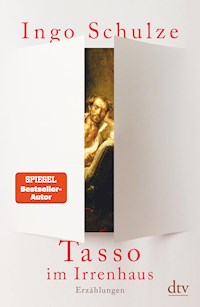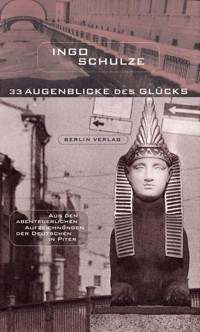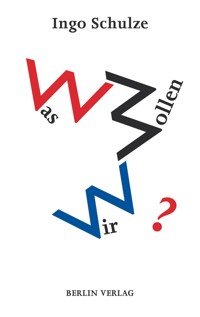
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ist Ingo Schulze ein so großartiger Erzähler? Weil seine Texte offenbaren, wie präzis er, was er sieht, in Sprache zu fassen vermag. Als Beobachter der Gesellschaft, in der wir leben, tritt uns Ingo Schulze in den vorliegenden Reden und Essays entgegen, die sein politisches Engagement zeigen - mit dem machtvollen Mittel der Sprache. »Mein Problem war und ist nicht das Verschwinden des Ostens, sondern das Verschwinden des Westens, eines Westens mit menschlichem Antlitz. Spätestens seit 1989/90 befindet sich die Politik auf dem Rückzug. Sie gibt von sich aus die Kompetenz ab und ebnet einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche, einem Exzess-Kapitalismus, den Weg. Die Politik versteht sich als Management, die Bürger werden auf Konsumenten reduziert, und der beste Bürger ist folglich der Playboy, weil er in möglichst kurzer Zeit möglichst viel ausgibt.« Für Ingo Schulze beginnt Widerstand mit Wahrnehmung. Seine Essays, Reden und Wortmeldungen zu Literatur und Gesellschaft sprechen eine Sprache, die die Welt als veränderbar zeigt. Und sie erinnern uns an eine schon fast vergessene Frage: »Was wollen wir?«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ingo Schulze
Was wollen wir?
Essays, Reden, Skizzen
Berlin Verlag
TEIL I
DAMALS IN DER PROVINZ
Wir waren von der Autobahn abgefahren, näherten uns auf Landstraßen von Norden her Berlin und suchten nach einem Lokal fürs Mittagessen. Ich hielt mich an die Verkehrsordnung und genoss die Landschaft mit ihren Alleebäumen, Buchenwäldern, Seen und abgeernteten Feldern. Fast zehn Jahre war ich nicht mehr hier gewesen und voller Erwartung, ohne zu wissen, worauf, nahezu heiter aus unerklärlicher Vorfreude – bis meine Beifahrerin am Ortsschild von S. sagte: »Früher waren solche Städtchen viel interessanter. Da hast du immer was gefunden.«
»Was gefunden?«
»Na, Bücher.«
Plötzlich war ich im selben Maß ernüchtert, wie ich eben noch voller Aufregung gewesen war.
Etwas Ähnliches hatte ich ein paar Monate zuvor erlebt. Auf dem Weg zu Freunden, deren Wohnung mir während des Studiums ein zweites Zuhause gewesen war, sah ich beim Näherkommen, dass im Erdgeschoss die Scheiben kaputt waren, Unkraut überwucherte den Weg zur verschlossenen Haustür … Sie waren längst umgezogen, ich hatte sie sogar schon in ihrer neuen Wohnung besucht. Trotzdem sah ich sie in meiner Vorstellung noch immer in den alten Räumen.
In der DDR waren die Buchläden in den Kleinstädten und größeren Dörfern die eigentlichen Schatzkisten – je kleiner das Nest, desto besser. Oft genügte schon ein Schreibwarenladen, um Auto- oder Fahrradfahrten zu unterbrechen. Sah man im Schaufenster einen bislang ungehobenen Schatz, wartete man auch gern das Ende der Mittagspause ab oder meditierte vor dem Schild »Komme gleich wieder«. Waren wir zwei oder mehr Interessenten, konnte es Streit geben. Wer hatte es zuerst gesehen? Wem war beim letzten Mal der Vortritt gelassen worden? Was in Dresden oder Leipzig gar nicht erst in der Auslage erschien oder noch am selben Tag ausverkauft war, dämmerte in kleineren Orten oft einige Tage, mitunter unfassbare Wochen lang unentdeckt vor sich hin. In der Provinz geschahen die Wunder.
Plötzlich konnte man vor einem grauen Buch mit der weißen Aufschrift Dubliner stehen. Oder ein dunkelvioletter Band der Insel-Bücherei – überhaupt: Inselbücher! – hypnotisierte den Blick: Nadja. Auf einem schwarzen Band der Spektrum-Reihe fügten sich die Buchstaben zu Sensationen zusammen wie: Malamud, Frisch, Pynchon, oder ein Reclam-Band warb in aller Schönheit mit Namen wie Singer, Camus, Onetti, Schmidt. Oder diese unvergleichlichen weißen Lyrik-Bände, eingeschlagen in Pergaminpapier: Tarkowski, Ungaretti, Pavese, Pasternak, Enzensberger, Auden, Pound, Celan, Benn, Stevens … Jedes Kaff konnte das Leben verändern.
Woher man die Namen kannte? Man wusste sie halt – von Freunden, aus Nachworten, man stieß den anderen mit dem Ellbogen an: Da liegt noch ein Exemplar, willst du das denn nicht? – Oh! Danke! Natürlich! Wer ist das?
Geradezu verstörend war es, wenn man, nach mehrfachen Bestellungen und Nachfragen oder schmerzlichen Tauschgeschäften, etwas erkämpft hatte und nun zum zweiten Mal Gelegenheit erhielt, den neuen Fühmann oder Braun, die Kassandra oder Horns Ende zu erwerben. Geschah das öfters, entstanden Zweifel an der Wichtigkeit des Buches, also an seiner Sprengkraft. In aller Regel kaufte man es trotzdem – und verschenkte oder verkaufte es weiter.
Bei Reclam-Büchern griff man auf Verdacht zu, vor allem dann, wenn der Autor nicht aus dem Osten kam. Die eine Mark fünfzig oder drei Mark hatte man meist. Bei Büchern der Spektrum-Reihe sowieso, schon wegen der Fotomontage auf dem Einband. Deshalb entdecke ich bis heute meinen Bücherschrank: Ach, das ist der Carver, der Heaney, der Donald Barthelme.
Was nicht »aktuell« oder lizenzpflichtig war, gab es mehr oder minder ausreichend und konnte gelassener betrachtet werden. Aber auch bei Dostojewski oder E. T. A. Hoffmann, bei Novalis oder Jean Paul war man gut beraten, sofort zuzugreifen. Die eigentlichen Probleme entstanden mit dem 20. Jahrhundert, und das begann bei Baudelaire und Rimbaud. Trotz aufwendiger Suche gelang es mir nie, die sieben Bände Proust aufzutreiben.
Mitunter zögerte man zu lange, glaubte, die drei Bände von Alexander Block würden sich noch eine Weile halten. Manches, wie die Memoiren von Ehrenburg, Nerudas Canto General kaufte ich nur auf Drängen einer Buchhändlerin, auch Babels Reiterarmee – sollte ich freiwillig Propaganda lesen?
Mein Lateinlehrer, ein Brecht-Experte, beklagte sich einmal vor der Klasse – er warf es uns regelrecht vor –, dass die Bücher Platonows in den Buchläden herumstünden. Mit der flachen Hand schlug er sich gegen die Stirn und rief: »So was will mir einfach nicht in den Kopf! Platonow!«
Beschreibe ich hier ein fragwürdiges, ein schäbiges Glück? Weil es dem Geist der Restriktion und des Mangels entspringt? Weil es wichtige Autoren gab, von denen nichts erschien, von anderen oft nicht mehr als ein Splitter ihres Werkes?
Heute hat sich die Literatur aus dem flachen Land zurückgezogen in die urbanen Oasen – und Antiquariate. Außerhalb davon existiert sie nur virtuell, im Computer, so exterritorial wie die Tankstellen.
Ja, tanken mussten wir auch, zu Mittag aßen wir im »Aalhof« und zwei Kilometer weiter hielten wir zum dritten Mal: an einem Antiquitätenladen.
Nachdem ich unter Aufsicht der Verkäuferin das Zimmer mit Militaria besichtigt hatte, stieß ich vor einem Glasschrank mit Zigarrenbilderalben gegen einen Chiquita-Bananen-Karton, in dem Taschenbücher standen – Reclam-Leipzig-Ausgaben –, jeder Band fünfzig Pfennig: Sarah Kirsch, Musik auf dem Wasser, Pavese, Bobrowski, Musil, Mandelstam, Rilke.
Lächelnd kam meine Beifahrerin zu mir herüber. Mit beiden Armen hielt sie eine riesige Steingutschüssel umschlungen, in der eine filigrane Briefwaage stand. Sie versuchte, die Namen auf den Büchern, die ich gegen meinen Bauch drückte, zu erkennen. »Warum kaufst du das denn?« Keine Frage hätte mich mehr überraschen können.
Ich besaß alle diese Bücher, brauchte dringend jeden Regalzentimeter; zum Verschenken waren sie zu vergilbt, exotisch kostbar erschienen sie nicht mal mir. Bin ich nostalgisch oder einfach falsch konditioniert?
»Findest du nicht, dass sie unglaublich preiswert sind?«, fragte ich und legte die Bücher zurück in den Karton. Sie zuckte mit den Schultern, und ich klopfte mir den Staub vom Hemd.
(1999)
WÄHLE EINE BENENNUNG
In Vercors’ Les animaux dénaturés von 1952 (dt. Das Geheimnis der Tropis) entdecken Anthropologen in Neuguinea Geschöpfe, von denen sie nicht wissen: Sind sie noch Tiere oder bereits Menschen? Ein Unternehmer sieht in den Tropis billigste Arbeitskräfte für die australische Textilindustrie, kauft die Rechte an jenem Landstrich samt Flora und Fauna und erklärt die Tropis zu Tieren. Das ruft die britische Textilindustrie auf den Plan. Der Journalist Templemore, Held des Romans, lässt eine weibliche Tropi mit seinem Samen befruchten. Sie gebiert in England ein Geschöpf, das Templemore, nachdem er es hat taufen und amtlich registrieren lassen, umbringt. Danach ruft Templemore die Polizei, er fordert Strafverfolgung und Prozess. Hat er ein Tier getötet oder seinen Sohn ermordet? Staatsanwaltschaft und Verteidigung laden wissenschaftliche Koryphäen vor. Die Geschworenen sind ratlos, weil ihnen niemand eine verbindliche Definition des Menschen geben kann. Deshalb sehen sie sich außerstande, ein Urteil zu fällen. Da jedem neuen Prozess ein ähnlicher Ausgang droht, beauftragt das britische Parlament eine Kommission, die eine juristische Definition des Menschen erarbeiten soll. Die Begründung, mit der die Tropis schließlich zu Menschen erklärt werden, fällt höchst fadenscheinig aus: Man deutet die Tatsache, dass sie Fleisch räuchern, als eine Art Fetisch-Handlung. Die britische Textilwirtschaft atmet auf.
Aus dieser fabelartigen Geschichte erfährt man, wie Benennungen entstehen und wie Benennungen unser Verhältnis zum anderen definieren. Vielleicht musste ich deshalb an Vercors’ Tropis denken, als ich vergeblich versuchte, eine Sprachglosse zu schreiben.
(2007)
VORSTELLUNG IN DERDARMSTÄDTER AKADEMIE
Meine sehr verehrten Damen und Herren,dieses Vor-Sie-Hintreten lässt sich weder mit irgendeiner bisherigen Prüfung noch mit einem anderen Auftritt vergleichen. Es hat seine Entsprechung am ehesten in den Träumen eines Jungen von dreizehn oder vierzehn Jahren, der sich möglichst schnell einen Namen machen wollte, weil er glaubte, dass dann vieles einfacher würde, zum Beispiel berühmte und interessante Leute kennenzulernen.
Ich glaube nicht, dass solche Vorstellungen spezifisch sind für jemanden, der 1962 in Dresden geboren wurde. Aber sicher hatten Zeit und Ort ihre eigenen, diesen Wunsch begünstigenden Faktoren: Die so kunstsinnige wie selbstverliebte Stadt, das Hochhalten des Bürgerlichen samt vergleichsweise hierarchischen Umgangsformen und die heute kaum noch vorstellbare Aufmerksamkeit, die jedem Wort zuteilwurde.
Meine Mutter, alleinerziehend, von Nachtdiensten geplagt, aber ihren Beruf liebend, hatte den größten Einfluss auf mich. Vor allem Frauen hatten Anteil an der Erziehung meiner Gefühle. Den Umgang mit Männern, die mir als Lehrer, Trainer oder gefürchtete Väter von Klassenkameraden entgegentraten, musste ich erst erlernen.
Schon im Kindergarten hatte ich Angst vor der Armee und schöpfte Trost aus der Bemerkung einer Nachbarin, vielleicht wäre ja alles ganz anders, wenn ich achtzehn sein würde. Aber darauf zu hoffen, gab ich bald auf.
Aus Faulheit habe ich erst spät begonnen zu lesen. Zu Hause wurde jedoch viel erzählt und vorgelesen. Vergeblich bemühte ich mich, meinem Leben dieselbe Intensität zu verleihen, wie ich sie aus mündlichen und schriftlichen Geschichten kannte.
1981 legte ich an der Kreuzschule in Dresden das Abitur ab und wurde von November 1981 bis April 1983 Soldat der NVA in Oranienburg. Das Kriegsrecht in Polen und die Haltung der DDR dazu ließ die als Schüler gestellte Frage, ob man den Wehrdienst verweigern sollte oder nicht, plötzlich ungeahnt folgenreich erscheinen. Während der Armeezeit schrieb ich erste Erzählungen.
In Jena studierte ich Latein und Altgriechisch, dazu ein bisschen Germanistik und Kunstgeschichte. Ich hatte Glück mit einigen Hochschullehrern, die zu Freunden wurden. In Gesprächen außerhalb der Universität lernte ich vieles von dem, was noch meine heutige Sichtweise prägt.
Nach Altenburg kam ich 1988 als Schauspieldramaturg. Das Theater, zumindest jenes, das ich kennenlernte, war bestimmt von Autonomie im Alltag und einem ungewöhnlichen politischen Freiraum.
Der Herbst 89 war auch für mein Leben ein Umbruch. Doch der eigentliche Weltenwechsel stand mir noch bevor. Eben noch fast ein Berufsrevolutionär, wurde ich aus derselben Intention heraus zum Mitbegründer einer Zeitung. Die Währungsunion schien alle Worte überflüssig gemacht zu haben. Offenbar konnte man alles tun und lassen, wenn es sich nur rechnete. Ich hatte den Eindruck, als politischer Mensch nicht mehr gebraucht zu werden. Dieses Gefühl korrespondierte mit meinem erstmaligen Interesse an Geld. Aus dem Journalisten wurde ein Anzeigenblattverleger.
In dieser Eigenschaft entsandte mich ein Geschäftsmann Anfang 1993 nach St. Petersburg, damit ich dort das erste kostenlose Anzeigenblatt aufbaute.
Sehr vereinfacht gesagt, hat mich St. Petersburg zum Schriftsteller gemacht. Dort begriff ich, dass ich nicht weiter nach meiner eigenen unverwechselbaren Stimme suchen musste, sondern dass es angemessener ist, sich der Welt nach dem Resonanzprinzip zu nähern. Die Forderung Alfred Döblins, den Stil immer aus dem Stoff kommen zu lassen, wurde für mich maßgebend.
Über Literatur spreche ich lieber aus der Sicht des Lesers. Denn als Leser kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass ich Literatur brauche, weil sie mich mit meinen Erfahrungen nicht allein lässt, weil sie diese an Menschheitserfahrungen misst.
Seit 1993 lebe ich in Berlin, ich bin verheiratet, wir haben zwei Töchter.
Ich erhoffe mir von der Akademie, die als Idee ja älter ist als die meisten Religionen, einen Ort des freundschaftlichen Disputs und der Verständigung. Wenn ich die Akademie auch als eine eminent politische Einrichtung auffasse, dann deshalb, weil sie eine vergleichsweise unabhängige Institution ist und weil ich keinen anderen Ort wüsste, der geeigneter wäre, wieder grundsätzliche Fragen zu stellen. Mein Problem ist nicht das Verschwinden des Ostens, sondern das Verschwinden des Westens unter der Lawine einer selbstverschuldeten Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die Begriffe wie Freiheit und Demokratie zunehmend zum Popanz macht.
Ich kenne die Gepflogenheiten dieser Akademie noch nicht, ich freue mich aber und danke Ihnen, dass Sie mich hierhergerufen haben.
(2007)
TAUSEND GESCHICHTEN SIND NICHT GENUG
Leipziger Poetikvorlesung 2007
Den Versuch, eine Poetikvorlesung zu halten, unternehme ich gegen verschiedene Widerstände. Zum einen hat künstlerische Nabelschau immer etwas Prätentiöses. Zum anderen enthält mein Roman Neue Leben bereits eine Art Poetik. Das trifft natürlich auf viele Bücher zu, denn die Auseinandersetzung mit dem eigenen Medium ist in meinen Augen ein entscheidendes Kriterium für Kunst überhaupt, doch ist in Neue Leben von einem die Rede, der Schriftsteller werden möchte und dessen Lebensstationen die meinen sind. Es ist nicht meine Geschichte, ich halte aber seine Geschichte für interessanter und aussagekräftiger. Und natürlich ist Literatur immer komplexer als das Reden über Literatur.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit diesem Beginn durch die Aufnahmeprüfung jeder Rhetorikschule fallen würde, denn statt Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, neugierig zu machen, zu fesseln und womöglich sogar durch eine Anekdote zum Lachen zu bringen, stoße ich Sie vor den Kopf, als wollte ich Ihnen zu verstehen geben, dass Sie sich für den Abend des Reformationstages wirklich etwas Besseres hätten vornehmen können.
Ich habe die Aufgabe aber nicht nur übernommen wegen der Ehre, hier vortragen zu dürfen, sondern weil ich in dieser Einladung auch die Möglichkeit sah, im Zusammenhang über meine bisherigen Bücher zu sprechen.
Indem ich versuche, meiner Schreiber-Biographie nachzugehen und etwas über das Werden der Bücher zu sagen, hoffe ich, mich den Orten und Zeiten zu nähern, in denen sie entstanden sind. Und vielleicht gelingt es dadurch, die Veränderungen meiner Sichtweise offenzulegen. Denn jede neue Erfahrung verändert den Blick auf die Vergangenheit und damit unser Bild von ihr.
Wenn im Folgenden von Schwierigkeiten die Rede ist, dann deshalb, weil sich gerade an jenen Stellen, an denen man nicht weiterweiß, die Fragen kristallisieren, die einen beim Schreiben umtreiben, und so noch am ehesten etwas über das Spezifische dieser Arbeit gesagt werden kann.
Mein Blickpunkt ist der eines Fünfundvierzigjährigen, der, in Dresden geboren, das Glück hat, seit dem Erscheinen seines ersten Buches 1995 von der Schreiberei gut leben zu können.
Oberflächlich betrachtet, bin ich das geworden, was ich als Dreizehnjähriger werden wollte, nämlich Schriftsteller. Gemessen an meiner damaligen Vorstellung, wurde ich es zu spät. Gravierender ist, dass meine heutige Existenz vor allem in puncto Heldenhaftigkeit in keiner Weise meinen damaligen Phantasien entspricht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!