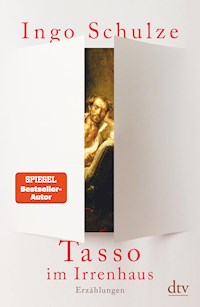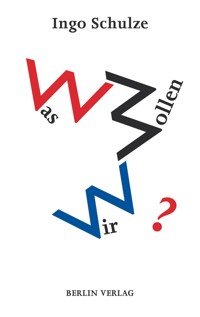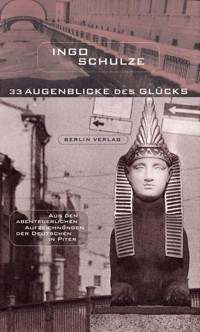Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit über dreißig Jahren betrachtet der Westen den Osten. Als Gast im Westen beschreibt Ingo Schulze, dass die Wirklichkeit immer jener Ort ist, der jenseits der Erwartung liegt. Ein halbes Jahr verbrachte Ingo Schulze von Oktober 2022 bis März 2023 im Ruhrgebiet als "Gast im Westen". Was ihn interessierte? »Einen Plan hatte ich nicht. Und erst allmählich begann ich meine "Methode‹ zu erkennen: Wenn mich jemand einlud, bin ich hingegangen. Es gibt wohl kaum ein unsystematischeres Vorgehen. Aber jeder Plan wäre mir nicht weniger willkürlich erschienen." So entstanden ganz unterschiedliche Betrachtungen, Porträts, Reportagen - eine Grundschule, in der die Musik die Rolle der Sprache übernimmt, weil zu wenige Kinder Deutsch sprechen; ein Stadionbesuch mit einem Polizeipräsidenten a. D., der nicht mehr das Wort "Clankriminalität" aussprechen wollte, es aber musste; ein Konzert im Alfried Krupp Saal der Essener Philharmonie führt zur Geschichte der Firma Krupp, zu den längsten Arbeitskämpfen der BRD und zu Europas größtem Binnenhafen; die Ruhe eines Kriegsgräberfriedhofs erscheint nicht mehr selbstverständlich; der Slapstick einer Theateraufführung setzt sich in der Wirklichkeit fort - über allem wabert ein Duft von Döner und Gyros und im Ohr hallen die Gesänge der Fußballfans nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingo Schulze
Zu Gast im Westen
Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet
Wallstein Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abruf bar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2024
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag
ISBN (Print) 978-3-8353-5583-5
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8654-9
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8655-6
Inhalt
Vorbemerkung
Prolog: Neu in Mülheim-Broich
Was du ererbt von deinen Vätern ...Krupp, Rheinhausen, Logport, Ruhrort und zurück
Auch das Publikum sitzt auf einer BühneBetrachtungen eines musikalischen Dilettanten
»Als ich meinen DDR-Ausweis vorzeigte, wurde ihr Ton schärfer.«Die Flucht des Michael Baumeyer aus Lützen in den Westen
»Ich kann ein Kind nicht lernend machen«Über eine begehrte Schule, die es gar nicht mehr geben sollte
Treu bis in den TodAuf dem Kriegsgräberfriedhof von Mülheim-Broich
»Dann kann ich ja Tauben füttern gehen ...«Gespräche mit einem Polizeipräsidenten a. D.
»Für die Fans ist das ihr Leben, es muss auch unser Leben sein.«Stadionbesuche bei Borussia Dortmund
Paul Lindemann und die Erzählung eines glücklichen LebensGelsenkirchen I
Schwierigkeiten mit den RuhrpottjungsWo Arbeiter noch Helden sind?
»Wir waren scheiße reich«Gelsenkirchen II
Mülheim-Styrum und der Farbpunkt des Egoisten FatzerEine Theateraufführung und ihre Folgen
Woraus das Ruhrgebiet gemacht istEine Buchhandlung, die Ruhr, die Emscher, die Dichtung und die Kohle
Jugenderinnerungen eines älteren StadtschreibersWilhelm von Kügelgen in Kettwig an der Ruhr
Persönlichkeitsspaltung in Erwartung einer RadiosendungStudio 9 ab 12.05 Uhr am Schreibtisch
Unter dem Staub die Literatur und der ProtestDie Buchhandlung »Weltbühne« in Duisburg-Neudorf
»Die Bevölkerung ist mein Chef«Marco Bülow, die SPD in Dortmund und der Kampf im »Lobbyland«
Die tagtäglichen Wunder von Duisburg-MarxlohUnterricht in einer Gemeinschaftsgrundschule
Epilog
Dank
Vorbemerkung
Für die sechs Monate, die ich von Oktober 2022 bis März 2023 auf Einladung der Brost-Stiftung im Ruhrgebiet verbracht habe, verfügte ich über kein konkretes Vorhaben, das heißt, ich wollte von morgens bis mittags an meinem Roman arbeiten und mir nachmittags das Ruhrgebiet ansehen, um dann, wenn ich etwas Mitteilenswertes gesehen oder erlebt hätte, darüber zu schreiben. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf mich selbst hereinfalle. Als würde ich mich nicht kennen und zudem glauben, ein halbes Jahr aus meinem Leben aussteigen zu können, indem ich einfach die Wohnung wechsele. Keine Zeile habe ich an meinem Roman geschrieben, obwohl ich einen Koffer voller Bücher nach Mülheim transportiert hatte in dem Glauben, sie alle für die Arbeit zu brauchen. Wie einen Wall hatte ich sie auf meinem Schreibtisch aufgebaut – und mich dann an das Muster gewöhnt, das die aufgereihten Buchrücken ergaben.
Meine Hoffnung war es gewesen, durch den räumlichen Abstand von Berlin meinen Alltag zu beruhigen. Allein in meiner temporären Bleibe in Mülheim hörte und las ich erst recht die neuesten Nachrichten vom Ukraine-Krieg, was unfreiwillig mein Denken und Fühlen, meine Selbstgespräche noch mehr als die Gespräche okkupierte. Und zugleich wundere ich mich jetzt, wie viele Begegnungen sich in diesen ersten Wochen im Ruhrgebiet ergaben, ja dass sich in dieser Zeit sogar Freundschaften anbahnten.
Wie gesagt, einen Plan, was und worüber ich schreiben sollte, hatte ich nicht. Und erst allmählich begann ich, meine ›Methode‹ zu erkennen: Wenn mich jemand einlud, bin ich hingegangen. Es gibt wohl kaum ein unsystematischeres Vorgehen. Aber jeder Plan wäre mir nicht weniger willkürlich erschienen. Dafür bescherte mir jede Einladung sofort einen persönlichen Bezug, und immer verbanden sich damit Anregungen. Über manche Begegnung, die mir bis heute eindrücklich vor Augen steht, über manchen Ausflug, den ich unbedingt festhalten wollte, habe ich nicht geschrieben.
Seit 1995, seit meinem ersten Buch, bin ich regelmäßig zu Lesungen im Ruhrgebiet gewesen. Deshalb wusste ich vage, welche Mentalität mich erwartete, eine, die es mir leicht machen würde, ins Gespräch zu kommen. Aber im Westen gelebt hatte ich zuvor noch nie.
Im Falle des Ruhrgebiets ist der Westen eine Selbstbeschreibung und eine Himmelsrichtung. Und zugleich bedeutet Westen im Gegensatzpaar Ost / West eine Hemisphäre, die für jene, die nicht in ihr aufgewachsen sind und sich ihr daher mit anderen Voraussetzungen von außen her nähern, mitunter nicht selbstverständlich ist. Insofern fühlte ich mich im doppelten Sinne als Gast im Westen.
Gerade anfangs fiel mir auf, dass ich, sobald ich nach meinen Eindrücken im Ruhrgebiet gefragt wurde, vom Osten zu erzählen begann, als hätte ich die Frage missverstanden. Ich versuchte, mich über den Vergleich, über die verschiedenen Selbstverständlichkeiten dem Ruhrgebiet zu nähern, was mir zumindest Einstiege und Anknüpfungspunkte bot, aber auch eine gewisse Vergleichbarkeit voraussetzt, sei es die Bedeutung der Kohleförderung, der Schwerindustrie oder die Rolle der Arbeiter und »Malocher«.
Im Gegensatz zu einer Erzählung oder einem Roman besteht bei Aufzeichnungen aus der realen Welt die Gefahr, dass die Darstellung als Vertrauensbruch oder gar Preisgabe aufgefasst werden kann. Denn während unserer Gespräche haben wohl die wenigsten einen Gedanken daran verschwendet, das Gesagte einmal von mir kommentiert veröffentlicht zu finden. Andererseits erschien mir manches Detail und manches Zitat als so aufschlussreich, dass ich ungern darauf verzichten wollte. Ich hoffe, dass diese Balance einigermaßen gelungen ist. Denjenigen, die namentlich erscheinen, habe ich den sie betreffenden Text zur Korrektur vorgelegt.
Die folgenden Aufzeichnungen, die im Laufe dieses Jahres in Mülheim und Berlin entstanden sind, lassen sich auch wie Eintragungen in ein Gästebuch lesen, Eintragungen, denen unbedingt mein Dank vorangestellt sein soll an all jene, die mich eingeladen haben und damit dieses Buch überhaupt erst ermöglichten.
Mülheim / Berlin, im Oktober 2023
Prolog: Neu in Mülheim-Broich
Sonnenschein, Herbstlaub, Ende Oktober ist es hier noch einmal so warm geworden wie sonst nur in südlichen Gefilden. Lange werden die Farben nicht mehr da sein. Ich mache mich auf die Suche nach einem Supermarkt in der Nähe. »Haben Sie denn kein Auto? Auch kein Fahrrad?« Meine Nachbarn, mit denen ich von Garten zu Garten spreche, sind überrascht und bieten mir Hilfe an.
Was ich Garten nenne, ist in meinem Fall von der Anmutung her ein Park im Bonsai-Format mit Brückchen und Schalen und einer Bank, es fehlen eigentlich nur Goldfische. Stattdessen steht ein riesiger Buddha auf dem Weg und lächelt durch mich hindurch. Eine stattliche Doppelhaushälfte steht mir vom Keller bis unters Dach zur Verfügung.
Die Einfamilienhäuser des Broicher Waldwegs, an denen entlang ich der abfallenden Straße folge, ließen sich als »schmuck« bezeichnen, alles tipptopp. Neben alten Straßennamen (Brandenberg, Liehberg) lauten die neuen Uranusbogen oder Jupiterweg, es gibt eine Ferienwohnung namens »Saturn«. Ein Mehrfamilienhaus ist im Bau, davor steht ein alter roter Rolls-Royce, der erst beim näheren Hinsehen auffällt, weil seine Karosse nicht wie die der anderen Wagen glänzt. Es folgen ein paar dörflich anmutende Häuser, bevor sich der Weg zu einer Grünfläche öffnet, die vielleicht einmal der Dorfanger gewesen ist. Am Ende quert eine große Straße, deren Namen, Saarner Straße, ich mir einprägen will. Jenseits davon ein breiter Häuserriegel von acht oder neun Stockwerken, darunter eine Tankstelle, Busstationen auf beiden Straßenseiten, eine Apotheke an der Ecke. Der »Lindenhof« nimmt sich zwischen den anderen Häusern aus wie eine Ansichtskarte, deren Farben schon leicht verblichen sind.
Der Supermarkt, so bin ich überzeugt, kann nicht mehr weit sein. Als ich einen Mann meines Alters danach frage, antwortet er grimmig und ohne aufzusehen: »Fahr ich jetzt nach Herne wegen dem Scharnier?!« Er telefoniert. Ich entschuldige mich gestenreich und will mich abwenden, da sieht er auf und weist, seinen freien Arm heftig schwenkend, als sollte ich mich beeilen, weiter in Richtung meines bisherigen Weges. Obwohl keine Autos zu sehen sind, warte ich an der Ampel das Grün ab, denn als Neuling will ich hier nicht unangenehm auffallen.
Woher kommt meine Vorsicht, ja Beklommenheit? Als wäre ich eben erst an meinem Studienort angekommen, der nun für fünf Jahre mein neues Zuhause und eine Lebensprüfung schlechthin werden soll. Oder wie die Ankunft an meiner ersten Arbeitsstelle, dem Theater in Altenburg. Fiel mir dort die Orientierung leichter?
Von Mülheim-Broich scheint die Entfernung nach Duisburg kaum weiter als die bis ins Mülheimer Zentrum. Und die beste Busverbindung geht nach Oberhausen. Supermärkte überall, nur nicht da, wo ich ab jetzt wohne.
Auf der Kirchstraße, die jenseits der Saarner Straße beginnt, werden die Häuser zu Wohnblocks, drei oder vier Etagen, die Nebenstraßen heißen Teutonenweg, Gotenstraße, Sachsenstraße, ich komme an einer Trinkhalle vorbei (eine etwas irreführende Bezeichnung für einen Kiosk, findet der Neuling), an einem Dönerladen, einem Imbiss und einem Bäcker. Ob ich wenigstens bei einem von ihnen öfter kaufen oder es gar zum Stammkunden bringen werde? Überhaupt, womit werde ich schnell vertraut sein? Womit nicht? Und plötzlich die lächerlich banale Frage, als hätte ich nicht ein Dreivierteljahr dafür Zeit gehabt: Was will ich hier eigentlich? Am Ende soll ich ein Buch abliefern und werde dafür gut bezahlt. Bin ich Greenhorn überhaupt der Richtige dafür? Und wenn mir nichts Gescheites einfällt?
Nach einer knappen halben Stunde komme ich endlich an eine Kreuzung mit Straßenbahnschienen, einer Sparkassenfiliale, einer zweiten Apotheke, sogar eine Post findet sich hinter der Ecke. Ich bin nicht nur am Ziel meiner Wünsche, also bei »Edeka Paschmann«, angekommen, sondern überhaupt am Mittelpunkt meiner neuen Welt, nämlich der »Broicher Mitte«.
Wann habe ich das letzte Mal allein für mich eingekauft? Erst beim Bestücken des Einkaufswagens begreife ich, dass ich derart bepackt keinesfalls zurücklaufen kann. Deshalb endet mein erster Einkaufsausflug leicht beschämt mit einer Taxifahrt.
Da es bei meiner Rückkehr schon fast dunkel ist und ich offenbar das Licht in der ersten Etage meiner Doppelhaushälfte angeschaltet hatte (es gibt so viele Lichtschalter, dass ich erst herausfinden muss, welcher tatsächlich funktioniert und welche Lampe dann angeht), sehe ich meinen Schreibtisch samt Bücherwall gut illuminiert. Von der Straße aus könnte also jeder beobachten, in was für einer Hose, in welchem Hemd oder Schlafanzug ich dasäße. Jede und jeder hier kann kontrollieren, ob ich schreibe, lese, telefoniere oder im Bürostuhl eingenickt bin – eine unangenehme Vorstellung. »Aber warum eigentlich?«, denke ich, als ich die Tür aufschließe. Wenn mir die Mülheimer schon nicht beim Schreiben über die Schulter schauen können, sollten sie wenigstens das Recht haben, ihren auf Zeit angestellten Stadtschreiber zu sehen.
Über die eigentliche Entdeckung der Umgebung zu berichten, ist für andere langweilig. Die kleinen und größeren Erkundungen, die sich unter der Rubrik »Ortskenntnis« zusammenfassen und abtun lassen, bedeuten allerdings für den Neuling Genugtuung, ja Erfolg, und stärken seine Versuche, in die Welt zu finden. Selbst eine gelungene Busfahrt bestätigt einen.
Ich kann an mir beobachten, wie sich Routinen ausbilden oder einfach nur Marotten, die schwer erklärbar sind. Es liegt nicht allein daran, dass ich lieber bergab als bergauf gehe. In die Stadt und zum Bahnhof fahre ich beispielsweise nach zehn Minuten Fußweg mit den Bussen 122 oder 124. Die Busfahrerinnen oder -fahrer haben es entweder immer eilig oder fahren mit Vorliebe schnell. Besonders mag ich die Schussfahrt, die nach der Haltestelle »Rosendahl« beginnt und hinab an die Ruhr führt. Es folgt noch eine letzte Ampel. Dann aber, so wie sich Skispringer vom Sitz am Gipfel der Schanze lösen, nimmt der Bus Fahrt auf. Ich stehe etwas breitbeinig da, die Arme angewinkelt, die Hände in die Schlaufen geschlungen, die von den unter der Decke verlaufenden Haltestangen herabhängen, als wäre ich bereit zu einem artistischen Kunststück. Ich sehe durch die Frontscheibe, links fliegt das Broicher Schloss vorbei, rechts ein Hotel, und stets bin ich mir sicher, dass wir diesmal die Brücke mit einem Satz nehmen werden. Und dann bin ich jedes Mal enttäuscht wie ein Zirkusartist, den man um seinen Auftritt gebracht hat, wenn der Bus fahrplanmäßig an der Haltestelle »Broicher Schloss«, kurz vor der Brücke, abbremst und sogar zum Stehen kommt.
Für die Rückfahrt jedoch führt mich der Weg vom Bahnhof hinab in die untere Etage zum Bahnsteig der Straßenbahn 102. »Uhlenhorst« lautet der Name der Endstation, »Dümpten« das andere Ende. Erst unweit der Broicher Mitte taucht die Bahn wieder ans Tages- oder Nachtlicht, sodass ich nicht nur nichts vom Mülheimer Zentrum, sondern auch nichts von der Ruhr, die unterquert wird, zu sehen bekomme. Immer wieder bin ich überrascht, an der Endhaltestelle der einzige Fahrgast zu sein. Nur ein Mal, an einem frühen Nachmittag, steigt auch eine Schülerin mit mir aus. Offenbar fährt hier niemand mehr Straßenbahn, obwohl eine Reihe von Häusern auf den Waldgrundstücken unmittelbar auf der anderen Straßenseite beginnt.
Das Erste, was mich in Mülheim und später auch andernorts überrascht, ist die Wohlhabenheit, ja der Reichtum, den es im Ruhrgebiet gibt. Je höher die Lage, desto größer und grüner, und ich möchte hinzufügen: desto unsichtbarer, werden die Häuser in den Grundstücken, ja die Grundstücke selbst. Richtig reich scheint es links vom Uhlenhorstweg zu sein, also südlich davon. Erst glaubt man, durch einen Wald zu gehen, bis man bemerkt, schon eine Weile entlang eines grün überwucherten Zauns zu spazieren. Als wären es Wildgehege, stößt man auf die Abgrenzung von Grundstücken. Aber auch nördlich des Uhlenhorstwegs reihen sich entlang der »Fuchsgrube« noch spektakuläre Häuser aneinander. Mit jedem weiteren Schritt, der dem allmählich in Richtung Ruhr abfallenden Hang folgt, wechselt es erst zu dem, was man gehobenen Mittelstand nennt, Ein- oder Zweifamilienhäuser, die schon entlang der Straße »Am Brandenberg« bescheidener werden, wo man auch ein Hochhaus eingepflanzt hat, aus dessen oberen Geschossen das halbe Ruhrgebiet zu sehen sein muss. Hält man sich südlich der Saarner Straße und geht einmal in östlicher Richtung nach Saarn, einmal in westlicher Richtung nach Speldorf, künden die Häuser ebenfalls von Wohlhabenheit. Die wenigsten davon, wenn vielleicht auch die schönsten und größten, stammen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Fällt mir das auf, weil ich Villenviertel im Osten fast nur als Bauten des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennengelernt habe? Wie würden sich die Wandlitzer Häuser der DDR-Staatsführung am Uhlenhorstweg oder der Fuchsgrube ausnehmen? Kärglich, nehme ich an. Aber die Häuser waren ja nicht das Problem.
Es gibt ein Gefälle zwischen dem Reichtum im Süden, der an der Ruhr regelrechte Idyllen wie Kettwig und Werden hervorbringt, und einigen im Norden gelegenen Stadtteilen des Ruhrpotts, wo sich zwischen sanierten und begrünten Zechensiedlungen auch verlassene oder verfallene Häuser finden.
Hinter diesem Kontrast liegt, wie ich bald erfahren werde, noch ein anderer Widerspruch, der sich zwar auch als der zwischen Arm und Reich beschreiben lässt, aber darin nicht aufgeht. Und es wird eine Weile dauern, bis ich auf jemanden treffe, der mir erklärt, was letztlich alle Einheimischen wissen: dass nach den Schließungen von Zechen und Stahlwerken zehntausende gut ausgebildete Arbeitskräfte und ihre Familien abgewandert sind. Zurück blieben sogenannte »Problemimmobilien«, die für die Städte und Gemeinden tatsächlich zum Problem wurden, weil niemand sie beziehen wollte. Die Häuser hätten saniert oder abgerissen werden müssen. Allmählich aber stellten sich doch neue Bewohner ein, die vor Armut, Obdachlosigkeit und Rassismus aus Südosteuropa geflohen waren oder durch Schlepper hierhergebracht und abgezockt wurden. Es braucht einige Zeit, bis ich überhaupt dieses neue Phänomen sehe. Und nochmals werden etliche Wochen vergehen, bis ich auf Menschen treffe, die über Ideen und Kenntnisse und einen langen Atem verfügen, ein städtisches Miteinander zu praktizieren, das niemanden ausschließt.
Als ich ein Fahrrad bekomme (sagt man immer noch »Damenrad«?), hängt wunschgemäß vor der Lenkstange ein Einkaufskorb. Nun kann ich zum Einkaufen fahren oder auf dem Weg in die Stadt die vom Bus abgebrochenen Schussfahrten – unter genauer Beobachtung der Ampelphasen! – mit einem Flug über die Schlossbrücke beenden.
Der Einkaufskorb lässt sich problemlos abnehmen und beinah problemlos wieder einsetzen, sodass ich schon beim Einkauf weiß, was bereits zu viel ist und in den Rucksack muss. Zur besonderen Kostbarkeit werden wegen ihres Gewichts Glasflaschen oder Marmeladengläser. Der Korb vor meiner Lenkstange zittert dann beharrlich bei der Fahrt über die Pflastersteine oder nickt ausladend bei jeder Kante. Irgendwann fällt mir beim Aufräumen die Montagebeschreibung des Korbs in die Hände. »Maximale Last: 7 kg!«, heißt es da. Ich bin gewarnt und will mich von nun an vorschriftsmäßig verhalten. Ich platziere den Einkaufsbeutel im Korb, der allerdings korrekt beladen besonders deutlich nickt. Jetzt, da ich mich offensichtlich richtig verhalte, springt mir beim Einbiegen in meine Straße (Kante zwischen Asphalt und Pflasterung!) der Korb aus der Fassung – reflexhaft erhasche ich den Einkaufsbeutel an den Henkeln und halte ihn kurioserweise in der Hand, während sich der leere Korb auf der Straße überschlägt.
Diese häufig von mir kolportierte Zirkusnummer, die sinnlos war, weil sich alles Zerbrechliche im Rucksack befand, führt zu dem Tipp, mal einen Lieferservice zu bestellen, eine Idee, auf die ich offensichtlich nicht selbst gekommen wäre. Mir wird die »Flaschenpost« empfohlen.
Wer vergleicht nicht gern seine Bücher mit einer »Flaschenpost«? Für einen Lieferservice allerdings ist das ein gewagter Name, aber der Witz gefällt mir. Ich bestelle also bei der »Flaschenpost« und merke, dass ich immer mehr und mehr bestelle in der Überzeugung, immer mehr zu sparen. Bei siebzig Euro habe ich genug gespart. Anderntags steht der Fahrer da, allerdings ohne die von mir nachbestellte Milch. Die Milch erhalte ich am folgenden Tag, sie wird mir mit beiden Händen überreicht wie eine Sektflasche.
Zudem rückt alle paar Wochen sturmklingelnd eine Apfelkooperative an. Ich bin sofort bereit zu kaufen – vor meinen Augen wird auf der blauen Schürzenbrust des Kooperative-Anführers ein Stück aus dem Apfel geschnitten und mir als Probe überreicht. Gern würde ich zwei Kilo von diesen wunderbaren Äpfeln nehmen, sage ich kauend und nicke anerkennend. Nein, so wenig verkaufen sie nicht. Also gut, drei Kilo! Nein, das Minimum sind zehn Kilogramm. Das nützt mir nichts, sage ich, ich bin allein … Der Kooperative-Anführer schickt einen Blick die Fassade hinauf zum Giebel, dann senkt er ihn, das gesamte Haus mit seinem Blick umfassend, langsam auf mich herab. »Allein?«, fragt er. Ich nicke. Sollte ich jetzt von meinem Amt als Stadtschreiber sprechen? Der Kooperative-Anführer steckt sich selbst einen Apfelschnitz in den Mund, einen weiteren reicht er mir, wortlos, bereits im Weggehen. Meinen Dank in Form einer ungewollt förmlichen Verbeugung sieht er schon nicht mehr.
Fast jeden Tag bin ich unterwegs. Wenn ich sagen müsste, was das Ruhrgebiet für mich bedeutet, dann würde ich antworten: Es sind die Bahnhöfe, die S- und Straßenbahnen, die Züge oder Busse. Es ist die Bewegung zwischen den Städten, deren Grenzen sich optisch für jemanden wie mich kaum ausmachen lassen. Selbst im Vergleich zu Berlin sind die Strecken hier nochmals länger, Zentrum und Peripherie wechseln einander beständig ab.
Und stets wabern auf den Bahnhöfen die Schwaden verschiedener Imbisse, vor allem der Dönerstände. So gut wie immer sitzt mir irgendein Fangesang im Ohr, denn die Spieltage der Bundesligen folgen dicht aufeinander, und mindestens einer der vielen Klubs im Revier hat immer ein Heimspiel.
Unterwegs werde ich selbst ein Teil jener Mischung von verschiedenen sozialen und nationalen Herkünften. Zweimal wird mir in der S-Bahn ein Platz angeboten, beide Male von Männern, deren Familien vielleicht aus Indien oder Pakistan ins Ruhrgebiet gekommen sind. Im Nachhinein bedauere ich es, auf ihre Freundlichkeit nicht eingegangen zu sein. Stattdessen habe ich so getan, als wäre ihr Angebot falsch adressiert und ich immer noch jugendlich.
Unterwegs verstehe ich am ehesten, dass im Ruhrgebiet die Integration von Zugewanderten eine lange Tradition hat, wohl eine der längsten in Deutschland. Um das zu begreifen, reicht tatsächlich schon eine kurze S-Bahnfahrt von Mülheim nach Essen oder Duisburg. Und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, empfinde ich Freude bei dem Gedanken, kein Tourist zu sein, sondern für einige Zeit dazuzugehören als Gast, der hier seiner Arbeit nachgeht.
Was du ererbt von deinen Vätern …
Krupp, Rheinhausen, Logport, Ruhrort und zurück
Offenbar hatte ich die Freikarte für das Konzert nur überflogen, sonst wäre mir der Name des Veranstaltungsortes sicher aufgefallen: Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal, Huyssenallee 53, 45128 Essen.
Die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner (in der Bearbeitung von Hans Werner Henze) stehen auf dem Programm, ich kannte sie bisher nur von der CD. Erst kurz vor Betreten des langgestreckten Saalbaus lese ich den Namen: Alfried Krupp Saal – und bin irritiert. Wie kann es sein, dass solch ein Saal nach Alfried Krupp benannt wurde? Statt mich ins Programmheft zu vertiefen, schalte ich mein Handy wieder an: Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, 1907 bis 1967, in Essen geboren und gestorben. Bereits 1931 war er förderndes Mitglied der SS geworden, 1938 dann Leiter der Rohstoff- und der Rüstungsabteilung von Krupp, 1943 Vorsitzender des Direktoriums der Friedrich Krupp AG. Im April 1945 wurde er von der US-Armee unter Arrest gestellt und später inhaftiert. Da sein Vater, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, als prozessunfähig eingestuft worden war und somit nicht wie geplant im ersten Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher angeklagt werden konnte, wurde Alfried Krupp in einem gesonderten Prozess 1947 zusammen mit elf leitenden Angestellten der Firma Krupp vor Gericht gestellt und 1948 wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern (»Sklavenarbeit«) und Plünderung von Wirtschaftsgütern im besetzten Ausland zu zwölf Jahren Haft verurteilt, sein gesamtes Vermögen wurde eingezogen. Anfang 1951 wurde er begnadigt und vorzeitig aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen. 1953 erhielt er sein gesamtes Vermögen zurück unter der Auflage, die Berg- und Hüttenbetriebe des Krupp-Konzerns bis 1959 zu verkaufen, was allerdings nicht geschah. Am Ende des Wikipedia-Eintrags steht ein Zitat von Alfried Krupp aus dem Jahr 1959. Die Daily Mail fragte ihn, ob er »irgendein Gefühl der Schuld« habe. Er antwortete: »Was für eine Schuld? Für das, was sich unter Hitler ereignet hat? Nein. Es ist jedoch bedauerlich, dass das deutsche Volk selbst zuließ, von Hitler so betrogen zu werden.«
Aufgeschreckt vom Applaus des Publikums kehre ich in die Gegenwart zurück, in den Alfried Krupp Saal. Erik Nielsen, der Dirigent des Abends, hat die Bühne betreten, setzt sich an den Flügel, spielt etwas aus Wagners Ouvertüre der »Meistersinger von Nürnberg«, erklärt, wie direkt sich Wagner dabei auf Johann Sebastian Bach bezieht, und erläutert anschließend die musikalischen Themen der »Rheinischen Sinfonie« von Robert Schumann. Zu den Wesendonck-Liedern sagt er wenig. Oder bekomme ich das nur nicht mit, weil ich mir eingestehen muss – beschenkt mit einer Freikarte –, zu einem schwer bestimmbaren Teil und vielfach vermittelt diesen Abend eben auch einer Entscheidung von Alfried Krupp und der von ihm gegründeten Stiftung zu verdanken? Mindert das meine Freude an der Musik?
Ich versuche, mich auf die Musik zu konzentrieren. Je bemühter ich bin, desto deutlicher stehen mir Sequenzen von Viscontis »Die Verdammten« (1969) vor Augen, ein Film, der die Familiengeschichte der Krupps umspielt, er ist kein Abbild, eine Alfried-Figur gibt es darin nicht. Der Film war mir, als ich ihn vor ein paar Wochen wieder gesehen hatte, unerwartet unter die Haut gegangen. Die Handlung hatte sich aus der Konfrontation der Charaktere mit dem Nationalsozialismus stringent, ja regelrecht mit Notwendigkeit entwickelt. Gegen Ende des Films steht allen Figuren erkennbar der Schweiß im Gesicht, obwohl es dafür aus dem Film heraus keine Notwendigkeit gibt. Es wirkte, als agierten sie alle bereits im Fegefeuer. Dann singt Bettina Ranch »Da stieg auch mir ein Engel nieder« – und plötzlich gibt es dann doch nur diese Musik.
Franziska, die jüngere Tochter, besucht mich Anfang Dezember in Mülheim. Am Tag nach Nikolaus, es regnet, fahren wir zur Villa Hügel. Den Namen umgibt ein Nimbus von Herrschaft und Macht. Gefragt, was uns dort erwarten würde, fällt meine Erklärung recht dünn aus: eine Art Schloss, eine riesige Fabrikantenvilla, der Stammsitz der Krupp-Dynastie. Ist das für sie ein Name wie jeder andere? »Sagt dir das was: ›Hart wie Kruppstahl‹?« Sie schüttelt den Kopf.
Viel Konkretes weiß ich nicht zu sagen, eher Allgemeines über die Kanonen und Kriegsschiffe von Krupp, über Zwangsarbeiter, Krupp als Synonym deutscher Stahl- und Rüstungsindustrie und die Verurteilung in Nürnberg.
Vom Essener Hauptbahnhof sind es nur ein paar Stationen mit der S 6 in Richtung Süden. Der eigens für die »Villa« gebaute Bahnhof heißt »Hügel« und wurde 1890 vom deutschen Kaiser eingeweiht. Wilhelm II. findet sich immer wieder an der Seite von Friedrich Alfred Krupp und seines Schwiegersohns Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, ob als Trauergast, Trauzeuge oder als Taufpate von Alfried Krupp.
Der kurze Aufstieg durch den menschenleeren Park mit seinen riesigen Bäumen und dem gepflegten Rasen, der Blick zurück auf die aufgestaute Ruhr, die hier zum Baldeneysee wird, die immer höher aufragende Fassade der Villa, die mit ihrem Großen und Kleinen Haus und der Galerie dazwischen natürlich ein Schloss ist, steigern die Neugier. Als wir die Rabatten vor der Villa erreichen, auf der Terrasse durch die Glastür hineinsehen und sich noch immer keine Menschenseele zeigt, fühlen wir uns wie Eindringlinge. Das ändert sich erst, als wir auf die der Ruhr abgewandte Seite der Villa gelangen. Vielleicht übertreibe ich, aber auch die höflichen Aufsichtskräfte, die in grau-schwarzen Uniformen stecken, wirken in ihrer Steifheit und Zurückhaltung, als müssten sie gleich wieder zur Herrschaft in den Salon zurückkehren. Die Empfangshalle ist riesig und mit den Porträts und Familienbildern der Krupps tapeziert. Wieder einmal bin ich unvorbereitet. Und diesmal habe ich keinen Baedeker dabei, aus dem ich (wie sonst üblich) vorlesen könnte. Dabei ist die Genealogie der Familie übersichtlich. Von Alfred Krupp bis zu seinem Urenkel Alfried umspannen vier Generationen rund hundertfünfzig Jahre. Mit den Eltern von Alfred und mit Arndt, dem einzigen Sohn von Alfried, sind es sechs Generationen. Auf den Gemälden erkennen wir zwar bald einige Gesichter wieder und könnten daran die Abfolge der Krupps studieren, aber als Bilder sind sie fad. Schwer vorstellbar, was es mit einem macht, wenn man in solchen Räumen leben muss.
Erik Reger, selbst einige Jahre Pressereferent und Bilanzprüfer bei Krupp, beschreibt die Villa in seinem großen Roman »Union der festen Hand« von 1931: »Die Villa baute er ungefähr nach den Vorstellungen, die ein Mensch, der nie betrunken war, von den Phantastereien eines Weinrausches hat. Sein werktägliches Leben verlief knapp, sachgemäß und zielvoll, darum glaubte er, daß die Kunst als Gegengewicht sonntäglich aufgeputzt und mit sinnlosem Zierrat überladen sein müsse. So hatte alles seine Ordnung bei ihm, und die Villa mit der seltsamen Mischung von falschem Klassizismus und scheinheroischem Barock war folgerichtig aus seinem Wesen und seiner Lebensweise heraus entwickelt.«
Die Bibliothek wird noch renoviert, das hundertfünfzigjährige Jubiläum der Einweihung steht kurz bevor. Wir steigen nach oben in den Festsaal, besichtigen ein paar Zimmer, eines mit dem furchteinflößend großen Schreibtisch. Auch hier scheinen sich die großzügigen Räume durch die Holzvertäfelung wie unter ein selbstverordnetes Joch zu beugen. Man krümmt sich eher mit, als dass man in diesem Saal aufatmet.
Am ehesten »spricht« zu mir noch die alte, elegante Ausstattung der Toiletten. Und der Blick in den Park. Alles andere wirkt brachial, ausstaffiert, lieblos, wie stellvertretend für das Eigentliche.
Die Kälte in den Gemälden scheint sich auf die Raumtemperatur zu übertragen. Bin ich hier im Herzen von Krupp? Sieht so das Innere von Macht aus? Mich beschleicht das enttäuschende Gefühl, durch diese Besichtigung dem Geist der Villa Hügel nicht näher zu kommen. Oder erkenne ich das Eigentliche nicht?
Bezogen auf die Fotografie zitiert Benjamin Brecht, dass »weniger denn je eine einfache ›Wiedergabe der Realität‹ etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie der Kruppwerke oder A. E. G. ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus.« (»Kleine Geschichte der Photographie«, Gesammelte Schriften, Band II.1, S. 383 f.)
Und dabei habe ich es mit echten Räumen zu tun. Aber die Wirkungsmacht verbirgt sich hinter dem Musealen. Es ist nur noch der abgelegte Panzer zu sehen, imposant, aber ohne den lebendigen Körper.
Interessant auch, dass Brecht als Erstes Krupp einfällt. Krupp war im Geschichtsunterricht bei uns der Inbegriff des Kapitalisten. Es gab die fünfteilige Fernsehserie »Krupp und Krause« von 1969, an die ich mich heute noch erinnere, wenn auch nur an wenige Episoden.
Hitler hat 1935 mit der berüchtigten Forderung, die deutsche Jugend solle »flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl« sein, den Mythos weiter aufgebläht, aber nicht erfunden. Hätte er nicht auch sagen können, hart wie »Thyssenstahl«? Thyssen hatte, vermittelt von Ludendorff, Hitler schon 1923 getroffen und sofort finanziell unterstützt.
Ich möchte, dass die Tochter mehr über Krupp erfährt. Außerdem werden wir morgen im Alfried Krupp Saal sitzen (ich zum zweiten Mal) und vorher im Folkwang-Museum gewesen sein, dessen Neubau die Krupp-Stiftung praktisch allein finanziert hat, ein Geschenk von 55 Millionen Euro an die Stadt Essen zum europäischen Kulturhauptstadtjahr 2010. Im Osten, an der Universität Greifswald (Berthold Beitz, der spätere Generalbevollmächtigte von Krupp, stammt aus dieser Region), gibt es ein »Alfried Krupp Wissenschaftskolleg«.
Im Kleinen Haus der Villa Hügel erhoffe ich mir die notwendigen Erkenntnisse durch die Ausstellung. Jedenfalls lerne ich hier anhand einer großen Tafel fürs Erste die Genealogie, die wir via Internet etwas anreichern.
Vom Gründerehepaar Friedrich Krupp (1787–1826) und Therese Wilhelmi (1790–1850) gibt es keine Bilder, nur Scherenschnitte, wenn es denn die von ihnen sind. Friedrich und Therese schafften es, in Essen eine Gussstahlfabrik errichten zu lassen.
Alfred Krupp (1812–1887) verlor mit vierzehn Jahren seinen Vater. Zusammen mit seiner Mutter gelang es ihm, die angeschlagene Krupp’sche Gussstahlfabrik wieder profitabel zu machen. Unter seiner Leitung wurde daraus in den folgenden Jahrzehnten das größte Industrieunternehmen jener Zeit. 1852 gelang Krupp die Erfindung der »nahtlosen Radreifen« – drei dieser miteinander verschmolzenen Ringe bilden bis heute das Firmensignet von Krupp –, die im expandierenden Eisenbahnwesen weltweit zum Standard wurden und Krupp enorme Einnahmen bescherten. Auch die Erfindungen und Verbesserungen bei der Produktion von Kanonenrohren aus Stahl machten ihn zu jenem sagenhaften »Kanonenkönig«. Da im Ausland noch mit Bronzekanonen geschossen wurde, bescherten Krupps Kanonen den Preußen im Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 wie im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 /1871 kriegsentscheidende Vorteile. Im Deutschen Krieg von 1866 zwischen Preußen und Österreich lieferte Alfred Krupp gleich an beide Parteien.
Am Tresen für die Eintrittskarten findet sich unter den Publikationen der Villa Hügel auch eine Broschüre, die sich dem Verhältnis von Alfred Krupp und Alexander von Humboldt widmet. Ich muss zwei Mal hinsehen: Was in meiner Vorstellung verschiedenen Epochen, unterschiedlichen geistigen Hemisphären angehört, hat sich doch berührt. Alexander von Humboldt starb, fast neunzigjährig, 1859, da war Krupp siebenundvierzig. Während für Krupp Humboldt schon jener berühmte Humboldt war, war für Humboldt Krupp ein aufstrebender Unternehmer, der sich bei ihm Empfehlungsschreiben für seine Pariser Unternehmungen erhoffte.
Alfred Krupp bekam es in Deutschland als einer der Ersten mit der sich formierenden Arbeiterbewegung zu tun, auf die er als Patriarch reagierte. Wer sich seinem strengen Reglement unterwarf, hatte Anspruch auf Sozialleistungen, wie sie vorher unbekannt waren: firmeneigene Siedlungen, günstige Baudarlehen, Altersversorgung, Krankengeld und anderes mehr. Die vor dem Hintergrund einer erstarkenden Sozialdemokratie geschaffenen und für ihre Zeit ungewöhnlichen Sozialgesetze unter Bismarck orientierten sich im Wesentlichen an dem »Krupp’schen Generalregulativ«.
Zwischen 1870 und 1873 ließ Alfred Krupp, der mit seiner Familie noch immer neben der Gussstahlfabrik in Essen wohnte, nach eigenen Vorstellungen und Entwürfen ein neues Anwesen bauen. Auf den ausgestellten Fotografien der Villa Hügel sieht die damalige Inneneinrichtung klarer, heller, moderner aus, da der Patriarch keine brennbaren Materialien für den Bau zuließ und so die spätere, alles überwuchernde Holzvertäfelung die Räume noch nicht verdunkelte. Hatte die Villa unter Alfred Krupp sechsundsechzig Angestellte, so waren es kurz vor dem Ersten Weltkrieg über sechshundert.
Das einzige Kind von Alfred und Bertha Krupp war Friedrich Alfred (1854–1902). Unternehmerisch kam er erst nach dem Tod seines Vaters 1887 wirklich zum Zuge und hatte seine Expansionspläne gegen einen Stab leitender Angestellter durchzusetzen. Er galt als kränklich und verbrachte mit seiner Mutter während der Kindheit und Jugend wohl mehr Zeit in Italien als in Essen. Seinen Wunsch, Ingenieurswissenschaften, insbesondere Metallurgie, zu studieren, konnte er sich nur gegen den Willen des Vaters und dies auch nur für wenige Monate erstreiten. Friedrich Alfred holte Wissenschaftler nach Essen, um die Qualität des Stahls durch Legierungen zu verbessern. Er kaufte etliche Zechen, erwarb unter anderem die Magdeburger Grusonwerke und die Germania-Werft in Kiel. Vor allem aber geht auf ihn die Gründung des bald größten Stahlwerks Europas in Rheinhausen zurück, das 1904, zwei Jahre nach seinem frühen Tod, in Friedrich-Alfred-Hütte umbenannt wurde.
Zu seiner Leidenschaft wurde der Golf von Neapel mit der Meeresforschungsstation (und deren wunderbaren Fresken von Hans von Mareés), vor allem aber Capri, wo er nicht nur eine spektakuläre Serpentinenstraße (Via Krupp) bauen ließ, sondern auch einer Geselligkeit frönte, die zum Anlass wurde, ihn homosexueller Ausschweifungen zu bezichtigen. Nachdem diese Vorwürfe auch in Deutschland im »Vorwärts« unter Nennung seines Namens erhoben worden waren, beging er im November 1902 Selbstmord, die offizielle Todesursache lautete: »Gehirnschlag«. Das gesamte Firmenimperium, umgewandelt in eine Aktiengesellschaft, erbte die ältere seiner beiden noch minderjährigen Töchter, Bertha (1886–1957).
Zwanzigjährig heiratete Bertha den Juristen und Diplomaten Gustav von Bohlen und Halbach (1870–1950) und erwirkte beim Kaiser die Erlaubnis, den Namen Krupp vor den Familiennamen setzen zu dürfen. Sie brachte acht Kinder zur Welt, von denen Arnold, das zweitälteste, nach einem Jahr verstarb. Das älteste war Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Man kann die Familie auf einem Gemälde von George Harcourt von Anfang der dreißiger Jahre betrachten. Warum Alfried weit entfernt vom Vater und der Mutter platziert wurde – und dies eher unsicher auf der Lehne eines Sessels –, während der nächstältere Sohn Claus, der 1940 als Pilot umkommen wird, geradezu demonstrativ als Einziger Mutter und Vater zugeordnet wird, weiß ich nicht.
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach wurde durch den Ersten Weltkrieg, die Ruhrbesetzung, die Inflation und schließlich die Weltwirtschaftskrise mit einem ständigen Auf und Ab des Konzerns konfrontiert. Offenbar beliebt, weil er sich für soziale Belange einsetzte – 1906 begann auch der Bau der Margarethenhöhe, neben Dresden-Hellerau die erste deutsche Gartenstadt und zugleich Werkssiedlung –, übernahm er 1909 den Aufsichtsratsvorsitz. Vor dem Januar 1933 wahrte er Distanz zu Hitler und spendete auch nicht für die NSDAP. Das änderte sich mit der Machtübernahme. Beim Treffen der Großindustriellen am 20. 2. 1933, bei dem Hitler drei Millionen Reichsmark für seinen Wahlkampf zugesagt wurden, gab Gustav Krupp als Erster eine Million. 1934 wurde Hitler in der Villa Hügel empfangen, ein Empfang, den Bertha Krupp 1933 noch hatte verhindern können. Doch die Krupp AG profitierte enorm von der Aufrüstung. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs steigerte sich die Nachfrage abermals. Zwischen 1940 und 1945 waren circa einhunderttausend Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge bei Krupp beschäftigt. Ende 1943 übernahm Alfried von Bohlen und Halbach die Geschäfte seines Vaters. Seine Mutter Bertha, die fast alle Aktien des Unternehmens besaß, hatte bei Hitler die als »Lex Krupp« bekannte Erlaubnis erwirkt, die Krupp AG wieder in eine Personengesellschaft umzuwandeln, die Firma Fried. Krupp, deren Alleininhaber ihr Sohn und später ein Nachkomme von ihm werden sollte. Nun erst durfte sich auch Alfried Krupp von Bohlen und Halbach nennen.
In der Ausstellung im Kleinen Haus findet sich das Dokument: »Erlass des Führers über das Familienunternehmen der Firma Fried. Krupp vom 12. November 1943«. Die Begründung, die dem Erlass vorangeht, fasst zusammen, was die Firma bedeutete: »Die Firma Fried. Krupp hat sich als Familienunternehmen in 132 Jahren überragende, in ihrer Art einzige Verdienste um die Wehrkraft des deutschen Volkes erworben. Es ist daher mein Wille, daß sie als Familienunternehmen erhalten bleibt.« Nebenbei ersparte dieser Erlass den Krupps 400 Millionen Reichsmark Erbschaftssteuer. (In meinen Notizen finde ich, leider ohne Quellenangabe, Vergleichswerte für dieselbe Zeit: In Großbritannien und den USA musste ein Alleinerbe 65 beziehungsweise 77 Prozent abtreten, selbst im konservativen Japan lag der Satz bei 60 Prozent. In Deutschland blieben es dagegen nur 15 Prozent. Krupp musste gar nichts zahlen.)
1937 heiratete Alfried Krupp Anneliese Lampert (1909–1998), Anfang 1938 wurde Arndt von Bohlen und Halbach geboren. Die Ehe wurde 1941 geschieden, 1952 heiratete Alfried ein zweites Mal, fünf Jahre später wurde auch diese Ehe wieder geschieden.
Arndt von Bohlen und Halbach ist auf etlichen der Fotografien zu sehen, meist gemeinsam mit seinem Vater – und fast immer zusammen mit Berthold Beitz. Der war bereits 1953, nur wenige Monate, nachdem Alfried Krupp die Geschäfte des Konzerns wieder übernommen hatte, zum Generalbevollmächtigten der Firma ernannt worden, was bedeutete, dass Berthold Beitz überall das letzte Wort hatte, sofern Alfried Krupp nicht widersprach – oder solange dessen Sohn Arndt nicht die Geschäfte übernommen hatte.
Als ich auf einer Fotografie in den Ausstellungsräumen der Villa Hügel Arndt von Bohlen und Halbach das erste Mal sehe, ohne etwas über ihn zu wissen, glaube ich, diesem jungen Mann sein Unglück, die Überforderung mit der Rolle des Alleinerben und Alleinlenkers der Firma Fried. Krupp, anzusehen. Er wirkt wie jemand, der die Sprache nicht versteht, die um ihn herum gesprochen wird, obwohl er kaum je eine andere gehört hat. Seine Homosexualität musste in dieser Zeit und erst recht in seiner Position verschwiegen werden, ein Geheimnis, um das alle wussten. Das Schicksal seines Urgroßvaters wird Arndt gegenwärtig gewesen sein.
Die Umwandlung der Firma Fried. Krupp in eine Stiftung (seit 1968) hatte in der offensichtlichen Nichteignung des Thronfolgers ihren Grund. Voraussetzung dafür war, dass Arndt für jährlich zwei Millionen D-Mark, für etliche Immobilien und teure Spielereien auf das Erbe verzichtete.
Fritz J. Raddatz ließ sich dazu hinreißen, Arndt als »fahle Made im weißen Seidenleinenanzug« zu bezeichnen. In dem Buch »Ihr da oben – wir da unten« von Bernt Engelmann und Günter Wallraff (1973) sagte der anonym bleibende Arbeiter Jürgen F.: »Wir kamen uns wie Leibeigene vor, die dem Nichtstuer Arndt sein ohnehin süßes Leben noch mit weiteren Millionen versüßten.«
Ich fotografiere mir ein paar Texte ab und ein paar Bilder, die ich nicht verstehe: »Berthold Beitz und Schah Reza Pahlewi 1974«, das Titelblatt von »Krupp, Zeitschrift der Kruppschen Betriebsgemeinschaft«: »Kruppsche Arbeiter umjubeln den Führer bei seinem Besuch auf der Gußstahlfabrik am 28. September 1935« (das Handy-Foto lässt sich vergrößern, mehr noch als die Freude in den Gesichtern, die meisten Arbeiter recken den rechten Arm zum Hitlergruß in die Höh, ist es die körperliche Nähe zu Hitler, die überrascht), »Adolf Hitler mit Gustav und Bertha Krupp von Bohlen und Halbach im Hügel-Park, im Hintergrund (Mitte) Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter, 11. April 1937.«
Auch wenn die Ausstellung Unangenehmes vorzeigt, wäre es leicht, einige Texte der unzulässigen Geschichtsklitterung zu überführen, z. B.: »Diszipliniert, ordnungsliebend und korrekt – Gustav Krupp von Bohlen und Halbach handelte stets als ›Treuhänder des Krupp’schen Erbes‹. Im Mittelpunkt seines Lebens standen die Familie und das Unternehmen. Wenn er ehrenamtliche Funktionen übernahm, engagierte er sich jedoch über Jahrzehnte hinweg und mit Nachdruck an führender Stelle.« Man fragt sich natürlich, warum so ein Mensch als einer der Hauptkriegsverbrecher angeklagt werden sollte.
Mich interessiert das Selbstverständnis, aus dem solche Texte entstehen, die ganz sicher nicht dem Stand der Forschung entsprechen, aber durch die Kontinuität der Firma Krupp und ihrer Stiftung im Alltag präsent sind. Wäre so ein Text außerhalb der Villa Hügel denkbar? Oder müsste man fragen: Außerhalb von Essen?
Wir laufen noch treppauf, treppab, drehen eine Runde durch den Park und versichern uns, jetzt, da die Dämmerung einsetzt, endlich Anspruch auf ein Mittagessen zu haben. Eigentlich ist alles hier dafür geschaffen, um es zu genießen. Trotzdem gehe ich unzufrieden davon, wie einer, der geglaubt hatte, schnell ein klares Ergebnis zu finden, und nun eher mit einer Aufgabe weggeschickt wird. Der Tochter hat es trotzdem gefallen. Und natürlich möchte auch ich, als wir in dem griechischen Lokal mit Blick auf den Baldeneysee auf die Stühle sinken, den Ausflug keinesfalls missen.
2010 war im Berlin Verlag die Biografie von Berthold Beitz erschienen, geschrieben von Joachim Käppner. Die Publikation dieses Lebensweges muss ein Ereignis gewesen sein. Mich haben damals diese sechshundert Seiten über einen Mann aus der Wirtschaft nicht besonders interessiert, obwohl meine Verlegerin Elisabeth Ruge von dem Buch und vor allem von Berthold Beitz schwärmte und mir die Lektüre nahelegte. Deshalb steht es auch als gebundenes Buch im Bücherschrank, allerdings in Berlin, aber jetzt bestelle ich die Taschenbuchausgabe, weil ich es gleich lesen will.
Mir fällt es dann tatsächlich immer schwerer, das Buch aus der Hand zu legen. Von Käppners Sichtweise, die sich der von Berthold Beitz annähert und von großer Sympathie für seinen Helden zeugt, lässt man sich gern an die Hand nehmen. Ich verfüge nicht über das historische Wissen, um Käppners Darstellung kritisch Paroli zu bieten, kann aber wie jede Leserin und jeder Leser die Widersprüche sehen, in denen Beitz sein Leben lang agierte. Da Berthold Beitz nur Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag verstorben ist, seine Karriere früh begann und er nie zurücktrat, durchwandert man in diesem Buch tatsächlich ein ganzes Jahrhundert. Die folgenden Seiten sind ein Destillat aus Joachim Käppners Beitz-Biografie.
Geboren 1913 im Dorf Zemmin, in der Nähe von Jarmen, südwestlich von Greifswald, wird er Bankangestellter, erlebt 1933 keineswegs als Zäsur, macht eine gewisse Karriere in Hamburg, lernt relativ früh seine Frau kennen, die für ihn die Liebe seines Lebens wird, die ständige Begleiterin und Unterstützerin, auch dann, wenn es um Leben und Tod geht. Beitz wird während des Zweiten Weltkriegs ins besetzte Polen geschickt, wo er nach einigen Zwischenstufen zum Chef der »Karpaten-Öl« aufsteigt, einer »kriegswichtigen« Öl-Firma.
Was ich nicht wusste: Beitz und seine Frau tun etwas, wofür jemand wie Alfred Schindler später berühmt wurde. Sie retten hundertfach jüdische Frauen, Kinder und Männer. Da Beitz eine unerschrockene Menschlichkeit besitzt, zudem großgewachsen und stets gut gekleidet ist und aufzutreten weiß, vermag er die nicht mit Widerspruch rechnende SS zu verunsichern. Noch aus den abfahrbereiten Waggons holt er »seine Juden«. Er wird denunziert und hat Glück, dass ausgerechnet jener SS-Offizier, der ihn verhören soll, sich als Jugendfreund herausstellt. Der inhaftiert Beitz ein paar Tage und lässt ihn dann nach Hause chauffieren, was seinen Nimbus noch verstärkt. Beitz kann viele retten, manche mehrmals. Für diejenigen, die er bei sich beschäftigt, scheint »die Familie Beitz von einem anderen Planeten zu kommen, einem ganz anderen als die übrigen Deutschen«. Als er eingezogen wird – viele Juden fliehen vorher in die Wälder in vorbereitete Verstecke –, gerät er in sowjetische Gefangenschaft, kann fliehen, überwindet die Oder gen Westen und überlebt die letzten Kriegsmonate in diversen Einheiten der Wehrmacht. Irgendwie schlägt er sich nach Hamburg durch, wohin auch die Familie kommen kann. Dort hält er die Seinen als Schieber und Kleinhändler über Wasser. Da aber Briten und Amerikaner unbelastete Kräfte suchen, wird er 1946 durch Fürsprache seiner früheren Sekretärin in Boryslaw (es ist ein zufälliges Wiedersehen der beiden auf Hamburgs Straßen) als Vizepräsident des Versicherungsaufsichtsamtes eingestellt, macht Karriere und geht 1949 auf das Angebot der Iduna-Germania-Versicherung ein, als Generaldirektor in deren Aufsichtsrat zu wechseln. Dort initiiert er unter anderem den Neubau der Iduna-Germania-Zentrale durch Ferdinand Streb, heute eine Ikone der Nachkriegsarchitektur.
Beitz gehört zu einer »Clique aus jungen Erfolgsmenschen«, die sich Luxus leisten können und ihn genießen. Es klingt wie die Beschreibung einer Boheme, nur heißen die Akteure Rudolf Augstein und Axel Springer; Berühmtheiten wie Max Schmeling oder der Architekt Ferdinand Streb, der Bankier Alwin Münchmeyer oder der Auschwitz-Überlebende und Begründer der Hamburger CDU Erik Blumenfeld gehören dazu. Da die Versicherung auch an die Familie Wagner Kredite vergibt, begegnet er oft Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan. »Wenn Sie Kontakte zur Industrie suchen, müssen Sie mitmachen«, sagt Beitz über die Gesellschaft der Freunde Bayreuths. »Da haben Sie die ganze Bande beieinander.«
Alfried Krupp lernt Berthold Beitz zufällig kennen, als Beitz in Essen das Atelier einer Sylter Urlaubsbekanntschaft, des Bildhauers Jean Sprenger, besucht, der für das Foyer der Iduna-Germania eine »Iduna« entworfen hat. Sprenger und Krupp sind seit der Schulzeit befreundet. Alfried Krupp, erst seit Anfang 1951 wieder ein freier Mann, besucht im Herbst 1952 mehrmals Beitz in Hamburg. Beitz rätselt, was Krupp von ihm will. Axel Springer lässt Beitz das Dossier über Krupp lesen, das offenbar schon damals bei Springer existierte. Ende September 1952 rückt Alfried Krupp dann damit heraus: »Sie bekommen Generalvollmacht, Sie können handeln wie ein Eigentümer und machen, was Sie wollen. Ich würde Sie gern als Generalbevollmächtigten in Essen haben.« Es folgen fast sechzig Jahre bei der Firma Fried. Krupp bzw. ihrer Stiftung. Wofür ich keine Erklärung finde, ist der Umstand, dass Krupp dieses Angebot 1952 macht, obwohl er erst 1953 wieder in den Besitz seiner Firma gelangt.
Von dem, was mir an Berthold Beitz bemerkenswert erscheint, kann ich nur wenige Aspekte herausgreifen:
Keine Schließungen
Berthold Beitz fühlt sich Alfried Krupp nicht nur zu dessen Lebzeiten verpflichtet. Er bewahrt ihm und seinem Vermächtnis eine Treue, die lange kompromisslos ist und für das Unternehmen existenzgefährdende Züge annimmt. Weil es sich sonst nicht mit der Firmenphilosophie vereinbaren ließe, wird an defizitären Betriebsteilen jahrelang festgehalten. »Dann müssen eben die anderen mehr erwirtschaften«, soll Alfried Krupps Devise gewesen sein.
Keine Waffen
Bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis 1951 antwortet Alfried Krupp auf die Frage, ob seine Firma wieder Waffen produzieren werde: »Ich habe nicht den Wunsch und nicht die Absicht. […] Ich hoffe, es wird für Krupp nie wieder nötig sein, zum Waffengeschäft zurückzukehren.«
Nach der Gründung der Bundeswehr 1955 gibt es allerdings den Wunsch nach Waffen. Krupp lässt einen seiner Direktoren verkünden: »Die Krupp-Werke werden niemals mehr einen Rüstungsauftrag ausführen, selbst wenn man uns eines Tages der Sabotage an der europäischen Wiederaufrüstung bezichtigen sollte.« Allerdings stimmt das nicht ganz, man baut Radargeräte, Lenksysteme für die Marine, liefert Spezialstahl, zum Beispiel für U-Boote, und anderes mehr. Zudem gehören Krupp große Anteile an MaK, die den Leopard-1-Panzer bauen.
Beitz versucht die Zurückhaltung von Krupp gegenüber der Produktion von Kriegsschiffen und anderen Waffen im Interview mit dem »Time Magazine« in Werbung zu verwandeln: »Warum in aller Welt sollten wir denn Kanonen produzieren? Schauen Sie doch unsere zivilen Aufträge an. Und nebenbei: Welcher Krieg würde heute noch mit Kanonen ausgetragen?«
Entschädigungen
Ein bis heute beschämendes Kapitel sind die Entschädigungszahlungen an ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Berthold Beitz setzt 1959 nach langwierigsten Verhandlungen Entschädigungszahlungen durch. »Rose Szego, die ungarische Jüdin, die in Auschwitz ihre Kinder verloren und im letzten Kriegswinter im Essener Walzwerk gearbeitet hat, erhält von Krupp nach dem Abkommen von 1959 etwa 3300 Mark«, resümiert Joachim Käppner. Vorausgegangen ist unter anderem eine Differenz zwischen Krupp und der Jewish Claims Conference. Berthold Beitz schreibt an die Conference: »Ihrem Bericht über den bisherigen Verlauf des Anmeldeverfahrens haben wir unter anderem entnommen, daß sich unter den Anspruchstellern annähernd 400 Ungarinnen befinden, von denen im Nürnberger Urteil angeführt ist, daß sie durch Krupp der Vernichtung preisgegeben worden seien. Diese Unrichtigkeit hat zusammen mit anderen Verzerrungen sicherlich mit zu der hohen Haftstrafe, zu der Herr von Bohlen verurteilt wurde und die er zum erheblichen Teil abgebüßt hat, beigetragen. Hierfür gibt es keine Wiedergutmachung, auch nicht einmal eine moralische in der Weltöffentlichkeit. Sie werden verstehen, daß diese Erkenntnis in unserem Hause mit Bitterkeit empfunden wird.«
Auch wenn der Zeitgeist von 1959 ein anderer war, ist es doch verwunderlich, von welch hohem Ross selbst Beitz, wenn auch im Auftrag von Alfried Krupp, hier vierzehn Jahre nach Kriegsende schreibt. Noch in der Ausstellung der Villa Hügel (Stand Dezember 2022) ist etwas davon zu spüren, dass Alfried Krupp hier Unrecht geschehen sei.
Die JCC antwortet: »Und die Firma Krupp hatte 1945 ihrerseits nichts dafür getan, die jüdischen Frauen vor dem Abmarsch in das Konzentrationslager Buchenwald und damit in den sicher geglaubten Tod zu bewahren. Das Direktorium stimmte dem Transport durch die SS, die keine KZ-Häftlinge lebend in die Hände der Befreier fallen lassen wollte, ausdrücklich zu, während britische und amerikanische Truppen sich bereits Essen näherten.«
Keine Grenzen
Gemäß der Hallstein-Doktrin, die eine diplomatische Anerkennung der DDR als »unfreundlichen Akt« gegenüber der BRD interpretiert und de facto diplomatische Beziehungen zu diesen Ländern ablehnt, sind die Firmen, die nach Osten exportieren wollen, nicht nur ohne diplomatische Begleitung, sondern werden von der Bundesregierung unter Adenauer auch argwöhnisch beäugt. Bis 1970 hat die BRD nur in Moskau eine Botschaft, sonst nirgendwo im Ostblock. Selbst in Jugoslawien wird die Botschaft 1957 wieder geschlossen. Beitz fährt 1958 zur Messe ins polnische Poznań, wo er u. a. mit dem polnischen Außenminister spricht. Auf polnischer Seite weiß man, wen man vor sich hat. So entstehen freundschaftliche Beziehungen zwischen polnischen Regierungsvertretern und dem Generalbevollmächtigten. Da aber die Polen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze fordern und Adenauer auf der Rückgabe der deutschen Gebiete beharrt, ist der Spielraum für Beitz eng. Dass es ausgerechnet die Firma Krupp ist, die auf den Messen in Leipzig, in Poznań und anderen östlichen Ländern den Vorreiter spielt, ist allein das Verdienst von Berthold Beitz. So wird er zehn Jahre vor Egon Bahr zu einem Vermittler zwischen West und Ost.
1958 wird Beitz zum ersten Mal in die Sowjetunion eingeladen. Adenauer stuft ihn daraufhin als »national unzuverlässig« ein.
1963 kommt es während eines Besuches von Beitz in der Sowjetunion zu einer überraschenden Einladung in den Kreml. In Käppners Buch gibt es eine Fotografie, die die beiden Gesprächspartner zeigt, darunter die handschriftliche Widmung des Generalsekretärs auf Russisch: »Dem liebenswürdigen Herrn B. Beitz, N. Chruschtschow.« Das Gespräch dauert zwei Stunden und muss sehr offen geführt worden sein, nur die Dolmetscher sind anwesend.
Nach dem Mauerbau hat sich der Ost-West-Konflikt etwas entspannt, Chruschtschow hofft – wie Beitz – auf neue Leute nach Adenauer. 1962 gibt es das Röhrenembargo, das Mannesmann und Hoesch, die beide in die Sowjetunion liefern, hart trifft. Chruschtschow habe gesagt, referiert später Beitz: »Wir haben die Rohstoffe, ihr habt die Technik, und zusammen sind wir unschlagbar.«
So wie es Berthold Beitz oder auch Otto Wolff von Amerongen verstehen, in Zeiten eines besonders kalten Krieges auf die Funktionäre des Ostblocks zuzugehen, ohne ihre eigenen Positionen und Interessen zu verleugnen, werden sie zu Pionieren der Verständigung und letztlich der Entspannung. Willy Brandt und Egon Bahr könnten zu der Maxime »Wandel durch Annäherung« auch von diesen »Wirtschaftskapitänen« angeregt worden sein.
Erich Honecker
Beitz pflegt auch gute Kontakte zu Erich Honecker. Dabei hilft es, dass Beitz ein passionierter Jäger ist. 1986 holt er die Ausstellung »Barock in Dresden« in die Villa Hügel, 1987, als Honecker zum Staatsbesuch in die BRD kommt, empfängt ihn Beitz in der Krupp’schen Residenz. Im Juni 1989 sehen sie einander zum letzten Mal in Greifswald und besuchen gemeinsam einen Gottesdienst in der Nikolaikirche, für die die Krupp-Stiftung die Fußbodenheizung gespendet hat. Im Oktober 1989 wird Honecker durch Egon Krenz abgelöst, Honecker muss in der Charité behandelt werden. Schon im Krankenhaus hat er sich den Kaffee erbetteln müssen, da er selbst über kein Geld mehr verfügt, sein Konto ist gesperrt. Als er entlassen wird, weiß er nicht wohin, denn auch sein Haus in Wandlitz wurde konfisziert. Es ist Beitz, der die Notlage erkennt und unter Vermittlung des Rechtsanwalts Vogel eine Unterkunft für das Ehepaar Honecker findet. »Ich habe den Pastor gebeten, ihn unterzubringen.« Die Gegengabe für den Pfarrer ist ein VW-Bus für die Kinder mit Behinderung, die in Lobetal betreut werden. Beitz muss Honecker auch angeboten haben, dessen Prozesskosten zu übernehmen – der ehemalige Generalsekretär ist offenbar zu Tränen gerührt, lehnt aber die Hilfe ab.
Was trieb den Kruppianer Beitz dazu? War es ein Gefühl für Anstand und Würde, das so viele andere, die Honecker näherstanden oder politisch verantwortlich gewesen wären, vermissen ließen? War es ein Akt der Solidarität mit dem Antifaschisten Honecker? Wie nachhaltig der Sturz von Erich Honecker Berthold Beitz beschäftigte, belegt eine Episode aus dem Jahr 1993, die Joachim Käppner schildert und die sich am achtzigsten Geburtstag von Beitz zugetragen haben soll. Ein TV-Team begleitet den Stiftungschef durch den Park der Villa Hügel. Doch statt von sich selbst zu erzählen, spricht er plötzlich von Honecker, der zu dieser Zeit schwer krebskrank in Chile lebt. »Wenn Erich Honecker jetzt nach Deutschland zurückkäme«, soll Berthold Beitz gesagt haben, »dann könnte er mit seiner Frau bei mir zu Hause wohnen, solange er lebt.« Beitz wehrt sich zunächst gegen den Rat seines Pressechefs, die Passage über Honecker zu schneiden. Schließlich stimmt er doch zu, die Fernsehleute sind enttäuscht, die Sensation bleibt aus, der gesamte Beitrag wird gestrichen.