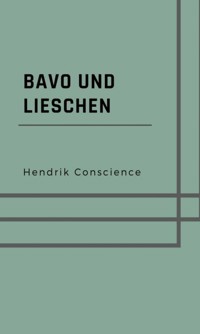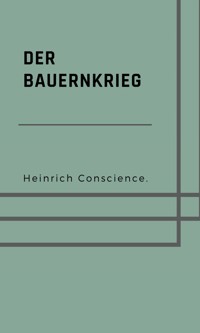
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
An der Chaussee, die nicht weit von Waldeghem lief und dieses Dorf mit größeren Gemeinden, und dann mit der Stadt selbst in Verbindung setzte, stand ein großes Wirthshaus, das einen Adler zum Aushängschilde hatte. Es gehörte dem Baes Cuylen, der zugleich Müller war. Seine Mühle lag knapp dabei und über die gewöhnliche Höhe, denn nach der Ostseite reichte der Adler bis an eine ausgedehnte Waldung, welche sich nach dieser Richtung auf einige Stunden erstreckte. Um nun den Wind, der von dieser Seite herblies, so gut wie möglich aufzufangen, hatte Baes Cuvlens Großvater mit Umsicht die Mühle recht hoch bauen lassen. Eines Sonntags Morgens, im Oktober des Jahres 1798, trat Baes Cuylen aus seinem Hause, um nach der Mühle zu gehen. Sus, sein Knecht, der ihm auf dem Fuße folgte, war sichtlich verstimmt und murrte vor sich hin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Bauernkrieg (1798).
Teil 1.
Vorspiel.(1793).
I.
II.
III.
IV.
V.
Teil 2.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Schluß.
Anmerkungen
Der Bauernkrieg (1798).
historisches Gemälde aus dem achtzehnten Jahrhundertvon Heinrich Conscience.
1853.
Teil 1.
Vorspiel.(1793).
B
elgien ist die Wiege der Freiheit; wie weit wir auch in unsere Vergangenheit zurückblicken, so finden wir selbst in den ältesten Zeiten die Bewohner unserer Städte im Besitz von ausgedehnten Freiheiten — diese Volksrechte wurzeln im Leben und Streben unserer Urväter und sind seit ihrer ersten Einwanderung in den Boden der Heimat eingepflanzt.
Der schnelle Gang der geschichtlichen Entwicklung in den Völkern deutschen Stammes brachte es mit sich, daß auch die Gemeinden im platten Lande bald ihre unabhängige Stellung gesichert hatten. Gegen das Ende des Mittelalters — in einer Epoche, wo Viele größere Länder, und Frankreich ganz besonders, sich aus dem Drucke der Knechtschaft noch nicht zur Idee der Freiheit erhaben hatten, waren in Belgien die Beziehungen zwischen Fürst und Volk schon geregelt; geschriebene Gesetze wiesen dem einen wie dem andern seine Pflichten und seine Rechte an.
Dieser Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit liegt unzweifelhaft im Blute unserer Ahnen; Belgiens Loos seit seinem ersten Bestehen liefert dafür den schlagendsten Beweis. Ist nicht das ganze Leben der Nation, von ihrer Geburt bis auf die jüngsten Tage, ein einziger Streit, ein unermüdetes Ringen, ein unausgesetztes Blutvergießen, eine riesige Kraftanstrengung — alles im Dienste der Freiheit?
Trotz allen Kämpfen, welche die früheren Generationen durch eine Reihe von Jahrhunderten ausgestanden, trotz den härtesten Prüfungen des Schicksals, hatten die Belgier, gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, ihre so kostbare bürgerliche Freiheit bewahrt. Der heitere Einzug, des Landes Grundgesetz, schirmte noch immer, für den Fürsten, wie für das Volk, die herkömmlichen Pflichten und Rechte; bei jeder Thronbesteigung band ein feierlicher Eid, unter Gottes freiem Himmel geleistet, den neuen Monarchen.
Damals drohte in Frankreichs Horizont das entsetzliche Unwetter, das nachher Europa’s Grundfesten so sehr erschüttern.
Die unleugbare Sittenlosigkeit und Verderbtheit derjenigen, die an der Spitze des Volkes standen und ihm zum Vorbild hätten dienen sollen, hatte die Gemüther in Frankreich für eine Lehre empfänglich gemacht, die jede Autorität leugnete, und somit den Fluch der Willkür und Tyrannei für immer weggebannt zu haben glaubte.
Stolze Geister, mit allen Waffen der Kunst und Wissenschaft ausgerüstet, träufelten das Gift des Zweifels in die empfänglichen Gemüther des Volkes. Den Menschen erhoben sie zum Gotte und empörten sich gegen den Gott, der im Himmel thront; überall machten sie das Gefühl der Menschenrechte rege und suchten dagegen den letzten Funken von Menschenpflichten zu ersticken-.
Der Haß gegen die gläubige Ehrfurcht ihrer Ahnen verleitete sie dazu, Zucht und Gottesdienst, alte Treue und Biederkeit beständig zu verspotten und zu verlästern; statt den Acker vom Unkraut zu säubern, rüttelte ihre leidenschaftliche Ungeduld an jeder Scholle, warf das Unterste zu oberst und begrub in dem wüsten Schutt alle Keime der Gegenwart. So wurde alles Bestehende frevelhaft umgestürzt und Frankreich in eine Bahn gezwängt, wo nur Trümmer und Ruinen die Thätigkeit eines früheren Geschlechts bewährten.
Und als die Herzen nichts mehr übrig behielten, als wilden Haß und trostlosen Unglauben, um sich in blinder Wuth nach dem Unbekannten zu wenden, da trug der Baum des Zweifels seine üppigen Früchte.
In Paris brach das höllische Feuer, an dem man so trefflich geschürt, zuerst aus; der Vulkan goß die kochenden Ströme seiner Lava selbst weit über Frankreichs Grenzen aus.
Der Fremde, der sich unaufgerufen zum Weltverbesserer aufwarf, bot uns seine Freiheit an, unter der einzigen Bedingung, daß wir uns in Frankreichs Ketten begeben sollten.
Wir, die wir mit der Freiheit geboren waren und sie seit undenklichen Zeiten besessen hatten, konnten in dem besudelten Bild von Zweifel, von Mord, Zerstörung und Tyrannei das Erbtheil unserer Vorältern nicht erkennen. Des Landes Unabhängigkeit war uns über Alles theuer. Wir weigerten uns und wurden durch die wilde Uebermacht der Mehrzahl erdrückt.
Im November 1792 lieferte die Schlacht von Jemappes unser Vaterland wehrlos und verlassen in die schnödeste Gewaltherrschaft —
Die Sendlinge der Pariser Clubs, wo Dante ist! Marat und Robespierre als Götter der Zerstörung thronten, verbreiteten sich gleich einer Wolke raubgieriger Raben über Belgien.
Nur vier Monate blieben sie für diesmal hier, und doch war die kurze Zeit ihnen zureichend, unsere schönsten Kirchen zu plündern, die heiligen Vasen in Tonnen zu stampfen und nach Frankreich zu führen, die Gemeinden mit Brandschatzung zu schlagen, die Bürger und Bauern gegen werthloses Papiergeld ihre Magazine und Vorrathskammern leeren zu machen, . . . und so das Gold und Gut von Belgien auf unzähligen Wagen nach ihrer unersättlichen Räuberhöhle, nach dem blutvergießenden Paris, zu schleppen1.
Von der furchtbaren Macht der Umwälzungen niedergebeugt, sah das belgische Volk der Vernichtung aller seiner Freiheiten, seiner Wohlfahrt, seines Gottesdienstes und seiner Sitten, mit stummer Trostlosigkeit zu; und wenn noch ein Funke von Hoffnung in einzelnen Herzen glimmte, so war es allein das Vertrauen auf Gottes Allmacht und Gottes Beistand. Alle menschliche Hilfe schien vergebens und unzureichend gegen den riesenhaften Andrang von Frankreichs wilder Volksmenge.
Und doch kam ein Tag der Befreiung: die Österreicher schlugen die französische Armee bei Neerwinden, am 18. März 1793. — Der Fremde verließen unsern Boden.
Dann athmete unser Vaterland nach dem bitteren Druck wieder auf. Gesetze, Sitten, Sprache, Gottesdienst, alles wurde in seiner vorigen Form hergestellt; ein Jeder sah mit Vertrauen der Zukunft entgegen, der Handel fing an sich augenblicklich zu heben, die verwüsteten oder verlassenen Felder wurden in Eile wieder besäet, die Kennzeichen der fremden Herrschaft beseitigt, die Kirchen neu verziert; — und überall, sowohl auf den Gesichtern, als in den Herzen schimmerte Freude und Dankbarkeit zu Gott für die unverhoffte Befreiung.
Was wir erzählen werden, hat sich in einem Dorfe der brabantischen Kampine zugetragen, welches wir gewisser wichtiger Ursachen halber hier mit dem Namen Waldeghem bezeichnen wollen.
Dieses Dorf lag einige Bogenschüsse von einem größeren Landweg entfernt; der Platz, wo sein niedrig Kirchlein stand, zeigte sich in der Ferne wie ein Lustwäldchen von mächtigen Linden, und wo oben nur das Kreuz des Thurmes in die Augen fiel, gleichsam um anzuzeigen, daß hier eine Anzahl Menschen unter dem Schatten von Gottes Tempel wohnte.
In der Nähe sah es lieblich und reizend aus: die Dächer seiner Hütten waren mit Moos bewachsen, die Giebel von Weinreben umschlungen oder lagen im stillen Schatten halb verdeckt unter dem dichten Laub der Nußbäume. Doch konnte man auch da einige größere Gebäude bemerken: die Pfarrei, an ihrem Nothglöckchen kenntlich, stand neben dem Kirchhof; ganz dabei die Wohnung des Küsters und Schulmeisters, minder hoch, doch ebenso freundlich; weiter im Dorfe das schöne Haus des Notars, und gegenüber die ausgedehnte Brauerei mit ihren Stallungen und Werkstätten.
Zwischen den Häusern und Hütten, die so zu sagen der Zufall auf beide Seiten des Weges hingestreut hatte, standen einige Räume leer, durch welche das Auge erst über fruchtbare Felder und sanfte Wiesen schweifen konnte und dann auf undurchdringbare Wälder stieß, welche das Dorf von allen Seiten einschlossen, so daß es sich wie ein liebliches Thal zwischen hohen Bergen ausnahm.
An einem Sommertage des Jahres 1793 feierte Waldeghem seine Kirmeß.
Vor der Kirche, unter den hohen Linden, standen verschiedene mit Leinwand überspannte Buden; aber was man darin verkaufte, konnte man nicht sehen, weil die Krämer, die Arme über die Brust gekreuzt, auf einer Kiste oder auf einer Bank lagerten und ihre geschlossenen Läden schweigend zu überwachen schienen.
Vor einigen Wirthshäusern waren Zelte von Segeltuch aufgeschlagen, ohne Zweifel um den Dorfbewohnern als Tanzsaal zu dienen; doch dieselbe unheimliche Stille herrschte auch unter diesen - Zelten. Fast hätte man beim Anblick der Dorfstraße glauben können, daß gestern der legte Tag der Kirmeß gewesen sei, und daß die erschöpfte Bevölkerung durch die Ermüdung verhindert war, die übriggebliebenen Zeichen des Frohsinns wegzuräumen.
Diese allgemeine Stille hätte wunderbar scheinen können, da es kaum drei Uhr Nachmittags war, hätte man nicht bei einem Fernblick durch die Hütten die Lösung des Räthsels erfahren.
Längs der Fußwege, die aus dem dunkelen Gebüsche sich durch Wiesen und Felder gegen die Kirche schlängelten, kamen zahlreiche Familien herauf. Männer, Frauen, Kinder, alle mit einem Gebetbuch, mit einem Rosenkranz, oder beide zugleich in der Hand.
Da die engen Fußwege nur einem einzelnen Menschen den Durchgang gewähren konnten, so gingen alle diese Personen je einer vor dem anderen und alle dicht hintereinander. Aus der Ferne gesehen, schien die Fortbewegung dieser Leute sehr schleppend, und hätte nicht die bunte Tracht der Frauen, mit dem Hochroth, Grün, Gelb und Weiß zwischen der dunkelblauen Tracht der Männer durchgeschienen, und sonach die Bewegung merklich gemacht, so hätte man fast denken mögen, daß diese Menschenreihen ganz bewegungslos in den Feldern ständen.
So zogen von allen Seiten die Einwohner der Gemeinde Waldeghem der Kirche zu, um der feierlichen Vesper beizuwohnen, welche eben beginnen sollte.
Wenn man im Dorfe selbst die gleiche Bewegung nicht bemerkte, so war es einer berechneten Gewohnheit der Bauern zuzuschreiben, die ihre Häuser um so später verlassen, je näher sie der Kirche wohnten, und daher kommt es, daß die Bewegung der Dorfbewohner zuerst an den äußersten Enden des Dorfes beginnt und sich allmälig fortverbreitet, bis der Glockenschlag die Allerfaulsten aus dem Wirthshause treibt, um den Anfang des Gottesdienstes nicht zu verfehlen.
Und fürwahr, dem würde sich für diesmal niemand haben aussetzen wollen. Es mußte diese Vesper einen bestimmten Zweck haben, um die Neugierde eines Jeden also zu reizen.
Bruno, der Sohn des Notars, welcher bei den Augustinern in Antwerpen die lateinische Schule besuchte, war auf Urlaub, um die Kirmeß in dem Dorfe mitzumachen. Er hatte eine wunderbar schöne Stimme und war in der Musik sehr bewundert. Der Küster hatte deswegen seit langer Zeit und mit großer Mühe den Sängern der St. Cecilia-Gilde eine feierliche Vesper einstudiert, worin sich eine Anzahl Solos befanden. Bruno sollte diese Solos singen.
Seit drei Monaten hatte man in den Familienkreisen der Gildebrüder von St. Cecilia von nichts anderm sprechen hören, als von der Vesper und Bruno’s schöner Stimme; und diese lange Sehnsucht hatte ihre Neugierde dergestalt gereizt, daß sie nun zur Kirche eilten, als müßte dort ein außerordentliches Ereignis stattfinden.
Kurz ehe die Glocke drei schlagen sollte, war die Kirche schon voll Leute. Die Weiber und Jungfrauen unter dem linken Schiff der Kirche; die kleinen Mädchen längs derselben Seite in der Mitte der Kirche, gerade gegenüber die kleinen Knaben mit einem Durchgang zwischen beiden; die Männer unter dem rechten Schiff, so daß die eine Seite der Kirche fröhlich und frisch, mit Schneeflocken von weißen Spitzen und hochfarbigen Zeugen glänzte, während auf der anderen die eintönige blaue Farbe der Männertracht alles verdunkeln.
Unter den Männern bestand noch eine besondere Reihenfolge dem Range oder dem Alter gemäß. Während die Aelteren in der Mitte, wie zufällig, zerstreut saßen, standen die jungen Leute, die angehenden Männer mehr nach vorne zu, um den Altar des heiligen Sebastian, des Beschützers der Schützen-Gilde. Von den heirathsfähigen jungen Burschen fehlte niemand, als blos die Mitglieder der St. Cecilia, die ihren gewöhnlichen Platz auf der Chorbühne wieder eingenommen hatten.
Knapp am Altar des heil. Sebastianus stand ein rüstiger Jüngling, den Ellbogen auf die Kniebank lehnend und halb nach dem Bilde des Heiligen hingewandt. In seiner Haltung lag etwas Mißbilligendes, auf seinem Angesicht etwas Hartes und Spöttelndes, als wäre er sich nicht recht bewußt, daß er sich im Gotteshause befinde. Es entfielen ihm selbst von Zeit zu Zeit schlechte Witze über Bruno und die versprochene Vesper, welche er an einen ältlichen Mann richtete, der, mit gekrümmtem Rücken und verwelktem Gesichte einige Schritte von ihm entfernt, vor dem Pfeiler auf den Knien lag.
Was er sagte, mußte den alten Mann sehr kränken, denn er knirschte unmuthig mit den Zähnen, und mit dem bittersten Ausdruck der Verachtung unterbrach er ihn:
»Schweiget, gottloser Kerl, Ihr seid nicht einmal werth, Bruno’s Schuhriemen zu lösen.«
Die Umstehenden gaben hinreichend durch ihre Blicke zu verstehen, daß sie dem alten Manne Recht gaben; einige entfernten sich selbst mit Widerwillen von dem trotzigen Jünglinge. Als dieser dessen gewahr wurde, lachte er spöttisch und zuckte die Achseln. Er dachte gewiß den alten Mann von neuem zu plagen, als plötzlich die kleine Seitenthür der Kirche sich öffnete und die Aufmerksamkeit eines Jeden sich nach diesem Punkte richtete.
»Bruno!« rief der alte Mann freudig. »Veva!« murrt der Spötter, und seine Augen brannten von Zorn.
Da trat wirklich ein Jüngling, schlank von Gestalt, fein von Gesicht und mit dem sittsamen Ausdruck eines Mädchens in die Kirche; er hatte einen großen Blumenstrauß in der Hand und begleitete ein junges Mädchen, das den Kinderjahren kaum entwachsen, doch bereits ein schönes Frauenbild war, so regelmäßig, so fein, so edel von Angesicht, daß ihr Anblick bezauberte und zu Träumereien verlockte.
Es war Genoveva, die einzige Tochter des Küsters und Schulmeisters, der auf sein angebetetes Kind all’ das Gefühl seiner sinnigen Seele ausgegossen hatte und ihr für ihr zartes Alter eine Bildung hatte angedeihen lassen, die sie unter den Dorfbewohnern als eine Wundererscheinung gelten ließ.
Die Jungfrau hielt gleichfalls einen Blumenstrauß in der Hand und nahm dazu noch denjenigen, welchen ihr Begleiter getragen hatte.
Sie schritt langsam über den Chor, bestieg die Treppen des Altars, nahm die halb verwelkten Blumen herab und stellte ihr frisches und wohlriechendes Opfer, Gott zu Ehren, neben das Tabernakel.
Dann kehrte sie wieder zurück und nahm den Stuhl, den Bruno für sie bereit hielt.
Der Jüngling ging, um sich nach der Chorbühne zu begeben, wo der Küster schon die Orgel spielte, langsam durch die Kirche.
Bei seinem Durchgang wurde die Stille durch das Schieben der Stühle gestört, jeder richtete sich auf, um den schönen Studenten zu sehen, der in der feierlichen Vesper vorsingen sollte; und daß er seinen Dorfgenossen willkommen war, das konnte man deutlich an dem stillen Lächeln der Zufriedenheit und Freundschaft erkennen, die ihm aus jedem Gesicht entgegenstrahlte. Er beugte, über diese Huldigung gerührt, sein schamrothes Haupt, beschleunigte seine Schritte und erreichte seinen Platz auf der Chorbühne gerade in dem Augenblicke, als der Küster die Orgelpfeifen auszog und dadurch die Ankunft des Pastors verkündete.
Der Pastor trat wirklich durch eine Thür neben dem Altar herein. Man konnte keinen ehrwürdigeren Mann als diesen Priester sehen. Obwohl er schon 70 Jahre alt sein mochte und hoch von Gestalt war, so ging er noch aufrecht, als hätte das Gefühl von der Erhabenheit seiner Sendung auch seinem Gemüthe und seiner Haltung Erhabenheit aufgedrückt. Weißes Haar, glänzend wie Schnee unter dem Sonnenlichte, umkränzte seinen Schädel und fiel in ungezwungener Fülle auf seine Schultern. Sein Angesicht, ruhig und sanft, war von tiefen Runzeln gefurcht; seine Augen waren noch hell und zeugten durch ihren friedlichen Blick von der Liebe und der Güte des Herzens.
Bei seinem Eintritt einen langanhaltenden Blick auf seine Pfarrkinder werfend, schien ein himmlisches Lächeln auf seinem Angesichte zu glänzen, und es war, als ob seine Augen vor Rührung sich befruchteten. Ja, er blieb eine kurze Weile bei der Thür stehen und schaute wie in einem seligen Traume die Menge an, welche die Kirche langsam füllte.
Außer einigen wenigen, hatte er alle diese Menschen getauft; er hatte alle in der christlichen Lehre erzogen, er hatte sie in ihren Krankheiten getröstet, ihnen in ihrer Armuth beigestanden; er hatte ihnen den Himmel als letzte Hoffnung angewiesen, als sich im Nachbarlande die Hölle geöffnet, und Verfolgung, Mord und Raub über das Vaterland ausgebreitet hatte. Er wußte alles, was sie gethan und gedacht hatten. Jede Falte in ihrem Herzen, selbst die tiefste, lag ihm offen und wies ihm ihre Geheimnisse.
So war ihm dieses Volk mehr als eine Schaar von Brüdern; es war sein geistiges Blut, das theure Eigenthum seiner Seele; für diese Menschen lebte er und liebte sie wie ein zärtlicher Vater seine Kinder liebt.
Doch welche Ehrfurcht fühlten sie für ihn, welche Liebe hatten sie ihm alle geweiht, ihm, der das Bild der Gottheit selbst, dastand, um zu erquicken und zu trösten oder zu segnen, bei jedem Vorfall, der ihre einförmige Lebensbahn unterbrach.
Diese Betrachtung durchflog wie ein Blitz des Priesters Seele, und um so mehr freute er sich, seine Familie nach der bitterer und hoffnungslosen Verfolgung wieder glücklich zu sehen.
Noch ganz in der sanften Beschauung verloren, wendete er sich zum Altar, um die Vesper zu beginnen. Da athmete er den frischen Hauch der Blumen, und ein Blick der Dankbarkeit leuchtete aus seinen Augen, indem er der jungen Genoveva im Vorbeigehen ein mildes Lächeln zuwarf.
Die Vesper begann.
Da die Glieder von St. Cecilia in voller Anzahl waren, und der Küster sie mit großer Sorgfalt angeleitet hatte« sangen sie viel einstimmiger als gewöhnlich; doch in der Ueberzeugung, daß sie eingeschult waren, schrieen sie um so lauter und sangen gegen die dröhnende Orgel, als hätten sie im Wettstreit mit dem mächtigen Instrumente den Preis erringen wollen.
So dauerte es eine Zeitlang fort, bis Bruno, nach einem Zwischenspiel der Orgel, die Solo-Hymne vortragen sollte.
Still und sanft, mit einer beinahe unhörbaren Stimme, aber so fein und deutlich, daß es die Seele zum Schmelzen brachte, begann Bruno den Lobgesang:
Ave, maris stella . . .
Und dann, nach und nach den Ton kräftiger steigernd und durch das Zittern der Noten seinem Gesang mehr und mehr Gefühl verleihend« gelangte er an die Strophe:
Monstra, te esse matrem . . .
die er zuerst mit gedämpfter Stimme schluchzte und dann wie einen Hilferuf in stehenden Klagen zum Himmel entsandte.
So fuhr er im Lobgesang fort und bewegte seine herrliche Tenorstimme mit so viel Freiheit und Ungezwungenheit, daß man die Musik vergaß und dachte, daß dieser Gesang die natürliche Sprache der menschlichen Seele war.
Und es muß wohl so sein, daß alles Wahre und Schöne selbst in den schlichtesten Herzen Saiten findet, die harmonisch wiederhallen; denn es war so still in der Kirche, als wären alle Dorfbewohner in Bildsäulen verwandelt.
Nur ein Mensch scharrte von Zeit zu Zeit mit den Füßen, oder hustete vernehmbar; und das war der Spötter bei dem Altar des St. Sebastian.
Obschon dieser Lärm Viele ärgerte, so konnte es die Ruhe der Uebrigen doch nicht stören; Bruno’s schöne Stimme machte sie die Welt vergessen; es war ihnen, als stieg ihre Seele mit in die Höhe, so wie die Töne mit Kunst und Gefühl aus Bruno’s mächtiger Brust sich gegen den Himmel emporheben und in ihrem Falle die ganze Kirche mit Harmonie erfüllten.
Man sagt, daß die Musik eine undeutliche Sprache ist. Dies mag der Fall sein, wenn sie schlecht vorgetragen oder zu nichtssagenden Spielereien verwendet wird. Die wahre Musik ist aber die Sprache des Gemüths, und wenn sie aus dem Herzen und zum Herzen spricht, dann versteht oder fühlt vielmehr selbst das stammelnde Kind ihre leisesten Anklänge.
Die Worte, die Bruno sang« gehörten der lateinischen Sprache an; ihre materielle Form machte sie demnach für die Zuhörer unverständlich — und doch begriffen die Bauern ganz wohl, was er sagte, und doch empfingen und theilten sie den Eindruck des Gesanges. Es entging ihnen nicht, daß es ein Gebet war — ein Gebet, so feierlich, so innig, so bezaubernd, daß sie desgleichen noch nie vernommen hatten — ein Gebet, das sie bald durch seine tiefen Trauertöne düster stimmte, bald durch seine Flehlaute mit zu Gott hinauszog, bald zu unwillkürlichem Zittern und Beugen brachte, sowie die Noten durch ihr ängstliches Zagen die Zerknirschung des Sängers vor dem Allmächtigen verriethen — ein Gebet endlich, das sich ihrer ganz bemeisterte und jede Brust hob, als der schöne Sänger das Magnificat selbst begann, und die Strophe:
Magnificat anima mea Dominum!
aus Bruno’s Kehle wie gellender Trompetenton zu den Gewölben der Kirche emporstieg.
Später fielen die Chöre ein und wechselten wieder mit Gebeten des Pfarrers und Tenorsolos ab, bis am Schlusse der Vesper ein Jeder aufstand und sich anschickte, die Kirche zu verlassen.
Auch Bruno war von seiner Bühne heruntergekommen und durchschnitt die strömende Menge, um seinen Vater und Genoveva zu erreichen, die sich am Altar befanden.
Der Jüngling war aufgeregt und heiter; seine Wangen waren bedeutend geröthet, und freundlich blickte er um sich, als wollte er fragen, was man von seinem Gesange dächte. Doch sein Lächeln blieb von den Männern wie den Weibern unerwiedert — alle wichen in stummer Ehrfurcht zurück, um ihm den Durchgang so viel wie möglich zu sichern, und starrten ihn an, als ob sich ihnen ein Wunder offenbarte.
Die schlichten Leute standen auch wirklich noch immer unter dem Zauber seiner Stimme, ihre Herzen bebten noch vor Rührung; es schien ihnen unerklärlich, daß der junge Mann eine so große Gewalt über sie geübt und ihnen die niegeahnten Gefühle von ihrem eigenen Werth und der Lebensfülle eingeflößt hatte — jetzt erst hatten sie gemerkt, daß auch unter ihrer rauhen Hülle ein dichterisches Gemüth schlummerte!
Deshalb blickten sie dem lieben Bruno dankbar und verwundert nach, als er sich gegen das obere Ende der Kirche richtete.
Der alte Mann am Altar des St. Sebastian war gegen einen Pfeiler gelehnt, und die hellen Thränen liefen ihm aus den Augen.
Der Jüngling, der dies gewahr wurde, stellte sich zu ihm und erkundigte sich mit Theilnahme, was ihm denn fehle.
»Ach« Bruno, Ihr herzlieber Bruno!« schluchzte der Alte, und schien ganz verzückt, »Jetzt habe ich lange genug gelebt! Gott lohne Euch das Glück, das Ihr dem armen Jan heute gespendet. Ich bin ganz von Sinnen, es ist mir, als käme ich vom Himmel herunter!«
»Ich glaub’s wohl, er hat zu tief ins Glas geguckt!« meinte spöttisch der Gegner des Alten, der noch immer seinen Ellbogen auf die Kniebank stützte.
Der Alte wandte sich um und entgegnete mit Heftigkeit:
»Lacht mich immerhin aus, scheltet mich den närrischen Jan — doch seht«, Simon, auf meinen Armen habe ich das Kind getragen« es auferzogen und tagtäglich in meinen Gebeten erwähnt! Der Herr hat mich erhört: Bruno ist zum Jüngling herangereift . . . «
»O über den Milchbart, der wimmern kann, wie ein Mädchen! Ihr solltet Euerem Bruno Weiberröcke anthun und ihm eine Haube aussetzen . . . !«
»Kommt, Jan«, sprach der Jüngling und zog den Alten mit sich — »laßt den Simon, und begleitet uns zur Kirmeß: der Vater hat es mir erlaubt.«
Inzwischen hatte sich die Kirche fast geleert.
Draußen war Alles wie durch einen Zauberschlag umgestaltet. Aus der Ferne hörte man das einladende Spiel der Geigen durch den Lärm der Kirmeß dringen.
Einige ältere Leute waren in Gruppen auf dem Kirchhofe stehen geblieben, um sich über die Neuigkeiten des Tages zu unterhalten. Sie redeten hin und her von der französischen Republik und den Jakobinern, von dem Tode Marats und der Lage des Kaisers von Österreich; sie freuten sich über die gesegnete Ernte und drückten die Hoffnung aus, daß Gott das Land vor weiteren Einbrüchen und Räubereien bewahren würde.
Da stand auch der freche Bursche, den wir früher am Altar des St. Sebastian getroffen. Es war Simon, der Sohn des Brauers, der, seit dem allzufrühen Tode seiner Mutter, sich und seinen Lüsten überlassen blieb; während der ersten Monate der französischen Herrschaft war er nach Brüssel gerannt, und Niemand wußte, was er in der Hauptstadt getrieben hatte. Doch er war mit schlechten Gedanken zurückgekommen, und dies war für die Bauern ein hinreichender Grund, zu denken, daß er dort eben nicht mit den besten Gesellen verkehrt haben müsse.
Jedenfalls war er nicht der Liebling des Dorfes, dessen ruhige Bevölkerung er durch sein wüstes Leben und rohes Poltern oft ärgerte. Nur einige der ärmsten Jungen bildeten seinen Hof und begleiteten ihn beständig; die Bierkannen, mit denen er freigebig traktierte, lohnten sie dafür.
Es war wirklich schade um den Simon, der für einen hübschen Jungen gelten konnte. Er war ziemlich groß, mit regelmäßigen Zügen und hatte auch etwas Erziehung genossen; doch in seiner Haltung lag ein gewisser Trotz, sein Gesicht hatte einen Ausdruck von Härte, und sein gewöhnliches Lächeln verrieth bittere Spottlust. Ein erfahrenes Auge konnte aus den ersten Blick erkennen, daß der junge Mann, obgleich kaum vier und zwanzig Jahre alt, doch schon seines Lebens satt war, weil er es sich durch Haß und Hochmuth vergällt hatte.
Die Triebfeder aller seiner Handlungen war eine übertriebene Eigenliebe, die Sucht es allen Andern zuvorzuthun und sich dadurch die allgemeine Bewunderung zu sichern.
Er bildete sich auf seine Talente nicht wenig ein; Keiner konnte besser singen und tanzen, oder sich artiger benehmen als er; Keiner konnte sich mit ihm in Verstand, Beredenheit und Bildung messen. Seine Kameraden im Dorfe, sagte er oft, wären eine Schaar von dummen Tröpfen, denen der Pfarrer nur die Fratze des Teufels vorzuhalten brauchte, um sie in ihr Bett zu jagen, wo sie dann die ganze Nacht über von nichts, als von Hölle und Fegefeuer träumen.
Ein halbes Dutzend ärmlich gekleidete Jungen, die um Simon am Eingange des Kirchhofs standen, erinnerten ihn an die zwanzig Kannen Bier, die er am Schlusse der Vesper zu zahlen versprochen hatte; Simon aber schenkte ihnen kein Gehör, sondern zog und putzte an seinem Rocke, und schob die Mütze über das linke Ohr, als ob er Jemanden erwartete, den seine persönlichen Vorzüge gewinnen sollten.
Eben traten fünf bis sechs Personen aus der Seitenthür der Kirche.
Es war der Notar und seine Frau, ihr Sohn Bruno und ihr bejahrter Diener Jan und dazu der Schulmeister mit seiner Tochter Genoveva.
Die beiden Familien schritten langsam durch die Gruppen, die ihnen voll Ehrfurcht Platz machten und den beiden jungen Leuten eine schmeichelhafte Bewunderung zollten. In den bezeichnenden Blicken, welche die Bauern dabei unter sich austauschten, stand zu lesen:
»Ja, die sind wahrhaftig für einander geboren. Ein schöneres Paar ist auf der ganzen Welt nicht zu finden!«
Derselbe Gedanke stand noch klarer ausgeprägt im Gesichte des Notars und des Schulmeisters, deren Augen in verzeihlichem Vaterstolze froh schimmerten.
Der alte Jan vollends war außer sich vor Freude. Er hielt sich so gerade wie möglich, drehte den Kopf nach allen Seiten und schien einem Jeden mit Stolz zurufen zu wollen:
»Den Jungen habe ich aufgezogen!«
Ihr Weg über den Kirchhof führte sie an Simon vorbei, der mißmuthig dastand und vor Eifersucht zitterte, als er Bruno und Genoveva, Hand in Hand, auf sich zukommen sah.
Der Brauersohn blickte dem Mädchen starr in die Augen« so daß diese den Kopf niederbog und sich fester an ihren Begleiter schmiegte; dann warf er auf den jungen Studenten einen durchbohrenden Blick. Doch der vorbeigehenden Genoveva wollte er sich gefällig zeigen, lächelte ihr entgegen und wünschte recht freundlich einen guten Morgen; das Mädchen aber, ärgerlich und beschämt, kehrte ihr Gesicht von ihm ab und flüchtete sich zu ihrem Vater, der schon auf der Straße stand.
Der alte Diener war über das, was er gesehen« höchst aufgebracht; er stellte sich vor Simon hin, drohte ihm mit der Faust und rief ihm zu:
»Wagt es noch einmal, Ihr ungezogener Trunkenbold!« —
Simon überhörte diese Drohung; mit gesenkten Augen war er gegen die Kirchmauer gelehnt und murmelte einige Worte vor sich hin« welche ihm die blinde Rachsucht eingab.
Doch nach wenigen Augenblicken sprang er auf und sprach zu seinen Gesellen, um sich seines Verdrusses zu entledigen:
»Kommt jetzt, heut soll es lustig hergehen. Trinken dürft Ihr, so viel Ihr wollt. Die Kirmeß ist noch nicht zu Ende; vielleicht bringt sie uns ganz eigene Dinge!«
Und mit seinem Gefolge lief er durch die Menge und stürmte mit wildem Schreien hin zum nächsten Tanzboden.«
Der große Marktplatz im Dorfe wies ein so lärmendes Gewimmel, daß dem unvorbereiteten Zuschauer dabei Hören und Sehen vergehen konnte.
Das Geschrei der Quacksalber, Krämer und Taschenspieler, das Gerassel der Trommeln, das Geschmetter der Trompeten und Waldhörner, der durchdringende Laut der Geigen, das wehklagende Grunzen der Schweine, die zu Hunderten feil standen, der schallende Gesang der Burschen — das Alles verschmolz zu einem anhaltenden Brausen und Sausen, das, aus einiger Entfernung, von einem riesenhaften Bienenkorbe herzurühren schien.
Die Menge wogte auf dem Markte hin und her; der Eine stieß und drängte den Andern, oder schritt ihm unsanft auf die Füße — doch störte das nicht im Mindesten den allgemeinen Ton von munterer und fast ausgelassener Laune.
An der einen Seite, gegen die Kirche zu, entfalteten sich viele Buden, in denen man allerlei Zuckerzeug und Spielereien, Gegenstände für den Hausrath, Wäsche und fertige Kleidungsstücke feil bot. Diese Seite bot im Vergleich zur andern ein Bild von Ruhe und Ordnung; sie wies kaum ein Zeichen des wilden Ungestüms — höchstens taumelte hie und da ein Bauer vor einem pfundeschweren Pfefferkuchen zurück, der ihm aus einer Bude etwas zu derb unter die Nase geschoben wurde.
Die Aeltern Bruno’s und Genoveva’s waren nach dieser Seite hingegangen; einige Zeit lang besahen sie die vielen schönen Sachen, und dann kaufte der Student das kostbarste Gebetbuch, mit Silber beschlagen, um es seiner Freundin zum Andenken an die Kirmeß zu verehren.
Dann wollten sie sich auch gegenüber umsehen und erfahren, was die Quacksalber und Taschenspieler mit ihren lauten Rufen, tollen Sprüngen und eigenthümlichen Gebärden zu verkünden hatten.
Hier war das Treiben ungemein rege; die lärmendsten Possenreißer hatten sich zusammengefunden.
Wo Bruno und Genoveva sich zeigten, räumte man ihnen willig und voll Ehrfurcht die besten Plätze; und obgleich die beiden Familien sich von den Buden ziemlich entfernt hielten, so konnten sie doch Alles ganz bequem sehen und hören.
In der Ecke an der Herberge zum Löwen stand ein Quacksalber in auffallender Tracht, der um den Hals eine Kette von Menschenzähnen trug. Sein Hanswurst stieß in die Trompete und pries die unerhörten Wunderkuren die sein Herr in allen Weltgegenden zu Wege gebracht hatte. Zum Beweis wies er auf große pergamentene Blätter mit rothen Siegeln, welche die unglaublichen Resultate bestätigten — freilich in fremden Sprachen, die Niemand im Dorfe zu lesen oder zu verstehen wußte.
Der Hanswurst war noch mitten in seiner Lobrede, als ein Bauer dazukam, dessen geschwollene Wange zur Genüge verrieth, an welchem Uebel er litt.
»Was habt Ihr denn vor, Sus?« frug ihn der Notar. »Der Kerl wird Euch abmartern!«
»Gleichviel«, entgegnete der Bauer, »länger kann ich’s nicht aushalten. Und wenn er mir auch den Kopf vom Leibe reißen sollte, der Zahn muß heraus!«
Der Quacksalber hatte die arme Beute wohl ersehen, darum rieb er sich die Hände, brachte den Hanswurst zum Schweigen und wandte sich recht würdig an die Leute um ihn« während er seinen Patienten bei den Schultern faßte und ihn näher zu sich zog:
»Meine werten Zuhörer und Zuhörerinnen, Ihr werdet alsbald sehen, daß ich weit über die gewöhnlichen Salbader, Urinbeschauer, Pedikuren u.s.w. stehe, die von der Chirurgie nichts verstehen und nur zu oft ihrem unglücklichen Opfer mit dem Zahne die halbe Kinnbacke ausreißen! Nein, nein, folgt allen meinen Bewegungen, und Ihr werdet Euch überzeugen. daß der berühmte Nicophorus in seiner Kunst ein unerreichter Meister ist!!«
Dabei schob er den rechten Aermel zurück, schnalzte mit den Fingern, setzte den Bauer mit dem Kopf gegen die Lehne eines Stuhles und griff nach einer eisernen Zange:
»Ihr meint wohl, dies Instrument sei aus Eisen oder Stahl? Nun, in meiner Hand wird es zu einer Feder, die nicht im Geringsten schmerzt und das Zahnfleisch ganz leise kitzelt — es hat nicht mehr zu bedeuten« als eine Fliege, die sich auf die Lippen setzt. Bewundert die Gewandtheit des Doktor Nicophorus! Und doch nehme ich nie mehr als sieben Stüber für einen Zahn. Nichts als sieben Stüber! Ich halte ihn fest, ich kriege ihn! Eins, zwei, drei — hier ist er!«
Und er schwang die Zange mit ihrer Beute in die Höhe.
Der Bauer war heulend zu Boden gesunken und lärmte ganz entsetzlich; doch der Hanswurst trompetete noch lauter, und Nicophorus rief im vollen Triumph ein Mal über das andere:
»Ohne Schmerz, ohne den geringsten Schmerz!«
Der Patient wälzte sich und jammerte um Hilfe; die Umstehenden dachten, er thäte er aus Spaß« und lachten aus voller Kehle. .
Doch der Hanswurst, der in dem heftigen Blutverlust des armen Teufels sah, daß Alles nicht recht abgelaufen sei, flüsterte ihm zu, während sein Meister den gaffenden Bauern Wunderdinge erzählte: "
»Schämt ihr Euch nicht, Ihr großer Tölpel, Ihr plärrt ja wie ein Kind! Ihr bildet Euch ein, daß es wehe thut — es ist aber nicht wahr!«
Da hob der Bauer, mit verweinten Augen und verzerrtem Gesichte, die zwei Vorderfinger in die Höhe und wimmerte:
»Zwei Zähne« du lieber Gott, zwei — mit dem schlechten ein ganz guter!«
»So, zwei Zähnezwei Zähne», war die Antwort, »dann macht, daß Ihr fortkommt! Mein Meister fordert sieben Stüber per Zahn — so daß Ihr ihm vierzehn Stüber zu zahlen habt — da hilft Euch kein König! Packt Euch fort — ich will es auf mich nehmen und vorgeben, Ihr hättet mir die ganze Summe bezahlt!«
Das ließ sich der Bauer nicht zweimal sagen und bahnte sich, die Hand vor den Mund haltend« einen Weg durch die Menge, bis er hinter der Kirche verschwand.
»Seht hin«, jubelte Nicophorus, »die Freude bringt den Mann dazu, daß er rennt, wie ein Hase. Ja, der ist geheilt — ich brauchte blos meinen Finger an seinen Mund zu setzen, um ihn im Augenblicke von seinen Schmerzen zu befreien!«
Eine Weile darauf standen Herr und Knecht wieder auf ihren Stühlen und priesen um die Wette ihre Wunderwaaren; doch mit Ausnahme von etlichen Pulvern, die ein langes Leben sicherten und doch nur vier Heller kosteten, war der Absatz nicht bedeutend; auch kehrten sich die meisten Umstehenden von ihm ab und eilten einer nahen Bude zu, in der hitzige Scheltworte auf Streit und Hader deuteten.
Die beiden Familien folgten dem Strome der neugierigen Bauern.
Hier trieb ein Taschenspieler seine Kunststücke. Mit den Muskaten und Bechern hatte er den Bauern schon viel vorgemacht, und verlangte dann einen Franken von Jemandem aus der Gesellschaft.
Ein Knecht aus einem Pachthofe, der zeigen wollte, daß er im Besitze einer silbernen Münze war, die er allmälig abgespart hatte, reichte ihm den gewünschten Franken.
Der Taschenspieler verschluckte sogleich das Geldstück und behauptete dann, daß es dem Bauer in der Nase stecke. Dieser griff zu verschiedenen Malen an seine Nase; doch nach einer viertelstündigen vergeblichen Arbeit überfiel ihn die Angst, sein Franken könne wohl auf immer weggezaubert sein, so daß er in vollem Aerger mit der Faust auf den Tisch schlug und den Taschenspieler einen elenden Gaudieb schalt.
Der Schulmeister, der den Bauer gut kannte, wollte ihn besänftigen und ihm begreiflich machen, daß die Kirmeß einen unschuldigen Scherz wohl billige; aber der Bauer war ganz im Harnisch und bestand darauf, sich an dem Betrüger zu rächen.
Sobald der Taschenspieler hinreichend viel Leute versammelt fand, bat er den ergrimmten Bauer, stille zu stehen, und zog ihm den Franken mit vieler Anstrengung aus der Nase.
Der arme Kerl starrte ganz verblüfft auf das Geldstück und wußte nicht mehr recht, ob der Franken echt geblieben wäre; unterdessen machte ein Knabe mit einer bleiernen Büchse die Runde unter den kichernden Bauern, die nach diesem letzten artigen Stücke ihre kleine Gabe williger reichten.
Doch die Ernte des Taschenspielers war bald zu Ende; die Aufmerksamkeit der Menge wurde von ihm abgelenkt« sobald einige Stimmen froh ausriefen:
»Jantje von Lierre ist mit neuen Liedern da!«
In einiger Entfernung war ein Mann — dem ein Arm fehlte — damit beschäftigt, einige Pfähle in dem Boden festzumachen — dann rollte er vor denselben eine große Leinwand auf, worauf verschiedene Bilder gemalt waren. Auf den meisten konnte man mit Entsetzen Soldaten mit bloßen Schwertern, blutige Leichen und die schreckliche Guillotine erblicken.
Der Liedermann hatte ehemals unter den Patrioten gedient und war in allen Dörfern durch die neuen, schönen Lieder, die er selbst dichtete, rühmlichst bekannt. Seinen rechten Arm hatte er in dem letzten Gefechte der Patrioten, bei Huy, verloren; doch diente ihm noch der Stummel am Ellbogen, denn er hatte daran eine eiserne Hand befestigt und schloß in diese die lange weiße Ruthe, womit er während des Singens auf die Bilder wies.
Die linke Hand rührte geschäftig eine kleine Trommel, die ihm vorn über den Bauch hing.
Hinter der Leinwand stand ein Weib mit einer Geige.
Bald versammelten sich viele Bauern um den alten Soldaten; auch Simon kam mit seinen Gesellen herbei; doch, sei es, daß sie zu viel getrunken hatten, oder den Sänger zu stören beabsichtigten, sie lärmten und tobten, als ob das ganze Dorf ihnen allein gehörte.
Deshalb hielten sich Bruno und Genoveva in ziemlicher Entfernung.
Alle Vorkehrungen waren jetzt getroffen — einige Schläge auf die Trommel luden die Schreier zur Ruhe ein. Dann wies Jan mit dem langen Stabe nach den Bildern in ihrer Ordnung — und sang und sprach dazwischen so durcheinander, daß man sich nicht genug wundern konnte, wie er die Singweise immer wieder so richtig einschlug.
»Ihr lieben Bauern, Bürger und sonstige Menschenkinder, kommt hierher! Der alte Jan ist wieder da und auf Euer Plaisir bedacht, er hat Euch wundersame Historien vorzusingen, darum schließt Euere Ohren und Eueren Beutel auf, aus daß Ihr etwas zu hören, und er etwas zu verdienen bekommt.«
Denn es kündet dies mein Lied Was jetzt in Paris geschieht. Unheilsvolle Neuigkeiten Thun sich durch das Land verbreiten.
»Doch darum müßt Ihr noch nicht zittern, Ihr Bürger und Bauern! Der alte Jan weiß, was er mit sich führt; die Sache ist wohl erschrecklich, aber »Ende gut, Alles gut, werdet Ihr zuletzt mit mir sagen.«
Unheilsvolle Neuigkeiten Thun sich durch das Land verbreiten, Wie die Sünd’ und Missethat Gottes Hand erreichet hat. ’s gilt dem Chef der Sanskulotten, Der des Himmels wagt’ zu spotten, Und das Beil, das nimmer ruht, Tränkt mit guter Menschen Blut.
»Ja, liebe Bürger und Bauern, hier seht Ihr, wie Marat im finstern Walde von einer Hexe auferzogen und mit Wolfsmilch genährt wird; weiter, wie er mit einem ungeheuren Messer seinen eigenen Vater verfolgt; weiter, wie er an der Spitze der rasenden Jakobiner die Gefangenen erwürgt; seht den Schelm, der bis an die Knie im Blute watet und seinen Gesellen immer zuruft: »Noch mehr! noch mehrt«
»Dumme Lügen,« unterbrach Simon, »was wollt Ihr den Dorflümmeln wieder weismachen, die so schon an Verstand nicht zu reich sind!«
»Wer mich nicht gerne hört, darf fortgehen!« schob der Sänger ein.
»Die Hexe, und die Wolfsmilch und das Blutbad bis an die Knie sind trefflich angebracht,« fuhr Simon fort. »Es sollte mich wundern, wenn nicht der leibhaftige Teufel daraus würde!«
Statt aller Antwort zeigte der Sänger ein Blatt und sprach mit Festigkeit: »Hier steht es schwarz auf weiß gedruckt.«
Und ohne sich weiter stören zu lasse, sang er weiter:
»Vor Marat, dem Bösewicht, Frankreichs Volk zu Füßen liegt. Hunderte läßt dieser hängen, Köpfen« ersäufen und versengen.
»Hier könnt Ihr den Schurken Robespierre . . . «
Bei diesem verhaßten Namen machte die Mehrzahl der Umstehenden ein Zeichen des Kreuzes.
»Hier, sage ich könnt Ihr den Schurken Robespierre sehen, bei dem sich Marat mit Unmuth erkundigt, warum die Guillotine diesen Morgen während einer ganzen Stunde hat rasten müssen.
»Spricht zum Teufel Robespierre: ’s geht die Guillotine nicht mehr! Hunderttausend Menschenleben Müssen wir dem Beil noch geben, Und ich spreche: Es genügt.
»Erlogen, erlogen!« schrie Simon.
»Könnt Ihr denn nicht still bleiben, Ihr verlaufener Sanskulott! — Daß Euch das Donnerwetter —
»Ja, meine lieben Bürger und Bauern, seht, wie selbst dem Robespierre das Ding etwas unheimlich wird — Marat meint: wenn wir die ganze Welt umbringen, bis auf zwei, so bleiben wir dann sicher die Herren.
Und ich spreche: Es genügt, Wenn im Sack die Menschheit liegt.
Seht das Mädchen, reizend schön — Jetzt thront sie in lichten Höh’n — Will recht gern ihr junges Leben Gott und ihrem Volk hingeben . . .
»Hier seht Ihr die Jungfrau am Spinnrad sitzen; ein großes Messer liegt zu ihren Füßen — weiter findet Ihr sie wieder, wie sie das Messer unter dem Halstuch verbirgt, ihren kleinen Reisebündel schnürt und von ihren armen Aeltern Abschied nimmt.
Will recht gern ihr junges Leben Gott und ihrem Volk hingeben, Zieht, ein großes Messer in der Hand,
Nach Paris« durch’s ferne Land.
»Jetzt klopft sie an Marats Thür, wie hier zu sehen.
’s fragt die Magd des blut’gen Helden, Wen sie ihrem Herrn sollt’ melden. Weither komm’ ich« heiß’ Cordav, Rett’ Euern Herrn vor sicherm Weh.
Und der Wütherich Marat, Der lag eben in dem Bad, Menschenblut war’s, sinteweilen, Dies kann jede Krankheit heilen.Lotte kommt, es fragt Marat, Was sie ihm zu sagen hat?
»So ist das Mädchen bei dem Henker vorgelassen und findet ihn in seinem Bad aus Menschenblut; um sich eine Gelegenheit zu ihrem Vorhaben zu verschaffen« will sie sich über die Einwohner ihrer Stadt beklagen, worauf Marat sich dahin ausspricht, die ganze Stadt müsse ein Opfer des Todes werden.
Meine Stadt, so spricht Charlotte, Lebt gen Staat und Kirch’ im Spotte — Marat denkt nicht her noch hin: Alle auf die Guillotin’!
»Das konnte die reine Jungfrau nicht ertragen; sie zieht ihr Messer heraus, wie es hier abgebildet steht.
Lotte ruft: Die ganze Stadt? Bluthund, stirb in deinem Bad! Weiter hat sie nichts gesprochen, Ihm das Herz im Leib’ erstochen. Marat fällt, schreit ohne Maß Nach Rob’spierre, dem Satanas — Marats Seele, sonder Zweifel, Ist geborgen bei dem Teufel!
»Der Lärm zog die Jakobiner herbei, die das Mädchen in Stücke reißen wollten; erst auf Robespierre’s Dazwischenkunft haben sie sie in Fesseln geschlagen und nach dem Gefängnis geschleppt. Seht her, wie grausam sie mit der armen Corday umgehen!«
»Sie hat es auch wohl verdient«, jubelte Simon, »die Creatur, die sich in Anderer Häuser schleicht, um sie umzubringen!«
»Ihr Wollt die hehre Jungfrau doch nicht angreifen«, rief der Sänger voll Entrüstung.
»Ich nenne sie nicht bei ihrem rechten Namen,« war die Antwort, »das Wort ist allzu häßlich!«
»Es wäre Euch wohl lieber, wenn ich dem Robespierre und seinen Jakobinern ein Loblied sänge! Doch seit den drei Monaten, wo Ihr, die rothe Mütze auf dem Kopf, im Sanskulotten-Club in Brüssel haustet, sind die Zeiten, Gottlob, anders geworden, mein frecher Junge!«
»Diese Anspielung schien dem Brauersohne ungelegen zu kommen, um so mehr, da sich die Bauern von ihm scheu entfernten, als ob er mit der Pest behaftet wäre.
»Laßt den Bänkelsänger in Frieden, fuhr der alte Soldat fort, er weiß mehr von Euch, als Ihr vermuthet, und Ihr könntet es bereuen, ihn in seinem ruhigen Broterwerb gestört zu haben!«
Simon murmelte etwas zwischen den Zähnen, blickte mit grimmen Augen auf den Sänger und wies ihm die geballte Faust:
»Ich werde Euch wohl noch zu treffen wissen!«
Nach dieser Drohung ging er mit stolzen, gemessenen Schritten in die Herberge zum Löwen.
Der Sänger verfolgte seine Weise« als ob nichts vorgefallen wäre.
Und das Volk« voll Raserei Schleppt Charlot’ in die Abtei.
Und es wurde laut geschrie’n: Sie muß auf die Guillotin’. Hierauf ziehen die Scheusale Lotte fort zum Tribunale.
»Hier seht ihr das Tribunal, wo Robespierre das Urtheil spricht, weiter den Karren, auf dem das Mädchen; weiter die Ausgeburt der Hölle, Guillotine genannt. Die arme Charlotte schreitet entschlossen hinauf und hat die Augen zum Himmel gewendet.
Lotto steigt zur Guillotin’ Kehrt zum Herren Aug’ und Sinn! ’s Messer fällt, das Haupt rollt nieder . . .
Die Heldin stirbt — stirbt wenigstens für diese Welt — doch wir wollen hoffen, geliebte Zuhörer, daß sie oben in alle Ewigkeit lebt.
’s Messer fällt, das Haupt rollt nieder, Gott gibt sie ihr Leben wieder — Das Schafott trieft, von Blute roth — Vivat Lotte, Marat ist todt!2
Das Lied, das nun zu Ende war, schien auf Genovevas Gemüth einen tiefen Eindruck gemacht zu haben, und sie war noch in ihre Gedanken versunken, als sie schon an die fernsten Buden des Marktes gelangt war, wo man Waffeln und Zuckerzeug verkaufte. Mit einem Male wandte sie sich an ihren Begleiter:
»Bruno, hat Charlotte Corday gut oder schlecht gehandelt?«
»Dieselbe Frage stellte ich eben mir«, antwortete der Student.
»Und wie ist Euer Urtheil ausgefallen?«