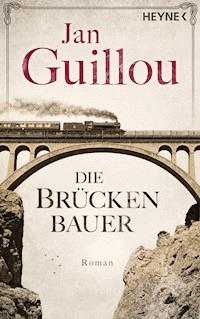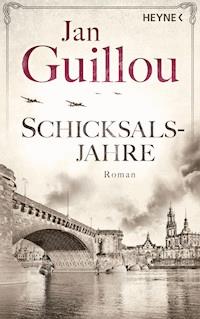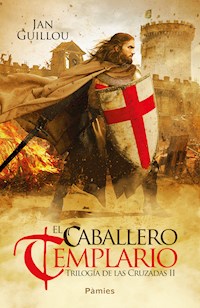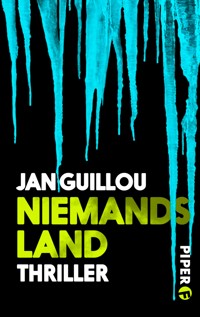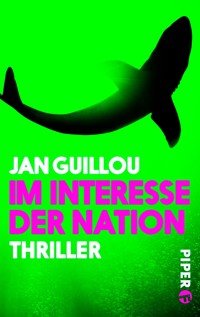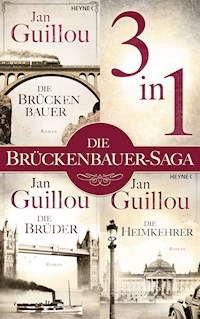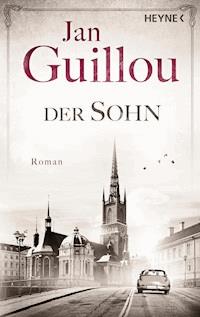
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brückenbauer-Serie
- Sprache: Deutsch
»Einer der besten und unterhaltsamsten Romane, die Jan Guillou je geschrieben hat.« Dagens Nyheter
Schweden in den 1950er-Jahren: Eric, der Enkel von Oscar Lauritzen, lebt mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder Axel im vornehmen Stockholmer Vorort Saltsjöbaden. Er führt das behütete Leben der Oberschicht, fernab von aller Armut und Not. Als Erics Vater sich als ungeeignet erweist, das riesige Familienimperium Lauritzen zu übernehmen, fällt die Wahl auf den jungen Eric. In den Augen seines Großvaters besitzt er den nötigen Ehrgeiz, den eine solche Position verlangt. Eric setzt fortan alles daran, den Ansprüchen zu genügen, doch ein tragisches Ereignis zerstört alle Pläne. Plötzlich mittellos geworden, muss Eric seinen Weg finden. Doch er wäre kein echter Lauritzen, wenn ihm das nicht bravourös gelänge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jan Guillou
DER
SOHN
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Zum Buch
Der junge Eric, Enkel von Oscar Lauritzen, lebt mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder Axel im vornehmen Stockholmer Vorort Saltsjöbaden. Erics Vater ist Pianist und zeigt wenig Geschick für die Leitung des riesigen Familienunternehmens Lauritzen. So fällt die Wahl auf Eric. Sein Großvater sieht in ihm den geeigneten Erben für das Lebenswerk.
Fortan verbringen sie viel Zeit miteinander, in der Oscar Lauritzen seinen Enkel mit dem Unternehmen vertraut macht. Doch ein tragischer Zwischenfall verhindert die geplante Übergabe des Imperiums.
Die Familienvilla wird verkauft, und Eric und seine Familie ziehen nach Stockholm. Die Trennung der Eltern, in deren Folge Erics Mutter plötzlich mittellos dasteht, ist eine weitere Tragödie. Doch Eric Lauritzen verzweifelt nicht und bietet dem Schicksal stolz die Stirn.
Zum Autor
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Autoren seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Äkta Amerikanska Jeans bei Piratförlaget, Stockholm
Copyright © 2016 by Jan Guillou
Copyright © 2018 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel/punchdesign, München
Umschlagabbildung: © Johannes Wiebel unter Verwendung
von Motiven von shutterstock.com
Redaktion: Maike Dörries
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-17314-2V002
www.heyne.de
1953
DER NAGELNEUE CADILLAC
Als ich erfuhr, dass Stalin gestorben war, rannte ich in Tränen aufgelöst zu Mama nach Hause.
Johan und ich waren nach der Schule in den Wald hinter Igelboda gegangen, weil er mir auf einem sonnigen Hang, auf dem der Schnee fast geschmolzen war, einen Ameisenhaufen zeigen wollte, in dem die Ameisen bereits aus ihrem Winterschlaf erwacht waren. Was wir mit den Ameisen gemacht haben, ist mir entfallen, vermutlich etwas, woran man sich lieber nicht erinnerte.
Wie gewohnt vertrödelten wir die Zeit und beschlossen daher, mit der Vorortbahn schwarz nach Hause zu fahren, Johan zwei Haltestellen, ich drei.
Am Bahnhof Igelboda verkündete eine Schlagzeile auf der Titelseite des Aftonbladet die erschütternde Neuigkeit. Zwei Worte, in großen schwarzen Lettern:
STALIN TOT
Zutiefst erschüttert schlichen wir in den ersten Waggon. Wir sprachen kaum, aber was hätten zwei Neunjährige auch groß dazu sagen können? Mit gesenkten Köpfen saßen wir da und dachten an den großen Mann mit dem markanten Blick und buschigem Schnurrbart. Solange Johan neben mir auf der schmalen, halb verborgenen Holzbank gleich hinter der Lokführerkabine saß, konnte ich mich beherrschen. Aber als er am Ringvägen ausstieg, konnte ich die Tränen nicht mehr aufhalten, was mir unsäglich peinlich war. In meiner Familie wurde nicht geweint, schon gar nicht als Junge.
Als Mama mich beim Eintreten besorgt fragte, wo ich gewesen sei, schlang ich meine Arme um sie, drückte mein Gesicht an ihre Brust und erzählte ihr schluchzend die fürchterliche Neuigkeit.
Sie schien meine Trauer nicht nachvollziehen zu können und sagte zu meiner Erschütterung, das sei auch höchste Zeit gewesen. Und dass kein Junge aus gutem Hause deswegen Tränen vergießen müsse. Wie käme ich denn nur darauf, mir darüber meinen süßen kleinen Kopf zu zerbrechen?
Als ich ihr zu erklären versuchte, dass ich ihn so unglaublich komisch gefunden hätte, wenn er von einer Polizistenhorde mit erhobenen Schlagstöcken gejagt wurde, reagierte Mama für mich noch unbegreiflicher als vorher. Sie lachte glucksend und dann für eine Mutter geradezu ungehörig schallend, ehe sie mich umarmte und mir über die Wangen strich, meine Tränen wegküsste und erneut lachte.
»Mein geliebter Junge«, sagte sie fröhlich, nachdem sie sich etwas gefasst hatte. »Du denkst an Chaplin, und der ist quicklebendig. Von Stalins Tod habe ich im Radio gehört, als du in der Schule warst, und seinetwegen musst du wirklich keine Träne vergießen.«
Meine Verwirrung und Erleichterung waren enorm. Trotzdem erstaunte es mich, dass man sich über einen Todesfall so amüsieren konnte.
Aber wer war dann eigentlich gestorben, wenn nicht Chaplin?
Ich erinnere mich nur diffus an Mamas Antwort. Politik gehörte für mich zu den drei Dingen, über die nicht einmal die Erwachsenen beim Sonntagsessen in der großen Villa sprachen. Die beiden anderen Themen waren Geld und Krankheiten.
Jetzt, fünfzehn Jahre später, verschmilzt die höchst unzuverlässige Erinnerung an die Antwort meiner Mutter mit reinen Mutmaßungen zu einer Rekonstruktion dessen, was sie in Anbetracht ihrer persönlichen Einstellung geantwortet haben könnte.
So könnte sie gesagt haben, Stalin sei der Führer aller Kommunisten der Welt gewesen, die noch schlimmer waren als die Sozis.
Dass die Sozis etwas ganz Schreckliches waren, wusste ich. Sie wollten uns unseren gesamten Besitz wegnehmen, alles was Großvater Oscar und seine Brüder aufgebaut hatten, und außerdem noch unsere Autos und Boote. In dieser Hinsicht waren die Sozis sogar noch schlimmer als die Engländer. Aber wer diese Sozis genau waren, war mir nicht ganz klar. Bei uns in Saltsjöbaden gab es jedenfalls keine. Wahrscheinlich tummelten sie sich in Stockholm. Oder in Norrköping.
Dass Stalin schlimmer als die Sozis und die Engländer zusammen sein sollte, überstieg mein Vorstellungsvermögen. Über Kommunisten wusste ich, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen musste. Sie waren Spione, schlimmer ging’s nicht, obwohl ich keine Ahnung hatte, womit sich ein Spion exakt beschäftigte. Offenbar bestand da ein Zusammenhang zwischen Spionen und den Leuten, die unsere Flugzeuge abschossen. Harry kam oft auf dieses Thema zu sprechen. Immerhin waren eine DC 3, unsere »zivile Maschine zur Wetterbeobachtung« und das Seerettungsflugzeug Catalina von den Russen abgeschossen worden.
Heute, fünfzehn Jahre später, wissen wir, dass die DC3 Spionageflugzeuge in Diensten der USA waren. Die allgemeine Ahnungslosigkeit jener Zeit lässt sich kaum nachvollziehen, bei einem Neunjährigen wie mir war sie eventuell noch verzeihlich.
Nach dem Abendessen verpasste Harry mir eine heftigere Tracht Prügel als üblich, schließlich gab es diesmal einen triftigen Grund: Ich war unentschuldigt zu spät nach Hause gekommen.
Es ist psychologisch interessant, dass dieser Mann für mich immer nur »Harry« war, nie »Papa«, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, dass er nur mein Stiefvater war. Ich schämte mich für ihn, weil er nicht wie andere Väter war. Meine Klassenkameraden wurden nie von ihren Vätern geschlagen, ich hingegen bezog jeden Tag nach dem Essen Prügel, und dafür schämte ich mich ebenfalls.
Die Prügel nach dem Essen erfolgten so regelmäßig, dass ich sie als selbstverständlich und gegeben hinnahm. Und dass sie an diesem Abend ausgiebiger ausfielen, fand ich nicht weiter erwähnenswert, schließlich war ich zu spät gekommen.
Wären wir zu Johan nach Hause gegangen, um Monopoly oder das Brio-Labyrinthspiel zu spielen, hätte ich zu Hause anrufen und Bescheid geben können, aber beim Ameisenhaufen hatte es kein Telefon gegeben.
Trotzdem ging ich an jenem Abend mit einer gewissen Erleichterung zu Bett, obgleich ich auf dem Bauch liegen musste, weil Rücken und Hintern brannten, und freute mich, dass Chaplin lebte!
Die Schmerzen waren nicht der Grund, dass ich dennoch nicht schlafen konnte. Mir graute vor dem nächsten Tag – der Autos wegen.
Autos haben Gesichter. Ein Volvo PV444 sieht freundlich und gemütlich aus mit seinem breiten lächelnden Kühlergrill aus Chrom. Der amerikanische Wagen hingegen sah aus wie ein Schwertwal mit weit auseinanderstehenden Raubtieraugen und einem schreckenerregenden Rachen mit zwei Reihen blitzender Zähne. Von vorne betrachtet wirkte das schwarze Monster lebendig, bereit, sich jeden Augenblick mit aufgerissenem Maul nach vorne zu stürzen und alles, was in seine Bahn geriet, zu verschlingen.
Anders und Johan hatten mir ewig in den Ohren gelegen, bis ich mich breitschlagen ließ, ihnen die Autos in unserer Garage zu zeigen. Anders interessierte sich brennend für Autos, er sprach über fast nichts anderes und schien alles darüber zu wissen.
Ich hatte irgendwie eine Ahnung, dass die Autos einem verbotenen Bereich angehörten, ohne genau benennen zu können, worin das Verbot bestand. Darüber wurde nicht gesprochen. Die meisten Familien in Saltsjöbaden besaßen damals bereits ein Auto, manche Väter fuhren morgens damit in die Stadt, obwohl die Bahn viel schneller war.
Da waren auf der einen Seite das unausgesprochene Verbot und auf der anderen Seite meine übereifrigen Klassenkameraden, die mir das Gefühl vermittelten, die Garage berge ein großes Geheimnis.
Der Schultag verging rasch, den wir in meiner Erinnerung komplett mit Eishockeyspielen verbrachten. Der Eishockeyplatz und die Schlittschuhbahn lagen direkt neben dem Schulgebäude. Obwohl das Eis bereits Risse hatte, behielten wir die Schlittschuhe mit Holzschienen unter den Kufen während des Unterrichts an. Sobald es zur Pause klingelte, zogen wir die Schnürsenkel fester und eilten aufs Eis. Die Jungs mit Eishockeyschlittschuhen, die Mädchen mit weißen Kunstlaufschlittschuhen.
Erst vor wenigen Tagen hatten wir unsere Fahrräder aus den Kellern geholt. Auf den unbefestigten Straßen lag noch stellenweise Eis, aber lieber nahmen wir in Kauf hinzufallen, als den langen Weg nach Hause zu laufen. So konnten wir nach einer Viertelstunde unsere Räder vor der Garage parken.
Mit einem mulmigen Gefühl öffneten wir die schweren Torflügel und zogen sie schnell wieder hinter uns zu. Die Fenster waren staubbedeckt, in der Garage herrschte Dunkelheit, und es dauerte eine Weile, bis sich unsere Augen darauf einstellten. In der Mitte, direkt vor uns stand der Schwertwal mit seinem bedrohlich funkelnden Rachen.
Anders stieß einen Zweifingerpfiff aus.
»Donnerwetter!«, rief er, trat auf das Auto zu und kickte fachmännisch gegen einen der Weißwandreifen. »Ein 1953er mit V8-Motor, mindestens 160 PS. Darf ich mir mal den Motor anschauen?«
Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf geantwortet habe, wusste ich doch knapp, wie man auf die Rückbank gelangte. Aber Anders kannte sich aus und hatte im Handumdrehen die Motorhaube aufgeklappt und auf die Stützstange gelegt. Dann erklärte er mir die Konstruktion eines V8-Motors, zeigte mir die Zylinder, Zylinderköpfe und Ventile und erläuterte, warum der Ölfilter amerikanischer Autos so viel größer war als der schwedischer.
Wir testeten die weiche, blaulederne Vorderbank, Anders hinter dem großen, elfenbeinfarbenen Lenkrad. Nach einer Weile wechselten wir auf die Rückbank. Mit ausgeklappten Notsitzen ließ sich hier eine halbe Fußballmannschaft unterbringen. Zwischen den beiden Notsitzen befand sich eine Mahagonischatulle mit zwei Kristallkaraffen und vier Gläsern. Der braunen Farbe nach zu urteilen, enthielt die eine Karaffe vermutlich Cognac.
Den Volvo PV begutachtete Anders mit einer gewissen Herablassung. Das etwas ältere Modell war mit einem Fixlight auf dem Dach ausgestattet, das dem sicheren Abbiegen diene, indem zuerst ein blaues Licht die Aufmerksamkeit nachfolgender Fahrer wecke und anschließend ein orangefarbenes Licht die Richtung angebe, dozierte Anders, um gleich hinzuzufügen, wie lausig diese Konstruktion sei, da Wasser eindringen könne. Daher gehörten Fixlights der Vergangenheit an. Der Wagen habe aber noch ein größeres Manko. Wenn man nämlich zum Überholen beschleunigte, setzten die Scheibenwischer aus, was bei Regen ein verdammtes Problem darstellte. Außerdem habe die Karre verglichen mit den 160 des Cadillacs nur schlappe 44 PS.
Der staubige und lange nicht mehr gefahrene Volvo war damit nicht weiter von Interesse. Inzwischen hatten sich unsere Augen ausreichend an das Dunkel in der Garage gewöhnt, dass wir hinter einem Stapel Reservereifen den langen, mit einer schweren grauen Plane abgedeckten Wagen erkennen konnten.
»Das muss der Wagen sein, von dem alle reden«, sagte Anders und ging schnurstracks auf das Auto zu. Er packte die Plane an der rechten vorderen Ecke.
»Helft mir!«, kommandierte er eifrig. »Wenn wir die Plane runterkriegen, kriegen wir sie auch wieder drauf!«
Mit einiger Mühe enthüllten wir das große Geheimnis.
Der Anblick verschlug uns die Sprache. Das riesige schwarze Ungeheuer glich keinem anderen Gefährt, das wir je gesehen hatten. Die silbernen Scheinwerfer glänzten mit den Trägern des Klappverdecks um die Wette. Statt der üblichen zwei Seitenscheiben hatte es drei. Auf der Kühlerhaube prangte ein dreizackiger Stern in einem Kreis.
Anders fasste sich als Erster wieder.
»Donnerwetter, ein Hitler-Schlitten!«
Er machte sich daran, die Kühlerhaube zu öffnen. Es dauerte eine Weile, bis er einsah, dass dies nur von der Seite und nicht von vorne möglich war.
Der Motor war noch größer als der in der Amikarre. Anders zählte zwölf Zylinder, hatte aber keine Ahnung, wie viele PS das bedeutete. Er gab zu, noch nie einen Hitler-Schlitten mit eigenen Augen gesehen zu haben, und hatte keinen Schimmer, warum diese Autos so genannt wurden.
Der Fond mit den zwei sich gegenüberliegenden Bänken war geräumiger als im Amischlitten. Dazu kamen zwei Notsitze, die unter dem zusätzlichen Seitenfenster heruntergeklappt werden konnten. Die Ledersitze waren nicht blau, sondern schwarz bezogen.
Die Plane wieder über das geheimnisvolle Auto zu ziehen war gar nicht so einfach. Ehe wir uns aus der Garage schlichen, verwischten wir unsere Fußabdrücke im Staub und schworen einander, niemandem etwas davon zu erzählen.
Draußen fiel Schneeregen. Im Silbertannenwäldchen oder oben bei der Grotte Cowboy und Indianer zu spielen stand nicht zur Debatte. Stattdessen lud ich meine beiden Freunde in das große Haus ein und bat eines der Dienstmädchen, uns heißen Kakao und Zimtschnecken zu bringen.
Die beiden schafften es, das Geheimnis fast vierzehn Tage für sich zu behalten, und ich glaubte schon, die Gefahr sei gebannt und die Besichtigung der Garage vielleicht doch kein Vergehen.
Das war ein großer Irrtum. Im Dorf werde getratscht, sagte Harry, als die Züchtigung nach dem Essen nahte. Wieder mit Zusatzration. Da ich ohnehin aufgeflogen war, nutzte ich die Gelegenheit, ihn zu fragen, was eigentlich mit Hitler-Schlitten gemeint war. Das war eine dumme Idee, denn dieses Wort war tabu. Die Zusatzration für das unerlaubte Betreten der Garage wurde um fünf weitere Schläge erhöht.
Das reichte, dass ich anschließend an mehreren Stellen blutete. Was lästig war, weil die Wunden mit dem Schlafanzugstoff verklebten, was morgens beim Ausziehen zu neuen Blutungen führte.
Ich erinnere mich mit erstaunlicher Deutlichkeit an diese Nacht. Durch das offene Fenster drang der Duft des Frühlings, und ich schlief erst im Morgengrauen zum vorsichtigen Gesang der Kohlmeisen ein. Aber nicht die Schmerzen waren der Grund für meine Schlaflosigkeit, da hatte ich schon Schlimmeres erlebt, sondern die plötzliche und unerklärliche Erinnerung an Snorre, den Seehund.
Kein anderes Buch hat mich in meiner Kindheit so beeindruckt, nicht einmal die Geschichte über die Wichtelkinder, die auf dem Rücken dreier kleiner Fledermäuse durch die nordische Sommernacht fliegen.
Bevor ich selber lesen lernte, las mir Mama immer eine Gutenachtgeschichte auf Norwegisch vor, meistens aus »Snorre, der Seehund«. Ich konnte es, trotz gründlicher Suche, nicht mehr finden. Wie »Grimms Märchen« war es verschwunden. Das lag vermutlich daran, dass die Erwachsenen manche Bücher für Kinder für ungeeignet hielten. Johan beispielsweise besaß mehrere Bücher über Pippi Langstrumpf, die bei uns verboten waren.
Der Grund dafür war nur unschwer zu erraten. Pippi Langstrumpf war frech, pfiff auf die Anweisungen der Erwachsenen und gehorchte nicht einmal der Polizei.
Aber warum Snorre, der Seehund?
Die wunderschönen Illustrationen begleiteten mich in meine Träume, und ich flog bis zum Eismeer, wo Snorre auf dem Eis lag und mit großen runden Seehundaugen zum Himmel schaute, an dem das gleißende Nordlicht wogte. Er träumte sich wie ich aus seiner Welt fort, obwohl überall Gefahren lauerten. Sein schlimmster Feind war der Schwertwal, der seinen Vater gefressen hatte. Seitdem hatte er nur noch seine Mutter, die ihn sehr liebte und nie schlug, nicht einmal, wenn er etwas ausgefressen hatte.
Es musste der Cadillac sein, der die Erinnerung an Snorre, den Seehund, geweckt hatte. Der Amischlitten, der von vorne wie ein Schwertwal aussah und hinten Flossen hatte.
Die Bilder gingen mir nicht aus dem Kopf und kehrten in dieser durchwachten Vorfrühlingsnacht überdeutlich zurück. Snorres tröstende Mutter mit ihren lieben Augen, der Eisbär mit dem heimtückischen Blick und der Walrossonkel, der an Großvater Oscar erinnerte. Alle traten sie aus den vergessenen Winkeln der Kindheit hervor, als hätte Mama am Abend auf meiner Bettkante gesessen und mich mit Snorre über die ungewöhnlich zahlreichen Schläge hinweggetröstet. Natürlich wusste sie, dass es mein Lieblingsbuch war. Vielleicht barg die Geschichte von der liebenden Seehundmutter und dem aufgefressenen Vater ja eine geheime Botschaft. Aber diese Art freudscher Interpretation war einem Neunjährigen sicher nicht gegeben.
Die Wichtelkinder, Snorre und die unerzogene Pippi Langstrumpf hatte ich als Neunjähriger hinter mir gelassen. Inzwischen wurde meine Fantasie von Prinz Eisenherz dominiert.
Als Kind hatte Onkel Hans Olaf jahrelang jede Woche die Prinz-Eisenherz-Comicseite aus Hemmets Journal ausgeschnitten und in mühsamer Kleinarbeit in Alben geklebt. Eine wahnsinnige Geduldsarbeit, aber das Ergebnis war fantastisch. Was Onkel Hans Olaf in einem Jahr zusammengetragen hatte, las ich an einem Abend. Prinz Eisenherz, der Norweger, sprach fließend Englisch, sobald er seinen Dienst als Knappe bei Sir Gawain antrat. Genau wie mein Cousin Peter, der in Schottland lebte und Prinz Eisenherz mindestens so sehr verehrte wie ich. Peter und ich trafen uns nur an Weihnachten und bei Familienfeiern und hatten immer sofort ein Gesprächsthema. Die Erinnerung an Prinz Eisenherz war mindestens so deutlich wie die an Snorre, den Seehund, oder an die Wichtelkinder. Bestimmte Dinge blieben im Gedächtnis haften, vermutlich wegen der Bilder: Die Wichtelkinder auf den Rücken der Fledermäuse, Snorre auf dem Eis unter dem Nordlicht und der über den entsetzten Raubrittern schwebende, als Dämon verkleidete Prinz Eisenherz.
Die Erinnerung an Snorre löste in dieser schlaflosen Frühlingsnacht eine Kettenreaktion aus.
Auf dem Schulweg am nächsten Morgen fielen mir die Namen des Schwertwals und des Eisbären wieder ein.
Ich schob mein Fahrrad die erste steile Anhöhe des Källvägen hoch, um den kleinen Frühlingsbächen, die sich im weichen Sand gebildet hatten, auszuweichen und keinen Sturz zu riskieren. Mich auf dem Heimweg schmutzig zu machen war nicht so schlimm, zu Hause konnte ich mich umziehen, aber in der Schule in Saltsjöbaden war saubere und ordentliche Kleidung angesagt, hier lebten ordentliche Menschen. Anders als in Norrköping.
Ich habe lange nicht mehr an Norrköping gedacht. Wie die alten Kinderbücher war die Stadt in Vergessenheit geraten. Aber jetzt kehrten die Bilder zurück.
Das grüne Wasser des Schwimmbades, stämmige Frauen, die die Erstklässler einen nach dem anderen am Genick packten, den so Gefangenen in einen großen Holzbottich mit Zinkbeschlägen tauchten und dort mit der Wurzelbürste abschrubbten, bis die Haut krebsrot war. Klassenkameraden, die nicht schwimmen konnten. Ich, vom Schwimmunterricht befreit, im tiefen Becken schwimmend, während die anderen mit Schwimmgürteln aus Kork im Schneidersitz Trockenübungen absolvierten. Sie waren Stadtkinder und wohnten weit weg vom Meer. Sie hatten es nicht so gut wie die Kinder aus Saltsjöbaden und Sandhamn, die bereits mit fünf Jahren schwimmen lernten. Ohne Pardon warf Großvater alle Lauritzen-Kinder vom Steg ins Wasser. Die Wassertemperatur war ihm gleichgültig. Für einen echten Lauritzen war Schwimmen so selbstverständlich wie Segeln.
Immerhin haben wir in Norrköping schön gewohnt, neben der Reichsbank und dem Rathaus mit seinem in den Himmel ragenden Turm.
Harry hatte eine von Großvaters Fabriken übernommen, ließ sich mit Herr Direktor ansprechen und fuhr ein rotes Auto mit Klappverdeck, wenn auch nur einen englischen Austin A 90 Atlantic, was Großvater vermutlich nicht gefiel. Harry behauptete, er habe 90 PS und fahre 160 Stundenkilometer, was sich am Tachometer ablesen ließ.
Anders an Norrköping war, dass es dort nicht nur normale Menschen wie in Saltsjöbaden gab. Auf der anderen Seite des Flusses in der Gegend von Tuppens Baumwollspinnerei wohnte ein anderer Menschenschlag. Mama hatte mir verboten, über die Brücke zu gehen.
Nach einiger Zeit lockerte sie dieses Verbot ein wenig, da der Vater meines Klassenkameraden Lasse der Direktor der Baumwollspinnerei war. Um Lasse zu besuchen, war es mir gestattet, über die Brücke auf die andere Seite des Flusses zu gehen, und auch ich durfte Lasse nach Hause einladen.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis mich das Brückenverbot in Schwierigkeiten albtraumhafter Dimensionen bringen sollte.
Jane aus meiner Klasse, die ihren Namen Jén aussprach, hatte mich zu sich nach Hause eingeladen.
Sie war bereits einmal bei mir gewesen, und wir hatten im Spielhaus auf dem Hof Doktor gespielt. Jetzt also war sie mit der Gegeneinladung an der Reihe, an sich eine ganz natürliche Entwicklung.
Aber sie wohnte auf der anderen Seite des Flusses.
Ich konnte die Einladung unmöglich ablehnen. Wie hätte ich ihr erklären sollen, dass mir Mama verboten hatte, über den Fluss zu gehen. Den wahren Grund kannte ich ja selbst nicht. Die Strudel des Flusses waren zwar gefährlich, aber die Gefahr hineinzufallen äußerst gering. Besuche bei Jane konnten also kaum gefährlicher sein als bei Lasse.
Die Gefahr aufzufliegen war gering. Einmal war keinmal, und niemand würde etwas erfahren.
Ganz alleine die verbotene Brücke zu überqueren war unsäglich aufregend. Die Schornsteine qualmten, und alle roten Backsteinhäuser sahen gleich aus. Auf den Straßen waren Schulkinder auf dem Heimweg, aber keine Erwachsenen zu sehen.
Jane wohnte vier Blocks von der Brücke entfernt in einem der mehrgeschossigen Backsteinhäuser ohne Fahrstuhl.
In der dritten Etage angekommen, holte ich tief Luft und beschloss, mich wohlerzogen zu verhalten. Auf diese Weise nahm der Albtraum seinen Anfang, und was bis dahin spannend gewesen war, wurde unheimlich.
Mit Entschiedenheit trat ich auf die Herrin des Hauses zu, die neben einer Zinkspüle stand und gerade den Spirituskocher anzündete. Ich machte einen Diener, stellte mich als Eric Lauritzen vor und teilte ihr mit, dass Jane mich eingeladen hatte.
Janes Mutter sah mich wortlos an.
Ich schlug vor, dass wir uns in Janes Zimmer zurückziehen könnten, um unsere Hausaufgaben zu erledigen.
Die Mutter musterte mich skeptisch und sagte etwas mir Unverständliches, was wahrscheinlich an ihrem Dialekt lag. Sie deutete auf eine Holzbank am anderen Ende der Küche. Dort nahmen wir nebeneinander Platz und schlugen die Fibel auf, die mit dem Satz begann: »Vater rudert, Mutter ist lieb.«
Während ihre Mutter Hering briet, flüsterte mir Jane zu, dass sie kein eigenes Zimmer habe, der zweite Raum in der Wohnung sei das Schlafzimmer ihrer Eltern. Sie schien sich zu schämen, und ich bereute schon, die Einladung angenommen zu haben.
Aber es wurde noch peinlicher, als ihr Vater, ihr großer Bruder und ein Onkel eintrafen.
Ich erhob mich, wollte sie begrüßen und mich vorstellen, erhielt aber nur Gelächter und Kopfschütteln zur Antwort.
Die Situation war mir unbegreiflich.
Nacheinander wuschen sich die Männer an der Spüle mit kaltem Wasser das Gesicht und unter den Achseln.
Dann gab es Abendessen – gebratenen Hering und Salzkartoffeln. Obwohl ich der Gast war, durfte ich mich nicht gleich bedienen, aber ich war ja auch nur ein Erstklässler.
Ich riss mich zusammen, um mich nicht noch mehr zu blamieren. Wie die anderen nahm ich nur einen Hering, aber weniger Kartoffeln.
Zu spät bemerkte ich, dass die anderen den Hering nicht entgräteten, sondern ihn komplett mit Flossen aßen.
Am Tisch trat Stille ein. Alle starrten auf meinen entgräteten Fisch, und Janes Vater hieb mit der Faust auf den Tisch und donnerte, jetzt reiche es aber, verdammt noch mal!
Er raunzte mich an, mich schleunigst zu verziehen. Vor Überraschung blieb ich sitzen, bis sich Janes Vater bedrohlich von seinem Platz erhob. Ich eilte zur Wohnungstür, drehte mich im letzten Augenblick noch einmal um, machte einen Diener und bedankte mich für das Essen.
Die Straßen hatten sich inzwischen mit Männern und Frauen in blauen Arbeitskleidern gefüllt. Die Männer trugen Schiebermützen, die Frauen Kopftücher. Alle gingen zu Fuß, auf dieser Seite des Flusses gab es keine gelben Straßenbahnen.
Ein unwirkliches Gefühl beschlich mich. Obwohl ich immer noch den Geruch des gebratenen Herings in der Nase hatte, war mir, als wäre das Erlebte nie geschehen. Als ich zur Brücke gelangte, hielt ich daher einen Augenblick inne, starrte auf die schwarzen Strudel und beschloss, meine Kleidung noch ein wenig im Freien zu lüften.
Aber es half alles nichts.
Ich war viel zu erfüllt von dem Unbegreiflichen und verplapperte mich, indem ich Mama fragte, warum manche Leute den Hering mit Gräten und die Kartoffeln mit Schale aßen. Sie begriff sofort, dass ich auf der anderen Seite des Flusses gewesen war. Meine Dummheit hatte mich überführt.
Natürlich gab es wieder einen Prügelaufschlag nach dem Essen.
Am nächsten Tag erzählte Jane, auch sie habe nach dem Essen Prügel bezogen, weil sie jemanden nach Hause eingeladen hatte, der offenbar nicht fein genug war. Zumindest deutete ich ihre Aussage so. Jane verwendete ein Wort, das ich noch nie gehört hatte und an das ich mich nach so vielen Jahren nicht mehr erinnern kann.
Vermutlich Klassenfeind.
Aber die Erinnerung ist trügerisch. Aus meinem ersten Schuljahr in Norrköping erinnere ich mich ansonsten vor allen Dingen an die Schwimmhalle. Hier wagte ich meinen ersten Kopfsprung vom Dreimeterbrett, während meine Klassenkameraden immer noch mit ihren Korkgürteln übten. Außerdem lernte ich mit gestreckten Armen und ohne Kopfbewegung zu kraulen. Ich erinnere mich an die lärmenden Krähen, die in einer schwarzen Wolke vor dem dunklen Herbsthimmel um den Rathausturm flogen. Ein Mitschüler bekam einen amerikanischen Panzer zu Weihnachten geschenkt, und wir unternahmen einen Ausflug zum Sommerhaus unserer Lehrerin, das an einem verschlungenen schwarzen Fluss mit Taumelkäfern und Wasserläufern lag. Mama und Harry veranstalteten ein großes Knutfest für alle meine Klassenkameraden von der richtigen Seite des Flusses. Ich lag meinen Eltern mit einem amerikanischen Panzer in den Ohren, ohne Hoffnung darauf, einen zu bekommen, obwohl er nicht sonderlich teuer sein konnte.
Glücklicherweise dauerte die Verbannung nach Norrköping nur ein Jahr. Dann war Harry nicht mehr Direktor und verkaufte das rote englische Auto, ehe wir wieder nach Saltsjöbaden zurückkehrten.
Ich begann in der Klasse 2 A, die ins Rathaus ausquartiert war, das Onkel Lauritz gebaut hatte. In Saltsjöbaden waren alle gleich. Im Gegensatz zu Norrköping musste ich nicht befürchten, mich zu blamieren, weil ich nicht fein genug war. Auf beiden Seiten der Tattbybrücke wohnten ganz normale Leute wie wir.
In diesem Jahr verursachte ich in der Weihnachtszeit einen unfassbaren, nicht vorhersehbaren Skandal. Es war zumindest ein schwacher Trost, dass nicht einmal Harry die Tragweite meines Vergehens erfasste und mir damit am Weihnachtstag, wie vorher versprochen, die üblichen Prügel tatsächlich erspart blieben.
Diese Rücksichtnahme erfüllte mich keineswegs mit Dankbarkeit, da ich den Grund der Begnadigung kannte, der weder dem Weihnachtsfrieden noch dem kleinen Jesuskind geschuldet war.
Großvater hielt nichts von der Züchtigung von Kindern, wie er es nannte, obwohl diese damals noch nicht gesetzlich verboten war. Und im großen Haus hatte er das Sagen. So einfach war das.
In der Chauffeurswohnung, die Mama mit ihrer Familie bezogen hatte, nachdem es keinen Chauffeur mehr gab, wehte ein anderer Wind. Dort sah und hörte niemand etwas.
Nach dem Weihnachtsessen in der Villa Bellevue waren Harry sozusagen die Hände gebunden. Er konnte sich schließlich schwerlich mit der Erklärung zurückziehen, dass er »seinem Sprössling« noch schnell die Abendprügel verabreichen müsse. Außerdem fehlten in der Villa die nötigen Werkzeuge, die Kleiderbürste, der lange Schuhlöffel aus Edelstahl und die Hundeleine, die sich als äußerst schmerzhafte Peitsche verwenden ließ.
So gesehen waren die Weihnachtsfeiertage und die Sommeraufenthalte in Sandhamn, während derer sich Harry hauptsächlich in Stockholm aufhielt, die schönste Zeit des Jahres.
Im Gegensatz zu meinen Cousins kannte ich die Villa Bellevue wie meine eigene Westentasche und durfte mich nach Belieben im Spielzimmer aufhalten, sofern ich hinter mir aufräumte. Außer an den Feiertagen waren mein kleiner Bruder Axel und ich die einzigen Kinder, aber Axel war noch zu klein für die Abenteuer der schier unerschöpflichen Schränke voll der Spielzeuge, mit denen Mama, unsere Onkel, Tante Rosa und Tante Johanne als Kinder gespielt hatten.
Es gab elektrische Eisenbahnen, Meccano-Baukästen mit Tausenden von Teilen, Dampfmaschinen, Autos, Schaukelpferde, Puppen mit Echthaar, vollständig eingerichtete Puppenhäuser, Indianerkostüme aus Leder, Revolver mit Holstern, Pfeil und Bogen, Tomahawks, Modellflugzeuge und vieles mehr. Aber es waren nicht nur die Spielzeugschränke, die mich an der Villa Bellevue faszinierten, sondern auch der große, gespenstische Speicher. Die Treppe dort hinauf begann im Korridor vor dem Spielzimmer.
Auf dem Speicher konnte man sich wunderbar zwischen Gartenmöbeln, Kleiderschränken, Truhen mit alten Fahnen oder Signalflaggen für die Beduin oder eines der anderen Boote verstecken, zwischen alten Steuerrädern, Fendern, Ankern, Positionslaternen, riesigen Lampions für die Krebsfeste, Wolfspelzen für Schlittenfahrten, Gemälden, für die es keinen Platz gegeben oder an denen sich jemand sattgesehen hatte, altmodischen Lampen mit Seidenschirmen, kleinen Marmorstatuen und gusseisernen Vogeltränken. Das war eine andere, überirdische Welt, in der alles geschehen konnte.
Obwohl ich mich sehr oft dort oben aufhielt, verstrich über ein Jahr, bis ich den verborgenen Schatz in einem Geheimfach im doppelten Boden eines großen Kleiderschrankes fand.
Langsam und lautlos robbte ich in geheimer Mission der Dschungelpatrouille unter dem Schrank hindurch, als mir die unebenen Bodenbretter auffielen. Im Schrankinnern bildeten sie eine glatte Fläche.
Aber von unten war das Geheimfach zu erahnen. Der knifflige Schließmechanismus widersetzte sich mir lange, aber zu guter Letzt fand ich die versteckte Verriegelung und konnte den Deckel abheben.
In dem geheimen Fach lag eine schwarze Aktentasche, schwer, aber nicht abgeschlossen.
Als ich sie klopfenden Herzens öffnete, lag der heimliche Schatz vor mir.
Ein großer Dolch in einer schwarzen, silberbeschlagenen Lederscheide mit einem Griff, der vermutlich aus Elfenbein war.
Des Weiteren enthielt die Tasche beschriebene Blätter in einer mir unbekannten Sprache und ein grünes Samtkissen mit einem eigentümlichen Ring und vier silbernen Orden. Ich betrachtete den mit mehreren kleinen Totenköpfen besetzten Ring, der mich an den Totenkopfring des Phantoms erinnerte. Zwischen den Totenköpfen sah ich verschiedene Geheimzeichen, die an Wikingerrunen erinnerten.
Die Orden waren schwer und vielleicht aus echtem Silber. Nicht wissend, was sie bedeuteten, war mir klar, dass sie wertvoll, aber trotzdem geheim sein mussten.
Ich verlor kein Wort über den geheimen Schatz. Versteckte Schätze waren nicht für neugierige Kinderaugen gedacht, das verstand sich von selbst.
An diesem Weihnachtsfest durften wir Kinder vor dem Festmahl nach Herzenslust spielen und lärmen. Mama erzählte, dass das in ihrer Kindheit ganz anders gewesen sei. Die Geschwister hatten in frisch gebügelten Matrosenanzügen und Kleidchen still und brav auf das Essen gewartet. Am ersten Weihnachtstag war es besonders streng zugegangen.
Aber jetzt waren neue Zeiten angebrochen, und andere Regeln galten. Die Cousins, also die Jungs von Tante Johanne und Tante Rosa, und ich fochten mit Steckenpferden einen Ritterkrieg im Spielzimmer aus. Cousin Peter hatte erst vorgeschlagen, dass Schottland und Norwegen gegen Schweden antreten sollten.
Aber das wäre ungerecht gewesen, denn Peter und ich, die Schottland und Norwegen repräsentierten, waren zwei Jahre jünger als die Schweden Eilert und Henning. Also entschlossen wir uns für einen Bürgerkrieg mit Henning und mir auf der einen und Peter und Eilert auf der anderen Seite.
Wir traten mit Holzschwertern gegeneinander an, die ordentlich schmerzten, aber da Blutvergießen vor dem Essen ausgeschlossen war, verlegten wir uns auf eine Kissenschlacht. Der Kampf wogte hin und her, ohne dass eine Seite siegte oder einer der Kämpfer auch nur Ermüdungserscheinungen zeigte.
Als wir schließlich lachend voneinander abließen, meinte Peter, in Schottland bekämen alle Soldaten nach einem solchen Kampf einen Orden verliehen.
So kam ich auf die unglaublich dumme Idee. Mit eifrig geröteten Wangen und ohne nachzudenken eilte ich auf den Speicher, um die Orden zu holen.
Wenig später galoppierten wir mit unseren Steckenpferden die Treppe hinunter und erwarteten lachenden Applaus der Erwachsenen, als wir im Weihnachtssalon eine Runde drehten. Sie saßen mit einem Drink vor dem offenen Kamin, während mein kleiner Bruder und Peters kleine Schwester Elizabeth andächtig auf die Bescherung harrten wie einst meine Mutter.
Wir waren bereits auf dem Weg zum Esszimmer und so gut wie in Sicherheit, als Großmutter Christa einen durchdringenden Schrei ausstieß. Wir blieben wie angewurzelt stehen, und Großmutter Christa streckte die Hand nach uns aus.
Es wurde vollkommen still. Die Erwachsenen starrten uns an, als ob wir Gespenster wären.
Die geheimen Orden hatten sie aufgeschreckt.
Tante Johanne fing sich als Erste, kam mit energischen Schritten auf mich zu und nahm mir den Orden ab. Ich hatte den schönsten genommen, den man an einem schwarz-weiß-roten Band um den Hals hängen konnte. Dann ging Tante Johanne zu Eilert und Henning und streckte die Hand aus. Gehorsam nahmen sie ihre Orden ab. Cousin Peter hielt seinen bereits in der Hand und überreichte ihn rasch seiner Tante.
Natürlich bestand kein Zweifel daran, dass ich der Schuldige war.
»Zeig mir sofort, wo du die gefunden hast!«, befahl Tante Johanne und sah mich durchdringend an.
Im Weihnachtssalon war es mucksmäuschenstill, als ich die Schiebetüren zum großen Esszimmer öffnete, um zur Treppe ins Obergeschoss zu gelangen. Tante Johanne folgte mir mit den Orden in der Hand.
Oben auf dem Speicher überflog sie die Papiere, warf alles achtlos in die Aktentasche zurück und machte sie zu.
Nachdenklich verharrte sie eine Weile in der Hocke, dann erhob sie sich rasch mit der Aktentasche in der Hand.
»Die nehme ich mit«, sagte sie ohne Ärger in der Stimme. »Über gewisse Dinge wird in unserer Familie nicht gesprochen, und diese Tasche zählt dazu. Ich werde meinen Jungs Bescheid sagen, und dann ist es, als sei nichts geschehen. Verstanden?«
Ich erhob keine Einwände, was hätte ich auch sagen sollen.
Es wurde ein sehr stilles Weihnachtsessen, sowohl am Erwachsenen- als auch am Kindertisch, an dem alle ohne Murren ihren Stockfisch aßen. Der Skandal wurde mit keinem Wort erwähnt, und alle taten, als wäre nichts geschehen. Aber das war es.
*
Stockholm, Mai 1968
Ich muss zugeben, dass ich im Augenblick lieber woanders wäre. In Paris haben sich Arbeiter und Studenten vereinigt und stehen buchstäblich auf denselben Barrikaden. In Frankreich herrscht Generalstreik, über zehn Millionen Arbeiter sind in den Ausstand getreten und haben über dreißig Industriezweige besetzt. Fast alle Studenten streiken und widmen sich der großen Aufgabe, die französische Republik von Grund auf zu verändern. Überall weht die NFL-Fahne. Dort trifft durchaus zu, dass »die leuchtende Zukunft bald unser ist«. Ich müsste mich eigentlich zu meinen Landsleuten gesellen. Wegen meines französischen Passes kann man mich an der Grenze nicht aufhalten wie die anderen europäischen Studenten.
Aber die Revolution muss warten. Ich will vor Semesterende erst noch die Prüfung in allgemeiner Rechtslehre bestehen, dann fehlt mir zum fertigen Juristen nur noch eine Abschlussarbeit. Um später einmal Schriftsteller werden zu können, brauche ich einen Beruf, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ein anständiger Intellektueller kann nicht vom Schreiben leben.
Ich stelle mir vor, dass Du jetzt lächelst. Erst die Prüfungen, dann der Roman, anschließend möglicherweise die Revolution. Ordnung muss sein. Die Pflicht kommt zuerst! In dieser Beziehung bin ich wie Onkel Oscar und Dein Vater Lauritz, den ich leider nie kennengelernt habe.
Aber zurück zum Ernst und zu Deiner Kritik.
Vorab ein Detail. Du findest, dass aufgeweckte und wissbegierige kleine Jungen wie ich und meine Cousins die deutschen Orden Onkel Haralds hätten erkennen müssen. Aber ich versichere Dir, dass dem nicht so war. Wir haben nicht einmal geahnt, dass es sich um deutsche Orden handelte.
Du mit Deinen Spezialkenntnissen hättest natürlich das Ritterkreuz und das Eiserne Kreuz erster Klasse bereits aus zehn Metern Entfernung erkannt. Aber Du warst im Krieg englische Spionin, nicht einmal der geheime SS-Ring wäre Dir entgangen.
Bei uns war das ganz anders. Die alten amerikanischen Kriegsfilme, die wir im Kino von Neglinge gesehen haben, waren vermutlich veraltet und für den Kinobetreiber damit einigermaßen günstig. In diesen Filmen waren die Russen noch die guten Alliierten. Ich erinnere mich deutlich an einen Film mit Humphrey Bogart, der von einem Schiffskonvoi nach Murmansk handelte, wo die Amerikaner als Verbündete willkommen geheißen wurden. Der deutsche Standardschurke, der flachsblond war und Englisch mit starkem deutschem Akzent sprach, trug – zugegebenermaßen – oft ein Ritterkreuz, allerdings späteren Datums.
Seltsamer war da in meinen Augen eher, dass weder Johan Hallström noch ich weniger als zehn Jahre nach Kriegsende wussten, wer Stalin war oder was mit dem Wort Hitler-Schlitten gemeint sein könnte. Es stellt sich also die Frage, ob man uns beschützt oder betrogen hat – vielleicht ja beides. Alles natürlich nur aus den besten Absichten heraus.
Meine Güte, ich habe eine Tante, die während des Krieges Majorin in der Special Operations Executive war, und einen Onkel, der den Rang eines SS-Sturmbannführers bekleidete. All das wurde in der Villa Bellevue totgeschwiegen. Hättest Du mir nicht davon erzählt, wüsste ich es heute noch nicht. Übrigens las ich gerade in der Zeitung, dass das Krankenhaus Villa Bellevue Einfamilienhäusern weichen soll.
Du siehst, ich schweife die ganze Zeit ab, was verzeihlich sein mag. Sich in die Fünfzigerjahre der Kindheit zurückzubegeben und in das Kind von damals hineinzuversetzen, die Lügen, das Schweigen und die Geheimnisse auszugraben, ohne sie der Öffentlichkeit preiszugeben, ist ein schwieriges, aufwühlendes Unterfangen. Aber Du hast die Regeln festgelegt, und ich verstehe sehr gut, warum. Damit ich nicht in die Journalistenprosa der 68er oder in den typisch französischen Redeschwall verfallen soll, der mir unseligerweise eigen ist. Das wird schwer. Aber ich strenge mich an, schließlich haben wir gewettet. Wie ein junger Candide fahre ich also im nächsten Kapitel fort, inzwischen zehn Jahre alt.
Im Übrigen finde ich, dass Du unbedingt Deine Kriegsmemoiren schreiben solltest. In diesem Punkt gebe ich nicht nach.
1954
TOMAHAWK
Die letzten Tage vor den Ferien bekam ich schulfrei, um an einer Beerdigung in Norwegen teilnehmen zu können. Meine Urgroßmutter, die Mutter von Großvater Oscar und Großonkel Sverre, war gestorben, also Mamas Großmutter väterlicherseits.
Einige Jahre zuvor war ich schon einmal in Norwegen gewesen, konnte mich aber nur vage erinnern. Das Wasser war viel salziger als bei uns, und wir hatten vom Ufer und vom Steg aus mit an Schnüren befestigten Miesmuscheln kleine Krebse gefangen.
Die Erwachsenen hatten während des Sonntagsessens darüber gestritten, wer fahren musste und wem es erspart blieb. Streit war vielleicht übertrieben, denn beim Essen wurde nicht gestritten. Jedenfalls war man sich zu Beginn der Mahlzeit nicht einig.
Onkel Carl Lauritz sträubte sich anfänglich, weil er dann die erste Sommerregatta in Vaxholm verpasste. Kurzerhand entschied Großvater, dass er auf diese Regatta verzichten müsse.
Tante Johanne wollte gerne reisen, da sie Großmutter Maren Kristine sehr nahegestanden hatte. Die Jungen sollten bei dem Dienstmädchen in Stockholm bleiben, da eine norwegische Beerdigung nichts für Kinder sei, wie sie meinte. Großvater widersprach nicht.
Es verwunderte mich, dass Eilert und Henning nicht mitmussten, ich aber schon. Harry und mein kleiner Bruder blieben ebenfalls zu Hause.
Onkel Hans Olaf teilte mit, er werde ohne Alice reisen, da sie nur verlobt seien. Danach wurde die Kleiderordnung besprochen, als ob man in Norwegen andere Kleider trug.
Bei näherem Nachdenken fand ich eine so weite Reise ziemlich aufregend. Außerdem hatte mir Anders einen Geheimauftrag erteilt, der nur in Norwegen ausgeführt werden konnte.
Am Morgen unserer Abreise wurde Großmutter Christa von einer seltsamen Krankheit befallen und musste zu Hause bleiben, was weder Mama noch Großvater sonderlich erstaunte oder beunruhigte. Großvater seufzte leise und schien ein wenig verärgert.
Harry, der uns mit dem Cadillac zum Stockholmer Hauptbahnhof bringen sollte, war bester Laune, vermutlich weil er jetzt eine ganze Woche lang unbeobachtet über den Wagen verfügen konnte.
Am Bahnhof warteten bereits Onkel Carl Lauritz, Onkel Hans Olaf und Tante Johanne. Onkel Sverre war vorausgefahren, und Tante Rosa wollte direkt von Aberdeen in Schottland die Fähre nach Bergen nehmen.
Bahnfahrten hatten mir schon immer Spaß gemacht, selbst die kurze Strecke von Saltsjöbaden nach Stockholm mit der Vorortbahn.
Die Reise nach Oslo nahm einen ganzen Tag in Anspruch und regte meine Fantasie an.
Während sich der Zug durch dichte Wälder schlängelte, brauchte ich nur das riesige Zauberschwert aus Tausend und einer Nacht auszustrecken, und die Bäume fielen, als striche eine Sense durchs Feld. Über offene Landschaften mit weidenden Kühen auf junigrünen Wiesen ließ ich die allermodernsten Flugzeuge, eine Staffel der J 29, genannt die fliegende Tonne, in niedriger Höhe und so nahe an unserem Abteilfenster vorbeijagen, dass ich die Sauerstoffmasken der Piloten sehen konnte. Wenn der Zug Brücken überquerte, bekam er plötzlich Flügel, und in den Städten verwandelte er sich in eine Märklin-Eisenbahn, deren Geschwindigkeit von mir, einem Riesen im Himmel, mit einem Trafo mit rotem Regler bestimmt wurde. Mir war an keiner Stelle langweilig, und ich brauchte mich nicht wie die Erwachsenen mit einem Buch abzulenken.
In Oslo nahm das Abenteuer ein Ende, denn dort stiegen wir in einen anderen roten Zug mit verdunkelten Schlafwagenabteilen, die die helle Mittsommernacht ausschlossen. Mama und ich teilten uns ein Abteil. Als sie glaubte, dass ich schlief, schlich sie sich, vielleicht um zu rauchen, nach draußen.
Das gleichmäßige Rattern des Zuges sorgte für raschen Schlaf. Ich erwachte, weil mir kalt war und es durch einen Spalt in der schwarzen Gardine vor dem Fenster ins Abteil schneite. Ich kämpfte eine Weile mit dem Fenster, bis es mir gelang, es ganz zu schließen. Als ich wieder in die obere Koje kletterte, war Mama immer noch nicht zurück.
Jetzt konnte ich nicht mehr einschlafen. Ich bibberte und rieb mir die eiskalten Hände, während unerwünschte Fantasiebilder mich unaufhaltbar überrollten. Mama war von Räubern entführt worden, und als Großvater sich als Geisel anbot, wurde auch er gefangen genommen. Die Räuber, die dann auch noch meine Onkel schnappten, trugen Cowboyhüte und schwarze Halstücher vor dem Gesicht. Sie hatten im Speisewagen ihr Quartier bezogen, indem sie sämtliche Fahrgäste zwangen, nacheinander ihre Taschen auszuleeren und ihre Brieftaschen und goldenen Uhren abzugeben.
Als wir in den Hauptbahnhof von Bergen einfuhren, erwachte ich, als mir Mama die Wange tätschelte und mich spöttisch einen Siebenschläfer nannte. Ich schämte mich, eingeschlafen zu sein, während Großvater und sie in Gefahr schwebten und ehe ich mir ein glückliches Ende zusammenfantasieren konnte.
Erst auf der Fähre nach Osterøya hatte ich das Gefühl, in einem anderen Land zu sein. An der Sprache lag es nicht, da ich mit dem Schwedischen und dem Norwegischen aufgewachsen war.
Aber der Fjord, die hohen Berge, deren Gipfel teilweise noch schneebedeckt waren, obwohl Mittsommer nahte, das funkelnde Sonnenlicht auf dem abwechselnd grünen und dunkelblauen Wasser, die weißen Häuser, die sich an die Hänge klammerten, die Wasserfälle, die vollkommen andersartigen Boote, all das war Ausland. Und das Meer roch ganz anders und viel stärker als in Sandhamn oder Saltsjöbaden.
Tante Johanne saß neben Mama und mir und erklärte uns, wie die verschiedenen Landungsbrücken hießen, was dort gelöscht und geladen wurde und dass es sich immer noch um dieselbe Fähre handelte, mit der sie als Kind und während des Krieges gefahren war, wenn sie ihre Großmutter besucht hatte.
Mama und Tante Johanne unterhielten sich auf Norwegisch, was mir im ersten Moment gar nicht auffiel, weil ich über andere Dinge nachgrübelte.
Als Mama und Tante Johanne über etwas reden wollten, was nicht für Kinderohren geeignet war, schickten sie mich zu Tante Rosas Familie aufs Achterdeck.
Gehorsam begab ich mich aufs Achterdeck, unsicher, worüber ich mich mit ihnen unterhalten sollte, obwohl Mama mir immer wieder eingeschärft hatte, wie wichtig die Fähigkeit geläufiger Konversation in feinen Kreisen war.
Als ich an den Tisch meiner Verwandten trat, stellte ich also weltmännisch fest, was für ein Glück wir mit dem Wetter hätten, da es hierzulande oft sehr regnerisch sei.
»Indeed«, erwiderte Peters Papa und stellte ein großes Fernglas vor sich auf den Tisch. »Atemberaubende Landscape. So viel zu sehen.«
Ich wurde eingeladen, Platz zu nehmen, und wir unterhielten uns eine Weile über das Wetter. Peter und sein Vater trugen Tweedjacken, Rollkragenpullover und Kniebundhosen. Tante Rosa hatte sich in einen langen, weiten Mantel, ebenfalls aus Tweed, gehüllt. Zum Abendessen würden sie sich natürlich umziehen.
Ich trug einen Lodenmantel. Großmutter Christa hatte mir den Unterschied zwischen Loden und Tweed erklärt und dass Letzteres eine zu meidende englische Erfindung war. Für die Jagd, auf See und bei Wind eigne sich Loden am besten. Aber in diesem Augenblick fand ich, dass Peter und Onkel Andrew sehr viel schicker aussahen als ich, jedenfalls wirkte Peter erwachsener als ich.
»Bist du auch Segler, junger Mann? Ihr da draußen in den Schären habt ja long traditions«, meinte Onkel Andrew in seinem seltsamen Englisch.
Ich kann mich nicht erinnern, was ich antwortete. Vermutlich, dass ich demnächst an einem Segelkurs der Königlichen Schwedischen Segelgesellschaft auf Lökholmen teilnehmen würde.
Am Kai von Tyssebotn wartete die gesamte norwegische Verwandtschaft, die an ihrer schwarzen Kleidung zu erkennen war. Mindestens 25 Personen, die meisten davon Kinder, standen in einer Gruppe für sich. Niemand lächelte.
In einer langen Reihe gingen wir von Bord, Großvater Oscar an der Spitze, Peter und ich zuletzt.
Wir gaben den schwarz gekleideten Verwandten, darunter auch Onkel Sverre, einem nach dem anderen die Hand, die mit gesenktem Blick antworteten: »Gottes Segen. Willkommen in Tyssebotn.«
Wenn sie sich unbeobachtet glaubten, starrten sie uns mit großen Augen an. Einige Kinder zeigten sogar auf Mama, lachten und wurden eilig zurechtgewiesen.
Mama trug auf Reisen keine Kopfbedeckung, offenes Haar, Hosen, Pullover und Sonnenbrille. Ich fand das nicht weiter bemerkenswert, aber die norwegische Verwandtschaft war offensichtlich befremdet.
Nach der Begrüßung begaben wir uns in einer Prozession zum Hof Frøynes, den ich sofort wiedererkannte. Das Langhaus ähnelte dem in Sandhamn, war aber viel größer, und der Dachfirst war mit geschnitzten Drachenköpfen verziert. Beide Häuser hatte mein Großonkel Lauritz gebaut.
Dann wurde getafelt. Lachs mit Sahnesauce, junge Kartoffeln und Gurkensalat.
Die Gäste waren im großen Haus einquartiert, in dem es wie in Sandhamn Schlafnischen mit Stockbetten gab.
Während des mehrere Stunden dauernden Essens, bei dem alle schwiegen, wurde nach dem Lachs getrocknetes Hammelfleisch, Hefezopf und Kaffee serviert. Der restliche Abend sollte in Stille und getrennt von der norwegischen Verwandtschaft verbracht werden. An Krebsangeln war offenbar nicht zu denken.
Jetzt kamen mir die Bücher zupass, die mir Mama während der Bahnfahrt aufgenötigt hatte. »Old Shatterhand« und »Der letzte Mohikaner« hatte Onkel Hans Olaf in seiner Kindheit auch gelesen.
Am nächsten Tag trugen acht mit hohen Zylindern und interessanten Westen gekleidete Männer, unter ihnen Großvater Oscar und Onkel Sverre, den Sarg meiner Urgroßmutter zum Kirchboot. Mama erklärte mir, dass eine Fischersfrau auf ihrer letzten Fahrt immer von ihren Söhnen gerudert werde.
Alle anderen Trauergäste saßen in Fuhrwerken, die von mit schwarzen Schleifen geschmückten Pferden gezogen wurden.
Wir sogenannten Schweden trugen an diesem Tag schwarze Anzüge mit weißen Krawatten, was offenbar von der norwegischen Verwandtschaft gebilligt wurde.
Onkel Andrew und Peter trugen Kilt, dazu schwarze Jacken, weiße Kniestrümpfe und schwarze, bis zu den Waden geschnürte Schuhe. Unter dem Bund ihres rechten Strumpfes steckte ein Messer.
Ihr Erscheinungsbild schien die norwegische Verwandtschaft noch mehr zu entsetzen als Mamas Reisekleidung.
Tante Rosa erklärte ihnen flüsternd, das sei in Schottland die zu Beerdigungen übliche und feierliche Kleidung. Anschließend wandte sie sich mit derselben Erklärung an die schwedische Verwandtschaft. Alle nickten verhalten, aber niemand lächelte.
Der Gottesdienst in der Kirche in Hosanger zog sich in die Länge. Es wurden viele Lieder gesungen, und die Predigt nahm kein Ende.
Peter und ich saßen in der hintersten Reihe, rutschten unruhig hin und her und flüsterten miteinander. Als Peter schließlich laut seufzte, drehte sich einer der älteren Norweger um und starrte uns streng an.
Zu guter Letzt trugen acht Männer, Großvater Oscar und Onkel Sverre an der Spitze, den Sarg zur Grabstelle.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ließen sie ihn in die Grube hinab. Anschließend verbeugten sich alle vor dem Grab und vor Urgroßmutter Maren Kristine. Der Ablauf der Trauerfeier stimmte im Großen und Ganzen mit dem überein, was meine Klassenkameraden mir erzählt hatten.
Außer in einem Punkt. Niemand weinte. Tante Johanne war den Tränen nahe, nahm sich aber zusammen.
Hinterher versammelten sich alle zum Trauermahl an einer riesigen, endlos langen Tafel in Frøynes, an deren unterem Ende auch die Kinder Platz fanden. Es gab Hammelbraten und viel Bier. Wir Kinder tranken sogenanntes Würzbier, das an Dünnbier erinnerte, aber besser schmeckte.
Nach einer halben Ewigkeit durften alle Kinder die Tafel verlassen. Die norwegischen mussten direkt auf die Nachbarhöfe zurückkehren, da Spiele oder laute Unterhaltungen verboten waren. Wie Zwerge sahen sie aus, als sie sich in ihren schwarzen Trauerkleidern auf den Heimweg machten.
Cousin Peter und ich saßen eine Weile gelangweilt und mit viel zu vollen Bäuchen vor dem Haus. Peter berichtete, die schottische Zeremonie für seinen verstorbenen Großvater sei ähnlich verlaufen, allerdings mit lustigerer Musik. Anschließend waren sie in das Haus des Großvaters eingezogen, weil es seinem Vater als ältestem Sohn zugefallen war.
Wir kehrten in unserer Trauerkleidung nach Bergen zurück, um mit unserer Reisekleidung bei der norwegischen Verwandtschaft kein erneutes Missfallen zu erregen.
Onkel Andrew und Peter froren auf der Fähre an den Beinen und wurden skeptisch angestarrt. Wobei die Norweger noch nicht einmal wussten, dass unterm Kilt keine Unterwäsche getragen wurde, wie ich nach einer Demonstration Peters erfahren hatte.
Vom Hafen in Bergen fuhren wir mit dem Taxi direkt zum Zentralhotel, um uns umzuziehen. Onkel Hans Olaf und Onkel Carl Lauritz fuhren mit dem Nachmittagszug nach Stockholm weiter, da sie in Eile waren. Onkel Sverre machte sich unterdessen auf den Weg in ein Kunstmuseum.
Die übrigen Erwachsenen wollten sofort wieder etwas essen, was kein Problem war, da die Fähre nach Aberdeen erst am Spätnachmittag ablegte.
Der Nachmittag gestaltete sich dann spannender als von Peter und mir erwartet. Mit einer Seilbahn fuhren wir auf einen Berg, wo ein Restaurant mit Aussicht auf die Stadt und den Fjord lag. Dank des guten Wetters konnten wir draußen sitzen. Vermutlich waren die Erwachsenen ebenso erleichtert wie Peter und ich, die schwarze Schwermut abschütteln zu dürfen. Man scherzte und erzählte von der Kindheit in Bergen und davon, wie einsilbig und zugleich redegewandt Urgroßmutter Maren Kristine gewesen war. Als Tante Johanne sie nachahmte, verstanden Peter und ich kein Wort.
Wir mussten unsere Portionen nicht aufessen und bekamen trotzdem Eis zum Nachtisch.
Danach begleiteten wir die Schotten zur Fähre nach Aberdeen. Spaßeshalber bezeichneten wir einander als Schotten und Schweden, weil uns die norwegische Verwandtschaft so genannt hatte.
Die Wetteraussichten seien gut, meinte der Steuermann an der Gangway und sagte eine ruhige Überfahrt voraus.
Als die Fähre ablegte, standen die Schotten auf dem Achterdeck und winkten mit weißen Taschentüchern. Vermutlich waren sie froh, die Feierlichkeiten hinter sich gebracht zu haben. Mir zumindest war es recht, dass unser Kreis stetig kleiner wurde und sich die Beerdigungsstimmung zusehends verflüchtigte wie Mottenkugelgeruch im Freien.
Im Schein der Spätsommersonne gingen wir am Hafen spazieren. Die bunten Holzhäuser erinnerten an leuchtende Signalflaggen und verstärkten das Gefühl, im Ausland zu sein.
Auf der Terrasse des Zentralhotels nahmen wir in der Dämmerung ein einfaches Abendessen zu uns, Dorsch mit zerlassener Butter und gehackten hart gekochten Eiern oder nach Geschmack knusprig gebratenen Speckwürfeln. Die Erwachsenen tranken Weißwein, und ich bestellte ein Würzbier, wogegen niemand etwas einzuwenden hatte.
Zu meinem Erstaunen unterhielten sich die Erwachsenen über das Erbe, sonst sprachen sie nie über Geldangelegenheiten, zumindest nicht beim Essen und keinesfalls im Beisein von Kindern. Aber das einzige Kind war ja ich, und die Unterhaltung fiel sehr kurz aus.
Onkel Sverre brachte das Thema zur Sprache, als er feststellte, dass sich niemand für seinen Museumsbericht interessierte.
Seiner Meinung nach war die Lage unkompliziert. Nach dem Tode ihres Bruders Lauritz waren Großvater Oscar und er die einzigen Erben. Aber was sollten sie mit Frøynes? Sollten sie das Erbe nicht besser den Verwandten auf Osterøya überlassen?
Großvater stimmte ihm zu. Dann wurde nicht mehr darüber gesprochen.
Tante Johanne berichtete von ihrer Kindheit in Bergen, als man sie deutsche Bälger geschimpft und ihren Bruder Harald beinahe totgeschlagen hatte, woraufhin sie nach Schweden geflüchtet waren.
Von diesen Dingen verstand ich nichts und schwieg daher.
Am nächsten Morgen trafen wir frühzeitig am Bahnhof ein. Die Träger des Zentralhotels brachten unser Gepäck ins Abteil, während uns Großvater das Gebäude zeigte, das ihr Bruder Lauritz gebaut hatte.
Onkel Sverre fand den Bau wunderbar romantisch, ein wenig Mittelalter, ein wenig Wikinger, mit einer Prise Ironie, daran erkenne man seinen Bruder.
Während sich die Erwachsenen über Granit und Reliefs unterhielten, befiel mich ein schlechtes Gewissen. Ich hatte einen Geheimauftrag von Anders erhalten, der sich an einem großen Kiosk neben dem Restaurant in der Haupthalle ausführen ließ. Aber ich besaß weder norwegisches noch schwedisches Geld.
Vorsichtig nahm ich Mamas Hand, zog sie beiseite und erklärte ihr die Lage. Sie wurde zu meinem Erstaunen nicht böse und begriff wahrscheinlich gar nicht, was an meiner Idee kriminell oder gar gefährlich sein sollte. Sie lachte nur und begleitete mich zum Kiosk, um den Geheimauftrag auszuführen.
Im Zug drückte ich meine Nase ans Abteilfenster. Anfänglich ging es so langsam steil bergauf, dass ich meine Hand in das weiße Blütenmeer tauchen wollte wie in das glatte Wasser der Ostsee an einem ruhigen Sommerabend im Ruderboot.
Neben der Abteiltür unterhielten sich Großvater und Onkel Sverre auf Norwegisch, nicht jenes Halbnorwegisch, das sie im Umgang mit den Schweden verwendeten.
Mir gegenüber am Fenster saß Mama, die außer mit den schwarz gekleideten Verwandten auf Osterøya fast nie Norwegisch sprach. Tante Johanne neben Mama war wie immer in ein Buch vertieft. Norwegisch sprach sie ebenso fließend wie Schwedisch. War sie in gleichem Maße Norwegerin als auch Schwedin?
Und ich, wie norwegisch war ich selbst? Dieser Sache wollte ich auf den Grund gehen.
Großmutter Christa war Deutsche, was mit Stillschweigen übergangen wurde. Abgesehen von Onkel Andrew sprach sie das eigentümlichste Schwedisch in der Familie.
Großvater war Norweger, also war Mama halb Norwegerin und halb Deutsche.
Das machte mich zum Viertelnorweger, Vierteldeutschen und Halbschweden, da Harry Schwede und sonst nichts war, wie er gerne betonte.
Das Norwegische in mir spürte ich, nicht aber das Deutsche.
Tante Johanne und ihre Geschwister waren aus Bergen geflohen, weil sie als deutsche Bälger beschimpft worden waren. Das hatte Tante Johanne beim Abendessen im Hotel erzählt. Wieso hatten die Norweger die Deutschen so sehr gehasst, dass sie Onkel Harald beinahe totschlugen? Ein Rätsel. Und hassten die Norweger die Deutschen noch immer? Wohl kaum Tante Johanne, da ihr nicht anzumerken war, dass sie deutscher Abstammung war? Sie sprach ebenso gut Norwegisch wie jeder Norweger.
Meine norwegischen Verwandten auf Osterøya waren mir zwar vertraut, aber zugleich schien uns ein Graben zu trennen. Hätte ich einer von ihnen sein können? Dazu musste man sich einen normalen sonnigen Tag am Fjord vorstellen, an dem alle ihre Alltagskleidung trugen und die Kinder so hemmungslos reden und lachen durften und vom Steg aus Krebse fingen. Ich kannte meine norwegischen Cousins und Cousinen, die eigentlich keine echten Cousins und Cousinen waren, nur von der Trauerfeier.
Ein bisschen Norweger war ich schon auch, und ich fand die norwegische Fahne viel schöner als die schwedische.
Aber rein mathematisch gesehen war ich vor allem Schwede – zu fünfzig Prozent. Ich war ebenso schwedisch wie meine Mitschüler in Saltsjöbaden und sprach sogar besser Schwedisch als sie.
Dass mein schwedischer Anteil von Harry stammte, war kein gutes Gefühl. Im Kreise von Harrys Familienangehörigen fühlte ich mich nicht unter Verwandten. Sie waren mir fremder als die norwegischen und manchmal schrecklich schwer zu verstehen. Mir wäre niemals eingefallen, Harrys Vater Großvater zu nennen.
Wir hatten ihn einige Male im Stockholmer Vorort Hammarbyhöjden besucht, und Mama fühlte sich dort ganz offensichtlich auch nicht wohl.
Ich war zuletzt im vergangenen Sommer dort gewesen, nachdem sowohl die Beduin als auch das Motorboot zu Beginn der Saison nach Sandhamn überführt worden waren. Warum Mama, mein kleiner Bruder und ich erst später nach Sandhamn fuhren, wusste ich nicht.
Nachdem wir den Booten in Saltsjöbaden hinterhergewunken hatten, sollte es eine Überraschung geben, hatte Harry angekündigt. Wir fuhren mit dem Cadillac nach Stockholm und von dort weiter nach Hammarbyhöjden, das weder richtig in der Stadt noch auf dem Land lag. Gleichförmige Häuser reihten sich aneinander. Dazwischen gab es ein paar Bäume und Büsche, Spielplätze, Teppichstangen und von hohen Maschendrahtzäunen umgebene Ascheplätze zum Fußballspielen.
Harrys Vater hieß Folke oder so ähnlich und war Briefträger gewesen. Jetzt unternahm er nicht mehr sonderlich viel, besaß aber ein schönes Aquarium mit Schwertträgern, Guppys und Black Mollys, die ihre Jungen lebend zur Welt brachten und dann auffraßen.
Harrys Schwestern hießen Sivan und Anki. Sie sprachen anders als normale Menschen, nasaler. Je länger man ihnen zuhörte, desto mehr fiel es auf.
Harrys Mutter wollte nett zu mir sein und goss mir ein Glas selbst gemachten Himbeersaft ein.
Dann wurde uns am Küchentisch ein Sommermittagessen serviert. Ich erinnere mich nicht mehr, was es gab, nur, dass Harrys Familie recht seltsame Essgewohnheiten hatte. Mama saß stocksteif da und fütterte meinen kleinen Bruder. Ihr Unbehagen war ihr anzumerken. Sivans Abneigung war ebenso offensichtlich, als sie sich eine Zigarette anzündete, Mama den Rauch ins Gesicht blies und sich mit einem kurzen »Hoppla« entschuldigte.
Harrys Vater wirkte jedoch nett und erzählte von den Fischen und der Aquarienpflege.
Die Familie bewohnte drei Zimmer, und nirgends stand ein Bücherregal.
Ich war erleichtert, als wir schließlich aufbrachen, obwohl Harry sich über uns, meinen kleinen Bruder natürlich ausgenommen, zu ärgern schien.
Irgendwo verbarg sich ein Geheimnis, das ich nicht ergründen konnte. Hammarbyhöjden war eine andere Welt und weit weg von Saltsjöbaden, obwohl die Fahrt dorthin nur eine Stunde dauerte. Übrigens hatte Harry vor seiner Schwester Sivan so getan, als gehöre der Cadillac ihm.
Das Ganze rief mir Norrköping in Erinnerung. Wer hatte schon Verwandte auf der anderen Seite des Flusses? Natürlich war ich Schwede, aber nicht auf diese Art.
»Jetzt müsst ihr schauen!«, rief Tante Johanne plötzlich, klappte ihr Buch zu und deutete aus dem Fenster. »Gleich fahren wir über die Kleivebrücke, die längste Brücke der gesamten Strecke, und die hat Papa Lauritz gebaut!«
Alle drängten sich ans Fenster, und das Rattern der Zugräder klang auf einmal anders, hohler. Wir blickten in einen unendlichen Abgrund, bevor gleich darauf der Zug in einem Tunnel verschwand und ich nur noch mein eigenes Spiegelbild sah.
Der Zug gewann an Höhe, und alle Bäume verschwanden bis auf niedrige, verkrümmte Birken. Streckenweise war die Landschaft beinahe hässlich und bestand, so weit das Auge reichte, nur aus grauem Geröll.
Ich begann, sie mit den Apfelblüten und dem frischen Grün meiner Fantasie anzumalen.
Bald waren erste weiße Flecken in den Senken zu sehen, die nach und nach in eine geschlossene Schneedecke übergingen, die bis zu den fernen Gipfeln und blau schimmernden Gletschern reichte. Da die Sonne hoch am wolkenlosen Himmel stand, musste ich die Augen zusammenkneifen, um nicht geblendet zu werden.
Mama erklärte mir, dass wir uns nun auf der Hardangervidda befänden. Auf der Hinreise hatte hier ein Schneesturm gewütet, der Schnee würde jedoch bei anhaltendem sonnigen Wetter innerhalb weniger Tage schmelzen. Sie deutete auf verschiedene winterharte Pflanzenexemplare, aber ich erinnere mich nur noch an das wahrscheinlich schönste, den Gletscher-Hahnenfuß.
Ich ließ meinen Blick über die endlose weiße Landschaft schweifen und versuchte mir vorzustellen, wie sich Großonkel Lauritz hier einst abgerackert hatte. Er war nicht nur der Erbauer der Brücke, die wir in zehn Sekunden überquert hatten, sondern der gesamten Bahnstrecke nach Oslo.
Ich kannte ihn nur von dem Bild im großen Esszimmer in Saltsjöbaden und konnte ihn mir gut in einem dicken Wolfspelz im dichten Schneesturm vorstellen.
Für jedes Do-Dong-Do-Dong der Schienenstöße waren zwei schwere Eisenbahnschienen herbeigeschleppt und auf ein Fundament aus Felsbrocken gebettet worden, für das die Arbeiter erst einmal den harten Boden ebnen mussten. Dann hatten sie die Schwellen verlegt und die Schienen mit Keilen und Vorschlaghämmern festgenagelt. Das alles bei Regen, Schnee und Kälte. Vermutlich hatten sie nicht mehr als sieben oder acht Schienen pro Tag geschafft. Wie mein Großvater war Großonkel Lauritz Bauingenieur gewesen, und die Arbeiter hatten die ganze Strecke nach Oslo Schiene um Schiene nach seinen Anweisungen verlegt.
In Oslo stiegen wir ohne Aufenthalt in den Zug nach Stockholm um. Dieses Mal hatten wir keinen Schlafwagen. Nach einer Weile nickte ich ein, da nur Wälder und Äcker vor dem Fenster vorbeizogen. Als die Zöllner unser Abteil betraten, wurde ich schlagartig wach. Mit Herzklopfen hörte ich die Erwachsenen sagen, dass wir nichts zu verzollen hatten. Ich schwieg, was mir eine Lüge ersparte, über die Schmuggelware im Gepäcknetz über meinem Kopf. Was wohl geschehen wäre, wenn man mich erwischt hätte? Vielleicht wäre es ja ein noch größerer Skandal gewesen als die Geschichte mit Onkel Haralds Orden, über die fortan geschwiegen wurde.
In Saltsjöbaden herrschte behagliche Stille, die Sommerferien hatten begonnen, und bis zur Regatta blieben noch ein paar ruhige Wochen. Die meisten Klassenkameraden waren in Urlaub gefahren. Das war ein neues Wort und bedeutete, dass die Eltern ihr Auto vollpackten, die Kinder auf der Rückbank verstauten und irgendwo Verwandte besuchten. Johan war mit seiner Familie in Båstad in Schonen.
Aber Anders war zu Hause geblieben. Er hatte ein neues Fahrrad mit einem Bananensattel bekommen. Das war der letzte Schrei, ein Sattel, wie ihn Motorräder hatten. Erwartungsvoll fand er sich ein und erkundigte sich, wie die geheime Mission in Norwegen gelaufen sei.
Ich ließ ihn ein wenig zappeln und nickte dann verschwörerisch. Der Auftrag war ausgeführt und die Schmuggelaktion perfekt verlaufen, die Zollschnüffler hatten keinerlei Verdacht geschöpft.
Wir schlichen zur Grotte hinauf, um unbeobachtet zu sein. Die Flaschen und zwei Gläser hatte ich in meiner Schultasche verstaut.
Ein letztes Mal schauten wir uns um, dann zog ich triumphierend die beiden Coca-Cola-Flaschen aus der Tasche und stellte sie vorsichtig auf den Gartentisch.