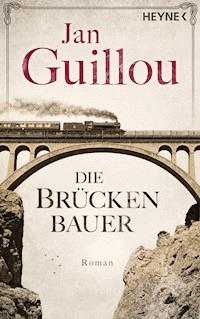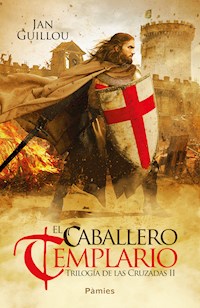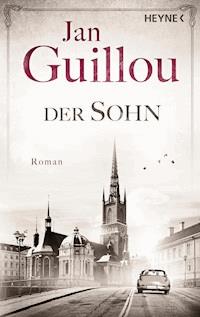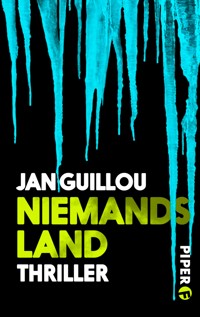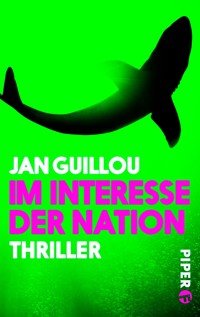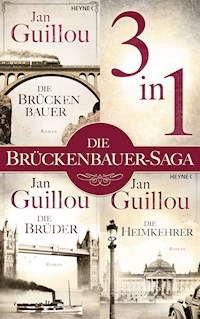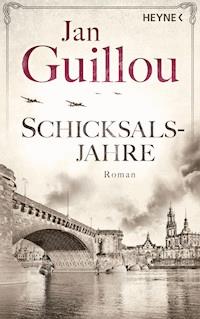
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brückenbauer-Serie
- Sprache: Deutsch
Stockholm 1940: Während vor den Grenzen Schwedens der Zweite Weltkrieg wütet, leben die Brüder Lauritzen das von den Kriegsereignissen nur peripher berührte Leben der Oberklasse. Doch die Situation spitzt sich zu, und es wird zunehmend schwieriger, eine Parteinahme zu vermeiden. Zumal sich auch innerhalb der Familie die Lager teilen: Harald, Lauritz’ ältester Sohn, dient bei der SS, während seine Schwester Johanne im Widerstand kämpft. Während Europa vor einer Zerreißprobe steht, droht auch die Familie Lauritzen zu zerbrechen. Bis es am Ende ums nackte Überleben geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jan Guillou
SCHICKSALS-
JAHRE
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Zum Buch
Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen, und auch für die in Schweden lebende Familie Lauritzen wird der Alltag mehr und mehr zu einem Drahtseilakt. Die Ehefrauen der Brüder Lauritzen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft und überlegen, diese aus Sicherheitsgründen abzulegen. Ein Großteil des Vermögens der Familie ist in Deutschland angelegt und nicht mehr zugänglich. Gleichzeitig verschlechtert sich die Auftragslage. Und auch im Privaten droht der Familie Ungemach. Lauritz’ Ehefrau Ingeborg ist schwer erkrankt, was sie ihrem Ehemann so lange verheimlicht, bis es zu spät zu sein scheint. Lauritz’ Kinder sind politisch in verschiedenen Lagern aktiv, was eine große Gefahr für die Familie birgt. Lauritz, der als Oberhaupt stets die Geschicke der Familie lenkte, verliert in den Wirren zusehends die Zuversicht, und als er die Nachricht vom Tod seines Sohnes erhält, scheint sein Lebenswille endgültig gebrochen zu sein.
Zum Autor
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Autoren seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Att inte vilja se bei Piratförlaget, Stockholm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2014 by Jan Guillou
Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Published by agreement with Salomonsson Agency
Redaktion: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel/punchdesign, München
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-17312-8
www.heyne.de
1940
Das Hämmern der Ramme pulsierte zuversichtlich durch seinen ganzen Körper. Die Arbeit schritt langsam, aber unaufhaltsam voran. Dieses Mal würden sie nicht versagen, niemand würde sterben.
Natürlich klagten die Bewohner der Häuser unten am Flussufer über den ständigen Lärm. Und er selbst hatte sich, statt mit den anderen Ingenieuren im Centralhotel in Kramfors, im Obergeschoss eines einfachen, ungestrichenen Holzhauses direkt am Wasser in der Nähe der Baustelle eingemietet, als wollte er damit dem Schicksal trotzen und es herausfordern. Würde das Bauwerk ein weiteres Mal in den Fluss stürzen, konnte die gewaltige Flutwelle die ufernahen Häuser mitreißen oder zerstören.
Aber das würde kein zweites Mal geschehen.
Er wollte dem Hämmern der Ramme nahe sein, wenn der Schlagbär langsam, aber sicher die Holzstämme mit jedem Schlag um sechzehn Millimeter weiter ins Flussbett trieb. In kleinen Schritten ging es stetig voran. Und er wollte dabei sein, jeden einzelnen Schlag mit seinem ganzen Körper spüren.
In seinem Mansardenzimmer, beim wiederholten Durchgehen der Pläne, oder wenn ein in Schräglage geratener Pfahl zunächst durch einen weiteren Pfahl abgesichert werden musste, gönnte er sich ab und zu eine kurze Pause, legte sich auf das gemachte Bett und lauschte dem Hämmern, als sei es Musik von Beethoven oder Brahms.
Das war der eine Grund.
Der andere war das allabendliche Beisammensein im Hotel in Kramfors. Nicht, dass an der Gesellschaft etwas auszusetzen gewesen wäre, die meisten Hotelgäste waren wie er Ingenieure. Hätten die Gespräche nach dem Essen von der Arbeit gehandelt, den Bemessungen oder zu erwartenden Problemen mit der möglicherweise aufwendigsten Fachwerkgerüstkonstruktion der Welt, wäre er gerne dabei gewesen. Solche Unterhaltungen brachten oft ganz neue Ideen hervor.
Aber solch nützliche Gespräche fanden so gut wie nie statt. Nach dem Abendessen wurden im Salon meist zwei unbehagliche Themen erörtert: Frauen und Krieg.
Er fand die Art und Weise, wie die erwachsenen Männer über Frauen redeten, beklemmend und genant. Der in dunkelgrünem Samt gehaltene Salon mit der gedämpften Beleuchtung verwandelte sich in ein Jungenzimmer oder eher noch in einen Kasernenhof und rief Erinnerungen an seine Studentenjahre in Dresden wach. Das despektierliche Verhalten unverheirateter Jungspunde war noch entschuldbar, das verheirateter, gestandener Männer jedoch nicht.
Was das zweite Thema, den Krieg, betraf, herrschte hinsichtlich der bolschewistischen Schandtaten kompakte Einigkeit. Jeder anständige Mensch hatte während des Krieges die Sache Finnlands unterstützt. Und auch jetzt, nach dem teuer erkauften Frieden, der die tapferen Finnen Karelien sowie große Gebiete im Südosten gekostet hatte, gab es nicht viel zu diskutieren. Ein kleiner Lichtblick war, dass Finnland glimpflicher davongekommen war als die Nachbarländer Estland, Lettland und Litauen, die von der Barbarei verschlungen und in Sowjetrepubliken verwandelt worden waren.
Über diese Dinge konnte man reden, denn in diesen Fragen herrschte Einigkeit.
Anders verhielt es sich in Bezug auf die deutsche Offensive an der Westfront. Alle Unterhaltungen über dieses Thema waren ein Minenfeld, auf dem ein unbedachtes Wort eine Explosion des Unbehagens auslösen konnte.
Natürlich stand er aufseiten Deutschlands, was die Eroberung Frankreichs betraf. Endlich hatte man es den Franzosen, diesen unerträglich eingebildeten Gecken, heimgezahlt, die auch dieses Mal ohne akzeptablen Grund den Krieg erklärt hatten. Er hatte geradezu genüsslich in der Zeitung gelesen, dass französische Generäle und Politiker gezwungen worden waren, die Kapitulation im selben Eisenbahnwaggon zu unterzeichnen, in dem sie den Anfang des unchristlichen Friedens von Versailles diktiert hatten. Dank deutscher Organisation und Technik würde auf dem französischen Hühnerhof vielleicht endlich einmal die wünschenswerte Ordnung einkehren.
Frankreich stellte kein Problem dar, Dänemark vermutlich auch nicht. Die Zeitungen hatten ausführlich über das gradewegs gemütliche Verhältnis der dänischen Bevölkerung und der deutschen Gäste berichtet. In Dänemark gab es nach wie vor einen König und eine Regierung, und die germanische Verbrüderung schien reibungslos zu verlaufen.
Auch England war nicht das Problem. Es gab keinen Grund, Mitleid mit den unmenschlichen Engländern zu haben. Sie hatten die Ermordung von Zivilisten eingeleitet, indem sie nicht nur Berlin, sondern auch andere deutsche Städte bombardiert hatten. Dabei hatten die Luftwaffe und das deutsche Heer die unterlegenen Engländer in Dünkirchen mit ausgesprochener Milde behandelt, als fast eine halbe Million Menschen wehrlos auf einem schmalen Küstenstreifen zusammengedrängt worden waren. Hätten die Deutschen sie damals mit Panzern und Flugzeugen angegriffen, wäre es zweifellos in das schlimmste Massaker der Geschichte ausgeartet. Aber die Deutschen hatten sie verschont und ungehindert auf ihre Insel fliehen lassen, um dort ihre Wunden zu lecken. Diese Großzügigkeit beantworteten die Engländer nun also mit massiven Bombenangriffen auf zivile Objekte.
Es war zwecklos, solche Aspekte diskutieren zu wollen. Erstaunlich viele Schweden sympathisierten mit den Engländern, das Gesprächsthema war also äußerst prekär, auch wenn für ihn persönlich England kein Problem darstellte.
Die Norwegen-Frage hingegen quälte ihn umso mehr. Seine Landsleute hatten die deutschen Truppen nicht wie die Dänen mit offenen Armen empfangen. Im Zuge der tapferen, aber sinnlosen Verteidigung waren drei deutsche Kreuzer und mehrere Fregatten versenkt worden, und besonders in Nordnorwegen erlitten die Deutschen schwere Verluste. Das hatte die Voraussetzungen für ein normales und freundschaftliches Verhältnis zwischen Norwegern und Deutschen so gut wie gänzlich zunichtegemacht. König Haakon und der Kronprinz, sein alter Seglerfreund Olav, hielten sich mit der geflüchteten norwegischen Regierung in London auf.
Darüber konnte man mit keinem Schweden reden, obwohl das unbehagliche Thema auf der Hand lag. Alle Kollegen und Arbeiter auf der Baustelle wussten, dass er Norweger war, so sehr er auch versuchte, wie ein Schwede zu klingen. Schwedisieren hatten die Gleisarbeiter auf der Hardangervidda das genannt, aber sobald er den Mund öffnete, hörten alle, dass er Norweger war.
Nein, über die Lage in Norwegen wollte er mit keinem Außenstehenden und eigentlich auch nicht an den Wochenenden beim Abendessen in Saltsjöbaden sprechen.
Hardangervidda. Die Bergenbahn. Dort hatte seine Ingenieurskarriere in sehr jungen Jahren begonnen, und nun, gegen Ende seines Berufslebens, kam es ihm fast so vor, als würde er wieder von vorn anfangen. Vielleicht war ja ein tieferer Sinn darin verborgen.
Es war der kälteste Winter seit hundert Jahren, hieß es. Das Quecksilber sank zwischendurch bis auf fast minus 40 Grad, aber der Wind war nicht so unerträglich wie oben auf der Hochebene. Dennoch fühlte er sich in seine Jugend zurückversetzt, dieses Mal allerdings besser ausgerüstet. Sein alter Wolfspelz leistete ihm gute Dienste, wenn die Arbeit in der frühen, stockdunklen Morgenstunde mit der Erwärmung des Holzes begann.
Das gefroren eintreffende Bauholz ließ sich nicht direkt bearbeiten. Aus den schwedischen Wäldern kamen gerade Stämme von zwanzig Meter Länge, aber zur Pfahlgründung im Fluss war die doppelte Länge nötig. Es mussten also zwei Stämme aneinandergefügt werden. Das war unter normalen Umständen mithilfe von Scheiben und Schrauben kein Problem, aber die Schrauben zersprengten die gefrorenen Stämme, sie zersplitterten wie Glas. Also wurde das Material erst einmal vorsichtig über dem Feuer rotierend erwärmt. In der Theorie eine simple Lösung, in der Durchführung sehr viel schwieriger. Bei zu schneller und starker Erwärmung begann der Baumsaft zu kochen und das Harz auszuquellen, das weichte die Holzfasern auf, und die Schrauben fanden keinen Halt. Wenn das Holz dann erneut gefror, platzten die Verbindungen, und der Pfahl war wertlos oder stellte, genauer gesagt, eine Gefahr dar. Dieses Mal durfte nichts schiefgehen, jedes noch so kleine Detail musste kontrolliert werden.
Keine der vielen Untersuchungen hatte irgendeinen nachweislichen Fehler aufgedeckt und die Frage beantworten können, warum die erste Konstruktion in den Fluss gestürzt war und achtzehn Bauarbeiter mit in den Tod gerissen hatte.
Aber irgendeinen Fehler musste es geben, der die gesamte Gussform für den Brückenbogen in der Endphase zum Einsturz gebracht hatte. Das war das Einzige, was er sicher sagen konnte.
Dennoch war es fraglich, ob das Unglück hätte verhindert werden können, wenn er persönlich in der Schlussphase des Betongusses anwesend gewesen wäre, in der sie sich einer bewährten und bereits vielfach verwendeten Technik bedient hatten, mit der das leitende Bauunternehmen, Skånska Cement, ebenfalls gute Erfahrungen gemacht hatte. Darum war sein Zorn auf die beiden deutschen Autoren wohl auch völlig ungerechtfertigt, die aus unerfindlichen Gründen nicht zusammen im Grand Hotel in Saltsjöbaden wohnen wollten, weshalb einer von ihnen, bedauerlicherweise der Bolschewik und nicht der Nobelpreisträger, bei ihnen zu Hause in der Villa Bellevue beherbergt wurde. Das wiederum hatte zur Folge gehabt, dass er als Gastgeber zum Abendessen hatte nach Hause fahren müssen. Der Gedanke, dass diese banale Frage der Etikette womöglich den Tod von achtzehn Menschen verschuldet hatte, war unerträglich für ihn.
Jetzt begannen sie also wieder von vorne, und es verstand sich von selbst, bei jedem Schritt auf Nummer sicher zu gehen. Es entbehrte nicht einer gewissen Komik, dass sie auf eine ältere Technik, vor dem Einsatz von Beton, zurückgriffen. Auf der Hardangervidda hatte er Brücken aus Stein gebaut. Dazu wurde aus Holz ein Bogen zwischen den beiden zu verbindenden Punkten gespannt. Damit dieser Bogen extremen Wetterbedingungen standhielt, wurde er durch ein stabiles Gerüst, für das Unmengen an Holz nötig waren, von der Talsohle aus abgesichert. So war es im Jahr 1905 gewesen. Jetzt schrieben sie das Jahr 1940 und wandten immer noch dieselbe Technik wie bei seiner Brücke über den Kleivefoss an. Mit dem Unterschied, dass das Bauholz damals nicht über offenem Feuer erwärmt werden musste. Auf der Hardangervidda hatte im Winter der Brückenbau geruht, stattdessen waren Tunnel gebohrt worden.
So gesehen war er also zum Ausgangspunkt seiner Karriere zurückgekehrt.
Der Geruch der mit Schmierseife gescheuerten Bodendielen und gewaschenen bunten Flickenteppiche erinnerte ihn an seine frühen Jahre auf der Hardangervidda, mit denen alles oder zumindest seine Ingenieurslaufbahn begonnen hatte. Der Specksteinofen wurde mit frischem, im Überfluss vorhandenen Abfallholz von der Baustelle geheizt, wenn er abends seine Zeichnungen und Berechnungen im Schein einer Petroleumlampe studierte, da es nur im Erdgeschoss elektrisches Licht gab. Schon bald war es so warm, dass er es nur noch im Unterhemd aushielt. Wenn er dann morgens unter seiner warmen norwegischen Daunendecke erwachte, die er von zu Hause mitgebracht hatte, fand sich auf der Kanne mit Waschwasser eine dünne Eisschicht, und gelegentlich war sogar der Urin im blau gemusterten Nachttopf unter dem Bett gefroren.
All das bescherte ihm einen schwer erklärbaren, inneren Frieden. Wie auch die morgendliche Rasur vor dem gesprungenen Spiegel im Schein der Petroleumlampe, der erste Gang vors Haus im Wolfspelz, die ersten tiefen Atemzüge in der eisigen Luft, wo einem bei Temperaturen um minus 40 Grad die Nase zufror.
Er empfand dieses vertraute Gefühl von Kälte, Dunkelheit und harter Arbeit als eine Art Wallfahrt zurück zu den Ursprüngen, ein geistiges und körperliches Reinigungsritual, indem er wie ein normaler Arbeiter lebte.
Als er die Hardangervidda verlassen hatte, nachdem die Bergenbahn allen Unkenrufen zum Trotz fertiggestellt war, hatte ein neues Leben begonnen. Sein Bruder Oscar hatte auf wunderbare Weise, vielleicht aber auch durch göttliche Fügung, in Afrika ein beachtliches Vermögen erworben, die Grundlage des späteren Wohlstands, um nicht zu sagen Überflusses der Familie für alle überschaubare Zukunft.
Zwei Jahre später hatte er mit der schönsten und schnellsten Segeljacht der damaligen Zeit bei der Kieler Regatta den ersten Platz errungen und beim Abschlussbankett frisch verlobt mit seiner Ingeborg am Tisch des Kaisers gesessen.
Es hätte alles ganz anders laufen können. Ingeborgs Vater, Baron von Freital, glaubte nicht an die Liebe, dafür umso mehr an Geld und Abstammung und ganz besonders an lukrative Verbindungen dieser beiden Größen. Ohne das Vermögen, das Oscar mit Mahagoni und Elfenbein in Afrika erworben hatte, wäre Ingeborg niemals die Frau eines einfachen norwegischen Ingenieurs geworden. Dass er an der Technischen Hochschule in Dresden der Beste seines Jahrgangs gewesen war, hatte ihm wenig genützt.
Warum Gott ihm und seinen Brüdern solche Gunst erwies, war ebenso unergründlich wie die Tatsache, dass der Herr in ihrer Kindheit sowohl den Vater als auch den Onkel zu sich gerufen hatte.
Nach seiner Rückkehr von der Hardangervidda nach Bergen wäre eine andere Entwicklung viel wahrscheinlicher gewesen. Ein beamteter Ingenieur verdiente in Norwegen 600 Kronen im Jahr zuzüglich freier Unterkunft, was ihm einen ähnlichen Lebensstandard wie jetzt ermöglicht hätte, nur mit sechs oder sieben Meter hohen Schneewehen vor dem Haus.
Oscar und er hätten in Bergen natürlich eine Firma für Ingenieurbau gründen und es auf diese Weise zu bescheidenem Wohlstand bringen können, allerdings wäre es ihnen sicher nie gelungen, an die Spitze der feinen Gesellschaft Bergens aufzusteigen. Früher oder später hätten sie beide eine Bergenserin geheiratet und ein gänzlich anderes Leben geführt als das gegenwärtige.
Ohne Ingeborg wäre sein Leben ärmer gewesen, so viel war sicher. Er liebte sie mehr als alles andere auf dieser Welt. Mit Ausnahme Gottes empfand er nur für Ingeborg dieses große Gefühl, das nicht einmal seine Kinder mit einschloss.
Die größte Gnade, die Gott ihm erwiesen hatte, war nicht das Vermögen, sondern Ingeborg, wenngleich er natürlich ohne das Geld aus Afrika keine Chancen bei Baron von Freital gehabt hätte. Bis zum Hochzeitstag hatte der seine Tochter mit demselben selbstverständlichen Besitzanspruch wie seine Segelboote und Schlösser betrachtet.
Der Geruch von Schmierseife, das Knacken des frischen, harzigen Brennholzes im Ofen und die Eisschicht auf dem Nachttopf waren also ein Reinigungsritual für die Seele und die sublime Erinnerung daran, wie viel er Gott zu verdanken hatte.
Vor allem aber erinnerten ihn diese Dinge an all das, was er zumindest in den letzten Jahren zu verdrängen suchte, nämlich wie leicht es doch gewesen war, Armut in Reichtum zu verwandeln. Der Wert des Immobilienbesitzes der Familie in Berlin und Dresden ließ sich kaum mehr berechnen, was allein Oscars Verdienst war, wenn auch mithilfe der deutschen Hyperinflation der Zwanzigerjahre. Er selbst war einfach nur ein von Gottes Gnade in seltenem Maße begünstigter Brückenbauer.
Seine Rückkehr in die Kälte und Dunkelheit war für ihn wahrhaftig eine gesunde Unterbrechung seines gewohnten Lebens, die ihm Zeit zum Nachdenken und Kraftschöpfen gewährte. Nachts träumte er ab und zu vom Leben auf der Hardangervidda. Wenn er im Halbschlaf die Füße auf den eiskalten Dielenboden setzte, um seine Blase zu erleichtern, wie es bei Männern seines Alters nächtens nun einmal nötig war, hatte er oft das Gefühl, dort zu sein.
Aber Britta, seine Wirtin und die Besitzerin des kleinen Holzhauses am Flussufer, war ganz anders als die derben, burschikosen Köchinnen auf der Hochebene, die unangefochtenen Herrscherinnen der Baracken, die mühelos zwei Dutzend Männer in ihre Schranken wiesen, gleichgültig, wie liebeskrank diese nach mehreren Monaten im Gebirge waren.
Britta war in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil dieser Köchinnen, eine entzückende Frau. Obwohl sich ein Mann in seinem Alter, immerhin war er bereits 65, vielleicht nicht auf diese Weise über eine Frau äußern sollte, um Missverständnisse zu vermeiden. Was ihn jedoch nicht ernsthaft von der unübersehbaren Tatsache abhielt. Und was er in seinem stillen Giebelzimmer dachte, konnte niemanden verletzen oder beschämen.
Sie war in der Tat eine entzückende Frau. Immer fröhlich und munter, immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen, niemals verdrossen und äußerst dienstbeflissen und fleißig. Vormittags putzte sie im Hotel in Kramfors, danach kehrte sie mit dem Bus zurück, um nach dem Mittagessen in den Essensbaracken der Arbeiter am Fuß der Brücke aufzuräumen und anschließend zu ihm nach Hause zu eilen, um das Abendessen zu richten. All diese Aufgaben bewältigte sie wie im Flug und mit gleichbleibend guter Laune.
Einen solchen Menschen, der es im Leben sicher nicht allzu leicht gehabt hatte, musste man einfach mögen, geradezu bewundern. Ihr Sohn hatte als Privatist in Härnösand das Abitur abgelegt. Zweifellos hatte sie ihm die Ausbildung mit ihrer harten Arbeit finanziert. Jetzt war der Junge wie alle anderen eingezogen worden, mit voraussichtlich langer Dienstzeit, da er ein Abiturzeugnis besaß und für die Offizierslaufbahn vorgesehen war.
Dies war nach der ersten, vorsichtig herantastenden Phase das erste ungezwungene Gesprächsthema zwischen ihnen gewesen. Beide hatten sie Söhne beim Militär, irgendwo in Schweden. Sie sorgte sich, weil der Militärdienst so viel Zeit verschlang und sie doch so dringend darauf angewiesen war, dass ihr Sohn Hjalmar endlich zu ihrem Unterhalt beitrug. Sein Sohn Karl tat auf unbestimmte Zeit bei der Marine Dienst. Das Studium an der Handelshochschule sowie diverse Praktika im Büro hatte er noch vor Kriegsbeginn abgeschlossen, aber als Leutnant der Marine war er in Kriegszeiten nun einmal unabkömmlich.
Brittas Sohn würde zum Unteroffizier aufsteigen, sah es doch ganz so aus, als würde der Krieg noch mindestens zwei Jahre andauern. Den Engländern war auf ihrer Insel nicht beizukommen. Er hatte Britta erklärt, dass Bewerber mit Offiziersrang nach dem Krieg im Berufsleben besonders gute Chancen hätten, was sowohl für ihren als auch für seinen Sohn galt.
In Wirklichkeit hatten sie natürlich nicht die gleichen Voraussetzungen. Es war ein beträchtlicher Unterschied, den Krieg wie sein Sohn Karl als Hauptmann der Marine der Reserve mit einem Examen von der Handelshochschule und einem garantierten Arbeitsplatz im Familienunternehmen zu beenden oder wie Brittas Sohn Hjalmar als abgedankter Unteroffizier ohne akademische Ausbildung auf Arbeitssuche zu gehen. Und dennoch wies ihre Lebenssituation, mal abgesehen vom Klassenunterschied, gewisse Ähnlichkeiten auf.
Britta jedenfalls machte sich hauptsächlich Sorgen um das Geld, und daher mied er die Frage, ob Hjalmar nach Beendigung des Militärdienstes studieren wolle, das Abitur war schließlich nur der erste Schritt. Sie jedoch schien es als die Spitze der Ausbildung und Eintrittskarte zu einer besseren Stellung in der Gesellschaft und damit auch zu einer besseren Anstellung zu betrachten. Lauritz unterließ es, ihr in diesem Punkt zu widersprechen.
Auf den wenigen Briefen, die sie bekam, in der Regel von der Sparbank in Kramfors, stand »Fräulein Britta Karlsson«. Und sie schien definitiv noch unter vierzig zu sein. Ihr Sohn war Anfang zwanzig, also musste sie ihn mit sechzehn oder siebzehn Jahren zur Welt gebracht haben.
Eine unverheiratete Mutter also, und wer immer Hjalmars Vater sein mochte, er war offenbar spurlos verschwunden. Sie erwähnte ihn jedenfalls nie.
Dagegen hatte er nichts einzuwenden. In dieser Frage entsprang seine Prinzipienfestigkeit nicht nur seiner grundeigenen Überzeugung, sondern zudem jahrzehntelanger Erziehung vonseiten Ingeborgs und ihrer besten Freundin, seiner Schwägerin Christa. Während ihrer Jugend in Deutschland hatten beide linksradikale Ansichten vertreten, Christa hatte sogar mehrere Jahre lang die Sexualaufklärung der Arbeiterklasse in Berlin betrieben und selbst mehrere Schwangerschaftsabbrüche durchgemacht. Beide wiesen mit Fug und Recht und nicht ohne Ironie darauf hin, dass die einsame und sitzen gelassene Mutter als sittenlos betrachtet wurde, während der sich feige allem entziehende Kindsvater ungeschoren davonkam. Lauritz teilte demnach nicht die Vorurteile seiner Zeit, dass alleinstehende Mütter besonders leichte Beute für Affären waren.
Jedenfalls weigerte Britta sich tapfer, Büßerhaltung einzunehmen, weil sie die einzige unverheiratete Mutter im Ort war. Man konnte sich unschwer vorstellen, was die nordschwedische Dorfbevölkerung von derlei Dingen hielt. Vermutlich herrschten dort genau dieselben Ansichten wie auf seiner Heimatinsel in Westnorwegen.
Trotzdem zeigte sie immer ein strahlendes Lächeln und gerötete Wangen, wenn sie von einer Arbeit zur nächsten und schließlich zu ihrem Untermieter eilte. In ihrer Aufrichtigkeit war sie ein Naturkind, das sich seiner offensichtlichen körperlichen Vorzüge nicht bewusst zu sein schien. Wenn sie sich vorbeugte, um den Küchenboden zu wischen, und ihm dabei ihr prächtiges Hinterteil entgegenstreckte, schien ihr die aufreizende Wirkung nicht klar zu sein. Eine solche Frau musste man einfach mögen.
Sie konnten sich also über das Befinden ihrer Söhne beim Militär unterhalten, den einzigen Aspekt des Krieges, der sie abgesehen von Lebensmittelmarken und Bezugsscheinen interessierte. Ihre Unterhaltungen gestalteten sich einfach und direkt. Nach einem Monat schlug er ihr vor, dass sie sich zumindest im Haus mit den Vornamen statt mit »Herr Ingenieur« und »Frau Karlsson« anredeten. Die Betitelung Fräulein verwendete er nicht, weil sie für ihn als Mutter Frau Karlsson war, unverheiratet oder nicht.
Eine bessere Unterbringung in der Nähe der Baustelle hätte er sich nicht vorstellen können. Die Gerüche, die Schmierseife, die eisige Morgenstunde, das laute Klopfen des Schlagbären, der den Pfahl mit jedem Schlag sechzehn Millimeter tiefer in die Erde und den Brückenbau seiner Vollendung entgegentrieb. Hier sollte sich einmal der längste Brückenbogen der Welt erstrecken. Dies war seine geheime, private Welt, in der er einfache Arbeitskleidung trug, hausgemachte Fleischwurst oder Labskaus zum Abendessen aß und ein Pils trank, aber keinen Schnaps, geschweige denn Wein.
In der schmalen Kleiderkammer im Obergeschoss, einer Nische zwischen zwei Dachbalken mit einem gesprenkelten Tuch statt einer Tür davor, verwahrte er die Kleider, die er auf der Heimreise trug. Wenn er übers Wochenende nach Hause fuhr, brach er zu einem Zeitpunkt auf, an dem Britta nicht zu Hause war, zog sich rasch seine Stadtkleider an und begab sich zu dem wartenden Holzgastaxi.
*
Obwohl es der kälteste Winter des Jahrhunderts war, fuhren die Züge mit den schneebedeckten, an Eisbären erinnernde Lokomotiven pünktlich. Die Erste-Klasse-Abteile waren angenehm geheizt, und bei jedem Schienenstoß klirrte die Wasserkaraffe aus Kristall. Das Licht der Leselämpchen mit den blütenförmigen, matt geschliffenen Glasschirmen fiel sanft auf das ausklappbare Tischchen, die roten Samtbezüge waren nie zu warm, nie zu kalt, und vor den fast zugefrorenen Abteilfenstern pfiff der Fahrtwind. Die Erste Klasse war nur selten ausgebucht wie die übrigen Abteile, da Armeeangehörige unter dem Dienstgrad eines Oberstleutnants in dieser Klasse nicht reisen durften. Oft saß er ganz allein in einem Abteil des Schnellzugs nach Stockholm.
Am Wochenende nach Hause zu fahren, in die andere Welt, zur Familie, war immer gleichermaßen entspannend, auch wenn die italienischen Maßschuhe anfänglich etwas eng waren, nachdem er zwei Wochen lang in groben Stiefeln mit dicken Wollsocken herumgelaufen war. In seiner Welt am Flussufer, in der jeder Arbeitstag damit begann, dass zwei Schlepper das Eis der Nacht aufbrachen, dachte er nur selten an zu Hause. In der anderen Welt, der Villa Bellevue mit Ingeborg und den Kindern, ertappte er sich immer häufiger dabei, dass er sich auf die Baustelle zurückwünschte.
Er wusste nie, was ihn bei seiner Rückkehr nach Saltsjöbaden erwartete und mit wie vielen Familienmitgliedern zum Sonntagsdiner zu rechnen war. Karl tat bei der Kriegsmarine Dienst, wo auf Sonntagsessen im Kreis der Familie keine Rücksicht genommen wurde. Bei Rosa war es ähnlich. Sie hatte sich gegen eine große Anzahl Mitbewerber durchgesetzt und als hoffnungsvolle Aspirantin im Außenministerium angefangen. Inzwischen arbeitete sie in einem Büro ohne Türschild in der Nähe des Karlaplan und weit weg vom Außenministerium. Was genau sie dort tat, war äußerst vage und offenbar streng geheim. Er vermutete, dass ihre Tätigkeit damit zu tun hatte, dass sie besser Deutsch sprach als die meisten Deutschen, und mehr wollte er gar nicht wissen.
Ähnlich verhielt es sich mit der ältesten Tochter Johanne, die in Literaturgeschichte promoviert hatte, jedoch keine Dozentur, sondern aufgrund irgendwelcher akademischer Intrigen nur eine Stelle als Gymnasiallehrerin bekommen hatte. Zumindest stellte sie es so dar. Er vermutete, dass sie sich in den Kreisen der literarischen Stockholmer Boheme bewegte und Freunde hatte, die sie zu Hause nicht vorstellen wollte. Über die Beweggründe zu sinnieren war sinnlos, dafür gab es sicher eine natürliche Erklärung. Dass sie recht häufig in das besetzte Norwegen reiste, unter dem Vorwand, ihre betagte Großmutter auf Osterøya zu besuchen, beunruhigte ihn da wesentlich stärker. In der Regel kehrte sie mit einer geräucherten Hammelkeule oder einem anderen greifbaren Beweis, wirklich dort gewesen zu sein, zurück. So seltsam ihre Ausflüge ihm auch vorkamen, hatte er sie diesbezüglich nie befragt.
Seine Wochenenden zu Hause warteten immer mit irgendwelchen Überraschungen auf. Entweder waren Ingeborg und er allein oder sie waren eine große Runde, wenn etwa ein Geburtstag gefeiert wurde, Ereignisse, über die er peinlicherweise keinen Überblick hatte, und Oscar mit seiner Familie von der anderen Seite des Källvägen herüberkam.
Da die Kleiderordnung fürs Diner, unabhängig von der Größe der Gesellschaft, ohnehin immer dieselbe war, spielte es keine Rolle, ob er im Voraus Bescheid wusste oder nicht. Wenn Ingeborg und er allein waren, verlief die Unterhaltung ungezwungen, da sie beide im Unterschied zu anderen Familienmitgliedern keine unumstößlichen Überzeugungen über den Krieg vertraten. Gespräche über den Krieg führten oft zu Streit, der im schlimmsten Fall den ganzen Abend verdarb.
Der Schnellzug traf mit fünfminütiger Verspätung auf dem Stockholmer Hauptbahnhof ein.
Das war etwas ärgerlich, aber wenn gleich eine Straßenbahn nach Slussen kam, würde er die 18-Uhr-Bahn nach Saltsjöbaden noch erreichen und wäre wie immer um Punkt sieben Uhr zu Hause.
Die Straßenbahn war voller junger Leute auf dem Weg ins Kino oder Restaurant, es gab nur noch Stehplätze im sehr kalten Freien, was ihm durch die Abhärtung in der Winterkälte Ångermanlands nicht viel ausmachte. Er hatte es sich seit Langem abgewöhnt, sich überallhin chauffieren zu lassen. Straßenbahn und Bahn waren ohnehin die schnellsten Verbindungen nach Saltsjöbaden. Zumindest ging es mit der Saltsjö-Bahn schneller als mit dem Auto.
Der Zug war leer, dafür warteten viele Leute auf dem Bahnsteig der Endstation, die vermutlich für einen Restaurant-, Theater- oder Kinobesuch in die Stadt fahren wollten. Die Rationierung hatte absurderweise dazu geführt, dass man im Restaurant einfacher gut essen und trinken konnte als zu Hause.
Die von meterhohen Schneewällen gesäumte Straße zum Grand Hotel war ordentlich geräumt, die Straße am Hotel vorbei zur Strandpromenade befand sich im selben vorbildlichen Zustand. So würde er in weniger als zehn Minuten zu Hause sein.
Die Villa Bellevue lag dunkel und still auf ihrer Anhöhe. Im Obergeschoss brannte kein Licht. Das bedeutete, dass die jungen Leute nicht zu Hause waren. Keine Fackeln vor dem Portal und die Freitreppe nicht vom Schnee geräumt, also kamen keine Gäste.
Er blieb vor dem Tor stehen und schaute zu dem dunklen Haus hinauf. Sein Atem stand wie weißer Rauch vor seinem Mund. Er war schnell nach Hause gegangen, vorfreudig. Erst jetzt bemerkte er die Kerze im Erker, ihr Zeichen, dass sie den Samstagabend allein verbringen würden. Darauf hatte er gehofft.
Er ging den steilen Källvägen hinauf zum Kücheneingang. Im Betonaquarium, Oscars moderner Villa mit den riesigen Panoramafenstern auf der gegenüberliegenden Straßenseite, brannte nur wenig Licht. Auch dort war offenbar für das Wochenende nichts geplant.
Als er die steile Treppe erklomm, sah er, dass der Schnee auf dem Hof vor dem Kücheneingang geräumt war. Spuren von Lastwagenreifen waren zu sehen. Karlsson, der Chauffeur ohne Auto, hatte offenbar eine Lösung gefunden, um nicht den ganzen Tag Schnee schippen zu müssen. Aber der Hang zum Spielplatz und zu den Schaukeln hinauf war schneebedeckt. Dort hatten die Jungen immer Skispringen geübt, aber diese Zeiten waren lange vorbei. Die Jungen waren im Krieg. Zumindest Karl. Was Harald tat oder wo er sich befand, daran wagte er gar nicht zu denken.
In der Küche brannte Licht. Er sah, wie sich jemand darin bewegte, vermutlich Ingeborg. Womöglich erschreckte er sie, wenn er das Haus nicht wie gewohnt durch den Haupteingang, sondern durch die Küche betrat. Mitten in seinen Überlegungen stellte er fest, dass er ohnehin keine Wahl hatte, weil der Weg um das Haus herum von riesigen Brennholzbergen versperrt war, die benötigt wurden, seit das große Haus sich nicht mehr allein mit der rationierten Kohle und dem Koks heizen ließ. Also nahm er zu guter Letzt doch den Kücheneingang.
Als er Ingeborg in den Arm nahm, fiel ihm auf, wie warm sie sich anfühlte, und dünner war sie auch geworden. Wortlos hielten sie sich in den Armen. Er wollte in dieser Umarmung verweilen, nichts sagen, nicht loslassen, einfach nur das Gefühl von Zweisamkeit auskosten. Das Gefühl verflüchtigte sich, als sie ihm aus dem Mantel half und er sich seiner Galoschen entledigte, während sie ihm erzählte, dass zum Abendessen eine norwegische Überraschung serviert würde, was der Duft aus der Küche ihm bereits verraten hatte.
Er lief rasch in sein Schlafzimmer hinauf, um sich seiner Reisekleider zu entledigen, Ingeborg hatte sich bereits umgezogen.
Sein Schlafzimmer war das einzige Unveränderte, wenn er samstagabends nach Hause kam. Im Übrigen musste er mit allem rechnen, einem Gewimmel von Gästen, die sich mit einem Glas Sekt in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand angeregt unterhielten, oder die Familie in ganzer oder halber Besetzung, mit oder ohne Bruder Sverre, umgestellte Möbel, neue Vorhänge oder neue Gemälde. Immer gab es Überraschungen. Aber sein Schlafzimmer hatte sich, seit sie vor über zwanzig Jahren in das Haus eingezogen waren, nicht verändert.
Das große Bett aus dunkel gebeizter Eiche, ein Kleiderschrank aus demselben Material, der den größten Teil der einen Längswand einnahm, ein Nachttisch mit einer Lampe und einer Bibel, vor dem Fenster ein einfacher Schreibtisch. Rechts vom Bett hing ein Kruzifix, links davon eine Fotografie seiner Jacht Ran mit Spinnaker in den norwegischen Farben. Bedauerlich, dass es damals noch keine Farbfotografie gegeben hatte.
Er zog sich rasch aus, nahm die getragene Unterwäsche aus seinem einzigen Gepäckstück, einer Krokodilledertasche, und legte sie in den Wäschekorb. Alle anderen Kleidungsstücke, die er in Lunde trug, wusch Britta. Dann ging er ins Badezimmer und rasierte sich zügig und ohne sich zu schneiden. Das Frischmachen nahm weniger als zehn Minuten in Anspruch.
Ingeborg erwartete ihn wie immer, wenn sie allein waren, im Erker. Sie hatte noch eine weitere Kerze angezündet und eine halbe Flasche Moselwein aus dem Keller geholt. Er lobte ihre Wahl, und sie scherzte, dass der Krieg auch das Leben der Frauen auf seltsamste Weise verändere, beispielsweise in der Notwendigkeit, sich in einem Weinkeller zurechtzufinden.
Wenn sie unter sich waren, begannen sie ihren Abend immer im Erker. Er erkundigte sich nach ihrer Arbeit als Vorsitzende des Roten Kreuzes in Saltsjöbaden und in ihrer Praxis, in der sie wegen dieses Ehrenamts aber nur noch drei Tage pro Woche arbeiten konnte. In letzter Zeit hatte sie sich auf zwei Dinge konzentriert, die Norwegenhilfe und Erste-Hilfe-Kurse mit besonderem Gewicht auf Brandverletzungen. Außerdem kümmerte sie sich um Kleidersammlungen und strickte, denn warme Wollstrümpfe wurden immer gebraucht.
Lauritz fand, dass sie sich zu viel Arbeit aufbürdete. Brandverletzungen in allen Ehren, aber es war äußerst unwahrscheinlich, dass jemals Bomben auf Saltsjöbaden abgeworfen würden. Als Lauritz Ingeborgs bekümmerte Miene bemerkte, bereute er augenblicklich seinen scherzhaften Tonfall.
»Darum geht es doch gar nicht«, erwiderte sie. »Es ist der Umstand, dass ich gebürtige Deutsche bin, was alle wissen. Ich muss zeigen, dass meine Loyalität hier bei ihnen liegt und nicht bei … du verstehst schon.«
»Jeder, der dich reden hört, hält dich für eine Norwegerin«, wandte Lauritz etwas lahm ein und merkte, dass er automatisch auf Deutsch geantwortet hatte, worauf er den Satz noch einmal mit größerem Nachdruck auf Norwegisch wiederholte.
»Ach was«, meinte sie. »Alle wissen genau, wie es sich verhält. Mit deiner Nichte und deinem Neffen auf der Schule in Tattby ist es genauso. Die anderen Kinder ziehen sie auf oder bewundern sie, weil sie Deutsche sind, und das eine ist ebenso schlimm wie das andere. Ich denke, wir sollten es genau wie Johanne machen und Schweden werden.«
»Du meinst, wir sollen einen Antrag auf schwedische Staatsangehörigkeit stellen?«
»Ich habe mich erkundigt. Nach so vielen Jahren in Schweden wäre das eine reine Formalität.«
Ingeborgs Vorschlag überrumpelte ihn. Natürlich war er Norweger, aber er lebte und arbeitete schon so lange in Schweden, dass die Farbe seines Passes doch wohl gleichgültig war.
Mitnichten, wandte Ingeborg ein, in Zeiten wie diesen. Die deutschen Truppen waren unbezwingbar, dafür gab es genügend Beweise. Die deutsche Presse bezeichnete Norwegen bereits als Nordland, eine Provinz im germanischen Großdeutschland wie Österreich oder Ostpreußen. Als selbstständiges Land existiere Norwegen schon gar nicht mehr. Wie schwer es ihm auch fallen möge, das zu akzeptieren, so sei es doch die Realität. Norweger zu sein bedeute, Deutscher zu sein, wenn nicht jetzt, dann doch in naher Zukunft.
Lauritz fiel keine passende Erwiderung ein. Bei politischen Diskussionen mit Ingeborg zog er immer den Kürzeren. Ihr ganzes Leben handelte seit den Tagen der Frauenwahlrechtsbewegung von Politik, und Christa und sie diskutierten noch immer angeregt und tiefgründig über Sozialdemokratie und Bolschewismus.
»Aber«, wandte Lauritz nach einer Weile ein. »Wenn ich in Norwegens schwerster Stunde Schwede werde, wäre das kein Verrat? Und wenn es Hitler einfällt, sich auch Schweden als Svealand oder was auch immer einzuverleiben, stehen wir vor demselben Dilemma. Die schwedische Armee hat gegen die Deutschen keine Chance, möglicherweise etwas länger als die norwegische, aber nicht auf lange Sicht.«
»Das soll uns jetzt nicht kümmern. Den Pass zu wechseln, um nicht deutscher Untertan werden zu müssen, hat mit Verrat nichts zu tun.«
Lauritz war ratlos. Über Fragen der Staatsbürgerschaft oder dass sein norwegischer Pass ihn zum Deutschen machen könnte, hatte er sich nie Gedanken gemacht. Ein eintretendes Dienstmädchen rettete ihn mit der Ankündigung, das Abendessen sei im kleinen Esszimmer angerichtet, aus seiner Verlegenheit.
»Ist heute nur Anne da?«, wechselte Lauritz das Thema, als sie sich erhoben, um sich zu Tisch zu begeben, wohl wissend, dass die Frage der Staatsbürgerschaft damit nicht erledigt war.
»Ja«, erwiderte Ingeborg. »Ich habe Jorunn und Signy Geld fürs Kino gegeben. Das Kochen war heute nicht so kompliziert, wie du gleich sehen wirst.«
Als Vorspeise gab es Makrelenrogen mit einer Pfeffersauce aus Rømme, norwegischem Sauerrahm. Das moderne Fischbesteck aus Edelstahl ließ darauf schließen, dass es gelaugten Stockfisch geben würde, der das sonst übliche Silberbesteck blaulila anlaufen ließ, was aufwendiges Putzen nach sich zog.
Zum Kaviar bekam Lauritz einen Schnaps und ein Bier, aber es standen auch Weingläser auf dem Tisch, was seine Neugier weckte. Es war nicht einfach, einen passenden Wein zu Stockfisch zu finden.
Lauritz lobte das Essen und wie sie es geschafft hatte, die knappen Lebensmittel herbeizuzaubern. Makrelenrogen und Stockfisch in Lauge waren zwar nicht rationiert, aber am ersten Advent sicher nicht leicht zu kriegen, redete er drauflos. Ingeborg ließ ihn erzählen, stieß mit Dünnbier an, während er seinen Schnaps trank, und meinte dann, Johanne hätte die Sachen von Osterøya mitgebracht. Es sei also nicht irgendein Stockfisch.
Die Unterhaltung kam zum Erliegen, und eine Weile war nur das Klappern von Messer und Gabel zu hören.
»Und?«, meinte sie und legte das Vorspeisenbesteck beiseite. »Sag mir, was du davon hältst.«
Sie sprach wieder Norwegisch.
»Von dem Makrelenrogen?«
»Tu nicht so, du weißt sehr wohl, wovon ich rede.«
»Hast du schon mit Karl und Rosa gesprochen?«, versuchte er Zeit zu gewinnen, sah aber im selben Augenblick ein, wie dumm diese Frage war.
Karl war schwedischer Offizier, Rosa arbeitete im Außenministerium in Stockholm. Natürlich besaßen die beiden schon lange die schwedische Staatsangehörigkeit. Das war so nebenbei und selbstverständlich passiert, dass sie es bislang nicht diskutiert hatten.
Ingeborg antwortete mit einem Lächeln, als sie ihren Mann sich seiner Gedankenlosigkeit bewusst werden sah.
»Also«, fuhr er fort, »sind nur wir zwei noch norwegische Staatsangehörige? Ich gebe mich geschlagen. Wir tun, was du für richtig hältst. Wie funktioniert das rein praktisch?«
»Die Anträge liegen im Arbeitszimmer, du musst nur noch unterschreiben«, sagte sie und klingelte mit dem Silberglöckchen zum Signal, dass es Zeit für den Stockfisch sei.
Der Dorsch war delikat. Von bester Qualität und nicht so groß wie bei den Schweden üblich. Dazu gab es keine fade helle Sauce, sondern knusprig gebratenen Speck und ausgelassenes Fett, grünen Erbsenbrei und Senf.
»Und jetzt zu meiner kleinen Überraschung«, sagte Ingeborg, als sie sich bedient hatten. »Ich habe einen Wein gefunden, der ausgezeichnet zu diesem exotischen Gericht passt.«
Sie klingelte erneut mit dem Silberglöckchen, und Anne, die offenbar vor der Tür gewartet hatte, trat mit einer schmalen grünen Flasche ein, die auf Moselwein schließen ließ. Damit lag er jedoch falsch.
»Das ist ein Riesling aus dem Elsass, besonders geeignet für sture Norweger, die sich weigern, französischen Wein zu trinken«, erklärte Ingeborg feierlich und lachte perlend. Es dauerte einige Sekunden, bis er ihren Scherz verstand.
Elsass-Lothringen war wieder Teil des deutschen Vaterlands und hieß nicht mehr Alsace-Lorraine. Der Gedanke, sich so gelegentlich wieder einen französischen Wein oder Champagner erlauben zu können, war ihm auch schon gekommen.
Und er musste Ingeborg unumwunden recht geben: Der Riesling aus dem Elsass passte in der Tat hervorragend zu echtem norwegischem Stockfisch.
Nach dem Essen sahen sie sich ein paar neue Gemälde an, die Ingeborg mit Sverres Hilfe von dem jüdischen Künstler gekauft hatte, der neuerdings in der großen Holzvilla des Schnupftabakfabrikanten Ljunglöf ein paar Hundert Meter weiter die Strandpromenade hinunter wohnte. Es handelte sich um typisch modernistische Werke, die mehr an Träume als an Wirklichkeit erinnerten und nicht ganz seinem Geschmack entsprachen. Er stimmte Ingeborg jedoch zu, dass sich die Farben der Gemälde auf den hellgelben Wänden des Esszimmers sehr gut machten.
Wie immer, wenn sie den Abend zu zweit verbrachten, kehrten sie nach dem Essen in den Erker zurück. Die beiden Kerzen waren fast heruntergebrannt. Ingeborg ärgerte sich, sie nicht ausgeblasen zu haben, als sie zu Tisch gegangen waren, aber Lauritz fand, dass man es mit der Sparsamkeit auch übertreiben könne.
An Samstagabenden konnten sie zwischen vielen unterhaltenden Radioprogrammen auswählen. Sie entschieden sich für den deutschen Sender, der mit einem Beethovenabend, der Kreutzersonate und der Pastoralsinfonie, gespielt von den Berliner Philharmonikern, aufwartete, eine ungewöhnlich friedliche Musik in diesen kriegerischen Zeiten. Anne servierte Kaffee, Likör und Weinbrand und brachte zwei neue Kerzen.
Während des zweiten Satzes der Violinsonate lehnte er sich zurück, schloss die Augen und versuchte, sich ganz der Musik hinzugeben, als gäbe es nur sie und die ihm gegenübersitzende Ingeborg. Sie war immer bei ihm, auch im Norden am Ångermanälven, und sie beherrschten seit vielen Jahren die Kunst, zusammen zu schweigen, besonders wenn sie Musik hörten.
Wenn Gott ihm die Gabe verliehen hätte, Musik zu komponieren, statt Brücken zu bauen, wäre er sicher eher ein Beethoven als ein unwiderstehlich mitreißender Mozart gewesen, von femininen Komponisten wie Chopin, Schumann und Tschaikowski ganz zu schweigen. Sofort schämte er sich seiner kindischen Gedanken. Aber nur Gott konnte ihn in diesem Augenblick durchschauen. Und vielleicht Ingeborg. Sie schien seine Gedanken lesen zu können, während er sie immer fragen musste, was in ihrem Kopf vorging.
In der Pause zwischen der Violinsonate und der Sinfonie, in der nur die Unterhaltungen des Publikums und das seine Instrumente stimmende Orchester zu hören waren, bemerkte er Ingeborgs gequälten Gesichtsausdruck, der trotz des schwachen Kerzenlichts deutlich zu erkennen war. Ein eisiges Gefühl erfasste ihn, er musste etwas sagen, musste fragen.
»Geliebte Ingeborg … was ist los?«, brachte er schließlich flüsternd über die Lippen. Wie auf frischer Tat ertappt, sah sie ihn an.
»Mit mir … nichts. Leichte Schmerzen … Nein, das ist es nicht. Es geht um dich, Lauritz. Du willst es nicht sehen. Wenn Oscar mich nicht aufgeklärt hätte, dass der Strauß seinen Kopf gar nicht in den Sand steckt, würde ich sagen, du bist ein Strauß. Ein guter, liebenswerter … Strauß.«
»Und was ist es deiner Meinung nach, was ich nicht sehen will?«
»Ist dir klar, dass Johanne nicht nur zu ihrer Großmutter nach Osterøya fährt, um dort Stockfisch und geräucherten Makrelenrogen zu holen?«
»Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, worauf du hinauswillst.«
»Meine Güte, Lauritz! Sie nutzt ihre deutsche Herkunft, ihre hervorragenden Empfehlungen und unsere Mitgliedschaft im schwedisch-deutschen Freundschaftsverein, um sich laufend neue Einreisevisa zu beschaffen. Und das sicher nicht, um Hammelfleisch und getrockneten Fisch zu besorgen.«
»Aber was …?«
Er verstummte. Sie betrachtete ihn zuerst mit strenger Miene, dann schüttelte sie lächelnd den Kopf.
»Lauritz, Lauritz, Lauritz …«, sagte sie seufzend. »Begreifst du denn nicht, dass sie als Kurierin für die Heimatfront tätig ist? Sie überbringt geheime Botschaften und riskiert mit jeder Reise aufs Neue ihr Leben. Und niemandem, zumindest mir nicht, gelingt es, sie zur Vernunft zu bringen. Aber lass uns später weiterreden, das Konzert geht weiter.«
Lauritz lehnte sich wieder zurück, schloss die Augen und versuchte, sich auf die Musik zu konzentrieren, was ihm nicht gelang.
Die Pastoralsinfonie war in seinen Ohren die harmonischste und freundlichste Sinfonie Beethovens. Beim Hören dieser Musik sah er weidende Schafe vor sich, aber nicht die in seiner Heimat übliche graupelzige Rasse, die sich übellaunig und robust gegen Wind und Wetter Westnorwegens behauptete. Die Schafe dieser Musiklandschaft stammten aus südlicheren, freundlicheren Gefilden, einer grünen, hügeligen Landschaft voller saftiger Weiden, einer Landschaft wie das südliche Sachsen, Ingeborgs Heimat.
Jetzt tauchten ganz andere Bilder vor seinem inneren Auge auf. Johannes Kindergesicht zu Hause in Bergen, dann als Jugendliche in Saltsjöbaden, die bei ihrer Abiturprüfung einen »Skandal« provoziert hatte, und jetzt als erwachsene Frau, scharfsinnig, mutig und schön, und das nicht nur in den Augen eines liebenden Vaters.
Mut und Willensstärke waren ihre grundlegenden Charaktereigenschaften. Und eine ideologische Unerschrockenheit, die sie natürlich von ihrer Mutter geerbt hatte.
So handelte der sogenannte Skandal am Examenstag, an dem es ihr groteskerweise gelungen war, ausgerechnet ihre Deutschnote zu verschlechtern, obwohl sie die Sprache sicher um Längen besser beherrschte als der einfältige Prüfer, auch von Politik.
Ganz offensichtlich agierte sie auch jetzt wieder aus politischer Überzeugung ohne Rücksicht auf die Folgen. Obwohl sich die Konsequenzen dieses Mal als viel schwerwiegender erweisen konnten. Es führte kein Weg an der unerbittlichen Wahrheit vorbei, dass es jetzt um Leben und Tod ging.
Ein Kurier der Heimatfront galt als Spion und wurde erschossen. Das war überall so. Die Franzosen hatten etliche deutsche Spione erschossen, auch noch nach der Besetzung des Ruhrgebiets, als eigentlich schon Frieden herrschte. Die Engländer verfuhren mit Spionen auch nicht zimperlich, von den Russen ganz zu schweigen, die nicht zögerten, diese so lange zu foltern, bis der Genickschuss schließlich als Erlösung empfunden wurde.
Was konnte der Vater einer Tochter wie Johanne dagegen unternehmen? Nicht viel, das sah er ein. Mit dem Argument, dass es zwar mutig und moralisch richtig sei, am Freiheitskampf teilzunehmen, aber auch sinnlos, da dieser in jedem Fall mit Niederlage und Tod endete, würde er nicht viel ausrichten. Der Widerstandskampf war kontraproduktiv. Wie moralisch gerechtfertigt er auch sein mochte, würde er die anschließende Versöhnung, wenn Deutsche und Norweger einen Modus Vivendi finden mussten, für beide Seiten nur erschweren und belasten.
Seine realistische, von Idealismus und Politik befreite Sicht der Dinge unterschied sich grundlegend von Johannes und Ingeborgs Auffassung. Sie setzten die Ideologie an erste Stelle, erst danach wurden die Konsequenzen erwogen.
ENDE DER LESEPROBE