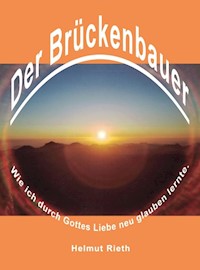
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MarTONius
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im alten System bekam er aufgrund seines Engagements als Lehrer Berufsverbot und wurde so zum Systemgegner gemacht. Aber er sah die wunderbaren Chancen der Wende 1989 und war an der Neugründung der SPD in Thüringen maßgeblich beteiligt. In den neun Jahren als Landtagsabgeordneter konnte er den Neuanfang mitgestalten und war auch jahrzehntelang im Kreistag und Stadtrat von Gotha sowie in anderen Ehrenämtern aktiv. Mit 47 Jahren wird bei ihm schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Er fühlt das Ende seines Lebens. Hilfesuchend wendet er sich an einen ehemaligen Schüler, der jetzt Pastor ist. Nach Gebeten für Leib, Seele und Geist wird er überraschend spontan geheilt. Er lässt sich daraufhin taufen und vertraut sein Leben nun ganz Jesus an. So wird er zum gehorsamen Diener Gottes und geht sogar vier Jahre als kultureller Brückenbauer nach Ägypten, um eine internationale Stiftung aufzubauen. Sein Glauben wird durch viele Erlebnisse gefestigt und selbst als nach elf Jahren der schwarze Hautkrebs wiederkommt, vertraut er Gott und wird dieses Mal auf eine andere Weise erneut geheilt. In Helmut Rieths Biografie ist die Führung und Handschrift Gottes sehr deutlich zu erkennen. Die Meereswoge Helmut Rieth bewegt sich und andere weiter im Vertrauen auf Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Rieth
Der Brückenbauer
Wie ich durch Gottes Liebe
neu glauben lernte.
ISBN-13: 978-3-949073-15-1
Für die Bibelstellen wurde - sofern nicht anders angegeben - die Übersetzung nach Martin Luther (LUT) verwendet.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers bzw. nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Copyright in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, sei es elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig, egal für welchen Zweck, reproduziert, auf einem Datensystem gespeichert oder übertragen werden.
Inhaltsüberblick:
1. Grüße und Dankesworte
2. Blankenhain und meine Kindheit - 1954
3. Kanin und die andere Heimat - 1969
4. Bad Berka und mein Abitur - 1969
5. Studentenzeit und meine Bärbel - 1975
6. Sozialdemokratie und mein Gedankengut - 1986
7. Wende und Gottes Wunder - 1989
8. Thüringen und unser Willy - 1990
9. Stadt- und Landespolitik - 1990
10. Wartburg und unsere Verfassung - 1993
11. Familienleben und unser Hausbau - 1996
12. Sport und Wacker 07 - 1997
13. Gerhard und mein Politik-Aus - 1999
14. Mosesberg und meine Erleuchtung - 2000
15. THILLM und meine Rehabilitierung - 2000
16. Krankheit und meine Spontanheilung - 2001
17. Visionen und meine Berufung - 2002
18. Überleben und Loslassen - 2002
19. Angebot und das Vlies - 2005
20. Alexandria und der Brückenbauer - 2006
21. Rückkehr und der Rückkehrer - 2009/2012
22. Sprecher und der ERF
23. Jüngerschaft und meine Söhne im Geist Jesu
24. Gottes Liebe und die Ewigkeit
25. Gebet und königliches Priestertum
26. Lebenslang mit Gottes Führung
1. Grüße und Dankesworte
Von ganzem Herzen grüße ich Sie und freue mich, dass sich wieder ein Paar gefunden hat und in Beziehung treten kann, nämlich Leser und Schreiber. Was wären die einen ohne die anderen oder andersherum!
Anstelle der üblichen Vorworte am unvermeidlichen Anfang eines Buches möchte ich Ihnen gleich zu Beginn meinen Dank ausdrücken, dass Sie dieses Buch nun in den Händen halten, aufgeschlagen haben, diese Zeilen lesen und wohl auch an der weiteren Geschichte mit den vielen Geschichten meines Lebens interessiert sind.
Nun werde ich also persönlich, ganz persönlich. Natürlich kenne und schätze ich die Etikette in aller Öffentlichkeit - ich bin ja selbst jahrelang ein Teil dieser Öffentlichkeit gewesen. Aber da es hier nun im Folgenden sehr persönlich und privat wird, bitte ich Sie einfach, das „Du“ in der direkten Ansprache meiner interessierten und geschätzten Leserschaft verwenden zu dürfen. Ich bin auch nur ein Mensch und selbst wenn ich Gott wäre, ist ja auch da die Anrede per Du üblich, wie Du weißt. Vielen Dank, dass ich Dir dieses einvernehmlich-verständliche Einverständnis abringen konnte. Es könnte ein wenig Verwirrung stiften, aber das gefällt mir gerade gut in diesem Falle. Also falls wir bisher per Sie unterwegs waren, so darfst Du Dich gern beim nächsten direkten Kontakt mit mir auf dieses Angebot berufen, auch wenn es keine Verpflichtung sein soll. Und das meine ich mit der tiefsten Wertschätzung gegenüber allen menschlichen Gottesgeschöpfen!
Da Du es sowieso in weniger als einer Stunde erfahren wirst, nehme ich das eine Detail schon mal vorweg: Ich bin Deutschlehrer geworden. Und als solcher wurmt es mich etwas, diese umständliche Kapitelüberschrift verwenden zu müssen. Ich wollte anstelle „Dankesworte“ einfach nur Dank schreiben, aber eben viel Dank. Nun gibt es in der deutschen Sprache leider keine Mehrzahl von Dank, es ist fachlich gesehen ein Singularetantum. Warum kann man im Deutschen nur einen einzelnen Dank aussprechen und nicht viele gleichzeitig? Das finde ich irgendwie traurig. Und es gibt noch mehr wichtige Wörter im Deutschen, die leider keinen Plural besitzen, stell Dir das einmal vor! Ich schreibe Dir ein paar Beispiele auf: Hunger, Durst, Obst, Gemüse, Milch, Fleisch, Ernst, Lärm und sogar Liebe!!! Wo so viel Liebe auf der Welt nötig wäre, da gibt es im Deutschen keine Mehrzahl? Vielleicht sollten wir das demnächst ändern, damit wir uns besser ausdrücken können. Jedenfalls wollte ich damit dokumentieren, dass ich trotz dieser sprachlichen Eingeschränktheit meine Erlebnisse aufgeschrieben habe und die deutsche Sprache immer noch und immer wieder schön finde.
Ich weiß nun natürlich nicht, ob wir uns bereits kennen. Vielleicht sind wir ja schon Bekannte, vielleicht Freunde, vielleicht warst oder bist Du ein Wegbegleiter. Ich freue mich jedenfalls über jeden Menschen, der diese Möglichkeit hier wahrnimmt, um mich überhaupt oder noch besser kennen zu lernen. Ich bin so froh, dass es noch Menschen gibt, die Interesse an anderen Menschen haben, die Beziehungen leben. Du wirst schnell merken, dass der Satz „Gott lebt in Beziehungen“ einer meiner wichtigsten Lehrsätze geworden ist. Beziehungen sind ganz wichtig und das ist für mich als Brückenbauer ein Lebensmotto geworden. Es hat sich in den vielen Situationen, die ich im Folgenden beschreibe, immer wieder bewahrheitet.
Ich bin sehr dankbar, dass es Dich gibt, weil Du ein wertvoller Teil meiner Beziehungskette werden könntest oder schon bist. Und ich bin dankbar, dass es Gott gibt und Er mich so lange leben, so vieles erleben und so einiges durchleben gelassen hat. Doch lies Du nun selbst meine Geschichte von Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen und von Seinem speziellen Wirken in meinem Leben:
Viel Freude wünscht Dir
Helmut Rieth
2. Blankenhain und meine Kindheit - 1954
Das Lindenstädtchen Blankenhain ist eine thüringische Kleinstadt zwischen Weimar, Rudolstadt und Jena. Sie ist bekannt für das „Weimarer Porzellan“, welches dort schon seit 1790 in einer von Christian Andreas Wilhelm Speck gegründeten Porzellanmanufaktur hergestellt wurde. Die Familie Fasolt übernahm diese Manufaktur und hatte in Blankenhain eine schöne Villa. Aber das älteste und imposanteste Gebäude steht seit einigen hundert Jahren auf dem zentralen Plateau im Mittelpunkt des Kurstädtchens: das Blankenhainer Schloss, welches auf eine fränkische Rundburg aus dem siebenten Jahrhundert zurückgeht.
Anfang der 1950er Jahre versuchten die Menschen in Blankenhain wie in vielen anderen Orten, sich ein neues Leben aufzubauen. Die letzten Jahre waren schwer für viele nicht mehr vollständige Familien der Einheimischen, aber auch für zugezogene Aussiedler, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
So waren auch Herta Korth mit ihren Schwiegereltern und mit ihrer Tochter Ilsa kurz vor Weihnachten 1946 den weiten Weg aus Pommern nach Blankenhain gewiesen worden. Hertas Vater ist leider auf dem langen, beschwerlichen Winterweg in Erfurt verstorben, so dass nur die drei Frauen in drei Generationen in Blankenhain ankamen und ein Zimmer nahmen. Herta und Ilsa fanden dann Arbeit als Kellnerinnen im „Thüringer Hof“. Hertas Mann Paul Korth kam erst zwei Jahre später aus russischer Kriegsgefangenschaft in ihre Nähe nach Gotha, wo er von einem Kriegskameraden die versprochene Hilfe bekam und Fuß fassen konnte. So hat er mit einem Pferdewagen das Schweinefutter in der Stadt eingesammelt und an die 130 Schweine verfüttert, für die er mit zuständig war. Er war es, der 1925 das Gehöft in Pommern für 25000 Reichsmark gekauft hatte. So konnte er mit der Arbeit in Gotha wieder ein wenig Bauer sein.
Zurück nach Blankenhain: Dort hatte Otto Rieth eine Schlosserei und hier auch seinen Sohn Kurt ausgebildet, bevor dieser viel zu jung in den Krieg ziehen musste. Er musste nach Kriegsende noch in englische Kriegsgefangenschaft und kam 1947 nach Blankenhain zurück. Dort lernte er im Tanzsaal des „Thüringer Hofes“ die nette Kellnerin Ilsa Korth kennen und sie verliebten sich. Etwas unterhalb des Blankenhainer Schlosses wohnten sie in dem kleinen Schlosserei-Gehöft an der Hauptstraße. Schon 1948 wurde ihr erster Sohn Erich geboren.
Die beiden bekamen im Juni 1954 ihr zweites Kind.
Die beiden waren meine Eltern. Ich, Helmut Rieth, war von nun an auf dieser Welt.
Bild: Meine Patentante Brigitte mit Helmut (Bildquelle privat)
Die beiden Bibelsprüche, die offiziell für diesen meinen Geburtstag von der Herrnhuter Brüdergemeine ausgelost worden waren, lauteten:
„Deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich Deine Gebote lerne.“ (Psalm 119,73)
„Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.“ (Joh 14, 20)
Damals war es üblich, dass man Texte aus dem Evangelischen Gesangbuch für den Tag noch dazu auswählte, und so lautete meiner:
„Heiliger Geist, regier und leite meinen Gang, dass ich nicht gleite. Gib mir Lust und Kraft dazu, dass ich Gottes Willen tu.“
Später im Laufe meines Lebens bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es keine Zufälle gibt. Gotthold Ephraim Lessing hatte es so formuliert: „Das Wort Zufall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall; – am wenigsten das, wovon die Absicht so klar in die Augen leuchtet.“ Diese Bibelverse zu meinem Geburtstag werden sich jedenfalls in und über meinem Leben bewahrheiten.
Natürlich empfing mich damals auch mein sechs Jahre älterer Bruder Erich. Später gesellten sich noch weitere zwei Jungs zu uns: 1956 Siegfried und 1958 mein jüngster Bruder Kurt, genannt Kuddel.
Meine Eltern hatten, wie bei allen ihren Söhnen, großen Wert darauf gelegt, dass sie kindgetauft wurden. So wurde also auch ich getauft. Dazu reiste meine Patentante Brigitte, die Cousine meiner Mutter, extra aus Berlin an. Sie wurde gebeten, dass sie für mich etwas Hübsches zum Anziehen mitbringt. Insofern war es sehr wichtig, dass sie dabei war.
Der Schlosserei-Inhaber Otto Rieth starb schon 1952. Da sein Sohn und mein Vater Kurt zwar ausgebildet, aber keine Erfahrungen in der Schlosserei hatte, wurde diese Schlosserei nicht weitergeführt. So nahm mein Vater eine Stelle als Schlosser und Hausmeister im Kreiskrankenhaus im östlich von Blankenhain gelegenen Egendorf an. Meine Mutter arbeitete als teilausgebildete Krankenschwester – eine sogenannte Halbschwester - hauptsächlich im Nachtdienst im selben Teil der Kreiskrankenhaus-Anstalten in Egendorf. Dort wurden vorwiegend Kinder und Jugendliche mit Behinderungen behandelt. Nach Egendorf waren es nur zwei Kilometer, die meine Eltern gut mit den Fahrrädern zurücklegen konnten.
Obwohl meine beiden Eltern arbeiten gingen, hatten wir anfangs nicht besonders viel Geld. Denn sowohl Halbschwester als auch Hausmeister waren nicht so üppig bezahlte Arbeiten. Aber uns ging es trotzdem gut, wir hatten alles, was wir brauchten.
Unser Haus hatte vorne an der Straßenseite einen Laden, in dem damals mein Großvater Otto Rieth seine Schlossereiwaren angeboten hatte. Dahinter war die große Werkstatt mit Hammer und Amboss und Schmiede. Da nach dem Tod von Otto die Schlosserei durch meinen Vater nicht weitergeführt wurde, war der Laden später an die HO (Handelsorganisation) vermietet. Die Werkstatt blieb aber als unsere Haus- und Hofwerkstatt noch bestehen, so dass ich diese gut gekannt habe.
Das Haus selber war relativ klein, auch die einzelnen Räume. In der ersten Etage gab es ein kleines Wohnzimmer – die gute Stube, das Schlafzimmer meiner Eltern und die Küche. Unter dem Dach hatten die Jungs ein Zimmer. Außerdem lebten in dem Haus noch meine Großmutter (die Frau von Otto) mit ihren beiden Schwestern, die in der ersten Etage ihr kleines Schlafzimmer hinter der Küche hatten. Ihre Küche und das Wohnzimmer waren unten im Haus. Die Toilette befand sich auch unten, später haben wir oben noch ein kleines Bad einbauen können. Alles war doch sehr beengt, bis wir in den 1970er Jahren einige An- bzw. Umbauten durchführen konnten, auch mit der Unterstützung meiner lieben Patentante Brigitte und Onkel Hans aus Berlin.
In der Küche war der große Esstisch mit der hölzernen Eckbank. Dort gab es abends gegen achtzehn Uhr immer gemeinsames Essen. Zum Frühstück war es wegen der Schichtarbeiten meist nicht möglich, dass wir alle gemeinsam aßen.
In einem kleinen Garten hatten wir etwas Gemüse angebaut sowie Hühner und Karnickel gehalten. Viel Unterstützung bekamen wir von Oma und Opa aus Gotha.
Da meine Mutter bald wieder arbeiten ging, kam ich mit ca. einem Jahr in die Kinderkrippe und später in den Kindergarten des Kreiskrankenhauses. Wenn es dann mal Grießbrei im Kindergarten gab, dann hatte ich immer die Backen voll gebunkert mit Grießbreikugeln. Nein, das tat ich nicht etwa, um das gute Zeugs aufzuheben wie ein Hamster, sondern einfach, weil ich das nicht runterschlucken konnte.
An den Kindergarten habe ich nur eine einzige schlechte Erinnerung. Mit einer der Kindergärtnerinnen kam ich nicht so zurecht, wahrscheinlich war ich mal frech gewesen. Sie hat mich daraufhin weggesperrt in so einen dunklen Gang, wo die Treppen runtergingen, und sie hat die Tür oben zugemacht. Da stand der kleine Helmut im Dunkeln im Verließ und fühlte sich verlassen.
Als Kind war ich gern in Egendorf, denn mein Vater hatte dort seine Werkstatt und auch einen Kollegen, der Tischler war. Und so konnte ich dort vieles Handwerkliche ausprobieren.
Als Kinder wurden wir oft in den Wald geschickt – nein, nicht wie Hänsel und Gretel in dem Märchen - sondern um Pilze oder vorzugsweise Heidelbeeren zu sammeln. So ein Zwei-Liter-Eimer Heidelbeeren konnte für fünf Mark verkauft und dafür zwei Stück Butter erworben werden. Leider hat es lange gedauert, bis so ein Eimer voll war, denn ich konnte unerklärlicherweise nur mit einer Hand pflücken. Da mein ältester Bruder Erich bereits in Gotha wohnte, war ich für meine beiden jüngeren Brüder Siegfried und Kuddel verantwortlich, die nicht immer viel Lust zum Beerenpflücken hatten. So mussten wir ziemlich früh mithelfen, aber das war in Ordnung. Wir waren jedenfalls gern im Wald. Manchmal war auch unser Vater mit dabei. Im Winter fuhren wir Ski, bauten eine kleine Schanze und hatten unseren Winterspaß.
Zu unseren Eltern hatten wir eine sehr enge Beziehung, sie nahmen sich viel Zeit für uns. Wir lebten beengt und - wie man so sagt - in bescheidenen Verhältnissen, aber Bescheidenheit ist eine Tugend, an der nichts auszusetzen ist. Ich bin meinen Eltern für meine schöne Kindheit sehr dankbar. Wir waren kaum in den Urlaub weggefahren, weil dafür das Geld zu knapp war, aber wir haben gemeinsam viele wunderbare Wanderungen oder Radtouren gemacht.
Meine Eltern und wir haben trotz der erwähnten bescheidenen Verhältnisse gern gefeiert. Zu meinen Geburtstagsfeiern durfte ich alle meine Freunde einladen – und ich hatte viele Freunde. Auch die Weihnachtsfeiern meiner Familie waren immer besonders schön. Es gab trotz des wenigen Platzes natürlich immer einen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen und Lametta. Es war richtig schön. Auch Ostern war immer ein wunderbares Fest für die Großfamilie, die in Blankenhain zusammenkam. Karfreitag und Ostersonntag waren wir immer in der Kirche. So richtig bewusst wurde mir das Osterfest allerdings erst in meinem Konfirmationsunterricht.
Meine Mutter und auch meine Oma hat mit uns am Abend oft gebetet:
„Ich bin klein, mein Herz ist rein,
soll niemand drin wohnen als Jesus allein.
Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu.
Hab ich Unrecht heut getan, sieh es, lieber Gott, nicht an.
Deine Gnad´ und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut.“
Zu meinem Opa Paul aus Gotha hatte ich eine besonders innige Beziehung. Er kam zu den großen Familienfeiern immer mit seiner Frau Herta, blieb aber höchstens für eine Nacht in dem Haus in Blankenhain, weil es ihm dort zu eng war.
Da wir vier Brüder waren, hat er darauf bestanden, dass wir alle Skat spielen lernen. Wir haben dann später auch um Geld gespielt. Opa hatte jedem zwei Mark Startkapital gegeben, und so war der Anreiz zum ordentlichen Reizen und somit zum guten Skatspiel auf jeden Fall gegeben. Wenn kein Geld mehr hatte, musste als Spieler aussteigen. Trotzdem hat das Opa Paul nie wegen des materiellen Vorteils gemacht, sondern um Spaß an der Freude zu haben.
Als Siebenjähriger wurde ich 1961 eingeschult. Die Grundschule befand sich in der am Anfang erwähnten Fasoltschen Villa des ehemaligen Porzellanmanufakturbesitzers, welcher Ende der 1940er Jahre allerdings enteignet wurde. Das waren noble Räume und ein schöner Schulhof war auch dabei. Und auch meine Grundschullehrerin, Frau Semsch, war ganz toll. Sie mochte mich und ich mochte sie. Sie war selbst auch Zwangsausgesiedelte und hatte deshalb ein besonderes Verständnis für Kinder aus solchen Familien. Für die Pause hatte ich nur Fettbrot, die anderen Kinder hatten Brot mit Butter und Wurst drauf. Frau Semsch lud mich immer mal zu sich ein und dort gab es auch ab und zu ein Stück Kuchen. Die Schule war jedenfalls für mich nicht anstrengend, das Lernen fiel mir irgendwie zu. Ich genoss eine sehr gute, fundierte Grundausbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Klassen bestanden aus höchstens zwanzig Schülern und wir saßen in diesen hölzernen Dreier-Schulbänken mit hochklappbaren Sitzen. Anfangs schrieben wir noch auf Schiefertafeln. Wenn ich da mal nicht mit dem Griffel, sondern mit den Fingern direkt draufkam, kratzte das immer so komisch – oh, das konnte ich gar nicht gut hören – da zieht es mir jetzt noch alles zusammen, wenn ich nur daran denke.
Im Alter von sieben Jahren schon durfte ich lernen, Akkordeon zu spielen. Der private Musiklehrer Herr Möller wohnte im Schloss und der 45-Minuten-Unterricht für mich kostete drei Mark in der Woche, was damals viel Geld für uns war. Zwei Jahre nach mir lernte auch Kuddel Akkordeon. Mein Opa Paul und meine Oma Herta Korth aus Gotha hatten mir ein kleines vierzig-bässiges Akkordeon geschenkt. Mein Opa hatte mir versprochen: „Wenn Du in zwei Jahren immer noch Akkordeon spielst, dann bekommst Du ein großes.“ Er hielt sein Versprechen.
Schon mit neun Jahren durfte ich das erste Mal auf der Bühne stehen, denn in unserem Kurstädtchen waren immer wieder FDGB-Urlauber (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund), die aller zwei Wochen wechselten. Wir haben landläufig FDGB mit „Feine Damen Gehen Baden“ übersetzt. So wirkten wir also aller vierzehn Tage bei einem Begrüßungsprogramm für die neuen FDGB-Urlauber mit wie
Bild privat v.l.n.r.: Gerald Kalbas, Helmut Rieth, Jutta Schmied, Bernd Sturm
auch an den Verabschiedungsabenden. Ein Männerchor hat dabei ebenfalls mitgewirkt, in welchem mein Vater mitgesungen hatte.
Wir waren erst ein Akkordeontrio mit Jutta Schmied aus meiner Schulklasse, ihr Cousin Bernd Sturm und mir. Als dann Gerald Kalbas noch dazu kam, waren wir logischerweise ein Quartett. Unser Akkordeonlehrer Herr Möller wählte das Programm aus und komponierte zum Teil auch extra für uns. Anfangs hat er uns dirigiert, aber bald sind wir gut alleine zurechtgekommen. Wir haben meist Volksmusik gespielt, selbstverständlich vieles von dem allseits bekannten Thüringer Volksmusikanten Herbert Roth. Das Schlusslied war dann immer ein von Herrn Möller geschriebenes Lied über unser Blankenhain:
„Es ist so schön in Blankenhain, möcht immer gerne bei dir sein,
die Wiesen und die Felder, die weiten grünen Wälder,
und muss ich einmal von dir gehen, sag ich ganz leis auf Wiedersehn,
im Herzen bin ich Dein, mein schönes Blankenhain.“
Zum Lindenfest als Jahreshöhepunkt im Lindenstädtchen Blankenhain durften wir dann auch im Lindenpark auftreten. Da waren ca. 2000 Besucher da. So haben wir nach und nach Bühnenerfahrungen gesammelt, die später wichtig werden sollten.
Meine Eltern ermöglichten mir also eine gute musikalische Ausbildung. Mit dem von Opa Paul geschenkten Akkordeon hatte ich mir die musikalische Welt der Bühne ein wenig zu eigen machen können.
Später wurde das FDGB-Ferienheim „Zum Güldenen Zopf“ renoviert. Der nur etwa zehn Jahre ältere Leiter dieses Ferienheimes, Peter Gelau, wollte danach die Begrüßungsabende etwas moderner gestalten und mit Bewegung – also Tanzen – auflockern. Er war selber Gitarrist und hatte auch einen Schlagzeuger rangeholt. Unser Akkordeonquartett hatte sich umstrukturiert. Ich hatte inzwischen Gitarre gelernt und hab dazu gesungen, auch Jutta war dabei. Gemeinsam spielten wir Schlagermusik und wir traten unter anderem auch beim sogenannten Tanztee immer sonntags fünfzehn Uhr im Schloss Blankenhain auf.
Nach der Grundschule war ich die nächsten vier Jahre an der POS (Polytechnische Oberschule) namens Friedrich Leßner in Blankenhain. Dieser Mann erlangte seine Bedeutung dadurch, dass er in London das Kommunistische Manifest von Karl Marx zur Druckerei getragen hat.
Meine Eltern wollten wenigstens einem ihrer vier Söhne ein Studium ermöglichen. Daher war ich meinen Eltern zuliebe einige Kompromisse eingegangen. So gab es eben die Zweigleisigkeit mit einerseits Kindstaufe und Religionsunterricht und später die Konfirmation, aber andererseits und gleichzeitig auch die Mitarbeit in der Pionierorganisation bis hin zur Jugendweihe. Es war damals in der DDR so, dass man ohne die Jugendweihe kein Abitur machen durfte. Und ohne Abitur war kein Studium möglich, also musste offiziell „mitgeschwommen“ werden. So war ich dann auch Gruppenratsvorsitzender bei den Pionieren und hatte so Verantwortung für meine Mitschüler übernommen. Dadurch war ich bei den Lehrern bis zu einem gewissen Grad und vor allem bis zu einem bestimmten Zeitpunkt respektiert. Dieser bestimmte Zeitpunkt nahte unwissentlich und völlig absichtslos im Frühjahr 1968 in meiner achten Klasse.
Ich hatte also aus zukunftsorientierten Überlegungen heraus die staatliche Jugendweihe und die kirchliche Konfirmation. Der Konfirmationsunterricht fand nach der Schule einmal wöchentlich bei unserem Pfarrer statt, insgesamt zwei ganze Jahre lang. Wir waren dort eine Gruppe von ca. zwölf Jugendlichen. Als Abschluss gab es in Eisenach eine Woche lang eine Jungschar-Rüstzeit, zu der aber nur sehr wenige aus meiner Blankenhainer Konfirmandengruppe dabei waren. Die meisten der Jugendlichen dort auf dem „Falkhof“ in Eisenach gegenüber der Wartburg kannte ich nicht.
Ich habe mich dort wohlgefühlt, es war eine dufte Gruppe. Auch wenn ich kaum jemand kannte, fühlte ich mich sofort wohl. Im Innenhof des Falkhofes stand ein Kreuz aus Birkenholz. Wir haben zusammen gesungen. Mir gefiel die liebevolle und freundliche Atmosphäre - man hat sich gegenseitig be- und geachtet. Auch habe ich dort die ersten Bibelarbeiten mitgemacht, die mich auch berührt hatten wie keine bis dahin. Ich kannte zwar die Bibel, aber dort in dieser Woche erkannte ich sie als Wort Gottes. Es hat mich aufgeschlossener gemacht und angeregt, anders zu denken. Wenn Gott mein guter Hirte ist, bin ich ja sein Schaf. Also muss es da eine Beziehung geben zwischen dem guten Hirten und mir als Schaf. Für mich war diese Jungschar-Rüstzeit der Beginn, Gottes Wort ernst zu nehmen und zu leben, weil ich in dieser Woche bemerkt hatte, dass da mehr ist, als man sieht oder begreift. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich eine Verbundenheit in Liebe, die nur Gott schenken kann. Ich war voll des Glückes.
Irgendjemand muss mich verpetzt haben, denn ich wurde gleich nach der Rückkehr aus Eisenach zum Direktor meiner Blankenhainer Schule bestellt. Anwesend waren außerdem der FDJ-Sekretär (Leiter der staatlichen Jugendorganisation „Freie Deutsche Jugend“), der Pionierleiter und der Parteisekretär der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) und die FDGB-Chefin. Fünf Erwachsene gegen einen kleinen Jungen. Dort wurde ich reichlich madig gemacht. „Wie ich denn dazu käme, einfach so etwas zu machen. Du solltest dich schämen. So wirst du nie studieren können …“ und viele ähnliche unerfreulich-verängstigende Sätze sind dort auf mich eingeprasselt. Ich hatte danach auf dem Heimweg geheult wie ein Schlosshund, denn ich sah wirklich meine ganze Zukunft verbaut oder eher versaut. Für sie alle war ich nicht linientreu und das musste bestraft werden. Kein Abitur, kein Studium. Ich spürte, wie sehr ich damit meine Eltern und meine Großeltern mit ihrem Wohlwollen für mich enttäuschen würde. Ich war völlig fertig. Innerhalb dieser zwei Tage war ich ganz oben und ganz unten – erst voll des Glückes und dann tief verzweifelt und unglücklich. Auch der Pastor wurde zur Schulleitung einbestellt und beschimpft, wie er denn meine Zukunft so verbauen könnte, indem er mich zur Rüstzeit hatte fahren lassen. Mein Vater hat dann nicht so mit sich reden lassen. Der Pastor schaltete dann die Kirchenleitung ein und über schwierige Wochen hinweg glätteten sich die Wogen langsam. Das war eine ganz üble und schreckliche Erfahrung für mich, dass ich das, was ich im Falkhof erlebt und seitdem im Herzen hatte, nicht leben konnte. Und auch dass sich plötzlich die Schulleitung von mir distanzierte, war mir unbegreiflich, denn ich hatte doch nichts falsch gemacht, oder doch?!
Mein Klassenlehrer Horst Brotmeyer hatte nur äußerlich und vor allem systemerzwungen den Anschein gegeben, sich von mir distanziert zu haben. Er war mir ein gutes Vorbild, wir hatten eine Beziehung mit großem Vertrauen. Er hat mir immer wieder gesagt: „Helmut, du bist geboren, um Lehrer zu werden!“ Auch durch diese Vorfälle nach dem Falkhof-Besuch hat er sich von mir innerlich nicht getrennt.
Im August 1968 hatte ich eine Klassenfahrt nach Prag während der Dubček-Ära. Seit dem Frühling wurde der „Brief der 2000 Worte“ veröffentlicht, auch auf Deutsch. Dieser Brief legte die Eckpunkte einer Erneuerung des Sozialismus „mit menschlichem Antlitz“ und den Aufbruch in eine freiere Gesellschaft dar. Das hat mich interessiert und ich habe auch unterschrieben, zum Teil aus jugendlichem Opportunismus. Es hat mich bewegt und gestört, dass die Sowjets mit ihren Panzern einrücken wollten. Und sie kamen auch, mit Zügen haben sie über Nacht die Panzer in die Innenstadt von Prag gebracht. Am 20. August 1968 sind wir als Klasse mit dem Zug zurückgefahren. Am nächsten Tag standen die Sowjets tatsächlich mit ihren Panzern auf dem Wenzelsplatz im Prager Zentrum. Mit einem Mal war meine Gedankenblase der DSF (Deutsch-Sowjetischen Freundschaft) und einiges mehr zerplatzt. Wir hatten über die DSF Brieffreundschaften und so weiter, aber das war danach nichts mehr für mich. Ganz schlimm und beängstigend war es für mich auch, dass unsere NVA (Nationale Volks-Armee) Gewehr bei Fuß stand. Bei unserer Einreise in die DDR direkt an der Grenze im Elbtal konnten wir sehen, wie dort Panzer und Kriegsgerät aufgereiht waren. Ich war zutiefst erschrocken. Das war Kriegszustand für mich. Das war mein Prager Frühling 1968 – die Erneuerungsgedanken von Dubček seit dem Frühjahr und das jähe Ende der Bewegung durch die sowjetischen Panzer am 21. August in Prag.
3. Kanin und die andere Heimat - 1969
1969 hatte ich als Fünfzehnjähriger eine Klassenfahrt an den polnischen Ostseestrand nach Swinemünde. Damit ging es für mich in die Heimat, die ich gar nicht kannte, aber von der mir Opa Paul viel erzählt hatte. So bekam ich im Geheimen von ihm den Auftrag, unbedingt von ihrem alten Gehöft in Pommern die Hochzeitsbilder aus der Heimat zu holen. Na, diese Freude wollte ich meinen Großeltern genauso und unbedingt machen. Für meinen Opa hätte ich alles gemacht.
Ich hatte zu meinem Opa Paul eine ganz besonders innige Beziehung. Er musste im ersten und im zweiten Weltkrieg kämpfen und konnte viel erzählen, auch aus seiner Heimat und von einigen übernatürlichen Erfahrungen, die er gemacht hatte. Wenn ich als kleines Kind manches Mal in seinem Arm lag, seinen spannenden Erzählungen lauschte und dabei in den Sternenhimmel blickte, dann war das ein Höchstmaß an Geborgenheit, wie bei einem großen Vater, vielleicht sogar ähnlich wie beim Himmlischen Vater. Zumindest hat mein Opa durch seine liebevollen Erzählungen eine Sehnsucht in mir geweckt, dass es da oben noch mehr geben muss – die Sehnsucht nach einem väterlichen Gott im Himmel.
Bild: Oma Herta und Opa Paul Korth, aus Kanin (Quelle privat)
Mein Opa Paul war kein großer Kirchgänger, auch meine Oma Herta nicht. Sie hat immer sonntags das (West-)Radio angestellt, somit regelmäßig die Gottesdienste gehört und viel in der Bibel gelesen. Mein Opa hatte trotzdem ein klares Gottesverständnis, eher aus der Natur heraus, wo er den Schöpfergott und dessen Kraft immer wieder bemerken konnte. Das war sehr inspirierend für mich.
Meine Ferien verbrachte ich gern bei meinen Großeltern in Gotha. Ich half dort dabei, den Schweinestall und auch den Pferdestall auszumisten. Opa Paul hat mich auf dem Kutschbock mitgenommen. Auch Reiten konnte ich ein wenig lernen. Gotha hat mir auch deshalb gefallen, weil ich den Eindruck bekam, dass es noch etwas Größeres gibt als mein kleines Heimatstädtchen Blankenhain. In Gotha gab es immerhin schon Straßenbahnen, mit denen ich auch gern hin- und hergefahren bin.
Opa Paul hat immer von Pommern als seiner Heimat gesprochen. Dieser Hof dort wurde ihnen 1945 weggenommen – zwangsenteignet - und an Polen gegeben, die von Stalin dahin zwangsumgesiedelt wurden. So lebten also die früheren Besitzer mit den neuen polnischen Eigentümern über ein Jahr zusammen auf dem Hof. In diesem speziellen Falle lebten die beiden Familien doch recht gut zusammen. Die Deutschen kümmerten sich um den Sohn der Polen. Und als die Russen kamen, versteckten die Polen das junge deutsche Mädchen Ilsa vor ihnen in der Jauchegrube. Trotzdem mussten die Deutschen dann gehen und die Polen bleiben – beide wollten es nicht so recht. Die Deutschen hatten gehofft, doch bleiben zu können, und die Polen hatten gehofft, doch wieder in ihre wirkliche Heimat zurückgehen zu können.
So reiste ich von Swinemünde allein die 350 Kilometer über Stettin in Richtung Danzig. Aus unerfindlichen Gründen hatte mir mein Klassenlehrer sozusagen zwei Tage freigegeben, ich musste nur bis zur Abreise der Klasse wieder zurück sein, das war jedenfalls die einzige Bedingung. Denn ohne mich, der ich mit auf der Klassenliste stand, wäre die ganze Klasse nicht wieder aus Polen rausgekommen.
Ich fuhr also früh um sieben Uhr mit dem Bus los in Richtung Danzig, immer schön an der Ostsee lang bis Darlowo/Rügenwalde genau zwischen Swinemünde und Danzig. Von dort musste ich irgendwie südöstlich weiter nach Kanin, wobei sich in der Karte drei verschiedene Orte mit fast demselben Namen befanden. In Rügenwalde hat mich allerdings erstaunlicherweise jemand auf Deutsch angesprochen und mich in einen Bus gesetzt, der bis Slawno / Schlawe fuhr. Von da fuhr der nächste Bus zum Kaniner Kreuz und das kannte ich aus den Erzählungen meines Opas. Also dachte ich, dass ich dann gleich da bin. Den Rest musste ich laufen, aber ich wusste ja immer noch nicht, welches der drei Dörfer nun das richtige Dorf ist.
Es war, als hätte ich einen Zeitsprung in genau die Zeit gemacht, als mein Opa über zwanzig Jahre zuvor dort lebte. Es war dort eine ärmliche Gegend, Pferdefuhrwerke waren unterwegs, eben so wie früher. Also wanderte ich die Straße entlang. Irgendwann kam mir ein altes Mütterchen mit einem Krückstock und einem Korb auf dem Rücken entgegen. Ich habe sie trotzdem in Deutsch angesprochen und nach dem Ort Kanin gefragt. Als diese alte Frau gemerkt hatte, dass ich deutsch sprach, nahm sie ihren Krückstock hoch, schlug auf mich ein und schrie „Du nemetzki Faschist! Du nemetzki Faschist!“ Ich war sowas von erschrocken und rannte so schnell und so weit ich konnte einfach weg. Dann fiel ich kraftlos in den Straßengraben und habe nur noch geweint. Ich war fertig, durch Mark und Bein erschüttert von dieser fürchterlichen Begegnung. Und ich konnte nur noch weinen.
Doch mit einem Mal spürte ich einen tiefen inneren Frieden, so als hätte sich ein Licht über mich gesetzt, das heller war als die untergehende Sonne. Ich bekam ein starkes Glücksgefühl und wusste, dass ich hier doch richtig bin. Dann hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte: „Steh auf! Steh auf und lauf!“ Und ich stand auf und lief und lief.





























