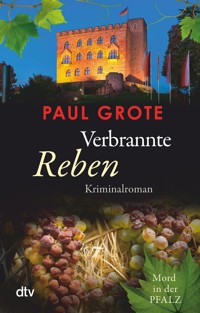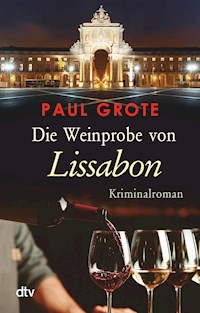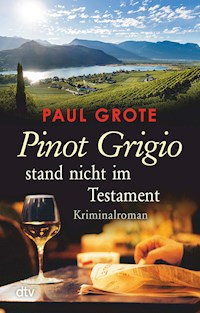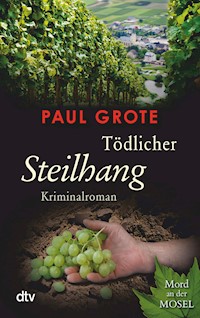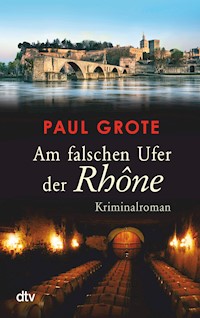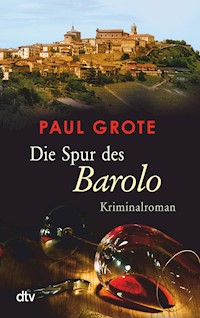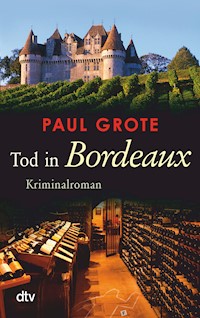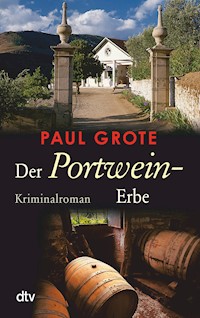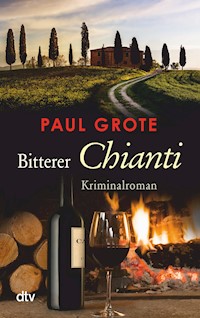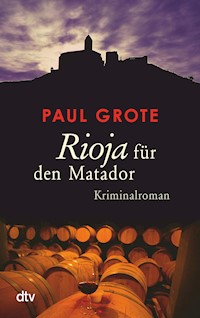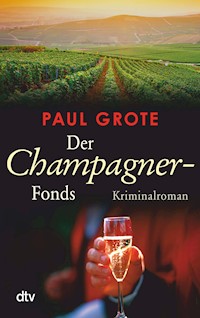
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Champagner, viel Geld ... und ein Mord? Philipp Achenbach hat ein Problem: Sein Chef, Inhaber einer Kölner Weinimporthandlung, will hoch hinaus. Ein Champagner-Aktienfonds soll die Firma wachsen lassen, und Achenbach soll die Arbeit machen. Aber schon die Idee gefällt ihm nicht, und er misstraut den Finanziers aus London. Als er in der Champagne einem umfangreichen Betrug auf die Schliche kommt, ermittelt Achenbach auf eigene Faust. Jetzt hat er nicht nur Unbekannte gegen sich, sondern auch den eigenen Chef.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Paul Grote
Der Champagner-Fonds
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2010© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40302-3 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21237-3Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dank
Die spritzige Gischt dieses Weines ist das glänzende Ebenbild von uns Franzosen.
Voltaire
Glaube denen nicht, die den Reichtum zu verachten scheinen. Denn nur die verachten ihn, die an ihm verzweifeln, und sie sind die Übelsten, wenn sie darankommen.
Francis Bacon
Dieser Roman ist den Franzosen aus dem Lager Oflag IV D gewidmet.
Prolog
Michael Müller wurde zuletzt am 23.März gesehen. Der Siebenundzwanzigjährige verließ nach Feierabend zusammen mit einigen Kollegen das Hauptgebäude der Kölner Druckerei Schwenke und Cie., ging zum Parkplatz, setzte sich in seinen Wagen und fuhr nach Hause. Zumindest meinten die Kollegen, die ihn an jenem Spätnachmittag gesehen hatten, dass er es vorgehabt habe. Von einer Verabredung für den Abend sei nicht die Rede gewesen. Müller hätte es ihnen auch schwerlich mitgeteilt, er galt als nicht besonders mitteilsam. Am nächsten Tag wunderte man sich, dass er nicht zur Arbeit erschien; es entsprach nicht seiner Art, dem Dienst ohne Entschuldigung fernzubleiben. Der Reprofotograf, für sein Alter bereits ein Spezialist auf seinem Gebiet, besonders der Reproduktion von Gemälden, genoss gerade wegen seiner Zuverlässigkeit die Wertschätzung seiner Vorgesetzten und der Geschäftsleitung.
Als er bis zur Mittagspause nicht erschien und sich auch nicht telefonisch meldete, rief die Sekretärin von Dr.Schwenke bei ihm an. Müller wohnte allein, zumindest war nichts Gegenteiliges bekannt. Deshalb wunderte man sich auch nicht, dass niemand ans Telefon ging. Bei Anrufen auf dem Mobiltelefon meldete sich eine stereotype Ansage: »Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist zurzeit...«
Am dritten Tag nach Müllers unerklärlichem Verschwinden wurde die Polizei eingeschaltet. Sie ermittelte Müllers Eltern, die ebenfalls in Köln lebten und keinerlei Kenntnis von seinem Aufenthaltsort hatten. Die aufgeschreckten Eltern gaben selbstverständlich ihre Einwilligung, die Wohnung des Sohns aufzubrechen, zumal man seinen Alfa Romeo nicht weit von ihr entfernt gefunden hatte. Der Wagen war unversehrt, ein Schlüssel fand sich nicht. Immerhin konnte damit ein Autounfall ausgeschlossen werden. Mysteriös war der extrem hohe Kilometerstand des Wagens für einen Fahrer, der normalerweise nur zwischen der Wohnung und dem Arbeitsplatz pendelte.
In der Wohnung selbst fanden sich keinerlei Anzeichen, die Müllers Verschwinden hätten erklären oder einen Hinweis auf seinen momentanen Aufenthaltsort geben können. Erstaunlich jedoch war die Menge antiquarischer Kunstbände, historischer Karten und wertvoller Reproduktionen alter Meister. Hinzu kam eine Sammlung wertvoller Jahrgangschampagner und Grands Cru, die man gar nicht mit Michael Müllers sonstiger Persönlichkeit in Zusammenhang bringen konnte. Er habe sie von Freunden geschenkt bekommen, erklärte seine Freundin, die der Ansicht war, dass einige Möbel minimal verrückt worden waren, und das Gefühl hatte, dass ein Fremder in der Wohnung gewesen sei.
Die Suche nach Michael Müller blieb erfolglos... er war einer mehr in der Liste von 5.332Personen, die in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamtes als vermisst gelten.
1
»Sie machen auf jeden Fall weiter! Sie werden uns nicht in Ruhe lassen, bevor sie uns nicht den letzten Cent aus den Taschen geschüttelt haben. Tag und Nacht denken sie darüber nach, wie sie das bewerkstelligen können, mit immer neuen Produkten, die lediglich aus heißer Luft bestehen. Sie arbeiten auch an den Wochenenden, Thomas. Solche Leute haben sowieso keine Familie, höchstens physisch, und keine Freunde. Dafür sind sie vernetzt und wahrscheinlich auch im Schlaf ›online‹. Die tragen ihren Mikrochip bereits unter der Haut.« Philipp Achenbach hatte sich in Rage geredet.
»Denkst du wirklich so, oder meinst du das ironisch?« Thomas war entsetzt. Er fand, dass sein Vater bei diesem Thema in letzter Zeit häufig übertrieb, und er hatte den Verdacht, dass mehr als nur die Bankenkrise dahintersteckte. »Sind alle Banker so?«
Das »Ja« seines Vaters kam voller Überzeugung. »Je weiter oben in der Hierarchie, desto skrupelloser sind sie. Man muss so sein, so kalt, so fern dem Leben und unmenschlich, sonst kann man diesen Beruf nicht ausüben.«
»Wen kennst du, der so ist?«
»Einige – das bringt meine Arbeit mit sich. Gerade wenn es um die besonders teuren Weine geht oder um die großen Champagner. Da kostet die Pulle schon mal an die Tausend Euro. Investmentberater suchen ununterbrochen nach neuen Geschäftsfeldern, und wenn sie Junk Bonds kaufen, Swaps und Futures, wenn sie dir Wetten auf den Preisanstieg bei Schweinehälften am Schlachthof in Chicago verkaufen oder Schulden anbieten, faule Kredite, die sie zu Paketen bündeln und als Sondermüll auch noch beleihen, stecken im Grunde genommen kriminelle Energie und Spielsucht dahinter.«
»Das ist doch Wahnsinn, oder?«, wandte Thomas ein. »Das hat doch Folgen, auch für sie.« Er empfand sich dem Redeschwall seines Vaters hilflos ausgeliefert.
»Folgen, mein Junge? Für sie nicht, aber für uns, und das ist ihnen gleichgültig, mein Junge. Ihre Schäfchen, ihre Millionen, die sind im Trockenen, längst in reale Werte umgewandelt, in Schiffe und Hochhäuser, in Fabriken und Kupfergruben in Chile, Coltan ist es im Kongo, denn kein Berater glaubt selbst an den Unsinn, den er von sich gibt.«
»Aber es heißt, dass sich was ändert, die Regierungen...«
»Eine derartige Bankrotterklärung hat noch keine politische Führung bisher hingelegt. Glaubst du allen Ernstes, dass sich was ändert? Das machen sie euch an der Uni doch wohl nicht weis?« Philipp Achenbach erwartete keine Antwort. Er sah seinen Sohn an und konnte sich das Grinsen nicht verbeißen. Er wusste, was jetzt in Thomas vorging.
Der konnte schlecht damit umgehen, weder mit diesem Grinsen, noch damit, dass die Worte seines Vaters etwas anderes auszudrücken schienen als seine Mimik. Er sagte etwas, schien aber etwas ganz anderes zu meinen. Obwohl Thomas bereits seit sechzehn Jahren bei ihm lebte, bis auf die wenigen Wochenenden oder Ferien, die er bei seiner Mutter verbrachte, ließ er sich davon immer noch verwirren. Er hatte das Gefühl, dass es seinem Vater darum ging, seine Gesprächspartner wenn nicht zu täuschen, so doch sie über seine wahre Meinung zumindest im Unklaren zu lassen. Das sollte er gefälligst in seiner Firma machen bei seinen Geschäftspartnern, bei den Winzern, die er besuchte, aber bitte nicht bei ihm.
Philipp wusste, dass Thomas sich darüber ärgerte. Er konnte es nicht abstellen, es war Teil seiner Natur. Er lächelte, wenn es ernst wurde, und konnte bei angeregter Unterhaltung sehr düster wirken. Jetzt setzte er lächelnd seine Kanonade fort, sodass es Thomas schwerfiel, seine Erbitterung ernst zu nehmen.
»Wenn einem die sogenannten Berater irgendwelche wertlosen Papiere verkaufen, bei denen kein Mensch versteht, wie da achtzehn Prozent Rendite nach einem Jahr rauskommen sollen – sollte man nicht davon ausgehen, dass es sich um gezielten Betrug handelt?«
Thomas war versucht, auf die Frage zu antworten, aber er wusste, sie war nicht ernst gemeint. Es kostete ihn Mühe, sich über seine Gefühle hinwegzusetzen.
Philipp Achenbachs Zorn steigerte sich. »Eine Flasche Wein ist dagegen was ganz Reelles. Die lässt sich austrinken, man löscht den Durst und wird betrunken, da hat man was davon. Aber jemanden mit Turbo-Optionsscheinen oder Dax-Mini-Futures besoffen reden, mit angeblichen Produkten, die nicht einmal die Erfinder von dem Schwindel verstehen, wie die Finanzterroristen in New York und London, das ist die Kunst. Dann ist plötzlich das gesamte Geld weg. Wer hat es? Es löst sich doch nicht einfach auf. Wo das geblieben ist, wissen nur Eingeweihte. Oder es bedeutet, dass es vorher auch nicht da war, dass es eine reine Fiktion ist, so wie ein Gott, der nur in der Vorstellung existiert. In dem Augenblick, wo die Leute es sich auszahlen lassen wollen, bricht das System zusammen. Das ist der Beweis.«
Thomas war an einem ernsthaften Gespräch gelegen, und er holte Luft: »Was ist mit den Maßnahmen, die in letzter Zeit ergriffen wurden, um die Finanzmärkte zu kontrollieren, Steuerschlupflöcher zu stopfen, die Steueroasen auszutrocknen?«
»Alles Augenwischerei von Seiten der Politik. Steueroasen sind kein Problem, die bringen niemanden in Gefahr, und Steuerhinterziehung betreibt jeder...«
»Du auch?«
Philipp stöhnte, er setzte die Brille ab, legte sie auf den Terrassentisch und rieb sich die Augen, dann die Hände und holte tief Luft. »Ich? Geldwerte Vorteile, Reisekostenabrechnungen, das gesamte Bewirtungswesen, Werbungskosten, und über die jahrelange Kindergeldschieberei zwischen deiner Mutter und mir will ich besser schweigen...«
»Dann sag nichts, lass Mutter aus dem Spiel.«
»Ist auch nicht so wichtig. Es liegt am System. Finanzkrisen werden von Menschen gemacht. Da haben sich Teile der Wirtschaft von der Gesellschaft abgekoppelt, die asozialen Teile...«
»...aber unsere Dozenten...«
»Die Burschen kenne ich von meinem Studium her«, schnitt Philipp ihm das Wort ab. »Bei uns in Marburg waren sie auch nicht anders als hier in Köln. Sie wären nicht länger Dozenten, wenn sie den Unsinn nicht weitergeben würden.«
Philipp beugte sich vornüber und massierte seine Waden. Die Beine taten ihm weh, sie waren mehrere Stunden in der Eifel gewandert. Es war nicht leicht, mit Thomas mitzuhalten, denn der hatte einen sehr schnellen und ausgreifenden Schritt. Dabei war er nur einen halben Kopf größer, aber er brachte zwanzig Kilo weniger auf die Waage und hatte die Kondition eines Zweiundzwanzigjährigen.
Erst seit er Betriebswirtschaft studierte, begleitete er Philipp auf seinen Wanderungen. Als er noch zur Schule gegangen war, hatte Thomas es als spießig empfunden und sich vor seinen Freunden geschämt, mit seinem Vater über die Höhen der Eifel zu wandern, vielleicht in Gesellschaft von rüstigen Rentnern mit ledernen Kniebundhosen, atmungsaktiven Mikrofaseranoraks und Energiedrinks im Rucksack. Es war ihm auch unangenehm gewesen, dass man ihn sofort als Philipps Sohn erkannte, denn beide sahen sich ähnlich, beide hatten die hohe Stirn, dieselbe Haarfarbe, ihre Augen waren grau und schmal, und um den Mund zeigte sich eine Skepsis, meist von einem dezenten Lächeln gemildert.
»Was lernt ihr in den Vorlesungen? Was erzählen die Betriebswirte in den Seminaren?« Sie hätten den ganzen Tag über Zeit gehabt, darüber zu reden, aber beim Wandern stand keinem von beiden der Sinn nach derartigen Debatten. Die wurden erst geführt, wenn sie auf dem Heimweg essen gingen oder Philipp sich zu Hause an die Zubereitung des Abendessens machte.
»Wir analysieren ziemlich ausführlich, wie die Manager erfolgreicher Unternehmen vorgehen. Die Dozenten legen uns Fälle zur Analyse vor, und natürlich orientieren wir uns an erfolgreichen Unternehmen. Ich habe auch einen Kurs für Ethik belegt und einen für Risikomanagement. Aber bei uns, in der gesamten Betriebswirtschaft, geht es um Gewinn, um Profit, um Verdrängung der Konkurrenz, um Marktmacht und Wachstum. Das solltest du eigentlich wissen. Das ist in eurem Weinimport nicht anders.«
»Richtig, mein Junge. Genau das ist ja mein Problem.« Philipp richtete sich auf und stöhnte. Er war erschöpft, aber mit dem Tag zufrieden. »Du kannst davon ausgehen, dass der Keim für die nächste Krise bereits in dieser drinsteckt.«
»Eines verstehe ich nicht«, sagte Thomas.
»Nur eines? Das ist ja toll. Ich verstehe vieles nicht mehr.«
»Red mir nicht immer dazwischen«, meinte Thomas ärgerlich. »Was ich meine – was machen die mit dem vielen Geld? Wenn sie ihrer Freundin fünfzig rote Rosen kaufen würden...«
»Die fünfzig sind für die Ehefrau, wenn sie merkt, dass die Freundin fünfundzwanzig bekommen hat...«
Verwirrt sah Thomas ihn an.
»Weil sie höchstens fünfundzwanzig ist, die Geliebte. Mit der Ehefrau ist das lange vorbei.«
Thomas stöhnte. »Sehr witzig, Papa.« Philipp wusste, dass er diese Anrede nur gebrauchte, wenn er seinem Sohn auf den Wecker ging. »Scheinst dich ja auszukennen. Soll ich für dich mal eine Kommilitonin einladen? Ich denke da an Marion: groß, schlank, blond, lange Haare, durchtrainiert, so ein Fit-for-fun-Typ, aber dumm wie Brot. Aber die macht todsicher Karriere. Also, wieder von vorn: Wenn sie für ihr Geld einen tollen Bildband über die Camargue und ihre Pferde kaufen würden oder eine Kiste Champagner und dann Freunde einladen würden...«
»Dafür braucht man keine Millionen oder Milliarden.«
»Wofür dann?«
»Um die Angst zu besiegen. Haben statt Sein. Besitz statt Charakter, weil der Bezug zum Leben verloren ging. Außerdem ist Geld der einzige Stoff, an dem man sich nicht überfressen kann! Von zu viel Alkohol wird man blöde und bekommt einen Leberschaden, von Schokolade wird man so fett wie von Fastfood – aber nicht vom Geld. Und man muss es nicht lagern, so wie Dagobert Duck, um darin zu baden. Es sind nur Zahlen auf dem Bildschirm oder dem Kontoauszug. Ernst wird es erst, wenn die Leute ihr Geld von den Banken zurückhaben wollen oder wenn tatsächliche Werte verloren gehen.«
»Du machst auch Geschäfte, kaufst Wein und verkaufst ihn teurer.«
»Immerhin stehen eine Leistung und ein konkreter Wert dahinter. Außerdem spekulieren wir nicht damit, wir kalkulieren unsere Kosten und rechnen sie – und den Gewinn – dem Einkaufspreis hinzu.« Philipp hielt inne, sah seinen Sohn an und sagte dann in einem nachdenklichen, eher nach innen gerichteten Ton: »Allerdings glaube ich manchmal, dass es Klaus Langer am liebsten hätte, wenn wir die einzige Firma in Deutschland wären, die französische Weine importiert, und wenn alle Weinhändler nur bei ihm kaufen würden.«
»Und warum?«
»Wenn Langer neuerdings wir sagt, meint er eigentlich sich selbst. Weil er die Preise diktieren möchte und wir unseren Kunden sagen würden, was ihre Kunden wiederum zu trinken haben.«
Thomas horchte auf. »Solche Töne habe ich von dir noch nie gehört. Habt ihr Krach? Bislang warst du mit dem Laden zufrieden. Wie lange arbeitest du jetzt für Langer?«
»Zehn Jahre.« Philipp stöhnte. »Ja, bislang war ich zufrieden, das stimmt. Langer hat sich verändert. Du merkst es kaum, aber er benimmt sich merkwürdig. Bei keiner Sache hält er sich lange auf, er interessiert sich kaum noch für den Wein. Bei den Verkostungen ist er fahrig, hört nicht zu, und wenn man ihn dann fragt, dann weiß er doch Bescheid. Aber er redet, als ginge es ihn nichts an. Es ist ein Gefühl, ziemlich vage, aber es beunruhigt mich.«
Philipp stand auf, reckte sich und rückte die Kissen auf dem Gartenstuhl zurecht. »Langer geht es anscheinend nur noch ums Geld, um die Finanzen der Firma, um Kosten, um die Umschlagsgeschwindigkeit, das heißt, wie lange eine Flasche im Lager liegt, bevor sie verkauft wird, und was uns das kostet. Für die Belange der Mitarbeiter, unserer Lieferanten, für die Winzer, für die Komposition der Weine und die Kunden hat er kaum noch ein Ohr. Dabei hat er alles aufgebaut. Es gibt nichts in der Firma, das er nicht wüsste.«
»Du kennst ihn ziemlich gut, nicht wahr?«
»Früher, und das war noch bis zum vorletzten Jahr so, sind wir zusammen verreist.« Philipp starrte nachdenklich vor sich hin. »Wir waren in Bordeaux auf der VinExpo, danach haben wir auf dem Heimweg gemeinsam Lieferanten besucht, wir haben zusammen die Weinberge besichtigt, haben uns stundenlange Fassproben gegönnt. Jetzt redet er von Wein und meint Geld. Es scheint, als hätte er seinen Geschmack verloren. Bei den Verkostungen liegt er mit seinen Bewertungen häufig daneben. Dabei war sein Urteil immer genau. Ich habe viel von ihm gelernt.«
»Wieso ist das anders geworden?« Auch Thomas kannte Klaus Langer seit vielen Jahren, und er kannte seine Firma France-Import recht gut. Er hatte viele Weine ihres Sortiments probiert, denn was im Katalog angeboten wurde, tranken sie zu Hause. Sein Vater hatte ihm die Kollegen vorgestellt, die waren mehr oder weniger sympathisch, und er hatte als Schüler und auch noch in den letzten Semesterferien im Lager und im Büro gejobbt. »Ihr siezt euch noch immer?«, fragte Thomas und blinzelte, denn die Sonne stand bereits tief und warf ihren blendenden Schein zwischen zwei hohen Bäumen direkt auf die Terrasse.
Philipp nahm die leere Karaffe in die Hand. »Die Distanz zum Inhaber muss bleiben. Was sich geändert hat?« Er zuckte mit den Achseln. »Irgendwer liegt ihm in den Ohren. Irgendwer, den ich nicht kenne, dreht am Rad. Es ist gar nicht mal so, dass es neue Anweisungen gäbe oder dass Kollegen zusammengestaucht würden. Nein, es ist auch keiner entlassen worden, was mich wundert. Es ist bloß ein Gefühl, ein komisches, und ich gebe was darauf... ach, hol du uns was zu trinken. Wir sollten uns den Rest vom Sonntag nicht mit solchen Gesprächen verderben. Trinkst du ein Gläschen Champagner mit?«
»Bevor du mich schlägst...«
»Das würde ich in dem Fall glatt tun.«
»Wo ist die Flasche?«
»Du weißt doch gar nicht, welchen Champagner ich meine. Er stammt von einem neuen Produzenten. Ich muss mal wieder entscheiden, ob wir ihn ins Programm nehmen. Es ist ein Millésime 2004, Brut, eine Cuvée von...«
»Ein Jahrgangschampagner? Hast du mal überlegt, was dich das kosten würde, wenn du alles bezahlen müsstest?«
»Quatsch nicht rum, es ist nicht dein Geld, und geh in die Küche, du wolltest den Schampus holen, also. Er steht...«
»Ich weiß«, sagte Thomas, »den Weg zum Kühlschrank finde ich blind.«
»Du solltest langsam wissen, dass Champagner nicht in den Kühlschrank gehört. Wo bist du eigentlich aufgewachsen?«
»Bei einem manischen Weintrinker, einem durchgeknallten Koch und dem ewigen Gärtner.«
»Wie hältst du das aus? Was sagt dein Therapeut dazu?« Philipp machte ihr Geplänkel Spaß. Es verringerte die Entfernung zwischen ihm und seinem Sohn, sie trieben dieses Spiel seit Jahren, was dazu geführt hatte, dass es kaum Geheimnisse zwischen beiden gab. Und Philipp hatte sich nie bemüht, sein Leben vor Thomas zu verstecken.
»Und – wo ist das Zeug nun?«
»Im Keller, da, wo es hingehört. Und gekühlt wird es im Sektkühler mit Wasser und Eis, eine Serviette über den Flaschenhals gelegt...«
»Ich habe nicht vor, Sommelier zu werden«, sagte Thomas und trat ins Haus, »höchstens Winzer.«
Die letzten beiden Worte hatte Philipp zwar gehört, aber sie waren nicht bei ihm angekommen, schon gar nicht ihre Bedeutung. Der Millésime 2004 war von einem klaren Sonnengelb mit einem leichten Stich ins Grünliche. Oder schimmerte das Tischtuch durch? Um die Farbe genau zu beurteilen, hielt Philipp das Glas normalerweise vor ein weißes Blatt Papier. Aber heute wollte er trinken und nicht beurteilen, obwohl ihm das zur zweiten Natur geworden war. Unweigerlich lief bei ihm ein inneres Programm ab: sehen, riechen, schmecken, bewerten und sich fragen, ob dieser Champagner von Marc Brugnon aus Écueil ins France-Import-Angebot passte.
Der Firmengründer war längst nicht mehr am Ruder, die Söhne, Alain und Philippe hatten den Betrieb übernommen. Die Weitergabe der Kellerei an die Kinder erfüllte Philipp immer mit einer gewissen Befriedigung, und er rechnete es den jungen Nachfolgern hoch an, dass sie nicht an die Global Player wie Moët & Chandon oder Veuve Clicquot verkauften und die Welt noch unpersönlicher machten. Bei Brugnons achtzehn Hektar wäre das ein fantastisches Geschäft gewesen, denn ein Hektar Weinland in der Champagne kostete inzwischen bis zu 1,2Millionen Euro, je nachdem, ob es eine normale Lage war oder ob sie als Grand Cru oder Premier Cru eingestuft war. Hätten sie verkauft, hätten sie und ihre Familien in ihrem Leben nie wieder arbeiten müssen. Aber was hätten sie stattdessen tun sollen? Also machten sie Champagner, fürchteten die späten Fröste des Frühjahrs und quälten sich durch die Unsicherheiten des Sommers. Sie probierten, bis die richtige Cuvée zustande kam, und suchten Kunden zwischen Argentinien und Zypern.
Ein Hauch von Pampelmuse kam Philipp aus dem Glas entgegen, grüner Apfel und etwas Hefe. Es waren Aromen eines Champagners, der zu drei Vierteln aus Chardonnay gekeltert war. Die Rebsorten Pinot noir und Pinot meunier bildeten die restlichen 25Prozent der Cuvée. Andere Rebsorten durfte der Champagner sowieso nicht enthalten. Philipp erinnerte sich nicht daran, wie der Jahrgang 2002 gewesen war, sicher anders als der von 2003, einer der heißesten Sommer in der Geschichte der Champagne – wenn nicht in ganz Europa. Den vergaß kein Winzer. Es war vielleicht ein Vorgeschmack dessen, was im Verlauf des Klimawandels auf sie zukommen würde. Und dann trug dieser Champagner eine mineralische Note. Woher sie kam, lag Philipp geradezu bildlich auf der Zunge...
»Kalk, oder vielmehr Kreide, nicht wahr?«, fragte Thomas, obwohl er es wusste, und äffte dabei das Gesicht seines Vaters nach. »Der Duft erinnert mich an Schule.«
»Stimmt, es ist Kreide. Champagnertrauben wachsen direkt auf massiver Kreide, da liegt vielleicht ein halber Meter Humus oder Verwitterungsboden drüber, aber sonst ist es Kreide, entweder fest oder als Granulat. Wir sollten mal zusammen hinfahren.«
»Da lag ich ziemlich richtig. Vielleicht sollte ich deinen Job machen, wenn du dich pensionieren lässt.«
»Und was machst du in den fünfzehn Jahren, bis es so weit ist?«
»Nach dem Examen spiele ich Investmentberater und mache Geld. Das tun einige Kommilitonen bereits heute. Du glaubst es nicht, aber die zocken sogar zwischen den Vorlesungen mit dem bisschen Kohle, das sie haben, die geben irgendwelche Kauf- oder Verkaufsaufträge, zum Teil mitten in der Vorlesung per Handy, voll bekloppt, dann hasten sie vor die Tür, damit niemand mithört, und ihre Clique rätselt, ob sie jetzt den absoluten Geheimtipp gekriegt haben. Wenn die Kurse für Rüstungsaktien um fünf Prozent steigen oder die von irgendeinem Chemiemulti, dann blasen die sich auf wie die Ochsenfrösche. Ein Wunder, dass sie am nächsten Tag wieder in der Uni erscheinen. Die halten sich heute schon für klüger als unsere Profs.«
Es entstand eine Pause, in der Philipp sich an sein BWL-Studium an der Philipps-Universität erinnerte, Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger. Ob er, Philipp, der Besitzer der Uni sei, damit hatten sie ihn aufgezogen, es war der Running Gag seines Studiums gewesen. Sein Examen war in den Beginn der Ära Kohl gefallen, und damit hatte das begonnen, was ihm wie ein Abstieg in Dummheit und Gleichgültigkeit vorgekommen war. Davor hatten andere Zeiten geherrscht, andere Menschen waren unterwegs gewesen, wenn er sich an die Debatten in ihrer Marburger Zeit erinnerte. Und auf dem Flohmarkt vom Steinweg waren tatsächlich noch Flöhe angeboten worden. Auch damals hatte es die Streber gegeben, die neben dem Studium im Steuerbüro gearbeitet hatten, nicht weil sie es nötig gehabt hatten, nein. Die Karriere war ihnen bereits in die Wiege gelegt worden, und Papa hatte geholfen, Mama dagegen hatte Kunstgeschichte studiert...
»Tempora mutantur«, murmelte Philipp, »die Zeiten werden geändert, sie ändern sich nicht.« Er hätte mit Thomas keinesfalls tauschen mögen, nicht heute jung sein, nicht auf einen Bachelor oder Master in überfüllten Hörsälen studieren wollen, schmalspurig und unter ständigem Druck, und das ohne Aussichten auf den gut bezahlten Arbeitsplatz. Aber seine Zustimmung wollte Philipp nicht so offen zeigen und schaute wieder ins Glas und beobachtete das Aufsteigen der Kohlensäure. Es gab kein anderes Getränk, bei dem es so kurzweilig war, ihm zuzusehen. Dann kam beim Probieren die Sensation der feinen Perlung im Mund, das Phänomen der Schaumbildung, l’effervescence, wie es auf Französisch so schön hieß. Dieser Champagner hier, der von Brugnon, war eher männlich als weiblich, kräftig und herb, auch ausreichend lange gelagert, denn die Säure war milder geworden, und der Geschmack blieb lange im Mund.
»Bleibst du zum Essen?«
Wie immer spielte Thomas mit der Agraffe, dem Drahtverschluss, der den Korken in der Flasche hielt. Es waren vier kurze, kunstvoll ineinander verdrehte Drahtenden, jedes knapp zwanzig Zentimeter lang.
»Was gibt’s heute? Wieder Gemüse oder einen Risotto? Wieder kein Fleisch? Eigentlich wollte ich noch weg.« Er betrachtete die kleine Kappe aus Weißblech, die verhinderte, dass der Draht in den Korken schnitt. »Die sind alle anders gestaltet, auf diesem Deckelchen sind drei Männer im Weinberg, sieht aus wie ein Foto aus den Zwanzigerjahren. Was man nicht alles tut, um sich von anderen zu unterscheiden.« Er gab Philipp die Kappe.
Als dieser nachschenken wollte, hielt Thomas die Hand übers Glas. »Mehr als eins ist nicht drin. Die Kohlensäure treibt einem den Alkohol immer so schnell ins Gehirn, und ich will noch los.«
»Was ist angesagt?«, fragte Philipp
»Die Ärzte treten im Palladium auf.«
»Hast du dich etwa in Köln eingelebt? Den Akzent kriegst du bereits ganz gut hin.«
»Allerdings, ganz im Gegensatz zu dir.« Thomas wusste, dass es seinem Vater nicht gefiel. »Alte Männer können sich angeblich nicht mehr umstellen, total unflexibel, meint Susanne.«
»Fährt die auch mit?«
»Ja, und kann ich deinen Wagen haben? Bei meinem ziehen die Bremsen ungleichmäßig, und Alex, der ihn sonst immer repariert, ist krank.«
»Also wirst du nicht mit mir essen?«
»Du kochst doch auch für dich allein.« Thomas sah auf die Uhr. »Oh, Schei... ich muss los, bin viel zu spät. Lass es dir schmecken.«
Zehn Minuten später hörte Philipp das Tor der Garage zufallen und kurz darauf den Wagen anfahren. Dann herrschte Ruhe im Viertel, mehr als Philipp heute lieb war.
Totenstille war für Lövenich am frühen Sonntagabend eher der richtige Begriff. Weder lärmten Rasenmäher, noch klappten die Autotüren, der Sonntagsbesuch war längst wieder abgefahren, Vater sah die Sportschau, Mutter stand in der Küche, und die Kinder saßen vor dem Killerspiel. Es war so still, dass der Wind das Rauschen von der nahen B 1 herübertrug.
Gleich nachdem sie nach Köln gezogen waren, hatte Philipp das große Einfamilienhaus gekauft. Er hatte sich für diese Gegend entschieden, da es nicht besonders weit zum Industriegebiet Marsdorf war, wo er bei France-Import als Einkäufer arbeitete. Einer der Gründe für den Hauskauf war der große Garten gewesen, und mit der S-Bahn waren es nur zwei Stationen bis zum Dom. Den Wagen nutzte er nur für Geschäftsreisen, Fahrten ins Theater oder für Ausflüge wie heute. Ins Geschäft fuhr er mit dem Rad. Er mochte die Stille des Viertels, aber nach einem Tag wie heute, besonders wenn Thomas abends fortging, beschlich ihn ein Gefühl von Einsamkeit. An einem stillen Abend wie diesem fragte er sich ernsthaft, ob er noch mal einer Frau begegnen würde, mit der er gern zusammenleben würde. Allein sie zu treffen war fraglich, denn sein soziales Leben fand im Ausland statt, wenn er Frankreichs Weinbaugebiete nach neuen Winzern und guten Weinen abgraste. Im italienischen Veneto gab es eine Gutsbesitzerin, bei der er hin und wieder einige Tage blieb. Mit einer Schweizer Önologin hatte er ein ähnliches Verhältnis und traf sich mit ihr bei internationalen Ereignissen. Wenn sie zur Weinmesse nach Düsseldorf kam, blieb sie danach sogar einige Tage hier. Er hatte nicht den Eindruck, dass Thomas darunter gelitten hatte, dass er ihn allein erzog, es hatte zu seiner Selbstständigkeit beigetragen. Er hatte ihn mehrmals gefragt, ob er nicht lieber bei seiner Mutter und ihrem heutigen Ehemann leben würde, aber das hatte Thomas heftig abgelehnt und ihm vorgeworfen, ihn loswerden zu wollen. So hatte es sich eingebürgert, dass sie die Wochenenden miteinander verbrachten, zumindest tagsüber, aber Philipp wäre es nie in den Sinn gekommen, Thomas zu bitten, seinetwegen zu Hause zu bleiben.
Soll ich im »Le Moissonnier« anrufen, ob sie noch einen Platz für mich haben?, fragte sich Philipp und verwarf den Gedanken sofort. Er kam sich allein am Tisch im Restaurant lächerlich vor, wie jemand, der niemanden hat oder kennt, der mit ihm essen geht. Von seinen Kölner Bekannten– Freunde wäre zu viel gesagt – wollte er niemanden sehen. Er wollte weder über Golf-Handicaps noch über Fußball oder gar über Politik reden, und die richtigen Freunde, die alten, die aus Marburg, lebten über das ganze Land verstreut.
Allerdings musste er sich eingestehen, dass der Hauptgrund, nicht im »Le Moissonnier« anzurufen, der war, dass er Klaus Langer hätte treffen können. Und dann würde er sich zu ihm und seiner langweiligen Frau und womöglich zu den Freunden aus dem Karnevalsverein an den Tisch setzen müssen.
Der Kölsche Klüngel war ihm ein Graus. Er hatte zu ihm ein ähnlich gespanntes Verhältnis wie der Schriftsteller Thomas Bernhard, den er ungemein schätzte, zu Österreich. Seit Jahren redete Langer auf ihn ein, endlich seine Mitgliedschaft in seinem Verein, Blaue oder Rote Funken, zu beantragen, Bürgen gäbe es genug. Langer sei, zumindest hatte er es mehrfach wiederholt, auch von den Freunden angesprochen worden, wieso seine »Weinnase«, wie sie Philipp nannten, nicht bei ihnen Mitglied werde. Er wäre eine Bereicherung des Vereins. Das konnte er sich nicht vorstellen. Nein, es reichte, wenn er den Chef wochentags traf, und die Narrenkappe trug man im normalen Leben oft genug. Dann kam hinzu, dass Langer kürzlich eine Bemerkung vom Stapel gelassen hatte, er zahle ihm wohl ein zu hohes Gehalt, wenn er sich das »Le Moissonnier« leisten könne. Es war natürlich ironisch gemeint gewesen, aber steckte in jedem dummen Spruch nicht ein Körnchen Wahrheit?
Die Champagnerflasche ragte schräg aus dem Sektkühler und zeigte auf ihn, als wollte sie sagen, dass für ihn ein zweites Glas durchaus in Betracht kam. Philipp schenkte nach, trank, erst jetzt hatte der Champagner die richtige Temperatur, er spürte dem Geschmack nach und betrachtete seinen Garten. Er war groß, und wenn es nach ihm ginge, hätte er doppelt so groß sein können, er hätte Ausmaße haben können wie ein Park. Seinen Nachbarn missfiel es offensichtlich, dass er im vorletzten Frühjahr begonnen hatte, die Zierpflanzen gegen Nutzpflanzen auszutauschen, die Büsche auszureißen und Johannis- und Stachelbeersträucher zu pflanzen, und wo ehemals Rasen wuchs, zogen sich jetzt Hochbeete mit Salat, Zwiebeln, Knoblauch und Küchenkräutern am Zaun entlang. Es war beileibe kein Vorzeigegarten, mehr ein gepflegter Wildwuchs, ein recht ordentliches Chaos mit einigen Zierpflanzen und Büschen.
Sie halten mich gewiss für einen Eigenbrötler, sagte sich Philipp, und das bin ich wohl, ein komischer Kauz, oder vielleicht halten sie mich auch für schwul, gerade hier in Köln, denn wenn schon mal eine Frau im Hause auftauchte, war sie sehr jung, zu jung – die Freundin von Thomas.
Philipp erinnerte sich, dass Langer für morgen die neue Sekretärin angekündigt hatte: eine Helena Schilling. Man munkelte, dass sie die geschiedene Frau eines Geschäftsfreundes sei, die nach der Scheidung zum ersten Mal im Leben für den eigenen Lebensunterhalt selbst aufkommen müsse, nach einem Luxusleben ohne Arbeitszwang. Derartige Gerüchte waren kein guter Auftakt, besonders bei einer so wichtigen Position wie der Chefsekretärin. Ihre Vorgängerin, Frau Maheinicke, hatte einen Bordelaiser Winzer kennengelernt, der bei Saint-Estèphe ein Weingut betrieb und France-Import seit vielen Jahren belieferte. Die beiden hatten seit Jahren miteinander telefoniert, korrespondiert, Rechnungen und Frachtdokumente hin- und hergeschickt, man war immer freundlich und höflich gewesen. Dann war der Mann eines Tages hier aufgetaucht, und es hatte geknallt, so laut, dass alle Kollegen es sofort mitbekommen hatten. Jetzt lebte sie bei Saint-Estèphe, ihr lang gehegter Traum war in Erfüllung gegangen, und sie füllte seine statt Langers Lieferscheine aus. Sie war sehr fähig gewesen, äußerst zuverlässig und stets guter Laune. Philipp empfand ihren Weggang als herben Verlust. Und als Nachfolgerin die verwöhnte Ehefrau eines Geschäftsfreundes, sozusagen ein nobler Sozialfall, möglicherweise sogar einer aus dem Klüngel?
Das wird heiter werden, sagte er sich, fühlte sich ein wenig verloren, nahm den Sektkühler und das Glas und trug beides in die Küche. Er würde sich einen Pilzrisotto machen – oder doch lieber Tagliatelle mit Meeresfrüchten? Letztere tauten schnell auf, und er dachte wieder an die Neue morgen. Er würde sich in Acht nehmen. So wie Langer sich gegenwärtig gebärdete, war wenig Gutes zu erwarten...
2
»Ist der Lkw aus Bandol noch immer nicht eingetroffen?«
»Leider nein, Herr Achenbach«, antwortete der Lagerleiter zerknirscht, als wäre er dafür verantwortlich.
Dabei hatte Philipp alles für den weiteren Versand des Weins an die Händler vorbereitet: Kartonagen, Lieferscheine, Rechnungen, das Einzige, was fehlte, war der Wein. Er hätte bereits Ende der vergangenen Woche eintreffen sollen. Philipp war am Morgen sofort nach der Ankunft in der Firma in die Lagerhalle gestürzt, um sich nach der Lieferung zu erkundigen. Er hatte sich die Sonderaktion mit diesem seltenen Wein ausgedacht, France-Import konnte von Glück sagen, dass er vier Paletten davon hatte ergattern können, ein Wein von den sonnenverbrannten Terrassen an der französischen Mittelmeerküste. Es war ein edler Tropfen, alkoholreich, kräftig und würzig, ein Wein mit intensivem Aroma, der sehr gut zu Wild und kräftigem Rindfleisch passte. Wer ihn kannte, ließ ihn mindestens fünf Jahre im Keller ruhen, bevor er die Flasche entkorkte. Und weitere fünf Jahre später bot er immer noch ein großartiges Trinkvergnügen.
Auch Philipp hatte sich von der Reise nach Bandol zwei Kisten mitgebracht. Sein Wagen ächzte sowieso immer in den Achsen, wenn er von einer Verkostungstour aus Frankreich mit Proben beladen zurückkam. Und weil der Bandol so rar und beliebt war, hatte France-Import die gesamte Partie bereits verkauft. Philipp kannte Händler, deren Kunden einen derartig seltenen Wein zu schätzen wussten. Die Paletten brauchten lediglich abgeladen und die einzelnen Kartons auf kleinere Transporter umgeladen zu werden. Es war ein sicheres Geschäft – das hatte er zumindest bis zu diesem Morgen gedacht.
Ohne auf das freundliche »Guten Morgen« der Kollegen zu hören, eilte er in sein Büro, hängte das Sakko des Anzugs, den er gewöhnlich im Büro trug, über die Lehne seines mit braunem Wildleder bezogenen Bürostuhls und griff zum Telefon. Der Winzer am Mittelmeer erklärte nach kurzem Plaudern über das Wetter, dass er die Lieferung korrekt abgefertigt habe und die Dokumente faxen würde. Jetzt ließ Philipp seinen Unmut am Disponenten der Spedition aus. Der konnte nur berichten, dass der Fahrer sich am Freitag zuletzt von der Loire gemeldet hatte, wo er in Sancerre eine Ladung übernommen hatte. Seitdem hatte man von ihm nichts mehr gehört. Man würde Philipp verständigen, sobald der Fahrer auftauchte.
Die Strecke von dort bis nach Köln war an einem Tag zu bewältigen. Philipp kannte Frankreichs Straßen fast besser als die deutschen, er kannte ihren Zustand, die Entfernungen und die Zeit, die man für eine Strecke benötigte. Dass der Fahrer sich nicht meldete, war ungewöhnlich. Jeder besaß ein Mobiltelefon, und alle verbrachten das Wochenende lieber zu Hause als in der Schlafkabine ihres Lastzuges auf überfüllten Rastplätzen. Das Fahrverbot für Lastwagen an Wochenenden wurde in Frankreich strenger gehandhabt als in Deutschland.
Wie ein Tiger im Käfig lief Philipp, den sonst wenig aus der Ruhe brachte, vom Schreibtisch zum Fenster, von wo aus er einen Blick auf die Einfahrt hatte. Links ging es zum Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher, rechts an der Rampe wurden die LKWs entladen. Nach einem kurzen Blick lief er zurück zum Schreibtisch, von da aus hatte er die Rampe im Blick. Wenn eine neue Lieferung eintraf, war er gleich darauf im Lager, um sich seine Probeflasche zu holen. Jede Sendung musste kontrolliert werden, er musste wissen, ob der gelieferte Wein mit jener Probe übereinstimmte, die sie hier in ihrem Verkostungsteam probiert hatten.
Klaus Langer gehörte dazu, er war der Kopf und das Herz der Firma, wobei es in letzter Zeit häufig zu Herz-Rhythmus-Störungen gekommen war. Der Lagerleiter machte im Team mit, er hatte sich zum Weinexperten gemausert. Frau Maheinicke war leider nicht mehr dabei. Frau Becher aus der Auftragsannahme hatte er aus dem Team gekippt. Ein eigenständiges Urteil über einen Wein war von ihr selten zu hören, und sie interpretierte ihre Angaben auf den Fragebögen zum Wein geschickt um. Dahinter stand die Angst, Fehler zu machen. Seit Anfang des Jahres äußerte Langer Zweifel am Verfahren und an den Fragebögen, die er anfangs überschwänglich als »praxisnah« begrüßt hatte, wobei er Philipp als ihren Erfinder immer wieder lobend erwähnte. Inzwischen kritisierte der Chef die »Prozedur« als zeitraubend und aufwendig. »Wenn Sie und ich die Weine probieren, dann reicht das.«
Für Philipp waren die Fragebögen hilfreich, ihm erleichterten sie die Arbeit, es gehörte zu seinen Aufgaben, bei jeder Lieferung zu prüfen, ob die Weine aus derselben Abfüllung stammten oder geschmacklich voneinander abwichen. Er verglich die Angaben der Fragebögen mit seinen ersten Notizen vom Winzer. Er musste nur probieren und analysieren – nicht trinken. Die angebrochenen Flaschen gab er an die Kollegen weiter, außer es handelte sich um einen ganz besonderen Tropfen, dessen »Entwicklung« er beobachten musste, nachdem die Flasche geöffnet war. Er war dadurch mehr als verwöhnt, doch er wusste auch einen schlichten Wein zu schätzen. Auf den Preis kam es ihm, im Gegensatz zu Langer, dabei am wenigsten an.
Es war eine Unverschämtheit von diesem verdammten Fahrer, sich nicht zu melden. Im Falle eines Unfalls, das war Philipp klar, wäre die Spedition längst benachrichtigt worden. Es kam jedoch gelegentlich vor, dass mit Wein beladene Lastzüge gestohlen wurden. Die wertvollsten Flaschen wurden mit kleinen, schnellen Transportern abtransportiert. Bei Sattelzügen brauchte man nur die Zugmaschine und das Nummernschild des Aufliegers auszutauschen, über die Ladung wurde eine neutrale Plane gespannt, und schon waren alle Hinweise beseitigt. Abnehmer gab es jede Menge, sowohl in der Gastronomie als auch im Handel oder bei Privatleuten. Man goss ein Glas Rotwein außen über den Karton, deklarierte ihn damit als beschädigt und hatte den Grund, ihn billiger zu verkaufen. Entweder machten die Fahrer mit den Dieben gemeinsame Sache, eine Beteiligung war selten nachzuweisen, oder die Polizei fand sie gefesselt oder mit einer dicken Beule am Kopf im Wald neben der Landstraße.
Man müsste wissen, welche Weine noch auf diesem Lkw transportiert wurden, um einschätzen zu können, ob ein Diebstahl in Betracht käme. Auf dieser Route wurde kein Champagner geladen. Unter den Weinen aus Sancerre und Burgund gab es allerdings einige sehr teure Weine, deren Diebstahl sich lohnen würde.
Dann bog Langers silberner Mercedes in die Einfahrt und hielt auf dem Parkplatz neben der Rampe. Neuerdings kam der Chef häufig spät. Früher war er einer der Ersten im Betrieb und oft der Letzte, der abends nach Hause ging. Das verstärkte Philipps Eindruck, dass Langer immer mehr die Lust am Wein verlor, der ja der eigentliche Geschäftszweck war. Ob die Firma Gewinn abwarf, war den Kunden gleichgültig, solange sie ihre Weine bekamen, Aktionen für sie vorbereitet wurden und man auf ihre Sorgen und bis zum Sankt Nimmerleinstag gestreckte Zahlungsziele einging. Daher stand France-Import trotz Krise gut da, nur den Gastronomen, Sterneköchen und Edelrestaurants konnte sowieso niemand etwas recht machen.
Kaum begann Philipp seine Post zu öffnen, als Langer energisch klopfte, ein deutliches Signal, dass er sich ärgerte. Es war im Hause die einzige Tür, an die er klopfte. Normalerweise rief er seine Mitarbeiter telefonisch zu sich. Wenn er heute selbst kam, musste ein besonderer Grund vorliegen.
Langer hielt den runden Kopf leicht zur Seite und ein wenig nach hinten geneigt, so sah er aus, wenn er angriffslustig war und sich überlegen fühlte. Blaue Augen, blondes Haar, das nicht in Grau überging, sondern die Farbe verlor. Philipp war sich sicher, dass Langer es demnächst färben würde. Jetzt, wie er da in der Tür stand und lächelte, mit diesem neuen arroganten Zug um den Mund, und wie er sich mit einer Hand ans Revers seines grauen, ein wenig silbrig schimmernden Anzugs fasste, gefiel er Philipp nicht mehr. Die lachsfarbene Krawatte auf dem weißen Oberhemd störte, sie reihte ihn ein. Philipp wusste nicht, in welche Gruppe von Geschäftsleuten, aber sie tat es.
»Der Wein aus Bandol ist nicht gekommen? Was wird nun aus Ihrer Aktion?« Ein wenig Häme schwang in seiner Stimme mit. »Sie haben sich die Aktion ausgedacht, also bringen Sie das auch in Ordnung, Sie sind doch sonst nicht auf den Kopf gefallen.«
Bislang hatte Langer sich mit Schuldzuweisungen zurückgehalten, aber dass er Schadenfreude zeigte, obwohl es auch um seinen finanziellen Verlust ging, verwunderte Philipp. Gemeinhin sagte er wir, wenn er France-Import meinte. Jetzt, in diesem Moment, wurde der feine Riss in ihrem Wir ein wenig breiter.
Im Weggehen drehte Langer sich halb um und sagte über die Schulter: »Um zwölf Uhr in meinem Büro. Ich möchte Ihnen allen Frau Schilling vorstellen. Sie können uns dann über Ihr Bandol-Abenteuer informieren, falls da noch was zu erwarten ist.«
Es gab einiges, was an diesem unangenehm beginnenden Montag erledigt werden musste, das brachte Philipp auf andere Gedanken. Es war nicht seine Art, sich lange zu ärgern, nachtragend zu sein oder sich Sorgen zu machen. Doch immer wieder blickte er von der Korrespondenz auf, starrte hinüber zur Rampe, und ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Es war wie an einem heißen Sommertag, wenn man mittags bereits spürte, dass es abends ein Unwetter geben würde, nein, kein Gewitter, danach war die Luft meist sauber, bei einem Unwetter hingegen waren die Schäden nicht absehbar.
Bis kurz vor zwölf Uhr tat sich nichts mehr, der Lkw von der Mittelmeerküste blieb unauffindbar, und in der Spedition machte man sich Sorgen um den Fahrer. Es wurde Zeit für eine Vermisstenmeldung. Philipp bat eine Kollegin, die Weinhändler abzuwimmeln, die auf ihr Sonderangebot wartend anriefen, und sie um zwei oder drei Tage zu vertrösten.
Er betrat Langers Büro als Letzter. Die wichtigsten Kollegen, Langer nannte sie Mitarbeiter, drängten sich um den Konferenztisch, der höchstens acht Personen Platz bot. Mehr waren bei der Montagsbesprechung sonst auch nicht anwesend. Heute saßen da der Prokurist, der Mann vom Marketing, die Leiterin des Außendienstes, der Lagerchef sowie die Grafikerin und sogar der Fahrer, der in Köln und Umgebung Weinhändler, Restaurants und Privatkunden belieferte. Wer keinen Stuhl ergattert hatte, lehnte an der Fensterbank, die Tasse mit dem Kaffee in der Hand. Philipps Platz am Tisch war freigeblieben. Er war neben dem Prokuristen der Dienstälteste in der Runde, seit Frau Maheinicke nicht mehr da war.
Es dauerte einen Moment, bis Philipp die Neue sah und ihre Blicke sich trafen. Es waren jene seltenen Blicke, die nicht auf der Netzhaut hängen bleiben, sondern von dort durch Nervenbahnen oder was auch immer durchs Gehirn bis in den Magen geleitet werden und von dort weiter in die Knie. Es knallte so laut, dass Philipp meinte, jeder im Raum hätte es gehört und den Blitz gesehen, der zwischen ihnen züngelte. Er starrte die Frau noch immer an, er hatte das Gefühl, der Blick dauere ewig, und er hätte immer weiter in diese dunklen Augen schauen können, die ihn hielten und ihm auch Widerstand boten.
»Schön, dass auch Herr Achenbach eingetrudelt ist!« Langers Stimme kam von irgendwoher, von jenseits der Blitze, und sie erlöste Philipp aus seiner Starre. »Dann können wir fortfahren.«
Der Prokurist, der ihn später diskret fragte, ob es zwischen ihm und Langer Spannungen gebe, rückte ihm freundlich lächelnd den Stuhl zurück. Philipp setzte sich und wagte nicht mehr aufzublicken. Jeder im Raum musste seine Verwirrung bemerkt haben. Zehn Jahre? War es zehn Jahre her, dass er sich zuletzt verliebt hatte? Aber bei Anneliese war es nicht so – direkt gewesen, so – überraschend, kein Überfall der Gefühle. Anneliese hatte er begehrt, sie hatte ihm gefallen, auf sie hatte er zugehen können, man war sich gut gewesen, bis sich ihr Verhältnis über die Jahre und wegen der vielen Unterschiede ausgelaufen und erübrigt hatte, so wie damals bei Thomas’ Mutter. Als sie die Trennung bereits beschlossen hatten, war sie plötzlich schwanger gewesen.
Was ist mit meinem Magen los?, fragte sich Philipp und achtete nicht auf Langers Vortrag. Weshalb kann ich sie nicht ansehen? Als er es doch wagte und neugierig auf seine eigene Reaktion den Blick hob, schlug die Neue sofort die Augen nieder, als wäre sie ertappt worden.
Sie ist eine Katze, fuhr es ihm durch den Kopf, sie hat die Augen einer Katze, schmal, hintergründig. Eine Katze kommt und geht, wann sie will, und nicht, wenn man sie ruft. Sie holt sich ein Streicheln ab, verlangt herrisch nach Futter, beugt sich dann gnädig über den Napf, streicht einmal kurz um die Beine – und verschwindet. Nein, was für ein dummes Zeug, sie ist eine Frau, sagte er sich, eine, die mir ziemlich gut gefällt.
Langer, fast stolz auf seine Eroberung, erzählte irgendwas aus Helena Schillings Vorleben und über ihren beruflichen Hintergrund, was Philipp in keiner Weise interessierte. Ein Irrtum wurde ihm allerdings rasch bewusst: Sie war nicht der Typ der verwöhnten Ehefrau, dazu sprach sie hier vor den Anwesenden viel zu klar und strukturiert. Philipp stellte sich vor, wie sie aussehen mochte, wenn sie das dunkelbraune Haar löste, das im Nacken zusammengesteckt war. Hatte er sich verhört? Es drangen nur Wortfetzen zu ihm durch. Ihre Eltern waren Winzer gewesen? Sie stammte vom Kaiserstuhl? Dann verstand sie einiges vom Wein, das zumindest sollte man voraussetzen. Wenn das so war... na ja, was dann? Dann hätte er ein Thema, um sie anzusprechen. Vom Kaiserstuhl wusste er so gut wie nichts und konnte eine Frage an die andere reihen und sie dabei anschauen...
Helena Schilling mochte für die Firma eine Bereicherung sein, für Philipp und seine Fantasie war sie es allemal. Er fragte sich, wie er ihr in Zukunft bei seinem Gefühlswirrwarr gegenübertreten sollte, ohne eine Antwort zu finden. Er schreckte auf, als Langer seinen Namen nannte, und brauchte einen Moment, bis er begriff, dass jeder Anwesende einen kurzen Abriss seiner Tätigkeiten gab, und sein Beitrag wurde entsprechend konfus.
»Ich, äh, ich – suche hier nur die Weine aus.«
Die Mitglieder der Runde betrachteten ihn mit Befremden. Mochten sie es als Desinteresse werten, ihm war es egal, er hatte sowieso einen Sonderstatus. Er galt im Hause als Künstler. Er war der Pfadfinder, vielleicht auch der Narr, bei dem nichts mit einem normalen Maßstab gemessen wurde. Ihm sah man vieles nach, doch dass ihm die Worte fehlten, war neu.
Langer und Frau Schilling saßen vor ihnen wie ein Geschwisterpaar, das sich zukünftig die Macht teilen würde. Dabei war sie ganz Dame – dezent und elegant in ihrem hellbraunen Kostüm. Ein Ausdruck von Verbindlichkeit spielte um ihre leicht gespitzten Lippen, als würde sie bescheiden und doch von einer gewissen Warte herab die Worte ihrer zukünftigen Kollegen aufnehmen. Sie wirkte beileibe nicht wie ein Scheidungsopfer, schon gar nicht wie eine sitzengelassene Ehefrau. Sie mutete eher an wie jemand, der angetreten war, Langer in seine Schranken zu weisen.
Immer bemüht, dass sich ja ihre Blicke nicht kreuzten, betrachtete er ihre Hände. Es waren Hände zum Zupacken, beinahe bäuerlich, von der äußeren Erscheinung das Einzige, was auf den familiären Ursprung verwies. Sie wirkten kräftiger als seine, denen jedoch sah man die Gartenarbeit an. Er mochte keine Ringe, sie hätten ihn gestört, er hatte nie einen getragen. Schmuck gefiel ihm nur an Frauen, wenn sie damit nicht behängt waren. Er betrachtete seine Hände, die schmalen Finger, Künstlerhände, wie mal jemand gesagt und ihn für einen Feingeist gehalten hatte. Im Vergleich zu ihm hatte Helena Schilling Pranken, es war die Form, die den Eindruck hervorrief. Als man sich erhob, sah er, dass sie kleiner war als vermutet, die Nadelstreifen ihres Kostüms machten sie größer.
Er gab ihr die Hand. »Auf gute Zusammenarbeit«, sagte er wie in Trance, dabei hätte er sie lieber gefragt, ob sie mit ihm jetzt auf der Stelle ins Café Schmitz kommen würde. Er war überzeugt, dass sie Jugendstil mochte, sie war der Typ dafür. Da sie bereits länger in Köln wohnte, kannte sie das Café sicherlich. Er hatte die Frage auf der Zunge, aber sein Sinn für die Wirklichkeit rettete ihn vor dieser Dummheit. Der Händedruck schien ihm endlos. Die Gelegenheit fürs Schmitz würde sich ergeben, ihr Thema würde der Kaiserstuhl sein, und er wollte zur Tür hinausgleiten, als hätte er Schaum unter den Sohlen. Langers Hand an der Schulter und seine eindringliche Stimme, die außer ihm niemand hören sollte, holte ihn aus seinem Schwebezustand.
»Lassen Sie uns zusammen Essen gehen. Soweit ich weiß, haben Sie heute keinen weiteren Termin. Mir wäre es lieb, wenn wir rausfahren.«
Das fehlte noch. Eine Debatte mit Langer? Die konnte Philipp in diesem Zustand am wenigsten gebrauchen. Er wollte in dem Traum bleiben, am liebsten hätte er sich ans Rheinufer gesetzt und auf den Fluss gestarrt, ohne etwas zu denken, und dieses Gefühl ausgekostet. Er hatte es zu lange nicht getan.
»Was grämen Sie sich? Der verdammte Lkw aus Bandol kommt an oder nicht, egal ob Sie nun hier sind.«
»Sicher. Sie müssen mich allerdings in Ihrem Wagen mitnehmen, ich bin mit dem Fahrrad gekommen.«
»Nehmen Sie ein Taxi für den Rückweg, fertig. Ich habe anschließend eine Verabredung und komme nicht mehr ins Geschäft. Übrigens sollten Sie den Unsinn lassen.«
»Welchen Unsinn?«
»Sie wissen genau, was ich meine – diese Öko-Geschichten.« Sie standen mittlerweile vor Philipps Büro, Langer schloss die Tür hinter sich. »Haben Sie sich mal gefragt, wie viel CO2Sie beim Radeln auf dem Weg hierher ausstoßen? Weben Sie den Stoff für Ihre Anzüge selbst? Reines Leinen oder Viskose? Züchten Sie Schafe? Nicht dass Sie mir das Stricken anfangen... Reicht es nicht, dass Sie uns ein Ökoweinsortiment verpasst haben?«
»Eben nicht, Herr Langer. Sie sehen, dass es gut läuft, und das ist erst der Anfang. Alles andere ist übertrieben, die konventionellen Methoden, unbeschränktes Wachstum, Produkte, die keine sind...«
»Mir fehlen der Nerv und die Zeit, mit Ihnen darüber zu debattieren.« Langer setzte sich und betrachtete die Bilder.
»Worüber wollen Sie mit mir sprechen?« Philipp hörte den Anrufbeantworter ab. Die Spedition hatte nicht angerufen.
»Über die Erweiterung Ihrer Aufgaben, über ein neues Geschäftsfeld für France-Import und über Ihre Kompetenzen in diesem Hause.«
»Eine Strategiedebatte? Sollten wir die nicht lieber aufs Wochenende verschieben?«
»Ihre grundsätzliche Haltung ist mir wichtig, die möchte ich gern kennen, bevor ich zu dem Anschlusstermin gehe.«
»Dann kann uns Ihre Frau Schilling gleich einen Tisch im ›Le Moisonnier‹ bestellen, sozusagen als erste Amtshandlung.«
»Kommt nicht infrage! Wir gehen dahin, wo uns niemand kennt.«
Langer ging hinaus, und Philipp sah ihm nach. Was war jetzt los? Sonst verkehrte Langer doch nur dort, wo man ihn kannte.
»Was halten Sie von ihr?«
Es war klar, wen Langer meinte. Er parkte den Wagen vor dem Restaurant am Rheinufer. Ohne es zu wollen, hatte er Philipp dorthin gebracht, wohin er eigentlich wollte, an den Rhein. Aber statt sich seinem Gefühlsdurcheinander hinzugeben, musste Philipp sich auf sein Gegenüber konzentrieren.
»Frau Schilling?« Er zuckte mit den Achseln.
»Weshalb grinsen Sie? Gefällt sie Ihnen nicht?«
»Doch, schon, sicher.« Philip gab sich gelangweilt. »Was weiß man von einem Menschen, den man nicht länger als fünfundvierzig Minuten zu Gesicht bekommen hat, dazu noch auf einer Theaterbühne?«
»Was meinen Sie mit Theaterbühne?«
»Was erwarten Sie von einer offiziellen Veranstaltung zur Selbstdarstellung? Außerdem schaut man niemandem hinter die Stirn.«
»Ich im Moment auch nicht hinter Ihre. Sie äußern sich doch sonst so gern eindeutig. Haben Sie was gegen die Frau?«
Wenn Langer so fragte, hatte auch sonst niemand etwas bemerkt.
»Sie werden sich mit ihr arrangieren, ich will sie haben!«
Dass Langer sie nicht als Frau wollte, war Philipp klar. Er war oft genug mit ihm auf Geschäftsreise gewesen, um das beurteilen zu können. Auf den Partys und Empfängen nach anstrengenden Messetagen in Bordeaux, in Angers oder an der Rhone, die von den Kellereien für Kunden veranstaltet wurden, tanzten sie manchmal bis in den Morgen, und man erkannte schnell, wo die Sympathien lagen und wer mit wem in welchen Autos zurück ins Hotel fuhr, oder wer besonders bemüht war, keinerlei Spekulationen Raum zu geben... So wie er heute.
»Sie werden es mit ihr nicht leicht haben, Herr Langer. Sie scheint mir sehr selbstständig zu sein, sie ist jemand mit einem eigenen Kopf. Eine Sekretärin zum Rumschicken haben Sie mit ihr nicht eingekauft. Ich halte sie für weniger diplomatisch als Frau Maheinicke. Wie es um ihre berufliche Qualifikation bestellt ist, kann ich nicht beurteilen.«
»Danke für die klare Meinung. Sie hat bis zum Abitur auf dem Weingut ihrer Eltern gelebt. Sie kennt den Betrieb, sie versteht was von Wein, sie wird nicht, und das ist Bestandteil des Arbeitsvertrages, auf einer 40-Stunden-Woche bestehen. Sie weiß, dass ich von ihr mehr erwarte.«
»Und was ist das?« Philipp hielt Langer die Tür des Restaurants auf.
»Danke. Genau darüber will ich mit Ihnen reden. Und dafür brauche ich auch Sie.«
Erst jetzt hörte Philipp wirklich zu. Plante Langer etwas, von dem er nichts wusste? War das der Grund für sein unverständliches Verhalten?
Sie bekamen einen Tisch in der äußersten rechten Ecke mit Rheinblick zugewiesen, an dem sie ungestört und ungehört blieben. Die Mittagssonne, die für Mai schon recht intensiv war, blendete sie dank der Jalousien nicht, dafür glitzerte die Wasserfläche. Sie setzten sich über Eck und wandten dem Publikum den Rücken zu.
Der Ober räumte nach einem Blick auf die beiden anscheinend solventen Gäste das Schildchen »RESERVIERT« vom Tisch, rückte die Stühle zurecht und brachte die Menükarten.
»Welchen Champagner führen Sie?«, fragte ihn Langer und bestätigte damit die Einschätzung des Obers.
»Champagner?«, fragte Philipp verblüfft. »Gibt’s was zu feiern?«
»Ich glaube schon«, meinte Langer vielsagend.
»Wir führen die großen Marken: Pol Roger, Pommery, Heidsieck, Mumm – ich bringe Ihnen die Weinkarte.«
»Nein, lassen Sie. Führen Sie keinen Winzerchampagner?«
Der Ober zuckte mit den Achseln. »Nur die Hausmarke.«
»Brut sollte er mindestens sein«, entschied Philipp, »auf keinen Fall mehr Süße beziehungsweise Zucker haben. Aus welchen Rebsorten setzt sich Ihre Cuvée zusammen?«
»Das entzieht sich meiner Kenntnis«, sagte der Ober und schien nicht recht zu wissen, ob er Experten oder Angeber vor sich hatte. »Ich bringe doch besser die Weinkarte.«
Aber auch da fand sich kein Hinweis auf die Reben, die Zusammensetzung der Cuvée, geschweige denn ein Hinweis auf die Produzenten. Langer überließ Philipp wie immer die Entscheidung. Der Champagner kam aus Aÿ, das Städtchen war als Anbaugebiet für Pinot-noir-Trauben bekannt, die würden sich dann vielleicht im Geschmack wiederfinden. Diese rote Traube verlieh dem Wein das Aroma roter Früchte und machte ihn intensiver. Pinot meunier, in Deutschland als Schwarzriesling oder Müllerrebe bekannt und ebenfalls rot, den Experten nach eine Unterart von Pinot noir, war die kräftigste im Champagnertrio, machte den Wein fruchtiger, geschmeidiger und erbrachte mehr Bouquet. Chardonnay, beim Champagner die dritte Rebsorte im Bunde, war hingegen elegant und fein, etwas blumig und fiel bei den Kalkböden der Champagne sowieso mineralisch aus.
»Es freut mich, dass Sie über Champagner so gut Bescheid wissen, das macht es einfach. Sie nennen den Champagner immer Wein«, bemerkte Langer, »ich habe mich stets darüber gewundert, aber nie gefragt, wieso Sie das tun.«
»Weil er in erster Linie ein Wein ist. Die Kohlensäure entsteht erst später bei der Flaschengärung, durch den Zusatz von Hefe und Zucker, durch die Fülldosage, die Franzosen nennen es liqueur de tirage. Denken Sie sich die Kohlensäure weg, und Sie haben einen Wein. Er wirkt mit Kohlensäure natürlich gänzlich anders.«
Aber ihren ersten Durst löschten die beiden Männer mit Wasser, wobei Langer es albern fand, dass Philipp sich immer über die Unverschämtheit ärgerte, dass für eine Flasche Wasser zehn oder zwölf Euro verlangt wurde.
»Es muss ein besonderer Tag sein, dass wir zum Mittagessen Champagner trinken. Was gibt’s zu feiern?«
Langer ließ sich mit der Antwort Zeit, er blätterte in der Karte und kostete Philipps Ungeduld aus.
»Vielleicht die Erweiterung der Firma, die Übernahme neuer Aufgaben und ein erweiterter Aufgabenbereich für Sie – ich kann Sie beruhigen – möglicherweise sogar mit einer anderen Stellung im Unternehmen«, schob er nach, als er Philipps Verblüffung gewahr wurde.
Philipp traf diese Eröffnung einerseits völlig unvorbereitet, andererseits hatte er insgeheim mit Veränderungen gerechnet. Wieso kamen sie just in dem Moment, wo er innerlich auf Abstand ging? Er wich Langers Blick aus und starrte auf den Fluss. Er wies normalerweise eine neue Idee nicht gleich von sich, er konnte sich auf veränderte Situationen schnell einstellen, sonst hätte er das ständige Reisen nie ausgehalten. Eine Umleitung war für ihn mit einer neuen Erfahrung verbunden und brachte ihn nicht zwangsläufig vom Weg ab, sondern zeigte ihm einen neuen. Aber diese Andeutung erfüllte ihn mit größter Skepsis. Es kam ihm so vor, als werde seine Welt gerade auf den Kopf gestellt und er könne nicht das Geringste dagegen tun.
»Sie hören ja gar nicht zu«, bemerkte Langer erstaunt. »Ich meine es ernst. Aber nichts ist umsonst, das sagen Sie selbst. Wie gefällt Ihnen die Idee?«
»Großartig, absolut großartig«, sagte er, ohne es zu meinen. Er hielt sich besser bedeckt und wartete ab, denn was Langer ankündigte, war in seinen Ausmaßen nicht zu überschauen. Mehr Geld klingt immer nach mehr Arbeit, sagte er sich, der Esel bekam die Möhre vor die Nase gehalten und rannte los.
Der Ober mit dem Block in der Hand enthob ihn einstweilen einer Antwort, von der Philipp nicht wusste, wie er sie diplomatisch formulieren sollte. Da war es schon einfacher, das Essen zu bestellen.
Langer entschied sich für Foie gras, was Philipp erzürnte. Wäre nicht ein besonderer Anlass der Grund ihres Aufenthalts hier gewesen, er hätte sowohl Langer wie auch dem Ober gesagt, was er davon hielt. Es war eines der ekelerregendsten Beispiele dafür, wie Menschen für ihren Luxus Tiere quälten. Es war wortwörtlich nichts anderes als Fettleber, die dadurch erreicht wurde, dass männlichen Enten und Gänsen zwei- bis dreimal täglich ein Metallrohr in den Schlund gedrückt und den zappelnden Tieren tausend bis zweitausend Gramm eines Getreide-Fett-Breis in den Magen gepumpt wurde. Durch diese Zwangsernährung weitete sich die Leber krankhaft aus. Er würde Langer morgen eine Abhandlung zu dieser Art Tierquälerei auf den Schreibtisch legen. Künstlich vergrößerte Organe zu essen empfand er als ähnlich krankhaft wie die japanische Manie, lebenden Haien die Rückenflosse abzuschneiden, um daraus Suppe zu kochen.
Er war kein Vegetarier, einem guten Stück Fleisch war er durchaus zugeneigt, aber es musste nicht täglich auf den Teller. Gemüse in allen Variationen besetzte immer häufiger seinen privaten Speiseplan, Pasta in jeder Art, diverse Sorten Reis, die man erst entdecken musste, feinste italienische Linsen, und wenn man Kartoffeln nicht mehr nur als satt machende Beilage betrachtete, wurden sie äußerst interessant in ihrer vielfältigen Zubereitung. Dann eröffnete sich die Welt der Salate, hunderterlei Käsesorten... Seine Abneigung gegen vorgefertigtes Essen, gegen Supermarktfutter, dazu noch von Fremden zubereitet, wuchs in dem Maß, wie er auf Reisen gezwungen war, sich in Restaurants zu ernähren. Er fand inzwischen mehr Gefallen daran, sein Essen selbst zu kochen, als sich von einem blasierten Sternekoch einwickeln zu lassen, zu exorbitanten Preisen. Zu Hause wusste er, was auf dem Teller lag. Bei dem technisierten Stand der Lebensmittelindustrie und der Kunstprodukte konnte das zur Frage des Überlebens werden.
Er entschied sich für eine Geflügelterrine und danach für den Zander. Langer, dem er seine Bedenken lieber verschwieg, liebäugelte zuerst mit pochiertem Kalbsfleisch, entschied sich dann aber für die Languste.
»Das ist kein gepresstes Fischeiweiß in Garnelenform?« Philipp konnte das Mäkeln nicht lassen.
Der Ober sah pikiert auf Philipp herab.
»Sie können einem mit Ihren Bedenken auch den Appetit verderben«, knurrte Langer wie ein Hund, dem man den Fressnapf wegzog, und nickte als Zeichen für den Ober, sie allein zu lassen. »Ich will mit Ihnen über etwas Ernstes reden und nicht über Ihre Gastro-Phobien. Ich will die Firma ausbauen und vergrößern. Die Lage erfordert es, die Krise erfordert es. Es heißt, sie sei vorüber, die Bars in London sind längst wieder mit Investmentbankern gefüllt, der Champagnerkonsum steigt – das ist der beste Indikator.«
»Vertrauen Sie der Presse?«
»Herrgott, nein. Aber ich habe einen Freund aus London, der sich bestens in der Szene auskennt, er ist sozusagen dort zu Hause. Gerade in dieser Situation müssen wir unser Angebot erweitern, uns über neue Felder Gedanken machen. Jedes Zögern wird als Schwäche begriffen, deshalb gehen wir vorwärts. Wenn andere untergehen, hissen wir die Segel. Wir werden wachsen, expandieren, wir dürfen gerade in dieser Situation den anderen nicht den Markt überlassen.«
»Wenn wir die Firma vergrößern, brauchen wir auch mehr Mitarbeiter. Wer soll die Aufgaben übernehmen?«
»Sie, Herr Achenbach, Sie! Sie werden daran einen entscheidenden Anteil haben. Sie werden unser zukünftiges Italienangebot aufbauen. Ich kenne niemanden, der sich im Handel so gut auskennt wie Sie. Spanien ist danach dran, und auch der Vertrieb deutscher Weine ins Ausland. Frankreich wird unser Testmarkt, wir nutzen Ihre Verbindungen dorthin. Wir müssen europäisch denken, nicht zum Global, aber doch zum European Player werden. Ich hatte immer Vertrauen zu Ihnen, und die Erfahrung der letzten Jahre gibt mir recht. Sie hatten alle Freiheit, die Sie wollten, und wir haben dabei immer hervorragend zusammengearbeitet. Sie haben mich nie enttäuscht. Und umgekehrt ist das genauso, oder?«
Philipp nickte. »Das ist absolut richtig.« Bis heute war es so gewesen, er zwang sich zu einem Lächeln und ahnte, dass alles einmal zu Ende ging. Aber das war nur ein vages Gefühl.
»In einem Jahr muss das Italienangebot stehen. Das hängt von Ihrem Verhandlungsgeschick ab. Sie müssen einige Winzer von ihren bisherigen Importeuren abwerben und sie veranlassen, mit uns zu arbeiten. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Es bleibt wenig Zeit, die Mitbewerber schlafen nicht. Friss, Vogel, oder stirb. Gleichzeitig muss unsere Logistik ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Personal, jemanden wie einen General Manager, einen CEO, wie die Konzerne es nennen, den Chief Executive Officer. Zuerst jedoch müssen unsere Mitarbeiter härter ran. Der Schlendrian hört auf. In zwei Wochen stößt ein Unternehmensberater zu uns und wird eine Betriebsanalyse vornehmen. Wir werden anbauen oder umziehen, denn für das, was ich mir vorstelle, sind die Büros und das Lager zu klein und zu unmodern. Vielleicht reicht vorerst auch ein Ausbau, wir werden sehen...«