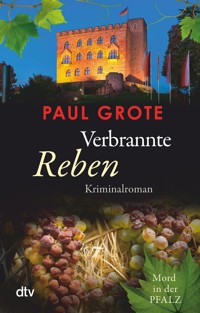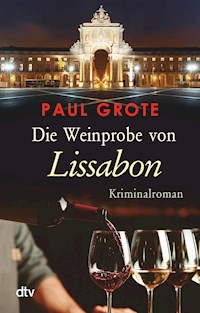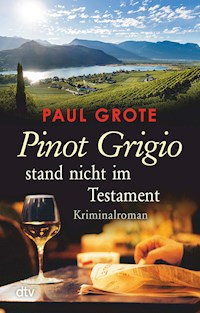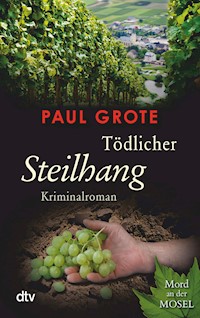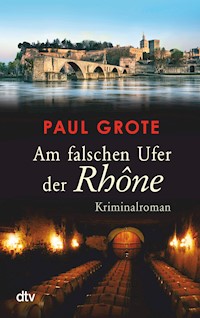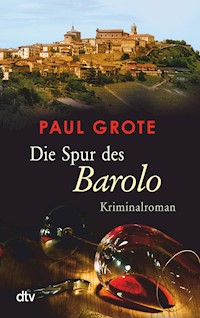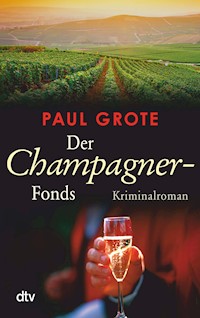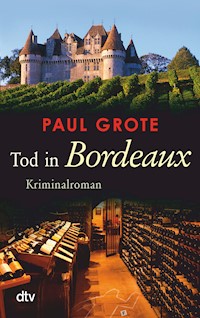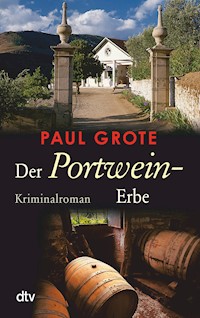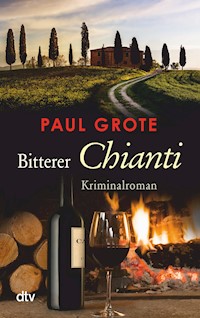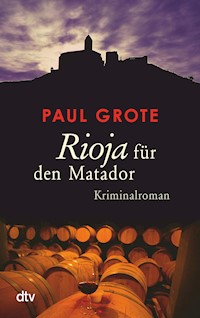6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Roter Wein am Schwarzen Meer. Martin Bongers, ehemals Frankfurter Weinhändler, heute Winzer in Bordeaux, erhält einen folgenschweren Auftrag: Für einen dubiosen französischen Investor soll er in Rumänien ein Weingut kaufen. Bereits in Bukarest gerät er zwischen die Fronten feindlicher Gruppen und widerstreitender Interessen. Stecken korrupte Beamte oder Ex-Securitate-Agenten dahinter? Bongers folgt dem Duft des großen rumänischen Weines, doch die Spur führt ihn hinein ins Grauen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Paul Grote
Der Wein des KGB
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2009© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40172-2 (epub) ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21160-4
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Dieses Buch ist all denen gewidmet,
die an Rumäniens Grenzen scheiterten.
»Tutti colpevole, nessuno colpevole«, wie man in Italien sagt: Wenn jeder schuldig ist, ist niemand schuldig.
1
Bis zu dem Moment, als Monsieur Coulange aufstand und sich der Rezeption zuwandte, hatte Martin Bongers keinerlei Argwohn verspürt. Das Gespräch, zu dem der Manager aus Paris angereist war, verlief in einem nahezu persönlichen Ton. Um das Eis zu brechen, hatten die beiden Männer ein unerschöpfliches Thema gewählt: die Krise des Bordelaiser Weinbaus. Allem Anschein nach hatten die Winzer begriffen, dass die Lorbeeren, auf denen sie sich ausruhten, wie alle Blätter nach einer Weile vertrocknen und dass in anderen Ländern ebenfalls großartige Weine gemacht werden. Den Auftrag jedoch – nur deshalb war Coulange nach Bordeaux gekommen – hatte er lediglich am Rande erwähnt. Aber auch das war noch kein Grund, misstrauisch zu werden.
Martins Misstrauen erwachte erst, als Coulange nicht wie angekündigt den Weg zu den Toiletten einschlug, sondern auf einen Mann zuging, der im entgegengesetzten Teil der Hotelhalle im Halbdunkel auf ihn gewartet hatte. Seit dem Mord an seinem Freund Gaston reichte dazu der nichtigste Anlass, Martin war dünnhäutig geworden. Die beiden Männer kannten sich zweifellos. Was hatte Coulange mit jemandem zu besprechen, den er ihm allem Anschein nach vorenthielt?
Auf halbem Wege zum Tisch mit den Zeitungen, wo Martin einen Blick in die heutige Ausgabe von ›Le Monde‹ hatte werfen wollen, änderte er die Richtung und blieb hinter einer der großen Palmen zwischen den Sitzgruppen stehen. Von hier aus hatte er Coulange und seinen Gesprächspartner im Blick, ohne gesehen zu werden.
Er bog einen der Fächer der Palme nach unten und strich mit dem Finger darüber. Mediterranes Flair, dachte er, künstlich wie alles in diesem Luxushotel. Coulange und sein unbekannter Gast passten bestens hierher. Coulange hatte das Hotel als Treffpunkt vorgeschlagen. Martin bewegte sich auf derartigem Parkett nur dann, wenn er seine Weine präsentierte. Sie waren gut, sie waren teuer, sie brauchten diesen Rahmen. Er brauchte ihn nicht, und Charlotte hatte ihn mehrmals lächelnd daran erinnern müssen, sich die Fingernägel zu reinigen, wenn er aus dem Weinberg direkt zu einem solchen Ereignis eilte.
Coulange lehnte sich an einen Pfeiler und redete auf den anderen Mann ein, der ab und zu eine Frage stellte. Beide standen so nah zusammen, dass zwischen ihnen eine vertrauliche Beziehung bestehen musste, gleichzeitig taxierten sie die ankommenden Gäste. Der zweite Mann war groß und schlank, grauhaarig und nicht übermäßig elegant gekleidet, und er war um einiges älter, er war der Ranghöhere. In den Jahren als Weinhändler in Frankfurt hatte Martin gelernt, seine Kunden bereits beim Betreten seines Ladens einzuschätzen. Er hatte sich selten getäuscht.
Wieso hatte Coulange diesen Mann nicht an ihren Tisch gebeten? War es sein Vorgesetzter, dem er einen Bericht über den Verlauf ihrer Unterredung erstattete? Unsinn. Bislang war nichts Konkretes besprochen worden. Nicht einmal den Vertrag hatte er gesehen. Wenn Coulange bereits jetzt zum Rapport bestellt war, dann war er nicht der, für den er sich ausgab. Oder ging es gar nicht um Martin und den möglichen Auftrag? Was sollte dann die versteckte Kopfbewegung in seine Richtung?
Es war unmöglich, sich den Männern weiter zu nähern, um zu hören, worüber sie sprachen. Martin ging langsam zurück zu den Zeitungen und blätterte in der ›Le Monde‹. Während er die Schlagzeilen überflog, ließ er die Männer nicht aus den Augen. Ihr Gespräch währte nur kurz. Ohne sich mit einem Händeschütteln zu verabschieden, trennten sie sich. Coulange ging immer noch nicht, wie angekündigt, zu den Toiletten, sondern zur Rezeption und steuerte dann auf den Tisch mit den Sesseln zu, wo sie zuvor gesessen hatten.
Martin erreichte die Sitzgruppe vor ihm. Er ließ sich in einen der Sessel fallen, faltete die Zeitung auseinander und starrte die Buchstaben an. Es war ärgerlich, dass ihm seine heimliche Beobachtung die Laune verdorben hatte. Mit einem Gefühl von Neugier war er hergekommen, jetzt hatte sich eine Missstimmung in das Treffen eingeschlichen, wie ein unbekannter Fehlton in einem ansonsten guten Wein.
Coulange hatte bisher einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, und sein Vorschlag war interessant. Martin ließ die Zeitung sinken, als der Manager sich setzte. Coulange lächelte, jovial und geschäftlich, jedoch nicht wie einer, der wirklich lächelt, wenn er morgens mit einer Schere in der Hand durch seinen Weinberg geht, Reben schneidet, sich dabei die Finger fast abfriert und trotzdem den Sonnenaufgang genießt.
»Ich frage mich, Monsieur Coulange, wie Sie oder die SISA ausgerechnet auf mich kommen«, sagte Martin, als sein Gegenüber sich im Sessel zurechtgerückt hatte. Er wollte die Initiative ergreifen und nicht warten, bis Coulange ihm eröffnete, was man von ihm erwartete. »Wieso wollen Sie mich nach Rumänien schicken? Es gibt andere, die als Consultant besser geeignet sind. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kenne das Land nicht. Ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist oder von dort stammt. Ich habe nicht einmal eine Vorstellung, wie es da aussieht. Gut, von dem monströsen Palast in Bukarest habe ich ein Foto in der Zeitung gesehen, anlässlich der NATO-Tagung – das Bauwerk eines Größenwahnsinnigen . . .«
Coulange nickte verständnisvoll. »Mir geht es ebenso, Monsieur Bongers. Oft ist es besser, man weiß nicht, was auf einen zukommt.«
»Was meinen Sie damit?« Coulange lächelte ausweichend, so zumindest interpretierte Martin es. »Sie wissen also auch nichts? Aber weshalb soll dann ausgerechnet ich dort hinfahren? Wieso glauben Sie, dass Sie auf meinen Erkenntnissen basierend investieren und bauen können?«
»Wir halten Sie für absolut vertrauenswürdig, Monsieur Bongers. Außerdem«, jetzt grinste Coulange kumpelhaft, »woher wollen Sie wissen, dass wir nicht gleichzeitig einen zweiten Mann mit demselben Auftrag losschicken?«
War das ein Witz? Wollte Coulange ihn testen oder verunsichern? »Von den dortigen Winzern oder Weinproduzenten habe ich nicht die geringste Ahnung, geschweige denn von ihren Weinen«, fuhr Martin fort, ohne seine Verstimmung zu zeigen. »Schwarze Mädchentraube, Fetească Neagră – keine Ahnung, was man daraus für Weine machen kann. Das wenige, was ich von dort probiert habe, hat mich nicht vom Hocker gerissen.«
Coulange lächelte unbeirrt weiter. Er und seine Auftraggeber werden sich viel von meiner Mitarbeit versprechen, dachte Martin, sonst wäre es der Vorschlag nicht wert gewesen, darüber zu verhandeln, und Coulange hätte sich den Weg sparen können.
»Sie fliegen also extra von Paris nach Bordeaux, um mit mir zu reden! Gibt es niemanden, der diese Aufgabe besser erledigen kann? Warum sollte ich mich darauf einlassen?«
Coulange setzte zu einer Antwort an, aber Martin ließ ihn noch nicht zu Wort kommen. »Sie rechnen mit meiner Zusage, nicht wahr? Man macht ein derartiges Angebot nur, wenn man annimmt, dass der Kandidat sich darauf einlässt. Oder sollte ich mich irren? Dann müssen Sie eine ganze Menge über mich wissen. Da wüsste ich gerne, was das ist und von wem diese Informationen stammen.«
Jetzt war Coulange dran, Martin lehnte sich zurück, betrachtete die Gäste an den Nebentischen, die alle besser in die Fünf-Sterne-Umgebung passten als er in seinem schäbigen Anzug. Nur die Krawatte war neu, ein Geschenk von Charlotte. Hatte Coulange den zweiten Mann mitgebracht, um ihn insgeheim zu beobachten? Er blickte sich um. Wozu der Aufwand? War sein Misstrauen erst einmal geweckt, dann dauerte es lange, bis er sich beruhigte. Gaston war seit fünf Jahren tot, aber er, Martin, sah noch immer Gespenster.
Coulange führte die Kaffeetasse zum Mund und setzte sie mit einem Ausdruck des Missfallens wieder ab. »Kalt. Möchten Sie auch noch einen Kaffee? Vielleicht einen Cognac dazu?«
»Lieber einen Armagnac.«
Coulange winkt nach dem Ober. Während dieser Coulange mit einem Überangebot an Cognacmarken bombardierte und die jeweiligen Vorzüge herausstrich, betrachtete Martin sein Gegenüber. Coulange mochte jünger sein als er, knapp vierzig, ein Karrieretyp und ein Stratege, der jeden Schritt genauestens plante, in Finanzangelegenheiten weitaus beschlagener als er – kein Wunder, beim Vertreter eines Agrarinvestors–, aber in menschlichen Fragen sicher hilflos. Ob er Kinder hatte?
Und Coulange war unsportlich, sein Gang zu schwerfällig. Die paar Schritte vom Schreibtischsessel zum Flughafen und ins Hotel, den Rollkoffer hinter sich, hielten ihn nicht beweglich. Sein dunkelblauer Anzug war elegant und teuer, die Armbanduhr auch, goldene Manschettenknöpfe, also verdiente er gut. Das Gesicht wirkte glatt, das Leben hatte so gut wie keine Spuren darin zurückgelassen, die Augen waren kalt. Das machte den Umgang mit diesem Vertreter der SISA nicht unbedingt einfach.
Als Martin bemerkte, dass der Kellner Coulange mit seiner Kenntnis von geistigen Getränken zunehmend bedrängte, nannte er eine Armagnac- und eine Cognacmarke, lächelte auffordernd und der Ober enteilte.
Martins Frage, weshalb man ihn für den Auftrag ausgesucht hatte, war immer noch nicht beantwortet. Coulange war intelligent genug zu wissen, dass von der Antwort viel abhing, er wusste sicherlich, dass der Umgang mit Menschen, für die das Streben nach Geld nicht die oberste Maxime im Leben war, sehr viel Fingerspitzengefühl erforderte.
»Wir haben uns über Sie informiert, Monsieur Bongers. Selbstverständlich wissen wir, dass Sie in Frankfurt einen Weinhandel betrieben haben und vor fünf Jahren das Weingut Ihres... tragisch ums Leben gekommenen Freundes übernommen haben. Sie betreiben es mit Erfolg. Das heißt, Sie bringen das Wissen über den Markt mit, haben Erfahrungen als Bindeglied zwischen Weinproduzenten und dem Kunden. Als Fachhändler kennen Sie sich in Europas Weinbaugebieten aus, haben Vergleichsmöglichkeiten, Sie besuchen internationale Messen und verfügen über entsprechende Kontakte. Dann sind Sie für Ihre deutschen Kunden als Makler von Bordelaiser Weinen tätig. Zusätzlich sind Sie Winzer. Ich will nicht sagen, Sie hätten die Seiten gewechselt, aber ein wenig scheint es mir so. Sie sind ein Multitalent. Sie wissen, wie Wein entsteht, und zwar guter Wein. Sie kennen sich mit dem Boden und mit dem Klima aus und wissen, wie weit man einen Wein beeinflussen kann. Also, Theorie und Praxis wären gewährleistet. Außerdem können Sie sich denken, dass wir über Ihre finanzielle Lage informiert sind . . .«
»Das klingt, als hätten Sie vor unserem Gespräch Geheimdienstarbeit betrieben. Und – was wissen Sie über meine Ehe?«, unterbrach Martin ihn unwirsch. Er hasste es, beobachtet zu werden, egal von wem und zu welchem Zweck. Er gab sich jetzt keine Mühe mehr, seinen Unwillen zu verbergen.
»Das geht uns nichts an. Sie wurden uns von Ihren Kollegen empfohlen.«
»Also haben die sich an den Deutschen gewöhnt? Gaston hatte es damals ziemlich schwer hier, sogar als Franzose . . .«
»Auch davon wissen wir. Wundert Sie das? Der Fall ist seinerzeit ausführlich in der Presse behandelt worden. Ich will auf Folgendes hinaus: Gerade der Umstand, dass Sie Deutscher sind, macht Ihre Mitarbeit so wertvoll für uns. Wir wollen nicht in Erscheinung treten. Wir möchten vermeiden – und da erwarte ich von Ihnen Stillschweigen, auch wenn Sie sich gegen unseren Vorschlag entscheiden–, dass die SISA in Zusammenhang mit Ihrer Recherche in irgendeiner Weise auftaucht.«
»Wie soll das funktionieren? Ich soll für Sie arbeiten, Ihnen Informationen beschaffen und Ihnen den Rücken freihalten? Sie treten nicht in Erscheinung und gleichzeitig reise ich in Ihrem Namen . . .?«
Coulange lächelte zum ersten Mal wirklich. »Eben nicht in unserem Namen. Sie treten als unabhängiger Experte auf, als Consultant, als Makler mit eigenen Interessen, der sich über die Weinwirtschaft informiert. Sie suchen für mögliche Investoren nach Weinbergen, Traubenlieferanten und Kellereien – durch Vermittlung von Kontakten erschließen Sie sich selbst ein neues Geschäftsfeld. Briefpapier, Visitenkarten und Kreditkarten bekommen Sie von uns, natürlich richten wir für Sie ein spezielles Bankkonto ein. Sie werden den Eindruck erwecken, dass Sie rumänische Anbieter und deutsche Investoren zusammenbringen. Der Umstand, dass Sie nichts über das Land wissen, macht Ihre Fragen besonders glaubwürdig. Wenn die Rumänen glauben, mit Ihrer Hilfe gute Geschäfte machen zu können und sich Exportmärkte zu erschließen, wenn man Sie als wichtig und kompetent erachtet, was Sie ohne Zweifel sind, Monsieur Bongers . . .«
». .. Sie meinen als nützlich!«, wobei in Martins Hirn kurz der Begriff »nützlicher Idiot« aufflackerte.
Coulange überging den Einwand. ». .. je wichtiger Sie für die dortigen Behörden, Verbände und möglichen Partner sind, desto mehr werden Sie erfahren, desto mehr vertraut man Ihnen an, zumal Sie allein auftreten. Damit sind Sie ungefährlich . . .«
»Ein Einzelner lässt sich leicht ausschalten?«
»Unsinn. Sehen Sie es positiv. Sie helfen uns, wir helfen Ihnen. Ich kann Ihnen eine Umschuldung Ihrer Verbindlichkeiten, die aus Ihren jüngsten Weinbergkäufen resultieren, zu besseren Bedingungen anbieten. Aber nach außen hin handeln Sie, und das muss klar sein, auf eigene Rechnung – es gibt absolut keine Verbindung zu uns, was auch immer geschieht.«
»Es muss Ihnen viel bedeuten, sich im Hintergrund zu halten, Monsieur Coulange.«
»Was glauben Sie eigentlich, was passiert, wenn wir offiziell dort auftreten?« Coulange verbarg seinen Unmut nur mühsam. »Die Preise für Weinberge und Kellereien werden explodieren. Wir werden uns vor Anbietern, Agenten und Beratern nicht retten können. Alle werden sich auf uns stürzen und Geschäfte vorschlagen, bei denen für uns nichts herauskommt. Soweit wir wissen, verkauft Rumänien alles, sogar an die Russen, die sichern sich bereits die Ölförderung, besitzen eine der drei Tankstellenketten – man wird Geld bieten, Schmiergeld, auch unseren Mitarbeitern, vielleicht auch Ihnen, um offen zu sein. Und dieser Gefahr wollen wir Sie nicht aussetzen. Wir würden also niemals ein objektives Bild erhalten. Und genau darum geht es, deshalb brauchen wir Sie! Wir wollen von Ihnen eine Analyse, einen Bericht und Vorschläge. Die Schlussfolgerungen ziehen wir.«
»Und ich werde von niemandem Geld nehmen?«
Coulanges »Nein!« kam spontan. »Das ist nicht Ihr Stil, Monsieur.«
Martin war sich nicht klar darüber, ob sein Gegenüber deshalb Mitleid mit ihm hatte und ihn womöglich für einfältig hielt, weil er nicht gnadenlos auf seinen Vorteil zusteuerte. Doch da täuschte sich Coulange. Martin sah durchaus seinen Vorteil, nur verzichtete er auf das wichtigtuerische Gehabe, er spielte weder den erfolgreichen Aufsteigerwinzer noch sprach er von »großen Herausforderungen«.
»Was Sie an Unterstützung von uns brauchen, Monsieur Bongers, finanziell sowie logistisch, das sollen Sie bekommen, Spesen inbegriffen.«
»Das klingt großzügig«, meinte Martin trocken und nippte am Armagnac, der mittlerweile vor ihm stand.
Coulange griff nach dem Cognac und zog gespannt die Augenbrauen hoch. »Ich trinke eigentlich nie etwas vor Sonnenuntergang.« Mit diesem Satz vermied er, auf Martins sarkastischen Ton einzugehen, er schaute ihn lediglich befremdet an. »Woher Ihr Unwille, Monsieur Bongers, Ihre Skepsis? Wir machen Ihnen ein großzügiges Angebot. Natürlich sind wir über Ihre finanzielle Lage im Bild. Sie sind mit dem Zukauf von Weinbergen und der Modernisierung Ihrer Kellerei – oder Garage, wie Sie es nennen – an die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit gelangt.«
»Nett gesagt. Allerdings macht eine größere Erntemenge diese Erweiterung erforderlich.«
»Ich weiß, in Ihrer Garage liegt nicht eine Flasche, die nicht längst verkauft ist. Ich habe auch nur von Grenzen gesprochen, der Rahmen ist überschaubar geblieben. Doch ein wenig mehr Geld, auch wenn sogar die neue Ernte bereits verkauft ist, schadet nicht. Es liegt Ihnen nicht, Schulden zu machen. Sie sind konservativ. Daher bin ich sicher, dass Sie unser Angebot schätzen. Als Honorar für Ihre Mitarbeit haben wir zwanzigtausend . . .«
»Fünfundzwanzigtausend.«
»An fünftausend wird es nicht scheitern. Wir haben einen Vertrag vorbereitet... wir zahlen es Ihnen auch in einem anderen Land aus, wenn Sie wollen.«
Ich hätte dreißigtausend verlangen sollen, dachte Martin, aber nun war es zu spät. Coulange legte den Vertrag auf den Tisch und schob ihn herüber.
»Wir können über alles reden, wir sind flexibel und gesprächsbereit, nur nicht in Bezug auf die Geheimhaltung. In spätestens einer Woche benötige ich Ihre Zusage, und in vier Wochen sollten Sie unterwegs sein. Ich halte den Juni für ideal, dann sind Sie sowohl im Weinberg wie auch in Ihrer... Garage abkömmlich. Außerdem ist Ihr Schwiegervater noch da.«
Das »Garage« klang ein wenig abfällig, Martin verstand es jedenfalls so. Aber ihn störte etwas ganz anderes. »Was wissen Sie eigentlich nicht von mir, Monsieur Coulange?«
Der Manager lächelte sanft und breitete die Arme aus.
2
Am frühen Abend kommt jeder Fluss zur Ruhe, so auch die Gironde. Der Wind legt sich, keine Welle kräuselt die weite Wasserfläche vor der Stadt. Die Sonne neigt sich dem Horizont zu, legt ihre späten Strahlen auf die graublauen Dächer, und obwohl der Feierabendverkehr durch Bordeaux brandet, herrscht am Wasser Ruhe.
Martin zog das Jackett aus, lockerte die Krawatte, schwang sich neben dem Zeitungskiosk auf die Brüstung der Uferpromenade, ließ die Beine baumeln und genoss die Aussicht. Er war nicht in Eile und brauchte sich keine Sorgen zu machen. Die Blüte verlief zufriedenstellend – bis jetzt. Von der Wetterlage her waren weder späte Kälteeinbrüche noch Regen zu erwarten. Ein Verrieseln der Blüten war so gut wie ausgeschlossen, sie würden sich zu guten Trauben entwickeln. Die drei Jahre alten Neuanpflanzungen auf dem Land seines Schwiegervaters würden in diesem Jahr zum ersten Mal tragen. Jérôme war überzeugt, dass sich aus den ersten Trauben ein trinkbarer Wein machen ließ. Auf den anderen drei Hektar, die Jérôme sozusagen als Strohmann für ihn gekauft hatte und die ein Stück nördlich ihrer eigenen Rebgärten lagen, waren sie noch nicht so weit. Insofern waren Coulanges Bedenken gerechtfertigt: Wenn er, Martin, und nicht Jérôme als Käufer aufgetreten wäre, hätten sie bedeutend mehr zahlen müssen. Aber die von Coulange verlangte Geheimhaltung war nicht das, was ihn störte – es war der Mann im Hintergrund...
Der Verkehr auf der Promenade nahm zu, um den Kiosk herum wurde es eng, die Abendzeitungen trafen ein, und Martin sah sich gezwungen, zur Seite zu rücken, um den Wartenden Platz zu machen. Er war im Hotel nicht dazu gekommen, die ›Le Monde‹ zu lesen. Er sollte sich ein Exemplar kaufen. Leider stand selten etwas über Deutschland drin. Wenn er hier nach einer deutschen Zeitung fragte, sah ihn François, der Verkäufer, mitfühlend an und erkundigte sich, ob er Heimweh habe, und wunderte sich, dass es nicht so war.
Von François sah er jetzt nur die Hände, die mit blitzschnellem Griff das Geld entgegennahmen, es erinnerte ihn an seine erste Sparbüchse, eine kleine schwarze Kiste, aus der nach einem schnarrenden Geräusch eine Plastikhand hervorschoss und die Münze schnappte, die man in einen dafür vorgesehenen Schlitz steckte. François war ein ähnlich körperloses Wesen, es bestand nur aus der linken Hand, selten aus einem schwarz behaarten Unterarm, die aus diesem Stapel von Zeitungen, Journalen, Broschüren und Büchern herausfuhr und nach dem Geld griff.
Heimweh? Martin blickte über die träge dahinfließende Gironde. Nein. Er hatte mit dem Wechsel nach Saint-Émilion nur gewonnen. Er bewegte sich heute gelassener, hatte mehr Freude an dem, was er tat, er sah sich als Gärtner, dem man die Verantwortung für die Rebstöcke übertragen hatte, er sah sich nicht als ihr Besitzer. Sie, dazu die Erde und das Wetter machten sowieso, was sie wollten. Er war viel draußen, heute allerdings hatte er wegen des Treffens aufs Jogging verzichten müssen. Allerdings waren seine Beziehungen zu Menschen weniger geworden, dafür intensiver. Er hatte sich daran gewöhnen müssen, dass nicht alle zehn Minuten jemand in seinen Laden trat, das Telefon klingelte selten, und wenn er im Weinberg war, stellte er sogar das Mobiltelefon ab. Das Geldverdienen allerdings war schwer geworden, aber auch das hatte er in den Griff bekommen, seit er für deutsche Händler Weine auswählte. Die Abwicklung der Lieferungen hatte Frau Schnor übernommen, seine ehemalige Mitarbeiterin aus Frankfurt, es klappte gut. Und alles das, was danach gefolgt war, hatte ihn nur fester mit Saint-Émilion verbunden.
Der größte Gewinn war Charlotte. Es klang makaber, aber hatte er letztlich nicht auch sie Gaston zu verdanken? Die Tochter der Nachbarn, die sonst in Paris lebte, war zu Besuch da gewesen, als Gaston beerdigt worden war. Nach ihrer Scheidung und als das Trauerjahr vorüber war, hatten sie und Martin geheiratet. Charlotte war eine großartige Frau. Sie war ihm fremd und gleichzeitig vertraut wie lediglich Gaston zuvor, sie waren eins, und doch tat jeder, was er für richtig hielt. Traten sie gemeinsam auf, hatte niemand eine Chance, und wer von ihnen Hilfe brauchte, bekam sie vom anderen. Manchmal beschlich ihn eine diffuse Angst, sie irgendwann zu verlieren, durch Umstände, einen Unfall...
Wieder stießen François’ Unterarme aus dem Papierhaufen, die Hände griffen Scheine so sicher wie Münzen. »Wenn ihr mich eines Tages begrabt«, pflegte François in vollem Ernst zu sagen, »dann in diesem Haufen Papier, am besten gleich unter dem Kiosk, da habe ich den Fluss an meiner Seite.«
Eine Bö kräuselte die Wasserfläche, zwei Boote waren unterwegs, und Martin erinnerte sich daran, wie entscheidend diese Lage für den Aufstieg von Bordeaux gewesen war, sowohl von der Bodenbeschaffenheit her wie auch vom Klima, und was nutzt der schönste Wein, wenn man ihn nicht verschiffen kann?
Sogar er, als eingefleischter Merlot-Fan, hatte wieder zur typischen Linie zurückgefunden, er hatte jetzt Cabernet Sauvignon gepflanzt, um neben dem Pechant, den Gaston erdacht hatte, eine klassische Cuvée zu machen. Im nächsten Weinberg würde es auch wieder Cabernet Franc geben, allein schon aus Protest gegen die Gleichmacherei der Geschmäcker, da sich zu viele Winzer von den Punkten des US-Weinpapstes Robert Parker beeinflussen ließen. Er würde bei Winzerkollegen viel probieren müssen, um die richtigen Klone zu finden. Dann kam es darauf an, wie sie sich auf seinem Boden entwickeln würden. Er würde das Thema angehen, wenn er aus Rumänien zurück wäre.
Ja, ich werde den Auftrag übernehmen, sagte er sich. Wenn die SISA bereit ist, so viel Geld auszugeben, müssen die Informationen, die ich ihnen beschaffen soll, ziemlich viel wert sein. Oder sind sie so schwierig zu bekommen?
Er wusste, dass ihn gerade das besonders reizte. Ja, er würde den Vertrag unterschreiben, außer Charlotte würde ihr Veto einlegen. Doch was könnte sie gegen die Reise einwenden? Im Rahmen ihrer neuen Aufgabe als Consultant des UN-Welternährungsprogramms war sie in Gegenden unterwegs, deren Namen er nicht einmal kannte. Das Unangenehmste an der Reise würde sein, dass er sie einen Monat lang nicht sehen würde. Doch bei dem guten Honorar konnte er mal eben herüberfliegen und drei Tage später da weitermachen, wo er aufgehört hatte.
Als Martin sich von der Brüstung schwang, sahen die vor dem Kiosk Wartenden her, erstaunt, dass ein Mann in seinem Alter und mit seinem Aussehen sich zu derartigen Sperenzchen hinreißen ließ. Francois rief ihn (konnte er durch Papier hindurchsehen?), er bekam eine drei Tage alte ›Süddeutsche Zeitung‹ aus dem Stapel gereicht, dann ging er zur Hotelgarage zurück, wo er seinen Wagen geparkt hatte. Das Hotel war nah, es lag in der Einkaufszone gegenüber vom Grand Théâtre innerhalb des sogenannten Goldenen Dreiecks. Außerdem wollte er Coulange noch sagen, dass er den Auftrag nur unter einer Bedingung übernähme: Die SISA musste ein Drittel des Honorars im Voraus zahlen.
»Monsieur Coulange? Sind Sie sicher?« Der Portier an der Rezeption starrte auf einen Bildschirm, drehte an den Knöpfen seiner Uniform und schüttelte den Kopf. »Mit diesem Namen ist niemand bei uns abgestiegen. Vielleicht logiert der Herr unter anderem Namen oder vielleicht unter dem einer Firma?«
Hatte Coulange nicht erwähnt, dass er hier wohne, oder war Martin lediglich davon ausgegangen? Er starrte den Portier an – normalerweise hörte er gut zu... Der zweite Mann fiel ihm wieder ein. Der Portier sagte noch etwas, aber Martin hörte nicht mehr hin. Er erinnerte sich, dass er sich gleich nach dem ersten Anruf von Coulange im Internet die Homepage der SISA angesehen hatte: das übliche Geschwafel von innovativen Lösungen, strategischer und operativer Beratung sowie komplexem Projektmanagement im Agrarsektor. Soll sich jeder darunter vorstellen, was er will, in der virtuellen Welt wird der Schein zur Wirklichkeit. Er sollte Sichel in Frankfurt bitten, Erkundigungen über die Firma anzustellen, sein Freund war in dieser Beziehung unschlagbar, auch wegen seiner internationalen Verbindungen, was er damals beim Aufdecken der London-Singapur-Connection bewiesen hatte. Wenn Sichel die SISA für seriös hielt, würde er sich sicherer fühlen.
Kurz vor achtzehn Uhr war er zu Hause und ging wie üblich, wenn Charlotte verreist war, in die »Garage«. Die Gärtanks blitzten kalt und sauber, vom Boden hätte man essen können, es gab keinen Geruch, der seine empfindliche Nase störte, wie Coulanges aufdringliches Aftershave. Als er die Tür zum Barriquekeller öffnete, wehte ihm der Duft von Nelke und Vanille entgegen, das Lignin, das die Eichenholzfässer verströmten. Er warf einen Blick auf die Barriques, ihr Anblick wirkte auf ihn immer besänftigend, in ihnen reifte nicht nur der Wein, sondern auch die Zeit. Der letzte Blick galt dem Flaschenlager. Es war gut gefüllt, jedoch stammten nur noch wenige Flaschen aus Gastons Bestand. Der Wein des Freundes diente ihm weiter als Vorlage und Orientierung für seine eigenen Weine. Er brauchte sie, um in Erfahrung zu bringen, wie die Jahrgänge sich entwickelten und wann sie den optimalen Trinkzeitpunkt erreicht hatten. Seine eigenen Weine gehörten ihm längst nicht mehr, alles war verkauft, aber die Flaschen blieben in seiner Obhut, bewegungslos und bei gleichbleibend niedriger Temperatur, bis er sie freigab. Die Kunden wollten trinkfertige Weine, also mussten sie warten.
Er schloss sorgfältig ab und wandte sich nach rechts, ging die leichte Anhöhe hinauf, von wo er das Haus seiner Schwiegereltern sehen konnte. Er machte sich Sorgen um Jérôme. Er klagte verstohlen über Druck in der Brust, ließ sich aber nicht dazu bewegen, einen Arzt aufzusuchen.
»Wenn man erst damit anfängt, kommt man von ihnen nicht mehr weg, bis sie einen in den Sarg stecken«, war seine stereotype Antwort. Charlotte konnte so viel schimpfen, wie sie wollte, und auf ihre Mutter, Madame Lisette wurde sowieso nicht gehört. Jetzt lag es an ihm, Jérôme hörte nur auf ihn. Aber die Fensterläden waren zugeklappt, demnach waren die beiden weggefahren. Martin kehrte enttäuscht zurück. Er hätte gern über die Eindrücke des Nachmittags mit seinem Schwiegervater gesprochen, damit er entweder seine Zweifel ausräumte oder ihn darin bestärkte. Er hatte das Gefühl, dass Coulange mehr wusste, als er sagte.
Der Auftrag kam Martin äußerst gelegen. Er würde wieder reisen, so wie früher, als ihn die Suche nach außergewöhnlichen Weinen durch ganz Westeuropa geführt hatte. Er kannte sich in Italien besser aus als in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Dieser Staat und die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang waren ihm immer fremd gewesen. Rumänien war jetzt in der Europäischen Union. Es wäre interessant zu sehen, wie die Weine inzwischen waren, wie sich die Menschen dort zwanzig Jahre nach ihrer »Wende« gebärdeten und ob dort neue Konkurrenten für den internationalen Weinmarkt heranwuchsen. Außerdem waren die fünfundzwanzigtausend Euro nicht zu verachten. Im Grunde genommen war es gar nicht viel, wenn er bedachte, dass Flying Winemaker, Wein-Coaches und sonstige obskure Berater zwei- bis dreitausend am Tag einsackten. Im Vergleich zu Coulange war er bestimmt ein armer Schlucker, sein Geld steckte in der Erde.
Die Stille im Haus an einem solchen Tag machte ihm zu schaffen. Vor vier Jahren hatten sie es gekauft, Gastons Frau Caroline und die Kinder waren ausgezogen und in den Süden zurückgegangen. Seit er mit Charlotte hier lebte, empfand er das Haus als viel zu groß für zwei, und dieses Gefühl wurde nahezu unerträglich, wenn sie verreist war. Für eigene Kinder waren sie leider zu alt. Wenn Daniel in den Sommerferien kam und ihm half – Gastons Sohn hatte die Begeisterung des Vaters für den Weinbau geerbt–, war die Stimmung gänzlich anders. Und auch Martins Schwester war nach der Scheidung und dem Bankrott ihres Exmannes oft zu Besuch. Aber das war alles nur vorübergehend. Sie hatten schon überlegt, ein oder zwei Zimmer an Feriengäste zu vermieten. Dann hätten sie allerdings umbauen müssen.
In der Küche begutachtete Martin den Inhalt des Kühlschranks und musterte die Vorräte in der Speisekammer. Er sah nichts, woraus er auf die Schnelle ein Abendessen hätte zubereiten können. Für sich allein zu kochen hatte er sich in der Ehe abgewöhnt. Einkaufen würde er morgen, bevor er Charlotte vom Flugplatz abholte. Missmutig verließ er die Küche, tauschte den Anzug gegen Jeans und Lederjacke und warf sich in den Wagen. Als er kurz vor Castillon-la-Bataille das Bistro an der Tankstelle erreichte, besserte sich seine Laune. Das Bistro war zum Treffpunkt der lokalen »Billard-Elite aus Winzern, Landarbeitern und Lieferwagenfahrern« geworden, wie Charlotte sarkastisch bemerkte. Ein wenig eifersüchtig durfte sie gern sein.
»Du bist eben ein Glückspilz.« Jacques strich zum wiederholten Male mit der Kreide über die Spitze des Queues. Martin hatte ihm während des Spiels vom Treffen mit Coulange berichtet. »Was deine Bedenken angeht, so übertreibst du. Im Grunde bist du zu beneiden. Dieser Auftrag kommt genau im Moment, wo du Geld brauchst. Was beklagst du dich?«
Martin sah Jacques ungeduldig auf die Finger. Immer wenn sein Freund die Spitze des Queues derartig bearbeitete, wusste er nicht, wie er den nächsten Stoß führen sollte. Er war in der Klemme, und das ärgerte ihn maßlos, aber zeigen konnte er es auch nicht. Jacques war, seit Martin begonnen hatte, hier im Bistro zu spielen, bedeutend besser geworden, aber er reichte nicht an ihn heran. Doch als Winzer nahmen sie ihn noch immer nicht ganz für voll, obwohl seine Entscheidung, demnächst eine klassische Cuvée zu machen, viel Zustimmung fand. Das hatte er wie immer über Dritte erfahren. An ihn als Deutschen hatten sie sich gewöhnt. Er bekam hier und da noch einen dummen Spruch zu hören, besonders wenn er zu viel gewann, aber nur von Leuten, die ihn nur flüchtig kannten, und die wurden dann von den Stammgästen zur Räson gerufen. Als Billardspieler hatte er sich einen Namen gemacht, weit über Castillon hinaus. Hier hatte ihn noch nie jemand geschlagen.
Jacques beugte sich über den Tisch und überlegte offenbar, ob er es schaffen würde, die rote Kugel über die Bande anzuspielen.
»Allez! Mach endlich, aber das schaffst du sowieso nicht«, maulte Martin, »außerdem langweilst du unser Publikum.« Heute fehlte ihm die richtige Konzentration fürs Spiel, zu viel ging ihm im Kopf herum. Er grinste die Gäste an, die am Nebentisch darauf brannten, dass der Tisch endlich frei würde.
Jacques zögerte, schüttelte den Kopf, sein langes schwarzes Haar, in dem sich erste graue Strähnen fanden, flog ihm um die Ohren. Er richtete sich auf. »Lassen wir das. Du hast heute keine Geduld. Was ist los mit dir? Aber vielleicht ist es ganz gut, dass Bernard wartet und dass wir die neuen Jahrgänge von Cairanne probieren, die sind eingetroffen.«
Sie übergaben ihre Queues an die Wartenden und gingen an die Bar, wo der Patron vier Flaschen und vor jeder Flasche drei Gläser aufgebaut hatte.
»Monsieur ist heute nicht in Stimmung?«, fragte Bernard und erwartete von Jacques die Antwort.
Martin zog sich einen Barhocker heran. »Eigentlich nicht, aber guter Wein bessert meine Laune. Schenk endlich ein.«
Der Patron hatte die Flaschen längst entkorkt, damit der Wein atmen konnte. Er stammte von der Genossenschaft Cave de Cairanne, Martin hatte ihn vor vielen Jahren hier entdeckt, er kam aus dem Anbaugebiet Côtes du Rhône Villages. Nur die besseren Lagen durften den Namen ihres Ortes angeben. Die weniger Guten mussten auf die Bezeichnung »Villages« verzichten. Und obwohl die Cairanne-Weine nicht zu den Großen zählten, waren sie in ihrer Art wunderbar, einzigartig und bis zur Trinkreife gelagert worden.
Martin, für seine gute Nase berühmt, hatte durch seine Weinauswahl das Bistro in eine Art Geheimtipp verwandelt: Hier gab es Top-Weine zu bezahlbaren Preisen. Er hatte sie ausgesucht, denn in gewisser Weise setzte er so seine frühere Tätigkeit als Weinhändler fort, und der Patron vertraute ihm. Allerdings hasste es Martin, der »deutsche Grenouille« genannt zu werden. Bichot hatte es aufgebracht, der Herr von Château Grandville, er hatte ihn mit dem Mörder aus Patrick Süskinds Roman ›Das Parfum‹ verglichen. Das Einzige, was Martin mit jener Romanfigur gemeinsam hatte, war der einzigartige Geruchssinn.
Jacques und Martin begannen mit einem Réserve von 2005, einem einfachen, unkomplizierten Rotwein, den man allerdings hätte dekantieren sollen. Es war ein Wein für Menschen mit Geschmack, wie auch der Les Voconces. Der stammte allerdings von 2003, und Martin rechnete es der Kooperative hoch an, dass sie die Weine nicht zu früh anbot. Die meisten Weine wurden zu jung verkauft, man überließ dem Kunden die Lagerung. So entging vielen, wie harmonisch ein gut gelagerter Wein wirklich sein konnte. Grenache, Syrah und Mourvèdre waren assembliert worden, so auch beim Les Saliens von 2003, einer dichten und würzigen Assemblage mit kräftiger Frucht und perfekt eingebundenem Tannin. Nichts kratzte, nichts störte, sie war glatt und geschmeidig am Gaumen, sie war reif und gleichzeitig saftig. Dieser Wein machte Lust auf ein gutes Essen, und Martin bekam Hunger.
Wohl der bemerkenswerteste, aber nicht der beste Wein war der Antique von 2001, die Trauben stammten von Rebstöcken, die zwischen fünfzig und hundertzwanzig Jahre alt waren. Der balsamische Duft kam Martin bereits über dem Glas entgegen: grandios für einen nicht einmal teuren Wein, und trotz seines Alters wirkte er lebhaft. Das waren Weine, die ihm gefielen, ganz anders als sein eher opulenter, warmer und eleganter Pechant. Die neuen Weine von Cave de Cairanne konnte der Patron mit bestem Gewissen wieder auf seine Weinkarte setzen.
Martin und Jacques hatten sich ihr Abendessen verdient, Bernard setzte sich dazu. Das Gespräch kam unweigerlich auf die Unterredung in Bordeaux. Martin hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen.
»Mir geht nicht der Auftrag gegen den Strich, aber ich hasse Geheimniskrämerei. Mit wem hat Coulange sich getroffen? Weshalb hat er ihn mir nicht vorgestellt, und es ärgert mich maßlos, dass sie so viel über mich wissen.«
Ein mitleidiges Lächeln war alles, was der Patron für Martins Bedenken übrig hatte. »Was weißt du, was der sonst noch für Geschäfte laufen hat? Machst du deine Geschäftspartner untereinander bekannt? Und dass sich Firmen die Leute genau ansehen, die für sie arbeiten – willst du ihnen das verdenken? Du machst es nicht anders . . .«
». .. aber ich kümmere mich nicht um anderer Leute Privatleben«, warf Martin ein und ärgerte sich, dass man ihn nicht verstand.
»Du bist kein Maßstab«, meinte Jacques, »die Standards setzen andere. Die Bank steckt das Spielfeld ab. Die weiß sowieso alles von dir, deine Krankenkasse auch, und das Finanzamt blickt besser durch als Charlotte.«
»Woher wissen sie von Gaston?«
»Hast du vergessen, was hier los war, damals?«, meinte der Patron. »Sogar mir haben die Journalisten die Bude eingerannt. Im Prozess ist deine Rolle ausführlich behandelt worden. Der war öffentlich, ja, zum Teil, und später kam noch der Prozess gegen den Korsen. Das war fast eine Staatsaffäre. Außerdem, mon ami, hatte Frankreich bereits unter Kardinal Richelieu einen funktionierenden Geheimdienst.«
»Ich dachte, dass nur Deutschland paranoide Innenminister hervorbringt.«
Jacques’ Mitleid ging in Unverständnis über. »Weißt du eigentlich, wo du lebst? Wir sind Atommacht! Frankreich ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Soll ich unsere Kriege aufzählen? Indochina und Algerien sind nur die bekanntesten, du kannst nur Krieg führen, wenn du deine interne Opposition kontrollierst. Und dann unsere Kolonien . . .«
»Eure Kolonien? Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, Jacques«, zischte Martin empört.
Der Patron schwieg weise, Martin wusste, dass er es verstand, jeden Streit abzubiegen, hier hatte es noch nie eine Schlägerei gegeben, obwohl die verrücktesten Typen aufkreuzten. »Da drüben« – der Patron wies auf einen untersetzten dunkelhaarigen Mann mit dunklen Schatten vom starken Bartwuchs im Gesicht–, »das ist ein Rumäne, soweit ich weiß. Er arbeitet seit einigen Jahren hier. Sprich mit ihm, der kann dir was sagen. Vielleicht hilft es dir. Hier, nimm die Flasche.« Der Patron drückte Martin den Les Voconces in die Hand und ein Glas. »Setz dich zu ihm, ich glaube, er ist in Ordnung.«
Der Rumäne hieß Grigore Constantinescu, war vor acht Jahren aus Rumänien abgehauen, wie er sagte, hatte sich zuerst als Landarbeiter und Erntehelfer durchgeschlagen und arbeitete inzwischen bei einer Firma für Landmaschinen als Monteur.
»Du willst nach Rumänien?«, fragte er unwirsch. »Weshalb? Was willst du da?«
Martin erklärte es ihm.
»Und soll ich gleich über Rumänien abkotzen oder erst später? Was willst du von mir hören? Dass da kein Mensch mehr den Unterschied zwischen Gut und Böse kennt? Dass alle die totale Gehirnwäsche hinter sich haben? Dass die ganze Kommunistenbande von damals noch immer an der Macht ist? Oder dass es Rumänien eigentlich gar nicht mehr gibt? Ein paar gute Weine gibt’s schon, nur die lohnen deine Reise nicht. Ihr habt viel schönere. Was glaubst du, weshalb ich abgehauen bin? Hier wird man auch als Arbeiter noch einigermaßen als Mensch behandelt. In Rumänien bist du ein Dreck, wenn du kein Geld hast. Aber wenn du unbedingt willst . . .« Grigore Constantinescu schrieb eine Adresse auf einen Zettel. »Hier, nimm. Das ist die Adresse von meinen Verwandten, wenn du mal Hilfe brauchst – und wenn du keine Angst vor armen Leuten hast.«
»Willst du nicht wieder zurück? Seit Rumänien in der Europäischen Union ist, hat sich viel geändert . . .«
»Wer hat das erzählt? Mir für zweihundert Euro im Monat den Arsch bei Nokia oder Dacia aufreißen? Nee, nie, nur über meine Leiche.«
Martin kehrte entgeistert zum Tresen zurück. Jacques sah ihm die Verwirrung an. »Was hat er gesagt?«
»Das mag man nicht wiederholen«, murmelte Martin kaum hörbar. »Dem muss irgendwas Schreckliches zugestoßen sein – das hat er bis heute nicht verdaut.«
3
Sie wirkte zierlich und zerbrechlich, was vom engen Schnitt und dem Dunkelgrau ihres Kostüms zusätzlich betont wurde. Ihre von langen Wimpern verschleierten schwarzen Augen erinnerten ihn an den traurigen Blick einer Heiligen auf einer Ikone. Andererseits war es erstaunlich, wie viel Energie in dieser zarten Person steckte. Zuerst, als Martin ihr Büro betreten hatte, war sie ihm einen Moment lang wie eine Art »Petra« vorgekommen. Das war ein Frauentyp, mit dem er seit der Episode mit seiner Petra, seiner Freundin vor Charlotte, überhaupt nicht mehr umgehen konnte: karriereorientiert, die Meinung anderer galt nichts, eine Frau, die den Wagenschlüssel ihres Audi-Kabrioletts als Zeichen des Erfolgs sichtbar auf den Restauranttisch legte.
Diese Frau ihm gegenüber hielt den Kopf stolz in den Nacken gelegt, wobei die Augen nicht weniger traurig wirkten, und schien so allwissend wie damals Petra, auch sie hatte einen ähnlichen Eindruck hervorrufen können. Aber bei Sofia waren es Wille und Entschiedenheit, die diese Wirkung erzielten, und auch ihre Art, sich unangenehme Zeitgenossen mit Sachlichkeit vom Leib zu halten.
Um sich an den komplizierten Nachnamen dieser Frau zu erinnern, musste er wieder auf ihre Visitenkarte schauen, die vor ihm lag. »Sofia RACHITEANU«. In der rechten oberen Ecke der Karte befand sich das Wappen Rumäniens – ein stilisierter Adler mit einem Schwert im Schnabel, oder sollte es ein Kreuz darstellen? Der Adler schien flügellahm und sein Schwert stumpf. Das war Martins Eindruck nach vier nervenaufreibenden Tagen in der Hauptstadt Bukarest. Es kam ihm nicht darauf an, Beweise für dieses Gefühl zu finden und das in seinen Bericht einfließen zu lassen, nein, das Gefühl war da, und damit war es gut. So wie er sich auf seinen Geschmackssinn verließ, auf Ahnungen, Mutmaßungen und Erfahrung, um einen guten Wein zu machen – und nicht auf chemische Analysen. Die waren zweifellos nötig, aber zweitrangig. Er fühlte sich nicht wohl, weder in dieser Stadt noch an diesem Ort, erst recht nicht in Sofias Büro und schon gar nicht in seiner Haut.
»Unter Ceauşescu ging es um nichts anderes als um die Erhöhung der Produktion – beim Stahl wie bei Weintrauben. Je höher der Ertrag pro Hektar war, desto besser. Wer sein Soll erfüllte, wurde belobigt, bekam mehr Geld, mehr Lebensmittel, Vergünstigungen eben.«
Sofia Rachiteanu betrachtete Martin mit einer Mischung aus Skepsis und Wohlwollen. Sie war die erste Person, bei der Letzteres überwog. Er meinte zu bemerkten, dass sie nicht wusste, was sie von ihm halten sollte, andererseits war sie ziemlich mitteilsam. Er trat als Wein-Consultant aus der Bankenstadt Frankfurt auf und als Wegbereiter für internationale Investitionen, und beides ging ihm gegen den Strich.
»Bei Stahl kam es auf die Qualität an«, setzte Sofia ihren Vortrag fort. »Er wurde ins Ausland geliefert. Beim Wein hat die Qualität niemanden interessiert, den mussten wir selbst trinken. Wir wussten gar nicht, was Qualität war, denn um das festzustellen, braucht man einen Vergleich, und wir hatten keinen, wir verglichen rumänische mit rumänischen Weinen. Es ist vielleicht auch unwichtig, was draußen geschieht, wichtig ist das eigene Land, aber hier gab es keinerlei Anreiz, einen besseren Wein zu machen, außer für die Bonzen. Es ging darum, mehr für sie zu produzieren und schneller, und natürlich auch kostengünstiger. Das ist heute bei den ausländischen Konzernen genauso. Wir sind eben Funktionäre, wir funktionieren und tun, was man uns sagt. Die Ungarn, die Tschechen und Polen, die haben revoltiert. Die Deutschen... na ja, bei einigem guten Willen wird eine kleine Revolution draus, lassen wir ihnen die Freude... Wie sehen Sie das, Monsieur Bongers?«
Es gefiel Martin, dass sie französisch miteinander sprachen.
»Wir hingegen, wir hatten nie die Zeit und auch nicht die Fantasie, darüber nachzudenken, was wir wollten«, fuhr sie fort, ohne seine Antwort abzuwarten. »Und heute? Alle Möglichkeiten sind vertan. Die Weichen sind gestellt, der Zug rollt, wieder haben andere entschieden... aber glauben Sie bitte nicht, dass wir alle so sind.«
Während dieser Sätze hatte sie nach unten geschaut, erst bei den letzten Worten hatte sie den Blick gehoben, ein wenig flehentlich, sich entschuldigend, sich zu den anderen zählend, sie hatte laut gedacht und schien erschrocken, dass sie etwas gesagt haben konnte, was sie nicht hätte sagen dürfen. Martin bemerkte, dass sich um Sofias Mund sofort harte Falten bildeten, wenn sie auf die Diktatur zu sprechen kam.
»Die Steigerung der Produktion und Planerfüllung, das waren die Ziele. Mehr, immer mehr, egal was. Es ging um Devisen, mit denen das Regime die Auslandsschulden bezahlen konnte, da war Ceauşescu gnadenlos. Die Pläne wurden nie erfüllt, nur über-erfüllt, und das wurde gefeiert, während wir hungerten. Wirklich, Sie brauchen gar nicht so ungläubig zu gucken. Ihre DDR war ein Paradies im Vergleich zu uns. Wissen Sie, was Hunger ist?«
Je länger Sofia sprach, desto mehr redete sie sich in Rage, der Anflug von Röte in ihrem Gesicht stand ihr gut. »Mir scheint, dass heute . . .«, jetzt sprach sie leiser, ihre Haltung änderte sich, sie neigte den Oberkörper weiter vor und schien über den Konferenztisch auf Martin zuzukriechen, ». .. dass heute die politischen Parolen ähnlich sind. Es werden hier im Hause so lächerliche Ziele formuliert: China und Russland sollen Absatzmärkte für unsere Weine werden. Welches sind denn die Visionen Ihrer Regierung in Deutschland? Sind es auch die großen Zahlen?«
Wovon sie in Berlin genau träumten, wusste Martin nicht zu sagen, und er zuckte ausweichend mit den Achseln. »Zurück zum Wachstum, was anderes fällt Ihnen nicht ein, Privatisieren, das Staatseigentum wird an die Konzerne verteilt. Globalisierung, das ist auch so ein Wort, das Volk hilft den Banken und ähnlicher Unsinn.« Sicher träumten sie davon, wenn Politiker zum Träumen in der Lage waren, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden und von der Pension oder Abfindung. »Models heiraten reiche Schauspieler, um sich später mit der Hälfte des Vermögens davonzumachen, und Manager steigen ein, nur um sich später teuer von ihren Firmen zu verabschieden. Politiker sind da nicht anders.«
Das war auch bei den Franzosen der Fall, bei denen kam noch eine gehörige Portion Eitelkeit dazu – allen voran ihr kleingewachsener Präsident. Aber Martin hütete sich, mehr zu sagen. Es fiel ihm in solchen Situationen besonders schwer, seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Er hatte nie eine falsche oder halb wahre Identität annehmen müssen, es hatte sich nicht ergeben. Genauso wenig wie er niemals in die Verlegenheit gekommen war, Schmiergeld anzunehmen oder jemanden bestechen zu müssen. Er hatte sich zwar dumm gestellt, hatte sich als Experte ausgegeben, er und Gaston hatten ein paar kleine Verkäufe an der Steuer vorbei getätigt, aber das waren Lappalien im Vergleich zu seiner momentanen Lage. Jetzt so zu tun, als käme er geradewegs aus Deutschland und würde dort als Weinbauberater oder Consultant, was bedeutender klang, tätig sein, fiel ihm dieser Frau gegenüber schwer. Charlotte hatte gelacht, als er ihr von Coulanges Bedingung berichtet hatte. »Stell dich nicht so an, das lernst du spielend.«
Er wusste nicht, wie sie es gemeint hatte, zumal sie das Du betont hatte. Was wusste sie von ihm, was er selbst nicht sah? Er hatte sich im Stillen geärgert, Charlotte hatte gut lachen – nach ihren Erfahrungen in der Politik, wo Verstellung und Lüge zur Grundausbildung gehörten. Unter Diplomatie verstand er etwas anderes, aber er hatte das nicht gelernt, und es war nie sein Wunsch gewesen, in dieser Disziplin eine Medaille zu gewinnen. Er dachte an Charlotte, sie fehlte ihm, und er bemerkte, dass Sofia bemerkt hatte, dass er mit seinen Gedanken woanders war.
». .. werden Produktionsmengen angepeilt von fünfzehnbis zwanzigtausend Kilo je Hektar. Sie wissen, was das bedeutet?«
Ja, das wusste Martin nur zu gut, er war rasch wieder beim Thema. Das waren Mengen, mit denen die deutschen Winzer ihren guten Ruf verdorben hatten. Er selbst produzierte extrem wenig, auf einem Hektar höchstens viertausend Kilo, das war weniger als ein halbes Kilo pro Rebstock. Wenn die Zielsetzung Masse vor Klasse gewesen war, dann konnte ein Investor, der Qualität erzeugen wollte, hier durchaus was werden – wenn denn solche Weine jetzt gefragt waren, woran Martin inzwischen zweifelte.
»Unser ehemaliger Minister war vom Fach«, sagte Sofia. Die Betonung, die auf »ehemalig« lag, zeigte deutlich, dass der Neue nicht ihre Zustimmung fand. »Er war Agrarexperte. Das ist bei Politikern selten, dass sie was von der Materie verstehen. Unser Land wird heute von Netzwerken aus Verbrechern, Hochstaplern und Spekulanten regiert. Es hat keine moralische oder demokratische Reform gegeben. Hier haben sich die alten Machthaber mit den internationalen Konzernen verbündet. Und genauso würde es in der alten DDR aussehen, wenn es die BRD nicht geben würde. Glücklicherweise gibt es die Europäische Union, und die bestimmt immer durchgreifender die Regeln. Und vielleicht wurden gerade deshalb siebenunddreißig Millionen Euro an Agrarkrediten für neue Projekte gestrichen. Sogar Brüssel weiß nicht mehr, wo das Geld versickert, wer es bekommt oder verschwinden lässt. Kurzfristig verlieren wir dadurch, unser Volk versteht die neuen Regeln nicht, aber langfristig könnten wir profitieren. Das ist zumindest die offizielle Lesart«, schob sie leise nach, und Martin merkte, wie wenig sie mit dem Gesagten einverstanden war. »Aber in der Praxis unterläuft die Regierung die neuen Regeln. Wozu ist man schließlich an der Regierung, wenn man nichts davon hat? Uns stehen jährlich 42Millionen Euro zur Verfügung. Am wichtigsten wäre die Neuanlage der Weinberge, denn die alten sind so runtergekommen, dass wir sie roden müssen. Wir hingegen verwenden das Geld für Versicherungen – gegen Hagel, gegen Schädlinge und so weiter. Da freuen sich die Versicherungen. Die Subventionen dienen auch zur Herstellung von konzentriertem Traubenmost, ein zukünftiges Exportprodukt, mit dem im südlichen Europa die Weine verbessert werden. Da freuen sich die Großkellereien. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken, ich sehe es Ihnen an . . .«
Martin hatte unwillkürlich die Stirn gerunzelt, er kannte die Methode der Chaptalisierung. Seit Napoleons Innenminister Chaptal wurde sogar in Bordeaux Zucker in den Most gegeben, um bei der Gärung einen höheren Alkoholgehalt zu erzielen. Neuerdings wurde Zucker durch geschmacksneutrales Mostkonzentrat ersetzt.
»Da zeigt sich der ganze Irrsinn der europäischen Weinbaupolitik«, seufzte Sofia. »Eigentlich unverkäuflicher Wein wird zu Most verarbeitet, um unverkäuflichen Wein zu verkaufen.«
»Die Menschheit ruiniert ihre Ressourcen«, murmelte Martin vor sich hin, und Sofia stimmte ihm zu.
»Wie beim Klima. Daran denkt bei uns leider niemand. Genauso wenig wie an Umweltschutz. Wenn Sie allerdings einem Großen auf die Füße treten, legt eine Behörde Ihren Betrieb still, weil Sie angeblich gegen eine EU-Norm verstoßen! Die finden immer was, wie das Finanzamt, und zack, ist Ihr Betreib pleite und wird aufgekauft... außer Sie zahlen . . .«
In diesem Augenblick öffnete sich die gepolsterte Bürotür. Eine gut aussehende Sekretärin mit auffälligem Dekolleté trat ein, grüßte kurz und sagte etwas auf Rumänisch. Martin verstand nichts, begriff noch nicht einmal den Sinn der Worte, ihren Ton hingegen empfand er als barsch und unfreundlich. Sofia antwortete in der gleichen ruppigen Weise. Sie wies auf ihn und wurde ungehalten, also hatte die Störung etwas mit ihm zu tun. Die Sekretärin ließ sich nicht beirren, insistierte weiter, bis Sofia verärgert aufstand und sich bei Martin für einen Moment entschuldigte. Ihr Chef wünsche sie zu sehen – sofort, tout de suite, wie sie in ihrem kehligen Französisch sagte.
Sie stand auf, strich unter dem herablassenden Blick der Sekretärin ihren Hosenanzug glatt, lächelte Martin entschuldigend an und folgte der Frau, die ihn abschätzig musterte, bevor sie leise die Tür schloss.
Martin sah, dass die gläserne Kaffeekanne fast leer war, er goss sich den kalten Rest ein, mehr Satz als Kaffee, nahm einen Schluck und blätterte in seinen Notizen. Er war dankbar für die Pause. So konnte er seine Aufzeichnungen durchsehen und prüfen, ob die wichtigsten Fragen beantwortet waren. Aber die Erinnerung an die Szene von eben lenkte ihn ab, und er starrte die unansehnlichen Wände an, betrachtete den billigen Kalender neben dem Fenster zum Lichtschacht und hatte den Eindruck, dass die abgeschabten Büromöbel, an denen sich das Furnier löste, aus den Zeiten der kommunistischen Diktatur stammten. Ein neuer Anstrich hätte dem Büro gutgetan, man hätte Kabel unter Putz legen können... Auf Sofias Schreibtisch türmte sich Arbeit, zumindest vermittelten die Papierstapel auf beiden Seiten ihres Laptops diesen Eindruck – oder sie sollten es tun. Es war kaum möglich, hinter die Dinge zu schauen.
Die ersten Tage in Bukarest hatte er damit verbracht, Kontakte aufzubauen, die im weitesten Sinne mit Wirtschaft, Wein und Investitionen zu tun hatten. Von offizieller Seite war das Misstrauen groß, und ihm wurde wenig Interesse entgegengebracht. Anders war es bei den Weingütern. Hier spürte er ein gewisses Entgegenkommen, eine Art von Neugier und etwas, das er als innere Verbundenheit mit Gleichgesinnten bezeichnen würde. Alles bewegte sich zwar noch auf der Ebene einer vorsichtigen Kontaktaufnahme, aber einige seiner Gesprächspartner schienen international Erfahrungen gesammelt zu haben.
Ganz anders ging es auf der wirtschaftlichen und politischen Seite zu, auch wenn es gar nicht um Politik ging, sondern um Technik und Finanzen. Oder kam er zu dieser irrigen Annahme, weil er sich darüber Gedanken machte, ob sein Gegenüber ihm die Rolle abnahm, die er spielte? Sah man ihm den Spion an, und wieso hatte er das Gefühl, einer zu sein? Er tat nichts Verbotenes. Trotzdem glaubte er, dass man ihm seine Unsicherheit ansah, dass man ihn deshalb geradezu belauerte. Ihm schien es, als würde vieles vorsichtshalber nicht aus- oder angesprochen. Er hatte sich sogar auf der Straße umgedreht, weil er meinte, verfolgt zu werden. Ob sie sich im Ministerium die Mühe machten, ihn zu überprüfen? Unter der auf seiner Visitenkarte angegebenen Telefonnummer meldete sich sogar eine Dame, die Deutsch sprach (er hatte es ausprobiert, um sicherzugehen), dafür hatten Coulange und seine SISA gesorgt, sogar eine Homepage hatten sie ihm gebastelt.
In diesem undurchschaubaren Geflecht von Beziehungen, Abhängigkeiten und hintergründigen Interessen war Sofia ein Lichtblick, die erste Person, bei der er glaubte, dass sie ihm bereitwillig Auskunft gab. Ihr gegenüber musste er sich nicht für jede Frage entschuldigen und sie begründen. Seinen Fragen wurden nicht mit Gegenfragen gekontert. Sofia erzählte von sich aus, sie zeigte ein so ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis, dass er sich sogar vorsichtig zurückhielt. Aber Sofia war auch verbittert, und das machte das Gespräch mit ihr nicht einfach.
»Ihr in Deutschland«, hatte sie immer wieder gesagt oder: »Bei euch in Deutschland . . .«
Dann folgte, was dort alles anders und besser sein sollte und was ihrer Ansicht nach hervorragend funktionierte. Zwischendurch beklagte sie den Schlendrian im Ministerium und das mangelnde Interesse an der Arbeit. Sie erging sich in Andeutungen über Korruption und den Ausverkauf nationalen Eigentums, ohne jedoch konkret zu werden. Sie bemängelte die fehlende Kompetenz der Kollegen und ihren Widerstand gegen jede Modernisierung, von mangelnder Solidarität ganz zu schweigen.
»Die haben sie uns im Sozialismus aberzogen, so absurd das klingt. Das war die beste Vorbereitung für die Übergabe unseres Landes an den Kapitalismus und die Konzerne!«
Ihre politischen Geständnisse waren Martin unangenehm, er fühlte sich in eine Art Mitwisserschaft hineingezogen. Ob es der Wahrheit entsprach oder eine politisch gefärbte Interpretation war, konnte er nicht beurteilen. Sofia machte einen ehrlichen Eindruck, ehrlich verzweifelt, ehrlich verbissen und verzweifelt bemüht...
Die Türklinke bewegte sich langsam, zaghaft wurde die Tür aufgeschoben, unschlüssig stand Sofia im Türrahmen, blass, viel blasser als vorher, die Falten hatten sich tiefer eingegraben, der Mund war verkniffen, als würde sie die Zähne zusammenbeißen. Martin sah ihr an, wie sie sich bemühte, ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu bringen. Die Frau schien vor Wut fast zu explodieren. Sofia lächelte.
»Mein Chef, Herr Tudor Dragos, möchte Sie unbedingt kennenlernen«, sagte sie, nachdem sie sich geräuspert hatte. »Er ist an deutschen Experten wie Ihnen äußerst interessiert. Er sieht die Zusammenarbeit innerhalb der Länder der Europäischen Union als sehr wichtig für die Entwicklung des rumänischen Weinbaus an. Ihre Investitionen sind uns immer willkommen«, fügte sie wie auswendig gelernt hinzu. Dann setzte sie sich. »Wir beenden dieses Gespräch jetzt – leider, ich bin kurzfristig für andere wichtigere Aufgaben abgezogen worden . . .« Und während sie nichtssagende Entschuldigungsfloskeln murmelte, griff sie nach einem Blatt Papier.
»Wir unterhalten uns ein andermal weiter«, schrieb sie und sah sich um, ». .. wo die Wände keine Ohren haben.« Dann folgten eine Adresse und eine Uhrzeit. Zustimmung heischend schaute sie Martin an, bis er nickte, und sie bedeutete ihm, den Zettel einzustecken.
4
Aufatmend trat Martin vor die Tür des Ministeriums. Er war heilfroh, das Gebäude hinter sich zu lassen. Er durfte sich um Himmels willen nicht in Auseinandersetzungen zwischen Sofia und ihrem Chef hineinziehen lassen. Was Charlotte ihm von ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin in Paris berichtet hatte, ließ Schlimmes befürchten. Da wurde nicht nur an Stühlen gesägt, da wurden Dokumente zurückgehalten, Falschinformationen ausgestreut, Kollegen denunziert, der Presse heimliche Winke gegeben und Fallen aufgestellt – und auch Telefonate abgehört. Immer wieder tauchten Meldungen auf, wonach sogar Minister ausspioniert worden waren. Aber fest installierte Mikrofone in den Büros? Sicher war deshalb die Nachfrage nach abhörsicheren Räumen so groß. »Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand.« Den blöden Spruch seiner Mutter hatte er in Erinnerung, sie hatte es gesagt, als sie ihn erwischte, wie er an der Wohnzimmertür gelauscht hatte. Es war allerdings richtig gewesen mitzuhören, denn nur so hatte er seine Abschiebung ins Internat verhindern können.
Die Frau in der Uniform des Wachpersonals des Ministeriums lächelte Martin zu, als sie die Tür für ihn öffnete. Er hätte diese Frau um die vierzig eher in der Fertigungshalle für Leuchtstoffröhren oder am Steuer eines Traktors erwartet, aber nicht als Wachpersonal. Was ihn zu diesem Vergleich brachte? In Gedanken zuckte er mit den Achseln. Sie war Arbeiterin, etwas fehlte ihr, er wusste es nicht genau, jedenfalls gehörte die Frau nicht hierher und nicht in die beige-weinrote Uniform mit Krawatte, nicht hinter den winzigen Schreibtisch, Ausweise kontrollierend und den Summer für den Mitarbeitereingang betätigend. Er betrachtete ihre Hand, als sie auf den Summer drückte. Diese Hand konnte zupacken, es war die einer Landarbeiterin, wie er sie aus Bordeaux kannte. Da war wieder das Gefühl, das ihn seit der Landung in Bukarest zwischen dem IKEA-Mast und dem ostzonenblau gestrichenen Flughafengebäude mit NATO-Draht auf dem Dach begleitete, dass die Dinge nicht zusammenpassten. Das Gefühl verstärkte sich.
Kurz vor dem hohen schmiedeeisernen Zaun blieb Martin stehen und sah zu den hohen Fenstern der Fassade des Ministeriums hinauf. Ob man auch ihn beobachtete? Sofias Hinweis war eindeutig, sie waren abgehört worden. Ihr Chef misstraute seinen Mitarbeitern, und wie es den Anschein hatte, nicht grundlos. Sofia hatte sich keinesfalls im Sinne der offiziellen Politik geäußert. Während er das Bauwerk im habsburgischen Stil des Fin de Siècle musterte, aus der Blütezeit dieser Stadt um 1900, versuchte er, sich an den Geruch des Gebäudes zu erinnern. Es hatte nach Desinfektionsmitteln, durchgetretenen Teppichen und Staub gerochen, nach alter Farbe und nach unausgesprochenen Worten. Der Gedanke schien ihm absurd, Worte besaßen schließlich keinen Geruch, und doch hatte er heute zum ersten Mal den Eindruck, dass es so war. Verstaubte Worte, lange nicht hervorgeholt, in alten Kisten oder Kartons aufbewahrt, wie die Fotos, die er auf dem Dachboden der Großeltern entdeckt hatte. In einem Raum hinter den blinden Scheiben im Souterrain vermutete er die mitlaufenden Tonbänder, viele nebeneinander, ihre Spulen drehten sich, wie sie es in Paris und Berlin taten, dort längst elektronisch. In diesen Kellerräumen hatten sie zu Zeiten der Diktatur gestanden, während der Wende hatte man sie sicherheitshalber weiterlaufen lassen, und auch nach dem Neuanfang (von was eigentlich?) waren sie allem Anschein nach nicht abgestellt worden. Unsinn, dachte er und sah die rumänische Flagge und die der Europäischen Union schlaff neben der NATO-Flagge in der Nachmittagshitze über dem Haupteingang hängen. Nein, keineswegs Unsinn, und er suchte nach Kameras. Eine war direkt auf ihn gerichtet... oder auf die Menschenmenge draußen, vor dem Zaun?
Polizeiwagen blockierten die Straße, Uniformierte den Gehweg, winkten Passanten durch und diskutierten mit den Demonstranten, viele in blauer Arbeitsmontur. Martin blieb hinter dem Zaun und vergewisserte sich, dass er nicht unversehens in ein Handgemenge geriet. Als er die Kamera zur Hand nahm, um ein Foto zu machen, schoss ein Wächter mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. Martin ließ sich nicht beirren, machte das Foto und fuhr den Wächter barsch auf Englisch an:
»Ich war eben beim Minister und mache nur ein Foto vom Gebäude.« Ton und Haltung ließen den Wächter zurückweichen. Martin hatte es nach wenigen Tagen begriffen: Auf hartes, rüdes Verhalten wurde reagiert. War das immer noch auf die Diktatur zurückzuführen? Da musste sich nach zwanzig Jahren doch was geändert haben.
Gegen wen oder wozu die Demonstranten sich versammelt hatten, blieb ihm verborgen, die Transparente waren für ihn unverständlich. Er könnte Sofia fragen, wenn sie sich an jenem Ort träfen, ». .. wo die Wände keine Ohren haben«. Er ging weiter und starrte hilflos auf den Verkehr, der aus allen vier Himmelsrichtungen kam und sich auf der Piat¸a Universităt¸ii zusammenballte. Die Fahrzeuge hatten sich ineinander verkeilt, BMWs kämpften zäh um jeden Millimeter, Mercedes-Geländewagen verbanden sich mit Dritte- und Vierte-Hand-Toyotas und -Renaults zu einem Blechbrei, während der Strom der von außen dazustoßenden Audis, riesigen schwarzen Hondas, abgeschabten Citroëns und Wartburgs oder fabrikneuen Tuaregs weiter anschwoll. Und selbst als er mit Charlotte kürzlich im Osten Berlins gewesen war, hatte er nicht so viele Trabants gesehen wie hier. Martin fragte sich, wann diese Leute in den hypermodernen oder schrottreifen Fahrzeugen aus diesem Gemenge entkommen und ihre Ziele erreichen würden. Nur seltsam, dass all diese Autos verschwunden waren, wenn er in aller Frühe vom Hotel aus zum nahen Park lief, um seine Runden zu drehen. Ihm grauste vor dem Gedanken, sich in drei Tagen selbst mit einem Leihwagen in dieses Chaos stürzen zu müssen.
Die Zugänge zur Metro unter dem Platz dienten gleichzeitig als Unterführung, und Martin stolperte über Betonbrocken ins Halbdunkel einer von Vorschlaghämmern und Staub erfüllten Luft. Zwischen Schutthaufen und aus den Wänden ragenden Muniereisen fühlte er sich in die Bunker des bretonischen Atlantikwalls versetzt. Die Menschen strömten hektisch herein, als müssten sie sich vor der Klimakatastrophe in Sicherheit bringen, und flossen als breiter Schwall weiter nach unten in die Metroschächte ab. Martin bewegte sich mehr wie in der Endzeitstimmung billiger Actionfilme als durch die Phase des rumänischen Aufbruchs in die strahlende Zukunft des vereinten Europa. Erleichtert kehrte er über eine halb zerstörte Treppe ins Tageslicht zurück, nur um weiter am Strom der Autos entlangzuhasten. Da stieß er mit dem Fuß gegen ein aus dem Boden ragendes Rohr und hielt sich gerade noch an einem Passanten fest, der entsetzt zurückwich. Er überquerte die Straße, betrat eine Wechselstube, tauschte zweihundert Euro gegen siebenhundertdreißig Lei ein, die er allerdings erst ausgehändigt bekam, nachdem er seinen Ausweis vorgelegt hatte. Irgendwo hatte er gehört, dass Wechselstuben zur Kette der Geldwaschanlagen gehörten. Wie funktionierte das, wenn man seinen Ausweis vorlegen musste?
Die Stände für gebrauchte Bücher vor dem Universitätsgebäude