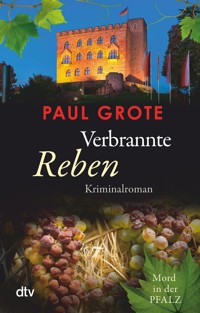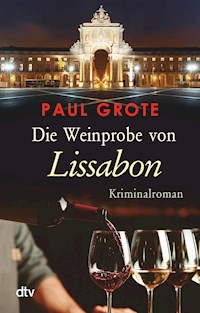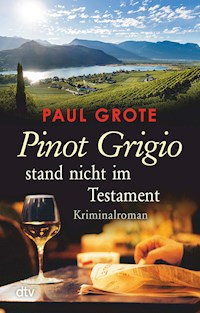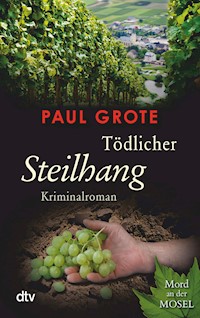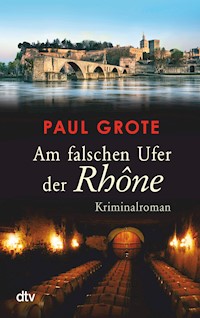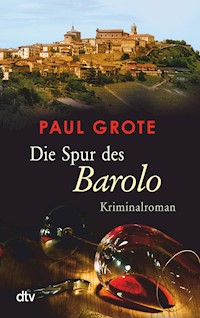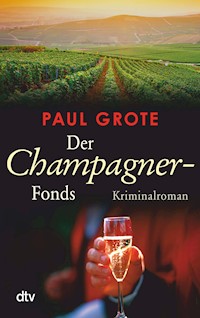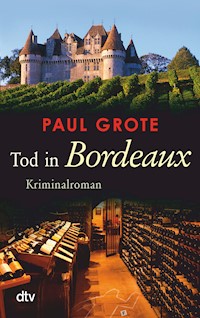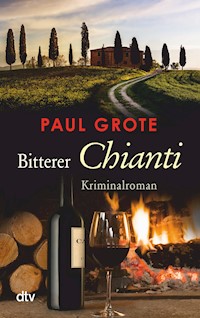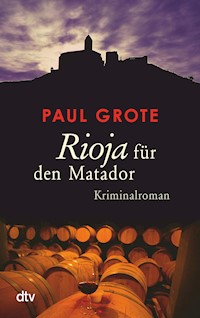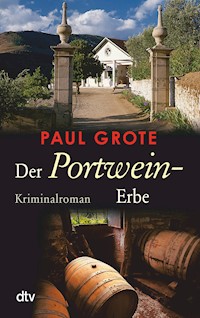
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Erbe Der Tod seines Onkels bring den Berliner Architekten Nicolas Hollmann in Bedrängnis: Weshalb vererbt er gerade ihm sein Weingut am Rio Douro? Soll er seinen Beruf aufgeben und das Erbe annehmen? Wie gefährlich die Reise nach Portugal wird, ahnt er nicht. Kaum auf dem Weingut, hat Nicolas den ersten Unfall. Die Weggefährten des Onkels tauchen ab, unversöhnlich seine Mitarbeiter, und nach dem zweiten Unfall fragt sich der junge Architekt, woran der Onkel wirklich starb ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Paul Grote
Der Portwein-Erbe
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Bernhard
Die einzige eines höheren Menschen würdige Einstellung ist das beharrliche Festhalten an einer Tätigkeit, die er als nutzlos erkennt, das Unterwerfen unter eine Disziplin, von der er weiß, dass sie fruchtlos ist, und das rigorose Anwenden philosophischer und metaphysischer Denknormen, deren Bedeutungslosigkeit er erkannt hat.
Fernando Pessoa
1.Der Brief
Wenn Nicolas Hollmann an jenem ungewöhnlich heißen Apriltag gewusst hätte, dass es Menschen gab, die eine Treppe ansägen würden, um ihn davon abzuhalten, ein Weingut zu besichtigen – er hätte den Brief des Rechtsanwalts, der mit den beiden anderen zusammen im Kasten lag, als er nach Hause kam, nicht geöffnet. Aber er hatte nicht die geringste Ahnung, welche Katastrophen in diesem Zusammenhang noch auf ihn zukommen sollten.
Hätte er sich überhaupt anders verhalten können, hätte er den neutral wirkenden Brief ignorieren, ihn wegwerfen oder besser noch, vorher zerreißen, in den Abfalleimer werfen sollen mit den vergammelten Salatblättern obendrauf, damit er ja nicht in Versuchung geriet, doch irgendwann nachzusehen, was eigentlich drin gestanden hatte? Das fragte er sich später, als er in schlaflosen Nächten daran zweifelte, ob seine Entscheidung richtig gewesen war. Doch was entschied man schon im Leben? Alles wurde entschieden oder entschied sich, Freiheit war eine Fiktion, pure Einbildung. So einfach war das. Nein, er hätte den Brief öffnen müssen, besonders bei einem Absender wie diesem: Rechtsanwalt Hassellbrinck, Bleibtreustraße.
Theoretisch wäre es möglich gewesen, den Brief zu ignorieren. Aber bei Post von Anwälten oder Behörden stellte sich immer ein ungutes Gefühl ein, es könnte sich um eine Schuld, eine Verfehlung, ein bevorstehendes Gerichtsverfahren handeln, langwierig und mit Ausgaben verbunden. Vielleicht hatte jemand ein Mahnverfahren gegen ihn angestrengt, weil er eine Rechnung übersehen hatte? Das schlechte Gewissen lauerte immer darauf, sich hervorzutun, genährt von Staat, Eltern, Chefs und Sylvia. Etwas Gutes konnte der Umschlag nicht enthalten.
Im Hausflur am Briefkasten hatte er den Brief stirnrunzelnd angestarrt, ein schlichter, weißer, länglicher Umschlag. Beim Hinaufgehen in seine Wohnung hatte er sich gefragt, was dieser Anwalt wohl von ihm wollte. Der Weg in den fünften Stock war lang, da ging einem eine Menge durch den Kopf, besonders an einem so heißen Tag wie diesem. Vielleicht die Kündigung der Wohnung? Die vorzeitige Kündigung seines ohnehin befristeten Arbeitsvertrages als technischer Zeichner? Eine Festanstellung war nicht drin gewesen – man hatte es als Gnade hingestellt, dass er für einen berühmten Architekten arbeiten durfte.
Oben angekommen wischte Nicolas sich den Schweiß von der Stirn; als er die Wohnungstür aufschloss, quoll ihm die stickige Wärme seiner Dachwohnung entgegen. So heiß war es in Berlin sonst nur im Hochsommer – aber in diesem Jahr war nichts wie sonst.
Die Tragetasche mit dem neuen Zeichenblock und den weichen Bleistiften ließ er an der Garderobe stehen, hängte die viel zu warme Jacke auf – dann folgte der Blick durch die Wohnung. Was hätte jetzt, am späten Nachmittag, anders sein können als am Morgen, als er gegangen war? Er betrat die Küche, warf die Post auf den Küchentisch. Der Brief vom Anwalt landete mit der Anschrift nach oben, was Nicolas als Aufforderung verstand, ihn sofort zu öffnen. Neugier und Skepsis wechselten sich ab, er schob die Entscheidung noch hinaus. Hoffentlich verdarb ihm die Nachricht nicht den Abend, nachdem der Tag schon nicht besonders gewesen war. Er füllte ein Glas zur Hälfte mit Leitungswasser, gab zwei Löffel Nescafé hinein, der etwas klumpte, und goss die Mischung mit kalter Milch auf. Zwei Stückchen Eis brachten die nötige Frische, und die Milch verlor das Schleimige.
Er sah sich nach seinem Brieföffner um; Couverts mit dem Finger aufzureißen, empfand er als stillos. Leider waren Brieföffner aus Elfenbein, aus Metall oder Holz, im jahrzehntelangen Gebrauch patiniert, längst aus der Mode, ein Finger tat es schließlich auch. Technisch gesehen hätte es die Zinke einer Gabel sein können, der Dorn zum Spicken des Bratens aus der Küchenschublade, aber Nicolas legte Wert auf Rituale, wie zum Beispiel das Öffnen seiner Post mit der Nachbildung eines Schwertes von Karl V., kaum länger als eine Handspanne. Er bewahrte es in der Schublade unter seinem Zeichentisch auf. Er hatte es als Schüler auf einer seiner Tramptouren auf einem Flohmarkt in Südfrankreich erstanden, der reine Plunder, aber er liebte es. Als er nach dem Abitur ein Jahr lang in Südamerika unterwegs gewesen war, hatte es allerdings in Frankfurt in einem Umzugskarton gewartet, war dann zum Studium mit nach Berlin gekommen und hatte nach dem Examen, das er als einer der Jüngsten bestanden hatte, auch den Umzug nach Holland mitgemacht. Jetzt wieder in Berlin wartete es auf Briefe, die hoffentlich wichtiger waren als Benachrichtigungen der Krankenkasse, Telefonrechnungen oder Angebote irgendeiner Bank mit 5000 Euro Sofortkredit, die Nicolas allerdings gut hätte gebrauchen können.
Er wusste nicht, dass dieser Brief zu den wichtigsten gehörte, ja vielleicht war es sogar der wichtigste, den er jemals erhalten hatte, und doch ahnte er etwas. Dieser Brief war anders, und er schob das Öffnen vor sich her. Der Umschlag, wahrscheinlich mit nicht mehr als einem einzelnen Blatt darin, wog schwer. Nicolas schob das Schwert unter die Lasche, die scharfe Schneide fuhr mit einem feinen Laut durchs Papier. Es befand sich tatsächlich nur ein Blatt im Umschlag, er zog es heraus, legte es auf den Küchentisch und strich es glatt.
Sehr geehrter Herr Hollmann,
wir möchten Sie bitten, sich möglichst bald mit uns in Verbindung zu setzen. Unser Korrespondenzanwalt in Porto/Portugal, Dr. Dr. Pereira, teilte uns mit, dass Sie im Testament Ihres Onkels, Herrn Friedrich Ernst Hollmann, der am 18. April leider verstorben ist, als Erbe genannt sind. Bitte rufen Sie uns an, damit wir bei einem persönlichen Gespräch das weitere Vorgehen klären.
Mit freundlichen Grüßen …
Es folgte die unleserliche Unterschrift einer Mitarbeiterin der Kanzlei – und für Nicolas der Schock. Er ließ die Hand mit dem Brief auf die Tischplatte sinken und starrte aufs Papier.
Friedrich war tot? Dieser kräftige, lebenslustige und fast 1,90 Meter große Mann sollte nicht mehr leben? Unmöglich, so jemand starb nicht. Er war gar nicht alt, Jahrgang 1947. Unvorstellbar. Nicolas sah ihn vor sich, ganz deutlich, seinem Vater ein wenig ähnlich, aber feiner, ohne das eckige Durchsetzerkinn, aber doch entschieden und dabei auch ziemlich feinsinnig. Nicolas hatte ihn vier oder fünf Mal zu Gesicht bekommen hatte, trotzdem war er immer präsent gewesen. Die Familie hatte über ihn gesprochen, selten mit guten Worten. Er musste sie ziemlich geärgert oder geängstigt haben, und Nicolas huschte ein Lächeln übers Gesicht. Sprachen sie nicht auch von ihm längst in ähnlicher Weise im abfälligsten Ton, nannten ihn aus der Art geschlagen, einen Spinner und Weltverbesserer – als ob die Welt nicht dringend eine Verbesserung nötig hätte …
Friedrich hatte nie getan, was man von ihm verlangt hatte, sich nie konform verhalten. Er war ein Totalverweigerer. Bei Nicolas selbst zeichnete sich eine ähnliche Entwicklung ab, aber anders als bei Friedrich hatte die Familie bei ihm die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er sein Erbe antreten würde, zumindest seine Mutter nicht, die sicher an einem dieser schwülheißen Frankfurter Frühlingstage an ihren unausgesprochenen Vorwürfen ersticken würde. Egal was er tat, sie empfand es als gegen sich gerichtet, als Schande oder Provokation. Sie hatte sich nie entscheiden können, für nichts richtig, hatte mit der Ehe gehadert, danach mit der Scheidung von seinem Vater, mit seiner herrischen Art, mit dem Vermögen, mit ihrem ehemaligen Schwager und dem neuen Ehemann.
Vor zehn Jahren hatte sie wieder geheiratet, diesen Fritzen vom Baudezernat – wo der seine Finger überall drin hatte –, und Nicolas hatte sich aus dem Staub gemacht, um Friedrich in Portugal zu besuchen. Knapp zwanzig war er damals gewesen und hatte drei Wochen bei ihm auf seinem Weingut am Rio Douro rumgelungert. Es war eine großartige Zeit gewesen. Bilder tauchten auf, ein Fluss, eingerahmt von hohen Bergen, grün-blaues Wasser, Ansammlungen von Häusern an den Berghängen. Er erinnerte sich an einen leicht moderigen Geruch, wie ein Teich mit Entengrütze … dabei war es ein Fluss, ein aufgestauter … das Geräusch von Booten und die große Hitze. Und jeden Tag hatten er und Friedrich Wein getrunken.
Tot? Friedrich tot? So eine Scheiße. Wieso erfahre ich das erst jetzt?, fragte er sich wütend, wieso sagt es mir keiner, auch wenn es der Bruder meines Vaters gewesen ist, mit dem ich seit Jahren zerstritten bin, genau wie Friedrich es war? Zumindest gehörte er zur Familie, mochte sie auch so zerrissen und kaputt sein wie die seine. Das Geld, gemeinsame Geschäfte und Teilhaberschaften hielten die Leute noch einigermaßen zusammen, das war der Klebstoff. Aber Friedrich war draußen gewesen, finanziell, soweit er wusste. Woran mochte er gestorben sein? Nie war die Rede von Krankheit oder einem Leiden gewesen, nichts, was Nicolas gewusst hätte, oder hatte man ihm etwas verheimlicht? Man hatte es damals sowieso für falsch gehalten, dass er ihn besucht hatte – wegen des schlechten Einflusses. Dabei fand er den Typ großartig, der einzige Erwachsene, mit dem er damals vernünftig hatte reden können. Ob der Anwalt wusste, woran er gestorben war?
Nicolas nahm den Brief erneut zur Hand: »am 18. April verstorben«. Kein Wort über die Umstände. Seinen Vater würde er niemals danach fragen, um sich das Lamento zu ersparen, dass er nicht in die Firma eintrat, die Frage, ob er sich endlich die Hörner abgestoßen habe, schließlich sei er der Erbe, man könne seiner Bestimmung nicht ausweichen und müsse wissen, was man wolle. Mit dreißig sei die Zeit der Spielerei vorbei, er hätte damals bereits … – und der ganze Scheiß von wegen seiner primitiven Existenz. Arme Leute zu imitieren, rieche nur muffig. Nicolas wusste nicht, was sein Vater in Wirklichkeit von ihm wollte. Er nahm an, dass er produziert worden war, um einen Erben abzugeben oder die linke Hand des Konzernchefs zu werden, damit der anderswo mit seinem Sohn angeben konnte. »Du kommst hoffentlich nicht nach meinem Bruder.« Wenn er sich den Vater hätte aussuchen können, hätte er Friedrich genommen. Doch nun war er tot – und Kinder hatte er nicht …
Nicolas überlegte, wen von seiner Mischpoke er anrufen und fragen könnte, wer mehr wusste. Er sollte sich gleich mit dem Anwalt in Verbindung setzen, der würde auf jeden Fall mehr wissen. Seine Telefonnummer stand auf dem Briefkopf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich leider nur eine freundliche Telefonstimme, die Bürozeiten ansagte. Er würde sich bis zum nächsten Tag gedulden müssen.
Sein Vater würde bestimmt mehr über die näheren Todesumstände wissen, aber ihn anrufen? Sich dumme Sprüche anhören? »Hast du dich endlich entschieden, hier deinen Schreibtisch zu besetzen, oder besetzt du Häuser?« Es war das Schlimmste für den Vater, dass er es als Nachfolger eines der großen Bauunternehmer hatte hinnehmen müssen, dass sein Bruder in den Siebzigerjahren in Frankfurt Häuser besetzt und sich auf der Straße mit der Polizei geprügelt hatte. Wie auch Nicolas' Großvater war er nie darüber hinweggekommen. Für sie war es Klassenverrat gewesen. »Hast du noch immer nicht kapiert, wo du hingehörst?«, war ein anderes Lieblingszitat seines Vaters. Nein, ich habe es noch immer nicht begriffen, dachte Nicolas, das Richtige hat sich nicht gezeigt – oder habe ich nicht hingeschaut? Aber wieder nach Frankfurt, um in den Konzern seines Vaters einzutreten? Weder tot noch lebendig. Sollte sein Vater sich gegen jede Erwartung diese Sprüche verkneifen, würde er sicher mit anderen Floskeln aufwarten, nach dem Motto: »Einmal sind wir alle dran, ich hoffe, dass es schnell geht.« Nach einem Unglück auf einer Baustelle hatte er Nicolas mit dem Ausspruch schockiert: »Opfer müssen eben gebracht werden.« Durchaus, solange es nicht eigene waren …
Also kam ein Anruf bei seinem Vater nicht in Frage – Friedrich hatte das nicht verdient. Nicolas hatte ihn als Mann in Erinnerung, der gewusst hatte, was er wollte. Er selbst bestimmte seine Lebensumstände mehr danach, was er nicht wollte. Nicolas stutzte, als er merkte, wie schnell er akzeptierte, dass »Nelken-Friedrich«, wie sie ihn genannt hatten, tot war.
Wenn er sich recht erinnerte, war Friedrich 1974 nach Portugal gegangen. Wenig später hatten Nicolas' Eltern sich kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Als er geboren wurde, lebte Friedrich bereits seit drei Jahren in Portugal. Es gab ein Foto von seiner Taufe, da war Friedrich mit drauf. Wild hatte er ausgesehen, Bart, langes Haar, Lederjacke, das Enfant terrible im Familienkreis und ein Schreckgespenst für die Frankfurter Society, erinnerte er sie doch an die Drohung mit sozialistischen Experimenten und die Enteignung derer, die wie sie im Überfluss lebten. Heute dachte Nicolas zum ersten Mal daran, dass Friedrich seine Geburt etwas bedeutet haben musste, wenn er eigens zur Taufe angereist war. Nein, seine Mutter konnte er nicht fragen. Friedrich war für sie ein Fremder, sowohl als Mann wie als Mensch unbegreiflich. Oh, war das zu böse gedacht? Menschen wie Friedrich waren in ihrer Welt nicht vorgesehen. Er selbst hatte bis heute nicht begriffen, wer oder was in ihrer Welt vorgesehen war.
Allerdings telefonierte sie häufig mit seinem Vater, rein geschäftlich natürlich. Clever, wie sie war, hatte sie sich einen guten Anwalt genommen und sich an der Scheidung gesundgestoßen, was in jenen Zeiten, als Gleichberechtigung noch kein Thema war, äußerst selten vorkam. Bis heute bezog sie Tantiemen oder Royalties, wie er es nannte. Und es ärgerte sie maßlos, dass Nicolas nicht beim Vater einstieg, nicht nur des Geldes wegen; sie hätte ihn auch zu gern als Spion benutzt. Immer im Bilde sein, lautete ihre Devise. Dabei war sie klug genug, niemals ein abfälliges Wort über ihren Exmann verlauten zu lassen, weder im Familienkreis noch Bekannten gegenüber, weshalb sich viele gefragt hatten, warum sie sich überhaupt hatte scheiden lassen.
Entnervt suchte Nicolas sein Telefonbuch in den Taschen des Sakkos, die Nummer seiner Mutter konnte er sich nie merken. Alle drei Monate wechselte sie wegen angeblich günstigerer Tarife den Telefonanbieter, es war eine Manie geworden. Er hatte den Hörer bereits in der Hand, als er ihn wieder sinken ließ. Er hatte ja gar keine Erklärung, wieso er von Friedrichs Tod wusste. Würde er von dem Brief erzählen, den er wieder und wieder glatt strich, als wolle er die Buchstaben vom Papier wischen, würde sich die Frage nach dem Erbe unweigerlich stellen. Es war ihm unklar, ob es ihr darum ging, den Sohn versorgt zu sehen oder selbst mehr Einfluss zu gewinnen. Sie hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Verlockung des väterlichen Vermögens groß genug sein würde, ihn wieder nach Frankfurt zu führen und ihn zur Aufgabe seines gegenwärtigen Lebens mit »Les Misérables« zu bringen, wie sie seine Freunde bezeichnete.
Irgendwann würde er die Aufgabe finden, die er sich wünschte, in der er aufging, bei der er weder Sohn noch Erbe sein würde und auch keine Rattenkäfige für Büroangestellte oder Bausparkassendoppelhäuser entwerfen beziehungsweise zeichnen musste, auch keine Details wie Fensterrahmen, Rohrleitungsschächte, Türeinfassungen oder Einfahrten von Tiefgaragen. Er würde eine Arbeit finden, bei der er das anwenden konnte, was er gelernt hatte.
Alles Unsinn, er verlor sich in Fantastereien, in Luftschlössern, die keiner bauen wollte, statt … Was würde er seiner Mutter sagen? Irgendetwas musste er ihr anbieten, sie brauchte was zum Beißen. Nicolas nahm sich vor, ihr lediglich zu sagen, was sie hören wollte, das Gespräch wie unbeabsichtigt auf den Onkel kommen zu lassen und sich nach ihm zu erkundigen. Nein, das war nicht besonders einfallsreich. Er könnte um Friedrichs Adresse bitten, sagen, er beabsichtige, in Portugal Ferien zu machen, und würde nach all den Jahren mal wieder bei ihm vorbeischauen wollen. Schon besser, das war eine passable Begründung. Sie würde die Adresse nicht haben und ihn an seinen Vater verweisen, doch wenn sie von Friedrichs Tod wusste, würde sie es ihm sagen. Könnte sie einen Grund haben, es zu verschweigen? Vor Überraschungen war man bei ihr nie sicher.
Er empfand es als absurd, dass er sich verstellen musste, wo es nicht einmal um ihn selbst ging, sondern um Friedrich, ihren ehemaligen Schwager – den längst vergessenen. Nein, vergessen hatte ihn niemand, höchstens er selbst. Wieso fühlte er dann einen Verlust? Friedrich war ein Mensch gewesen, zu dem er Zutrauen gefasst hatte, jemand, der ihn weder mit Fragen nach der Schule genervt noch nach seiner Zukunft im väterlichen Imperium gelöchert hatte. Zehn Jahre waren seitdem vergangen – wie hieß Friedrichs Weingut? Quinta do Amanhecer.
Nicolas schaltete sein Laptop ein und suchte amanhecer in seinem elektronischen Wörterbuch. Morgendämmerung, Morgengrauen kam als Antwort, also Landgut der Morgendämmerung. Weiter unten klickte er unter »Tal der Morgendämmerung« zufällig einen Satz an, der ihm sein Dilemma zwischen Familie und seiner Wirklichkeit vor Augen führte: Der Reichtum eines Menschen liegt nicht in der Summe oder Verteilung seiner materiellen Güter, sondern in seiner Würde.
Die Familie wollte materielle Güter, er wollte seine Würde. Leicht gesagt. Sicher stammte der Satz von jemandem, der nichts besaß. Wieso hatte er das Gefühl, dass er seine Würde verlöre, wenn er ins väterliche Unternehmen einträte? Wieso glaubte er, dass alle nur darauf warteten, dass er überliefe, sich so verhielte wie alle? Weil »jeder Andersdenkende eine Bedrohung der Mehrheit« war? Er wusste nicht, wer das gesagt hatte. Der Satz mochte einst seine Richtigkeit gehabt haben, aber er war belanglos geworden, denn was jemand dachte, war absolut gleichgültig. Das machte die Meinungsfreiheit überflüssig, wie sein Freund Happe nicht müde wurde zu betonen. Über derartige Sätze hatte er auch mit Friedrich diskutiert. Auf seiner Terrasse hatten sie hoch über dem Fluss auf einer Mauer sitzend die Beine baumeln lassen und Wein getrunken. Was verband ihn mit seinem Onkel? Er hatte sich nie unterlegen gefühlt. Ach, Erinnerungen – und der Brief …
Was hatte Friedrich ihm vermacht? Ein Bild? Eine Kiste Wein? Einige Bücher aus seiner großen Bibliothek – oder etwas Persönliches? Nein, so nahe hatten sie sich nicht gestanden, doch wenn sie sich gesehen hatten – wirklich nur viermal im Leben? – , dann war es intensiv gewesen. Friedrich war kein gewöhnlicher Mensch gewesen, und deshalb hatte sein Vater ihn – ja was – gehasst? Verachtet? Belächelt – oder insgeheim beneidet? Weil er sich genommen hatte, was er wollte?
Riesige Fässer, ein ganzer Keller voll, graue Wände aus Granit. Dann tauchten Gerüche in Nicolas' Erinnerung auf, undefinierbar zuerst, süß und moderig, diese Erinnerung ruhte irgendwo tief in ihm wie auch die an bewachsene Steine, Palmen. Fragmente waren das, Teile von Bildern, die nach langer Zeit an die Oberfläche schwappten. Sogar die Stimme schien er noch im Ohr zu haben, nur Friedrichs Gesicht blieb verschwommen. Je mehr Nicolas sich zu erinnern versuchte, desto undeutlicher wurde die bildhafte Vorstellung. Die Erinnerung war zerbrochen wie ein Spiegel, und er hielt Scherben in der Hand, die nicht zusammenpassten. Wer hatte den Spiegel zerschlagen? Die Zeit? In seinem Kopf verschoben sich die Scherben wie ein Kaleidoskop, das man vor dem Auge dreht. Alles purzelte durcheinander. Da musste noch jemand gewesen sein, es gab andere Gesichter und Namen, unaussprechliche, er war auf einem Traktor gefahren und hatte gefürchtet, an dem steilen Hang abzustürzen. Es gab eine Steintreppe, lackiertes Holz, einen silbernen Leuchter auf einer polierten Tischplatte, sie hatten draußen gegessen. Sie hatten vor einem riesigen Stapel Flaschen gestanden, in einer Mauernische … Hatte er auf jener Reise an den Rio Douro vor zehn Jahren nicht bereits gezeichnet? Irgendwo müsste der alte Skizzenblock zu finden sein.
Während die Bilder weiter durch seinen Kopf rasten, hatte er, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Nummer seiner Mutter gewählt, und er erschrak, als sie sich meldete.
»Hollmann?«
Wieso setzte sie stets ein Fragezeichen ans Ende ihres Namens, wenn sie sich am Telefon meldete? Sie hätte ihren Mädchennamen wieder annehmen können, Sichel, oder den des neuen Ehemannes, Willbauer, wenn sie damit haderte, sich so zu nennen. Aber der Name Hollmann bedeutete viel in Frankfurt, wo man sich weder mit dem Müll, der Stadt noch dem Tod auseinandersetzen wollte, und schon gar nicht mit jemandem wie Rainer Werner Fassbinder. Dessen Theaterstück hatten sie wegen angeblichem Antisemitismus mit Spielverbot belegt, da war der spätere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde noch einer der großen Spekulanten seiner Stadt gewesen. Aber in Israel und den USA war man nicht so borniert gewesen, da hatte man Fassbinders Stück aufgeführt.
»Hallo! Wer spricht da?«
»… auch Hollmann«, sagte Nicolas nach einer Weile, »Tag …«
Die Mutter zögerte verwirrt. »Nicolas? Ist was mit dir? Du klingst so fremd.«
»Nein, es ist nichts, mit mir ist nichts, nur …«
»Was ist los? Ist was passiert? Du hast doch was.«
»Ja«, sagte er gedehnt und fügte hinzu: »Friedrich ist tot, Onkel Friedrich.«
»Wer ist tot? Onkel Friedrich? Welcher Friedrich …?«
»Friedrich Hollmann, dein ehemaliger Schwager, Papas Bruder, Nelken-Friedrich, wie ihr ihn genannt habt, euer Chaot«, sagte er böse.
»Ach der. Ja, davon habe ich gehört«, sagte sie, als hätte sie in den Nachrichten vom Ableben eines unbekannten Schauspielers erfahren. »Dein Vater hat davon gesprochen.«
»Wieso hast du mir nichts gesagt?«, fragte Nicolas empört.
»Seit wann interessierst du dich für die Familie?«, antwortete die Mutter spitz. »Ist ja ganz was Neues.« Dann wurde sie misstrauisch, Nicolas kannte ihre Stimme zu gut, um sich von ihr hinters Licht führen zu lassen. »Woher weißt du das? Hast du mit deinem Vater geredet?«
Also fürchtete sie, dass ihr etwas entgangen war. Nicolas zögerte. Sollte er sie auf die Folter spannen oder besser an der Nase herumführen? Nein, er würde sich nicht auf die üblichen Spielchen einlassen. »Friedrich ist am 18. April gestorben, und ich wollte wissen, woran.«
Seine Mutter wusste es nicht, es interessierte sie nicht, wie Nicolas ihrem gelangweilten Tonfall entnahm, ihr Exmann hatte von Herzstillstand berichtet, wie sie sagte. Mehr als ein desinteressiertes »Nein, weiß ich nicht, woher soll ich das wissen, du fragst aber Sachen« bekam er nicht zu hören.
»War er krank?« Nicolas drängte auf eine Antwort, mit der er etwas anfangen konnte. »Hatte er es mit dem Herzen?«
»Was weiß ich? Habe ihn nie gesehen …«
»… das stimmt nicht. Bei meiner Taufe, und wir waren vor zehn Jahren zusammen dort, ich bin dageblieben, in den Sommerferien. Du bist dann mit Willbauer weitergereist und hast mich wieder abgeholt.«
»Meine Güte, du nimmst es aber wieder genau, ich kann mich nicht erinnern.«
»Das wundert mich … und du weißt es von Vater?«
»Der hat weiter nichts gesagt.«
»Dich interessiert das Ganze nicht, oder?«, warf Nicolas ein.
»Ehrlich gesagt, nein. Dein Onkel hat uns verachtet. Wir waren für ihn das Establishment, er hat uns den Rücken gekehrt, der Stadt, dem ganzen Land. Sodom nannte er Frankfurt, und als sie die Hochhäuser bauten, dein Vater war mit dabei, meinte er, wir hätten nichts Besseres verdient.«
Nicolas grinste, seine Mutter ärgerte sich noch immer. In gewisser Weise gab er Friedrich recht, aber er hütete sich, es durchklingen zu lassen. Er selbst empfand Frankfurt als misslungen, konzeptlos, ohne Stil und Linie, da änderten weder der Römer noch die Museumslandschaften am Main etwas daran. Er selbst hatte der Stadt zwei Tage nach dem Abitur den Rücken gekehrt – die Entscheidung für Berlin war nach einer Silvesterparty am Brandenburger Tor gefallen. Happe und er hatten sich begeistert ins Gewühl geworfen. Es war nicht allzu viel von dem späten Vereinigungsgefühl übrig geblieben, zumindest war Berlin immer eine Stadt der Einwanderer gewesen, die es Neuankömmlingen nicht zu schwer machte.
»… ein Chaot war er, hat sich mit der Polizei geprügelt, hier im Westend«, hörte er seine Mutter voller Abscheu sagen, »Häuserkampf. Lächerlich, mit diesem ehemaligen grünen Außenminister. Front hat er gemacht gegen die Interessen der eigenen Familie. Was uns wichtig war, hat er abgelehnt, was uns heilig war, hat er verachtet. Und da soll ich mich für ihn interessieren? Ich weine ihm keine Träne nach. Ein Wunder, dass er nicht bei den Terroristen gelandet ist …«
Heilig? Das Einzige, was dir heilig ist, dachte Nicolas voller Zorn, ist dein Depot bei der Deutschen Bank. Damit versuchten sie ihn seit einem Jahrzehnt vergeblich zu ködern. Irgendetwas musste bei ihm falsch gelaufen sein, Geld als Lockmittel kam nicht an. Aber mit zu wenig, so wie jetzt, mit dem lausigen Job als technischer Zeichner, war das Leben auch unerfreulich.
»Was ist für dich eigentlich ein Chaot?«, fragte er. »Ich dachte, du kanntest Friedrich gar nicht? Wie kann man so urteilen – oder verurteilen, wenn man jemanden nicht kennt?«
»Ich …«, sie zögerte mit der Antwort, von seiner Frage aus dem Konzept gebracht, »ich habe ihn einige Male erlebt.«
»Wo und wann?«
»Dein vorwurfsvoller Ton gefällt mir gar nicht, Nicolas. Du fragst wie der Inquisitor persönlich. Mit dir ist doch was. Du hast dich nie für ihn interessiert. Jetzt ist er tot, basta. Irgendwann ist immer Schluss. Wahrscheinlich sein Lebenswandel, der Alkohol, er hatte ja das Weingut da in Portugal. Bei labilen Menschen geht das auf Dauer nicht gut.«
»Ach, labil war er auch?« Um sich nicht weitere Tiraden anhören zu müssen, erzählte Nicolas von Reiseplänen und dass er auf seine Anfrage, ob Friedrich zu Hause sei, die Todesnachricht erhalten habe.
»Du kannst ja mal bei der Kellerei vorbeischauen und sehen, was aus seinem Besitz wird; ziemlich viel Land soll er besessen haben, soweit ich weiß, hat er keine Kinder, keinen Erben …«
Darauf lief es bei ihr hinaus, jedes Gespräch, alles drehte sich in ihrer Welt ums Geld. Mit dem Versprechen, sie auf dem Laufenden zu halten, konnte er sie abwimmeln und tiefer gehende Fragen vermeiden. Sie hatte also von Friedrichs Tod erfahren, sein Vater hatte es gewusst. Herzversagen als Todesursache. Hoffentlich wusste der Anwalt mehr.
2.Ein Haus am Fluss
In den Räumen des Anwalts war es kühl, geradezu eine Erleichterung nach dem Weg durch die aufgeheizte Stadt. Holzgetäfelte Wände, Büromöbel aus der Gründerzeit, knarrendes Parkett, und über allem ein leichter Duft nach Holz, eine Aura von Gediegenheit, Anstand und Würde. Sogar Aktenordner und Gesetzbücher standen hinter Glas. An der Wand gegenüber den hohen Fenstern hing das Foto einer Demonstration: junge Männer, rennend, untergehakt, viele im Anzug und mit Krawatte, aufgerissene Münder, und im Hintergrund die Ruine der Gedächtniskirche, die Nicolas an einen ausgebrochenen Zahn erinnerte. Die Ruine und der Funkturm waren seine Wahrzeichen der Stadt. Die Siegessäule verabscheute er, im Fundament der Goldelse lagen die Toten von drei Kriegen, und die Quadriga war ihm zu oft bei den Aufmärschen der Nazis mit im Bild gewesen.
»Der da in der zweiten Reihe, das bin ich«, sagte Dr. Dr. Hassellbrinck schmunzelnd, als er den Raum betrat. Der Rechtsanwalt und Notar zeigte mit dem Finger auf einen Jüngling mit Vollbart, den Nicolas beim besten Willen nicht mit ihm in Verbindung gebracht hätte. »Damit man nie vergisst, woher man kommt, was einem wichtig war und ist und woran man glaubt.« Der Ton des Rechtsanwalts war weder nostalgisch noch parolenhaft, die Stimme klang freundlich und selbstsicher.
Nicolas wandte sich vom Bild ab, das neben einem Bücherschrank hing, und trat dem Anwalt entgegen.
»Sie sind das?«, fragte er ungläubig. »Niemals!«
»Doch, doch.« Anscheinend war der Rechtsanwalt derartige Reaktionen gewohnt, er lächelte belustigt und schüttelte Nicolas die Hand. Sein Blick war offen und durchdringend, ein Blick, den man nicht lange aushielt. Dazu langes graues Haar, ein hageres Gesicht, Lachfalten. Sein Lächeln konnte sowohl Zynismus wie auch Distanz bedeuten. Der elegante Flanellanzug ließ ihn als Verteidiger von Wirtschaftsbossen und -verbrechern als geeignet erscheinen.
»Das sind Sie?«, fragte Nicolas noch einmal kopfschüttelnd und folgte der Geste des Rechtsanwalts hin zum Besucherstuhl, während Hassellbrinck sich hinter seinem übergroßen, mit abgeschabtem Wildleder bespannten Schreibtisch niederließ.
»Als Jurastudent habe ich das Fach ernst genommen, es gab Gruppen, in denen sich angehende Juristen, Anwälte und Richter zusammenfanden, die in dieser Gesellschaft was verändern wollten, sie menschlicher und demokratischer gestalten wollten. Ich gehörte 1979 zu den Gründern des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins: Immer etwas mehr Demokratie, als gerade erreicht ist, das war und ist unser Ziel, besonders heute wieder, bei diesem Innenminister … Damals hatten wir andere Sorgen, Sie können sich kaum vorstellen, wie es in Deutschland ausgesehen hat – auf beiden Seiten der Mauer: drüben Stalinisten und Stasi, hier weichgespülte Nazis und die ehemaligen NS-Richter in unserer Justiz …« Hassellbrinck musterte Nicolas, als wolle er sein Innerstes nach außen kehren. »Wissen Sie«, fuhr er fort, »das Schönste für den Menschen scheint zu sein, wenn er sich über andere erheben kann – aber deshalb sind Sie nicht gekommen.« Hassellbrinck stieß hörbar die Luft aus. »Zuerst mein Beileid zum Tod Ihres Onkels. Soweit ich weiß, ist er bereits bestattet. Dr. Pereira aus Porto teilte es mir gestern am Telefon mit. Ich rief ihn an, nachdem wir diesen Termin für heute vereinbart hatten. Ihr Onkel, Friedrich Hollmann, muss Sie sehr geschätzt haben. Sie haben die Dokumente mitgebracht, um die ich Sie gebeten habe?«
Mich geschätzt haben?, fragte sich Nicolas, er kannte mich doch gar nicht. Er reichte dem Rechtsanwalt Geburtsurkunde und Personalausweis. Der Anwalt ließ beides fotokopieren und sprach eine kurze Notiz in ein Diktiergerät. »Erschienen ist heute am 4. Mai dieses Jahres Herr Nicolas Hollmann, geboren in Frankfurt am …« Als er geendet hatte, richtete er das Wort wieder an Nicolas: »Ihr Onkel ist Mitte der Siebziger nach Portugal ausgewandert und hat am Rio Douro – Sie wissen sicher besser als ich, wo das ist – ein Weingut aufgebaut, die Quinta do Amanhecer. Sicher spreche ich das falsch aus. Sie sprechen Portugiesisch?«
Nicolas verneinte, was den Rechtsanwalt die Stirn runzeln ließ. »Wäre aber hilfreich, besonders in Ihrem Fall.« Er seufzte, griff nach einer Mappe und schlug sie auf. »Andererseits – vielleicht brauchen Sie es nicht. Dr. Pereira will mir übrigens eine Kiste Wein von Ihrem Onkel schicken, soll sehr gut sein, auch sein Portwein, ein Tawny. Nun zu der Sache, deretwegen ich Sie hergebeten habe.«
»Können Sie mir sagen, woran mein Onkel gestorben ist?«, unterbrach ihn Nicolas, denn seine Nachfragen im Familienkreis – er hatte sich überwunden und auch seinen Vater angerufen – hatten nichts ergeben. »Friedrich war Jahrgang 1947, es hat nie jemand erwähnt, dass er krank war. Gut, ich habe selten von ihm gehört. Sie wissen, wie das so ist …« Nicolas war es unangenehm, darüber zu sprechen. »Sein Bruder, mein Vater, weiß auch nichts. Der Kontakt war aufs absolute Minimum beschränkt, wenn Sie so wollen. Mal ein Weinpaket zu Weihnachten …«
»Verstehe«, sagte der Anwalt. Wahrscheinlich kannte er derlei Geschichten zur Genüge. »Pereira hat von Herzversagen gesprochen, Genaueres müssten Sie vor Ort erfragen. Sprechen Sie mit seinem Arzt, wenn Sie dort sind, der weiß sicherlich mehr. In unserem Alter geht es manchmal schnell. Nun lassen Sie mich Ihnen die Angelegenheit erläutern.«
Nicolas hob erstaunt den Kopf. »Wenn ich dort bin? Wo, in Portugal? Wieso?«
»Wie bereits erwähnt, hat Friedrich Hollmann Sie als Erben eingesetzt, als Alleinerben. Er hat Ihnen sein Weingut nebst Immobilien sowie den festen wie auch den beweglichen Gütern hinterlassen. Dazu gehören die Kellerei, das Wohnhaus, 36 Hektar Weinberge der Kategorie A bis C. Was das bedeutet, entzieht sich meiner Kenntnis – des Weiteren Fahrzeuge, Mobiliar, Bilder, Möbel …«
»Mir? Wieso mir?«, fragte Nicolas fassungslos, nachdem der Anwalt die Aufzählung beendet hatte. »Was soll ich damit?«
Hassellbrinck schien Nicolas' Verwirrung zu amüsieren. »Diese Frage habe ich in Zusammenhang mit einer Erbschaft noch nie gehört. Sie können das Erbe ausschlagen, das bleibt Ihnen überlassen. Es gibt allerdings eine Einschränkung von Seiten des Erblassers. Sie können das Erbe nur unter einer bestimmten Bedingung antreten.«
»Und die wäre?« Nicolas ging auf Abstand, spürte, wie er sich versteifte. Seine Neugier wandelte sich schlagartig in Misstrauen. Die Familie war eine Krake, die einen mit tausend Saugnäpfen festhielt und von dem abhielt, was man selbst wollte. Man hatte Erwartungen zu erfüllen, aber nicht so zu sein, wie man war.
»Sie, Herr Hollmann, erben das alles unter der Bedingung, dass Sie das Weingut betreiben. Was bedeutet, dass Sie dort Ihren Wohnsitz nehmen müssten. Für die Entscheidung bleibt Ihnen ein halbes Jahr Zeit. Pereira hat mir den 28. Oktober dieses Jahres als letzten Termin genannt. Wenn Sie ablehnen, erben die Mitarbeiter alles.«
Die Pause, die entstand, als der Rechtsanwalt sich zurücklehnte, die Arme vor der Brust verschränkte und auf Nicolas' Reaktion wartete, war mehr als lang. Hassellbrinck war sich der Wirkung seiner Worte durchaus bewusst, mit Worten zu beeindrucken war sein Geschäft. Es war weniger eine Pause als vielmehr eine vollkommene Leere, die von Nicolas Besitz ergriff, ein Schwebezustand, unwirklich und unbekannt. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf, doch nicht ein einziger nahm derart Gestalt an, dass er ihn hätte aussprechen können. Er war sprachlos.
»Diese Eröffnung überrascht Sie. Verstehen Sie etwas von Wein und Weingütern?«
Nicolas schüttelte nur den Kopf; er hatte seine Sprache noch nicht wiedergefunden.
»Und Sie sprechen wirklich gar kein Portugiesisch?«
Wieder schüttelte Nicolas den Kopf. Unfassbar, er hatte damit gerechnet, vielleicht ein Bild, Zeichnungen oder die Architekturbücher zu erben, denn Friedrich hatte, wie alle in der Familie, Architektur studiert, bis auf seinen Vater, der Bauingenieur geworden war. Der Rechenmaschine, wie der Onkel seinen Bruder nannte, fehlte jede künstlerische Begabung. Dass der Vater Beamte bestach, sich Lieferanten oder Subunternehmer gefügig machte und Politiker für sich arbeiten ließ, wie in der Branche üblich, passte zu seinen Künsten. Im Grunde genommen war es diese Art, die Nicolas von ihm entfernt hatte.
»Herr Hollmann!«
»Was haben Sie gefragt?«, sagte Nicolas fahrig. »Sprachen? Ja, Schulfranzösisch, Latein und – ich habe am Berlage-Institut in Rotterdam die Postgraduation erworben, zwei Jahre. Studiensprache war Englisch, das Holländische kam von allein. Aber Portugiesisch? Nein, kein Wort, doch Amanhecer, das heißt Morgendämmerung …«
Hassellbrinck lachte. »Nomen est omen – vielleicht beginnt sie gerade bei Ihnen. Sie werden sich das Weingut anschauen. Mein Kollege in Porto spricht gut Englisch, Sie werden sich verständigen. Die erste Hürde könnten Sie nehmen. Danach wird es kompliziert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer sonst noch von dem Testament weiß, ob die Belegschaft informiert ist. Kennen Sie das Weingut? Waren Sie mal dort? Wann haben Sie Ihren Onkel zuletzt gesehen? Wie viele Mitarbeiter hatte er auf der – wie heißt das? – Quinta?«
Dann kamen Fragen, von denen Nicolas viele nicht beantworten konnte. Hassellbrinck brachte ihn dazu, dass er ihm auch ein Bild seiner momentan desolaten Lebensumstände gab. In Deutschland sah er wenig Chancen, seinen Beruf in der Weise auszuüben, wie er es sich vorstellte.
»Eine letzte Frage habe ich noch.« Nicolas blieb in der Tür stehen. »Hat mein Onkel irgendetwas für mich hinterlegt, ein Schriftstück, einen Brief, eine Erklärung, weshalb ich seine Quinta erben soll?«
»Pereira hat mir nichts davon gesagt, ich nehme an, dass er die entsprechenden Unterlagen für Sie bereithält.«
»Sie wissen wirklich nicht, weshalb Friedrich Hollmann gerade mir die Quinta vererbt hat? Es muss doch einen Grund geben. Welche Veranlassung sollte er gehabt haben?«
»Sie werden es herausfinden, Herr Hollmann. Fahren Sie hin, Portugal ist schön, und die Menschen sind freundlich.«
Verwirrt trat Nicolas vor die Tür des stattlichen Hauses und quetschte sich zwischen den geparkten Wagen hindurch, um die Straßenseite zu wechseln. Die Blechkisten störten ihn maßlos, nicht nur, dass sie die Luft verpesteten; als fixer Bestandteil jedes Stadtbildes verschandelten sie die Bildfläche, rahmten die Gebäude ein wie ehemals Vorgärten und Rabatten. Aus keiner Landschaft waren sie mehr wegzudenken. Nur auf Schrottplätzen gefielen ihm die Autos, dort faszinierte ihn ihr Anblick: ausgeschlachtet, zertrümmert, dem Verfall preisgegeben, so offenbarten sie ihre wahre Natur, der Schrottplatz war ihre finale Bestimmung, und er konnte fast ein wenig Mitleid mit ihnen haben. Ob eine Reise nach Portugal seine Kollektion von Fotos mit Autowracks in ausdrucksstarken Landschaften bereichern würde? Einen zerbeulten und verrosteten Japaner oder Franzosen zwischen Weinreben in der Morgendämmerung hatte er noch nirgends fotografiert.
Vor dem Weinladen, den ihm Hassellbrinck empfohlen hatte, blieb er stehen. »Arbeiten Sie sich möglichst rasch ins Thema ein«, hatte der Anwalt geraten. »Nur so können Sie ein fundiertes Urteil fällen. Je eher Sie damit beginnen, desto klarer wird Ihr Blick – und Ihr Geschmackssinn. Trainieren Sie Ihren Geruchssinn, riechen Sie an allem, was Ihnen unter die Nase kommt. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie gelegentlich mal zu mir zu einer Weinprobe, ich habe einen sehr schönen Keller. Man sieht und schmeckt nur, was man kennt – und berichten Sie mir, wenn Sie aus Portugal zurück sind. Alles Weitere regelt Pereira.« Mehr hatte er ihm nicht gesagt.
Sollte er sich wirklich das Weingut ansehen? Ein kleiner Urlaub konnte nichts schaden, Billigflieger nach Porto gab es bestimmt. Als er sich fragte, ob er Sylvia dabeihaben wollte, war er an dem empfohlenen Weinladen angelangt. Er verschob die Beantwortung auf später. Die Auslage war lieblos gestaltet, lediglich Flaschen verschiedener Form und Größe auf umgestülpten Weinkisten, eingebettet in Holzwolle, mit Schleifchen um den Hals, stehend oder liegend, Namen und Preise auf den Zettelchen daneben. Einfallslos. Dabei stammten die Weine aus den schönsten Gegenden der Welt. Bei so viel Natur musste es doch andere Stoffe geben als Holzwolle. Sogar die Optiker, die lediglich Brillen und Kontaktlinsen verkauften, gestalteten ihre Schaufenster spritziger. Von außen gesehen gab es keinen Grund, hier einzutreten.
Er tat es trotzdem und sah sich vorsichtig um. Die Frau hinter dem Tresen sah nicht einmal auf, obwohl die Türglocke läutete. Über einen Block gebeugt schrieb sie weiter. Berliner Freundlichkeit. Schnauze mit Herz hatte es früher geheißen; die Schnauze war übrig geblieben und das Herz auf der Strecke – wie bei Onkel Friedrich, dachte er. Ist Herzstillstand ein rascher, vielleicht sogar schöner Tod, wenn der Tod überhaupt schön sein kann? Man merkt nichts, ist weg, verschwindet ohne Abmeldung, einfach so. Unvorstellbar, auf immer und ewig. Die Frau mit dem ungepflegten Haar, das ihr struppig vom Kopf abstand, sah jetzt auf.
»Was kann ich für Sie tun?«, knurrte sie.
Nicolas wusste weder, wie er richtig fragen sollte, noch, was er genau wollte. Die Verkäuferin mit den rot geränderten Augen machte nicht den Eindruck, als würde sie ihn gern mit der Welt portugiesischer Weine vertraut machen.
»Können Sie mir sagen, was so besonders ist an portugiesischem Wein?«, fragte er zaghaft und wusste, dass es bestimmt falsch ankommen und sie ihm kaum eine erschöpfende Antwort geben würde. Die Frau sah ihn an, als hätte er Hundefutter verlangt. Er schob eine andere Frage nach, die er genauso dämlich fand. »Weshalb sollte man portugiesische Weine trinken – und zum Beispiel keine französischen?« Die Frau sah ihn immer noch an, als hätte sie einen Schwachsinnigen vor sich. War das ein Laden nur für Eingeweihte? Er versuchte es mit einer dritten Frage: »Wie unterscheiden sich portugiesische Weine von anderen?«
Die Verkäuferin runzelte unwillig die Stirn. Vielleicht glaubt sie, ich will sie verarschen, dachte Nicolas. Kommen alle anderen her und wissen, was sie wollen? Er sah sich um. Er befand sich zwischen Regalen mit Flaschen, Flaschen in Kisten, rechts stand eine Palette mit Weinkartons, geschlossen und aufgeschnitten, Flaschen lagen gestapelt an den Wänden, Rotwein, Weißwein, Rosé …
»Das kommt darauf an«, sagte die Verkäuferin, und Nicolas wunderte sich über ihre angenehme Stimme. »Es kommt darauf an, was Sie wollen. Hatten Sie an einen Wein aus dem Ribatejo gedacht, an einen Dão oder eher an einen aus Bairrada? Die aus der Estremadura sind auch sehr schön, ganz anders natürlich die aus Sétubal. Sicher, auch im Alentejo gibt es ausgezeichnete und sehr eigenständige Weine …«
Sie hatte erreicht, was sie wollte: Er stand als Dummkopf vor ihr. Bitte schön, dachte Nicolas ergeben, sollte sie es genießen. Lediglich Alentejo und Algarve waren ihm von seiner damaligen Tour her vertraut, es waren portugiesische Regionen. Den Rio Douro hatte sie nicht genannt, den kannte er natürlich, aber der Rest? Er stand hier als Depp unter Kennern, denn auch ein anderer Kunde schaute ihn missbilligend an, wie Nicolas sich einbildete. Da kam ihm die rettende Idee.
»Haben Sie Weine von der Quinta do Amanhecer?«
Die Frau stutzte. Ihr Ja kam so, als würde sie ihm jede Berechtigung absprechen, danach zu fragen. »Da drüben«, sie wies mit dem Kopf hin, »den Vinho de Mesa, dann eine Semi-Crianza, wie die Spanier sagen, mit kurzem Barriqueausbau. Die Reserva ist in französischer Eiche gereift, der Wein wird nicht gefiltert, es bildet sich also ein Depot, man muss ihn dekantieren. Einen schönen Port macht er auch, schauen Sie links im Portweinregal. Wie kommen Sie auf dieses Weingut?« Das klang, als hätte sie gefragt, was er überhaupt hier zu suchen hätte.
»Eine Empfehlung«, murmelte Nicolas kleinlaut, worüber er sich ärgerte. Er ließ sich doch sonst nicht einschüchtern. »Welcher ist es?«
Er trat ans Regal. Flaschen mit englischen Namen wie Grahams, Dow, Smith Woodhouse, Cockburns, Harris und Churchills waren eindeutig in der Mehrzahl. Niepoort und Burmester waren sicher Holländer, Kopke konnte deutsch sein, und die Portugiesen hießen Ferreira, Romariz, Ramos-Pinto und Vallado. War es ein Fehler, Friedrichs Portwein nicht sofort zu entdecken, das Etikett nicht zu kennen, nicht zu wissen, wonach er unter den vielen Marken zu greifen hatte? Hilflos sah er sich nach der Verkäuferin um.
»Könnten Sie mir vielleicht …«
Sie knallte den Kugelschreiber auf den Block, schlurfte hinter dem Tresen hervor und griff seufzend in ein anderes Regal. Sie hielt ihm eine Weinflasche so dicht vor die Augen, dass er sich zurücklehnen musste.
»Vinho Verde, der billigste, 6,90 Euro!«
»Ist das der Einzige?«
»Die Semi-Reserva kostet 12,50 Euro.« Vorwurfsvoller ging es nicht. »Die Reserva kostet 22 Euro!« Sie war offenbar der festen Überzeugung, dass Nicolas keinen Cent in der Tasche hatte.
»Und der Port dieses Hauses?«, sagte er jetzt so blasiert wie möglich und blickte an ihr vorbei. Da wurde die Verkäuferin wach. Dass ihr der Laden gehörte, hielt Nicolas für ausgeschlossen. Vielleicht musste man so mit ihr reden, sie mochte es von ihren Kunden gewohnt sein. Mit einem verunglückten Lächeln wies sie auf eine Flasche, auf der eine große Zehn prangte.
»Zehn Jahre alter Tawny, auf der Quinta gemacht, nicht in Gaia. Gehört einem deutschen Winzer, soweit ich weiß. Macht einen ausgezeichneten Port, und auch seine Tischweine werden gern gekauft. Wir würden ja gern mehr abnehmen, leider bekommen wir nur wenig von jedem Jahrgang zugeteilt.«
Wenigstens einmal eine erfreuliche Nachricht, dachte Nicolas und griff nach der Brieftasche. Er zögerte, als ihm der Gedanke kam, dass er etwas völlig Absurdes tat – nämlich seinen eigenen Wein zu kaufen. Unsinn, nichts gehörte ihm. Er nahm die Flasche in die Hand und betrachtete das Etikett. Nur wenige Linien umrissen einen Berg, ein Haus und einen Fluss, schwarz auf weiß, klar und eindeutig – war das die Hinterlassenschaft? Auf der Rückseite der Flasche klebte ein kleines Etikett mit einem portugiesischen Text – er verstand kein Wort. Da zeigte sich die ganze Tragweite seines Problems.
»Es ist ein Tawny«, sagte die Frau, »zusammengestellt aus verschiedenen Portweinen dieser Quinta, die im Durchschnitt mindestens zehn Jahre alt sein müssen. Die Grundweine bleiben bis zur Assemblage in pipes und verlieren dabei ihr intensives Rot, das Rotweine normalerweise auszeichnet.«
Was ein Tawny genau war, fragte er besser nicht. Im Englischen zumindest bedeutete es lohfarben, ein gelbliches Braun oder ein bräunliches Gelb … Eine Assemblage konnte nur eine Zusammensetzung sein. Und pipes? Nicolas sah auf die Uhr, der Nachmittag war angebrochen, es lohnte nicht, ins Büro zurückzufahren, und er hatte auch nicht die geringste Lust dazu, sich am PC zu langweilen. Er sollte sich lieber in einem Buchladen nach Fachliteratur umsehen.
Er kaufte von jedem »seiner« Weine eine Flasche und reichte der Verkäuferin einen 50-Euro-Schein.
Sie nahm ihn, grinste ihn an und streckte die Hand wieder aus: »Es fehlen 16,40 Euro.«
Nicolas schluckte, wieder hatte sie ihm seine Unkenntnis bewiesen. Außerdem hatte er noch nie im Leben so viel Geld für nur vier Flaschen ausgegeben, eigentlich überstieg der Betrag sein Budget – und das auch noch für den eigenen Wein. Unsinn. Der gehörte ihm doch gar nicht. Alles, was er bei sich trug, war ein Empfehlungsschreiben von Hassellbrinck für Dr. Pereira. Pass und Geburtsurkunde als vom Konsulat beglaubigte Kopie musste er mitnehmen und diesem Pereira vorlegen, dabei war Nicolas nicht sicher, ob er überhaupt fahren sollte …
»Absurd.« Sylvia schüttelte den Kopf. Sie betrachtete Nicolas, der mit großen Augen vor ihr saß, als hätte sie eines der Kinder vor sich, die sie unterrichtete. Behandelten ihn heute alle so? »Völlig absurd ist das, Nicolas. Und außerdem – wieso erzählst du mir erst jetzt davon? Seit wann weißt du von der Erbschaft?«
Nicolas hörte ihre Stimme, vernahm die Empörung, in ihren Augen jedoch flackerte die Unsicherheit, die Angst davor, die Kontrolle über die Situation zu verlieren und ihn dazu. Sie konnte gar nicht objektiv an die Frage herangehen, ob es sinnvoll war, sich das Weingut anzusehen. Sie träumte von einer Zukunft an seiner Seite, die Ehefrau eines von Geburt an reichen und erfolgreichen Frankfurter Bauunternehmers zu werden. Sie sah die Kinder der Zehlendorfer Eltern, die ihre Gören im Cabriolet zur Schule fuhren. Sie hatte diesen Wunsch nie klar ausgesprochen, lediglich umschrieben. Doch dieser Wunsch bestimmte ihr Handeln und sie wollte ihn dazu bringen, es auch zu wollen, und dabei machte sie alles falsch. Er war nicht geradlinig, er ging in Schlangenlinien auf sein Ziel zu, wenn er denn eines hatte. Er hasste Zwang und liebte Spontanität. Wenn ihm etwas in den Sinn kam, dann tat er es – oder eben nicht.
Sylvia suchte, wie immer in Situationen, in denen ihr die Argumente ausgingen, stets Zuflucht im Wohl der anderen. Dahinter verbarg sie ihre eigentlichen Interessen. Dann, später erst, wenn nichts half, wurde sie bissig. Noch war dieser Moment nicht da, und Nicolas würde sich hüten, es heute dazu kommen zu lassen.
»Ist das wieder eines deiner Luftschlösser? Du bist ein Architekt von Luftschlössern!«
»Es ist weder meine Idee noch ein Luftschloss, sondern eine Kellerei, Sylvia. Es geht um meinen Onkel. Und auch ich bin von seinem Tod überrascht.«
»Allzu nahe wird es dir nicht gehen, bei deiner Familienparanoia«, bemerkte sie schnippisch. »Wieso ist er so plötzlich gestorben? War er krank? Ich meine vorher, so ein Herzleiden kündigt sich an. Andererseits«, sie lächelte gekünstelt, Mitgefühl heuchelnd, »mit 60 ist kaum jemand mehr richtig fit, und bei dem Lebenswandel in den südlichen Ländern, wer weiß. Hat er viel getrunken?«
Waren das nicht die Worte seiner Mutter, vom Lebenswandel in den südlichen Ländern? Was stellten sie sich eigentlich unter dem Süden vor? Hochhäuser an der Costa del Sol oder einen Ferienklub in Atalaya, dazu Ballermann auf Mallorca? Promiskuität und tägliche Weinorgien an der Algarve? Nichts hielt sich so hartnäckig wie Vorurteile. Nicolas kam die Idee, dass er sich vielleicht wegen der gewissen Ähnlichkeit mit seiner Mutter für Sylvia entschieden hatte. Gut zu wissen, dass er unter einem Ödipuskomplex litt. Allerdings hatte er sich nie für Sylvia bewusst entschieden. Sie war einfach da gewesen. Also bestand Hoffnung für ihn.
»Ich weiß nicht, ob seine Gesundheit angegriffen war. Unser Kontakt war minimal. Ich hatte bislang keinen Grund, von ihm zu erzählen, und mein Besuch bei ihm liegt lange zurück.«
Sylvia wollte nicht über Friedrich Hollmann sprechen, sie wollte über Nicolas sprechen. »Du wirst dich entscheiden müssen, du schiebst immer alles vor dir her, du verzettelst dich, du musst dir Ziele setzen – das ist nicht dein Ernst, von wegen nach Portugal reisen?«
»Klar, ich überlege allen Ernstes, ob ich mir das ansehen sollte. Es wäre dumm, es nicht zu tun. Reisen bildet …«
»Ach was!«, sagte Sylvia voller Überzeugung. »Portugal ist zwar in der Europäischen Union, die Menschen sind aber total anders als wir. Und rückständig, das Armenhaus der EU.«
»Du hast mir gar nicht erzählt, dass du mal dort warst«, sagte Nicolas lauernd. Er bekam Lust, sie zu provozieren.
»War ich auch nicht, und ich brauche es auch nicht zu kennen«, meinte Sylvia ohne den geringsten Selbstzweifel. »Ich habe an der Schule genug mit Ausländern zu tun. Das ist in allen Ländern gleich. Du bleibst draußen, du kommst nicht rein, eine geschlossene Gesellschaft. Menschen mögen nun mal keine – Fremden.«
Du vielleicht nicht, wollte Nicolas sagen, aber er verkniff es sich, es hätte sich beleidigend angehört, und die Grundstimmung ihres Gesprächs war angespannt genug.
»Ich will da gar nicht rein, in diese Gesellschaft, ich will mir das Weingut ansehen.«
»Ich denke, du warst mal da.«
Heute nervte sie ihn besonders. »Das ist lange her. Ich weiß nur noch, dass sein Haus in einer traumhaften Landschaft liegt, an einem Fluss oder an einer Talsperre, ein irrer Blick, rings von Weinbergen umgeben, Terrassen, ein großer Garten, es sind mehrere Gebäude, soweit ich mich erinnere.« Je länger die Aufzählung wurde, desto klarer wurde die Vergangenheit. »Außerdem – unter diesen Voraussetzungen schaut man anders hin.«
Sylvia gab sich nie leicht geschlagen, sie hatte immer noch ein Argument, wenn er längst aufgegeben hatte. »Dich soll einer verstehen. Erst träumst du davon, dass du als Architekt Häuser entwerfen willst, die Architektur revolutionieren, ja künstlerisch oder wie auch immer tätig sein willst, und dann kommst du mit einer Erbschaft. Das war doch ein rotes Tuch für dich, deine Frankfurter Erbschaft, Familien, die sich ihre Mitglieder mittels Geld gefügig machen. Ich werde mich nicht als Erbe definieren, dein Originalton, mein Lieber …«
»Friedrich war anders, der hat sich genauso von der Familie abgesetzt wie … er war ein …« – Nicolas suchte nach einem passenden Begriff – »ein Nonkonformist, der ist seinen eigenen Weg gegangen, ein ziemlich cooler Typ.« Unwillkürlich dachte Nicolas an den Rechtsanwalt, der ihm gestern die Eröffnung mit der Erbschaft gemacht hatte. Sie waren sich ähnlich.
»Wie willst du dich mit diesen Leuten verständigen, mit den Angestellten und Arbeitern? Der Onkel wird nicht alles allein gemacht haben. Seine Leute werden dir sonst was erzählen, aber nicht das, was du wissen willst. Du kennst die rechtliche Lage gar nicht, die portugiesischen Gesetze, Steuerrecht, ach … du überblickst gar nicht, wer sonst noch was erbt, mit wem du teilen musst, wer hinterher Ansprüche erhebt. Wenn es was zu holen gibt, halten alle die Hände auf und haben dabei das Messer zwischen den Zähnen. Es kommen endlose Prozesse auf dich zu. Bleib hier!«
»Woher weißt du das so genau?«, fragte Nicolas verärgert.
»Sie sind alle gleich, die Menschen …« Sie zuckte mit den Achseln.
»Vermitteln dir deine Kinder ein so schreckliches Weltbild? Wenn die jetzt schon verdorben sind, wie hältst du deinen Beruf dann eigentlich aus?«
Sylvia wischte seinen Einwand beiseite. »Das tut nichts zur Sache, wichtig bist allein du.«
Besonders empörte sie der Umstand, dass Friedrich Hollmann seinem Neffen keine Erklärung hinterlassen hatte, weshalb er ihm das Weingut vererbte. Dann folgte wieder eine längere Aufzählung dessen, was ihrer Meinung nach für ihn das Beste sei. Er kannte ihre Argumente, sie wiederholte die Forderung, dass er sich endlich seiner Verantwortung stellen und die ihm zustehende Rolle im väterlichen Konzern übernehmen, seiner »natürlichen Berufung« folgen solle. Sie hatte in den zwei Jahren ihrer Beziehung noch immer nicht begriffen, wer er war. Er war mit seiner Geduld am Ende.
»Geh du doch nach Frankfurt, wenn dir so viel daran liegt«, sagte er provozierend.
»Wissen die Mitarbeiter dieser Quinta von der Regelung, dass sie erben werden, wenn du das Weingut nicht übernimmst?«
Nicolas hatte keine Ahnung, und er hatte auch vergessen, den Rechtsanwalt danach zu fragen. Für ihn zählte lediglich die Entscheidung, ob er hinfahren und sich die Quinta ansehen sollte oder nicht. Die Frage, ob er das Weingut übernehmen sollte oder nicht, stand noch nicht an, doch Sylvia war längst weiter.
»Wie soll man entscheiden, ohne eine Grundlage dafür zu haben? Die werden dich an nichts ranlassen, die werden dir nur Knüppel zwischen die Beine werfen, dir Schwierigkeiten machen, die lassen dich bestenfalls ins Leere laufen. Was hast du gesagt? Häuser, Land, 36 Hektar, und in den Kellern liegen die Fässer mit Wein. Maschinen gibt es und Fahrzeuge? Nimm dir eines von den Autos und gib dich damit zufrieden.«
»Unsinn, davon war keine Rede. Es geht darum, das Weingut zu führen. Alles oder nichts, so habe ich es verstanden.«
»Das werden sie nicht zulassen. Hatte dein Onkel keine Frau? Die wird das Testament anfechten, sie wird dich auflaufen lassen. Du kennst dort niemanden, du hast keine Verbündeten, man wird dich betrügen, dich hintergehen, dich beklauen. Die werden dir sonst was erzählen, zumal du vom Weinbau nicht den leisesten Schimmer hast.«
»Das kann man lernen«, verteidigte sich Nicolas, »aber du verstehst es anscheinend immer noch nicht. Ich muss mir das ansehen, damit ich entscheiden kann.«
»Wein ist kein Geschäft mehr. Den gibt's heute an jeder Tankstelle, in jedem Baumarkt und kistenweise für 1,99 Euro bei Lidl und Aldi …«
»Das wird 'ne Plörre sein …«
»Die von deinem Onkel ist besser?«
»Deshalb habe ich ja die Flaschen gekauft, damit wir probieren.« Mit diesen Worten griff er zum Korkenzieher und öffnete den vinho de Mesa, den Tischwein, nahm zwei Gläser aus dem Küchenschrank, goss ein und begann, den Tisch zu decken.
»Und was meint deine Mutter dazu?«
Nicolas starrte auf die weißen Kacheln hinter dem Küchenherd, sah die Fettspritzer und dachte daran, dass er sauber machen müsste.
»Nichts«, sagte er. Er fürchtete, dass Sylvia nichts Eiligeres zu tun haben würde, als sie anzurufen. »Bitte lass es, ich bitte dich eindringlich!«, sagte er. Dabei war ihm klar, dass sie es tun würde, obwohl sie nickte. Irgendwann hatte Sylvia darauf bestanden, seine Mutter kennenzulernen, was er lieber vermieden hätte, denn kaum kannte jemand seinen familiären Hintergrund, änderte sich das Verhalten. Allein der Gedanke, wie viel Geld in Aussicht war, ließ die meisten auf dumme Gedanken kommen und sich fragen, wie sie am besten in den Genuss zumindest eines Teils davon kämen und was sich damit machen ließe. Zu allem Unglück hatten sich Sylvia und seine Mutter sofort verstanden. »Das ist die richtige Frau für dich, bodenständig, nicht so spinnert, die holt dich auf den Teppich«, hatte seine Mutter gemeint, und im selben Moment war Nicolas innerlich weiter von Sylvia abgerückt. Konnten sie ihn sein verdammtes Leben nicht einfach allein leben lassen, statt ihm blödsinnige Ratschläge zu erteilen, die ausschließlich ihnen selbst galten?
Sylvia war in Fahrt, es war auch nicht möglich, ihr ein Glas Wein einzuschenken und sie damit zu bremsen. »Wer weiß, was auf dieser Quinta wirklich los ist. Hast du dich mal gefragt, weshalb dieser Onkel nach all den Jahren des Schweigens dir und keinem anderen das Weingut vermachen will? Womöglich ist alles hoch verschuldet. Er konnte deinen Vater nicht leiden …«
»… sie haben sich nicht verstanden, das ist was anderes«, warf Nicolas ein.
»Spielt das eine Rolle? Vielleicht will er sich posthum an ihm rächen, schlägt den Neffen und meint den Bruder, vielmehr lässt ihn schlagen. Kann sein, dass zwischen den ehemaligen Mitarbeitern bereits Krieg herrscht, und du gerätst zwischen die Fronten.«
»Alles das wird man sehen. Trink lieber, mit dir kann man nicht reden, du denkst zu verquer, zu negativ …«
»Wenn du nicht mit mir diskutieren willst, kann ich ja gehen.« Beleidigt stand Sylvia auf, betrachtete die vollen Weingläser, griff nach einem, kostete und verzog das Gesicht. »Widerlich.«
»Das habe ich mir gedacht«, murmelte Nicolas und dachte daran, seinen Freund Happe zu fragen, ob er schon gegessen hätte.
Sylvia griff nach ihrer Handtasche, in der das Mobiltelefon erstickte Laute von sich gab. Sie meldete sich, blieb kurz angebunden, mehr als ja und nein bekam Nicolas nicht mit. Als sie das Telefon wegsteckte, meinte sie, dass sie einer Kollegin helfen müsse, die mit den Korrekturen einer Klassenarbeit nicht zurechtkäme. Es war ihre Standardausrede, wenn sie sich zurückziehen wollte.
»Du bist naiv, Nicolas«, meinte sie, nachdem sie ihn an der Wohnungstür flüchtig geküsst hatte. »Das Fell werden sie dir über die Ohren ziehen. Die kennen sich alle untereinander. Du solltest nicht fahren, es ist rausgeworfenes Geld. Schade um die Zeit. Wie willst du das mit deinem Job regeln? Bei dem befristeten Vertrag steht dir kein Urlaub zu.«
»Das ist richtig. Wenn sie mich nicht beurlauben, werde ich kündigen, oder ich melde mich krank.«
»Du bist total übergeschnappt. Aber im Grunde muss jeder selbst wissen, was er tut.«
Er hasste diesen Satz. Er hob alles zuvor Gesagte wieder auf. Wozu dann reden? »Jeder muss selbst wissen …« Es war der Ausdruck ihres zunehmenden Desinteresses. Seine Ideen passten nicht zu ihren Plänen. Sie hatte ihm die Laune gründlich verdorben.
Er sah ihr nach, wie sie die Treppe hinunterging, ein Lichtstrahl fiel aus dem Oberlicht auf Kopf und Schultern, das Letzte, das er von ihr sah, war der wippende Pferdeschwanz. Sie drehte sich nicht um. Wenn es nicht zu dieser Missstimmung gekommen wäre, hätte er gern gehabt, dass sie geblieben wäre. Aber jetzt war es ihm lieb, dass sie gegangen war. Wenn sie gut drauf war, sah sie blendend aus, konnte charmant und reizend sein, manchmal sogar witzig. Doch dann wieder empfand er ihr Verhalten als aufgesetzte, berechnende Freundlichkeit, einer ihrer pädagogischen Tricks zum Erreichen ihres Ziels. Das war nicht böse gemeint, sie war einfach so. Vielleicht klärte sich einiges, wenn er sich eine Weile aus dem Staub machte. Er ärgerte sich, dass ihr der Wein nicht gefallen hatte, dabei schmeckte er gut, kräftig und sehr würzig, wenn er sich ein Urteil erlauben konnte, keine dünne Lorke – ein Begriff, den Happe gern für billige Weine gebrauchte.
Nicolas hörte Sylvia unten im Treppenhaus, er wusste, welche Etage sie erreicht hatte, denn jede Stufe knarrte anders, er kannte sie alle und horchte auf ihren Schritt. Er erinnerte sich daran, wie sie das erste Mal heraufgekommen war, ganz außer Atem. Ob er sich nicht eine Wohnung nehmen könnte, für die man kein Himalaya-Training absolviert haben müsste, hatte sie ihn damals gefragt. Man sollte aufpassen, solange man noch nichts zu verlieren hat, dachte er.
Sie hatten sich auf einer Party getroffen, zu der ein Freund von Happe sie mitgeschleppt hatte. Nicolas hatte sich gelangweilt, die Musik reichte nur von Disco bis Techno, in der Küche war es noch am interessantesten gewesen, jeder kam mal vorbei. Er beobachtete, was die Gäste sich auf die Teller luden, wie sie aßen, was sie redeten, und Sylvia hatte da gestanden, in einem hellgrauen Kostüm, und lächelnd in die Runde geblickt. Ein schöner Anblick, nicht gepierct, nicht tätowiert, sie hatte nicht dazugehört. Er war erst kurz zuvor aus Holland zurück nach Berlin gekommen, und was er aus Rotterdam zu erzählen hatte, war für sie äußerst interessant gewesen. Den Eindruck hatte sie in der ersten Zeit zumindest erweckt. Sie war eine erotische Frau, das hatte ihn gereizt, auch dass sie recht geradlinig vorging, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Nur als sich ihre Geradlinigkeit auch auf ihn bezog und sie von Ehe sprach, hatte alles einen anderen Beigeschmack bekommen, und fortan hatte er sich nur bedrängt gefühlt.
Als die Haustür zufiel, ging er zurück in die Küche und begann mit den Vorbereitungen fürs Abendessen. Happe würde die Einladung nicht ausschlagen, zumal er ihm einen guten Wein vorsetzen würde. Da sagte er nie Nein. Als er zum Telefon ins Wohnzimmer ging, erinnerte er sich an eine Frage, die Sylvia aufgeworfen hatte: Weshalb hatte Friedrich gerade ihm das Weingut vermacht? Dafür musste es einen Grund geben. Den würde er allerdings nur am Rio Douro erfahren.
3.Abflug
Happe hatte sich freigenommen, um Nicolas zum Flughafen zu fahren. Man hatte Verständnis dafür, dass er sich um die Belange seines verstorbenen Onkels kümmern wollte, und ihm zwei Wochen unbezahlten Urlaub bewilligt. Sollte es sich als notwendig erweisen, könne er auch drei Wochen bleiben, was ihm deutlich machte, dass sie ihn im Grunde genommen nicht brauchten. Er erledigte Arbeiten, für die man weder studiert noch eine Postgraduierung absolviert haben musste.
Es war alles gesagt, das Für und Wider war nach allen Seiten hin abgewogen worden. Sylvia hatte schließlich, als Nicolas sich nicht von der Reise hatte abbringen lassen, ihren Widerstand aufgegeben und sich damit zufrieden gegeben, dass es ja »nur zum Eruieren« war, wie sie es ausgedrückt hatte. »Und bilde dir ja nicht ein, dass ich nachkomme.«
Kurz vor dem Funkturm gerieten Happe und Nicolas auf der Stadtautobahn in einen Stau. »Im Grunde bist du zu beneiden«, sagte Happe in die Stille, als er für einen Moment hielt und den Motor abstellte. »Bei der Hitze ist die Stadt kaum auszuhalten. Allerdings soll es am Douro noch schlimmer sein, im Hochsommer steigen die Temperaturen dort bis auf 45 Grad.«
»Was du alles weißt«, murmelte Nicolas und sah nervös auf die Uhr.
»Heute regnet es in Porto«, fuhr Happe fort. »Ich hab's aus dem Internet. Wirklich, zu beneiden bist du, ein Weingut geerbt. Wo was ist, kommt was hin, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Nun reg dich nicht gleich auf«, er winkte ab, als er merkte, wie Nicolas Luft holte, um zu protestieren. »Ich kenne deine Einstellung. Ich frage mich tatsächlich auch, ob ich umziehen soll, in irgendeine Kleinstadt. Da kennen sich die Leute, der Bäcker sagt noch Guten Morgen und die Zeitungsfrau auch, du kennst die Nachbarn, hast nicht den Stress mit dem Krach und Gestank, kannst die Fenster aufmachen und gut schlafen. Ich könnte einen Hund halten. Ich miete oder kaufe ein Haus mit Garten, wo die Äpfel nicht nach EU-Norm wachsen. Gartenarbeit ist besser als Fernsehen, ich sag's dir.«
»Und die Kultur?«