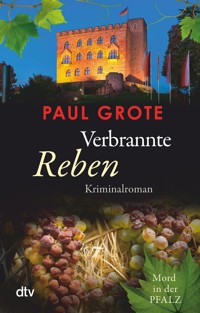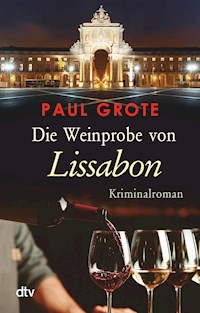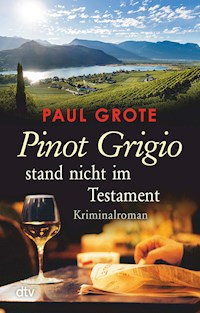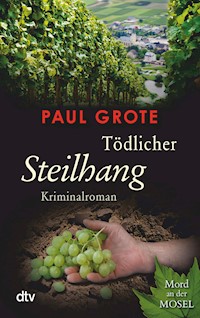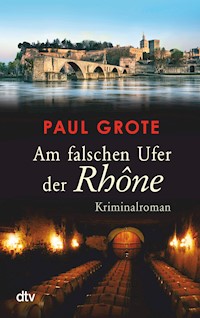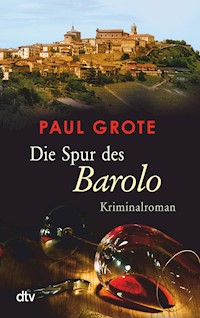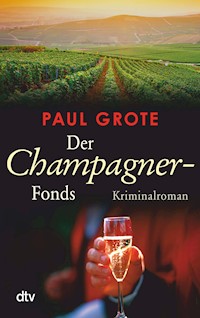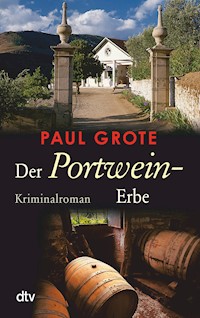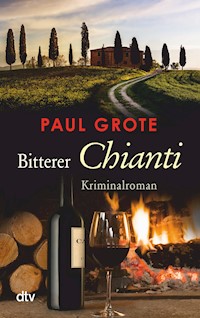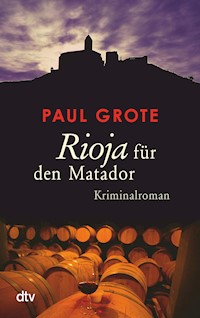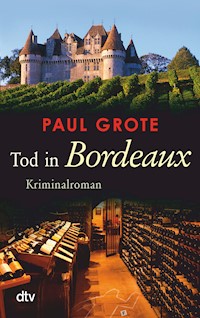
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Band 1 der erfolgreichen Weinkrimi-Reihe Martin Bongers ist erschüttert: Gestern erst hat er sich von seinem besten Freund, einem Winzer im Bordelais, verabschiedet, nun ist Gaston tot. Und der Wein, den Martin verkosten sollte, ist ihm auf seiner Rückreise nach Frankfurt gestohlen worden. Martin wird misstrauisch. Er muss zurück nach Frankreich, muss wissen, was mit Gaston geschehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Paul Grote
Tod in Bordeaux
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Überarbeitete Neuausgabe 2014
© 2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Der Band erschien erstmals 2004 im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg.
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Umschlagfotos: Corbis/Hans-Peter Siffert und Yutaka Imamura
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
eBook ISBN 978-3-423-42364-9 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21536-7
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Gewidmet Gaston Latroye aus Gurgy an der Yonne,
gefallen im Ersten Weltkrieg
1
»Wie lange sollen wir diese Geschäfte eigentlich noch weitermachen?« Gaston schob die Weinkiste auf die Ladefläche des Kombi und sah Martin vorwurfsvoll an, dann wandte er sich wieder der Garage zu, um die letzte Kiste zu holen.
»So lange es sich lohnt«, rief Martin ihm leichthin nach. »Weshalb fragst du?«
Es dauerte einen Moment, bis sein Freund wieder mit einer Kiste im Arm in der Tür erschien. »Weshalb ich frage? Weil ich mir Sorgen mache. Irgendwann fallen unsere kleinen Spielchen auf. Einer von deinen Konkurrenten kriegt Wind davon und verpfeift dich bei der Steuerfahndung. Da reicht ein anonymer Anruf …«
»Wieso interessiert dich das auf einmal? Das war dir doch bisher egal. Wir machen das seit Jahren so.«
»Eben darum«, knurrte Gaston, »und irgendwann fällt es auf.« Er stellte die Kiste mit einem Stöhnen zu den anderen auf die Ladefläche. Sie waren schwer, jede fasste zwölf Flaschen und wog mehr als fünfzehn Kilo. Aber harte körperliche Arbeit machte Gaston nichts aus, als Winzer war er daran gewöhnt.
»Weshalb machst du dir Sorgen, Gaston? Was ist los mit dir? Du bist irgendwie gereizt. Da steckt doch was anderes dahinter!« Kopfschüttelnd beobachtete Martin seinen Freund und fand, dass er seinem Blick auswich.
»Das siehst du falsch. Ich bin nicht gereizt!« Gaston strafte seine Worte Lügen und grummelte: »Du weißt nie, was dich erwartet.«
Martin verstand nichts mehr. Was war nur mit seinem Freund los? »Hast du schlecht geschlafen oder Zoff mit Caroline?« Er ging zum Heck seines Wagens und warf einen Blick auf die Kiste, die Gaston zuletzt gebracht hatte. Er betrachtete den aufgedruckten Schriftzug. »Haut-Bourton?« Nachdenklich blätterte er in seinen Rechnungen. »Habe ich nicht gekauft.«
»Den findest du auch nicht in den Papieren«, sagte Gaston hastig. »Ein … äußerst interessantes Gewächs. Ich möchte, dass du den Wein probierst, ganz in Ruhe, wenn du wieder in deinem Laden bist.«
Martin verstand das Benehmen seines Freundes immer weniger. »Ich kenne den 89er. Ich glaube, ich habe davon sogar noch was im Lager. Und wozu gleich zwölf?«
»Probier ihn einfach mal und vergleich ihn mit dem aus deinem Keller. Dann erkläre ich es dir.«
Gastons ruppiger Ton irritierte Martin. »Ist irgendwas passiert? Was ist los? Wir reden doch sonst über alles.«
Gaston machte eine wegwerfende Handbewegung. Er schob die Kisten auf der Ladefläche des Wagens zurecht, quetschte sich dabei die Finger und fluchte. Als die Kisten eine Fläche bildeten, breitete Gaston eine Decke darüber. Jetzt war nicht mehr zu erkennen, dass Bordeaux im Wert von etlichen tausend Euro darunter lag. Der Wagen hing nur auffällig schwer auf der Hinterachse. Er schlug die Heckklappe zu. »Du musst los, sonst kommst du heute nicht zurück. Caroline hätte sich gern verabschiedet, aber sie bringt die Kinder zur Schule.«
Gaston schloss die Garage ab, die ihm zugleich als Kellerei und Flaschenlager diente, und ging ins Wohnhaus. Einen Augenblick später kam er mit einer Einkaufstüte zurück und stellte sie hinter den Fahrersitz. »Das soll ich dir von Caroline geben, damit du nicht verhungerst.«
Die Männer umarmten sich, bei weitem nicht so herzlich wie sonst, und Martin hatte das Gefühl, dass Gaston ihn möglichst rasch loswerden wollte. »Sag Caroline ein Dankeschön und grüß die Kinder. Und was deinen Wein angeht – so gute Trauben wie in diesem Jahr hattest du noch nie. Ich bin sicher, der Pechant wird großartig.«
Martin zwängte sich umständlich hinters Lenkrad. Der Rücken schmerzte ihn schon jetzt so, als hätte er die tausend Kilometer Autobahn bereits hinter sich. Er blinzelte gegen die flach über den Weinbergen stehende Morgensonne. »Viel Glück mit dem Pechant, Gaston! Ich drücke dir die Daumen. Dieses Mal wird es ein 95-Punkte-Wein, falls du was drauf gibst.«
»Worauf du dich verlassen kannst. Ich werde die Rebstöcke jeden Tag küssen.«
Martin fuhr langsam an und hob grüßend die Hand. Er hatte ein ungutes Gefühl, seinen besten Freund in dieser Stimmung zurückzulassen, aber er konnte die Rückfahrt nach Deutschland nicht aufschieben. Das Überholen des Kühlaggregats und der Pumpen hatte länger gedauert, als sie gedacht hatten. Jetzt erwartete ihn sein Geschäft in Frankfurt.
Er bog in die Landstraße Richtung Saint-Émilion ein, ließ das ihm seit langem vertraute Dorf auf dem Hügel hinter sich und erreichte eine knappe Stunde später die Autobahn. Es herrschte wenig Verkehr, sodass er bereits mittags kurz vor Paris war, wo der Verkehr zunahm. Den Moloch an der Seine umfuhr er und nahm die A4 Richtung Reims.
»Mach Pause unterwegs, vergiss die Rückengymnastik nicht, rase nicht so, und nimm dir Zeit«, hatte Gaston ihn ermahnt. Doch Martin würde wie immer in einem Rutsch durchfahren. Da war er fast so störrisch wie sein Freund, der sich als kleiner Winzer in den Kopf gesetzt hatte, die Größen des Bordelais mit seinem Können herauszufordern.
Martin, dem jeder Ehrgeiz fremd war, bewunderte Gastons Courage. Er hatte deshalb nie den Versuch unternommen, ihm sein Vorhaben auszureden, im Gegenteil. Er zweifelte keinen Moment am Erfolg seines Freundes und unterstützte ihn, wo immer er konnte. Darum war er auch in Saint-Émilion gewesen: um Gaston bei den letzten Vorbereitungen für die Lese zu helfen.
Kurz nach Paris begann es zu regnen. Hoffentlich dehnte sich das Tief nicht bis nach Bordeaux aus! Das wäre eine Katastrophe, so kurz vor der Ernte. Martin hatte im September in Bordeaux schon Dauerregen der übelsten Sorte erlebt. Die Temperatur stürzte, und die Winzer des Bordelais rannten mit Angstschweiß auf der Stirn durch ihre Weinberge und rauften sich die Haare. Graue Schleier verhüllten an solchen Tagen die Gironde. War die Fähre zwischen Côtes du Bourg und dem Médoc in der Mitte des Flusses, konnte man auf keiner der beiden Seiten mehr Land sehen.
Bislang jedoch hatte sich das sonnige Wetter gehalten, und die Winzer fieberten steigenden Preisen entgegen. Der erste Merlot wurde bereits gelesen, er verlor die Fruchtigkeit, wenn er zu lange am Stock blieb. Doch Gastons Trauben hatten noch nicht ganz die richtige Reife erreicht, damit sein Pechant so wurde, wie er ihn sich vorstellte: voll, rund, dramatisch, weiches, süßes Tannin, eine seidige Struktur am Gaumen und mehr elegant als wuchtig. »Ein Wein, den man erst in zehn Jahren trinken darf und der dann noch fünfzig Jahre hält«, hatte er gestern Abend mit Martin gescherzt.
Gaston riskierte viel, besonders jetzt, da das Wetter unbeständig war und der nahe Atlantik seinen Einfluss geltend machte. Sie hatten lange über den Zeitpunkt für die Lese diskutiert, und Gaston war sich wie immer absolut sicher: »In fünf Tagen fange ich an, nächste Woche Dienstag, dann sind die Trauben richtig!«
Hinter Metz tankte Martin den Wagen auf, traktierte seinen Rücken mit Lockerungs- und Dehnübungen und trank in der Raststätte einen Kaffee im Stehen. Der Geruch von abgestandenem Essen vertrieb ihn aus dem Rasthof. Er schlenderte zurück zum Wagen. Schön, dass Caroline an ihn gedacht hatte. Das Erste, was er in dem Lunchpaket jedoch sah, waren zwei Flaschen Haut-Bourton. Schon wieder dieser Wein? Wozu zwei Flaschen, wenn hinten im Wagen eine volle Kiste lag?
Martin wischte den Gedanken beiseite und griff hungrig nach den mit verschiedenen Käsesorten belegten Baguettes. Der nussige Reblochon und der mit Bohnenkraut und rotem Pfeffer gewürzte Tomme de Pèbre gefielen ihm am besten. Mit Wehmut erinnerte er sich an Carolines Kochkünste. Von morgen an würde er wieder für sich selbst kochen müssen, Petra ging lieber essen. Er hob die Schokolade und das Obst für später auf und fädelte sich wieder in den Verkehr ein.
Im Rückspiegel sah er einen silbergrauen BMW aus der Auffahrt schießen. Er war so schnell, dass er Martin, der seinen Wagen nur langsam beschleunigen konnte, fast rammte. Der BMW raste vorbei, und Martin atmete auf. Gerade noch mal gut gegangen. So ein verdammter Idiot. Raser waren auf Frankreichs Autobahnen selten, in Deutschland würde es weit schlimmer werden. Um wie viel lieber wäre er jetzt in aller Ruhe statt nach Nordosten nach Süden gefahren, hinunter ans Mittelmeer – oder ins Piemont vielleicht? Die Brüder Giacosa besuchen, ihren hervorragenden Barolo kosten, dazu eine Rehkeule …
Die Wasserfahnen der vor ihm fahrenden Lastwagen zerrten an Martins Nerven, der Scheibenwischer fuhr mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms vor seinem Gesicht herum. Hoffentlich saugen sich Gastons Trauben nicht mit Wasser voll, dachte er unruhig, als er die Grenze nach Deutschland passierte. Gott sei Dank keine Kontrollen, ein vereintes Europa hatte viel für sich.
Da riss die Wolkendecke auf, und die Sonne warf ihre letzten Strahlen auf die Erde. Sie fielen auf einen Wald, entflammten ein namenloses Dorf und malten die Hügelkuppen golden. Die gebündelten Strahlen erinnerten ihn an mittelalterliche Altarbilder, wunderschön, aber unheimlich zugleich. Das rief Martin Gastons unverständliches Benehmen an diesem Morgen wieder ins Gedächtnis: Angespannt, gereizt und sogar aggressiv war er gewesen.
Die Wolkendecke schloss sich wieder, es wurde früh Nacht. Heute würde er die Strecke nicht schaffen, er war müde und der Wagen zu schwer. Fast eine halbe Tonne Wein transportierte er, Kisten mit klassifizierten Crus aus dem Médoc, aus Pauillac, Saint-Estèphe und Margaux und von der anderen Seite der Gironde, aus Canon-Fronsac, Pomerol und natürlich Saint-Émilion. Er hatte die Weine direkt von den Winzern gekauft – zu Freundschaftspreisen dank seiner jahrelangen Beziehungen und Gastons Hilfe. Es waren erste Gewächse, nur für Liebhaber. Sie bekamen einen fairen Preis, zahlten bar und fragten nie nach der Rechnung. Nur knapp ein Drittel davon stand auf seiner Transportliste. Deshalb hatte ihm Gaston am Morgen auch Vorwürfe gemacht.
Ab Saarbrücken nahm Martin die A6, aber als die Hügel begannen, verließ er die Autobahn. Es reichte ihm für heute. In einem menschenleeren Dorf flackerte ein Schild »Fremdenzimmer« an der Giebelwand eines Gasthofes. Er hielt und setzte den Wagen rückwärts so dicht an die Wand, dass niemand an die Heckklappe herankommen konnte, ließ das Lenkradschloss einrasten und kontrollierte trotz der Zentralverriegelung alle Türen.
Als er schwerfällig die von Geranien eingefasste Treppe zum Gasthof hinaufging, fuhr ein großer BMW auf der Dorfstraße langsam vorüber. War das nicht der Idiot, der ihn fast gerammt hätte? Ach, von diesem Wagentyp gab es Tausende.
Martin öffnete die Tür. Eine Theke mit runden Lämpchen darüber empfing ihn, rechts lag der spießig-gemütliche Gastraum mit ein paar Tischen, darauf gemusterte Decken und Vasen mit einsamen Blumen. Links vom Eingang blinkten die Lichter eines Spielautomaten wie Notsignale. Aus der Tür hinter dem Tresen trat eine Frau, wischte sich die Hände an der Kittelschürze ab und musterte Martin stumm von oben bis unten. Mit dem zerzausten Haar, dem Dreitagebart und der abgewetzten Lederjacke sah er weder wie ein Vertreter noch wie ein Tourist aus.
»Haben Sie ein Zimmer – und vielleicht was zu essen?«
»Eigentlich ist die Küche geschlossen. Aber wenn’s sein muss …« Die Frau blätterte im Gästebuch. »103 ist frei, erster Stock, 35 Euro mit Frühstück.« Sie gab Martin den Schlüssel. »Gepäck?« Sie runzelte die Stirn.
»Doch, doch. Im Wagen, ich hol’s gleich«, sagte Martin entschuldigend. »Haben Sie eine Garage?«
»Nein, aber wenn es Sie beruhigt, dann stellen Sie den Wagen auf den Hof. Wir schließen abends das Tor ab, da kann keiner rein.«
Die ausgetretene Treppe hinauf in den ersten Stock knarrte entsetzlich, das Zimmer jedoch war passabel, und als die Wirtin ihm später Salat mit Putenfleisch vorsetzte, entspannte er sich. Nur der Balsamico-Essig schmeckte unecht. Das Geschnetzelte mit den hausgemachten Spätzle war ausgezeichnet, das frische Pils nach dem vielen Wein eine Wohltat und der Kaffee stark genug. Jetzt nur noch ein wenig frische Luft, und er würde gut schlafen können.
Martin trat auf die Straße. Es war kalt geworden, und Feuchtigkeit wehte in dicken Schwaden von den Wiesen herüber. Der Herbst kündigte sich an. Er schlenderte durch das vereinsamte Dorf und bekam den Kopf wieder frei. Ein ferner Lichtpunkt zog ihn magisch an, das Schaufenster einer Apotheke. Das riesige Foto einer strahlend schönen und endlich von Kopfschmerzen befreiten Frau lächelte ihn an; sie erinnerte ihn an Petra.
Er hatte das Handy nicht eingeschaltet, um sich zumindest heute noch den Alltag vom Hals zu halten. Sollte er Petra jetzt anrufen? Er zögerte und betrachtete die Frau im Schaufenster. Wovon könnte er ihr erzählen? Von langen Spaziergängen mit Gaston und ihren Gesprächen über Setzlinge und Rebschnitt? Oder von Fassproben in kleinen, kalten Gewölben? Das waren nicht ihre Themen. Sie träumte von den gewaltigen Kellern der großen Châteaus mit der feierlichen Atmosphäre von Kirchen, in denen man beim Hall der eigenen Schritte erschrak.
Petra mochte Gaston nicht. Er gehörte nicht zu den Menschen, von denen sie sich etwas versprach. Sie hätte Martin lieber in Gesellschaft der Besitzer von Château Cheval Blanc oder Latour gesehen. Dass Gaston auf dem besten Wege war, sich einen Namen zu machen, ließ sie kalt. Für Caroline empfand sie Mitleid; die Ärmste hatte schmutzige Fingernägel und stapfte in Gummistiefeln herum.
Umgekehrt war es nicht viel anders. Gaston nannte Petra, die stets blendend aussah, la pimbêche, die eingebildete Pute, und damit war von seiner Seite aus alles gesagt. Ihr gegenüber blieb er jedoch höflich und zuvorkommend, sie war schließlich die Freundin seines Freundes.
Martin kehrte um und ging zum Gasthaus zurück. Heute würde er Petra nicht mehr anrufen, das hatte Zeit bis morgen.
Das Tor war noch offen, und er stellte den Wagen in den Hof, nahm den Koffer, kontrollierte alle Wagentüren und ließ sich in der Schankstube eine Flasche Wasser geben. Durch die Vorhänge drang das Flackern des Leuchtschildes ins Zimmer und ließ ihn lange nicht einschlafen. Er fragte sich, weshalb Gaston ihm den Haut-Bourton aufgedrängt hatte. Gut, er würde ihn morgen probieren, und Gaston würde sich wieder beruhigen.
Mitten in der Nacht wachte Martin schweißgebadet auf. Eine Autotür wurde zugeschlagen, ein Wagen fuhr an. Es war stickig im Raum. Schlaftrunken stieß er das Fenster auf und sah zwei Rücklichter im Nebel verschwinden. Er wusch sich das Gesicht, trank etwas und legte sich wieder hin.
Zum Frühstück gab es Eier von den Hühnern, die auf dem Hof herumliefen, Wurst aus eigener Schlachtung und selbst eingekochte Marmelade. »Die macht unsere Oma«, sagte die Wirtin, ein wenig freundlicher als gestern. Martin zahlte und ging auf den Hof.
Als er den Knopf der Zentralverriegelung drückte, passierte nichts. Er versuchte es noch einmal – keine Reaktion. Martin hielt die Luft an, mit wenigen Schritten war er am Wagen. Was war los? Die Heckklappe war unten eingebeult und stand offen. Die Decke über den Kisten hing durch. Schlimmes ahnend schlug Martin sie zurück. Es war, wie er befürchtet hatte: Eine 12er-Kiste fehlte. Hoffentlich nicht die teuerste, 250 Euro die Flasche, das wäre bitter. Bei diesen Geschäften an der Steuer vorbei war nur das versichert, wofür er die Rechnung vorlegen konnte. Alle anderen Weine, so nebenbei abgefüllt, gab es offiziell nicht. Ich Narr, dachte er, wieso habe ich den Wagen nicht rückwärts ganz an die Wand gesetzt? Und die Wirtin hatte gelogen und den Hof nicht abgeschlossen.
Mit fliegenden Fingern zerrte er die Frachtpapiere aus der Aktenmappe, schob die Kisten hin und her und verglich die Namen mit denen auf seinen Listen. Seine Rückenschmerzen vergaß er. Nein, von den offiziellen Weinen fehlte keiner. Wahrscheinlich einer von den »inoffiziellen«, wie er sie nannte. So eine Scheiße!
Es waren dreimal drei Kisten gewesen, genau in drei Lagen übereinander, damit beim Bremsen nichts verrutschte. Martin stutzte. Der Haut-Bourton?
Er lehnte sich an den Wagen. Ausgerechnet der Wein, den Gaston ihm zum Probieren gegeben hatte! Dabei hatte er ihm erst beigebracht, seine Nase richtig zu benutzen. Gaston hatte ihn zu Verkostungen auf Châteaus und Versteigerungen mitgenommen, in die Keller anderer Winzer geschleppt, so lange mit ihm seine eigenen Weine in den unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung probiert, bis Martin fast jedes Fass auseinanderhalten konnte. Gaston hatte ihn gebeten, den Haut-Bourton zu probieren – und er hatte ihn sich klauen lassen. Jetzt konnte er Gastons Wunsch nicht mehr erfüllen. Obwohl – was war mit den Flaschen im Lunchpaket? Er atmete auf, als er sah, dass sie unberührt hinter dem Fahrersitz standen.
Aufgeregt tippte er Gastons Nummer in das Handy. Leider antwortete ihm nur die Mailbox, die ihm empfahl, eine Nachricht zu hinterlassen, was er tat.
Außer Gaston wusste niemand, was er geladen hatte. Also war es kein geplanter Diebstahl. Jemand hatte die Gelegenheit genutzt, vielleicht Leute aus dem Dorf? Die Wirtin hatte bestimmt nichts gehört und würde bei allen Heiligen schwören, den Hof abgeschlossen zu haben. Sicher waren die Diebe gestört worden und hatten nur diese eine Kiste mitnehmen können. Oder wollten sie die gesamte Ladung rauben und konnten den Wagen nicht starten? Aber am Zündschloss fanden sich keine Spuren.
Was war der Haut-Bourton wohl wert? Ein bekannter Deuxième Cru würde nicht billig sein, bestimmt so an die hundert Euro pro Flasche. Das waren – 1200 Euro. Die Polizei musste er aus dem Spiel lassen, er würde sich selbst in Gefahr bringen, und das Finanzamt würde ihm auf die Schliche kommen. Wozu also hier noch länger herumstehen und sich selbst blöde Fragen stellen?, dachte Martin grimmig. Außerdem begann es wieder zu regnen. Er besorgte sich einen Strick, um die Heckklappe zu befestigen, und setzte mit zusammengebissenen Zähnen seine Heimreise fort.
An diesem Freitag war die Autobahn so voll wie immer, zu allem Unglück goss es wie aus Kübeln. Für die letzten fünfzig Kilometer nach Frankfurt benötigte er fast anderthalb Stunden – eine Strapaze, bei der er den Diebstahl vergaß. Erst als er unter dem Torbogen auf den Hof seines Weinhandels einbog, erinnerte er sich wieder daran.
Frau Schnor kam freudestrahlend auf ihn zu, die Erleichterung, jetzt nicht mehr die gesamte Verantwortung fürs Geschäft tragen zu müssen, war ihr ins Gesicht geschrieben. Sie half seit Jahren, kannte sich aus und hielt während Martins Reisen die Stellung. Er konnte beruhigt nach Italien oder Spanien fahren und sich sogar Zeit dabei lassen. Frau Schnor ertrug seine Launen, wenn er sich über schlechte Weine oder Preiserhöhungen ärgerte, sie wimmelte Vertreter ab und beschwichtigte übellaunige Kunden.
»Jede Menge Bestellungen, Herr Bongers, alles notiert.« Mit diesen Worten reichte sie Martin eine Liste der Weine, die heute ausgeliefert werden mussten. »Sie müssen selbst fahren, Klüsters ist krank«, fügte sie seufzend hinzu. »Unser Fahrer hat mal wieder Grippe. Er markiert nicht, er hörte sich tatsächlich verschnupft an. Aber ich habe Hilfe für Sie.«
Kaum zu Hause, geht der Ärger wieder los, dachte Martin. Er hatte Klüsters extra für schwere Arbeiten eingestellt, um seinen Rücken zu schonen. Der Mann hatte Kräfte wie ein Pferd, schleppte 24 Flaschen mühelos die Kellertreppe rauf und zerbrach nicht eine. Doch seine Körperkraft stand in direktem Verhältnis zu seiner Sensibilität. Ein unbedachtes Wort, und er war für Tage unauffindbar.
Der Ersatzmann war jung und kam aus der Teppichhandlung gegenüber. Gemeinsam luden sie die mitgebrachten Weine aus und packten die Bestellungen für Restaurants und Privatkunden in der Reihenfolge ihrer Auslieferung. Martin ging ins Büro, um einen Termin mit der Werkstatt zu machen. Er durfte den Wagen unmöglich offen stehen lassen. Auf seinem Schreibtisch stapelte sich Post, Arbeit für ein langes Wochenende, falls Petra ihn nicht davon abhielt. Er griff zum Telefon, aber statt sie anzurufen, wählte er Gastons Nummer. Diesmal hinterließ er keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Als er kurz vor Geschäftsschluss von der Tour zurückkam, war der Laden brechend voll. Noch ehe Martin den ersten Kunden bedienen konnte, nahm Frau Schnor ihn beiseite: »Ihre Freundin hat angerufen. Sie hat keine Zeit, sie muss mit einem Kunden, wie sie sagte, essen gehen. Neue Geschäfte und so.«
Das gespannte Verhältnis zwischen Martin und Petra war Frau Schnor nicht entgangen, und sie sah ihn mitleidig an. »Sie möchten morgen bitte anrufen, am Wochenende hätte sie Zeit.«
Martin atmete auf. Die Abende mit Petra waren in den letzten Monaten selten amüsant gewesen, ein klärendes Gespräch stand an, womöglich das letzte. Nun gut, auf diese Weise konnte er in die Sauna gehen und anschließend zum Masseur, sein Rücken hatte es verdient. Auf jeden Fall besser, als den Abend in einem öden Szene-Restaurant unter Selbstdarstellern zu verbringen. Doch es beunruhigte ihn, dass sich in Saint-Émilion niemand meldete.
Um diese Zeit kochte Caroline normalerweise, die Kinder tobten durchs Haus oder wühlten im Garten herum. Später saßen alle zusammen in der Küche bei einem guten Wein und diskutierten angeregt über Gott und die Welt. Bei Gaston und Caroline fühlte Martin sich zu Hause, sie waren die Familie, die er so gerne gehabt hätte. Zu seinen eigenen Eltern hatte er nur sehr wenig Kontakt.
Sein Vater war nie ein Familienmensch gewesen, er verkaufte der Welt lieber Maschinen. Seine Mutter gab die Gewinnbeteiligung aus und war mit Bridge-Freundinnen und Tennisplatz vollauf beschäftigt. Ihre Hunde waren ihr wichtiger als die Kinder. Die Bestien spürten Martins Abneigung und lagen knurrend unter dem Tisch, wenn er zu Besuch kam. Er versuchte sie zu bestechen, aber sie schnappten eher nach seiner Hand als nach den Brocken, die er ihnen zuwarf.
Die Gleichgültigkeit seiner Eltern hatte ihm viel Bewegungsfreiheit gelassen. Für seine Freunde und für seine Langstreckenläufe hatten sie sich genauso wenig interessiert wie für seine erste Freundin. Schule und Studium hatte er mühelos hinter sich gebracht, und wenn er Geld brauchte, hatte er es bekommen.
Seine Schwester hatte den ihr vorgezeichneten Weg beschritten und einen Banker geheiratet, der ihr den gleichen Luxus bot, den ihre Mutter genoss. Der Ehemann war ein Langweiler, ihn bewegten Geld, die Börse und der »Tom Jones Index«, womit Martin ihn immer wieder provozieren konnte. Und Petra? Eigentlich war sie genauso. Äußerlichkeiten zählten viel für sie, enorm viel. Deshalb war sie auch keine Frau zum Heiraten.
Der letzte Kunde verließ das Geschäft, Frau Schnor ging nach Hause, Martin machte Kasse. Die Einnahmen waren ausgezeichnet, auch die der letzten Wochen, obwohl die Konjunktur alles andere als rosig war. Ein gutes Omen für den Winter. Erleichtert steckte er Schecks und Bargeld in die Geldbombe, um sie in den Nachttresor zu werfen. Sein Blick fiel auf die Papiertüte mit den Haut-Bourton-Flaschen. Jetzt hatte er Zeit, den Wein zu probieren. Hatte er den 89er-Jahrgang eigentlich noch im Keller?
Er trat auf den Hof und stieg die Treppe zum Gewölbekeller hinunter. Er stammte aus der Zeit, als das Anwesen noch ein Bauernhof gewesen war und außerhalb der Stadt gelegen hatte. Das Klima war ideal zur Lagerung von Wein: Die Luftfeuchtigkeit war relativ hoch, und die Temperatur blieb das ganze Jahr über konstant. Hier lagen seine besten Gewächse. Die Stahltür am Fuß der Treppe hatte er einbauen und mit drei Schlössern sichern lassen, die in einer bestimmten Reihenfolge geöffnet werden mussten. Anderenfalls heulte die Alarmanlage.
Martin hielt sich gern im Keller auf, den er seine »Schatzkammer« nannte. Die Flaschen stapelten sich in schmalen, gemauerten Regalfächern bis unter die Decke, das Licht war warm und weich, und kein Laut der Außenwelt drang hierher. In der Mitte des Raumes standen ein grober Tisch mit gescheuerter Platte und drei Stühle. Heute blieb ihm keine Zeit, die Stille zu genießen, denn was er nicht gleich morgen ausliefern würde, musste eingeräumt werden.
Martin fand die Kiste Haut-Bourton oben in einem Fach – die verschnörkelten Buchstaben und das Wappen des Château vom Prägestempel tief ins Holz gedrückt. Er brauchte eine Leiter, um heranzukommen, und nahm den Deckel ab. Genau der Jahrgang, den Gaston ihm gegeben hatte. Diese Kiste hatte er völlig vergessen, der Wein musste seit Jahren hier liegen, genug gealtert, um ihn jetzt zu trinken. Sieben Flaschen waren übrig.
Er kannte ihn und hatte ihn so gut verkauft wie auch andere Crus. Der Jahrgang 1989 würde kaum noch aufzutreiben sein, und wenn, dann nur zu einem horrenden Preis. Weshalb sollte er ihn dann probieren? Aber wenn Gaston ihn um etwas bat, gab es immer einen triftigen Grund.
Martin klemmte sich eine Flasche unter den Arm und verließ den Keller. Er stieg die Treppe hinauf, und als er die Tür öffnete, riss der Sturm sie ihm aus der Hand. Regen peitschte ihm ins Gesicht, und Böen trieben Blätter über den Hof. Erleichtert atmete er auf, als er wieder im Laden war. Draußen jaulte der Wind, und eine diffuse Unruhe ergriff ihn – anders als die angenehme Spannung, die er normalerweise beim Verkosten großer Gewächse empfand.
Er kennzeichnete die Flasche, die er von Gaston bekommen hatte, und verglich die Etiketten. Ein Unterschied ließ sich nicht feststellen, und wie üblich schrieb er das Datum der Verkostung aufs Etikett. Als er Gastons Haut-Bourton öffnete, kam es ihm vor, als wäre der Flaschenhals rauer, aber das waren Unregelmäßigkeiten, die in der Produktion von Glas immer vorkamen.
Er dekantierte den Wein, jeden für sich, ließ ihn langsam an der Innenseite der Karaffen hinunterlaufen, damit er möglichst viel Luft zog und oxidierte. Die bauchigen Bordeaux-Gläser waren zum Verkosten dieses Weins am besten geeignet. Martin schnüffelte daran und war zufrieden, sie rochen weder nach Handtuch noch nach Spülmittel. Er schenkte den Wein zwei Finger breit in jedes Glas und setzte sich.
Der Wein war von einem tiefen dunklen Rot, beinahe tintenfarben und undurchsichtig. Von der Farbe her waren beide identisch, nein, nicht ganz, wenn er genau hinsah. Der aus seinem Keller erschien ihm dichter und hatte eine leichte Braunfärbung am Rand, was er weniger dem Alter als dem Licht im Büro zuschrieb. Martin schürzte die Lippen, steckte die Nase tief in das Glas mit dem Wein, den Gaston ihm mitgegeben hatte, schloss die Augen und atmete tief ein – und wartete, was in seinem Kopf passieren würde.
Zuerst stellte sich ein Gefühl von Wärme ein, dann Aromen von schwarzen Johannisbeeren, Backpflaume, Schokolade, ein wenig Leder roch er heraus und – Teer? Nein, aber etwas Chemisches, ganz weit hinten, Gummi vielleicht? Dazu kamen wie üblich Nelke und Vanille vom Ausbau im Eichenholzfass und Karamell – eher zu scharf, wie von amerikanischen Eichenfässern und nicht von französischen. Dabei verwendete Haut-Bourton angeblich kein amerikanisches Barrique, sondern Allier-Eiche. Eigentlich hätte dieser Duft beim Alter des Weins längst vergehen müssen. Dann schnupperte er in das Glas mit dem Wein aus seinem Keller.
Eindeutig besser, dachte Martin verwundert, ganz klar. Zu dumm, ich hätte die Weine blind verkosten sollen. Ich werde es morgen wiederholen, das geht, dann sind beide Flaschen gleich lange offen, oder ich probiere es mit der zweiten Flasche. Wieder sog er die Luft ein. Sein Wein war stärker in der Frucht und schwächer im Holz. Bei dem von Gaston war es umgekehrt, obwohl sonst alle Aromen vorhanden waren, doch nicht so ausgeprägt. Kaum möglich, dass das ein und derselbe Jahrgang war, dass beide dieselbe Zeit im Barrique verbracht hatten. Sie konnten allerdings aus verschiedenen Abfüllungen stammen, denn auf der Flasche hätten sie sich kaum so unterschiedlich entwickelt.
Martin ließ den Wein über die Zunge laufen, bewegte ihn im Mund, er kaute ihn, öffnete die Lippen ein wenig, um Luft einzusaugen, und schnatterte wie eine Ente. Da war etwas Unausgegorenes. Er schloss die Augen und spürte in sich hinein. Es gab einen Unterschied, minimal zwar, aber doch vorhanden. Er probierte von neuem, und der Unterschied wurde ihm bewusster. Gastons Haut-Bourton war vom Tannin her härter, rauer, fühlte sich am Gaumen anders an, die Gerbsäure hatte eine andere Textur. Und die Säure? Auch sie war anders, spitzer, irgendwie jünger? Das Verhältnis von Süße und Säure stimmte halbwegs überein und schien ihm doch bei beiden Weinen anders. Und der Körper? Gastons Wein wirkte nicht so voll und gesetzt. Die Unterschiede waren minimal, winzige Nuancen – gleichzeitig so deutlich und vielschichtig, dass es nicht nur an der unterschiedlichen Entwicklung liegen konnte. Die chemische Note bei Gastons Haut-Bourton hätte nicht sein dürfen, denn ein Gärfehler hätte sich auf den gesamten Wein ausgewirkt. Ein unsauberes Fass? Nein, das war es nicht. Plötzlich wurde es ihm klar.
Er fuhr wie elektrisiert auf und starrte die beiden Gläser an. Das konnte nicht derselbe Wein sein. In der Flasche, die er mitgebracht hatte, war etwas anderes.
Martin griff nach dem Telefon und wählte Gastons Nummer. Es dauerte eine Weile, bis sich eine Männerstimme meldete.
»Gaston? Bist du es?«, fragte Martin erstaunt.
»Nein, hier ist, äh … sein, sein Schwager. Wer spricht, bitte?«
»Martin, aus Deutschland.«
»Wer sind Sie?«
»Martin Bongers, du musst mich doch kennen, ich bin der Weinhändler aus Frankfurt. Kann ich Gaston sprechen – oder Caroline?«
Der Mann am anderen Ende zögerte. »Das … das geht leider nicht, das ist, äh, unmöglich …«
»Warum? Ist er in der Garage?«
»Nein. Gaston Latroye, ähm, er hatte gestern einen Unfall im Lager. Ein Stapel Paletten ist umgefallen …«, stammelte der Schwager. Er schien nach Worten zu suchen. »Gaston … ist tot!«
2
Martin ließ den Hörer fallen. Gaston – tot? Nein. Das konnte nicht wahr sein. Oder doch? Wenn der Schwager es sagte? Martins Blick blieb an dem gerahmten Foto auf seinem Schreibtisch hängen: Gastons Haus in Saint-Émilion. Links der kleine Hof, daran anschließend die zum Gärkeller umgebaute Garage. Mit der darüber aufgeschütteten Erde, die das ganze Jahr über die Temperatur niedrig hielt, erinnerte die Konstruktion an eine Nissenhütte, die Büsche darauf an einen Begrünungsversuch von Friedensreich Hundertwasser. Gastons Weinberg, mehr ein Hang als ein Berg, begann direkt hinter dem Haus. Das warme Licht des späten Sommertags strich über die Rebstöcke.
Martin hatte die Aufnahme gemacht, kurz nachdem Gaston das Haus gekauft und sie es zusammen renoviert hatten. Der Sandstein leuchtete, die hohen Fenster mit den hellgrauen Läden wirkten ein wenig zu großbürgerlich, oben rechts war das Zimmer, in dem er bei seinen Besuchen wohnte. Erst vorgestern war er dort aufgewacht.
Vorgestern? Mein Gott, war das lange her. Wie schnell doch der Tod Zeiträume verändert, dachte Martin. In jenem Haus hatte er sich wohlgefühlt, dort hatten sie die Taufen der Kinder gefeiert, die gelungenen Ernten und sich dabei mit Gastons Weinen ordentlich betrunken. Und jetzt war nichts mehr wie vorher.
»Du weißt nie, was dich erwartet.« Genau das hatte Gaston vorgestern Morgen gesagt. Was in aller Welt hatte er damit gemeint? Martin wehrte sich gegen den Gedanken, dass er es nie erfahren würde.
Geistesabwesend zog er ein Weinglas heran, beugte den Kopf darüber und schnüffelte, ohne etwas zu riechen, starrte hinein, ohne den Wein zu sehen, schwenkte es langsam – dann immer schneller. Rote Reflexe huschten über seinen Handrücken. Als der Wein überschwappte und sich über den Schreibtisch ergoss, kam er zu sich. Die nassen Flecken sahen aus wie Blut.
Gaston war tot, sein Leben vorbei, es gab ihn nicht mehr, nur eine unfassbare Leere, die Erinnerung an ihn und die Frage, wie es weiterging. Der einzige Mensch, vor dem er keine Geheimnisse hatte, mit dem er alles besprechen konnte, nein, jetzt nicht mehr, war von Paletten zerquetscht, wie der Schwager gesagt hatte. Was für ein grauenvoller Tod. Welcher Schwager überhaupt? Carolines Bruder? Caroline hatte doch nur eine Schwester, die in Schweden lebte, oder?
Sie wird Hilfe brauchen, jetzt, da Gaston … Die zwei hatten wunderbar zusammengepasst, bis auf die üblichen kleinen Reibereien. Sie liebten sich, nein, mehr als das, sie litten, wenn sie sich einen Tag lang nicht sahen. Jetzt war Caroline Witwe. Grausig, dieses Wort. Klein war sie, eine südfranzösische Schönheit, wache Augen, römische Nase, ein feiner, klar gezeichneter Mund, drahtig und agil, voller Lebenslust und Energie. Ein Glücksfall. Sie hatte Gaston zu nehmen gewusst, seine Marotten, seinen Dickkopf und sein Einzelgängertum. So eine Frau hätte Martin sich gewünscht, und er seufzte bei dem Gedanken an Petra.
Im Sommer erst waren Caroline und Gaston übereingekommen, aus Bordeaux wegzugehen, nicht gleich, aber in absehbarer Zukunft, zurück nach Saint-Chinian, von wo sie gekommen waren, weit weg vom Neid und der Eitelkeit des Bordelais. Gaston hatte erst nach langen Debatten zugestimmt, denn es hatte ihn immerhin zehn Jahre gekostet, sich hier einen Namen zu machen. Doch der größte Erfolg konnte das Gefühl, nicht willkommen zu sein, kaum aufwiegen.
Carolines Wesen war ihrer Integration nicht gerade förderlich. Sie hatte keine Freude am Repräsentieren. Sie mied die großen Diners in festlichem Rahmen, wich den blasierten Spinnern aus, wie sie die Chefs der großen Châteaus nannte. Lieber träumte sie vom Himmel Saint-Chinians, von seinem »Blau zum Reinfallen«, von den endlosen Weinbergen und mittelalterlichen Dörfern, vom Horizont mit Raum zum Atmen. Dorthin wollte sie zurück, ihrer Liebe wegen, die in Bordeaux vor die Hunde gehen würde. Das war ihr wichtiger als der Wein, der seit zwei Jahren endlich den nötigen Gewinn abwarf, um die Kredite zu tilgen.
»Wenn alles bezahlt ist, gehen wir«, hatte sie an Martins letztem Abend zu ihm gesagt. »Gaston ist einverstanden. Wir werden Syrah anbauen, Grenache und Mourvedre, die Rebsorten, die dort zur Erde passen, und nicht Merlot wie hier. Vielleicht ein bisschen Cabernet, nur ein wenig, um interessante Cuvées zu machen.« Und ihre Augen hatten bei diesen Worten gestrahlt.
Martin rannen Tränen übers Gesicht. Er konnte es noch immer nicht fassen. Mühsam erhob er sich, um sich die Hände zu waschen und den Wein vom Schreibtisch zu wischen. Als er sich später in seiner Wohnung verkroch, versuchte er eine Antwort auf die Frage zu finden, weshalb Gaston ihm diesen Haut-Bourton aufgedrängt hatte. Wozu die Geheimniskrämerei?
Am nächsten Abend holte Petra Martin ab, und gemeinsam fuhren sie ins »Romolo«, ihr Lieblingsrestaurant. Sie ging vor und öffnete wie üblich die Tür. »Wie ist es zu dem Unfall gekommen?«, fragte sie über die Schulter und sah sich nach dem reservierten Tisch um. Der Inhaber begrüßte Petra persönlich mit Küsschen auf beide Wangen und brachte sie zu ihrem Tisch. Petra genoss die Aufmerksamkeit.
Martin wäre lieber zu Hause geblieben, er war niedergeschlagen, traurig, enttäuscht und sogar wütend. So vieles würde ihm von jetzt an fehlen. Wieso brachten es die größten Lumpen bis in die Achtziger und anständige Menschen nur bis knapp vierzig?
»Wer wird älter«, fragte er Petra unvermittelt, »die guten Menschen oder die schlechten?«
»Darauf kommt es nicht an. Die Frage ist, ob jemand schlau ist oder dumm. Die Schlauen leben länger. Aber sag, wie kam es zu dem Unfall?«
Demnach hielt sie Gaston für dumm? »Mehr als das, was der Schwager erzählt hat, weiß ich auch nicht«, sagte Martin verstimmt, »und Caroline habe ich nicht erreicht. Gaston war sowieso sehr komisch an dem Morgen, als ich abgefahren bin, bedrückt und ärgerlich, als wenn ihn irgendetwas quälte …«
»Und was meint Caroline?«
»Ich habe dir gerade erklärt, dass ich nur mit dem Schwager gesprochen habe.« Nur mit Mühe unterdrückte Martin seinen Unmut. »Ich nehme an, dass sie bei ihren Eltern ist.«
»Wann wird die Beerdigung sein?« Petra kam immer schnell zum Praktischen, damit konnte sie umgehen. Gefühlsduseleien, wie sie es nannte, waren ihr ein Gräuel.
»Woher soll ich das wissen?«
»Ist sie versorgt? Hatte Gaston eine Lebensversicherung?«
Martin schüttelte unwillig den Kopf. »Woran du jetzt denken kannst.« Er selbst hatte nicht einmal begriffen, dass Gaston nicht mehr da sein würde. Alles, was er bislang mit ihm zusammen gemacht hatte, musste er in Zukunft alleine tun. Und das war viel.
Sie hatten sich vor über zehn Jahren in der Provence kennengelernt, es war kurz nach Martins siebenundzwanzigstem Geburtstag gewesen, er hatte dort seinen Urlaub verbracht und an einem irrsinnig heißen Tag eine Panne gehabt. Er hatte hilflos neben dem Wagen gestanden, sein Studium als Maschinenbauer half ihm auch nicht weiter, denn die Benzinpumpe war kaputt, und weit und breit war kein Mensch zu sehen. Er betrachtete die Umgebung, und sein Blick fiel auf Rosen am Rande eines Weingartens, und er wunderte sich, wie jemand auf die Idee kam, in dieser Einöde Rosen zu züchten.
Aus dem Flimmern über der Chaussee löste sich ein Fahrzeug, Martin hob den Arm, der verbeulte Kastenwagen hielt tatsächlich, und ein gut gelaunter Franzose in seinem Alter bot seine Hilfe an. Mit Händen und Füßen erklärte er ihm, was es mit den Rosen auf sich hatte. An ihnen zeigten sich Schädlinge und Pilze, noch bevor sie den Wein befielen.
Den kaputten Wagen schleppte Gaston zu dem Winzer, bei dem er damals arbeitete. Im Haus war Platz, und weil Martin einige Tage auf die Benzinpumpe warten musste, blieb er. Gaston führte ihn in den Weinbau ein, eine lebendige Welt im Gegensatz zu seinem Job als Konstrukteur am Rechner. Martin entdeckte hier seine Gabe, Düfte wahrzunehmen, Weine zu riechen, sie zu unterscheiden und sich auch später noch an sie zu erinnern.
Von dieser Reise brachte er eine Auswahl von Weinen der Provence mit, verschenkte sie, bestellte nach, besorgte neue für Freunde und Kollegen und legte sein erstes Weinlager im Keller seiner Wohnung an. Je mehr der Wein ihn interessierte, desto langweiliger empfand er seinen Job, der sich eben so ergeben hatte – wie so vieles in seinem Leben.
Er machte Fehler bei der Arbeit, war unkonzentriert und zeigte wenig Interesse, bis eines Tages sein Chef ihn zu sich rief: »Man ist nur bei dem gut, was man wirklich gern tut.« Deutlicher hätte er sich kaum ausdrücken können.
Die ersten Jahre im Weinhandel waren alles andere als ein Vergnügen. Die kaufmännische Seite lag Martin wenig. Später verdiente er gut, aber je besser das Geschäft lief, desto mehr kassierte das Finanzamt. Das ergab wenig Sinn. Also beschränkte er den Umsatz auf ein gesundes Maß und half Gaston lieber beim Anlegen des Weinbergs in Saint-Émilion. Dabei lernte er die Beschaffenheit des Bodens zu beurteilen und pflanzte mit ihm die ersten Rebstöcke. Bei seinen häufigen Aufenthalten im Bordelais knüpfte er Kontakte zu Winzern auf beiden Seiten der Gironde und in Entre-Deux-Mers. Die ersten kleinen Geschäfte mit nicht registrierten Weinen entwickelten sich dabei fast von allein, und Martin entdeckte, dass sich davon gut leben ließ.
In letzter Zeit jedoch hatte sich die Lage geändert. Die Börse trudelte, Vermögen verschwanden, Firmenkunden verzichteten auf Präsente, und Unternehmer, die zu seinen besten Kunden gehört hatten, wurden arbeitslos. Das Geld wurde knapper. Billigangebote mit einer spanischen Reserva oder einem Cru Bourgeoise für 4,99 Euro hatten Konjunktur. Martin war es ein Rätsel, wie man das grauenhafte Zeug trinken konnte.
»Du hörst mir nicht zu«, sagte Petra ärgerlich und blickte von der Speisekarte auf. »Stell dich der Realität. Du siehst wie immer an den Fakten vorbei. Gaston ist tot! Es ist traurig für dich, für seine Frau, aber ändern kann niemand mehr etwas, nur sich damit abfinden. Reiß dich zusammen, du siehst aus wie ein geprügelter Hund.«
So fühlte Martin sich auch. Von Mitgefühl keine Spur, dachte er bitter. Normalerweise rappelte er sich nach einer Katastrophe schnell wieder auf, Selbstmitleid war ihm fremd, doch dies war etwas anderes. Es ging hier nicht um ein geplatztes Geschäft, auch wenn Petra sich so verhielt. Ihre Kälte erschreckte ihn.
Martin betrachtete ihr fein geschnittenes Gesicht, den schönen, geraden Mund, um den sich in letzter Zeit ein Zug von Hochmut gebildet hatte. Das Haar war sorgsam gefärbt, jede Strähne und jeder Schimmer geplant, die Hände gepflegt, mit glänzenden Nägeln. Das alles hatte ihm einmal gefallen, jetzt betrachtete er es nur als Fassade.
Er wandte den Blick ab und klappte die in Leder gebundene Speisekarte auf. Seit gestern Morgen hatte er nichts mehr gegessen. Gestern? Vom Haut-Bourton und dem Diebstahl erzählte er Petra besser nichts. Sie würde wie immer ihm die Schuld daran geben.
»Ich nehme den Crevettencocktail und dann den Seeteufel. Hast du was gefunden? Du bist eingeladen.« Petra tätschelte begütigend Martins Hand.
Wie schnell sie sich auf die Stimmung ihres Gegenübers einstellen kann, dachte er verletzt. Oder war sein Misstrauen inzwischen so groß, dass er nichts mehr gelten ließ?
»Nimm auch den Seeteufel, der ist hier wunderbar. Den Wein suchst du natürlich aus.« Sie lächelte verbindlich.
Martin hielt einen gereiften Riesling für ideal – mineralisch, reintönig und trocken statt sauer. Er bestellte das Essen und wollte gerade nach dem Wein fragen, als Petra entschieden dazwischenfuhr:
»Wir nehmen den sizilianischen Chardonnay von Planeta, im Barrique ausgebaut, der ist fantastisch, meinen Sie nicht auch, Lodovico?«
Der Inhaber des »Romolo«, der sie persönlich bediente, verbeugte sich lächelnd. Martin schluckte nur, es war ihm zu dumm, ihr ins Wort zu fallen – der Chardonnay passte überhaupt nicht –, und der Abstand zwischen ihnen wuchs.
Petras Thema war wie üblich ihr Job als Public-Relations-Beraterin in einer großen Agentur. Sie berichtete von neuen Strategien für neue Firmen, von wahnsinnig interessanten Leuten, neuen Herausforderungen und großartigen Ideen. Martin hatte das alles schon mehrmals gehört, wenn auch in anderer Form, und er konnte beim besten Willen keinen Unterschied darin entdecken, ob sie nun für einen Fußballverein arbeitete oder ein Duschgel. Für Petra hingegen war es ungeheuer wichtig, und so zwang er sich, bei ihrem Marketing-Geplapper eine interessierte Miene aufzusetzen.
Er erinnerte sich an jenen Empfang, für den er die Weine geliefert hatte und auf dem sie sich kennengelernt hatten. Der Veranstalter, mit dem er häufig zusammenarbeitete, hatte ihn eingeladen. »Schau dir die Gäste genau an, lauter Verrückte aus der Werbebranche«, hatte er gesagt, »aber sie zahlen gut.«
Petra und er waren ins Gespräch gekommen, und Martin hatte ein wenig über seine Weine und die Produzenten geplaudert. Sie lauschte hingerissen seinen Geschmacksbeschreibungen, und ihre Augen strahlten, als er auf Bordeaux und seine berühmten Châteaus zu sprechen kam. Sie fragte ihn nach Empfängen, fand es fantastisch, unter historischen Kronleuchtern zu soupieren, in Louis-Quinze-Möbeln, elegante Roben ringsum, kostbarer Schmuck und erfolgreiche Leute. Anscheinend hatte sie ihn mit diesen verwechselt, und er hatte ihre Faszination als Begeisterung für seine Person missverstanden.
Martin merkte, dass er die Lippen zusammenpresste. Sah man im anderen nur, was man zu sehen wünschte? Er blickte Petra finster an: Pech, meine Liebe, leider, für uns beide.
Petra hatte einen gesunden Appetit, er hingegen würgte den Fisch, der wirklich ausgezeichnet war, ohne Genuss hinunter, blieb einsilbig und vermied jeglichen Kommentar über den aufgemotzten Wein. Der Holzton war penetrant, die Frucht verblasst, aber der Winzer lag voll im Trend.
Als sie in Petras Wagen stiegen, zeigte sie wenig Verständnis für seinen Wunsch, zu Hause schlafen zu wollen, allein! Ihm stand der Sinn weder nach ihrer neuen Wohnung, die wie die Ausstellungsräume eines bekannten Innenarchitekten aussah, noch nach erotischem Sport.
Missgelaunt setzte sie ihn vor seiner Wohnung ab. Wahrscheinlich fuhr sie noch in irgendeine Bar. Es war ihm egal.
Früh am nächsten Morgen ließ Martin Frankfurt weit hinter sich und fuhr zu einem Waldgebiet, in dem er noch nie gejoggt war. Ohne sich Gedanken über den Weg zu machen, lief er los, verlor seinen üblichen Rhythmus, steigerte das Tempo wie nie zuvor und rannte immer schneller, bis er sich keuchend und schwindlig vor Anstrengung an einem Baum festhalten musste und begriff, dass er sich verlaufen hatte und auf diese Weise der Wirklichkeit nicht entkam. Erst nach zwei Stunden fand er den Wagen wieder und erreichte gegen Mittag seinen Laden, froh, dass Sonntag war und er mit niemandem reden musste.
Unkonzentriert wühlte er sich durch die Korrespondenz, die während seiner Abwesenheit eingetroffen war. Mit seinen Gedanken war er in Saint-Émilion.
Caroline wird Hilfe brauchen, sie ist mit der Weinlese total überfordert, dachte er, jede Hand wird benötigt, besonders die des Winzers, der seine Augen überall hat. Wer soll sich darum kümmern? Wer kann zu Ende bringen, was Gaston begonnen hat? Wer soll es weiterführen?
Zu dritt hatten sie den Weinberg ausgesucht, Caroline, Gaston und er, gemeinsam die Garage umgebaut, die Stöcke gepflanzt und nach drei Jahren die ersten Trauben geerntet. Martin kannte die Kriterien, nach denen Gaston Trauben beurteilte, und hatte dazu eigene entwickelt. Er war mit Gastons Weinen bestens vertraut, hatte jeden Jahrgang des Pechant in allen Stadien seiner Entwicklung erlebt. Die Maschinen hatte er eigenhändig überholt, alles war für die Lese vorbereitet. Unsicher fühlte er sich nur in Bezug auf die Dauer der Gärung und die Maischezeit. Nach wie vielen Tagen hatte Gaston letztes Jahr den Pechant in die Eichenfässer umgefüllt?
Er würde es herausfinden, das war er Gaston schuldig – und Caroline auch. Er musste den Wein machen, niemand sonst wusste so genau Bescheid. Damit war die Entscheidung gefallen, und mit einem Mal fühlte er sich besser, konnte sich den Rechnungen, Mahnungen, Bestellungen und Angeboten zuwenden und den Papierberg abtragen. Immer wieder griff er zum Telefon und wählte Gastons Nummer, nein, jetzt nur noch die von Caroline. Würde er sich daran gewöhnen können? Die Ungewissheit ließ ihm keine Ruhe, und für einen Moment klammerte er sich an die Hoffnung, dass Gaston noch lebte. Aber der wäre längst ans Telefon gegangen und hätte seinen Weinberg jetzt unter keinen Umständen verlassen.
Martin rief sich die Abreise in Erinnerung. Hatte er etwas überhört, irgendeine Kleinigkeit übersehen, auf eine beiläufige Bemerkung nicht geachtet? Irrte er sich, oder war Gaston erleichtert gewesen, dass er den Haut-Bourton los war?
Das Telefon schrillte. Martin zuckte zusammen und griff erschrocken nach dem Hörer.
»Martin, bist du es?« Sofort erkannte er Carolines Stimme.
»Ja. Wo bist du?«
»Gott sei Dank, dass ich dich erreiche. Ich bin in Bordeaux … Es ist etwas Furchtbares geschehen …«. Sie schluchzte.
»Ich weiß.« Was sonst hätte er sagen können. »Mein herzliches Beileid« klang abgedroschen, Sätze wie »Es tut mir leid …« oder »Was für ein schrecklicher Verlust …« klangen banal in Anbetracht dessen, was geschehen war. »Ich würde dich jetzt gern in den Arm nehmen. Wie geht es dir?«, fragte er stattdessen.
»Woher weißt du …«
»Von deinem Bruder. Als ich vorgestern anrief, war er am Telefon.«
»Mein Bruder? Du meinst Jean-Claude, Gastons Bruder. Der ist doch in Narbonne! Hat er mit dir telefoniert? Er kommt erst zur Beerdigung …« Sie verstummte.
»Aber – da war jemand am Telefon, der sagte, Gaston hätte einen tödlichen Unfall gehabt, mit Paletten …«
»Das stimmt. Am Donnerstag, nachdem du weggefahren bist, mittags, bei LaCroix, drüben in Bordeaux.« Caroline schluchzte. »Ich weiß nicht, was er da wollte. Als ich zurückkam, ich hatte die Kinder in die Schule gebracht, erklärte er mir, dass er unbedingt wegfahren müsse. Er hat mir nicht gesagt, wohin, und er war ganz komisch. Du weißt, wie er ist, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat.«
»Ja, ich weiß …«
»Wäre er nur hiergeblieben …« Caroline schnäuzte sich und fuhr mit erstickter Stimme fort: »Alle sind entsetzt, fürchterlich schockiert, aber ich glaube, nur du kannst ermessen, was es wirklich bedeutet, was er mir bedeutet hat. Seine Eltern natürlich auch, sie sind auf dem Weg hierher. Der arme Gaston …«
Stockend erzählte sie weiter. Sie war ins Krankenhaus gefahren, doch den Leichnam hatte man gleich in die Gerichtsmedizin gebracht. »Sie mussten die Todesursache untersuchen, hat man mir gesagt, wegen der Berufsgenossenschaft, und ich musste ihn identifizieren. Oh, Martin, es war so schrecklich, er sah so fürchterlich aus …« Als sie sich etwas beruhigt hatte, sprach sie weiter: »Sie reden jetzt über Unfallversicherung, Lebensversicherung, über Witwenrente und dass ich mich um alles kümmern muss, besonders wegen der Kinder.«
»Wie haben sie es aufgenommen?«
»Ach, die verstehen es nicht, sie brauchen Zeit. Sie denken, er kommt wieder. Du arbeitest, heute am Sonntag?«
»Es ist viel liegen geblieben. Wie weit sind die Trauben?«
»Sind alle noch dran. Es ist kälter geworden, die Reife dauert länger, aber nächste Woche müssen wir anfangen. Jean-Claude kommt zum Helfen. Leider kriegt er nur eine Woche Urlaub, er muss mit den Studenten in die Weinberge. Ganz Frankreich ist wegen der Weinlese im Stress. Martin, was soll ich tun? Irgendetwas muss ich tun. Die Ernte …« Sie schluchzte wieder.
»Wo bist du jetzt?« Martin fühlte sich hilflos wie nie zuvor, er wusste nicht, was er sagen sollte, und rettete sich zu seinem Thema: »Ich habe seit meiner Abreise mehrere Male angerufen. Da stimmt etwas nicht mit dem Wein, den er mir mitgegeben hat.«
»Davon habe ich keine Ahnung. Ich bin in Bordeaux, bei Freunden, du kennst Marie und Victor. Ihre Wohnung ist groß genug. Wir gehen wieder nach Hause, wenn meine Mutter kommt, allein halte ich es da nicht aus.«
Sie schwieg eine Weile, nur ihr Atem war zu hören. »Martin, kannst du … kannst du vielleicht kommen? Klar, dein Geschäft, aber lässt es sich nicht einrichten? Bitte, nur für einige Tage. Ich … ich brauche dich, wir brauchen jemanden, der weiß, was Gaston wollte, wir müssen den Wein machen.«
»Ich habe auch schon daran gedacht. Ich spreche mit Frau Schnor, ob sie sich zutraut, jetzt, da die Saison beginnt, den Laden alleine zu führen. Meinst du, dass eine Woche reicht?«
Caroline schwieg, Martin sah ihr flehendes Gesicht fast vor sich und befreite sie aus der Verlegenheit: »Ist gut«, sagte er beruhigend, »ich komme bestimmt.«
»Wann sprichst du mit Frau Schnor?«
»Heute oder morgen, verlass dich auf mich, ich komme! Dann können wir auch klären, wer bei dir im Haus gewesen ist.«
Das war Caroline nicht so wichtig wie die Gewissheit, dass Martin ihr helfen würde, und sie verabschiedeten sich kurz.
Martin legte den Hörer zurück und sah sich um. Ein merkwürdiges Gefühl von Unwirklichkeit und Stille ergriff von ihm Besitz. Von draußen drang kein Laut in den Raum, und nur der Rechner unter seinem Schreibtisch brummte leise. Martin stand auf und lief rastlos vom Büro in den Laden und zurück. Er fühlte sich wie ein Hamster im Rad. Sein Blick blieb am Schaufenster hängen. Es lagen noch die Sommerweine in der Auslage, dabei klatschte Regen gegen die Fensterscheibe. Die Winterweine waren an der Reihe, die Roten und Schweren, die Fülligen und Warmen, mit richtig viel Tannin zum fetten Gänsebraten.
Frau Schnor erreichte er erst am Abend.
»Wir besprechen das persönlich«, meinte sie beruhigend und kam sofort in den Laden.
Die Nachricht von Gastons Tod war auch für sie ein Schock. Sie mochte seinen Charme, die Art, wie er sie »Madame« genannt und ihr immer ein kleines Geschenk mitgebracht hatte.
»Natürlich fahren Sie, Herr Bongers. Selbstverständlich werden wir der armen Frau helfen.« Ihre Zuversicht beruhigte Martin ein wenig. »Mein Mann wird zwar Zicken machen, wenn ich so viel arbeite«, sie zuckte mit den Achseln, »aber die macht er immer. Und alles Wichtige kann ich Ihnen per Mail schicken. So, und jetzt dekorieren wir das Schaufenster um.«
Frau Schnor schrieb in ihrer schnörkeligen Schrift die Preisschilder für die Weine, gemeinsam räumten sie den Laden um, schleppten Kisten, staubten Flaschen ab, dachten sich Sonderangebote aus, und Frau Schnor drapierte die Ladenhüter mit besonderer Sorgfalt. Ihre Unverdrossenheit ließ Martin nicht auf trübe Gedanken kommen, und als sie sich kurz vor Mitternacht verabschiedeten, bedankte er sich überschwänglich.
Frau Schnor wiegelte ab. »Wenn das Geschäft der Freundschaft keinen Raum mehr lässt, verliert das Leben seinen Sinn.«
Den Montagvormittag verbrachte Martin mit Telefonaten, den Nachmittag mit der Auslieferung der in Bordeaux gekauften Crus – das Geschäft hatte sich mal wieder gelohnt, doch zum ersten Mal hatte er dabei so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Nicht etwa, weil er den Staat betrog, nein, der betrog ihn auch, nur erinnerte er sich nun daran, dass Gaston ihn gefragt hatte, wann sie damit aufhören würden. Was hatte ihn gerade jetzt zu dem Meinungsumschwung bewogen?
Als er zurückkam, empfing ihn Frau Schnor, die das Geschäft um fünfzehn Uhr geöffnet hatte, ein wenig ratlos: »Da waren zwei Herren, die wollten nur von Ihnen bedient werden. Sie haben nach einem bestimmten Wein gefragt, einem Bordeaux. Hier, der Name.« Sie reichte Martin einen Zettel. »Haben wir den?«
Martin las den Namen und starrte sie an.
»Was ist? Habe ich es falsch geschrieben?« Sie wich erschrocken einen Schritt zurück.
»Sind Sie sicher? War es dieser Wein?« Martin tippte auf das Papier.
»Ja, ganz sicher, Haut-Bourton.«
»Was haben die beiden gesagt?«
»Nun, eigentlich nichts weiter. Sie haben lediglich nach dem Jahrgang 1989 gefragt, und ich habe gesagt, dass nur Sie wüssten, was im Keller liegt.«
»Waren es Franzosen?«
»Der eine sprach Deutsch, ohne Akzent, ein unangenehmer Mensch. Als der reinkam, habe ich mich gefürchtet. Der andere war kleiner, elegant, aber schmierig, der hat nichts gesagt. Was halten Sie von Männern mit lackierten Fingernägeln?«
Frau Schnor blickte auf die Uhr. »Sie müssten jeden Moment wiederkommen, wenn überhaupt. Sie wissen, wie manche Kunden sind. Erst spielen sie sich auf, dann sieht man sie nie wieder. Die beiden waren … unangenehm, ganz unsympathisch.« Frau Schnor schüttelte sich. »Und so was leistet sich einen Deuxième Cru. Ich habe nachgesehen, 115 Euro die Flasche. Teuer, nicht wahr?«
Martin nickte geistesabwesend. Schon wieder dieser Name. Wieso war auf einmal alle Welt hinter dem Wein her? Hatte er die Kiste wieder ins Regal zurückgestellt?