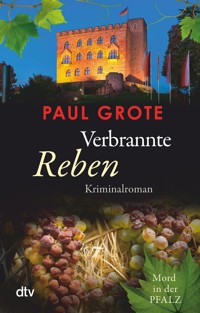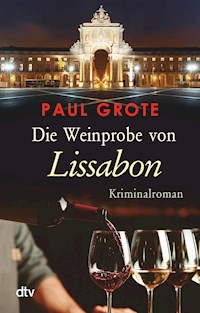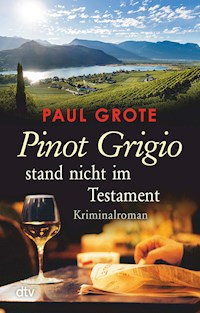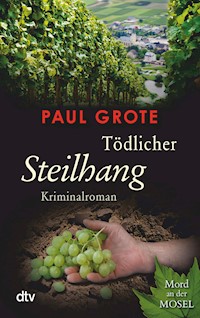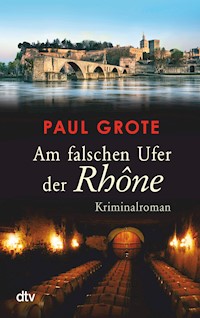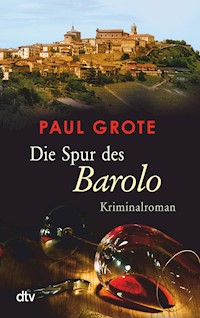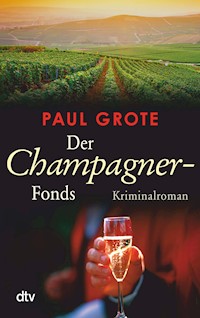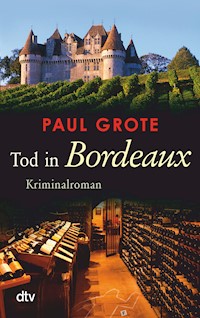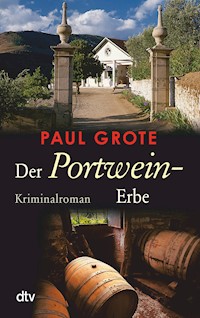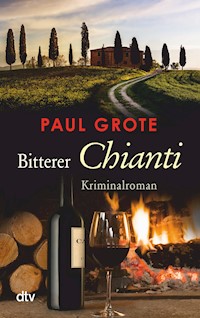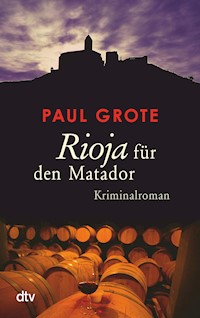9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Mord im Rheingau... Entsetzen in der Hochschule des deutschen Weinbaus in Geisenheim: Die Studentin Alexandra wurde erschlagen, und alle Indizien weisen auf den Geliebten der Toten als Mörder hin. Völlig unfassbar für Thomas Achenbach, Student und Freund des Verdächtigen. Alexandra war nicht so unbedarft, wie sie tat! Nur Dozentin Johanna Breitenbach behält die Nerven. Sie steigt hinab ins undurchsichtige Geflecht von Interessen und Beziehungen. Ein Riesling bringt sie auf die richtige Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Paul Grote
Ein Riesling zum Abschied
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2011
© 2011Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40822-6 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21319-6
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
|5|Fast zwangsläufig wird man schließlich zu der Person,
für die einen die anderen halten.
Gabriel Garcia Marquez:
Erinnerung an meine traurigen Huren
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
|7|1
Er blickte an dem Haus mit den dunklen Fenstern empor. Es schien verlassen, und nirgends brannte Licht, nur die Straßenlaternen, an diesem Sommerabend von Insekten umschwirrt, schienen hell und kalt. Der fahle Schein der Laternen, in dem Fledermäuse sich im Flug satt fraßen, ließ die menschenleere Straße noch einsamer erscheinen. Weiter vorn fiel das kalte Blau einer Lichtreklame auf den Asphalt. Der Nachtwind griff in die Tannen, die Schatten ihrer großen Zweige strichen lautlos über die Fassade. Im ersten Stock stand ein Fenster offen, eine weiße Gardine wehte heraus, wie um etwas zu verdecken – oder als Mahnung? Der weiße Schleier stand für einen Moment still in der Luft, verharrte in der Form einer Totenmaske, und Thomas Achenbach meinte, in ihr Alexandras Züge zu erkennen. Ihn schauderte.
Am Abend war bei Tisch über sie geredet worden, und die Gespräche hatten die Geburtstagsfeier überschattet. Am Freitag war er Alexandra zuletzt auf dem Campus begegnet. Jetzt war sie tot, erschlagen, und lag irgendwo in einem eisigen Keller der Gerichtsmedizin von Wiesbaden.
Ratlos, entsetzt und auch widerwillig hatten seine Kommilitonen die absurdesten Theorien gewälzt und jeden zum Mörder erklärt, der aus diesem oder jenem Grund als Täter in Betracht kam oder am wenigsten sympathisch war. An Manuel hatte niemand gedacht. Bestand nicht auch die Möglichkeit, dass Alexandra von einer Frau getötet worden |8|war? Als eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung am Montag die Heizungsmonteure in die Wohnung gelassen hatte, war die Tote entdeckt worden. Die Nachricht vom Mord hatte nicht nur unter den angehenden Önologen des Fachbereichs Geisenheim, wie dieser Teil der Hochschule RheinMain hieß, rasend schnell die Runde gemacht. Auch die Bevölkerung des Städtchens war schockiert. Seit dem Mord war nichts wie vorher.
Thomas fand es immer noch richtig, dass er sich den Abend über mit seiner Meinung zurückgehalten hatte. Im Grunde genommen hatte er überhaupt keine. Er wusste nichts über die Todesumstände. Außer Manuel und Regine, mit denen er die Wohnung teilte, wusste niemand von seiner Abneigung gegenüber der Toten, von seinem tief sitzenden Misstrauen. Er war Alexandra, wenn es sich irgendwie einrichten ließ, stets aus dem Weg gegangen, damit sich seine Antipathie nicht zur Feindseligkeit auswuchs. Ihm kam dabei entgegen, dass sich ihre Studiengänge sehr voneinander unterschieden. Alexandra hatte Internationale Weinwirtschaft gewählt.
»Ich will mir doch nicht alle fünf Minuten die Fingernägel sauber machen.«
Diese Worte, bei ihnen am Küchentisch ausgesprochen, hatte er noch im Ohr. Aber sie hatte es für nötig befunden, die Nägel mehrmals täglich zu lackieren, mal eben so, nebenbei. Er selbst und seine Freunde hingegen machten sich nicht nur die Finger schmutzig, auch die Hände, die Schuhe, sie schwitzten bei der Arbeit – sie studierten eben Önologie und Weinbau. Ihnen machte das nichts aus.
Es gab allerdings einige gemeinsame Lehrveranstaltungen, bei denen ein Zusammentreffen unvermeidlich war. Er und Alexandra hatten es bei der Andeutung eines Kopfnickens belassen. Morgen hätten sie sich bei der Mikrobiologie-Vorlesung gesehen, und auch im Kurs Weinbeurteilung |9|waren sie zwangsläufig zusammengetroffen. Aber da saß sie stets neben Manuel.
Thomas wusste, dass Alexandra ihn genauso verabscheute wie er sie. Er hatte sie durchschaut – und sie hatte es gemerkt. Es war nichts als ein Augenblick gewesen, in seinem Blick hatte sie sich erkannt gefühlt, abends bei ihnen in der Küche, nach dem Essen, beim Espresso. Der Rest des Abends war dann nur noch peinlich gewesen, schließlich war sie Manuels Freundin.
»Ich liebe Hausmannskost«, pflegte sie an solchen Abenden zu sagen und hatte ihn, der meistens kochte, dabei herausfordernd angegrinst. Die brachte er nun wahrlich nicht auf den Tisch. Aber was war für eine junge Frau schon gut genug, die am liebsten in den Etablissements von Sterneköchen verkehrte?
Außer dem trockenen Hall seiner Schritte hörte Thomas nur das Knarren der großen Äste der Tannen. Es würde Regen geben. Er konnte es riechen. Er hatte sich angewöhnt, an allem zu riechen, nicht nur an Früchten, nicht nur am Essen, an Holz oder Blumen, er roch an Eisen, an Glas, an Kunststoffen und an der Erde. Und er hatte Alexandra von Anfang an nicht riechen können. Die Abneigung war geradezu körperlich. Aber das hatte er Manuel genauso verschwiegen wie dieses Gefühl, dass sie allen etwas vorspielte. Doch er hatte es gespürt, und es verletzte ihn. Thomas’ gespanntes Verhältnis zu Alexandra machte seinem Freund arg zu schaffen.
An der Kreuzung neben der Sparkasse blieb Thomas stehen, schaute nach rechts zum Bahnhof und blickte noch einmal zu dem Haus mit dem offenen Fenster zurück. Er meinte, die weiße Gardine wieder gesehen zu haben, aber war das bei der Entfernung überhaupt möglich? War es ein Zeichen, ein Wink, eine Warnung? Ihm wurde schon wieder kalt, die Gänsehaut kroch von den Schulterblättern zum Nacken hinauf. Geh weiter, sagte er sich, sieh nach vorn, doch auch der Anblick des nächtlichen Bahnhofs mit dem |10|wartenden Taxi, das abgeblendet unter dem Baum davor parkte – der Fahrer hoffte wohl auf einen späten Fahrgast aus dem letzten Zug aus Wiesbaden–, wirkte nicht beruhigend. Links daneben drohte die massige Silhouette des in völligem Dunkel liegenden Schlosses Schönborn. Der Anblick der Weinstöcke davor, von einer halbhohen Mauer umfriedet, ließ Thomas aufatmen. Riesling wuchs hier. Was sollte es im Rheingau auch anderes sein? Ein wenig Spätburgunder? Thomas betrachtete die knorrigen Gebilde, von Blättern umrankt, in der Dunkelheit mehr Scherenschnitt als Wirklichkeit. Geisenheimer Schlossgarten hieß diese Lage mitten in der Stadt, fünfundzwanzig oder dreißig Jahre mochten die Weinstöcke hier stehen. Anthroposophen hätten an dieser Stelle kaum je etwas gepflanzt, ihnen wäre es für die Pflanzen zu laut gewesen. Aber eine Nacht wie diese, wenige Tage nach einem Mord und noch dazu kurz vor dem Regen, war sehr still – bis der nächste Güterzug aus dem Rheintal heraufdonnerte und die lautlose Dunkelheit zerriss. Thomas ging schnell weiter, um seinen düsteren Gedanken zu entkommen.
Er ärgerte sich, dass er zu träge gewesen war, den Vorderreifen seines Fahrrades zu flicken, andernfalls wäre er längst zu Hause gewesen. Den Wagen ließ er grundsätzlich stehen, wenn klar war, dass probiert und getrunken wurde. Es gab kein Essen unter den angehenden Önologen, bei dem nicht wenigstens einer von ihnen die Weine vom elterlichen Weingut oder sonstige Proben auf den Tisch stellte. Heute hatten sie die Weine von Hans Lang probiert, es hatte sozusagen ein Themenabend über biologisch gemachte Weine werden sollen.
In Sachen ökologischer Weinbau war Lang einer der Ersten im Rheingau, und was er und seine Mannschaft produzierten, gehörte zur Spitze. Sie hatten Gutsweine sowie zwei Lagen- und Ursprungsweine probiert, »vom bunten Schiefer«. Zum Kauf von Ersten Gewächsen reichte das studentische Budget nicht. Thomas war der Ansicht, dass |11|ein Winzer, der seinen einfachsten Weinen nicht die gleiche Sorgfalt angedeihen ließ wie seinen besten Gewächsen, ihnen nicht als Vorbild dienen konnte. Aber Lang war ein Vorbild, und seine Weine waren erschwinglich, und es war eine Frage des Geschmacks, des Anspruchs und der Möglichkeiten, für welchen Wein man sich entschied.
Thomas hatte es der Spätburgunder angetan, ein rebsortentypischer Wein, diskret im kleinen Holzfass ausgebaut, mit einem schönen Beerenaroma. Als grandios hatte er den Johann Maximilian »R« von einer Probe auf dem Weingut in Erinnerung. Thomas’ Freunde hatten mehr vom Grauburgunder und von Langs Riesling mit der Goldkapsel geschwärmt, leider hatten sie von allem nur eine Flasche, mehr gab der väterliche Monatsscheck nicht her. Sie lernten, sie probierten, sie diskutierten, und sie genossen, aber heute hatte ihre Privatdegustation, wie sie es nannten, nicht in euphorischer Stimmung geendet.
Heute Nacht kam Thomas die Winkeler Straße besonders lang vor, fremd und leblos, und er fragte sich, welche Sorge ihn mehr bewegte. War es Mitgefühl für Manuel, mit dem er seit einem Jahr zusammenwohnte und studierte, der sein Partner und inzwischen auch sein Freund geworden war? Mit Argwohn hatte er bemerkt, wie Alexandra ihn eingewickelt und umgarnt hatte, wie er mehr und mehr auf ihre Tricks reingefallen war und ihren lasziven Mund. Sie hatte mit Manuel gespielt, sie hatte seine Klaviatur schnell begriffen und ihre Fertigkeiten ausprobiert und perfektioniert. Manuel war blind gewesen, dankbar für das, was er für Liebe, für Zuneigung hielt. Er begriff nicht, dass sie ihn ausgenutzt, ihn verführt und dabei in die Irre geführt hatte.
Manuel war reich, vielmehr seine Eltern waren es, und für jemanden, der hoch hinauswollte, so hoch hinaus wie Alexandra, musste er das Ziel ihrer Träume gewesen sein.
Kreisrund und hell stand der Mond am Himmel, Wolkenschleier zogen vorüber. Thomas wäre gern unten am Rhein |12|gewesen, ein Glas Wein in der Hand, und hätte das Glitzern des Lichts auf den Wellen genossen, aber er war zu müde, bis ans Ufer zu laufen. Außerdem war der Weinstand bestimmt längst geschlossen. Er sah das Schild an einem Mast:
Weinproben, Flaschenwein, Verkauf– Versand
Alles hier in Geisenheim war Wein, kam mit dem Wein, geschah durch den Wein und hing vom Wein ab. Vom Küchenfenster der WG sah er den Rothenberg, der sich nach dem langen Winter längst mit frischem Grün überzogen hatte. Auch sein Leben drehte sich um nichts anderes, seit er Köln hinter sich gelassen hatte.
Die Straße machte einen Bogen nach links, das Licht der Schaufenster erleuchtete die Fußgängerzone. Einen Bürgersteig gab es nicht, die Autos standen dicht an den Hauswänden. In dieser Nacht wirkte alles leblos und ungenutzt. Eine solche Nacht hatte Thomas in den anderthalb Jahren in Geisenheim noch nicht erlebt. Aber in einer solchen Nacht war er auch noch nie durch die Stadt gegangen, weder nach einem derartig schrecklichen Ereignis noch allein. Obwohl es ein Umweg war, ging er am Bach hinunter zum Dom und folgte dem Plätschern des Wassers.
Wäre Alexandra einfach aus Manuels Leben verschwunden, hätte sich an einen wohlhabenderen Kandidaten rangemacht, wäre er froh gewesen und Manuel einiges erspart geblieben. Außerdem hätte er die Chance gehabt, etwas über sich selbst zu lernen: Falschheit zu erkennen, seine Reaktionen darauf und seine Schwäche zu begreifen. Man war zu einem Teil immer selbst schuld! Nun aber würde sich dieser Widerspruch niemals auflösen, die Trauer würde die Erkenntnis unmöglich machen, die Chance war vertan. Alexandra gab es nur noch in der Vergangenheit, sie war das Opfer, damit wurde sie heilig gesprochen – und er, Thomas, sah sich zum Schweigen verdammt, denn über Tote sprach |13|man nicht schlecht. Wieso eigentlich, wenn sie es verdient hatten? Aber seine Meinung teilte kaum jemand, und allen Unbeteiligten war es egal.
In der Rheingau Apotheke hing ein Plakat mit dem Produkt des Monats. Einen Wein des Monats konnte Thomas sich durchaus vorstellen, aber ein Produkt des Monats – aus einer Apotheke? Kopfschmerztabletten? Nasentropfen oder Insulinspritzen? Na dann schon besser Kondome, aber die gab’s in der Drogerie, und schon wieder dachte er an Alexandra und daran, dass er den Eindruck gehabt hatte, dass sie nie wirklich scharf auf Manuel gewesen war. Oft war sie abends nicht bei ihm geblieben und hatte vorgeschützt, noch lernen, einen Vortrag oder eine Präsentation ihrer Arbeitsgruppe vorbereiten zu müssen. Sie hatte sich dann von Manuel heimfahren lassen und ihn anschließend nach Hause geschickt oder war selbst ins Auto gestiegen oder hatte sich ein Taxi kommen lassen. Manuel, der Idiot, hatte sogar dafür bezahlt.
Regine, der Frau in der WG, war das natürlich aufgefallen, und vorsichtig wie sie war, hatte sie ihre Kritik in Verwunderung gekleidet. Sie kannte Thomas’ Einstellung Alexandra gegenüber und hatte ihn mehrmals gefragt, woher er die Frechheit nahm, derart negative Äußerungen über Menschen von sich zu geben. Ihr gefiel überhaupt nichts, was den geringsten Anschein von Radikalität erweckte, was sich absolut anhörte und sich nicht zurücknehmen ließ; alles das, wofür man sich nicht entschuldigen konnte, war ihr zuwider. »Schwamm drüber« war einer ihrer Lieblingsausdrücke, und es ärgerte Thomas maßlos, wenn sie meinte, dass schließlich jeder selbst wissen müsse, was er tue.
Für einen Moment blieb Thomas vor dem Fotogeschäft stehen. Hochzeitsbilder waren der Renner: Ein überglückliches Brautpaar vor einem vom Wein überrankten Torbogen lachte ihm entgegen. Das würde Manuel nun erspart bleiben. Der einzige Moment, an dem Thomas seinen Freund hatte zweifeln sehen, war der gewesen, als Alexandra |14|erklärt hatte, dass sie in Weiß heiraten wolle, und Thomas erinnerte sich an Manuels Augen. Es war ein sehr kurzer Blick gewesen, ein Blick, in dem Zweifel aufgetaucht waren, Angst, als würde er den Boden unter den Füßen verlieren, als wenn er Thomas hätte fragen wollen, ob es das war, was er meine. Alexandra hatte es bemerkt, ihre Augen waren denen von Manuel gefolgt, und sie fand sich von Thomas’ Blick gefangen. Sie hatte gespürt, dass er ihr misstraute, und ihre Augen hatten sich mit Verachtung gefüllt.
Die übergroße Taschenuhr über dem Juwelierladen zeigte zehn Minuten vor Mitternacht. Thomas ging schneller, er wollte schlafen, er wollte nicht denken, nicht grübeln. Sicher war Manuel noch wach, und es würde wieder eine Nacht mit unendlichen Gesprächen werden. Manuel war traurig, aber er war auch hilflos, und ihm fehlte die Orientierung. Er stand wie vor einer inneren Mauer. Er wusste, dass dahinter etwas lag, aber er wusste nicht, was es war. Noch nie hatte Thomas einen Menschen in diesem Zustand erlebt.
Vor ihm schälte sich die Linde aus dem Dunkel, mit ihr hatte Geisenheim sich zur Lindenstadt gemacht. Der Baum sollte siebenhundert Jahre alt sein. Im Rathaus dahinter brannte unter den Arkaden über der Freitreppe noch Licht. Die Buchhandlung Untiedt, wo er seinen Bedarf an Büchern und Schreibpapier deckte, lag im Dunkeln. Der Besitzer vom »Kiosk Linde« hinter dem Rathaus versuchte verzweifelt, die letzten Zecher am Stehtisch vor seiner Tür zur Aufgabe zu bewegen, und als Thomas um die nächste Ecke bog, hörte er noch immer ihre lauten Stimmen. War Alexandra für sie ein Thema? Sicher, denn vor Kurzem war hier auf jemanden aus einem fahrenden Auto heraus geschossen worden.
Regine konnte mit all dem am wenigsten anfangen; sie war nur entsetzt, dass Menschen anderen Menschen etwas antun konnten. Am liebsten hätte sie den Kriminalbeamten, von denen sie gestern verhört worden waren, einen Namen gesagt und damit basta. Aber sie konnte keinen Namen |15|nennen, hatte nicht den leisesten Verdacht. In Gefühlsangelegenheiten war Regine hilflos, in allen Fragen des Weinbaus war sie Spitzenklasse und bei der Lösung von technischen Problemen immer vorneweg. Aber mit Männern, Kindern oder Familie hatte sie nichts im Sinn. Thomas erinnerte sich schmunzelnd, wie sie vor dem Schaufenster des Geisenheimer Wäschegeschäfts »Unterm Rock« stehen geblieben waren, um einen Freund zu begrüßen. Als sie bemerkt hatte, wo sie standen, war sie knallrot geworden.
Thomas sah drei junge Leute, die er vom Sehen her kannte, das »Colours« betreten. Gehörten sie zu den Landschaftsarchitekten oder zu den Getränketechnikern? Er zögerte, ob er auch... nein, besser nicht, Manuel würde ihn vielleicht brauchen. Das Bräunungsstudio »California – sun & more« erinnerte ihn wieder an Alexandra. Hier hatte sie sich ihre Ganzkörperbräune geholt, wie er bemerkt hatte, als er einmal unabsichtlich in das nicht abgeschlossene Badezimmer geplatzt war.
Zehn Minuten später war er zu Hause. In dem Zweifamilienhaus oberhalb der Bahnlinie bewohnten sie zu dritt die untere Etage. Auf der Straße davor stand Manuels schwarzes Alfa Romeo Cabrio, ein Anlass für neidvolle Blicke. In Manuels Zimmer brannte Licht, demnach war er noch wach. Thomas schloss die Haustür auf, die Wohnungstür war nicht abgeschlossen, und als er leise Manuels Zimmer betrat, sah er nur den über die Tasten des Klaviers gebeugten Rücken und die langen schwarzen Locken, die sich bewegenden Hände, von denen eine plötzlich weit nach links griff und mit spielerischer Leichtigkeit zurück über die Tasten lief. Das einzige Geräusch war Manuels heftiger Atem und die trockene Berührung der Tasten mit den Fingern. Beethoven, wie ihn einige Studenten nannten, die von seiner Passion wussten, hatte die Stummschaltung aktiviert. Nur er hörte sich selbst über den Kopfhörer. Manuel hatte sich in seine Welt zurückgezogen.
|16|Müssen wir wieder von vorne anfangen?, fragte sich Thomas und dachte daran, wie die Starre von Manuel nach und nach abgefallen war, wie er aus seiner Zurückgezogenheit hervorgekrochen war und sich seiner Umwelt mit vorsichtiger Neugier näherte. Zu einem großen Teil hatten die Besuche auf ihrem Pfälzer Weingut dazu beigetragen. Zuerst hatte er sich geweigert, die Einladungen anzunehmen, mittlerweile freute er sich auf die Wochenenden, obwohl sie immer in eine elende Schufterei ausarteten – und das nach einer anstrengenden Studienwoche mit einem Stundenplan, der für studentische Sperenzien, wie nächtliche Fahrten in die Disco nach Wiesbaden, kaum Zeit ließ. Thomas hatte es gern gesehen, dass Manuel besonders zu seinem Vater Zutrauen gefasst hatte, erstaunt, dass es Väter gab, mit denen man reden, zu denen man gar ein freundschaftliches Verhältnis haben und sie lieben konnte. Manuel konfrontierte ihn mit Fragen, die er seinem eigenen Vater nie hatte stellen dürfen, die nie beantwortet worden waren. Der Vater hatte sich Manuel schon immer entzogen und das Geld gemacht, mit dem er ihn heute vollstopfte und ihn sich vom Leib hielt. Der Alfa Romeo war mehr ein Schweige- als ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Als Manuel, ein Mensch mit einem grünen Daumen und ein Crack in Biologie, den Wunsch geäußert hatte, Winzer zu werden, hatte ihn sein Vater endgültig abgeschrieben.
Thomas sah Manuel lange zu, sah seine Hände über die Tasten gleiten, sah, wie er Weinstöcke anfasste, vorsichtig, respektvoll, aber doch entschieden. Da nahm Manuel die Bewegung hinter sich wahr, hielt inne und hob den Kopf. Er drehte sich um und blickte Thomas mit großen Augen an, als sei er bei etwas Verbotenem ertappt worden, dann lächelte er erleichtert.
»Du hast mich überrascht...«, sagte er atemlos.
Thomas ging zum Klavier und nahm die Notenblätter in die Hand. Es war das Klavierkonzert Nr.1 von Chopin.
|17|»Das werde ich beim Rheingau Musik Festival in diesem Jahr im Kloster Eberbach spielen. Es wird mein erster großer Auftritt werden.« Manuel seufzte. »Schade, dass Alexandra das nicht erleben darf. Sie hätte sich riesig gefreut.«
»Bestimmt«, sagte Thomas und nickte mehrmals, als müsse er das Gesagte bestätigen, »das hätte sie gewiss getan.«
Es war schrecklich, einen Freund anzulügen, aber hätte er Manuel die Wahrheit sagen sollen? Alexandra hätte aller Welt erzählt, dass sie die Freundin des Solisten sei und der Rest des Orchesters unwichtig.
Manuel schaltete die Stummschaltung des Klaviers aus, rührte einige Tasten an, horchte auf den Klang und nickte. »Wie war dein Abend? Worüber habt ihr geredet?« Furcht stand in seinem Gesicht.
Thomas biss sich auf die Lippe und zuckte mit den Achseln. »Worüber wohl – ist doch klar, oder? Alle wollen wissen, was los ist, sie fragen, ob wir mehr wissen, wir hatten ja engen Kontakt zu ihr, besonders du! Und dass die Leute neugierig sind bei so einer Sache (das Wort »Mord« wollte er lieber nicht in den Mund nehmen), finde ich verständlich.«
»Sensationsgierig sind sie, geil auf Drama, für die ist es doch nichts weiter als eine neue Soap, eine Seifenoper. Endlich ist in dem verpennten Geisenheim mal was los. Da können sie sich das Maul zerreißen. Aber was es bedeutet...«, er hielt inne, und sein Blick kehrte sich nach innen, »was es bedeutet, was dieser Verlust bedeutet, für sie, für Alexandra, für mich, für ihre Eltern...«
»Du kennst sie?«, unterbrach ihn Thomas. »Das wusste ich gar nicht.«
»Nein, ich kenne sie nicht, sie sollen morgen in Wiesbaden sein.«
»Hast du etwa mit ihnen geredet?« Thomas wunderte sich, denn Alexandra war den Fragen nach ihren Eltern stets ausgewichen, was seinen Verdacht genährt hatte, dass sie sich ihrer schämte.
|18|»Ich weiß es von der Polizei. Kurz nachdem du gegangen bist, hat dieser Typ von der Mordkommission angerufen. Ich glaube, der taucht morgen hier auf, er hat gefragt, wann wir zu Hause sind. Die wollen uns alle noch mal verhören. Du kennst ja die dummen Sprüche, alles sei reine Routine.«
»War das wieder dieser Sechser? So heißt der wohl...« Thomas erinnerte sich an das erste Gespräch oder Verhör mit dem unangenehmen Kommissar. Er ernährte sich falsch, das sah man ihm an, und Thomas hielt ihn für einen jener Polizisten, die ihre Überlegenheit herauskehren, aber in Wirklichkeit unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber Studenten litten. »Hat er irgendeinen Verdacht geäußert? Haben sie irgendwelche Spuren gefunden?«
Die Entspannung, die Manuel beim Klavierspiel gewonnen hatte, war verflogen. Seine sonst vollen Lippen waren wieder schmal geworden, er senkte die Augen, und seinem Körper entwich die Luft wie einem Ballon, der in sich zusammenfiel.
»Es gibt keinerlei neue Hinweise, bislang... hat dieser Sechser gesagt. Alexandra muss ihren Mörder in die Wohnung gelassen haben. Es sind keinerlei Einbruchsspuren gefunden worden. Es gibt keine Hinweise auf einen Kampf oder darauf, dass sie sich gewehrt hat. Abwehrverletzungen nennt man das wohl. Es ist ein grausiges Vokabular.« Bittend sah er Thomas an. »Können wir nicht von etwas anderem reden?«
»Vorhin haben sie mich gefragt, wer alles einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte. Woher soll ich das wissen? Vielleicht eine ihrer Freundinnen, die Rosa Handtaschen?«
Ein verzweifeltes Kopfschütteln war alles, was von Manuel kam. »Bitte, hör auf, mir solche Fragen zu stellen.«
»Was ist mit ihrem Mobiltelefon?«
»Ich habe nicht danach gefragt, ehrlich gesagt habe ich es vergessen«, sagte er unwillig. »Außerdem war ich froh, als das Gespräch vorüber war. Der Kommissar ist direkt auf |19|mich losgegangen, so als zweifelte er an allem, was ich sagte, so von oben herab, weißt du?«
Manuel war am Ende seiner Kräfte. Seine Freundin war tot, ermordet. Es war für Thomas schwer zu begreifen, wie viel Alexandra Manuel bedeutet hatte. Sie war zwar nicht seine erste Freundin gewesen, aber die erste, von der er meinte, geliebt zu werden. Er verkniff sich weitere Fragen und ging zu dem Bord neben dem Piano, wo der Flaschenkühler stand. Der Rest in der grünen Flasche reichte kaum, um ein Glas zu füllen.
»Ich hole eine neue«, sagte Manuel entschuldigend und stand auf. »Ich habe zu viel getrunken. Mit den Noten hat es heute nicht so geklappt. Die wollten nicht in meiner Art gespielt werden.« Er grinste verlegen. »Aber ich habe die ganze Scheiße für eine Weile vergessen. Wenn Regine kommt, trinkt sie vielleicht noch ein Gläschen mit, oder?«
»Wo ist sie eigentlich?« Thomas blickte auf die Uhr. Es war Viertel vor eins. »Sonst...«
In diesem Moment hörten sie Schlüssel klimpern. Leise, als wolle sie niemanden wecken, trat ihre kleine Mitbewohnerin in den erleuchteten Flur. Sie hatte offenbar nicht erwartet, ihre beiden Wohnis, wie sie ihre Mitbewohner nannte, noch munter anzutreffen. Um acht Uhr begann die Vorlesung zur Agrarmeteorologie, die sie alle gemeinsam belegt hatten.
»Noch Lust auf einen kleinen Schlaftrunk?«
Regine nickte begeistert, obwohl sie todmüde zu sein schien. »Ich habe den ganzen Abend über keinen Tropfen angerührt, obwohl Thorsten mich...«, erschrocken hielt sie inne, und ihre Wangen überzogen sich mit einem feinen Rot. Thomas und Manuel kapierten es sofort: War der Fall eingetreten, den Regine für die Zeit ihres Studiums immer weit von sich gewiesen hatte? Den Annäherungsversuchen ihrer Kommilitonen wich sie stets mit Bravour aus, hatte auch die gut gemeinten immer mit einem coolen Spruch |20|beendet, darin war sie klasse. Und nun tauchte ein Thorsten auf? In jeder anderen Situation hätten Thomas und Manuel sie nach ihrer neuen Bekanntschaft gelöchert, aber nach einem Seitenblick auf Manuel, dem sein kläglicher Gemütszustand ins Gesicht geschrieben war, hielt Thomas sich zurück.
»Gibt’s irgendwas Neues?«, fragte sie vorsichtig. »Wisst ihr inzwischen mehr?« Es war klar, worauf sich ihre Frage bezog.
Manuel überließ Thomas die Antwort. Er ging in die Küche, sie hörten, wie er den Kühlschrank öffnete und wieder schloss und laut in der Schublade mit dem Besteck herumkramte.
»Der Korkenzieher ist in der mit dem Kleinkram«, sagte Regine, die ihm mit Thomas gefolgt war.
Manuel starrte auf den Korkenzieher in seiner Hand und dann auf den Schraubverschluss der Flasche. »Es gibt keine neuen Erkenntnisse.« Mit einem Knacken brach der Schraubverschluss, ein langweiliges Geräusch im Vergleich zum Herausrutschen eines Korkens. »Jedenfalls hat die Polizei nichts in der Richtung verlauten lassen. Ach – nur dass in ihrer Küche eine angebrochene Flasche Riesling stand – und zwei sauber abgewaschene und abgetrocknete Gläser, nicht ein Fingerabdruck war drauf. Da hat sich jemand Mühe gegeben, seine Spuren zu beseitigen.«
»Würdest du dich als Mörder anders verhalten?«
Manuel überging Thomas’ Einwand.
»Ein Riesling zum Abschied– Weingut Altensteineck?« Regine schüttelte den Kopf. »Ganz ordentlich, aber nichts Besonderes. Wundert mich, dass Alexandra so was getrunken hat.«
Mit einem Glas in der Hand setzte sich Regine an den Küchentisch und hielt es Manuel am ausgestreckten Arm hin. »Ich bin sicher, dass man den Mörder bald fasst. Man traut sich nachts ja gar nicht mehr auf die Straße.«
|21|»Woher weißt du, dass es ein Mann war?«, fragte Thomas und steckte seine Nase ins volle Glas.
»Ist doch logisch. Eine Frau schlägt nicht zu. Eine Frau mordet anders.«
»Als wir neulich die Pfähle in der Neuanpflanzung gesetzt haben, hast du dich mit voller Kraft reingehängt, nicht anders als ein Mann. Wenn es eine Winzerin war, eine angehende zumindest?« Wer ihm dabei kurz in den Sinn gekommen war, ließ sich Thomas nicht anmerken.
»Übrigens...« Thomas wurde gewahr, dass Manuel längst nicht genügend Abstand hatte, um darüber zu reden, deshalb wechselte er das Thema. »Ich wollte fragen, Regine, ob du am Wochenende mit uns rauf in die Pfalz kommst. Wir müssen spritzen, und du kannst die Düsen besser einstellen als ich. Während der Lehre hatte ich kaum Gelegenheit dazu. Du hast das schon auf eurem Weingut gemacht.«
»Und was war letztes Jahr? Du warst dabei.«
»Ja, mit dem alten Betriebsleiter des Vorbesitzers, von dem wir das Weingut übernommen haben. Aber der will keine Neuerungen, der ist unfähig, was zu lernen, und er kann nicht erklären.«
»Genau wie mein Vater.« Regine verzog gequält das Gesicht. »Ihr Quereinsteiger habt es leichter.« Damit meinte sie Thomas und auch dessen Vater, der als ehemaliger Chef-Einkäufer eines Weinimporteurs das Weingut übernommen hatte. Manuel hingegen war Neueinsteiger, er hatte nach dem Finanzstudium in der Schweiz lediglich ein halbjähriges Praktikum auf einem Weingut absolviert.
»Dafür haben wir andere Probleme, du Klugscheißerin. Was ist? Kommst du mit?«
»Am Wochenende muss ich selbst auf den Schlepper.«
»Auch nachts? Und was sagt Thorsten dazu?«
»Jetzt meinst du wohl, dass du mich erwischt hast, nicht wahr? Außerdem haben wir ein Gerät mit Radialgebläse, und ihr habt eins mit Tangentialgebläse. Und ihr habt ein |22|Recyclingsystem. Damit würde ich auch lieber arbeiten, aber mein Alter... na ja, ihr fangt eben in der Gegenwart an, und wir leben in der Vergangenheit. Frag doch morgen einfach die Techniker drüben vom Weinbau, die erklären dir alles.« Sie trank ihr Glas aus, stellte es unsanft auf den Tisch, umarmte Manuel und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Frühstück um sieben Uhr? Ich gehe pennen...«
Thomas und Manuel blieben zusammen, bis die Flasche leer war. Thomas meinte Manuel alles berichten zu müssen, was während des Essens an diesem Abend geredet worden war.
»Haben sie ihn schon?« Die pausbäckige Verkäuferin in der Bäckerei sah Thomas mit großen Augen an und tastete derweil nach den Roggenbrötchen im Korb hinter ihr. »Sie wollten drei haben, oder?«
Die Fragen nach dem Mörder hingen Thomas zum Halse heraus, obwohl er sie sich natürlich selbst auch stellte. Es hatte den Anschein, dass die gesamte Bevölkerung des Städtchens wusste, dass er mit dem Freund des Mordopfers zusammenwohnte und Alexandra gekannt hatte.
»Was für ein hübsches Mädchen«, sagte die Verkäuferin und steckte noch zwei Kümmelbrötchen in die Tüte, dann stutzte sie, runzelte die Stirn. »Jetzt habe ich doch vier Roggenbrötchen genommen. Drei wollten Sie haben, oder?«
Thomas zwang sich ein Lächeln ab. »Und drei Stütchen, also Rosinenbrötchen. Und dann nehme ich noch ein Dinkelbrot.« Vielleicht konnte er sie mit Bestellungen von ihren Fragen abbringen. Doch die Verkäuferin blieb hartnäckig.
»Ich verstehe nicht, wie jemand einer so hübschen Frau was antun kann. Was sind das nur für Menschen heutzutage?«
»Keine Ahnung. Möglicherweise...« Thomas tat geheimnisvoll und beugte sich über den gläsernen Tresen, »möglicherweise läuft der Mörder noch in der Stadt herum!« |23|Er machte ein so finsteres Gesicht, dass die Verkäuferin zweifeln musste, ob er sie ernst nahm. Beleidigt packte sie die Brötchen ein.
»Es kann doch nicht sein, dass man sich über eine so ernste Sache lustig macht, das ist... Sie wissen bestimmt mehr, als Sie mir sagen.« Sie nickte, um sich selbst zu bestätigen. »Wahrscheinlich hat die Polizei Sie vergattert, den Mund zu halten? So wird es sein, damit die Untersuchung nicht gefährdet wird.« Das hörte sich ganz wichtig an.
»Das Dinkelbrot, bitte...« Thomas hatte die Tüte mit den Brötchen in Empfang genommen und streckte die andere Hand aus, als eine Kundin den Laden betrat, die mit Vornamen begrüßt wurde. Die Verkäuferin brannte darauf, ihr zu erzählen, dass jemand aus dem Dunstkreis des Mordopfers neben ihr stand. Sie gab Thomas die Tüten, er zahlte, verstimmt über das Gespräch und dass hier niemand so schmackhaftes Brot buk wie ihr Edelbäcker in Köln, der auch nicht wesentlich teurer gewesen war. Mit einem hinterhergeworfenen »Schönen Tag noch« wurde er verabschiedet.
Er hatte sich notgedrungen Manuels Rennrad ausgeliehen und es vor dem Schaufenster der Bäckerei abgestellt. Durch die Scheibe sah er die beiden Frauen tuscheln, und die Verkäuferin zeigte mit dem Finger auf ihn wie auf den Mörder persönlich. So würde man ihm überall begegnen, bis der tatsächliche Mörder gefasst wäre. Es graute ihm vor den Fragen an der FH, mehr noch waren es die Blicke, die ihn verunsicherten, besonders wenn er neben Manuel den Hörsaal betrat.
Der Besuch im Supermarkt, wo er Aufschnitt fürs Frühstück kaufen wollte, war angenehmer, hier wechselte das Personal mit den Minijob-Verträgen so häufig, dass niemand mehr einen Kunden kannte. Er kaufte Käse und gekochten Schinken, Regine bestand darauf, und nahm eine Packung aus dem Kühlregal, um das Kleingedruckte zu |24|lesen. Wie leicht vergriff man sich, packte Kunstkäse in den Einkaufswagen und kam mit Pseudo-Schinken nach Hause. Man musste schon genau hinsehen. Nichts war so, wie es aussah, sogar beim Wein: Wenn Riesling auf dem Etikett stand, konnten durchaus fünfzehn Prozent Weißburgunder in der Flasche sein. Das, was er für Betrug hielt, war legal.
Als ihn das Mädchen an der Kasse anblickte, stand schon wieder diese verdammte Frage im Raum. Der Gedanke an den Mord ließ ihn nicht los, seit sie am Dienstag davon erfahren hatten. Es fiel Thomas schwer, sich auf seine Angelegenheiten zu konzentrieren, auf das Studium, auf die Vorlesung in Mikrobiologie heute, er hatte nicht einmal die der letzten Woche wiederholt. Er durfte den Anschluss nicht verpassen. Er musste den Spritzplan für ihr Weingut aufstellen, auch den für seine Arbeitsgruppe. Er hatte fest mit Regines Hilfe gerechnet und nicht bedacht, dass ihr Vater wie immer mit alter Technik auf der Stelle trat.
Thomas hängte sich die Tasche auf den Rücken und stemmte sich in die Pedale. Manuel würde in seinem Zustand in Bad Dürkheim sicher auch keine Hilfe sein. Ob es gut war, ihn mit Arbeit zu überschütten? Sie hatten ihren eigenen Versuchsweinberg angelegt, genau nach Geisenheimer Vorbild, nur dass sie zu Hause völlig auf sich gestellt waren.
Dieser verfluchte Mord. Wer kam auf eine so beknackte Idee? Was hatte Alexandra getan, gewusst oder unterlassen, dass jemand sie aus dem Weg räumen wollte?
Thomas sah den Wagen im letzten Moment aus der Einfahrt kommen. Er riss an den Bremsen, die Tasche rutschte vom Rücken, die Brötchen kullerten über den Asphalt – aber das Rad stand. Eine Bleistiftlänge trennte ihn von der Motorhaube des Wagens. Die Fahrerin ließ wenig gerührt die Scheibe herunter, entschuldigte sich kurz – und fuhr die Brötchen platt. Thomas starrte ihr nach... das war heute nicht sein Tag...
|25|2
Heute stand sie zufällig mal als Erste in der Warteschlange und hätte sofort auf die Fähre fahren können, dummerweise sprang jetzt der verflixte Motor nicht an. Hinter ihr wurde gehupt, der Einweiser auf der Fähre fuchtelte in der Luft herum, er sorgte für Stress. Erst nachdem sie den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen und wieder hineingesteckt hatte, entschloss sich der Computer – ein Auto konnte man ihren neuen Peugeot längst nicht mehr nennen – aufzuheulen. Natürlich fuhr sie zu schnell über die Ladeklappe, hatte einen kurzen Aufsetzer und hielt drei Zentimeter vor dem Einweiser, der nicht einen Schritt zurückgewichen war. Er dachte sicher was Blödes über Frauen, doch das war Johanna Breitenbach schnuppe. Sie gab den Blick genauso unverfroren zurück. Der Mann musste neu sein, die meisten Einweiser kannte sie vom häufigen Übersetzen, schließlich nutzte sie die Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim mehrmals pro Woche, um zur Fachhochschule nach Geisenheim zu kommen, wo sie, wie auch an der FH in Bingen, über Umweltschutz dozierte. Im letzten Winter, als der Fährverkehr kurzfristig eingestellt worden war, hatte sie einen riesigen Umweg über Mainz und Wiesbaden in Kauf nehmen müssen.
Johanna stieg aus und stützte sich auf die Reling neben der Schranke. Was hinter ihr geschah, interessierte sie nicht, vor ihr lag der Rhein und glänzte kalt wie flüssiges Silber in |26|der Morgensonne. Es war kühl für die Jahreszeit, der Wein war vom Austrieb her erst im Fünf-Blatt-Stadium, wie es ihre Kollegen nannten, dafür war das Licht grandios, und Johanna hätte auch eine Überfahrt von einer Stunde in Kauf genommen, denn das Panorama der Rheinlandschaft war gewaltig. Nach dreißig Kilometern in Ost-West-Richtung knickte der Strom genau am Binger Loch nach Norden ab und brach zwischen Taunus und Hunsrück durch, um seinen bisherigen Lauf in Richtung Norden fortzusetzen. Die rechtsrheinischen Weinterrassen oberhalb von Rüdesheim boten nicht nur einen strahlenden Anblick, sie erinnerten Johanna auf angenehme Weise an ihre Arbeit. Seit einem Jahr versuchte sie, den angehenden Önologen der Hochschule und aufgeschlossenen Winzern sowohl im Rheingau wie auch auf der Rheinhessischen Seite einen wirtschaftlichen Umgang mit Energie zu vermitteln.
Die fossilen Brennstoffe gingen zu Ende, die Zeit wurde knapp, die Preise wurden ins Uferlose gesteigert, die Länder würden sich gegenseitig überbieten, und wer sich nicht rechtzeitig umzustellen verstand, würde als Sklave in den Händen der Energiekonzerne enden und untergehen. Und die Klimaerwärmung nahm mit der Umweltverschmutzung zu. Dass die Entwicklung eine andere Richtung nehmen würde, hielt sie für ausgeschlossen. In der Hinsicht war sie pessimistisch. Nach zwanzig Jahren als Umweltingenieurin traute sie weder den Regierungen noch den Konzernen zu, ihr Konzept zu ändern und sich auf neue Bedingungen einzustellen.
Ihre Zeit als Dozentin hatte ihr Vertrauen in die Zukunft nicht gestärkt, im Gegenteil. Sämtliche deutschen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt in den vergangenen zwanzig Jahren waren durch den Dreck, den Chinas Wirtschaftswachstum innerhalb von sechs Monaten hervorrief, aufgehoben worden. Jede weitere Krise diente sowohl den Politikern wie auch der Wirtschaft als Vorwand, auf Wachstum zu setzen und weiterzuwursteln wie bisher. Dabei pinselten |27|die Marketingstrategen alles »grün« an, äußerst »nachhaltig« natürlich, aber nur, um ihre Mitmenschen noch mehr zu verwirren. Die Strategen besaßen sicher in kühleren und hoch gelegenen Gegenden ihre Villen, ihre Top-Restaurants mit der entsprechenden Weinkarte und den Golfplätzen, wo die unterirdisch verlegte Bewässerung das Green saftig machte. Waren diese Menschen nur dumm, oder waren sie bösartig? Johanna hielt das Letztere für wahrscheinlicher, anders konnte sie sich den langsamen Atomausstieg und den halbherzigen Ausbau von erneuerbaren Energien nicht erklären. Oder trieb sie die Geldgier? Waren sie nur überfordert?
Wahrscheinlich war von allem etwas dabei, und das war eine gefährliche Mischung. Das ließ ihr die Mitmenschen fremd werden, auch die hinter dem Lenkrad ihrer Autos auf der Fähre. Außer ihr war nicht einer ausgestiegen, um den Morgen und das Übersetzen über den wunderbaren Strom an der frischen Luft zu genießen, mit Blick auf die grünen Weinberge und dem Wind im Gesicht.
Sollten sie sich selbst kaputt machen. Was interessierte sie die Zukunft? Sie wurde bald fünfzig, hatte keine Kinder, um deren Aussichten sie sich hätte sorgen müssen, und gegen die zunehmende Erderwärmung hatte sie eine Klimaanlage im Wagen. Immer häufiger entdeckte sie an sich einen Zug zum Zynismus. Sie geriet in diesen Sog, aus dem sie sich nicht würde befreien können, sie haderte mit ihrer Rolle als Dozentin, manchmal sogar, wenn sie vor den Studenten stand.
Sie predigte gegen Mauern. Ihre jungen Zuhörer nahmen es zwar mehr oder weniger an, aber spätestens im Beruf würden die viel zitierten Sachzwänge sie in ihren Weingütern auf den Boden der Tatsachen zwingen, und die hießen Kosten und Profit. Johannas Zynismus hatte sie sogar schon einmal so weit gebracht, für die Gegenseite zu arbeiten. Dabei war sie kläglich gescheitert und ihre Ehe in die Brüche gegangen. Trotzdem hatte sie sich nicht von Carl scheiden lassen. Die Wunden waren verheilt, das Vertrauen |28|war wieder gewachsen, und ihr stand Carl von allen Menschen am nächsten. Er war schlicht von seinem Wesen her und ohne Arg. Vielleicht war das die Voraussetzung, dass sie sich auf ihn verlassen konnte. Und er tat, was er sagte. Aber da gab es noch Markus. Früher hätte man jemanden wie ihn einen jugendlichen Liebhaber genannt. Er sah gut aus, er war intelligent, er war wirklich ein guter Liebhaber. Aber sie liebte ihn nicht, sie war nicht einmal in ihn verliebt.
Johanna spürte das Vibrieren des Schiffskörpers, dann hörte sie das übliche Schrammen der Ladeklappe über den Beton der Rampe. Die Fähre legte ab, nahm Fahrt auf, und jenseits der Mole schlingerte sie leicht. Trotz der frühen Stunde herrschte viel Verkehr auf dem Rhein, und hier, vor der engen Fahrrinne des Binger Lochs drängten sich die Schlepper und Schubeinheiten zusammen, nachdem sie die breiteste Stelle des Rheins passiert hatten.
»Nur eine Person?«, fragte plötzlich ein Mann hinter ihr, und Johanna wandte sich rasch um. »Das ist doch Ihr Auto, nich?« Der Mann mit der Geldtasche vor dem Bauch zeigte auf den blauen Peugeot. Es war der Kassierer. Als Johanna nickte, verlangte er »dreieurofumzich«.
Ein Osteuropäer, dachte sie und erinnerte sich daran, dass im Rheingau kaum noch eine Traube von Deutschen gelesen wurde. Die Weinlese war, wie das Spargelstechen, fest in polnischer Hand. Alle Arbeiten im Weinberg waren »outgesourct« und wurden seit Jahren von denselben Arbeitern ausgeführt. Bei dem Winzer, den sie zuletzt beraten hatte, waren es zwei Großfamilien aus einem polnischen Dorf, die sich mittlerweile zu Experten für Boden- und Laubarbeiten und die Lese entwickelt hatten. Aber mit der »Harmonisierung« der europäischen Sozialgesetze würde das vorbei sein. Würden dann die Deutschen wiederkommen und die Trauben auf dem Gebirgszug ihr gegenüber lesen?
|29|Vom Fluss aus wirkte er mächtig, mitten drin das Niederwalddenkmal. Sie mochte das Denkmal nicht, die Germania mit Krone und Schwert, genauso wenig wie die anderen, mit denen Siege gefeiert wurden, denn es siegten immer nur wenige. Hundertachtzigtausend Männer waren im Deutsch-Französischen Krieg von 1871 gefallen. Wie sympathisch waren dagegen die Weinstöcke ringsum. Sie wusste von keinem Krieg, der um Weintrauben geführt worden war. Der Hang war zu zwei Dritteln bepflanzt, nur den Kamm bedeckte dichter Wald. Alles war mit Riesling bestockt. Die Terrassen begannen unten am Ufer an der Ruine von Burg Ehrenfels. Sie markierten die Stelle, wo der Fluss nach Norden abbog und das Mittelrheintal begann. Ein Zaun hatte sie bei ihrer letzten Wanderung gehindert, die Burg zu betreten, die jetzt Wanderfalken als Heimstatt diente. Ob man den Zaun abreißen würde, wenn die Falken weiterwanderten?
Der Weinberg darüber war der Schlossberg, mit siebzig Prozent Steigung die steilste Lage im Rheingau, wie sie von einem ihrer Studenten erfahren hatte. Der Boden bestand aus Schiefer und Taunusquarzit. Angeblich fand sich das im Weingeschmack wieder, doch das zu beurteilen, fühlte sie sich außer Stande. An den Wein hatte Carl sie herangeführt, aber bevor sie wieder über ihre Beziehung ins Grübeln geriet, schüttelte sie die Gedanken ab.
An den Schlossberg grenzte der Rottland, groß stand sein Name in weißen Lettern inmitten der Reben, so wie Hollywood über der US-Filmstadt. Darüber lag der Berg Roseneck, nur der Drachenstein reichte noch höher hinauf. Hier wurde das Terrain flacher, der Boden anders, wie ihr der Student erklärt hatte, tiefgründiger, er setzte sich aus Löss und Lehm zusammen, womit er auch mehr Wasser zurückhalten konnte. Die Bodenbeschaffenheit wiederum führte beim Wein zu einem reicheren Körper und ausgeprägten und vielseitigen Aromen. So bewusst, um dieses Urteil zu bestätigen, hatte sie Wein noch nie probiert. Vielleicht sollte |30|sie mit ihren Studenten zusammen an der Vorlesung für Sensorik teilnehmen? Einen Riesling zu jedem Bodentyp probieren und dazu vielleicht noch eine Bodenprobe vor sich liegen haben, die Auskunft über Beschaffenheit, Struktur, Farbe und Körnung gab? Durch ihre Arbeit tauchte sie immer tiefer in das Thema ein, obwohl ihr doch eigentlich die technischen und physikalischen Prozesse wichtig waren. Schaden würde das auf keinen Fall, und ein klares Urteil zum Wein würde ihr Ansehen bei den Winzern sicher steigern. Ihre Arbeit hatte sie bisher weniger unter dem Gesichtspunkt des Genusses und des Gefühls betrachtet. Dabei gab es kaum einen Wirtschaftsbereich wie den Weinbau, der so mit Emotionen verknüpft, ja oft sogar von unerträglichem Getue begleitet war, das sonst nur um Sterne-Köche und TV-Sternchen gemacht wurde.
Bei dem Gedanken an den Weißwein, den sie gestern Abend auf dem winzigen Balkon ihrer Binger Wohnung getrunken hatte, hob sie den Kopf und sah wieder hinauf zum Berg, der sich östlich von Rüdesheim zum Wald hin abflachte. Davor stand die Abtei St. Hildegard, ein mächtiges, graubraunes neo-romanisches Bauwerk, in seiner Schwere und Düsternis wenig anheimelnd, geschweige denn vertrauenerweckend. Obwohl die historische Hildegard von Bingen eine bemerkenswerte Person gewesen sein mochte (nirgends wurde so viel gelogen wie in Biographien und in der Politik), empfand sich Johanna viel zu sehr der Welt zugewandt, um sich auf Religionen einzulassen. Sie war der Wissenschaft verhaftet, und sie glaubte, was sie mit eigenen Augen sah und selbst erlebte.
Bevor sie zu ihrem Wagen zurückging, schaute Johanna noch einmal wehmütig auf das Wasser. Im letzten Herbst war sie bei Sturm mit ihrem Surfboard zwischen Oestrich-Winkel und Walluf über die aufgewühlten Fluten geglitten – weggeweht und hingegeben – und schnell genug, um nicht von der Strömung vor einen Schlepper getrieben zu werden. |31|Im Sommer vermisste sie dieses mitreißende Vergnügen. Sie sollte wirklich mal eine der Frauen besuchen, die sie vor einigen Jahren am Neusiedler See kennengelernt hatte, und dort wieder surfen. Das war mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden, deshalb hatte sie es sich bislang verkniffen. War der Laacher See nicht auch ganz schön und in einer guten Stunde zu erreichen?
Als Johanna den Schriftzug »Asbach« an der Hauswand auch ohne Brille lesen konnte, Kontaktlinsen trug sie nur beim Surfen, wurde es Zeit, sich hinters Lenkrad zu klemmen – der Motor sprang sofort an–, und als Erste verließ sie die Fähre. Sie überquerte die Gleise und befand sich auf der Promenade, die um diese Zeit mehr von gehsteigfegenden Hotelportiers und chinesischen Souvenirverkäufern bevölkert wurde als von Touristen. Die würden nicht vor elf Uhr aus den Bussen tappen, danach war kaum noch ein Durchkommen. Was machte dieses Städtchen bei ihnen so beliebt? Eltville war um vieles schöner und sehenswerter, Oestrich romantischer und gediegener – aber vielleicht suchten die Touristen gerade jene Welt der Postkarten, Schlüsselanhänger und Schoppengläser mit geriffeltem Fuß. Und was trieb die Menschen in die enge Drosselgasse?
Sie kam schnell voran, noch war wenig Verkehr, und am Ortsausgang bog sie links in die Rüdesheimer Straße, die sie direkt zur FH führen würde. Die Brentanostraße, wo man ihr ein winziges Büro in der alten Villa zur Verfügung gestellt hatte, fanden nur Eingeweihte. Sie betrat das alte Gebäude und ging hinauf in den ersten Stock. Als sie die Tür aufschloss, kam die Sekretärin aufgeregt aus dem Nebenzimmer.
»Haben Sie schon von dem Mord gehört?« Der Frau stand eine Mischung von Faszination und Abscheu im Gesicht.
Johanna schüttelte abwehrend den Kopf. Sensationsgeschichten waren ihr zuwider. Sie öffnete die Tür, nahm den bekannten Geruch von Mauerwerk und Papier wahr, der dem Raum anhaftete, sodass sie meistens bei offenem |32|Fenster arbeitete oder sich unten in der Küche am Automaten einen Kaffee holte, dessen Aroma den Raum wundersam verwandelte. Sie drehte sich noch einmal um, sie wollte nicht unfreundlich wirken.
Die Sekretärin folgte ihr. »Lesen Sie keine Zeitung, Frau Breitenbach? Wir sind alle zutiefst schockiert und entsetzt! Unglaublich, dass bei uns so etwas passieren kann – bei uns! Und Sie haben wirklich nichts davon gehört?«
Johannas Unwissenheit irritierte die Sekretärin genauso wie ihr Desinteresse an einer so abscheulichen Tat, der sie offenbar gleichgültig gegenüberstand.
»Und wer ist ermordet worden?«, fragte sie, Anteilnahme heuchelnd und überzeugt, wieder ein Bild-Zeitungsdrama aufgetischt zu bekommen.
»Alexandra, Alexandra Lehmann, eine unserer Studentinnen. Sie kannten sie wahrscheinlich. Ein bildhübsches Mädchen, nein, eine junge Frau, sie war kaum zu übersehen, eine auffällige Erscheinung, sehr ungewöhnlich für unsere Studenten: Ziemlich groß, eine gute Figur, und sie sah gut aus, ein feines Gesicht. Blond, meist hochgestecktes Haar, sehr gepflegt, auch von der Kleidung her, ein ausgefeilter Geschmack. Sie zeigte überdurchschnittliche Leistungen, sie hätte das Studium mit Bravour gemeistert und ihren Weg gemacht. So einer jungen Frau stand die Welt offen, ohne Zweifel. Aber dann – ein Mord – eine Katastrophe.«
Johanna brauchte einen Moment, bis sie das Gesagte begriff. »Eine unserer Studentinnen wurde ermordet? Richtig so...?«
»Wie – richtig so? Mord ist Mord, ob Sie es glauben oder nicht, ja, in ihrer Wohnung erschlagen. Am Montag hat man sie gefunden. Ihre Wirtin war’s, in ihrem Apartment.« Die Sekretärin war noch immer empört.
»Die Wirtin hat sie ermordet?«
»Ach, Sie sind aber schwer von Begriff. Die Vermieterin hat sie gefunden.«
|33|Johanna glaubte noch immer, sich verhört zu haben. Erschlagen? Hier in diesem friedlichen Städtchen hatte sich ein Mord ereignet? Unmöglich. Die Sekretärin musste etwas durcheinanderbringen.
»Vielleicht haben Sie sie ja auch nicht bemerkt, Sie sind ja nicht so oft hier, Frau Breitenbach.«
Hörte Johanna da einen Unterton von Kritik heraus? Wieso sollte sie öfter herkommen, wenn sie lediglich einen Lehrauftrag hatte, der sie zwei Mal pro Woche hierher führte oder zu den unvermeidlichen Konferenzen?
»Sie haben ja nur mit den angehenden Önologen und den Getränketechnologen zu tun und weniger mit den Internationalen Weinwirtschaftlern.«
»Das stimmt«, sagte Johanna nachdenklich. Ökologie und Umweltschutz oder Energietechnik gehört bei Weinwirtschaftlern weder zu den Pflichtveranstaltungen noch zu den Profil- oder Wahlmodulen, wie die freiwilligen Veranstaltungen inzwischen hießen. Sie versuchte, sich an ihre Studenten zu erinnern, aber das von der Sekretärin beschriebene Gesicht war nicht darunter. Es wäre ihr aufgefallen.
»Aber auffällig war sie doch, kaum zu übersehen. Die Lehmann trat immer mit zwei Freundinnen auf, die studierten zusammen.« Die Sekretärin kicherte verstohlen. »Die Rosa Handtaschen hat man sie genannt.«
»Wie heißen die?« Johanna meinte, sich verhört zu haben.
Ein verlegenes Schulterzucken begleitete die Antwort. »Rosa Handtaschen. Ich habe es nicht erfunden. Es kam von den Studenten. Eine hat mir das mal erzählt, weil sie alle drei am selben Tag mit rosa Handtaschen in die FH gekommen sind.«
Johanna fand es lächerlich. »Weiß man schon...«
»...wer der Täter ist?«, beendete die Sekretärin die Frage. »Nein. Es gibt keine Spur, soweit ich weiß. Die Kripo hält sich bedeckt, Sie wissen ja, um die Ermittlungen nicht zu gefährden«, flüsterte sie, »aber die taucht bestimmt noch bei uns auf – die Mordkommission.«
|34|War es unfair, dass Johanna der Sekretärin unterstellte, sich bestimmt darüber zu freuen?
»Also wenn Sie mich fragen...«, die Sekretärin hielt inne, »...einer aus Ihrem Seminar war mit der Lehmann befreundet, ja, er war ihr Freund, der wird bestimmt mehr wissen. Stern heißt er, Manuel Stern, er stammt aus München, ein piekfeiner Junge und ein Pianist.«
»Der studiert Weinbau?«
»Warum soll ein Student nicht Klavier spielen? Der soll ziemlich gut sein, hat man mir gesagt, tritt auch öffentlich auf. Und beim Rheingau Musik Festival wird er in diesem Jahr dabei sein, richtig mit einem Orchester und so, das werde ich mir anhören. So jemanden hatten wir hier noch nie...«
»Ich muss los, Sie entschuldigen mich, ich muss mich vorbereiten«, sagte Johanna, um die Frau loszuwerden. Sie griff nach ihrem Rechner und der ledernen Handtasche, sah sie befremdet an, aber sie war nicht rosa, sondern beige.
Als die Sekretärin ging, spürte Johanna den missbilligenden Blick im Rücken, während sie zur Kaffeeküche ging, um sich einen Cappuccino zu holen. Die Vorlesung begann um zehn Uhr, sie hatte noch Zeit, ihre Präsentation einmal durchlaufen zu lassen und sich Fragen zu den diversen Themenbereichen in Erinnerung zu rufen. Sie fühlte sich in ihrem Thema so sicher, dass sie kein Konzept benötigte. Um die sechzig bis siebzig Studenten anderthalb Stunden lang unter Kontrolle zu halten, musste sie die jungen Leute einbeziehen, und das geschah am besten anhand der Erfahrungen, die sie während des Praktikums, ihrer Winzerlehre oder im elterlichen Betrieb gemacht hatten.
Vor dem Hörsaal blieb Johanna irritiert stehen. An anderen Tagen hatte sie bereits im Flur ein hoher Geräuschpegel erwartet, die Tür war von debattierenden Studenten umlagert, die sich weniger über die Inhalte der bevorstehenden Veranstaltung unterhielten als über den gestrigen Abend. |35|Aber heute herrschte Stille. Niemand wartete auf Johanna, um sie mit Fragen zu löchern oder Ratschläge einzuholen. Aus dem Hörsaal drang nur Gemurmel, die Stimmung war gedämpft. Drei Gruppen hatten sich um jeweils eine Person geschart, zwei junge Männer und eine junge Frau, die Johanna als sehr interessierte und aufmerksame Zuhörer kannte. Der größte von ihnen, ein hoch aufgeschossener Mann mit gestutztem Bart und schwarzem Haar hatte sich neulich wegen einer individuellen Beratung »unseres« Weingutes an sie gewandt – sicher war das seiner Eltern gemeint. Sie war sich nicht sicher, ob er besonders motiviert, krankhaft ehrgeizig oder ein eitler Streber war. Seine Fragen jedoch hatten nicht so geklungen, als ob er sich hatte aufspielen wollen. Er war ihr nicht eine Minute lang unaufmerksam vorgekommen, genau wie der schwarzhaarige Lockenkopf und die kleine lebhafte Studentin, die meistens zusammenhockten. Jetzt bildete jeder von ihnen den Mittelpunkt einer Gruppe.
Als man Johanna bemerkte, suchte sich jeder schweigend einen Platz. Sogar oben in der linken Ecke des Hörsaals, wo sich die Winzersöhne versammelten, war es still. Sonst quatschten sie, zuzuhören brauchten sie nicht, sie erbten irgendwann das elterliche Weingut, und damit glaubten sie, ausgesorgt zu haben.
Die außergewöhnliche Ruhe war Johanna recht. Es würde weniger anstrengend werden. Sie schloss ihr Laptop an den Beamer an, probierte beides aus, dann bat sie eine Studentin, den Inhalt der letzten Vorlesung zusammenzufassen. Als die Studentin stockte, forderte sie einen Kommilitonen auf fortzufahren. Sie hatte kein Interesse, irgendwen mit seinem Unwissen vorzuführen. Sie wollte niemanden prüfen, sie wollte lediglich an ihr Thema der letzten Woche anschließen. Aber die gedrückte Stimmung im Raum verunsicherte sie doch, so zahm hatte sie ihre Studenten nie erlebt.
»...also gut, vielen Dank für Ihre Ausführungen.« Damit |36|beendete Johanna die Wiederholung. »Machen wir uns noch einmal Folgendes klar: Wir gehen von einer Verknappung der Energie aus und damit von steigenden Preisen. Durch Erhöhung unserer Preise können wir die Steigerung nicht auffangen, es würden uns Kunden wegbrechen. Also müssen wir unsere Kosten senken. Und langfristig gedacht müssen wir unsere Energiebilanz verbessern. Energie benötigen wir im Weinbau wofür?«
Merkwürdigerweise gab es heute so viele Meldungen wie sonst nie. »Für die Produktion der Trauben, für die Weinbereitung und die Vermarktung.«
»Richtig. Einen Teil der Energie dafür bekommen wir gratis – von der Sonne, wenn wir die Blätter für die Photosynthese als Kollektoren sehen und den Regen als Ersatz für Bewässerung, die bei fortschreitendem Klimawandel in einigen Regionen durchaus auf uns zukommen könnte.«
Der Konjunktiv, die Möglichkeit, dass es so werden könnte, war den Studenten geschuldet. Sie selbst war überzeugt, dass Wasser zur Überlebensfrage werden würde.
»Aber um die Photosynthese zu verbessern, benötigen wir bereits Energie, und zwar für den Schnitt der Laubwand. Sollten wir das per Hand erledigen, brauchen wir zumindest Kraftstoff für unser Fahrzeug, das uns in den Weinberg bringt. Geschieht der Laubschnitt maschinell, benötigen wir zusätzlichen Dieseltreibstoff und Strom für die Akku-Schere. Wir waren demnach bei der Erstellung und der folgenden Auswertung unserer Energiebilanz, dem folgt die Ermittlung der Energiekosten und die Berechnung der CO2-Emissionen. Wir haben eine Musterrechnung aufgemacht und ein Familienweingut in der Pfalz von der Größe von sieben Hektar angelegt...«
Niemand sprach, alle hörten aufmerksam zu. Gemeinsam wurden die Betriebsstunden pro Jahr ermittelt, von der Unterstockpflege bis zum Ausbringen des Tresters nach der Kompostierung. Bei der Festlegung des Energieverbrauchs |37|und der Kosten für die Kellerarbeiten war man sich noch einig, aber dass die Fahrten zu Kunden und Messen mit dem Lieferwagen zwecks Vermarktung der Weine die Hälfte aller Kosten ausmachte, verblüffte die Studenten. Die Bilanz ergab vierzehn Cent Energiekosten pro Liter Wein und zweihundertachtzig Gramm CO2 für den Transport.
Welche Einsparpotenziale sich in einem bisher konventionell geführten Betrieb ergaben, würden sie in der nächsten Veranstaltung behandeln. Es war allen freigestellt, sich vorab mit dieser Frage zu beschäftigen oder aus den eigenen Betrieben über Umstellungsmaßnahmen zu berichten.
Im Gegensatz zu dem sonst aufbrandenden Lärm packten die Studenten leise ihre Blocks und Kladden ein, nur wenige hatten mitgeschrieben. Die Mehrheit würde warten, bis die Zusammenfassung dieser Vorlesung im Internet abrufbar war. Während Johanna ihren Rechner herunterfuhr, dachte sie darüber nach, wie anders ihr eigenes Studium verlaufen war. Vor fünfundzwanzig Jahren hatten sie wesentlich mehr selbst entwickeln müssen, das Schwergewicht hatte auf Seminararbeit und auf Hausarbeiten gelegen und weniger auf dem Abfragen angelernten Wissens.
Allerdings war der Lehrplan in den Fachbereichen Weinbau und Getränketechnologie derart umfangreich, dass man nach den alten Methoden weit mehr als drei Jahre für den Abschluss als Bachelor benötigt hätte. Chemie, Betriebswirtschaft, Physik und Phytomedizin, Mathematik sowie Statistik waren bereits im ersten Studienjahr erledigt worden. Exkursionen, Projekte im Weinberg wie im Keller sowie Übungen waren dem dritten Studienjahr vorbehalten. Je länger Johanna hier dozierte, desto mehr lernte sie selbst. Es war unglaublich, wie kompliziert und komplex sich die Weinbereitung, die sie früher für einen eher einfachen Prozess gehalten hatte, für sie inzwischen darstellte, wenn sie zusätzlich sogar noch an Marketing, Buchführung, Informationstechnologie und das gesamte Zertifizierungs(un)- |38|wesen dachte. Die Hälfte ihres Tages (und der Nacht) verbrachten Winzer heute mit Marketing und der Organisation ihrer Büros. Einfache Weinbauern waren das längst nicht mehr.
Sie blickte auf und sah den Studenten mit dem Wochenbart vor sich, der sie wegen der Beratung angesprochen hatte. Seinen Nachnamen, Achenbach, hatte sie sich gemerkt, denn jemand hatte ihre Namen verwechselt und sie gefragt, ob sie, Johanna Breitenbach, seine Mutter sei. Sie hatte gelacht. Aber nein, sie hatte keine Kinder, ein »leider« schwang dabei im Stillen mit, doch es wagte sich nicht so weit in ihr Bewusstsein vor, als dass es ihr hätte wehtun können. Ihr Sohn? Nein, der wäre anders gewesen, jedenfalls nicht so selbstgefällig wie der junge Mann vor ihr. Der andere neben ihm mit den langen dunklen Locken kam längst nicht so selbstbewusst daher. Die Dritte des Trios blieb auf Distanz. Sie wandte sich just in dem Moment einer anderen Studentin zu, als der Bärtige zu sprechen begann. Er stellte sich als Thomas Achenbach vor, seinen Begleiter als Manuel Stern.
»Ich habe mit meinem Vater geredet«, sagte er mit einer überraschend freundlichen Stimme. »Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Zeit für einen Besuch fänden und uns beraten würden. Wir stellen unser Weingut von konventioneller auf ökologische Produktionsweise um, und da gehört ein modernes Energiemanagement dazu, also genau das, was Sie uns hier beibringen. Wenn Sie uns helfen könnten, den Betrieb auf mögliche Einsparungen hin zu analysieren...«
»In der Pfalz ist das Weingut, wenn ich mich recht erinnere?«
»Ja, bei Bad Dürkheim. Vierzehn Hektar haben wir im letzten Jahr gekauft, es ist ein hügeliges Gebiet mit verschiedenen Bodentypen. Wir hätten da ein bescheidenes Gästezimmer...« Thomas Achenbach lachte etwas unsicher, Johanna fand diesen Zug an ihm sympathisch.
|39|»Das ist was für Mönche«, ergänzte Manuel Stern freundlich. »Es ist mehr eine Zelle mit Tisch, Stuhl, Bett und drei Kleiderhaken an der Wand. Ich kenne das Zimmer, man schläft wunderbar – es ist ein Raum für das Wesentliche...«
»...aber wir zahlen natürlich auch das Hotel, wenn Sie lieber in Bad Dürkheim...« Die letzten Worte Thomas Achenbachs kamen kaum noch bei Johanna an. Sie kannte den Namen Stern nur in Bezug auf eine bekannte Dynastie von Diamantenhändlern, und sie blickte Manuel zum ersten Mal sehr bewusst ins Gesicht. Stammte er aus dieser Dynastie? Er schien ein reicher Junge zu sein, freundlich, weiche Gesichtszüge, längst nicht so hager wie sein Freund und mehr ein verträumter Typ als ein Realist, den Johanna im philosophischen Seminar erwartet hätte statt unter diesen bodenständigen Studenten. Dieser Manuel benahm sich wie ein Städter, war gut angezogen, bevorzugte Hemden mit geknöpftem Kragen statt Kapuzenpullover, er trug lederne Slipper und nicht die üblichen Laufschuhe. Er wirkte gepflegt, gut erzogen, verbindlich, aber er war auch ein wenig zaghaft und verschlossen. Jetzt zupfte ihn seine Begleiterin am Ärmel. Johanna bekam mit, wie eine Frage gestellt wurde. Sie verstand nur ein einziges Wort: Mord!
»Geht es um... die Studentin?« Johanna deutete mit dem Kopf in die Richtung, aus der die Worte kamen. »Ich habe erst heute davon erfahren. Wissen Sie mehr darüber?«
Manuel Stern schlug die Augen nieder und stöhnte. Thomas Achenbach antwortete für ihn. »Sie meinen wahrscheinlich Alexandra Lehmann.« Er machte auf Johanna den Eindruck, als würde er das Thema recht sachlich angehen. »Manuel war mit ihr befreundet, auch wir, Regine und ich, wir kannten sie. Alexandra war ab und zu bei uns – in der WG.«
»Oh, das tut mir leid – mein... mein Beileid.« Mehr wusste Johanna nicht zu sagen.
Achenbach drehte sich zu der kleinen Studentin um und |40|schob sie nach vorn. »Das ist Regine, die Dritte in unserem Wohnchaos.«
Johanna wollte nicht neugierig erscheinen, aber sich gar nicht dafür zu interessieren wäre auch falsch.
»Ich habe erst heute von diesem... schrecklichen Ereignis erfahren. Wann ist es passiert?«
»Montag hat man sie gefunden. Also wird sie am Sonntag ermordet worden sein. Am Dienstag war die Polizei bei uns und hat uns alle verhört, besonders Manuel haben sie in die Mangel genommen. Wir wissen nichts, nur das, was man sich aufgrund der Fragen der... Polizisten zusammenreimen kann. Am wichtigsten waren ihnen unsere Alibis.«
Er hat Bullen statt Polizisten sagen wollen, dachte Johanna, insgeheim lächelnd. »Und was... glauben Sie? Wer...?« Kaum hatte sie die Frage gestellt, bereute sie es auch schon wieder.
»Nichts deutet auf einen Einbruch hin.«
»Dann kannte sie ihren Mörder? Das finde ich erstaunlich.«
»Ja erstaunlich, wie schnell sich das herumspricht«, warf die junge Frau schnippisch ein.
Sie ist ein wenig verbissen, dachte Johanna und wandte sich ihr zu, halb missbilligend, halb neugierig. »Was haben Sie mit der... Sache zu tun? Sind Sie eine Kommilitonin des... äh... der... Toten?« Des Opfers – hatte sie sagen wollen, aber das wäre ihr dann doch zu theatralisch vorgekommen.
»Im weiteren Sinne bin ich das, im näheren nicht. Sie hatte den Rosa-Handtaschen-Studiengang belegt. Wir hier«, sie sah sich um, »wir sind die Handwerker, die Malocher, die glücklichen Traktoristen.«
Es hatte für Johanna den Anschein, dass diese Regine mit etwas haderte, entweder mit ihrer Rolle oder mit der Ermordeten? Versteckte sich hinter Ablehnung nicht allzu häufig bloßer Neid?
|41|»Und – haben Sie nun alle ein Alibi?« Johanna lachte gekünstelt, sie hatte etwas Lustiges sagen wollen, um sich von dem Thema zu befreien, aber ihre Frage bewirkte das Gegenteil.
Dieses Mal antwortete Manuel, er war urplötzlich wütend. »Thomas war zu Hause auf unserem Weingut. Regine war bei ihren Eltern und musste am Sonntag helfen, sie haben Riesling vom letzten Jahr für einen Kunden abgefüllt. Also hat auch sie ein Alibi. Ich bin der Einzige, der keines hat!« Er sah Johanna geradeheraus an. »Und ihre Nachbarn behaupten, wir hätten uns am späten Nachmittag gestritten – und das stimmt sogar...«