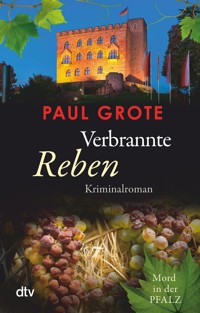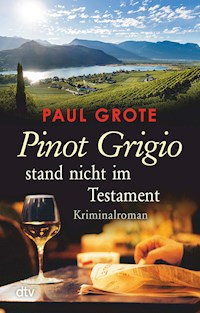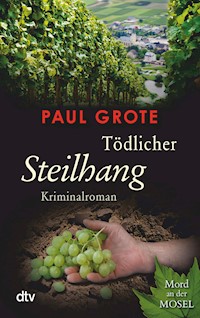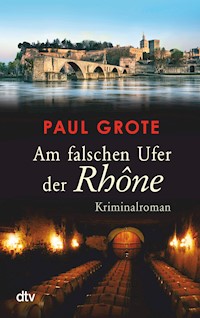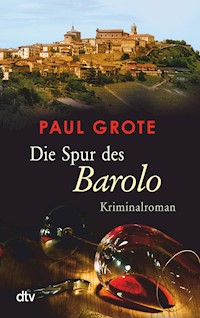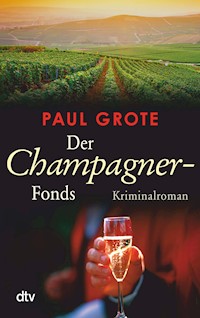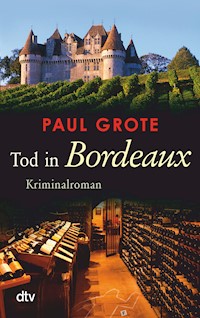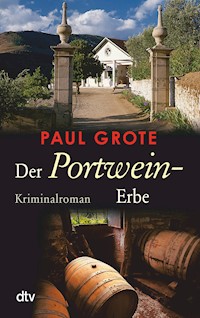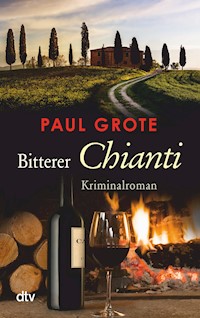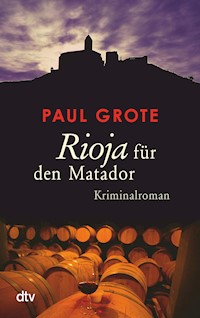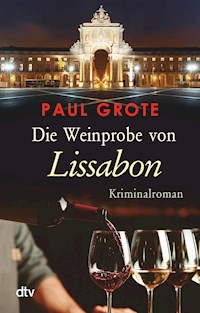
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im Wein liegt die Wahrheit. Und manchmal auch der Tod. Nicolas Hollmanns Welt scheint rundum in Ordnung zu sein: Der Familienvater gestaltet sein Weingut am Rio Douro ökologisch und zukunftsfest. Seine eingespielte Mannschaft hilft ihm dabei nach Kräften. Alles wäre gut - wären da nicht zwei Morde und ein dummer Zufall bei einer Weinprobe in Lissabon. Wie sich herausstellt geht es um Drogenschmuggel in ganz großem Stil. Hollmann kann und will die Dinge nicht auf sich beruhen lassen. Doch sein Gegner bleibt - vorerst - im Dunkeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Der Logistiker Andreas Fechter weiß, wie man Kokain schmuggelt und Morde wie Unfälle aussehen lässt. Die Dozentin Johanna Breitenbach soll portugiesischen Winzern zeigen, wie sie auf ihren Weingütern Energie einsparen, doch angesichts des Klimawandels hält sie das für nutzlos. Nicolas Hollmans Welt hingegen ist in Ordnung: Der Familienvater gestaltet sein Weingut am Rio Douro ökologisch und zukunftsfest, und seine eingespielte Mannschaft hilft dabei.
Alles wäre gut – wären da nicht zwei Morde und ein dummer Zufall bei der Weinprobe in Lissabon. Weder Breitenbach noch Hollmann lassen die Dinge auf sich beruhen. Doch ihr Gegner bleibt im Dunkel …
Da fließt ein Strom unter den großen Städten durch, ein Strom, der in Südamerika entspringt, Afrika durchquert und sich überallhin verteilt.
Roberto Saviano
Personen
Andreas Fechter, Logistiker, Lissabon
Johanna Breitenbach, Umweltingenieurin, Geisenheim
Nicolas Hollmann, Winzer am Rio Douro
Berthold Henke, Fechters Vorgesetzter
Ronaldo Malvedos, Fechters Mann fürs Grobe
Aparecida Barroso führt Fechters Geschäfte
Rosalie, Fechters Geliebte, Finanzexpertin
Quinta da Lua
Herbert Vollmer, Winzer, Ex-Finanzexperte
Karin Vollmer, seine Frau, Eventmanagerin
Eduardo Tavares, Kellermeister auf da Lua
Quinta da Tia Joana
Flávio dos Santos, Winzer
Sofia dos Santos, seine Frau
Joana, ihre Tochter
Alvaro, ihr Sohn
Quinta da Fonte
Paulo Oliveira, Winzer
Pedro Oliveira, sein Bruder
Henry Meyenbeeker, Journalist aus La Rioja
José Maria Salgado, spanischer Privatermittler
Andreas Fechter
Als Strohmann war er nützlich
Fehler? Nein – er machte keine Fehler, niemals. Er nannte das still lächelnd seinen ganz persönlichen Stil. Wenn er etwas in Angriff nahm, ging er extrem gründlich vor, jeden noch so kleinen Schritt durchdachte er genau und schloss von vornherein jedes Risiko aus. Fehler konnte er sich nicht erlauben. Diese Strategie funktionierte, sie war das Geheimnis seines Erfolgs, da er genau wusste, was er erreichen wollte, was er sich zutraute und wie weit er gehen durfte.
Er kannte seine Reichweite. Die Ziele stimmte er grundsätzlich mit seinen Fähigkeiten ab. Und die wuchsen. Annahmen und Wahrscheinlichkeiten gab es in seinem Denken nicht. Imponderabilien, unvorhergesehene Zwischenfälle, blieben zwar nie ausgeschlossen, aber sogar sie kalkulierte er in ihrer möglichen Wirkung und den Konsequenzen bereits ein.
Sowohl für Situationen wie für Menschen hatte er einen untrüglichen Instinkt. Er hatte bereits in der Schulzeit begriffen, dass das Risiko zu groß war, sich auf etwas wie Worte zu verlassen; jedes Versprechen war heikel. Nie hatte er sich einer Prüfung gestellt, wenn er nicht sicher war, sie zu bestehen. Er empfand es als lächerlich, wenn andere von »Bauchgefühlen« sprachen. Der Bauch war zum Essen da und der Kopf zum Denken. So einfach.
Er wusste nicht immer sofort, wen er vor sich hatte, Freunde – wenn es sie denn gab – oder einen Feind. War sein Gegenüber nicht einzuschätzen, so mied er jede Nähe, jeden persönlichen Kontakt, bis er sich aus der Distanz ein klares und eindeutiges Bild gemacht hatte. Konnte er ihm oder ihr nicht aus dem Wege gehen, blieb von seiner Seite her alles im Vagen, gab es mit dem Betreffenden weder eine Verabredung, noch traf er eine Absprache. Er stand grundsätzlich auf der richtigen, auf seiner Seite.
Auch das Verlieren war genau geplant. Strategisch eingesetzt, konnte es ihm nützlich sein, es täuschte den Gegner. Doch damit trumpfte er niemals auf. Das wäre ein schwerer Fehler gewesen. Misstrauen und Verschwiegenheit waren Charakterzüge, die er an sich besonders schätzte.
Er ließ sein Gegenüber stets so nah wie nötig an sich heran, um sich Klarheit zu verschaffen. Manch einer verwechselte es mit Nähe – wie lächerlich. Sie war lediglich erforderlich, um den anderen zu riechen. Er besaß eine ausgezeichnete Nase, in jeder Hinsicht, besonders in Bezug auf Wein. Als Prüfer wäre er bestens geeignet gewesen, doch noch fehlte ihm das Vokabular, Weine richtig zu beschreiben.
Das alles hatte ihm sehr geholfen, als er nach Lissabon gekommen war und die Stelle in der Reederei OSC als Abteilungsleiter angetreten hatte. Susanne und Tochter Helena hatte er sechs Monate später nachkommen lassen. Er hatte das Terrain sondieren müssen, ohne sich von der Familie ablenken und einschränken zu lassen.
Die wenigen Wochen Sprach-Intensivkurs in Hannover waren bei Weitem nicht ausreichend gewesen. So hatte er den Unterricht hier in Lissabon fortgesetzt: täglich eine Stunde allein mit einem Lehrer. Im Radio hörte er nur portugiesische Sender, beim Fernsehen halfen die Bilder und Szenen, die Worte in den richtigen Kontext zu stellen. Innerhalb eines halben Jahres hatte er die Sprache erlernen wollen. Er hatte das Ziel erreicht, zur Verblüffung aller Kollegen, aber für ihn war es eine Selbstverständlichkeit. Was er sich vornahm, setzte er grundsätzlich im Rahmen eines selbst gesteckten Zeitplans um. Er konnte sich auf sich selbst verlassen. Sonst auf niemanden, geschweige denn auf Susanne. Sie war launisch.
Dass das Gesagte hier in Portugal und in diesem Umfeld längst nicht das Gemeinte war, anders als in Deutschland, hatte ihm, im Gegensatz zur portugiesischen Grammatik, niemand beibringen müssen. Ein Nein gab es nicht, und ein Ja bedeutete noch lange keine Zustimmung. Er wusste, wer ihm etwas einbrachte, mit wem er ein Stück des Wegs teilen musste, um weiter voranzukommen.
Und er wusste genau, wer seinen Aufstieg in der Reederei behinderte, ob gewollt oder nicht. Wer stärker war, zumindest einstweilen, den analysierte er, äußerst sachlich, man hätte seine Warte als durchaus objektiv bezeichnen können. Das war für seine schnelle und steile Karriere enorm nützlich gewesen, auch die vermeintliche Loyalität Vorgesetzten gegenüber. Dann kam der Moment, an dem sich alle Schwachstellen seines Gegenübers offenbarten, er den berühmten wunden Punkt kannte – jeder war damit behaftet. Das war das Blatt des Siegfried.
Die Sagen der Germanen hatten ihn als Jungen enorm beeindruckt. Doch neben dem Wissen um die verletzliche Stelle zwischen den Schulterblättern war es notwendig, sich über den Zeitpunkt Gewissheit zu verschaffen, an dem er den Speer werfen musste. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen …
Langsam schob er sich mit dem Bürostuhl vom Schreibtisch zurück, stand in Anbetracht des vor ihm liegenden Feierabends in aller Ruhe auf und trat an das Panoramafenster seines Büros. Seit drei Jahren genoss er die grandiose Aussicht über den tiefblauen Tejo. Ein wenig weiter rechts überspannte die im Abendrot leuchtende Brücke des 25. April den Strom, an ihrem Ende die Cristo-Rei-Statue vor Almada am jenseitigen Ufer. Eine eilige Personenfähre hinterließ in den blassblauen Wellen einen Streifen weißes Kielwasser. Linker Hand wich das Ufer zurück, von Lissabon war genauso wenig zu sehen wie von der flachen Vasco-da-Gama-Brücke.
Bevor er dieses Büro bezogen hatte, war ihm lediglich die traurige Aussicht auf die Rua da Cintura vergönnt gewesen, auf billige graue Lagerhäuser und die Parkplätze – eine Aussicht, geteilt mit drei Kollegen, die mittlerweile unter ihm arbeiteten. Der jetzt anstehende Schritt hinauf in die oberste Etage des Reedereigebäudes als Junior Executive Officer, als JEO, war lediglich eine Frage von Tagen. Der Plan stand. Nach dem CEO werde ich der zweite Mann in unserer Lissaboner Niederlassung sein, sagte er sich und gefiel sich in der neuen Rolle. Damit werde ich mein Ziel erreicht haben, den strategisch notwenigen Posten für den nächsten Schritt. Von dieser Position aus lassen sich meine Vorhaben am besten verwirklichen. Der CEO wird nichts tun, ohne mich zu informieren, und die Mitarbeiter kommen nur über mich an ihn heran. Dafür werde ich sorgen. So habe ich beide Seiten unter Kontrolle und gewinne Einfluss auf sämtliche Entscheidungen.
Wieder betrachtete er die Brücke des 25. April. Sie faszinierte ihn. Sie war das Sinnbild für die Verbindungen, die er mit seiner Arbeit schuf. Aber die wahren Brücken waren die Schiffe und letztlich das, was sie transportierten. Auf der Pier von Alcântara unter ihm stapelten sich die Container hoch übereinander, auf den Metallwänden las er die Namen der Reedereien, die sie über die Meere beförderten: MAERSK, Südkoreas Hanjin, Hamburg-Süd, ach, die gehörte mittlerweile auch zu MAERSK, und dann gab es noch die chinesische COSCO und hundert andere.
Auf die brasilianische Aliança verließ er sich besser nicht, Brasilianer waren unzuverlässig, obwohl Aliança zur Oetker-Gruppe gehörte und für seine Transporte hilfreich gewesen wäre. Dann war da noch die Overseas Shipping Company, kurz und prägnant OSC, schwarz auf weiß die Buchstaben. Das waren die firmeneigenen Container, meine Verfügungsmasse, sagte er sich, und ein befriedigtes Lächeln spielte um seine Lippen. Der Weg hierher war weit gewesen – und er würde noch viel weiter gehen …
Als Junge hatte er Schiffe gebastelt, sie mit allem Möglichen beladen und davon geträumt, sie über die Ozeane zu schicken. Dass man das zum Beruf machen und damit Geld verdienen konnte, sehr viel Geld, war ihm später in den Sinn gekommen, vorausgesetzt, man verfügte über eine kostbare Fracht, vermied schwierige Fahrwasser, steuerte die richtigen Häfen an und bekleidete eine entsprechende Position im Management der Macht. Als Erster Offizier hatte man sowohl die Mannschaft wie auch den Kapitän im Blick. Bald, sehr bald sogar …
Andreas Fechter trat näher an die getönte Scheibe seines klimatisierten Büros, so nah, dass sein Atem das Glas beschlug. Zufrieden sah er den Portalhubwagen nach, die, hochbeinigen Insekten gleich, über die Pier eilten und die Container von der Verladebrücke zu den Stellplätzen brachten. Der breite Radstand und die hohen Aufbauten erinnerten ihn an die Vollernter, die in wenigen Tagen wieder in den Weinbergen unterwegs sein und sich breitbeinig über die Weintrauben hermachen würden. Die Weinlese begann in diesem Jahr später als gewöhnlich. Das Frühjahr war kalt und nass gewesen, zumindest in der Region Lissabon, riesigen Schaden allerdings hatten die jüngsten Hitzetage angerichtet. Doch für seine Zwecke gab es auf der Quinta da Fonte genügend Wein.
Gedämpft von der dicken Glasscheibe, hörte er das schrille Warnsignal der langsam vorrückenden Verladebrücke, sie hob die Container vom Schiff und setzte sie auf der Pier ab. Seit dem Morgen wuchsen die Aufbauten des dort festgemachten Containerfrachters langsam aus dem Wasser, je weiter er entladen wurde. Oder hatte die Tide ihn angehoben? Richtig, der höchste Wasserstand war jetzt erreicht.
Die Welt vor ihm war die Welt, die er sich immer gewünscht hatte, und er blickte in kühler Erwartung dem Schiff entgegen, das fast bedächtig im weiten Fahrwasser vom Atlantik heraufkam. Es wird die City of Ikorodu sein, endlich, sie wird vor dem Frachter festmachen, dachte er und griff mit Genugtuung nach seinem Fernglas. Mit jeder ihrer Ladungen, die hier an Land gebracht und sicher weitertransportiert wurde, wuchs sein Vermögen. Das war entscheidend, denn auf dieser Welt zählte nichts außer Geld. Mit diesem Stoff ließ sich alles erreichen und ein jeder bewegen (eine jede sowieso).
Er hielt sich für kaltblütig, Furcht kannte er nicht, Angst hingegen war hilfreich, denn sie warnte vor Gefahren. Nur schwache Charaktere ließen sich davon lähmen. Zutiefst erschrocken war er allerdings gewesen, als er zum ersten Mal auf einem schmalen Wirtschaftsweg im Weinberg einem dieser Vollernter begegnet war. Ihm war es vorgekommen, als würde ein Kampfroboter auf ihn zufahren und ihn mit seinen Greifarmen einfangen und zerfetzen. Womöglich eine Methode, sich gewisser Gegner zu entledigen? Nein, viel zu spektakulär, das rief Entsetzen und Aufruhr hervor. Es gab einfachere Methoden, weniger dramatisch, lautlos, schnell und sicher. Ein Lieferwagen war immer ein nützliches Werkzeug, und Ronaldo verstand es, ihn richtig zu handhaben. Ronaldo war ein guter Mann.
Fechter hätte gern länger den Aktivitäten auf der Pier zugesehen, besonders jetzt, da die City of Ikorodu von einem Schlepper an die Pier geschoben wurde und die Leinen flogen … Nicht mehr lange, und er würde sich das Schauspiel von ganz oben ansehen können, vielleicht schon, wenn sie das nächste Mal aus Lagos kam? Er dachte kurz an Lagos, an Dreck, Gestank und Menschenmassen und an die Nächte, die allemal ihr Geld wert gewesen waren.
Er setzte sich wieder, erledigte einige Telefonate und arbeitete weiter, bis das Licht des Nachmittags weich und warm wurde. Das tiefe Blau des Himmels über Barreiro am jenseitigen Ufer verblasste, ein rosafarbener Hauch legte sich über den Tejo. Es war an der Zeit, sich den letzten täglichen Überblick über die Position ihrer Schiffe zu verschaffen. Dank des Global Positioning Systems brauchte er dazu nur ins Internet zu gehen. Diese Technik war eingeführt worden, als er seine Lehre als Reedereikaufmann begonnen hatte.
Die City of Ikorodu hatte inzwischen festgemacht, die richtigen Leute waren auf der Pier, sie wussten, was zu tun war, ohne dass sie zu viel wussten. Wer zu viel fragte, tat es nur einmal. Wer nicht fragte, verdiente besser und behielt den Job. So lautete die Regel. Der Zoll würde die üblichen Kontrollen durchführen. Sein Vertrauensmann hätte ihn längst informiert, falls etwas nicht nach Plan lief und andere sich überraschend einmischten. Ging eine Ladung verloren, so gab es eine nächste zur Kompensation. Aber das war ausgeschlossen.
Fechter schaltete seinen Rechner ab, nachdem er seinen Chef informiert hatte, dass er einen Geschäftstermin im Zentrum wahrnehmen müsse. Henke glaubte ihm alles, obwohl er kein Dummkopf war. Henke kannte das Geschäft und seine Schliche, trotzdem genoss Fechter sein volles, nein, sein vollstes Vertrauen. Henke hatte viel von sich preisgegeben, er war wie ein offenes Buch, hatte ihm sogar erzählt, dass er kein treuer Ehemann war. In dieser Hinsicht war er ein Dummkopf, der Angeber. Fechter hingegen war sich sicher, dass er nicht einmal im Vollrausch etwas preisgeben würde. Nur würde es zu einem Vollrausch niemals kommen.
Von seiner Geliebten wusste niemand, keiner kannte die Wohnung, die er für Rosalie (eigentlich für sich) gekauft hatte, ganz unauffällig in einem Hochhaus im Bairro da Boavista, sechste Etage. Über kurz oder lang würde Rosalie sich ein solches Apartment selbst leisten können, denn sie war brillant in ihrem Job als seine Finanzberaterin. Einstweilen finanzierte er noch ihren aufwendigen Lebensstil, denn was sie für ihn tat – seine Einnahmen international zu verteilen, bevor sie das europäische oder US-Bankensystem erreichten –, war Gold wert. Er wusste sehr gut, was er an ihr hatte! Es war erstaunlich, wie schnell Rosalie sich in die internationale Finanzwelt eingefunden und sich an den Luxus gewöhnt hatte. Seiner Frau war es gleichgültig, wofür er sein Geld ausgab, solange für sie und ihre Tochter genug vorhanden war.
Wenn er allein unterwegs war, vermied er Fahrstühle. Er nahm die Treppe, egal, in welches Stockwerk er sich bemühen musste, und wenn es das sechste war. Das hielt ihn fit und beweglich. Wäre der Verkehr in der Stadt nicht eine Zumutung für Nerven und Lunge, er nähme für die Fahrt zum Arbeitsplatz lieber sein Rennrad. Leichtfüßig trabte er die Stufen hinab, verließ das Gebäude zur Rua da Cintura hin, warf im Vorbeigehen einen kurzen Blick auf seinen alten silbergrauen Mercedes, steckte dem Lagerarbeiter, der ihn gewaschen hatte, einen Zehn-Euro-Schein in die Brusttasche seines Overalls und wandte sich den Kaianlagen zu. Im Vorbeigehen grüßte er den Mann am Tor, der sich mit zwei Zöllnern unterhielt. Der Kleinere der beiden Uniformierten war ihm gut bekannt, ein Mann mit viel Verständnis für die Interessen Dritter und mit Offenheit für finanzielle Zuwendungen.
Die City of Ikorodu lag inzwischen sicher vertäut an der Pier. Irgendwo im Gewühl dieser an Deck aufgetürmten Container stand der eine, den speziell er erwartete: Kaffee aus Angola! Robusta, eine Seltenheit. Nur er und Aparecida wussten, dass es brasilianischer Kaffee war und das Ursprungszeugnis auf Angola umgeschrieben worden war. Alles deutete darauf hin, dass die Ladung auch diesmal reibungslos gelöscht wurde. Sein Container würde dann wie immer ins Lagerhaus gebracht und ausgeräumt werden. Ronaldo wartete bereits. Er selbst würde sich morgen darum kümmern.
Fechter ging zurück zum Wagen und quälte sich durch den Feierabendverkehr hinauf zur Praça Camões. Glücklicherweise gab es im Hof der Rösterei den für ihn reservierten Parkplatz. Er hatte Aparecida nichts von seinem Kommen gesagt, erschien wie immer unangekündigt. Niemand durfte sich sicher fühlen, er tauchte zu den unmöglichsten Zeiten in der Confeitaria auf, auch auf das Risiko hin, Aparecida nicht anzutreffen. Oder er meldete sich an und fuhr nicht hin. Anfangs hatte sie aufbegehrt, aber schließlich eingesehen, dass ihr Protest nichts half. Jetzt murrte sie nur unhörbar.
Aparecidas Eltern waren vor vielen Jahren aus Angola gekommen, hatten die portugiesischen Truppen auf ihrem Rückzug nach der Nelkenrevolution begleitet. Damals hatte die Befreiungsorganisation MPLA unter Agostinho Neto die Macht übernommen, und der Bürgerkrieg mit der Unita begann. Danach war Eduardo dos Santos als Präsident gefolgt und an der Macht kleben geblieben, bis vor Kurzem. Die achtunddreißig Jahre hatten gereicht, um sein Töchterchen Isabel zur reichsten Frau Afrikas zu machen. Papa hatte ihr die richtigen Türen und Ölquellen geöffnet, und sie hatte sich geschickt angestellt. Ganze dreieinhalb Milliarden Dollar nannte sie ihr Eigen. Für sie hatte sich der Befreiungskampf gelohnt, bei dem hunderttausend Angolaner und zehntausend kubanische Waffenbrüder gestorben waren. Was waren die Menschen dumm. Und für die Krüppel der Landminen gab es nicht einmal Prothesen. Dafür hatte er im letzten Jahr zehntausend Dollar von einem seiner schwarzen Konten überweisen lassen.
Aparecidas bewunderte Isabel, zu gern hätte sie mit ihr getauscht. Aber auch sie hatte Talente, war eine ausgezeichnete Verwalterin, hatte einen ähnlichen Sinn für Geld wie er und führte die Konditorei sowie die Rösterei, die Fechter ihr eingerichtet hatte, mit sicherer Hand. Auch bei der Verwaltung seiner Wohnungen stellte sie sich geschickt an und zeigte bei der Auswahl des Personals Weitblick.
Die beiden adretten Verkäuferinnen am Tresen der Confeitaria blickten Fechter erwartungsvoll lächelnd entgegen. Sie hatten das Jungmädchenalter gerade hinter sich, er hätte sie beide haben können, sie legten es geradezu darauf an. Aber zu jung durften sie nicht sein, das könnte Ärger geben. Ein rascher Blick über die Terrasse und den Gastraum zeigte ihm, dass sämtliche Tische besetzt waren. Auch der Tresen war dicht umlagert, hauptsächlich von älteren Männern, die gierige Blicke auf die beiden schwarzen Schönheiten warfen und mit ihnen zu flirten versuchten. Aber sie hatten keine Chance. Mehr befremdeten ihn die drei Schmeißfliegen. Es war nicht ihre Hautfarbe, die ihn störte, vielmehr die Tatsache, dass sie Dealer waren.
»Die Chefin ist im Büro?«, fragte Fechter und zeigte sein charmantes Lächeln.
Das gehauchte »Ja« konnte weit mehr bedeuten, als dass Aparecida an ihrem Schreibtisch saß. Fechter bemerkte es an den neidischen Blicken der Espresso schlürfenden Männer und den feindseligen der Afrikaner. Sie würden in wenigen Minuten verschwunden sein, er duldete keine Dealer hier. Sie zogen Ermittler an. Das war schlecht fürs Geschäft.
Fechter stieß die Schwingtür auf, die den Gastraum von dem Büro und der am Ende des Korridors liegenden Rösterei trennte. Der wunderbare Duft des gerösteten Kaffees empfing ihn, und er atmete mit geschlossenen Augen tief und langsam durch die Nase ein, ähnlich, wie er es bei einem großen Wein tat. Er wusste, dass Aparecida ihn dabei beobachtete, denn sie hielt die Jalousie vor ihrem Bürofenster ein wenig offen. Erst als Fechter sich satt gerochen hatte, betrat er ihr Büro, ohne anzuklopfen. Eigentlich gehörte hier alles ihm, er hatte Aparecida die Confeitaria und die Rösterei eingerichtet, um sie zu besänftigen, als er ihre kurze, dafür aber umso heftigere Liaison beendet hatte. Inzwischen war sie ihm eine wertvolle und verschwiegene Stütze.
Sie hatte ein ovales Gesicht und große Augen, die ihm immer noch gefielen, und nicht zu wulstige Lippen – da wird irgendwann mal ein weißer Kolonialherr dazwischen gewesen sein, vermutete er. Das glänzende schwarze Haar kämmte Aparecida nach hinten, die Krause war kaum mehr bemerkbar, und alles war zu einem engen Knoten gesteckt. Die weißen Perlen in den Ohren waren echt, er hatte ihr seinerzeit den Schmuck geschenkt, und sie hatte sich von da an klaglos in das Schicksal der Exgeliebten gefügt. Es ging ihr nicht schlecht dabei. Sie war vom gleichen Schlag wie Fechter, sie wusste jeden Vorteil zu nutzen und verdiente gut, besser als die meisten Frauen in Portugal. Sie hatte von ihm gelernt, wusste schnell, wer zuverlässig und wer zu neugierig war, wer zu viel redete und überflüssige Fragen stellte. Hielt sich eine ihrer Hilfskräfte nicht strikt an ihre Anweisungen, so wurde sie rigoros ausgesondert. Die Härte, mit der sie dabei vorging, war ihr nicht anzusehen, was auch wenig hilfreich gewesen wäre. Fechter schätzte sie. Jemanden wie sie aufzubauen, dauerte Jahre.
Aparecida stand auf, umarmte ihn und verharrte mit ihrem Mund kurz vor seinem. Doch er schob sie sanft und entschieden von sich.
»Vorne sind Leute, die dort nicht hingehören. Wer mag sie eingeladen haben?«
Aparecida tippte auf die Tastatur ihres Computers, bis sich das Bild der Terrasse auf dem Bildschirm öffnete. »Dass die immer wieder auftauchen, ist kein Wunder, wenn du die Confeitaria ›Luanda‹ nennst. Ich würde den Laden umbenennen.«
»Ich nehme an, es sind Angolaner.«
»Dann haben sie Heimweh. Ich seh’s mir mal in natura an.« Damit verließ Aparecida den Raum und kam nach einer Minute zurück. »Dein Blick ist gut. Es sind Angolaner. Und es sind Schmeißfliegen. Verfahren wir wie beim letzten Mal – oder soll ich ihnen die passenden Worte sagen?«
»Ich regle das!« Draußen warf Fechter einen Blick auf die Männer. Er kannte diesen Typ. Sie durften sich nicht an den Ort gewöhnen. Sie gefährdeten seine Geschäfte, sie mussten verschwinden. Er hatte schon einige bei der Polizei gemeldet. Die drei auf der Terrasse hatten wohl noch nicht davon gehört.
Fechter war nicht besonders groß, aber er wirkte kräftig, durchtrainiert und äußerst überzeugend, wenn er etwas sagte. Er ging um den Tresen der Konditorei herum, blickte stirnrunzelnd auf den Tisch mit den drei Männern und schritt betont langsam über die Stufen zu ihnen hinab. Die drei versuchten, mit harten, der Situation wenig angemessenen Blicken zu kontern, doch dahinter verbarg sich ihre Unsicherheit.
»Es wurde bereits für Sie bezahlt, meine Herren! Sie können gehen. Wir möchten Sie hier nicht mehr sehen. Sollten Sie das nicht verstehen, so werden Sie bezahlen. Ist das klar? Sie haben mich verstanden? Im Übrigen sollten Sie sich bei allem, was Sie tun, vorher vergewissern, von wo aus die Kameras auf Sie gerichtet sind. Und sparen Sie sich Ihre Tiraden über weiße Rassisten.«
Dass sie wiederkämen und die Confeitaria verwüsteten oder Aparecida oder ihr Personal belästigten, schien Fechter unwahrscheinlich. Die drei Burschen waren keine Leuchten, so wie sie auf seine letzten Worte reagierten. Provozierend langsam erhoben sie sich, nannten Fechter dennoch ein »Rassistenschwein« und drohten damit, dass er von ihnen hören werde. Ohne ihnen nachzublicken, kehrte Fechter zum Tresen zurück, wo ihn die bewundernden Blicke der beiden Grazien empfingen. Er zahlte die Rechnung der drei Figuren (die Kasse musste schließlich stimmen) und ging ins Büro.
»Es ist ein Container eingetroffen. Er steht morgen früh im Lagerhaus. Ich will, dass er abends entladen ist. Wir brauchen ihn schnellstmöglich wieder. Ronaldo weiß Bescheid.« Mehr musste Aparecida nicht wissen.
»Um die Frachtpapiere kümmerst du dich, wie immer?«
»Ja, sicher doch.« Fechter wandte sich zum Gehen.
»Gehen wir noch zusammen essen?« Aparecida wäre gern zu dem Zustand zurückgekehrt, wie er vor zwei Jahren bestanden hatte. Sie liebte ihn und schien sich nicht sicher, ob das, was sie tat, für ihn war oder wirklich für sich selbst.
Er zuckte mit den Achseln. »Leider keine Zeit. Ich muss mich um meine Familie kümmern.«
»So wie immer?«
»Ja, sicher doch.« Er warf ihr ein Lächeln und eine Kusshand zu und fuhr zum Fitnesscenter.
Auf dem Laufband machte er sich warm, auf dem Speedbike kam er ins Schwitzen, danach war das Krafttraining an der Reihe, anschließend wechselte er zum Multitrainer, und als er nass vor Schweiß immer schwerere Gewichte stemmte, trat Hector zu ihm, der Besitzer des Centers.
»Mach Pause, Andres, es reicht, du bist zu ehrgeizig. Mach dich nicht kaputt. Ein Muskelriss ist kein Vergnügen.«
Hector war Fechter dankbar, er hielt ihn für einen Freund, da er ihm bereits mehrmals aus finanziellen Schwierigkeiten herausgeholfen hatte. Ohne ihn gäbe es das Fitnesscenter nicht mehr. Fechter hatte sich damit einen weiteren Abhängigen verschafft, da Hector ihm das Geld weder kurzfristig noch auf lange Sicht zurückzahlen konnte. Irgendwann würde Fechter ihn aus dem Geschäft drängen, denn hier wie auch mit den Wohnungen und in der Confeitaria ließen sich seine Einnahmen waschen. Seine größten Projekte waren der Neubau eines Hotels – der Rohbau stand bereits – und die Ferienanlage bei Peniche. Bauherr war eine seiner Scheinfirmen in Übersee. Nur eine halbe Million hatte er für die Wohnung in Hannover Kleefeld hingelegt, einen Teil davon in bar. Deutschland war ein Eldorado für Immobilienkäufe mit Schwarzgeld.
Eigentlich fehlte Fechter zu seinem Glück nur noch ein Weingut. Er hatte sich in der Estremadura umgesehen, in der Região de Lisboa, wie das Weinbaugebiet neuerdings hieß. Er hatte eines in Aussicht, die Besitzer waren alt, und mit einem der beiden Söhne war er geschäftlich aufs Engste verbunden. In ein Weingut ließ sich unendlich viel investieren, denn das verdiente Geld musste der normalen Wirtschaft zugeführt und versteuert werden, damit es legal wurde.
Hector jedoch war sowohl sein Vorname wie auch sein Status als vermeintlicher Unternehmer zu Kopf gestiegen, er gab mehr Geld aus, als er einnahm, und so verschoben sich langsam die Besitzverhältnisse. Als Strohmann war er mit seiner Naivität allerdings recht nützlich.
Und genau, wie Fechter vermutet hatte: Hector – so athletisch er gebaut war, so klein war sein Gehirn – brauchte mal wieder dringend Geld. Um es ihm nicht zu leicht zu machen, ließ Fechter ihn zappeln, erfand Einwände und Hinderungsgründe wie einen augenblicklichen Engpass, um schließlich so zu tun, als brächte er große Opfer. Hector musste es als seinen Erfolg begreifen und nicht als einen weiteren Schritt hin zum Totalverlust seines Unternehmens. Das würde er erst merken, wenn es zu spät war.
Hector war noch in anderer Hinsicht nützlich gewesen – durch ihn hatte Fechter Ronaldo kennengelernt, und Ronaldo löste für ihn die wirklich ernsten Probleme. Außerdem versorgte er Hector mit Stoff, und mit dem Koks im Kopf hielt sich Hector für den Größten. Es war gut, dass es Ronaldo gab, Fechter würde demnächst wieder auf ihn zurückgreifen. Es war spannend, zu verfolgen, dass sich für jedes neue Problem jemand anbot, der es für ihn löste.
»Wann brauchst du das Geld?«, fragte Fechter und wischte sich den Schweiß mit dem Muskelshirt aus dem Gesicht. »Reicht nächste Woche? Vorher kriege ich das nicht hin, ich müsste ein paar Papiere verkaufen«, log er mit zerknirschter Miene und seufzte. »Aber für ’nen Freund tue ich es gern. Du musst dich mehr um den Laden kümmern, meu caro amigo, du solltest renovieren, mein lieber Freund, und neue Geräte anschaffen. Ich bringe dir mal einen Katalog mit, dann überlegen wir gemeinsam …«
»Und das Geld dazu, wo kriege ich das her?«, unterbrach ihn Hector und zog verstört den Kopf ein, was gar nicht zu seiner massigen Erscheinung passte. »Es geht schließlich nicht um Kleingeld, bei fünfhundert Euro geht es los …«
»Mach dir darüber keine Sorgen.« Beruhigend klopfte Fechter ihm auf die Schulter und legte sich sein Handtuch um den Hals. »Wir kriegen das hin.«
Dankbar und zuversichtlich sah ihm Hector nach, als Fechter, ohne geduscht zu haben, sich anzog und das Fitnesscenter verließ. Seine Klamotten sollten nach Schweiß riechen, dann hatte er zu Hause eine gute Ausrede, sofort unter die Dusche zu gehen, und Susanne bekam nichts von Rosalies Parfüm mit.
Von unterwegs kündigte er Rosalie sein Kommen telefonisch an. Die Brasilianerin würde ihn wie gewünscht unter der Dusche erwarten. Sie war eine morena, keine Mulattin wie Aparecida, längst nicht so dunkel wie ein Espresso, nach Fechters Farbskala eher wie ein Crema. Er mochte dieses Schauspiel, wenn Rosalie sich hinter dem nassen Glas räkelte, die Tür beiseiteschob und ihm dann die Arme um den Hals legte. Allein die Vorstellung erregte ihn maßlos. Er stellte den Wagen in der Tiefgarage ab und lief in den sechsten Stock, schloss die Wohnungstür auf und sah im Kühlschrank nach, ob sie den Champagner kalt gestellt hatte. Dann warf er seine verschwitzte Kleidung auf den Teppich der sala, betrat nackt das Badezimmer und schob die Glastür beiseite …
Während sie sich später hingebungsvoll mit dem Haartrockner und mehreren Cremes beschäftigte, warf er sich im Bademantel in einen der Ledersessel – das Apartment hatte er eingerichtet, Stil hatte sie nur im Bett – und dachte nach. Rosalie wusste, woher sein Kapital kam, wie er die Wohnung bezahlte. Er war Logistiker, sie wusste, womit er handelte. Von jeder Transaktion bekam sie das, was er die »Transaktionssteuer« nannte. Ob sie an die Zukunft dachte, etwa daran, an Susannes Stelle zu treten, war bislang nie Thema gewesen, obwohl sie jüngst gewisse Andeutungen gemacht hatte. Aber sie hielt sich zurück. Bis zu welchem Maß und wie gekonnt sie ihre Eifersucht versteckte, war Fechter nicht klar. Sollte sie Ansprüche stellen, müsste er ihr deutlich machen, sich besser um ihre Angelegenheiten zu kümmern, oder sie wäre ein Fall für Ronaldo. Doch sie kannte nun die Gepflogenheiten der Branche bei Leuten, die den Mund nicht hielten.
So wie Aparecida war Rosalie nicht einzusetzen, damit wäre sie unterfordert. Sie lebte vom Umgang mit Zahlen mit möglichst vielen Nullen dahinter. Würde er die beiden Frauen zusammenbringen, würden sie sich gegenseitig die Augen auskratzen. Irgendwann würde er nicht mehr zu Rosalie unter die Dusche kommen, und das nicht nur, weil er kürzlich im Jachtclub eine junge blonde Frau entdeckt hatte, die ihm besonders gefiel und die er haben wollte. Womöglich war sie verheiratet, das machte vieles leichter.
Aber jetzt war nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Er erinnerte sich lieber an den Ausblick aus seinem Büro und sah vor sich die weißen Segel der Jachten, ihre geblähten bunten Spinnacker. So ein Segelboot würde er gern besitzen, er konnte es sich locker leisten. Den Umgang damit würde er sich zeigen lassen, Segelschulen gab es genug, einen Bootsmann oder Skipper konnte man kaufen. Nur wo bekam man eine Mannschaft her? War der Eintritt in einen Jachtclub unabdingbar? Vielleicht wäre es auch geschäftlich sinnvoll, sich in der hiesigen Gesellschaft mehr zu integrieren.
Rosalie trat von hinten an ihn heran, unhörbar, und fuhr ihm mit ihrer kleinen Hand unter dem Bademantel über die nackte Brust.
Fechter sprang mit einem Satz auf und ging in Abwehrstellung. »Erschreck mich nie wieder, mein Schatz, nie wieder!«, sagte er drohend und sah sie an, als hätte er einen Gegner vor sich.
»Aber ich liebe dich doch«, entgegnete sie verängstigt.
»Mach das nie wieder«, wiederholte er, »und zieh dich endlich an, du erkältest dich!« Er ließ sich zurück in den Sessel fallen. »Lass mein Zeug da am Boden liegen«, herrschte er sie an, als er sah, wie sie sich über seine verschwitzte Kleidung beugte.
»Dir kann man auch gar nichts recht machen«, seufzte sie und war sichtlich verstört.
»Doch. Hol den Champagner und zwei Gläser und setz dich her zu mir. Wir sollten besprechen, ob wir am Sonnabend wieder nach Foz do Arelho zum Windsurfen fahren … Oder willst du lieber nach Praia do Baleal? Ich könnte dir das Kiten beibringen.« Fechter wusste genau, wie er bei ihr wieder für gut Wetter sorgen konnte.
»Wo kommst du denn jetzt her?« Susanne Fechter hatte schlaftrunken die mit der Kette gesicherte Haustür geöffnet und wickelte sich fröstelnd in ihren Morgenrock. »Es ist zwei Uhr in der Nacht.«
Geschmeidig wechselte Fechter vom Portugiesischen ins Deutsche. »Wer ernsthaft Karriere machen will, kann sich seine Arbeitszeiten kaum aussuchen.« Jetzt schlug er einen versöhnlicheren Ton an und ging auf sie zu, als wollte er sie in die Arme schließen. »Bei deinen Ansprüchen bleibt mir wenig anderes übrig.«
Sie wich zurück und rümpfte die Nase. »Du warst wieder beim Fitness. Aber so spät noch? Bleib mir vom Leib, du stinkst erbärmlich. Wenn du geduscht hast, kannst du gern ins Bett kommen. Ich geh wieder schlafen. Und mach nicht so viel Krach, sonst weckst du Helena auf.« Sie wandte sich ab und verschwand im Schlafzimmer.
Fechter grinste. Wieder war es gelungen, sie von sich fernzuhalten, bis sein Körper keine Spuren der vorangegangenen Ereignisse mehr aufwies. Er schlich hinüber zum Kinderzimmer, öffnete vorsichtig die Tür und trat ans Bett seiner Tochter. Helena schlief fest, er strich ihr leise über den Kopf. Er liebte sie über alles, für sie würde er alles tun. Zweifellos war sie die schwächste Stelle in seinem System. Aber er wusste genau, wie er sie blitzschnell in Sicherheit bringen konnte, falls es Ärger gab. Darüber sprach er nicht einmal mit Ronaldo. Ob ihm ein Sohn lieber gewesen wäre, wusste er nicht, außerdem wollte Susanne keine weiteren Kinder.
Fechter schloss lautlos die Tür und ging ins Bad. Unter der Dusche kam ihm Rosalie in den Sinn, doch als er im Bett lag und Susannes Atem hörte, dachte er daran, dass er bei OSC in zwei Wochen an zweiter Stelle stehen würde. Sein Plan war perfekt. Für die Mexikaner stand er hier sowieso an erster Stelle. Diese Position konnte ihm nur ein anderes Syndikat streitig machen, aber derartige Signale würde er früh genug erkennen.
Johanna Breitenbach
Algorithmen der Zerstörung
Sie durfte ihm ihre Einstellung keinesfalls zeigen, nicht einmal durchschimmern lassen. Das konnte sie den Job kosten. Das war schon einmal geschehen, allerdings unter gänzlich anderen Vorzeichen. Obwohl es zehn Jahre her war, erinnerte sich Johanna noch gut an den Rausschmiss. Letztlich hätte sie als Umweltingenieurin mit dem Dozentenjob, der daraus entstanden war, sehr zufrieden sein können. Es hatte sie wieder auf den Boden der Realität gestellt, ihrer ganz persönlichen Realität.
Obwohl ihre Situation jetzt eine ganz andere war und sie wieder nicht mehr an das glaubte, was sie tat, wuchs ihr Unbehagen. Sie mochte da sein, wo es ihr gefiel und wo sie hingehörte, aber die Welt bewegte sich weiter, die Umstände veränderten sich. Sie empfand ihre Arbeit, die sie bisher ausgefüllt hatte, in immer stärkerem Maße als nutzlos, wenn nicht sogar als überholt. Sie kam mit den Entwicklungen nicht mehr mit, was nicht an ihr lag. Je länger sie sich mit den drängenden Fragen beschäftigte, je tiefer sie in die Materie eindrang, desto weniger schien ihr ein Erfolg gegeben, ja geradezu unmöglich. Mit dem Gedanken, der einsame Rufer (oder die Ruferin) in der Wüste zu sein, ließ sich schlecht leben, wenn sie bereits in den Morgennachrichten von brennenden Amazonaswäldern und der Zunahme des Artensterbens hörte.
Die Lösungen hielten bei Weitem nicht mit dem Wachstum und den daraus entstehenden Problemen Schritt. Sie wollte in aller Offenheit darüber sprechen, doch wenn sie das, was sie wusste und wovon sie überzeugt war, im Hörsaal vor den Studenten ausbreitete, nahm sie den jungen Menschen dann nicht den Mut? Gerade jenen, die in der Lage waren – oder es sein könnten –, Einfluss zu nehmen. Sollte sie ihnen das »Weiter so« predigen, da es für alles andere sowieso zu spät war? Menschen zu belügen, war ihr verhasst.
Sie starrte aus dem Fenster des kleinen Restaurants, in dem sie mit ihrem Kollegen Stefan, dem Bodenkundler, saß, auf die weite, sich leicht bewegende Wasserfläche des Rheins. Sie wäre viel lieber dort unterwegs, auf ihrem Surfboard, weit zurückgelehnt, beide Hände fest am Gabelbaum, dem Wind entgegen, über die Wellen rutschend, das Rauschen des Wassers im Ohr und alles vergessend, bis auf die Schiffe, denen sie ausweichen musste und auf deren Bug- oder Heckwelle sie manchmal surfte.
»Du hörst mir gar nicht zu, Johanna!« Der Vorwurf in der Stimme ihres Kollegen war nicht zu überhören.
»Du irrst, Stefan«, antworte sie entschieden, ohne dem kritischen Blick auszuweichen. »Ich bin mittendrin.« Was nicht einmal gelogen war, nur in anderem Sinne gemeint, als der Dozent es vermutete. Wahrscheinlich viel zu weit drin, hätte sie eigentlich sagen müssen. »Soweit ich weiß, haben die Phönizier vor mehr als zweitausend Jahren den Weinbau nach Portugal gebracht. Im 16. Jahrhundert haben die Portugiesen bereits Wein nach England exportiert, während die Zisterzienser hier gerade mal begonnen haben, rings ums Kloster Eberbach Reben aus dem Burgund anzupflanzen. Die portugiesischen Winzer sind kaum auf unsere Ratschläge angewiesen, sie werden besser wissen, was dem Land beziehungsweise ihren Weingütern guttut. Was soll ich da? Sie kennen die Wetterverhältnisse, die Zahl ihrer Sonnenstunden, den Boden, ihre Reben, sie wissen, was Strom und Diesel kosten und welche Bausubstanz ihre Quintas haben, ganz im Gegensatz zu mir. Das alles ist fürs Energiemanagement entscheidend. Aber wer will sich schon das Dach seines spätbarocken Landgutes durch Solarkollektoren verschandeln?«
»Dann stellt sie in den Weinberg«, erwiderte Stefan. »Außerdem stammen die wenigsten Gebäude noch aus dem Barock. Stell die Kollektoren vor eine Mauer, oder pflanz ein paar Bäume als Sichtschutz davor. Aber darum geht es nicht. Nimm meinen Freund Flávio dos Santos: Sein Weingut liegt zwischen Hügeln, keine fünfzig Kilometer von Lissabon entfernt. Er hat an irgendeinem Ökokongress teilgenommen, und seitdem will er sein Weingut zukunftsfähig machen. Damit setzt er ein Zeichen, und die Nachbarn schauen sehr genau hin, was die anderen treiben, allein aus Neid. Und wer will kein Geld sparen?«
»Erst mal kommen die Investitionen, später …«
Stefan stöhnte und winkte ab. »Ich habe Flávio erzählt, dass du jetzt bereits im achten Jahr bei uns an der Hochschule die angehenden Winzer und Önologen mit Energiemanagement vertraut machst, damit, wie sie durch sinnvolleren Umgang mit Energie Geld sparen, weniger Dreck machen, weniger Wasser verbrauchen und CO2 einsparen. Er war begeistert, er wollte sofort, dass du kommst und ihn berätst. Er würde sogar Seminare mit anderen Winzern organisieren. Ich kenne niemanden, der mehr als du davon versteht, Johanna. Dein Fachwissen kombiniert mit nachhaltigem oder biologischem Weinbau, das ist die einzige Perspektive für den naturnahen Weinbau! Wenn Flávio jemanden in Portugal kennen würde, der ihm helfen könnte, säßen wir nicht hier. Sieh es als Chance, dich international zu orientieren. Täglich kommen Berichte, wo überall Klimakatastrophen herrschen: Kälteeinbrüche, Schneestürme, Hitzewellen. Eine Konferenz jagt die nächste.«
»Ja, Konferenzen, Öko-Gelaber mit Tausenden von Teilnehmern«, ereiferte sich Johanna. »Aber nichts passiert. Jedes Jahr UN-Klimakonferenzen, gleichzeitig Treffen zum Kyoto-Protokoll und zum Paris-Abkommen. Jedes Mal prügeln sich die Teilnehmer vorher darum, wer hinfahren darf, wer Spesen und Karriere macht, wer das Tagegeld kassiert, und dann reisen dreißigtausend mit dem Flugzeug an. Wie viele tausend Liter Kerosin werden verbrannt? Wie viele Tonnen Papier bedruckt? Wie viele Kaffeebecher weggeschmissen?«
»Da kommen sicher etliche mit der Bahn …«
Johanna ließ den Einwand nicht gelten. »Sechzigtausend Taxifahrten vom und zum Flughafen, dreißigtausendmal Bettwäsche und Handtücher in den Hotels waschen, dreißigtausend Leute müssen verpflegt und dreißigtausend Smartphones täglich aufgeladen werden, und alle gehen mehrmals täglich auf die Toilette! Wie viele Liter sauberen Wassers werden verbraucht?«
»Etwa hundertdreißig Liter pro Person und Tag«, sagte Stefan Gerlach und schien sich seinem grimmigen Gesichtsausdruck nach zu ärgern, dass er darauf eingegangen war. »Die würden sie zu Hause auch verbrauchen – aber wieso bist du nur so defätistisch?«
»Was ist das, defätistisch?«
»Du siehst alles schwarz, siehst keine Aussicht auf Erfolg, alles wird schlechter …«
»Ist es ein Wunder bei dem, was uns täglich serviert wird? Noch nie haben so viele Leute über Umweltschutz geredet, noch nie gab es so viele Institute und Konferenzen – und der Müll nimmt täglich weiter zu, die Temperatur steigt weiter an, so wie die CO2-Emissionen, und ein Gletscher nach dem anderen schmilzt weg. Und wenn du diesen Sommer betrachtest«, fuhr Johanna ungerührt fort, »ist der nicht schon an sich eine Katastrophe?«
»Das ist relativ.« Der Dozent für Bodenkunde ging nicht darauf ein. »Dieser Sommer, Johanna? Der war fantastisch. Die Trauben bei uns im Rheingau, ach, überall in Deutschland waren bestens, die Keller sind übervoll, ganz im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, und die Weinstöcke sind gesund! Allerdings weiß keiner, aus welcher Tiefe die Reben das Wasser hergeholt haben.«
»Und in Portugal? Fantastisch? Ein Drittel der Trauben sollen im August an den Stöcken verbrannt sein. Stell dir vor, du müsstest auf ein Drittel deines Gehalts verzichten, ein ganzes Jahr lang. Wie viele Weinstöcke dabei geschädigt wurden, weißt du auch nicht. Das siehst du erst beim Austrieb im Frühjahr. Die Schäden bei vielen Bäumen zeigen sich im nächsten oder übernächsten Jahr. Und wie das Wetter im kommenden Jahr wird, kannst du auch nicht vorhersehen. Bauernregeln gelten nicht mehr.«
»Deshalb sollst du ja hinfahren, verdammt! Außerdem muss man nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Was macht dich so pessimistisch? Steckt was anderes dahinter? Stimmt in deiner Ehe was nicht?«
Jetzt wurde Johanna zornig und ihre Stimme leise. »Meine Ehe, lieber Stefan, geht dich gar nichts an, die ist ganz in Ordnung. Aber meinen Ärger darüber, was offen zutage tritt, auf eine persönliche Ebene zu schieben, finde ich ziemlich frech von dir.«
»Es tut mir leid, ich wollte …«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Jeden Tag muss ich mir derartige Argumente anhören«, unterbrach ihn Johanna. »Alle stecken die Köpfe in den Sand, denn wenn sie’s nicht täten, müssten sie ihren Lebensstil ändern. Köpfen im Sand entspringen keine Lösungen, das müsstest doch besonders du als Bodenkundler wissen. Im Sand kommt nicht einmal die Reblaus voran. Diejenigen, die was ändern oder es zumindest vorhaben, werden von den anderen als Spinner abgetan, abschätzig als ›Ökos‹ bezeichnet, als Gutmenschen abqualifiziert und beschimpft. Wieso machst du die Augen zu? Du müsstest doch sehen, wie die Böden versiegelt werden, hundert Quadratkilometer pro Jahr, dann die durch Gülle und Überdüngung und industrielle Schadstoffe degenerierten Böden. Muss jeder Wirtschaftsweg asphaltiert werden, damit bloß kein Wasser mehr hindurchkommt und der Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre unterbunden wird?«
»Ich dachte immer, du wärst Dozentin für Energiemanagement«, wagte Stefan ihren Redefluss zu unterbrechen.
»Energiemanagement heißt, Energie zu reduzieren. Aber Industrie und Politik und die Agrarkonzerne reden nur von Wachstum. Ich hoffe, sie ersticken an ihrem Profit! Aber wir ersticken leider vorher, an ihrem Dreck«, fügte sie leiser hinzu.
Sie hatte sich in Rage geredet, was sie selten tat. Sie musste sachlich bleiben, polemisch durften nur die Studierenden werden. Reden konnte sie allerding, sie tat es täglich mehrere Stunden lang, hier an der Hochschule in Geisenheim und drüben, auf der anderen Rheinseite, an der Fachhochschule in Bingen. Abends hielt sie zusätzlich Vorträge, vor einem Fachpublikum, bei Umweltgruppen, vor Interessierten der Volkshochschule Mainz sowie Zweiflern und jenen, die das Gerede über den Klimawandel für Humbug hielten.
Sie würde der Reise zustimmen, sie wusste es, es war die Hoffnung, dass sich doch noch etwas bewirken ließ, dass es nicht längst zu spät war … Für sie sah es so aus, als wollten alle noch so viel mitnehmen wie möglich vor dem Untergang, bevor die Ökosysteme endgültig umkippten, bevor die Luft knapp wurde und Hamburg wegen steigender Wasserstände verlassen werden musste. Leider war die Arche zu klein. In eine Raumkapsel passten nur vier Mann. Ob den Enkelkindern noch sauberes Trinkwasser zur Verfügung stehen würde, war ihnen egal. Sie würden erst Ruhe geben, wenn der letzte Streifen indonesischen Urwalds in eine Palmölplantage verwandelt worden war und im letztem Fjord Lachse gemästet wurden. Ja, es musste unbedingt Lachs sein, auch bei Aldi.
Sie warf ihr Haar mit einer raschen Bewegung in den Nacken, als wollte sie die Gedanken abschütteln und den Kopf wieder freikriegen. Wer Untergangsszenarien an die Wand warf, machte sich unbeliebt. Die Leute hörten weg. Das hatte sie oft genug bemerkt, und das hatte sie schon einmal auf einen falschen Weg geführt.
»Du kriegst die Reise selbstverständlich bezahlt, Spesen, Hotel, Honorar und so.« Stefan gab nicht auf. Er kannte Johanna und ihre temporären fatalistischen Anwandlungen. Und spielte seinen letzten Trumpf aus: »Portugals Atlantikküste eignet sich hervorragend zum Windsurfen. Es soll auch ein Kite-Paradies sein. Tolle Wellen, grandiose Strände ganz in der Nähe, keine vierzig Kilometer vom Weingut meines Bekannten. Die Surferszene magst du doch.«
»Du willst mich bestechen«, vermutete Johanna und sah wieder aus dem Fenster. »So geht das nicht, Stefan.« Aber ihre Fantasie war bereits angesprungen. Es war tatsächlich etwas anderes und verdammt reizvoll, nicht von den Ufern eingezwängt, von Fallböen überrascht und in der Strömung ständig vor den Frachtkähnen auf der Flucht zu sein. Die Wellen reizten sie, das Brandungssurfen, das war hohe Kunst, die Dünung nutzend oder sich vom Schirm an der Küste entlang ziehen zu lassen, die meterhohen Sprünge dabei waren, als flöge man. Sie hätte sich wegträumen können …
Wieder auf dem Boden bat sie sich Bedenkzeit aus »… bis Samstag. Ich möchte nicht anderen, die gutgläubig sind, etwas vermitteln, woran ich selbst …« Den Rest des Satzes schluckte sie hinunter.
Surfboard und Segel brauchte sie nicht mitzunehmen, beides konnte man in jedem Surfrevier ausleihen. Nur ihren Neoprenanzug würde sie einpacken … Sie merkte, wie sie sich mehr und mehr mit dem Gedanken an die Reise anfreundete. Bis zum Beginn des Wintersemesters war noch unendlich viel Zeit. Praktische Überlegungen brachen sich Bahn, legten sich wie eine durchsichtige, matt schimmernde Folie über ihre Bedenken. Eigentlich hatte sie den Achenbachs in Ellerstadt bei der Weinlese helfen wollen, aber Manuel, Thomas und sein Vater kämen auch ohne sie klar.
»Wenn sich alle verweigern so wie du«, gab Stefan zu bedenken, »dann geht hier alles noch viel schneller den Bach runter. Also, was ist nun?«, fragte er, müde vom Argumentieren. »Spielt es für dich gar keine Rolle, wenn ein Freund dich um etwas bittet? Und auch wenn du selbst nicht mehr daran glaubst – andere jedenfalls tun es! Die denken anders. Und diejenigen, die für den Dreck verantwortlich sind, freuen sich über jeden, der untätig bleibt.«
»Denen ist das völlig egal. Aber komm mir nicht mit der Moralkeule, Stefan! Ich habe gesagt, ich brauche Bedenkzeit …« Johanna stand auf. Unentschieden zwischen Wut und Mutlosigkeit ging sie zu ihrem Wagen.
Was sie auf dem kurzen Heimweg nach Oestrich-Winkel, wo sie eine kleine Zweizimmerwohnung gemietet hatte, am meisten ärgerte, waren Stefans letzte Worte. Es war frech von ihm, zu behaupten, dass sie sich verweigerte. Bereits während ihres Studiums hatte sie protestiert, gegen Atomanlagen demonstriert, an Sitzblockaden in Gorleben teilgenommen, war verhaftet worden, hatte Nächte im sogenannten »Polizeigewahrsam« verbracht – als wäre es ein Gewahrsam, ein Schutzraum, gewesen, Tritte und Nackenschläge von Männern und besonders von Polizistinnen verabreicht zu bekommen, die einen Eid auf die Bundesrepublik geleistet hatten. Damals hatte sie begriffen, was von einem Eid auf den Staat – und nicht auf seine Bürger – zu halten war.
Jahre später war die unrühmliche Episode bei Environment Consult & Partners gefolgt, ihr Mann Carl hatte es damals »ihre Machenschaften« genannt und die Katastrophe vorausgesehen. Daran war ihre Ehe fast zerbrochen. Zumindest hatte sie dadurch die Arbeit der Gegenseite kennengelernt und viel Geld damit verdient, Umweltgutachten an die Gesetze anzupassen und sie so umzuschreiben, dass mögliche Kläger der Bürgerinitiativen vor Gericht kein Recht erhielten. Deren Einwände vorauszusehen, war ihr Job gewesen.
Mit viel Glück und Carls Hilfe hatte sie gerade noch die Kurve gekriegt und sich wieder auf die richtige Seite gestellt. Und je mehr sie wusste, je mehr sie tagtäglich über Artensterben und Mikroplastik, Feinstaub und Versteppung, Smog im indischen Delhi erfuhr, desto auswegloser erschien ihr die Situation. Aber der Gedanke, an den Widersprüchen zu ersticken, war auch nicht erbaulich. Die Kunst der Verstellung hatte sie bei Environment Consult & Partners gelernt, aber diese Kunst war ihr zuwider, sie verursachte Kopfschmerzen und Übelkeit und ein schlechtes Gewissen. Dass andere keines besaßen oder bestens damit lebten, war ihr gleichgültig. Sie jedenfalls konnte es nicht. Dann eben untergehen …
Als der Wagen vor ihr an der Ortseinfahrt plötzlich scharf bremste, brauchte sie einen Moment, um zurück ins Hier und Jetzt zu gelangen, so sehr war sie in ihren Gedanken gefangen. Gerade einen Zentimeter hinter dem Geländewagen kam sie zum Stehen. Am Steuer saß eine Frau, die jetzt mitten auf der Straße hielt und ihr Mobiltelefon ans Ohr presste. Mutti brauchte den SUV mit Allradantrieb dringend, um zum Friseur zu fahren. Genau das war das Problem!
Die letzten Meter bis zu ihrem Wohnhaus schlich Johanna fast, schleppte sich entnervt die Treppe hinauf und riss sämtliche Fenster auf. In ihrer Dachwohnung war es zum Ersticken heiß, kaum zum Aushalten. Dieser Sommer war gnadenlos.
Nach dem Duschen schlang sie ein Badetuch um sich und setzte sich auf ihren winzigen Balkon. Heute fehlte ihr Carl besonders. Der trieb sich wieder in Südtirol herum, möglicherweise auf einem kühlen Berg, weit weg von allen Sendemasten. Aber er wanderte nicht gern, besonders dann nicht, wenn es bergauf ging. Er saß lieber auf seinem Rennrad und fuhr mit Rückenwind bergab. Oder war er mit seinem Surfboard auf dem Kalterer See unterwegs? Wäre sie jetzt allein in ihrer gemeinsamen Wohnung in Stuttgart, wäre das Gefühl der Einsamkeit noch stärker. Hier war sie es gewohnt. Sie griff zum Telefon und rief ihn an, doch es war, wie sie befürchtet hatte, er war momentan nicht zu erreichen.
Sie schaute nervös auf die Uhr. Das Gespräch mit Kollege Stefan ging ihr nicht aus dem Kopf. Es bewegte sie, wie sie an ihrem Herzklopfen bemerkte, mehr, als sie angenommen hatte. Argumente gab es für alles, es kam auf den jeweiligen Blickwinkel und die Interessen jedes Einzelnen an – und natürlich auf die Menge an Informationen, über die man verfügte und an sich heranließ. Bei ihr trafen täglich neue Informationen ein, aus der Energiewirtschaft, ihrer Lobby und der Politik. Die Landwirtschaft war ein weites Feld. Die Chemiekonzerne taten ihr Bestes, die Menschen (für sie: die Verbraucher) zu verwirren, ähnlich wie die Lebensmittelindustrie und deren Methoden, ihre Kunden in die Irre zu führen. Greenwashing und Werbekampagnen mussten permanent hinterfragt werden. Und seit Johanna wusste, dass der Weinbau bei 0,8 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche dreizehn Prozent aller in Deutschland verwendeten Spritzmittel einsetzte – waren ihre beruflichen Bemühungen dagegen nicht nur grotesk, geradezu lächerlich und zum Scheitern verurteilt?
Sie kannte sich, sie kannte diese Stimmung, in die sie an manchen Tagen hineinstürzte. Es war das Gefühl, am Rande einer Depression zu stehen, nicht nur ihren Beruf, sondern auch ihr eigenes Leben als sinnlos betrachtend. Nur mit Arbeit konnte sie sich da rausholen, sich ablenken, auch beim Surfen oder in Carls Armen befreite sie sich davon. Aber der blieb einstweilen unerreichbar, obwohl sie es alle zehn Minuten erneut versuchte.
Erschöpft warf sie sich aufs Bett, fiel in einen kurzen, wenig erholsamen Schlaf, kam schweißüberströmt wieder zu sich und trat erneut unter die Dusche. Automatisch griff sie zum Föhn, und als sie ihn einschaltete, kam ihr der Gedanke, dass ihr langes Haar auch von allein trocknete. Frustriert legte sie den Föhn beiseite und bearbeitete wütend ihr Haar mit einer Bürste. Früher habe ich auch keinen Föhn benutzt, sagte sie sich und bürstete grimmig weiter. Muss ich mich an eine neue Frisur gewöhnen?
Sie kam sich eingekesselt vor, von Verboten umgeben, neue Regeln waren aufgestellt, und neue Gebote galt es zu befolgen. Und an alldem wirkte sie selbst mit. Jetzt wuchs es ihr über den Kopf. Dabei ging es nur darum, sich umzustellen, alte, lieb gewonnene Gewohnheiten abzustreifen. Nur das, nichts weiter. Weniger zu essen, war außerdem gesünder. Tote Tiere waren sowieso ekelhaft. Was war daran so schwer zu verstehen?
Sie griff zum Augenbrauenstift und hielt ihr Gesicht nah an den Spiegel. War der Eyeliner auch giftig? Und der Lidschatten? Enthielt das Zeug nicht auch Mikroplastik?
Sie stieß einen verzweifelten Schrei aus. Wie konnte man noch leben, ohne die Welt zu verdrecken? Sie wollte nicht so werden wie die Ökomädchen in ihrem Kurs, die in offenen Sandalen in die Vorlesung kamen, die Baumwollkleidchen ungebügelt, ihr Ökotum anklagend vor sich hertragend. Und die anderen, die wöchentlich mit einem neuen Shirt kamen, genäht von KiK- und Gucci-Sklaven in Bangladesch? Nein, das war auch kein Weg.
Ich werde mich beim Hersteller erkundigen, sagte sie sich, als sie die Augenbrauen nachzog und sich langsam beruhigte. Oder einfach einen ungiftigen Augenbrauenstift kaufen, und mit dem Eyeliner mach ich’s genauso. Und wie man bei einem Shirt auf dem Etikett nach der Größe schaute, konnte man sich auch über die Herkunft und die Inhaltsstoffe Klarheit verschaffen. Das ist alles ganz einfach, sagte sie sich, als sie den Lippenstift in die Hand nahm, das ist nur eine Frage der Gewohnheit.
Gleich traf sie den Kollegen von der Technischen Hochschule in Mainz. Es ging um ein erweitertes Konzept für den Masterstudiengang in Agrarwirtschaft und Umwelt sowie Energie- und Betriebsmanagement. Doch bevor sie das Haus verließ, griff sie zum Telefon und wählte Thomas Achenbachs Nummer. An einem Mittwoch wie diesem vermutete sie ihn zu Hause und nicht bei seiner Freundin Simone in Bordeaux.
Thomas meldete sich sofort und freute sich auf ihren Besuch. Mit ihrem ehemaligen Studenten verband Johanna eine intensive Freundschaft, in der auch mütterliche Gefühle eine Rolle spielten, ganz anders als mit seinem Kompagnon Manuel, der ihr in seiner Art immer fremd geblieben war. Das Gästezimmer sei frei, meinte Thomas, Riesling sowie Weißburgunder stünden kalt, und sein Vater nebst Frau Verena seien auch zu Hause. Man werde also mit dem Essen warten.
Johanna Breitenbach hatte sich daran gewöhnt, ihren Wagen an der Wallbox vor dem Haus abzustellen, um die Batterien aufzuladen. Allerdings hatte sie die Box selbst zahlen müssen. Aber wer Energiemanagement lehrte, musste auch ein Elektroauto fahren – oder das Rad nehmen. Mit den Fahreigenschaften ihres ZOE von Renault war sie zufrieden, für ihre Ansprüche reichte der Wagen, auch von der Reichweite her. Zwar war der ZOE teuer gewesen, zumindest für ihre Verhältnisse, aber sie musste ein Beispiel geben. Ob es irgendwem außer dem Autokonzern nutzte, war fraglich. Die Herstellung der Batterien war der Schwachpunkt, ebenso die kurze Reichweite, dann die hohen Produktionskosten, neue Rohstoffe. Oh Gott! Und ob es innen richtig warm wurde, würde der nächste Winter zeigen – wenn es im Rheingau denn einen gäbe.
Von Oestrich-Winkel zur Hochschule war es nicht weit, nach Bingen durchaus. Trotzdem nahm sie gewöhnlich auch dorthin das Rad, denn im Auto auf die Rheinfähre zu fahren, machten ihre Nerven nicht mehr mit, seit jemand versucht hatte, sie in ihrem Wagen in den Rhein zu schieben. Acht Jahre waren seitdem vergangen, und noch immer griff die Panik nach ihr. Zu Fuß hingegen, die Hände am Lenker ihres Rades, konnte sie entspannt hinübergehen.
Doch heute nahm sie den Wagen und würde nach ihrem Termin in Mainz zu den Achenbachs fahren. Die drei Männer, Vater Philipp, Sohn Thomas und Freund Manuel, hatten auf ihrem Weingut bei Ellerstadt schwere Krisen durchlebt, sie halbwegs heil überstanden, doch andere würden folgen, auch die galt es zu meistern. Johanna war überzeugt, dass sie es schafften, und dieser Gedanke richtete sie auf.
Zerberus sprang zur Begrüßung jaulend an ihr hoch, mit seinem Gewicht warf er sie fast um. Thomas schloss sie freundlich in die Arme, und Philipp Achenbach drückte sie fest. Seine Frau Verena hatte noch in ihrer Galerie in Bad Dürkheim zu tun, und Manuel war wie immer sehr zaghaft. Auf ihn musste man zugehen, und schnell zog er sich in die Küche zurück.
Als Vorspeise hatte er Rucola-Salat mit Geflügelstreifen und einer pikanten Vinaigrette zubereitet. Die Röschen des Broccoli in dem Auflauf, den er anschließend servierte, hatten genau die richtige Bissfestigkeit und den Eigengeschmack behalten. Trotzdem bezeichnete Manuel seinen Broccoli-Kartoffel-Auflauf mit Crème fraîche, Gorgonzola und Schinken als ein Alltagsgericht.
»So kocht er beileibe nicht immer«, kommentierte Thomas die Kochkunst seines Freundes. »Das kriegt er so nur hin, weil er sich verliebt hat.«
»Hoffentlich diesmal in die Richtige«, meinte Johanna, die von dem Drama wusste, das vor zwei Jahren beinahe zum Zusammenbruch des gemeinsamen Projekts geführt hatte.
Manuel verzog das Gesicht, stand rasch auf und verschwand wieder in der Küche.
»Ist er beleidigt?« Schon taten Johanna ihre Worte leid.
Doch Philipp Achenbach beruhigte sie, indem er lächelnd den Kopf schüttelte.
Manuel kam mit der noch heißen Quitten-Blätterteig-Tarte zurück. Dazu servierte er die Beerenauslese des Hauses, die von ihm wie ein Heiligtum gehütet und niemals verkauft wurde, sondern nur besonderen Gästen oder dem Eigenverbrauch, vielmehr -genuss vorbehalten blieb. Davon waren leider nur noch wenige Flaschen übrig.
Die Temperatur im Esszimmer war trotz der tagsüber herrschenden Hitze erträglich. Man hielt es hier wie in Spanien: Tagsüber blieben sämtliche Fenster geschlossen und die Fensterläden zugeklappt, die dicken Mauern des zweihundert Jahre alten Hauses hielten die Hitze ab, abends hingegen wurden die Fenster aufgerissen und blieben die Nacht über geöffnet. Wenn es mit den Mücken zu arg wurde, holte man die Moskitonetze hervor, aber niemals die chemische Keule. Das oberste Gebot galt auch für den Weinberg. Nur Bordelaiser Brühe gegen falschen Mehltau, die musste sein.
Schon vom Esszimmertisch aus hatte Johanna den Blick über den Garten hinweg in die Weinberge genossen. Jetzt wollte sie nach draußen, den Sonnenuntergang und die Stille des Abends genießen und endlich mit Thomas allein reden. Das, was sie wirklich bewegte, tief in ihrem Inneren, vertraute sie – außer Carl – nur ihm an. Ihr Verhältnis war so eng, dass man ihnen nicht nur einmal eine intime Beziehung unterstellt hatte. Nahe standen sie sich, zweifelsohne, er, der Draufgänger, sie die vorsichtig Abwägende, aber Gefühle, die über reine Freundschaft hinausgingen, waren beiden fremd. Die enge Beziehung war in der Zeit entstanden, als sie darum gekämpft hatten, Manuel von der Mordanklage zu befreien und aus dem Gefängnis zu holen.
Anschließend hatte Johanna in den Jahren des Aufbaus maßgeblich die energiewirtschaftliche Seite des Weinguts betreut, nachdem Thomas mit Vater und Manuel das ein wenig heruntergekommene Anwesen gekauft, umgebaut und modernisiert hatten. Gemeinsam mit den Männern hatte sie Solarkollektoren auf dem Dach verschraubt, mit den Handwerkern die Pläne für die Kühlanlagen überarbeitet und Wärmetauscher eingebaut. Die Investitionen hatten ein Vermögen gekostet. Der Schuldenberg würde erst in zwanzig Jahren abgetragen sein.
Dass es ihr nicht gut ging trotz des wunderbaren Essens, musste Thomas ihr angesehen haben, sie entnahm es seinem besorgten Blick. Deshalb verzichtete er auf den Kaffee, als sie ihn heimlich nach draußen bat. Sie gingen nach unten und betraten vom Keller aus den Garten, um den Manuel sich maßgeblich kümmerte.
»Hat er denn endlich wieder eine Freundin?«, fragte Johanna am Ende der Besichtigung.
»Es bahnt sich was an«, antwortete Thomas. »Hast du es nicht am Essen bemerkt?« Er steuerte die Sitzgruppe in der äußersten Ecke des Gartens an, dort, wo hinter dem Zaun die Rebzeilen begannen. »Aber deshalb bist du nicht hergekommen. Worum geht’s wirklich?«
Manchmal empfand sie Thomas in seiner direkten Art zu ruppig und schroff, manchmal war sie ihm dankbar dafür, man kam schnell zum Wesentlichen, und Johanna berichtete von dem Gespräch mit Stefan, von dem Angebot, portugiesische Winzer zu beraten, und ihren massiven Zweifeln. Thomas kannte den Bodenkundler noch aus seiner Zeit als Student.
»Der Mann hat völlig recht«, sagte Thomas ungerührt. »Was willst du, Wein oder Wasser?«
Es dauerte einen Moment, bis Johanna begriff, was er meinte. »Na, was wohl, wenn ich schon mal hier bin.«
Thomas ging zurück ins Haus und kam mit beidem zurück, stellte Gläser, Karaffe und Flasche auf den von der Sonne ausgebleichten Holztisch. Es schien, als hätte er die Zeit zum Nachdenken gebraucht.
»Versteh mich bitte nicht falsch, Johanna, wenn ich nicht in das Lamento über den Zustand der Welt einstimme. Und deine Selbstzweifel kenne ich, Zweifel habe ich auch. Menschen, die keine haben, halte ich für gefährlich, Leuten, die nur von sich überzeugt sind, sollte man besser aus dem Wege gehen. Aber das Angebot von Stefan bestätigt doch nur dich und deine Arbeit. Es zeigt, wie ernst du genommen wirst und dass andere das Thema als ähnlich brennend empfinden wie du!«
»Wenn sie es täten, sähe die Welt ein wenig anders aus.«
»Rom wurde auch nicht an einem …«
»Ja, ja«, unterbrach ihn Johanna, »ich weiß, was du sagen willst. Alles braucht seine Zeit. Aber die haben wir nicht. Täglich geht mehr kaputt, täglich zerstören wir mehr von unserer Welt, täglich sterben unwiderruflich etliche Arten aus, und die Forscher streiten, ob es fünfzig oder einhundertfünfzig sind. Wale ersticken an Plastiksäcken, und die IG Metall kämpft für Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Autokonzerne betrügen ihre Kunden und die Politiker ihre Wähler. Mutti fährt im SUV zum Einkaufen, sie ist mir heute erst begegnet. Angeber, Aufschneider, Großtuer und Blender. Schau dir diese Agrarministerin an, eine Weinkönigin als Lobbyistin, sie glaubt, sie verstünde was von Landwirtschaft. Nichts als menschliche Sprechblasen …«
»Aber ihr Vorgänger war auch nicht besser«, warf Thomas ungerührt ein.
»Und die Bauern kippen weiter Glyphosat auf unser Essen, als hätte es nie eine Debatte gegeben. Wie dumm sind die eigentlich? Oder sind sie dreist und unverschämt? Oder zu faul zum Nachdenken? Und ich soll da was ausrichten?«
»Du wirst nie alle überzeugen.«
»Ja, höchstens eine Minderheit«, warf Johanna ein, »eine, die nicht gehört wird, die nichts zu sagen hat.«
»Die Mehrheit hat andere Sorgen, Johanna. Schlechter Lohn, keine Wohnung, die Kinder, ausgefallener Unterricht …«
»Das hängt alles damit zusammen. Die Welt ist nur noch dazu da, Geld zu machen, alles in Zahlen zu verwandeln, in Algorithmen der Zerstörung.« Johanna verstummte. Sie sah Thomas an, der ihr scheinbar ungerührt zuhörte. »Wie kannst du dabei so ruhig bleiben?«, fragte sie empört. »Ihr unternehmt hier alles Menschenmögliche, um …«
»Sicher, ich sehe es ähnlich wie du. Aber das tut die Mehrheit nicht, denen fehlt sowohl die Fähigkeit zum Nachdenken wie auch die Zeit.«
»Ja, weil sie nur noch aufs Smartphone starren, als würde die App es richten. Wenn sie sich am Nachdenken hindern lassen, sind sie selbst schuld.«