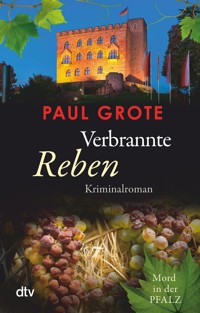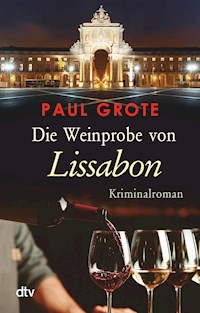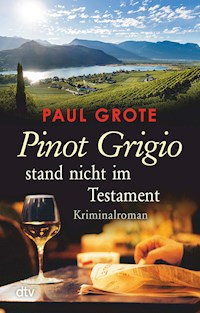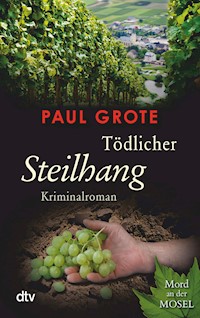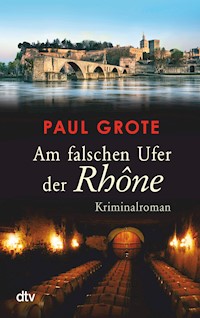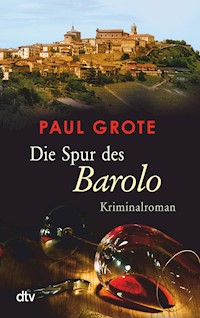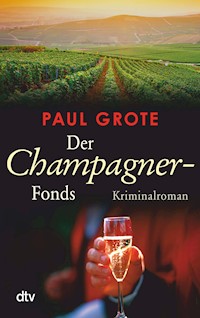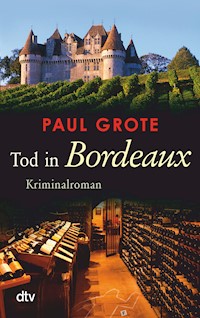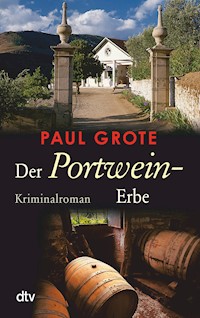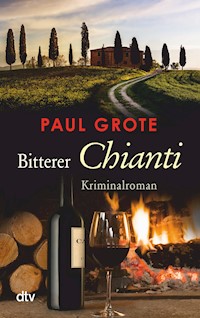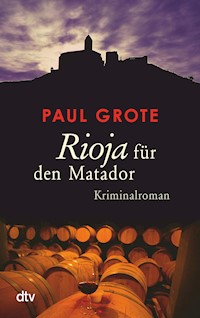9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Band 17 der erfolgreichen Weinkrimi-Reihe Was geschieht auf dem ehemaligen Gut der Familie Semmering? Und wer ist Peter Studt wirklich? Nur ein Strohmann – oder betreibt er das Weingut bei Meißen? Alexander Semmering, Enkel des seit 1945 verschollenen Besitzers, will es wissen. Doch die Mauer des Schweigens scheint undurchdringlich. Deshalb beauftragt er den Moselwinzer Georg Hellberger, die Fragen zu klären. Hellberger nimmt den Auftrag an, er freut sich auf die sächsischen Weine. Doch bereits auf dem Weg dorthin wird er verfolgt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Grote
Ein Weingut für sein Schweigen
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Gewidmet all jenen, die auf dem Weg nach Westen starben
Wer die Wahrheit sagt, den treiben sie durch sieben Dörfer
Türkisches Sprichwort
Personen
Georg Hellberger, Winzer, mit Susanne verheiratet
Rose Hellberger, Studentin, Georgs jüngste Tochter
Susanne Berthold, Winzerin
Kilian Berthold, Gymnasiast, ihr jüngster Sohn
Alexander Semmering, Hellbergers Auftraggeber
Peter Studt, betreibt ein Weingut
Renate Studt, seine Ehefrau
Hilde Wagner, Georgs Gastgeberin, Kunsthistorikerin
Theo Wagner, ihr Sohn, arbeitslos
Rico Schmidt, Architekt, pensioniert
Leufert und Tischler, Informanten
Strecker und sein Schwiegersohn, Bestatter
Pepe, Ritze und Keule, Biker und Georgs harte Freunde
Beamte des BND, der Kripo und des LKA Sachsen
1. KapitelDer Auftrag
»Wer war der Mann?« Georg Hellberger ging um seinen Schreibtisch herum und setzte sich, mehr an der Post interessiert, die heute gekommen war, als an der Beantwortung seiner Frage. Es kamen häufig allerlei Leute bei ihnen auf dem Weingut vorbei, die irgendetwas wollten.
»Das hat der Herr mir nicht verraten«, antwortete Klaus, seit einem halben Jahr auf dem Weingut Berthold & Hellberger als Kellermeister tätig.
»Hast du ihn nicht gefragt?« Georg griff nach dem Brief vom Finanzamt. Er hatte es sich zur Regel gemacht, die unangenehmen Dinge als Erstes zu erledigen. Eine Forderung erwartend, riss er den Umschlag auf.
»Was denkst du denn?« Klaus baute sich unwillig ihm gegenüber auf. »Selbstverständlich habe ich gefragt. Aber er meinte, dass er lieber mit dem Chef persönlich sprechen würde, der feine Herr, nicht mal mit der Chefin …«
»Reg dich nicht gleich auf.« Georg starrte auf den Bescheid. »Ich tu’s auch nicht.« Aber er lächelte.
»Vom Finanzamt?« Klaus streckte den Hals, wollte einen Blick auf das Schreiben werfen. »Was gibt’s da zu lächeln?«
»Wenn man was zurückbekommt, womit man nicht gerechnet hat – ist das kein Grund zum Lächeln? Nun, wer war der Mann wohl? Irgendwas muss er ja gewollt haben …«
»Das glaube ich auch, nur mir hat er es nicht gesagt. Ich habe ihn nach seiner Visitenkarte gefragt, auch damit wollte er nicht rausrücken, aber er sah nicht so aus, als hätte er keine. Ein komischer Vertreter …«
»Hat er keinerlei Andeutungen gemacht? Welchen Eindruck hattest du von ihm?« Georg war neugierig geworden. Er kannte Klaus lange genug, um auf seine Urteilsfähigkeit zu bauen. Vor acht Jahren, als er an die Mosel gekommen war und gegenüber auf dem Weingut von Stefan Sauter eine Weile gelebt hatte, war Klaus noch Lehrling gewesen, in permanentem Streit mit seinem Ausbilder. Inzwischen hatte er die Hochschule in Geisenheim absolviert, hatte seinen Master gemacht – und als Georg sich endgültig mit Susanne Berthold zusammengetan, das Nebenhaus gekauft, die Keller erweitert und einige Hektar Rebland gepachtet hatte, brauchten sie dringend jemanden wie ihn.
Georg hatte von Klaus unendlich viel über den Weinbau gelernt, und er hatte eine gute, kollegiale Art, ihm, seinem Chef, sein Wissen zu vermitteln. Er kannte die Mosel und ihre Hänge, wusste, was dem Boden und den Reben zuzumuten war, kannte das Klima so gut wie die Nachbarn und die Mentalität der übrigen Bewohner des Moseltals. Er war einer von ihnen. Georg hingegen fühlte sich hier auch nach acht Jahren häufig noch immer fremd. Trotz des Altersunterschieds und seiner Position als Chef verband Klaus und ihn seit Langem eine Freundschaft. Wenn es um Wein und Menschen ging, hörte er grundsätzlich auf Klaus’ Rat, weniger auf den seiner Frau. Sie hingegen hielt den Laden und die Patchworkfamilie zusammen.
»Er kam um neun Uhr auf den Hof – ich hatte gerade mein Frühstück beendet – und starrte die Tanks an, besonders hatte es ihm unsere neue Korbpresse angetan. Er fragte speziell nach dir. Er komme aufgrund einer Empfehlung, es sei etwas Persönliches.«
»Hat er zumindest gesagt, auf wessen Rat hin?«
Klaus schüttelte den Kopf. »Auch das nicht. Ich hielt ihn anfangs für einen Wichtigtuer. Aber dazu trat er zu geschäftsmäßig auf, so um die fünfzig, nehme ich an, glattes Gesicht, irgendwie vornehm, war gut angezogen, teure Krawatte, teure Armbanduhr, soweit ich das beurteilen kann. Genau der Typ, der gern teure Weine trinkt.«
Georg lächelte, er kannte diese Spezies. »Er hat keine Telefonnummer hinterlassen, gar nichts, den Wohnort vielleicht?« Ihm schwante nichts Gutes. Auf eine Empfehlung hin war er gekommen? Als Winzer oder Weinbauexperte wird man eher Klaus als mich empfohlen haben, dachte er, oder Stefan Sauter von gegenüber. Georg hielt sich mittlerweile zwar für recht gut in Sachen Weinbau und Kellerwirtschaft, aber ihm fehlte noch unendlich viel, er spürte es jeden Tag, denn die Bedingungen, unter denen sie Wein anbauten, änderten sich nicht mehr nur von Jahr zu Jahr.
Aber er holte auf, sein Bezug war Klaus, den er in seinem zweiten Lehrjahr kennengelernt hatte. Mit seinen sechsundzwanzig Jahren hatte er ihm gegenüber einen riesigen Vorsprung, hatte ihm das Studium von Weinbau, Önologie und Kellerwirtschaft voraus. Dass Georg ihm jeden Monat einen Zuschuss hatte zukommen lassen, war nicht ohne Eigennutz geschehen. Auch Stefan Sauter, Klaus’ Lehrmeister und sein Winzerfreund, hatte monatlich zweihundert Euro rübergeschoben. Sonst hätte er es nicht geschafft, seine Mutter hätte ihn als Alleinstehende nicht drei Jahre lang finanzieren können. Und mit Bafög kam man nicht weit. Jetzt profitierten sie alle, Sauter wie Georg, von dem brandaktuellen Wissen des jungen Mannes. Bei Sauter konnte er nur deshalb nicht arbeiten, weil er sich mit dessen Kellermeister Bischof nach fünf Minuten bereits in die Haare geriet.
Georg hätte sich lieber mit Wein beschäftigt oder mit dem positiven Bescheid des Finanzamtes, aber der Besuch des Unbekannten ließ ihm keine Ruhe. In Sachen Wein wäre Klaus durchaus ein guter Ansprechpartner gewesen, aber da der Fremde ihn hatte sprechen wollen, konnte es nur mit seiner Vergangenheit in Hannover zu tun haben. Daran erinnerte er sich noch immer mit einem gewissen Schauder. Die Ereignisse von damals hatten ihn lange verfolgt, in seinen Gedanken, in seinen Träumen und vor dem Arbeitsgericht durch die Instanzen.
»Na ja, er wird sich wieder melden«, meinte Klaus. »Wenn er wirklich was will – oder auch nicht.« Für ihn schien das Thema erledigt, er wandte sich ab und öffnete die Bürotür. »Du findest mich mit Tarek im Lager. Am Nachmittag will ich zur Sonnenuhr, mir den Zustand unserer Reben dort ansehen. Ich nehme an, du kommst mit?«
»Selbstverständlich, wenn der Unbekannte mir nicht dazwischenfunkt. Wir sehen uns beim Mittagessen?«
Klaus schaute auf die Armbanduhr, nickte und verschwand eilig. Ihm musste niemand erklären, was zu tun war.
Georg starrte auf die Tür, die der Kellermeister lautlos geschlossen hatte. Er bewegte sich sowieso immer lautlos, außer er saß auf seiner Geländemaschine und knatterte durch Zeltingen-Rachtig. Georg nahm das Schreiben des Finanzamtes zur Hand und starrte auf die Buchstaben und Zahlen. Doch statt sie wahrzunehmen, brachen sich die Erinnerungen an sein früheres Leben in Hannover Bahn.
Mit Judo hatte alles angefangen. Wenn er heute daran zurückdachte, war ihm klar: Er hatte seine Schwäche, fremden Ansprüchen etwas entgegenzusetzen, mit dem Kampfsport kompensieren wollen. Aber das war ihm weder gelungen noch bewusst gewesen. Sein Sport und sein kräftiger Körperbau hatten ihm allerdings die Möglichkeit eröffnet, sich als Security bei Rockkonzerten und anderen Massenevents das Geld für sein Studium zu verdienen, etwas, das seine Eltern für Unsinn hielten. Eine kaufmännische Lehre täte es auch, so sein Vater. Unter Betriebswirtschaft konnten sie sich wenig vorstellen – sogar das Abitur hatte er nur unter Protest machen dürfen –, und außerdem habe er ihnen schon lange genug auf der Tasche gelegen.
So war er zu der Sicherheitsfirma gekommen, für die er vorher die Muskeln hatte spielen lassen. Und irgendwann nach Jahren war er kaufmännischer Geschäftsführer geworden – bis sein Chef kränkelte und die Amerikaner den Laden übernahmen, ihn in COS umbenannten, Customers Overseas Service, und seiner Ansicht nach eine Agentur für Wirtschaftsspionage daraus machen wollten. Sein Widerstand gegen diese Veränderung war der Grund für den unvermeidlichen Rauswurf. Ob es dabei geblieben war, ob die Firma eine Abteilung des Special Collection Service geworden war, einer US-Abhörorganisation mit Sitz in der Berliner Botschaft, oder sich auf die Überwachung deutscher Politiker und Konzerne spezialisiert hatte, entzog sich seiner Kenntnis.
Nach ihm hatten weitere Mitarbeiter gekündigt, die wie er die Arbeit von COS als gefährlich angesehen hatten. Aber die in dem jahrelangen Prozess erstrittene Abfindung hatte ihm die Mittel eingebracht, um sich hier ins Weingut von Susanne einzukaufen. Von seinem Haus in Hannover hatte seine Exfrau die Hälfte bekommen, die andere Hälfte hatte als Eigenkapital gereicht, den Kredit für den Kauf des Nachbarhauses abzusichern und nötige Umbaumaßnahmen durchzuführen, unter anderem die Keller zusammenzulegen, den Zwischenraum zwischen beiden Häusern zu überdachen und einige bestockte Flächen hinzuzupachten. Georg starrte noch immer vor sich hin, als Susanne den Raum betrat.
»Was schaust du so finster? Welche düsteren Gedanken plagen dich denn gerade?« Sie trat neben ihn und legte ihm beruhigend den Arm um die Schultern. »Du siehst so angespannt aus, mein Lieber, als würden dich die bösen Geister heimsuchen. Was ist los?«
»Nichts, es ist nichts«, wehrte Georg ab und wusste, dass Susanne es ihm nicht abnahm. Aber er wollte sie nicht mit den alten Geschichten behelligen. Die Gegenwart war deutlich besser als ihrer beider Vergangenheit. »Hast du etwas von dem Besucher mitbekommen, der nach mir gefragt hat?«
»Das macht dir Sorgen?« Susanne hatte Klaus zwar mit einem Fremden im Hof sprechen sehen, doch sie hatte den beiden Männern keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. »Ich war viel zu beschäftigt mit der guten Nachricht, die vorhin per E-Mail reingekommen ist. Wir haben den Auftrag von der Cateringfirma. Sie wollen drei gemischte Paletten für einen Event. Sie haben die Preise akzeptiert. Tarek hat bereits mit dem Packen angefangen.« Sie meinte den jungen Syrer, der seit einem halben Jahr bei ihnen arbeitete.
Dass die Cateringfirma ihr Angebot akzeptierte, war für Georg mehr als verwunderlich. »Ohne jede Reklamation? Kein Gejammer über die Preise? Sonst meckern die Weinhändler bereits bei einer Lieferung von zwölf Flaschen. Was ist das für ein Laden?«
Susanne sah keinen Grund zur Skepsis. »Ich habe mir die vorgelegten Dokumente genau angesehen, die Steuernummer, den Handelsregistereintrag, auch die Schufa-Auskunft ist in Ordnung. Das haben sie alles vorgelegt. Und sie wollen bei dem Event explizit deutsche Weine anbieten, Weine der Mosel. Was soll daran falsch sein? Sei nicht immer so misstrauisch. Freu dich lieber. Einen Auftrag in dieser Größenordnung können wir gut gebrauchen. Ich hoffe, wir werden in Zukunft häufiger mit der Paradies GmbH zusammenarbeiten. Wenn der Wein gut angenommen würde, könnten sich Folgeaufträge anschließen, heißt es.«
Damit kamen sie immer, mögliche Folgeaufträge waren die Karotte, mit der man den Esel zum Weitergehen animierte. »Für wen wird der Event ausgerichtet, wer ist der Auftraggeber?« Georg blieb vorsichtig, es musste sich nicht unbedingt um eine Großveranstaltung handeln, tausendsiebenhundert Flaschen waren nicht die Welt, aber einige Tausend Teilnehmer mussten zusammenkommen, um die auszutrinken.
»Es geht wohl um die Vorstellung eines neuen Autos, mehr wollte Herr Weber nicht preisgeben, er habe sich des Wagentyps wegen dem Auftraggeber gegenüber zu Stillschweigen verpflichtet, und außerdem wisse er es selbst nicht.«
»Wo soll die Vorstellung steigen?«
»Danach habe ich nicht gefragt, die Paletten werden abgeholt«, sagte Susanne. Ihr war deutlich anzumerken, dass ihr Georgs Fragerei auf die Nerven ging.
Aber er ließ nicht locker. Der letzte Punkt für Georg waren die Rabatte. »Sie haben die zwanzig Prozent akzeptiert?« Normalerweise war das eine Frage, über die länger und intensiver diskutiert werden musste, bis man zu einer Lösung gelangte. Warum sollte man der Paradies GmbH bessere Konditionen einräumen als den Weinhändlern? »Sie haben auch das Zahlungsziel von einem Monat akzeptiert? Einfach so, ohne nachzuverhandeln?« Für Georg ging das alles viel zu glatt über die Bühne. Es gab nichts ohne einen Haken.
»Du siehst Gespenster, mein Lieber.« Susanne nickte gut gelaunt. »Wir haben lediglich die Zusammensetzung der Lieferung verändert, jetzt überwiegen die Weißen, Riesling, Chardonnay und Weißburgunder. Auf den war er ganz scharf. Es ist nicht das erste Geschäft dieser Art, das ich abschließe. Freu dich darüber – sonst beklagst du dich, dass ich vieles negativ sehe.«
Das tat Georg schon lange nicht mehr. Anfangs, als sie sich kennengelernt hatten, war ihr Misstrauen Männern gegenüber extrem. Er kannte den Grund, die Nachbarn hatten ihn gleich in den ersten Tagen darüber informiert, dass ein Jahr nach der Geburt des zweiten Kindes der Vater spurlos verschwunden war, auf Nimmerwiedersehen. Es war allen klar gewesen, auch der Polizei, dass er keinem Verbrechen zum Opfer gefallen war, denn er hatte vor seinem Abtauchen am selben Tag sowohl ihr Privatkonto wie auch das der Firma geplündert, und alle persönlichen Dokumente waren verschwunden. Das Weingut hatte er nicht mitgehen lassen; er hätte es wahrscheinlich getan, wenn es nicht auf Susannes Namen eingetragen gewesen wäre, es handelte sich schließlich um das Erbe ihrer Eltern. Dann hatte sie, von Beruf Diplom-Geologin, sich jahrelang abgerackert, um den Betrieb zu erhalten und ihre beiden Söhne durchzubringen, bis Georg eines Tages hier an der Mosel mit einem totalen Burn-out aufgeschlagen war. Später, als er sich erholt und bei ihr eine Art Betriebsprüfung durchgeführt hatte, war sie fast pleite.
Kilian, Susannes Jüngster, hatte an Georg einen Narren gefressen, vielmehr einen Vater gesucht, eine männliche Orientierung, hatte ihn nach und nach auf ihre Seite gezogen, ihn Stefan Sauter abspenstig gemacht und seine Mutter mit ihm verkuppelt. Danach war Rose hier aufgetaucht. Georgs jüngste Tochter hatte – im Gegensatz zu ihrer Schwester Jasmin – die Gelegenheit genutzt, ihrem Vater zu folgen und der ungeliebten Mutter zu entkommen. Rose hatte sich gut integriert.
Für Georg war es eine wunderbare Lösung, wäre da nicht der Zweikampf der Brüder um die Gunst des Mädchens entbrannt, obwohl sie inzwischen weit weg und im zweiten Semester war. Kilian war ihm ans Herz gewachsen wie ein eigener Sohn und hatte die Auseinandersetzung mit Karsten für sich entschieden. Mit ihm, dem Älteren, war er bis heute nicht warm geworden, der war noch immer auf der verzweifelten Suche nach dem Vater und gab seiner Mutter die Schuld an dessen Verschwinden. Jede freundliche Annäherung Georgs wurde brüsk zurückgewiesen, jeder Rat ausgeschlagen, jedem Entgegenkommen eine Abfuhr erteilt. Dieses Verhalten wurde zu seiner zweiten Natur (an die erste erinnerte er sich nicht einmal selbst), und alle und jeden machte er für sein Unglück verantwortlich. In der Schule war er zum Einzelgänger und Klassenprimus geworden, sein Bruder hingegen war als Klassensprecher gewählt worden, was im letzten Jahr den Konflikt zwischen den beiden weiter verschärft hatte.
Es gab Tage, da fürchtete sich Georg vor dem Mittagessen, wenn die beiden Jungen, seine Tochter Rose und Susanne ihm gegenübersaßen, wenn gestritten oder geschwiegen oder um Sympathien gebuhlt wurde. In diesen Momenten war Klaus’ Gegenwart am hilfreichsten, er fand klare Worte und schob die beiden Jungen auf die ihnen zustehenden Plätze. Er war der am wenigsten mit Schuldkomplexen Beladene von ihnen. Und Georg war froh, wenn er nach dem Essen aufstehen und im Keller oder im Weinberg verschwinden konnte.
Er hörte das Quietschen des grünen Hoftors, es erinnerte ihn daran, das Ölkännchen in die Hand zu nehmen. Als er aus dem Fenster zum Hof blickte, vermutete er, Kilians Blondschopf über sein Rennrad gebeugt zu sehen, aber es war ein Fremder. Der Unbekannte, von dem Klaus gesprochen hatte?
Georg stand auf, durchquerte den dunklen Korridor, trat auf der obersten Treppenstufe ins Licht und sah dem Fremden mit unverhohlener Skepsis entgegen. Dann ging er vier Stufen auf ihn zu.
Die ersten drei Sekunden entscheiden, sagte sich Georg. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass diese Regel sich immer wieder aufs Neue bestätigte. Sein Gegenüber war etwa gleich groß, nur schmaler als er und einige Jahre älter, ein Eindruck, den das graue Haar noch unterstützte, er mochte an die sechzig heranreichen. Das Gesicht war freundlich und offen, in den Augen las Georg Entschiedenheit, wie auch im Kinn, zugleich auch Zweifel. Er interpretierte es als Erfolg, dem dennoch etwas fehlte – vielleicht war es die Krone, die er sich aufsetzen wollte? Oder die Anerkennung, die man sich selbst schuldete? Am Geld mochte es nicht liegen, Georg hatte keinen armen Mann vor sich, der hellgraue Anzug stammte nicht von C&A.
Auch der Fremde maß ihn mit seinem Blick, er musste es gewohnt sein, Menschen zu beurteilen, um von ihnen etwas verlangen zu können und zu wissen, wie weit er mit seinen Forderungen – oder Anforderungen – gehen durfte. Schwäche zeigte er jedenfalls nicht. Er streckte die rechte Hand mit dem Ehering aus, da erst bemerkte Georg an der linken Hand den golden gefassten Siegelring mit dem Lapislazuli.
»Alexander Semmering, Und Sie sind Georg Hellberger?«
Das alles gehörte zum Ritual der ersten Begegnung: das gegenseitige Abschätzen, ein Kräftemessen und die eigene Befragung, ob die jeweiligen Erwartungen erfüllt werden konnten. Das jedenfalls las Georg aus dem Blick und der Art des längeren Händeschüttelns. Das hier, diese Begegnung, das war ihm klar, würde nicht ohne Folgen bleiben.
Trotz seiner Skepsis und seines Unwillens war ihm Semmering auf eine spezielle Art sympathisch – ein Gefühl, das seiner Neugier entsprang –, deshalb blieb Georg freundlich und dabei bemüht, sich keine seiner Regungen anmerken zu lassen. »Sie waren heute bereits hier, sagte mein Kellermeister. Was kann ich für Sie tun?«
Semmering holte tief Luft, beugte sich ein wenig vor, Vertraulichkeit suggerierend, und lächelte gewinnend. »Sie können oder könnten sehr viel für mich tun, Herr Hellberger! Aber wollen wir uns nicht irgendwo setzen, wo wir ungestört sind? Unser Gespräch könnte länger dauern.«
»Geben Sie mir mal einen Tipp, worum es geht, dann kann ich entscheiden, wo …«
»Ich möchte, dass Sie für mich ein Weingut ansehen«, unterbrach Semmering, »nein, besser gesagt, dass Sie klären, was es mit dem Weingut und seinem Besitzer auf sich hat.«
Georg, im Begriff, den Besucher in die Probierstube zu führen, einen neutraleren Ort gab es in diesem Haus nicht, zögerte mit der Antwort. »Deshalb kommen Sie ausgerechnet zu mir?« Sein Gegenüber machte nicht den Eindruck, als wäre er auf den Kopf gefallen, als könnte er sich nicht selbst einen Eindruck verschaffen oder Einblick gewinnen. Genau das fragte er ihn. »Wenn Sie ein Weingut kaufen wollen, weshalb machen Sie das nicht selbst? Außerdem stehen die meisten Weingüter Besuchern offen, man kann probieren, die Winzer sprechen gern über ihre Arbeit und leben davon, ihren Wein entsprechend zu verkaufen, meistens mit einer schönen Geschichte. Und niemand verlangt den Personalausweis.«
Semmering wand sich, als hätte er Mühe, sich zu einer Antwort durchzuringen. »Ich möchte gern, dass es sich um eine neutrale Person handelt, jemand, der das objektiv sieht. Aber bitte, setzen wir uns lieber, im Sitzen kann ich alles besser erklären …«
Georg dachte daran, Klaus zu rufen, aber Semmering hatte betont, nur mit ihm sprechen zu wollen.
»Vielleicht gehen wir zum ›Zeltinger Hof‹, ich habe gesehen, es sind nur wenige Schritte, ich lade Sie gern zum Essen ein.«
»Besten Dank, wir essen jedoch bei uns gemeinsam mit den Mitarbeitern.« Georg schaute auf die Uhr, um deutlich zu machen, dass er nicht unbegrenzt zur Verfügung stand. »Danach halten wir üblicherweise unsere Arbeitsbesprechung ab« – wenn es die Arbeit zuließ, auch mal ein Mittagsschläfchen – »klären, wie es am Nachmittag weitergeht und wer morgen welche Arbeiten übernimmt. Außerdem sollte jemand am Telefon bleiben.« Georg merkte, dass er den Besucher nicht so schnell loswürde. »Nun gut, gehen wir besser in mein Büro. Folgen Sie mir.«
Im Korridor stellte er Semmering kurz seiner Frau vor und signalisierte ihr, dass sie nicht gestört werden wollten, dann wies er im Büro auf den Platz, an dem sonst Susanne saß, schob einige Papiere zusammen und legte das unwichtigste Dokument oben auf den Stapel. Dann warf er die Kaffeemaschine an, was ihm noch einen Moment Zeit ließ, sich auf diesen »Kunden« einzustellen, bis sie beide eine Tasse vor sich stehen hatten und Georg ihm gegenübersaß. Jetzt blickte er nochmals auf Semmerings gepflegte Hände und die im Gegensatz zu seinen absolut sauberen Fingernägel. So jemand konnte nichts mit Weinbau zu tun haben, außer er residierte in der Chef- oder Marketingetage einer Großkellerei.
»Erzählen Sie bitte der Reihe nach«, bat er. »Ich soll also für Sie ein Weingut besichtigen. Und wo soll das sein? Hier in der Nachbarschaft, an der Mosel?«
»Nein, keineswegs.« Semmering beugte sich verschwörerisch vor, als wäre die Antwort nur für Georg bestimmt. »In Sachsen, Herr Hellberger, an der Elbe! Zwischen Dresden und Meißen.«
»In Sachsen? An der Elbe?«, wiederholte Georg ungläubig. »Wie kommen Sie darauf, mich zu fragen? Ich kenne mich ein wenig in diesem Abschnitt der Mosel aus, zumindest an dieser Schleife, aber in Sachsen war ich noch nie!«
»Bestens, ausgezeichnet!«
»Wie gesagt: Ich war da noch nie«, wiederholte Georg, seine Ablehnung unterstreichend, fast ein wenig empört, als wäre es ein Unding, ihn überhaupt zu fragen. Gleichzeitig ließ das Anliegen seine Neugier weiterwachsen. Sachsen? Das war für ihn ähnlich weit entfernt wie das türkische Anatolien. Dresden! Meißen! Das waren Wörter, aber keine Städte für ihn, das waren nicht einmal schwammige Vorstellungen von Gegenden der ehemaligen DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, der Sowjetischen Besatzungszone – ach, das war ein Rattenschwanz von Assoziationen, der sich da auftat. Mauertote, die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, und die Stasi, für ihn alles leere Worte, Bilder im Fernsehen, Artikel in Zeitungen, Kommentare im Radio. Er war fünfzehn gewesen, als die Mauer fiel. Im Fernsehen hatte er es gesehen und sich gefragt, was die Leute, die über die Grenzübergänge drängten, alle hier wollten. »Ich weiß nichts von Sachsen, ich weiß so gut wie nichts über die ehemalige DDR, nichts, was über den Horizont des durchschnittlich ungebildeten Bürgers hinausgeht. Wir sind mal in Frankreich gewesen und in Italien, es gab eine Klassenfahrt nach Amsterdam. Bei der Wiedervereinigung 1990 habe ich in Hannover gelebt, die Wiedervereinigung habe ich nur im Fernsehen mitgekriegt …«
»Wunderbar«, sagte Semmering, als hätte Georg das bestätigt, wonach er gesucht hatte. »Genau so jemanden brauche ich, jemanden, der ohne Vorurteile an die Sache herangeht.«
»Keine Vorurteile? Warten Sie’s ab! Meine Eltern hatten keinerlei Verbindungen in die DDR, wir hatten weder dort noch in Westberlin Verwandte. Die Stadt hat meine Eltern nicht interessiert, Kultur war nicht ihre Sache, und ich war nur mit der Schule und mit Judo beschäftigt. Da bin ich vor der Wende mal mit unserer Mannschaft durch die DDR gefahren, im Bus über Helmstedt nach Berlin. An der Meisterschaft haben auch Judoka aus der DDR teilgenommen, aber zu irgendwelchen Verbrüderungen kam es nicht. Die hatten immer Aufpasser dazwischen. Nur als einer von den Älteren abgehauen ist, in Westberlin untergetaucht und geblieben, da gab’s ein Riesentheater. Das betraf aber weniger uns als die DDR-Kollegen und deren Sportfunktionäre. Wir haben weder von zu Hause Päckchen mit Schokolade nach drüben geschickt noch an Weihnachten eine Kerze ins Fenster gestellt.«
All das brachte Georg vor, um jedwedes Anliegen Semmerings als unmöglich abzuwehren. Es war ihm völlig unverständlich, gerade ihn mit einem derartigen Auftrag zu konfrontieren. »Ich weiß so gut wie nichts, weiß wahrscheinlich nur das, was in den Zeitungen über die neuen Bundesländer stand, so neu sind die aber gar nicht, von blühenden Landschaften über die Treuhand bis zu fremdenfeindlichen Demonstrationen und Neonazi-Treffen, Pegida und diesen Schwachsinn. Also – dass ich keine Vorurteile hätte, möchte ich nicht bestätigen. Und über Wein weiß ich lediglich, dass an der Elbe und in Saale-Unstrut Wein angebaut wird. Der beste soll es nicht sein, ziemlich sauer wegen des Wetters und der Lage.«
»Wunderbar«, wiederholte Semmering. »Sie sind genau der richtige Mann …«
Das Telefon läutete. Georg bemerkte, wie Semmerings Blick seinem Griff zum Hörer folgte. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Kunde, der eine Bestellung aufgab. Georg notierte, bedankte sich und legte auf.
»So ist das auf einem Weingut mit Familienbetrieb. Jeder wird gebraucht, jeder hat seine Aufgabe, auf niemanden kann man verzichten. Auch unsere Kinder müssen helfen, die eine mit mehr, der andere mit weniger Enthusiasmus.« Es waren die Älteren, die sich am hartnäckigsten sträubten, Susannes Sohn Karsten und seine Tochter Jasmin, die nach der Trennung lieber bei der Mutter geblieben war.
Georg war verunsichert, gleichzeitig wuchs seine Neugier. Wieso ist dieser Semmering durch meine Gegenrede in keiner Weise beeindruckt, fragte er sich. »Sie sagten, Sie kämen auf eine Empfehlung hin.«
Semmering nickte. »So ist es. Man sagte mir, dass Sie früher in Hannover als eine Art Ermittler bei einer Sicherheitsfirma tätig waren und hier an der Mosel einen Mord aufgeklärt hätten.«
»Rein zufällig.« Georg hob abwehrend die Hand. »Ich geriet in diese Situation, und alles andere ergab sich von allein.«
»Nichts ergibt sich von allein, Herr Hellberger.« Semmerings Souveränität und sein Selbstvertrauen waren scheinbar durch nichts zu erschüttern. »Ein Mann ohne Ihren beruflichen Hintergrund hätte sich nie mit dem Tod des Restaurantbesitzers Albers beschäftigt und dazu noch den Mord aufgeklärt.«
Er wusste von Albers? Dann musste Semmering sich gut über ihn informiert haben. Wenn er den Namen Albers erwähnte, konnte der Hinweis auf ihn nur von dort kommen, von Albers’ Sohn Patrick, oder er kannte die Witwe. Möglich, dass er in der »Goldenen Gans« in Pünderich verkehrte. Dass der Hinweis aus anderer Quelle stammte, hielt er für wenig wahrscheinlich, es kam höchstens noch die Bürgerinitiative gegen den Bau der Hochmoselbrücke in Betracht. Aber Albers war lange tot, und die Brücke stand auf ihren Pfeilern, und er gehörte seit Jahren längst nicht mehr zum Stadtgespräch.
»Der Tod des Winzers, der damals der Bürgerinitiative vorstand, blieb aber bis heute ungeklärt?«
Mit wem alles hatte Semmering gesprochen? »Sie scheinen bestens informiert zu sein«, sagte Georg unwillig. Sein Misstrauen und die Neugier hielten sich die Waage. Dazu trug auch das überlegene Lächeln seines Gegenübers bei.
»Das bringt mein Beruf mit sich, er erfordert es geradezu.«
»Darf man wissen, was Sie tun?«
»Ich bin bei einer Dortmunder Leasingfirma tätig, wir finanzieren Maschinen und Anlagen. Ich schaue mir die Unternehmen an, die mit uns arbeiten wollen.«
»Und wozu brauchen Sie dann mich, Herr Semmering? Wieso kommen Sie dann gerade zu mir? Sie werden sicher einiges mehr über die Wirtschaft wissen als ich, auch über die im Osten.« Georg wusste jetzt gar nicht mehr, was er von der Angelegenheit halten sollte. Wieso machte dieser Mann seine Arbeit nicht selbst?
»Ich verstehe nichts von Wein und Weingütern, Herr Hellberger, nichts von der Landwirtschaft. Am rechten Elbufer sind die dortigen Steillagen, und mit solchen sind Sie vertraut, Sie bearbeiten selbst welche.«
Das könnte eine Erklärung sein. Aber Georg blieben Zweifel: »Und wie kommen Sie auf ein Weingut in Sachsen, wieso gerade dort? Es gibt andere Regionen, wo es sicherlich mehr Spaß macht, Wein anzubauen, die Pfalz, Württemberg vielleicht …« Noch dazu war Sachsen weit weg, als Herkunftsgebiet klein und im Westen weder bekannt noch in den Weinhandlungen vertreten, dazu wenig Sonne, saure Weißweine … Der Gedanke an Rechtsradikale, die sich im Osten immer stärker formierten, ja geradezu eine Bedrohung bildeten, lag nicht fern. Georg wiederholte seine Frage. »Also, weshalb Sachsen?«
Es dauerte eine Weile, bis Semmering sich zu einer Antwort durchrang. Es schien ihm nicht leichtzufallen. »Es gibt in der Nähe von Meißen ein Weingut, das ich kaufen wollte. Dieses Weingut hat meinem Großvater beziehungsweise meinen Großeltern gehört. Als die Rote Armee vorrückte, sind sie in Richtung Berlin geflohen, wie Tausende andere. Sie hatten Angst, nicht so sehr wegen ihres Besitzes, sie waren keine Großagrarier, es waren gerade mal fünfzehn Hektar Weinland und eine kleine Kellerei …«
»Das war alles?«
»Na ja, dazu kam ein Stück Wald, etwas Weide- und Ackerland, aber nicht viel, insgesamt etwas mehr als einhundert Hektar. Was ihnen mehr Angst gemacht haben soll, so hat man es mir später erzählt, war der eigene Name. Sie müssen wissen, dass wir ursprünglich von Semmering hießen – ich habe das später ändern lassen –, auf den Adel sollen die Russen nicht besonders gut zu sprechen gewesen sein, was sich auch kurz darauf zeigte.«
Wie Semmering erklärte, waren nach 1945 Großgrundbesitzer und Industrielle enteignet worden, ohne eine Entschädigung zu erhalten. »Mit der Parole ›Junkerland in Bauernhand‹ wollte die Besatzungsmacht damals die Kleinbauern und Landarbeiter für sich gewinnen und die alten Machtstrukturen auf dem Land zerstören, was ihnen gelungen ist.«
»Und was geschah mit Ihren Großeltern, nachdem sie geflohen sind?«
Jetzt zeigte sich im Gesicht Semmerings zum ersten Mal eine emotionale Regung, die über das verbindliche Lächeln hinausging. »Glücklicherweise haben sie meinen Vater und seine Schwester auf dem Weg nach Berlin einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter übergeben, denn meine Großeltern sind nie in der Hauptstadt angekommen. Andere aus dem Dorf, die mit ihnen unterwegs waren, haben sie aus den Augen verloren. Sie sind einfach verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt, in den Kriegswirren auf der Flucht verschollen.« Semmering breitete schicksalsergeben die Arme aus. »Dabei ist es von Meißen nach Berlin gar nicht so weit. Vielleicht haben sie sich unterwegs für ein anderes Ziel entschieden, auch das ist möglich. Oder sie wurden ausgeraubt und ermordet. Sie werden selbstverständlich ihre Wertsachen mitgenommen haben, Geld, Familienschmuck. Mein Vater und seine Schwester haben sich dann noch vor dem Mauerbau in den Westen abgesetzt – von dort haben sie jahrelang nach ihren Eltern gesucht, auch über den Suchdienst des Roten Kreuzes. Nach Kriegsende fehlte von etwa zweieinhalb Millionen Menschen jedes Lebenszeichen.« Semmering verzog gequält das Gesicht. »Jahrzehntelang war es ein Thema in unserer Familie. Es wurde auch erwogen, dass einer der ehemaligen Mitarbeiter, der die Vermögensverhältnisse kannte, an ihrem Verschwinden beteiligt war.«
»Und als das Weingut Ihrer Großeltern enteignet wurde, konnte niemand Widerspruch einlegen?«
Semmering lächelte mitleidig. »Das ist eine Frage, die man heute stellen kann, damals war Widerspruch gegen die Besatzungsmacht unmöglich. Wer den Mund aufmachte oder protestierte, galt als Nazi oder Kriegsverbrecher und verschwand im Zuchthaus, wurde deportiert oder erschossen. Bis 1949 wurden weit mehr als siebentausend Großgrundbesitzer enteignet beziehungsweise war ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Sowjetzone von Enteignungen betroffen.«
Semmerings Erläuterungen gingen Georg mittlerweile zu weit und waren ihm viel zu speziell. Er musste zum Kern vordringen. Ihm war das alles zu nebulös.
»Mir scheint, dieses Weingut existiert und wird von jemandem betrieben, dem es jetzt gehört?«
»So ist es. Augenblicklicher Besitzer ist ein gewisser Peter Studt, angeblich soll er es kurz nach der Wende gekauft haben.«
»Wenn die Besitzverhältnisse klar sind, was treibt Sie dann noch um? Sie könnten ihm ein gutes Angebot machen, könnten vor Gericht gehen …«
Semmering zögerte eine Sekunde zu lang mit der Antwort, was Georgs Aufmerksamkeit nicht entging. »Ich habe mich bereits 1995 an die Treuhand gewandt, da hatte noch kein Verkauf stattgefunden. Die Treuhand verwies mich an die BVVG in Berlin, eine Gesellschaft des Bundes für Bodenverwertung und -verwaltung. Die regeln bis heute den Flächenverkauf in den neuen Bundesländern.«
»So neu sind die gar nicht mehr«, warf Georg ein.
Semmering ging nicht darauf ein. »Von der BVVG bekam ich keine Auskunft, der Fall sei dort nicht bekannt, es gebe auch keine Unterlagen. Der Besitzer unseres ehemaligen Weingutes, Herr Studt, hat mich vom Hof gejagt. Als ich ihm ein Kaufangebot gemacht habe, hat er mir sogar mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gedroht, wenn ich nicht verschwinden würde. Der Einblick ins Grundbuch wurde mir von der Behörde verweigert, da ich angeblich kein plausibles Interesse nachweisen konnte.«
»Und das alles wollen Sie jetzt mir aufbürden, ich soll mich mit denen, besonders mit diesem Herrn Studt herumärgern? Sind nicht kürzlich die Dokumente der Treuhand freigegeben worden, da könnten Sie …«
Semmering unterbrach und wehrte entschieden ab. »Die haben vorgesorgt. Nur Wissenschaftler und Journalisten erhalten Auskunft. Wenn man einen Antrag auf Akteneinsicht stellt, muss der begründet sein, dann werden die entsprechenden Akten erst einmal von der Behörde gesichtet und das entfernt oder geschwärzt, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen soll. Dann soll es noch Akten in mehreren Ministerien geben, die man dem Bundesarchiv verweigert. Um solche Recherchen kann ich mich selbst kümmern, Ihre Aufgabe hingegen wäre es, sich im Umfeld des Weingutes umzusehen und auch direkt vor Ort. Sie als Winzer fallen nicht auf, Sie haben Steillagenerfahrung und verfügen über das Wissen eines privaten Ermittlers. Ich nehme an, dass Sie wissen, wie und welche Fragen man stellen sollte. Ich selbst bin verbrannt, mein Gesicht und meinen Namen kennt man dort. Ich bin der böse Wessi, der den Besitz der adligen Ausbeuter zurückhaben will. Nach dem Motto: Die Junker sind zurück! Sind spannende Geschichten nichts mehr für Sie?«
Jetzt wand sich Georg. Einerseits war mit jeder weiteren Information über Semmerings Anliegen sein Interesse gewachsen, andererseits hatte er wenig Lust, sich mit fremder Leute Probleme herumzuschlagen, besonders wenn es dabei nichts zu gewinnen gab, weder für den Betrieb noch für seine Familie oder gar für sich selbst als persönlichen Erkenntnisgewinn.
»Ich nehme an, die Klärung dieser Angelegenheit ist dringend?«
Die Antwort kam prompt: »Ich klebe seit Jahrzehnten an der Sache. Ich bin jetzt sechzig Jahre alt. Zu viel Zeit habe ich nicht mehr, ein Winzer zu werden. Es war immer mein Traum, von klein auf, da existierte seit meiner Kindheit so etwas wie ein Familientraum. Vielleicht ist es Blödsinn, vielleicht kommt nichts dabei raus, möglicherweise muss ich mich endgültig von dem Traum verabschieden, bevor es ein Albtraum wird, allerdings nicht, bevor ich alles versucht habe. Ich biete Ihnen siebenhundert Euro Tageshonorar, Spesen sind selbstverständlich extra …«
Semmering hatte sich erhoben, und Georg begleitete ihn nach draußen.
»Denken Sie darüber nach«, sagte Semmering, als Georg ihn am grünen Tor verabschiedete, »aber bitte nicht zu lange.« Im abschließenden intensiven Händeschütteln zeigte Semmering, wie wichtig ihm sein Anliegen war. Er ließ Georgs Hand kaum los.
2. KapitelDie Leidenschaft fürs Schöne
»Wer war das?«, fragte Kilian, stieg vom Rad und sah den Fremden zwischen den Häusern der Kurfürstenstraße verschwinden. »Ein Kunde?«
»Das war jemand, der es eilig hat, nicht ganz mit der Sprache herausrückt und viel Geld für einen Traum übrig hat.« Georg blickte ihm noch immer nach, als er längst verschwunden war, und bemerkte irritiert, dass Kilian ihn fragend anstarrte.
»Er will, dass ich für ihn einen Auftrag erledige, irgendeine heikle Geschichte über ein Weingut in Sachsen, angeblich eine alte Familientragödie.«
»Angeblich? Ist das nicht klar?« Kilian wandte sich dem Hof zu, das Rad zwischen sich und Georg herschiebend. »Kennst du den Mann gut?«
Georg schüttelte den Kopf. »Nein, erst seit heute.«
»Und wieso hat er gerade dich angesprochen?«
»Damals, als ich hergekommen bin, du erinnerst dich, hatte ich einen anderen Beruf …«
»Ich weiß, du warst so was wie ein Privatdetektiv.«
»Nein, das stimmt so nicht. Ich war für den kaufmännischen Bereich einer Sicherheitsfirma zuständig, also für die Finanzen. Mit der Alltagsarbeit hatte ich wenig zu tun. Habe ich dir das nie erklärt?«
»Nein, du hast immer ein Geheimnis daraus gemacht, als wäre es dir peinlich.«
In gewisser Weise war es das Georg auch, besonders die Schlussphase. »Ich werde dir bei passender Gelegenheit alles ausführlich darlegen, mein Herr.«
»Was ist eine passende Gelegenheit? Wann tritt die ein?«
Damals, als Georg an die Mosel gekommen war, hatte Kilian ihn bereits mit einfachen, klar gestellten Fragen überrascht, denen er nicht hatte ausweichen können. »Du warst gerade mal acht Jahre alt, als ich herkam, da hätte ich dir das schlecht vermitteln können.«
»Du meinst also, dass wir im Englischunterricht zwar Shakespeares Königsdramen auf Englisch lesen dürfen und verstehen müssen, aber deine Geschichte ist komplizierter als King Lear und Macbeth?« Er sagte es in ruhigem Ton, sehr gelassen, mit einem Grinsen, wohl wissend, dass er mit seinen direkten Fragen andere in Erklärungsnot bringen konnte.
»Nein, meine Geschichte ist nur persönlicher – und aktueller.«
»Was glaubst du eigentlich, was Rose mir alles von früher schon erzählt hat, aus eurer Zeit in Hannover. Wie du dich mit deiner Exfrau gestritten hast, wie sie dich hintergangen hat, wie du und Rose heimlich zusammen essen gegangen seid, weil ihr das tägliche Bestellfutter leid wart.«
Rose und Kilian verstanden sich prächtig, ganz im Gegensatz zu Karsten, der sich immer weiter zurückzog und inbrünstig darauf hoffte, möglichst bald nach dem Abitur für ein Studium das enge Moseltal und auch das spießige Weingut zu verlassen. Es schien Georg so, als lebte Karsten mit ihm und Rose und seinem Bruder Kilian sowie mit dem Weinbau in einer Art Status quo. Er fühlte sich ausgeschlossen und verweigerte jede Annäherung.
»Aber was ich weiß, das hat mir nicht nur Rose erzählt, auch dein Freund Pepe plaudert gern – über eure Abenteuer bei den Festivals, die Prügelei beim Rockkonzert, und das nicht nur einmal. Er meinte, du hättest gut hingelangt.«
»Glaubst du mir jetzt, dass es etwas zu persönlich wird und mir ein wenig peinlich?«
»Quatsch, das braucht dir nicht peinlich sein, außer du hast angefangen. Aber jetzt noch mal zu dem Sachsen. Was genau will der von dir?«
Georg wusste, dass niemand Kilians Neugier auf Dauer gewachsen war. Der Junge insistierte, fragte, quetschte aus, er ließ nicht locker und bohrte nach, dann begann er von vorn, bis er wusste, was er wissen wollte. »Ich erzähle es euch beim Essen.« Er blickte auf die Uhr. »Rose und Karsten müssten auch jeden Moment hier sein.«
Kilian stellte sein Fahrrad unter das Dach, das den Raum zwischen den beiden zum Weingut gehörenden Häusern überspannte. So war eine Art Remise für den Traktor, das Spritzgebläse und den Anhänger geschaffen worden. Georg hatte gegenüber auf dem Weingut von Stefan Sauter beobachtet, wie dieser den Zwischenraum zwischen Haus und Weinberg hatte überdachen lassen, um dadurch quasi eine neue Halle zu gewinnen.
Es war längst nicht genug Sauerbraten vom Sonntag übrig, um alle satt zu bekommen. Der junge Syrer sowie Kilian und Karsten verschlangen danach Unmengen an Kartoffelpuffern mit Apfelmus, Klaus stand ihnen kaum nach. Rose war, seit sie Agrarwissenschaft studierte, zur Fleischverweigerung übergegangen und hielt mit, Georg hingegen zeigte heute wenig Appetit. Außerdem sah er sich von Kilian genötigt, den Besuch vom Vormittag zu erklären und sein heimliches Interesse nicht zu deutlich werden zu lassen.
»Lasst mich doch erst einmal in Ruhe darüber nachdenken, ich muss mir klar werden, was ich davon halten soll.«
»Siebenhundert Euro am Tag – das sind dreieinhalbtausend Euro in der Woche«, bemerkte Susanne in ihrer stillen Art, als sie aufgeräumt und die jungen Leute die Küche verlassen hatten. »Das Geld könnten wir gut gebrauchen, es stehen einige Anschaffungen an. Steuerfrei?«
»Davon gehe ich aus, Semmering wird genügend Geld haben.«
»Oder er blufft. Hast du das in Erwägung gezogen?«
»Ich habe noch gar nichts in Erwägung gezogen«, sagte Georg ärgerlich, er fühlte sich ungern gedrängt. »Ich könnte natürlich ein Voraushonorar verlangen, das würde mir zeigen, wie ernst er es meint.«
»Ich merke dir an, mein Lieber, wie es in dir gräbt. Im Übrigen glaube ich, dass es dir guttut, wenn du mal wieder … draußen bist, dir anderen Wind um die Nase wehen lässt und mit anderen Winzern fachsimpeln kannst, die nicht unbedingt zu den Konkurrenten aus dem Nachbarort gehören.«
Georg stand auf und trat zur Küchentür. »Ich komme nach«, rief er in den Flur, denn eigentlich war eine Begehung der Sonnenuhr geplant. In dieser Jahreszeit ging es darum, auf der Lage oberhalb ihres Anwesens Wasserschosse sowie Doppeltriebe auszubrechen, um von vornherein die sich entwickelnde Laubwand nicht zu dicht werden zu lassen und die Menge an Trauben zu beschränken. Gleichwohl mussten die jetzt lang wachsenden, später Trauben tragenden Triebe in den Drahtrahmen eingeflochten werden. Das musste mehrmals geschehen, es war warm, es hatte geregnet, die Triebe wucherten geradezu, täglich bis zu zehn Zentimeter.
»Vielleicht ist es ganz gut, wenn du dir mal eine andere Region anschaust und siehst, wie sie es dort handhaben und was sie aus ihren Trauben zu machen verstehen. Sachsens Weinbaufläche ist im Vergleich zu anderen Regionen geradezu winzig.«
»Es sind etwa fünfhundert Hektar.«
»Das ist ja noch weniger als an der Ahr«, sagte Susanne erstaunt. »Ich habe hier noch nirgends einen Wein aus Sachsen gesehen, geschweige denn getrunken.«
»Ich nehme an, sie trinken alles selbst.«
»Und dann ist noch ein Teil der Fläche Steillage, da sind die Erträge deutlich niedriger, wahrscheinlich wie bei uns. Wenn mich nicht alles täuscht, wirst du den Auftrag annehmen. Andernfalls hättest du längst abgelehnt. Aber mach dich erst schlau«, empfahl Susanne, »auch über diesen Semmering. Das kann in keinem Fall schaden.«
»Du wälzt wie immer zu viele Gedanken. Ich würde es als Chance auf bezahlte Ferien ansehen«, sagte Georgs Tochter Rose. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie zum Mittagessen da war. Sie kam immer mal wieder her, wenn ihr das Stadtleben oder die Uni zu viel wurde oder sie die Ruhe des Landlebens suchte, um eine Hausarbeit zu schreiben. Sie trat neben ihren Vater, schmiegte sich an ihn, legte ihm eine Hand auf die Schulter und betrachtete die Landkarte, die Georg auf dem Schreibtisch vor sich ausgebreitet hatte.
»Du brauchst dringend Ferien, Papa. Vor drei Jahren sind wir zuletzt zusammen verreist – mit Kilian an die Rhône, natürlich haben wir Weingüter besichtigt. Wahrscheinlich hast du mich nur mitgenommen, damit du eine Übersetzerin hast, weil du kein Französisch sprichst …«
»Das ist nicht wahr«, fuhr Georg auf, »ich verreise gern mit euch!«
Rose lachte. »Siehst du, Papa, wie dringend du Ferien brauchst? Du fällst auf jeden Blödsinn rein und regst dich sofort auf. Nein, es war eine schöne Reise, und wir haben ja nicht nur Keller angesehen, auch viele kaputte Burgen und alte Kirchen. Ich würde gern nach Sachsen mitkommen, sogar Weinkeller besichtigen, aber die Uni ruft, mit Entschuldigungsschreiben wie früher ist leider nichts mehr. Bis Juli kannst du mit der Reise nicht warten?«
»Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt dorthin reise.«
»Natürlich wirst du reisen. Ich kenne dich. Ist das die Gegend, wo du hinsollst?« Rose fuhr mit dem Finger die Elbe entlang. »Meißen habe ich schon mal gehört, Dresden auch, aber Radebeul? Und was ist das hier – Weinböhla? Sörnewitz und Brockwitz, Kötzschenbroda«, sie lachte wieder, »was sind das für Namen? Hier oben«, ihr Finger blieb an der Elbe oberhalb von Meißen stehen, »Rottewitz, Winkwitz und Proschwitz?«
»Ich glaube, diese Namen sind sorbischen oder slawischen Ursprungs«, erklärte Georg.
»Gibt’s von denen eigentlich noch welche?«
»Klar, die Sorben leben in Brandenburg und in Sachsen. Nun hör aber endlich auf zu lachen«, meinte Georg ernst, nicht sehr davon angetan, dass Rose sich über die Namen lustig machte. »Wir hier in Zeltingen-Rachtig, da könnte man meinen, wir lebten in Zelten und litten an Rachitis.«
Rose ließ sich davon nicht beeindrucken, sie hatte sich eine Lupe genommen und suchte weiter nach für sie besonders witzigen und komischen Namen. »Gauernitz und Pinkowitz und dann hier unten«, ihr Finger näherte sich Pirna, sie kicherte, »da haben wir Blasewitz und Tolkewitz, hört sich wirklich an wie ein Witz. Und da wird überall Wein angebaut? Oh, geil, ich komme mit, die Dörfer will ich sehen. Aber nach Freital, Bautzen oder Heidenau will ich nicht, da ist es gefährlich. Da hocken die schlimmen Jungs.«
»Woher willst du das wissen?« Georg war erstaunt, er konnte sich nicht erinnern, dass Neonazi-Aufmärsche bei ihnen ein Thema gewesen wären.
»Nachdem es in Trier eine Durchsuchung wegen Combat 18 gegeben hat, haben sie in Kilians Schule einen Arbeitskreis Rechtsextremismus gegründet, zusammen mit einem Lehrer, der in Dresden geboren und nach der Wende sofort abgehauen ist. Kilian arbeitet in dieser Gruppe mit, weißt du das nicht? Ich kannte den Lehrer nur vom Sehen, wir hatten damals keinen Unterricht bei ihm.«
Von dieser Gruppe hatte Kilian ihm nichts erzählt. Es gab Georg einen kleinen Stich, und er sah es als Zeichen, dass der Junge zunehmend unabhängig wurde und eigene Wege ging. Bis vor einem Jahr hatte es fast nichts gegeben, was er nicht mit ihm besprochen oder ihn um Rat gefragt hatte.
»Trauben werden nur entlang der Elbe angebaut«, sagte Georg, um zum Thema zurückzukommen. »Ich glaube, sogar nur am Südufer, da ist es am wärmsten, von Pirna bis Diesbar-Seußlitz, entlang der Sächsischen Weinstraße.«
»Du weißt ja doch einiges.« Übergangslos wurde Rose ernst. »Weshalb vertraust du diesem Mann nicht?«
»Du meinst Semmering?« Georg atmete tief ein, lehnte sich nachdenklich zurück und starrte auf den Arbeitsplan an der Wand. Dort waren die Arbeiten aufgeführt, die in den nächsten Monaten stattfinden mussten und wer von ihnen jeweils verantwortlich war. In der momentanen Phase der Rebentwicklung würden sie ihn hier eine gute Woche entbehren können. »Du hast Semmering nicht gesehen?«, fragte er.
»Nein, ich bin erst später gekommen, da war er schon wieder weg.«
»Jemand wie er hat Möglichkeiten, hat Mittel, kann es sich leisten, Leute loszuschicken, die für ihn Ermittlungen anstellen können. Er scheint sich verbrannt zu haben, sein Gesicht ist bekannt, er bekommt keine Antworten mehr, so sehe ich das. Möglich, dass sein Name einen schlechten Ruf hat.«
»Oder der, dem das Weingut jetzt gehört, streut Gerüchte?«
Georg hielt auch das für möglich. »Man – oder besser gesagt: ich – weiß nicht, was dort in der Zeit nach der Wende los war, wem die Weingüter gehörten, wer damals enteignet wurde, da fand nämlich eine zweite Enteignung statt, dabei hat die DDR-Regierung den Bauern das Land weggenommen, die Landwirtschaft kollektiviert und im Arbeiter- und Bauernstaat die Bauern zu Landarbeitern gemacht.«
»Und wie war das beim Weinbau?«
»Keine Ahnung, damit habe ich mich nie beschäftigt, das könnte ich in dem Zusammenhang tun.«
»Und der jetzige Besitzer von dem Weingut, ist das ein Wessi oder Ossi?«
»Du fragst mich Sachen! Aber stimmt, das könnte wichtig sein, ein Wessi hätte es dort sicher schwerer, Fuß zu fassen, als ein Einheimischer …«
»Einer von denen kennt die Nachbarn«, unterbrach Rose, »der weiß, was gespielt wird, die helfen sich gegen die Hinzugezogenen, die wollen keine Fremden, das merkt man deutlich beim Thema Flüchtlinge.«
»Ich frage mich viel mehr, ob etwas an dem Namen Semmering klebt und was das sein könnte.«
»Den Namen musst du ja nicht erwähnen. Wahrscheinlich haben sie den sowieso längst vergessen. Oder den kennen nur noch die Alten. Gibt’s was über diesen Semmering im Internet?« Rose beugte sich über den Schreibtisch und zog die Tastatur des Rechners zu sich heran. »Habe mein Smartphone leider nicht zur Hand.« Sie lachte ihren Vater an und schob ihn mitsamt seines Bürostuhls freundlich zur Seite. Dann gab sie den Namen in die Suchmaschine ein, doch bis auf etliche Fundstellen zu einem gleichnamigen Ferienort in Niederösterreich fand sich kein Eintrag. »Der Typ scheint gar nicht zu existieren.«
»Existieren für euch nur die Leute, die eine digitale Spur hinterlassen?« Eigentlich hatte er »digitale Schleimspur« sagen wollen, aber hier ging es nicht um Facebook.
Rose verließ kopfschüttelnd den Raum und kam einen Moment später zurück, ihr Smartphone in der Hand. »Bei Facebook wird sich was finden, du machst ja da nicht mit.«
Doch auch hier gab es keinen Eintrag, weder von Semmering noch von Peter Studt. Georg griff nach der Visitenkarte und wählte Semmerings Büronummer. Es meldete sich eine Telefonistin, verband Georg mit Semmerings Sekretärin, die ihm erklärte, dass ihr Chef heute nicht im Büro sei.
»Dann wissen wir zumindest, dass er wirklich bei dieser Firma arbeitet und kein kleines Licht ist, sonst hätte er keine Sekretärin, und heute ist er nicht anwesend, weil er hier ist – oder war. Wie seid ihr verblieben?«
»Ich soll ihn anrufen, wenn ich mich entschieden habe. Jetzt werde ich mir die Homepage von diesem Studt ansehen, die gibt es immerhin.«
Die Einstiegsseite zeigte ein schmuckes Fachwerkhaus, auf der Veranda saßen einige Personen an Tischen unter großen bunten Sonnenschirmen, Kunden, Weinfreunde oder Touristen, wer auch immer, und prosteten einander zu. Die Menschen wirkten ein wenig leblos und gezwungen, wie bezahlte Statisten, die vorgaben, einen vergnüglichen Nachmittag zu verbringen. Georg empfand den Auftritt als bieder und antiquiert, auch Rose rümpfte die Nase. »Ich find’s spießig. So sehen Hunderte von Weingütern aus.«
Unter dem Foto stand ein pseudophilosophischer Text.
»Wein – das ist die Leidenschaft für das Schöne, das ist Hingabe und Inspiration, Wein ist das Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur – des Terroirs, des Klimas, der Rebsorte und der Hand des Winzers. Aus dem Ergebnis schöpfen wir immer wieder die Kraft, unseren Weinbergen das Beste zu geben, das wir haben – uns selbst.«
Dann folgte der übliche Absatz über die Verantwortung den Kunden gegenüber, Geschwafel vom Erhalt der Tradition und der Hinwendung zur Moderne, die Verbindung von Wissenschaft und Technik mit der Intuition und Erfahrung des Winzers. Diese Begriffe wurden von den Werbetextern in eine Dose gesteckt, dann wurde kräftig geschüttelt, und die Begriffe fielen in immer neuer Kombination aus der Dose heraus. Es bedurfte nur entsprechender Füllwörter. Dieser Text sagte absolut nichts über die Betreiber und das Weingut aus. Dann hieß es noch, dass man einen berühmten Önologen habe gewinnen können, der Peter Studt, Winzer aus Leidenschaft, kenntnisreich berate.
»Zu viele Adjektive, findest du nicht auch?«, meinte Rose.
Da war die zweite Seite der Homepage schon aufschlussreicher: Hier fanden sich die angebauten Rebsorten nebst Fotos von Weinstöcken und einer Beschreibung des Geschmacks nebst einigen Testimonials oder Zeugnissen von wirklichen (oder erfundenen?) Kunden. Wer mochte ein Herbert P. aus M. sein, wer eine Christine A. aus O.? Und diese Buchstaben hatten selbstverständlich beste Bewertungen abgegeben.
Unter den Rebsorten war Riesling vertreten, ein Goldriesling, eine Sorte, die Georg noch nie probiert hatte und die nur in Sachsen angepflanzt wurde. Müller-Thurgau war ein Muss, der Weißburgunder würde interessant sein, Georg war neugierig, wie er an der Elbe ausfiel, denn er hatte vor fünf Jahren diese Rebsorte auch hier in ihr Portfolio aufgenommen. Sie brachte mehr Vielfalt und neue Impulse in ihren Betrieb. Da war er sich mit Susanne und Kellermeister Klaus einig. Traminer schien in Sachsen beliebt zu sein, nicht nur bei Studt, aber damit hatte Georg keinerlei Erfahrung, mit Spätburgunder schon eher, die Rebsorte mit dem größten Eigenleben oder besser: Eigensinn. Auch beim Dornfelder fühlte er sich als Experte nicht berufen, er mochte ihn nicht, denn der fiel ihm meistens zu gewöhnlich aus. Das musste natürlich nicht für die Lagen an der Elbe gelten.
Auf Roses Anraten gab er Sachsen und Elbling in die Suchmaschine ein und fand nur zwei Weingüter, die ihn kultivierten. Er notierte die Namen der Güter, die er gegebenenfalls besuchen würde. Dabei hatte Elbling nichts mit der Elbe zu tun, die Römer hatten diese Rebsorte einst bei der Eroberung Germaniens mit an die Mosel gebracht.
Mit einem Mal wurde Georg gewahr, was er eben gedacht und für den Fall des Besuchs notiert hatte: wie Weißburgunder ausfallen würde und dass er die Weingüter besuchen wollte, die einen Elbling kelterten. Also nahm nun doch die Neugier gegenüber der Skepsis überhand?
»Du träumst, Papa«, sagte Rose, »diese Seite gibt nichts her, sagt nichts über den Winzer, über seine Person, nichts über die Arbeitsweise, nichts über die Geschichte des Weingutes. Ob die Steillagen dazugehören, wird auch nicht klar. Alles allgemeines Gelaber, aber die Preise sind heftig.« Rose hatte die nächste Seite mit dem Shop des Weingutes angeklickt. Sie überflog die Angebote: »Das ist ein Drittel teurer als bei uns. Und ich finde, dass wir schon teurer sind als Franzosen und Spanier.«
»Es wird Gründe für die Preise geben«, gab ihr Vater zu bedenken. »In fremde Kalkulationen mische ich mich nicht ein. Höhere Preise können höhere Kosten bedeuten, höhere Qualität oder geringere Mengen. Es geht immerhin um Steillagen, du weißt, wie viel Arbeit da drinsteckt. Oder sie verkaufen nur über den Fachhandel oder im Weingut direkt, da kann man sich das leisten.« Er hatte gesehen, dass andere Weingüter über einen Garten oder eine Gästeterrasse verfügten, wo Besuchern Weine und kleine Speisen angeboten wurden.
»Dabei verdienen die im Osten doch alle weniger als wir hier, die Löhne sind immer noch niedriger.«
»Aus der Entfernung darüber ein Urteil zu treffen ist schwierig, das fällt meistens ungerecht aus. Gib mir lieber mal den ›Gault & Millau‹, wir schauen uns mal an, was in dem Weinführer über die Weingüter gesagt wird.«
Rose ging zum Regal mit der Fachliteratur, kam mit den letzten drei aktuellen Bänden zurück und baute sie vor Georg auf. »Schreiben die jedes Jahr dasselbe?«
»Das werden wir gleich sehen«, sagte er und zählte die von den Autoren als Sachsens bestebezeichnete Weingüter. »Fünfzehn sind es. Als sehr gut ist hier ein Martin Schwarz aufgeführt, dann ein Schloss Proschwitz und Schloss Wackerbarth.«
»Wie kommen die zu Schlössern? Ich denke, die haben in der DDR damals den Adel abgeschafft.«
Georg hörte nicht mehr zu, er hatte begonnen, die Beschreibungen zu lesen.
»Dann kann ich ja gehen«, meinte Rose beleidigt. »Ich glaube sowieso, du hast dich längst entschieden. Erstens willst du hier mal raus, und zweitens bist du neugierig. Aber Achtung, in Sachsen gibt’s ’ne Menge Leute, denen man besser aus dem Weg geht.«
»Wen meinst du?« Georg sah auf.
»Ich meine die Leute, die in schwarzen Klamotten rumlaufen, Parolen brüllen, sich für das Volk halten, als wenn wir hier nicht dazugehörten, und sich Hakenkreuze irgendwohin tätowieren lassen – von mir aus am besten am Hintern, da sieht es wenigstens keiner«, kicherte sie. »Pass auf, wenn du Autonummern mit 88 und 18 siehst – die Zahlen stehen für die Buchstaben des Alphabets. Die 88 steht in Neonazi-Kreisen für Heil Hitler, die 18 oder AH für Adolf Hitler. Dann gibt’s noch HH für Heil Hitler. In Sachsen sind diese Kombinationen nicht verboten. Du kannst bei solchen Leuten nicht an dich halten, Papa, aber die treten immer in Gruppen auf und schrecken vor nichts zurück. Die wollen eine Diktatur wie unter Hitler …«
»… oder unter Honecker«, meinte Kilian, als er das Büro betrat und sich krachend in den Bürostuhl seiner Mutter fallen ließ. Dann reckte er den Hals und ließ neugierig den Blick über den Schreibtisch gleiten. »Herr Fink, unser Englischlehrer, der beim Mauerfall abgehauen ist, meint, dass die große Mehrheit in der DDR ganz zufrieden war mit den Zuständen.«
»Das ist die Mehrheit immer …«, warf Georg ein.
»Freiheit sei denen am Arsch vorbeigegangen, sagt er, das hätten die ersten freien Wahlen gezeigt, da hat die Mehrheit CDU gewählt und nicht die Bürgerrechtler, die ihren Kopf hingehalten haben. Aber sie hatten nichts zu versprechen, dafür hat das der damalige Bundeskanzler getan, dieser Kohl, Merkels Vorgänger, der von blühenden Landschaften gesprochen hat, die er dort schaffen wollte. Und die Leute haben den Versprechungen geglaubt.«
»Das ist immer einfacher, als selbst was Neues aufzubauen«, meinte Rose.
»Das habe ihnen die SED abgewöhnt, sagt jedenfalls Herr Fink. Aber du solltest besser mit ihm persönlich reden«, schlug Kilian vor. »Soll ich einen Termin machen, wie ihr immer sagt? Aber ich warne dich, wenn der einmal in Fahrt ist, hört er nicht mehr auf.« Dann runzelte er die Stirn. Sein neugieriger Blick hatte einen länglichen geschlossenen Umschlag entdeckt, der unter einigen Papieren hervorragte. »Machst du deine Post nicht auf?«
Georg nahm erstaunt den Brief wahr, zog den zugeklebten Umschlag hervor, er trug handschriftlich seinen Namen und die Adresse des Weingutes Berthold & Hellberger. Weder hatte er den Brief vorher bemerkt, noch kannte er die Schrift. »Der war heute nicht in der Post.« Dann fiel ihm auf, dass er keine Briefmarke trug. Er nahm den Umschlag in die Hand, befühlte ihn mit beiden Händen und suchte vergebens nach einem Absender. Er blickte von Rose zu Kilian. »Es fühlt sich an wie … wie Geldscheine, da scheint Geld drin zu sein!«
»Mach ihn auf, dann wirst du es sehen.« Kilian dachte immer pragmatisch.
Georg zögerte. Bargeld in einem Umschlag? Er riss ihn auf, Scheine rutschten heraus, Fünfziger und Hunderter, er zählte sie. Es waren dreieinhalbtausend Euro, dazu ein handgeschriebener Zettel:
»Hier ein Vorschuss, fünfmal das Tageshonorar, damit Sie loslegen können. Ich zähle auf Sie. Danke, dass Sie den Auftrag annehmen.« Die Unterschrift darunter war unschwer als die Semmerings zu erkennen.
»Ist der verrückt?« Rose starrte das Geld an. »Und du hast nicht einmal Ja gesagt?«
»Der wusste mehr als ich.« Georg war verstimmt, dass ein Fremder seiner Entscheidung vorgriff, obwohl sie letztlich auf dasselbe hinauslaufen würde. Auch ärgerte er sich, dass ein Fremder ihn erkannt hatte. Was nahm Semmering sich heraus? Hatte er an seinen Fragen sein wachsendes Interesse erkannt? Er würde ihn zur Rede stellen und sich in Zukunft vorsichtiger äußern.
Bereits am Nachmittag des nächsten Tages rief er unter derselben Nummer an wie am Vortag. Georg benötigte eine Kontonummer, um die Dreieinhalbtausend zurückzuüberweisen. Wie zuvor meldete sich Semmerings Sekretärin: Er sei noch nicht im Hause, wichtiger Gespräche wegen habe er seine Geschäftsreise verlängern müssen. Aber morgen sei er sicher zurück. Als Georg es am folgenden Tag erneut versuchte, benutzte die Sekretärin fast dieselben Worte wie zuvor, doch ihr Ton hatte sich geändert, sie war deutlich zurückhaltender. Erst jetzt fragte sie nach dem Grund des Anrufs und erkundigte sich, wer er sei, wann ihr Chef bei ihm gewesen sei, was der Grund ihrer Besprechung sei und wie man Georg erreichen könne – um ihn gegebenenfalls über Semmerings Rückkehr zu informieren, schob sie schnell nach.
Ohne ihr die gewünschten Antworten zu geben, beendete Georg das Gespräch, da er sich plötzlich ausgefragt fühlte und, was stärker zählte, eine dahinterstehende Absicht vermutete. Es war eine merkwürdige Situation. Einerseits wollte er Semmering das Geld zurückgeben, da es ihm wie eine Art Bestechung erschien, andererseits reizte ihn der Auftrag umso mehr, da Semmering jetzt weder für ihn noch für seinen Arbeitgeber zu erreichen war.
Georg verließ sein Büro, überquerte nachdenklich den Hof und öffnete das Tor. Auf der Straße sah er sich misstrauisch um. Ein Gefühl wie damals, als er von Detektiven seines ehemaligen Arbeitgebers ausspioniert worden war, ergriff ihn. Aber nichts war anders, kein Auto, aus dem heraus er beobachtet wurde, weder stand jemand mit einem auf ihn gerichteten Feldstecher hinter halb blinden Scheiben noch lugte jemand hinter eine Ecke hervor. Lediglich ein Touristenpaar schlenderte mit seinen beiden Kindern an der Häuserzeile entlang. Niemand würde Frau und Kinder zu einer Observation mitnehmen. Langsam kehrte Georg ins Haus zurück, gerade rechtzeitig, um das Tor für den Lastwagen zu öffnen, der die drei Paletten Wein für den Caterer abholen wollte.
Wenn es darum ging, eine Arbeit mit dem Gabelstapler auszuführen, war Kilian meistens sofort zur Stelle. Hätte er nicht weiterreichende berufliche Pläne gehabt, wäre der Job als Gabelstaplerfahrer für ihn die Erfüllung gewesen. Er ging mit dem Fahrzeug geschickter um als Georg und hatte die Prüfung für den Gabelstaplerschein mit Bravour bestanden. Nachdem er die Paletten auf den Lkw gestellt hatte, ließ er den Fahrer die Übernahme quittieren und gab Georg die Frachtpapiere.
»Übrigens, wenn du Zeit hast, Studienrat Fink ist morgen frei, am Nachmittag ab vier Uhr …«
Kilian hatte das Treffen mit dem Englischlehrer arrangiert, der sofort bereit gewesen war, sich mit Georg zu treffen. Sie verabredeten sich in Bernkastel-Kues auf den Schlossbergterrassen.
Fink kam eine Viertelstunde zu spät, eigentlich selten für einen Lehrer, aber er habe noch seinen Arbeitskreis zum Erstarken des Rechtsextremismus zu Ende führen müssen, die Debatte sei heftig gewesen. Er habe sich zum Ziel gesetzt – begann er, noch bevor er etwas bestellt hatte und ohne einen Blick in die Runde oder über den Fluss zu werfen –, seine Schülerinnen und Schüler zu radikalen Demokraten zu erziehen. Auf den Typus seiner Mitbürger aus seiner DDR-Zeit, Befehlsempfänger, Opportunisten, Jasager und Mitläufer, könnten er und das Land in Zukunft sehr gut verzichten. Die jungen Leute, die ihm heute in der Schule gegenübersäßen, sollten früh lernen zu sagen, was sie dächten, ohne sich zu fürchten. Sie sollten sich nicht scheuen, jedermann zu kritisieren, auch die Lehrer nicht, sie sollten lernen, ihr Leben zu gestalten, sich nichts gefallen lassen, nichts unhinterfragt hinnehmen und im Austausch mit ihren Mitmenschen, mit Nachbarn und Kollegen ihre Lebensumstände selbst bestimmen.
»Mit diesen Forderungen, sollten sie ernst genommen werden, machen Sie sich wohl kaum Freunde, weder im Lehrerkollegium noch bei den Eltern der Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Sehe ich das falsch?«
Der große, schlaksige Mann mit dem grauen Bart, der Gesichtszüge und Regungen versteckte, machte eine Geste, als wäre es ihm gleichgültig. »Einige werfen mir vor, ein verkappter Kommunist zu sein, dabei wissen die gar nicht, was das ist. Die glauben auch bis heute, dass die DDR so was wie ein sozialistischer Staat war, dabei war es russisches Besatzungsgebiet, die SBZ, wie die revanchistischen Kreise der BRD es seinerzeit nannten, also CDU und CSU und die Vertriebenenverbände. Sie hatten zwar recht, es war besetztes Land und in keiner Weise frei. Aber sie nutzten dieses Kürzel SBZ, um sich über den östlichen Teil Deutschlands zu erheben, etwas wie der bessere Deutsche zu sein, nur weil hier im Westen die Amerikaner herrschten. Hätte die Rote Armee Bayern besetzt oder Hessen, wäre dort alles genauso abgelaufen wie in Sachsen oder Brandenburg. Da hätte es die gleichen Hundertfünfzigprozentigen gegeben, die Claqueure, Opportunisten und Denunzianten, die Stasi-Typen und IMs. Einige wären abgehauen und hätten dabei ihr Leben riskiert, andere hätten sich freikaufen lassen, wieder andere auf die Genehmigung zur Ausreise gewartet.«
»Das kam für Sie nicht infrage? Sie hätten einen derartigen Antrag stellen können.«