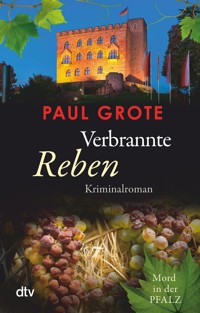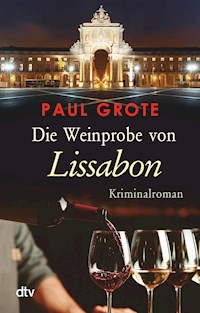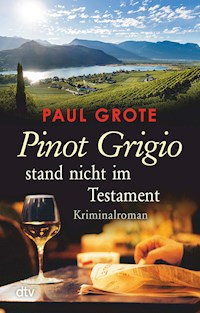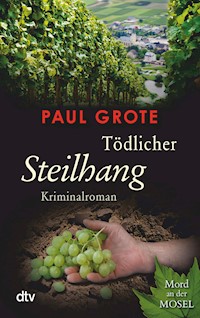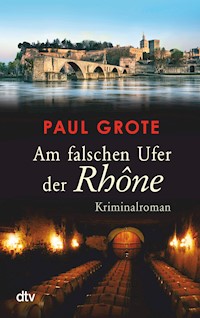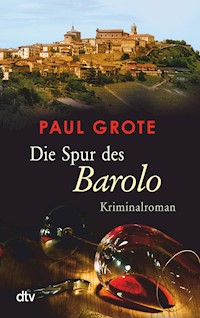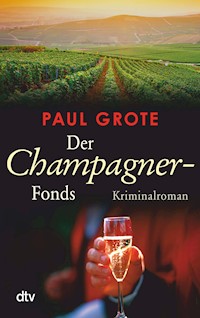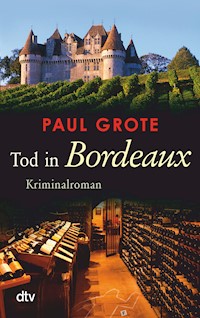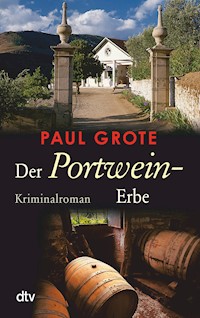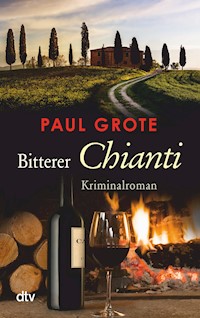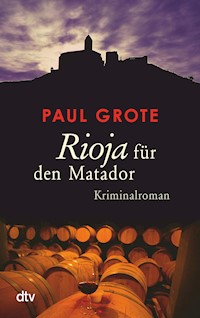9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mord am Kaiserstuhl Henry Meyenbeeker, in Spanien lebender deutscher Weinjournalist, liebt Kaiserstühler Burgunder. Da kommt die Einladung zur Baden-Baden Wine Challenge wie gerufen. Doch als der Starverkoster Alan Amber ermordet wird, ändert sich alles. Meyenbeeker wird erpresst: Findet er den Mörder nicht vor der Polizei, steht seine berufliche Existenz auf dem Spiel. Das Wettrennen beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Paul Grote
Sein letzter Burgunder
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2012
© 2012Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41373-2 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21391-2
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
»Hab Acht, wie du hineinkommst, wem du traust,
lass dich nicht täuschen durch des Eingangs Weite.«
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie
Inhalt
Am Morgen danach …
Hecklers Kettenhund
Barcelona bei Nacht
Dorotheas Dossier
Das Rollenspiel
Vulkanfelsen
Ein tiefer Schnitt
Gelbe Rosen
Spielerglück
Die Rufmordmaschine
Chaostheorie
Das Verhör
Der Zorn Gottes
Die Wandlung
Viererwette
Ein harter Aufprall
Schwarze Flecken
Bedenkzeit
Besuch bei Nacht
Rebeccas Auftritt
Klopfgeräusche
Die Wahrheit?
Danksagung
Am Morgen danach…
Es war spät geworden. Kaum einer der Juroren war an diesem Abend vor Mitternacht ins Bett gekommen. Henry Meyenbeeker hatte das Spielcasino erst kurz vor ein Uhr verlassen, an den Spieltischen war allerdings noch rege gesetzt worden. Besonders der Roulettetisch, wo Alan Amber weiter spielte, war umlagert gewesen, als er gegangen war, weniger von Spielern als von Neugierigen. Sie brannten darauf zu erfahren, ob der Brite hier sein Waterloo erleben oder das Verlorene zurückgewinnen würde, und das war nicht wenig. Einige mochten es dem Weinkritiker gewünscht haben, aber bei der Mehrheit der Schaulustigen meinte Henry, Häme oder sogar Schadenfreude bemerkt zu haben. Es hatte ihn nicht gewundert. Die Unsterblichen des Olymps sollten ruhig mal richtig bluten. Einige Tausend Euro würden Amber nicht schmerzen.
Von der Spannung der vergangenen Nacht war bei den Juroren, die in der Morgensonne jetzt dem Kongresszentrum zustrebten, nichts mehr zu bemerken. Knapp die Hälfte von ihnen waren Deutsche, sie gingen zusammen, der größere Teil war den Statuten nach Ausländer, auch die hielten sich an ihre Landsleute. Henry lebte im Ausland, war aber von Geburt Deutscher, seine Mutter Spanierin. Also– was war er dann? Deutscher Ausländer oder ausländischer Deutscher? Folgte ihm hier etwa der Schatten des Migranten? Den hatte er in Barcelona nie bemerkt.
Unter den Juroren wurde er als Deutscher geführt, obwohl er seit fast fünf Jahren nicht mehr im Land residierte, wo er immerhin die ersten fünfundvierzig Jahre seines Lebens verbracht hatte, von vielen Auslandsreisen abgesehen. Er selbst betrachtete sich als eine Mischung, deutsch-spanisch. Er fühlte sich in beiden Ländern gleichermaßen fremd und heimisch.
Henry spürte die Frische eines jungen Tags und die Wärme der leichten Junisonne auf der Haut und dachte mit Blick in den supergepflegten Park, wo er sich gern ins Gras gelegt hätte, an die Prozedur der Einweisung. Sie war glücklicherweise zu einer menschlichen Zeit angesetzt worden. Die Leitung der Baden-Baden Wine Challenge wusste, was sie den Weintestern zumuten konnte, im Wissen, dass die Nacht davor lang geworden war. Der Anruf des Hotelweckdienstes hatte Henry zumindest nicht mehr aus dem Tiefschlaf gerissen, und die Nacht war lang genug und dunkel genug gewesen, um den Eklat bei Ambers Rede zu vergessen, fürs Erste jedenfalls. Mit einem Nachspiel allerdings musste er rechnen. Er war gespannt, wer ihn ansprechen würde, denn er war verantwortlich, er hatte für das Debakel gesorgt. Das würde Verlagschef Heckler ihm nicht verzeihen. Henry konnte sich durchaus vorstellen, dass man ihn bitten würde, abzureisen. Aber zu ernst durfte er die Angelegenheit nicht nehmen. Gehörte ein schöner Eklat nicht auch zum Unterhaltungsprogramm?
Für ein Frühstück war genügend Zeit geblieben. Nur eine Tasse Kaffee hätte Henry nicht gereicht, wenn bis zum Mittagessen mehr als dreißig Weine probiert und bewertet werden mussten und danach noch mal knapp zwanzig. Der Kopf musste klar bleiben, wie die Sinne und die Urteilsfähigkeit.
Einzeln, paarweise und in Grüppchen schlenderten die Juroren aus Holland, der Schweiz und Österreich durch den frühsommerlich erblühten Kurgarten, auch belgische Weinexperten waren hier, Griechisch sprach man und Französisch, Weinkenner aus Japan, den USA und Australien gehörten zu den Gästen ebenso wie ein Chinese und ein Mann aus Chile. Sie alle verhielten den Schritt auf der Brücke und starrten hinab ins flache Wasser der Oos und wünschten wohl, sich jetzt auf eine der Bänke ans Ufer setzen zu können, sich zurückzulehnen und den Sommertag zu genießen. Aber alle hatten ein gemeinsames Ziel– das Kongresshaus: Hatte es am Abend zuvor den Eindruck vermittelt, von innen heraus zu glühen, so war es jetzt im Inneren der schlichten Konstruktion, deren Glaswände dem Beton- und Stahlbau aus den Sechzigerjahren die nötige Leichtigkeit verliehen, dunkel. Die großen Glastüren standen weit offen, und erst im weitläufigen Foyer fanden sich die Juroren gemeinsam vor den Tischen wieder, wo Namensschilder und Formulare für die Reisespesen ausgegeben wurden. Wer die Anwesenheitsliste unterschrieben hatte, hängte sich das Band mit dem Schild um den Hals, auf dem neben dem Namen auch Nationalität, Beruf und Jurygruppe vermerkt waren.
An manches Gesicht erinnerte sich Henry aus der Nacht im Casino. So wie er schielten auch andere Teilnehmer auf die Namensschilder derer, die plaudernd am Fuß der Treppe neben ihm warteten. Die Neugier, zu erfahren, wer zur selben Jurygruppe gehörte, war groß, immerhin würde man vier lange Tage eng beieinander sitzen, Ellenbogen an Ellenbogen, sozusagen auf Tuchfühlung, und würde gemeinsam an die zweihundert Weine probieren. Und jeder hoffte, dass nicht irgendein Großmaul, Besserwisser oder Klugscheißer am Tisch mit seiner Meinung die Stimmung verdarb.
Weiter vorn in der Schlange standen der Fotograf und seine schöne Frau, die Winzerin Antonia Vanzetti, die sich gerade das Band mit dem Namensschild über den Kopf streifte. Henry sah sie die Arme heben, die Armreifen rutschten auf ihren gebräunten Armen nach unten, und sie drückte ihr volles krauses Haar zusammen, denn das Band hatte sich verheddert. Ihr Mann, Frank Gatow, schaute belustigt zu und grinste, als er Henry erkannte. Der Fotograf gehörte nicht zu den Juroren, aber er wich nicht von der Seite seiner Frau, außer wenn er fotografierte– heimlich, nur von Henry bemerkt, wie letzte Nacht beim Roulette.
Kurz bevor Henry an der Reihe war sich einzutragen, bemerkte er in der übernächsten Reihe einen Spanier, der ihm die Laune verderben konnte: Patricio Mendoza, Autor und Publizist. Sie waren mehrmals aneinandergeraten, weniger in Sachen Wein als in Bezug auf Politik. Henry hielt ihn für bösartig, und er war schwarz bis auf die Knochen, seiner Einstellung nach gehörte er entweder dem rechten Movimiento Social Republicano an oder der Falange Auténtica, beides Organisationen der extremen Rechten. Mendoza hatte ihn noch nicht entdeckt oder wollte ihn nicht sehen. Henry musste jede Konfrontation vermeiden. Sollte Mendoza ihm wieder mit ausländerfeindlichen und antisemitischen Parolen auf den Wecker gehen, würde er ihm zu gern…
Marion Dörners Lächeln unterbrach den finsteren Wunsch. Ihr war anscheinend die Aufgabe zuteilgeworden, die Hostessen bei der Ausgabe der Namensschilder zu kontrollieren. Im letzten Monat in Andalusien, wo sie sich kennengelernt hatten, hatte sie mit dem Pagenkopf mehr dem Typ des jungen Mädchens entsprochen. Heute gab ihr das hochgesteckte Haar einen Hauch von Noblesse, was ihr auch gut stand. Der Eindruck wurde von ihrem offiziellen Auftreten im dunkelblauen Kostüm unterstrichen. Hatte sie bisher mit verschränkten Armen zwei Schritte hinter den Tischen gestanden, so griff sie jetzt selbst nach den Schildern, um Henry das seine umzuhängen– und um ihm möglichst nahe zu kommen? Das wäre ihm nicht recht gewesen und verbot sich hier von selbst. Er nahm das Schild mit der ausgestreckten Hand entgegen, aber um ein Bussi kam er nicht herum. Aus den Augenwinkeln bemerkte Henry, dass es Frank Gatow, der belustigt die Augenbrauen hob, nicht entgangen war. Das hatte er schon gestern in der Spielbank getan, als Marion ständig in seiner Nähe geblieben war.
»Wir sehen uns beim Mittagessen?!«
Ob Marion das als Frage oder bestätigend gemeint hatte, war ihrem Tonfall nicht zu entnehmen.
»Ich werde mich meiner Jurygruppe anpassen müssen, wahrscheinlich machen wir nach dem dritten Flight Pause. Dann hätten wir nur noch einen Flight von zehn oder fünfzehn Flaschen vor uns und können es ruhig angehen. Heute Abend sehen wir uns bestimmt.« Es wäre undiplomatisch, ihr Ansinnen gänzlich auszuschlagen, obwohl Henry sich bedrängt fühlte.
»Ich hoffe es«, gurrte Marion und zog sich mit einem charmanten Lächeln auf ihre Position zurück, denn Oliver Koch war aufgetaucht, finster wie immer und so wichtig wie am Abend zuvor.
»Sie haben unseren Gast ziemlich alt aussehen lassen, zu alt!«
»Das war nicht ich, das war die Roulettekugel«, erwiderte Henry. Bevor Koch auf das andere Thema kommen konnte, wandte er sich der Treppe zu, wo Frank Gatow auf ihn wartete.
»Du lässt deiner Frau den Vortritt?«, fragte Henry und legte ihm freundschaftlich die Hand auf den Rücken.
Gatow war der Typ Fotograf, mit dem er als Journalist sich vorstellen konnte, auf eine lange Reportagereise zu gehen. Auf der kollegialen Ebene hatten sie sich sofort verstanden.
»Man hat mir ausnahmsweise gestattet, als Ehemann einer geladenen Jurorin unentgeltlich an den Events teilzunehmen. Doch seit gestern darf ich nirgends mehr mit der Kamera rein«, antwortete Gatow mit gespieltem Bedauern. »Der da«, er neigte den Kopf in Richtung Koch, »hat es verboten.«
»Der kann nicht anders, er spielt sich auf, das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Er ist der Einpeitscher des Verlags oder der Kettenhund vom Chef. Nehmen Sie ihn nicht ernst. Aber ich muss jetzt da rauf, in den Saal. Sehen wir uns später im Hotel?«
»Es gibt viele wunderschöne Ecken hier in Baden-Baden, ich werde mich ein wenig dort umsehen, wo die Russenmafia investiert hat. Angeblich hat sie einige kleine und große Hotels gekauft, auch der ›Europäische Hof‹ ist in östlicher Hand, die beste Art, Geld zu waschen, dann gehören ihr bereits an die achtzig Villen…«
»Ihr Italiener kennt euch mit der Mafia aus?«
»Auch mit der Cosa Nostra, der Sacra Corona Unita, ’Ndrangheta, Camorra… Ach, Unsinn, ich verstehe nichts davon, es wird viel gemunkelt– aber wir treffen uns bestimmt.«
»Auch beim ›Fidelio‹ im Festspielhaus?«
»Nein, dafür sind die Karten abgezählt.«
»Ich gebe dir meine, angeblich lieben Italiener die Oper. Ich hasse sie. Das Gesinge macht mich krank, ich kriege Eurodermitis davon.«
Frank Gatow prustete los. »Du meinst Neurodermitis!«
»Wieso? Was habe ich gesagt?«
»Eurodermitis…«
Henry schloss sich dem Lachen an. »Passt auch, daran leiden nicht nur unsere griechischen Kollegen. Zwei oder drei von denen sind heute dabei, damit sie sich mal wieder richtig satt essen können, aber jetzt muss ich wirklich los. Eine Frage noch.« Er beugte sich Gatow zu. »Den Angriff auf Amber hast du fotografiert– und was ist mit den Fotos aus dem Casino mit dem Burgunder?«
Gatow zwinkerte ihm zu. »So was macht mir am meisten Spaß.« Er wandte sich zum Gehen.
»Paparazzo!«, warf Henry ihm nach, und Gatow drehte sich winkend um. »Sehr richtig. Aber sag es nicht noch einmal. Das hat schon mal jemand gesagt, und der ist jetzt im Knast.«
Wie schnell man durch ein unbedachtes Wort den wunden Punkt eines Menschen treffen konnte, dachte Henry, als er den halbdunklen Saal betrat, unschlüssig wie viele andere, wo er sich hinsetzen sollte. Wer einen Platz und einen gesprächigen Nachbarn gefunden hatte, probierte natürlich sofort das Mikrofon zwischen den Sitzen aus, aber Koch, um die Verspieltheit seiner Branchenkollegen wissend, hatte die Mikrofone ausgeschaltet. Hecklers Kettenhund bezog mit finsterem Blick am Fuß der halbhohen Bühne seinen Posten, wichtige Papiere unter den Arm geklemmt, und tat, was er allem Anschein nach am liebsten machte, er gab Anweisungen.
Henry ließ sich weit hinten in einen der blauen Sessel fallen, stellte sich dem neben ihm sitzenden Portugiesen kurz vor, und man sprach über die Unannehmlichkeit der weiten Anreise.
Koch durfte den Moderator spielen. Er begann mit der Laudatio auf die Baden-Baden Wine Challenge und insbesondere auf seinen Chef, Verlagsdirektor Dirk Heckler, der unter höflichem Beifall die Bühne betrat und das Wort ergriff. Er freue sich über die große internationale Bedeutung des von ihm ins Leben gerufenen Wettbewerbs, über die Beteiligung der weltweit besten Weinerzeuger, die ihre Weine zu dieser wichtigsten Prüfung in Deutschland angestellt hatten. Das Medienecho der unter Ägide der OIV stehenden Veranstaltung sei gewaltig, und man sei stolz, dass die Internationale Organisation für Rebe und Wein, die achtundvierzig Länder repräsentiere, wieder die Schirmherrschaft übernommen habe. Besonders glücklich sei er natürlich über die Anwesenheit von Alan Amber, dieser herausragenden Persönlichkeit der internationalen Weinwelt, und er bedauere, dass er aufgrund wichtiger Verpflichtungen nicht an der gesamten Challenge teilnehmen könne. Den Skandal des gestrigen Abends überging Heckler. Henry war sich nicht sicher, ob Heckler ihn als Rädelsführer der Aktion vom Vorabend begriff. Koch tat es sicherlich. Stattdessen freute sich der Verlagschef, gute Laune versprühend, dass die hier versammelten Experten aus fünf Kontinenten mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz und ihrer Hingabe an den Beruf die Veranstaltung zu einem großartigen Erfolg werden lassen würden.
Das Lob der Menge kam immer gut an, der Beifall war entsprechend. »I love you all« hätte nur noch gefehlt. Dann sagte er einige Sätze zu den »wichtigen und in der Branche hoch geschätzten Publikationen« des Verlags und zu ihrer Bedeutung für die Weinbranche, diskret das Zusammenspiel von Redaktion, Anzeigen und Preisverleihung noch einmal hervorhebend, nicht ohne gleichzeitig doppelzüngig an die Unvoreingenommenheit und Verantwortung der Juroren zu appellieren.
Koch trat aus dem Hintergrund, er kommentierte die in Gold, Silber und Bronze gehaltene Präsentation, in Anlehnung an die in den nächsten Tagen zu verteilenden Medaillen. Die Organisatoren und das Präsidium wurden vorgestellt, Koch selbst würde als Koordinator der zwanzig Teamleiter fungieren, die am Tisch mit jeweils sechs Juroren den ordnungsgemäßen Ablauf der Proben garantierten und für die Dokumentation der Bewertungen sorgten.
Er wird es so eingerichtet haben, dass wir möglichst wenig zusammentreffen, dachte Henry. Nach den schlechten Erfahrungen auf unserer Weinreise durch Andalusien wird er mich kaum in seiner Nähe ertragen– und nach dem gestrigen Abend wird er jede Gelegenheit nutzen, um mich bloßzustellen. Aber er weiß auch, dass er trotz seiner Selbstüberschätzung keine Chance hat, und doch kann er mir schaden.
Einhundertvierzig Juroren kamen hier zusammen. Jemandem die Kompetenz abzusprechen wäre Unsinn gewesen, jemandem den Willen zur Manipulation zu unterstellen ebenfalls, höchstens den Veranstaltern, nur sie hatten in alles Einblick und die Möglichkeit dazu. Wo die Schwachstellen waren, würde Henry sicher entdecken. Wer die OIV-Schirmherrschaft beanspruchte, musste sich den Regeln dieses zwischenstaatlichen Verbandes unterordnen. Einer ihrer Vertreter würde als Beobachter den gesamten Wettbewerb begleiten.
Als Heckler darauf hinwies, dass es auf die fachliche Einschätzung eines Weins und nicht auf persönliche Vorlieben ankam, »wir sind ja vorurteilslos und unbestechlich und legen objektive Kriterien an«, konnte Henry sich das Schmunzeln nicht verbeißen. Was war objektiv? Nur industriell hergestellte Produkte ließen sich objektiv bewerten, für sie konnte ein Hundert-Punkte-Schema gelten. Beim handwerklich oder künstlerisch gemachten Wein kam es immer auch auf die Empfindung an. Auf der Weinreise durch Andalusien hatte Henry erlebt, wie Koch probierte, und seine Vorliebe für konventionell gemachte Weine bemerkt. Nun gut, es war nicht sein Problem, er würde sich an die Vorgaben halten.
Es folgte eine Übersicht der Weine, die sie bewerten würden. Unter »Stillwein« gab es die trockenen und halbtrockenen Roten und Weißen, desgleichen beim Rosé. Liebliche Weine entsprachen nicht seinen Vorlieben, aber er würde sich bemühen… doch bei Süßweinen zog er gern mit. Nur wenn sie schlecht gemacht waren, wenn kein Körper die Süße stützte und wenig Säure den Wein pappig machte, schmeckten sie widerlich. Genau um das zu bewerten, war er hier. Schaumwein war wie alles, das prickelte, in der Beurteilung am schwierigsten. Man benötigte Übung, um an der Kohlensäure vorbeizuriechen.
Nachdem die Nummerierung der Flaschen erläutert worden war, wurde der Bewertungsbogen vorgestellt, den man zu jedem Wein vorgelegt bekam. Der organisatorische Ablauf wurde besprochen, wie die Bewertungsbögen zu handhaben waren, dass sie unterschrieben und an den Chef des Tisches weitergereicht werden mussten, der sie auf Vollständigkeit zu überprüfen hatte und sie abzeichnen musste. Es war ein höllischer Aufwand. Henry überschlug kurz, dass bei zwanzig Teams und maximal fünfzig Weinen pro Tag in vier Tagen insgesamt etwa viertausend Weine zur Beurteilung anstanden. Wenn er diese Zahl dann noch mit der Startgebühr von hundertvierzig Euro je Flasche multiplizierte, kamen fünfhundertsechzigtausend Euro zusammen– war das ein gutes oder schlechtes Geschäft für den Veranstalter? Seine alte Freundin Dorothea, die beim konkurrierenden Wettbewerb in Hamburg mitmachte, hatte berichtet, dass die Preise dort niedriger waren und Winzern Rabatte eingeräumt wurden, damit auch die weniger starken sich das Vergnügen leisten konnten, eine Medaille auf ihre Flaschen zu kleben.
Nach der Vorstellung des Programms für die nächsten Tage ging das Licht an, und wie nach einer Kinovorstellung schoben sich die Önologen, Sommeliers, Großhändler, Einkäufer, Marketingdirektoren und Weinjournalisten durch den Ausgang. Man ging zum Hotel zurück, wo die viertausend Weine der Verkostung harrten. Den wichtigsten Prüfern schüttelte der Verlagschef die Hand, weniger wichtige wurden von Koch begrüßt.
Unter den Anwesenden war außer Mendoza niemand, den Henry zu kennen glaubte. Er sah sich nach Alan Amber um, er reckte den Hals, er musste mit ihm reden, das Interview mit ihm war für den späten Nachmittag angesetzt, seine persönliche Sekretärin hatte es arrangiert, aber der Star unter den Prüfern ließ sich nicht blicken. War ihm der Spätburgunder im Casino nicht bekommen? Der Mann musste Derartiges gewohnt sein, und wenn der Wein schlecht gewesen wäre, hätte er es sicherlich auf einen Meter Entfernung von der Flasche sofort gemerkt– das zumindest wurde von ihm behauptet.
Für Henry war es überraschend, in dieser großen Gruppe von Kollegen außer Mendoza kein einziges bekanntes Gesicht zu finden. Doch, da war der kantige Kopf mit grimmigem Gesicht auf dem massigen Körper, und der gehörte zu Aguirre, dem Zorn Gottes, wie Henry Jacobo Arienzo, den spanischen Önologen, nannte. So grimmig, wie er aussah, war er auch, aber er war ehrlich. Außer ihm gab es sicher noch weitere Spanier, mit Sicherheit sympathischere Typen als den Widerling Mendoza, der sich großspurig »Publizist« nannte. Henry hatte bei seinen Besuchen spanischer Weingüter mehr mit Winzern, Kellermeistern und Weinbauern zu tun und nicht wie hier mit Vertriebsleitern und Geschäftsführern, mit Marketingdirektoren und Weinberatern. Von denen bekam man sowieso meistens ähnliche Vorträge zu hören.
Ja, da war noch Antonia Vanzetti, sie stieg vor ihm angeregt plaudernd inmitten eines Trupps bestens gelaunter Italiener die Treppe hinab. Zwei ihrer Begleiter meinte er gestern bereits im Gartenrestaurant des »Il Calice« gesehen zu haben, die Valianos, ein Winzerehepaar aus Süditalien. Leider sprach er zu schlecht Italienisch, um sich ihnen anzuschließen.
Henrys Französisch hingegen reichte, um mit dem Herrn, der neben ihm auf der Brücke über die Oos stehen geblieben war, über den Concours Mondial de Bruxelles zu plaudern, an dem Pierre Faudot teilgenommen hatte, wie Henry dem Namensschild entnahm, das an dessen Hals baumelte. Brügge, Belgien, Weinkontrolleur, Jurygruppe neun. Also gehörte auch er nicht zu Henrys Team der Gruppe dreizehn. Monsieur Faudot war genauso gespannt wie er, wie er durchblicken ließ, mit wem er die nächsten Tage zusammensitzen würde, und betrachtete das spärlich fließende Rinnsal.
»Wenn einer da ertrinken will, muss er schon volltrunken sein und mit dem Gesicht nach unten liegen«, meinte der Belgier.
Diese Art von Humor konnte Henry teilen, und er stimmte in das Lachen ein, fragte sich allerdings, wer darin ertrinken solle, als Koch alle Nachzügler mit ausgebreiteten Armen vor sich her zum Hotel trieb.
Beinahe als Letzter betrat Henry die Lobby und spürte sofort, dass sich etwas verändert hatte. Die Stimmung hatte sich gewandelt. Die Leichtigkeit und Fröhlichkeit des Neubeginns waren verflogen. In der Lobby herrschte eine gespannte Stille, die Menschen an der Rezeption flüsterten. Sie sahen nicht wie Hotelgäste aus. Ein besonders großer Mann fiel ihm auf, und niemand trug das Namensschild mit dem Zeichen der BBWC.War eine neue Reisegruppe eingetroffen? Ohne Gepäck? Reisende benahmen sich anders, waren aufgeregter, ausgelassen. Niemand füllte ein Formular aus. Der Ernst und die Haltung des Personals verunsicherten Henry, da war nicht ein Lächeln im Gesicht, nicht einmal das auf der Hotelfachschule eingeübte.
Irritiert folgte Henry dem belgischen Kollegen hinauf in den Verkostungssaal und ließ seinen Blick über die weiß gedeckten Tische streifen, wo sie die nächsten vier Tage zubringen würden. Hier war die Stimmung gänzlich anders.
An seinem Tisch, dem mit der Nummer dreizehn, waren bis auf seinen alle Stühle besetzt, und erst jetzt wurde er wirklich gewahr, welche Zahl man ihm verpasst hatte. Ihn an die Dreizehn zu setzen konnte nur Kochs Werk gewesen sein. Die Dreizehn ist keine gute Zahl, sagte er sich und sah die schwarze Katze vor sich, die in jener Nacht in Laguardia die Straße vor ihm überquert hatte, bevor der Önologe Jaime Toledo ermordet worden war. Nein, das hat damit nichts zu tun, sagte er sich, schüttelte im Geiste die Erinnerung ab und ging auf fünf neugierige Gesichter zu, von denen bis auf eines alle lächelten, als er die Hand auf die Lehne des freien Stuhls legte. Die Dreizehn bezieht sich nicht auf mich, sagte sich Henry, hier ist keiner böse– doch, einer schaut hinterhältig.
Statt sich zu setzen, trat Henry zu der farblosen, ungeschminkten Dame mit dem Fransenschnitt und dem grauen Kleid, das zu den grauen Augen passte, und gab ihr die Hand. Er kannte sie– vom Foto her. Das Eleganteste an ihr war die echte Perlenkette. Isabella hatte eine von ihrer Mutter geerbt und ihm gezeigt, woran man die Echtheit erkannte.
Isabella– Henry durchzuckte der Gedanke an die Drohbriefe, die sie erhalten hatte, inzwischen waren es drei…
»Mrs.Josephine Rider, aus London, wie ich vermute?« Er gab ihr erfreut die Hand. »Von Ihnen habe ich viel gehört, nur Gutes– und gelesen. Sie schreiben für das britische ›Decanter Magazine‹? Ich halte es für das beste Weinmagazin überhaupt, und zwei Ihrer Bücher stehen in meinem Büro.«
Das dankbare Lächeln Mrs.Riders strafte ihre Erscheinung Lügen. Keiner ist, was er scheint, dachte Henry, wandte sich der anderen, elegant, aber konservativ gekleideten Dame zu und deutete eine Verbeugung an.
Es war die Schweizerin Beatrix Stöckli aus Winterthur. »Ich verkaufe unseren lieben Mitmenschen das, was sie glücklich macht.«
Henry lächelte und war gespannt, wo sich ihre Bewertungen decken würden.
Der Nächste, dem er die Hand schüttelte und der fest zugriff, war der Winzer François Dillon von der Loire. Er kam aus Sancerre. »Sauvignon Blanc ist meine Spezialität«, sagte er, und Henry fragte sich, ob die Weine eines groben Winzers fein ausfallen konnten. Gleichzeitig merkte er, dass er der Begrüßung des blonden Mannes am Tisch auswich, der ihn über seine randlose Lesebrille hinweg aus blauen Augen beobachtete. Er trug, anders als der hemdsärmelige Winzer, einen Anzug mit karierter Fliege und hatte sein Haar zu einem Zopf gebunden. Nichts passte. Henry war gespannt auf die Stimme.
Mehr als ein sonores und dabei distanziertes »Good Morning« kam nicht, nicht einmal der Name. Henry musste sich hinunterbeugen, um den Namen auf dem Schild zu lesen, das Bram van Buyten neben der Mappe mit den Verkostungsbögen abgelegt hatte. Er war Wein-Großhändler aus Rotterdam. Die Abneigung war spontan und gegenseitig.
Der Italiener Paolo Castellani war von anderem Kaliber. Der Önologe aus Meran in Südtirol, dunkler Anzug, weißes, offenes Hemd, stand auf und hätte Henry fast umarmt.
»Sie sind auf dem Weg zur Weinmesse in Verona oder an die Adria sicher bei uns vorbeigekommen, durch unser wunderschönes Tal gerast, ganz bestimmt zu schnell, auf dieser schrecklichen Brenner-Autobahn.«
»Das stimmt, man fühlt sich zwischen den Leitplanken wie eingesperrt, zum Weiterfahren gezwungen, einen Zwanzigtonner im Nacken, dabei möchte man bleiben…«
»Autobahnen sind eine deutsche Erfindung.«
Mrs.Rider unterbrach sie auf Deutsch, der für Engländer typische Akzent gefiel Henry, ihm lag ihre bescheiden snobistische Art. Er wunderte sich sowieso, dass er der einzige Deutsche war und alle anderen die Sprache ebenfalls beherrschten.
»Meine Herren, wir werden in den nächsten Tagen sicher ausführlich Gelegenheit haben, uns auszutauschen, aber jetzt sollen wir arbeiten. Vor Ihnen liegt Ihr persönlicher Aktenordner mit den Bewertungsbögen. Es gibt einen für jeden Juror und jeden Wein. Die Flights, also die zuvor…« Sie suchte nach dem richtigen Wort.
Henry half ihr aus: »…in Gruppen nach gemeinsamen oder ähnlichen Merkmalen zusammengestellten Weine…«
Sie nickte ihm vornehm zu. »…sind von einem grauen Zwischenblatt getrennt. Alle Bögen sind nummeriert. Es lässt sich also genau zurück… well … nachprüfen, wer welchen Wein wie und mit welcher Punktzahl bewertet hat. Oh… well … ich muss erklären… dass ich nur ersatzweise eure Teamleiterin, Vorsitzerin des Tisches bin, weil…«
Sie war endgültig aus dem Konzept und ins Stammeln gekommen, denn sie hatte sich von Koch und seiner Hampelei ablenken lassen. Er war mit erhobenen Händen in den Saal getreten, als stünde jemand mit einem Revolver hinter ihm, und ging zur Fensterfront, das Licht im Rücken. Er bat um Ruhe. Das Gemurmel verstummte nur widerwillig, und erst in der absoluten Stille ließ er sich oberlehrerhaft herab, das Prozedere zu erklären, wobei ihn Verlagschef Heckler von der Tür aus beobachtete.
Alle gemeinsam würden jetzt den Referenzwein probieren, die Ergebnisse der Beurteilung in den Musterbogen eintragen, und der Vorsitzende des Tisches würde das Ergebnis vor dem Auditorium präsentieren. So könne man die Bewertungen harmonisieren und das eigene Urteil hinterfragen.
An der fensterlosen Längsseite des Saals standen die Tische mit Batterien verhüllter Flaschen. Die Eleven der hiesigen europäischen Hotelfachschule, ganz in Schwarz mit langer weißer Schürze als Kontrast, warteten mit auf dem Rücken verschränkten Händen auf das Signal zum Einschenken. Jeder Tisch hatte seinen eigenen Mundschenk. Die jungen Leute würden flitzen müssen, denn nach jeder Probe verlangte jeder Juror ein sauberes Glas. Natalie, die junge Frau, die am Tisch dreizehn bediente, hatte es leichter, denn ein Juror fehlte, der Inhaber der Weinwerbeagentur Önostyle aus Wien, der den Vorsitz hätte führen sollen, war nicht erschienen. Das waren etwa zweihundert Gläser weniger für Natalie.
Der rote Referenzwein war gut, interessant in den Aromen und sauber gemacht, Henry hatte keine Schwierigkeiten, eine entsprechende Punktzahl zu geben. Für ihn war es eine französische Assemblage aus den Rebsorten Mourvedre, Carignan und Syrah, etwa zwei Jahre alt. Aber er hielt sich mit dieser Äußerung zurück.
Gastgeber Heckler freute sich nach dem gestrigen Fiasko über den gelungenen Auftakt. Sein Kettenhund strich an den Tischen vorbei und schaute, ob auch alles zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurde, dann bat er laut um die ersten Resultate. Die Punktzahl bewegte sich in der oberen Hälfte der achtziger, also wäre es eine Goldmedaille geworden, nur ein Tisch machte wegen der extrem niedrigen Punktzahl von sich reden.
Ein unwilliges Gemurmel erhob sich, da stürzte ein grauhaariger, elegant gekleideter Herr mit lachsfarbener Krawatte in den Saal, dem ansonsten sicher eine vornehmere Gangart zu eigen war. Hektisch sah er sich um, seine Augen flogen über die Tische, er entdeckte Heckler, hob den Arm und drängte rücksichtslos durch die Tischreihen, sodass der Unmut jetzt ihm galt statt dem Urteil. Es war ihm gleichgültig. Atemlos beugte er sich zu Heckler, packte ihn bei den Schultern und raunte ihm etwas zu.
Heckler hatte mit offenem Mund zu ihm aufgeschaut, er wirkte entsetzt, seine angewinkelten Arme fielen herunter wie die eines vom Zug der Strippe erlösten Hampelmannes. Er schüttelte den Kopf und hob beide Hände, flehend oder um etwas Unangenehmes fernzuhalten. Dann strich sein entsetzter Blick über die Köpfe der Juroren, von denen einer nach dem anderen von der Stimmung erfasst wurde. Das Gemurmel erstarb.
Koch huschte eilig zwischen den Tischen hindurch– Heckler legte ihm eine Hand auf die Schulter, als müsse er sich festhalten. Jetzt wiederholte der Bote einer anscheinend schrecklichen Nachricht das Gesagte, und Koch schaute nach anfänglicher Verblüffung noch finsterer als in seinen dunkelsten Momenten, wie Henry empfand. Dann verließ das Trio mit fliegenden Jacketts den Saal, aber die Unruhe blieb, wie die Bedrohung, die jeder spürte.
Fragende Blicke wurden am Tisch ausgetauscht, gepaart mit hilflosem Achselzucken. »Wissen Sie, worum es geht?« »Nein, woher auch?« »Irgendwas muss passiert sein…« Aber da es keine Antworten gab, erhielten die Hotelfachschüler das Zeichen, mit den Flaschen auszuschwärmen und die Gläser zu füllen, und nur mühsam fanden alle zu einer brüchigen Konzentration zurück.
Der erste Flight für Tisch dreizehn bestand aus dreizehn jungen trockenen Weißweinen.
Schon wieder diese Zahl, fluchte Henry im Stillen und ärgerte sich über seine Unfähigkeit, seinen Aberglauben zu überwinden. Mühsam richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Wein. Farbe, Klarheit, Duft und Geschmack standen zur Beurteilung, die Harmonie, das Verhältnis von Süße und Säure. Ihre Einbettung in die gesamte Komposition war ein spezieller Punkt. Henry, der zwischen der Engländerin und dem Italiener saß, merkte, dass der Holländer auf die Bögen seiner Nachbarn schielte und seine Punktzahlen korrigierte, bis er bemerkte, dass Henry ihn beobachtete.
Sogar beim fünften Wein war kaum jemand richtig bei der Sache. Die Reaktion der Veranstalter war zu heftig gewesen, um vergessen zu werden, und als sie beim siebten Wein angekommen waren– mit Besprechung dauerte das Verkosten einer Probe zwischen fünf und sieben Minuten–, betrat Heckler erneut den Saal, ernst und gefasst und in Begleitung des Grauhaarigen und eines elend langen Mannes, den Henry an der Rezeption bereits bemerkt hatte. Sofort wurden alle Gläser abgesetzt.
Die Lautsprecheranlage knackte, der Grauhaarige mit lachsfarbener Krawatte griff nach dem Mikrofon, das Koch ihm hinhielt.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bitte dringend um Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horowitz, ich bin…«
… ein Namensvetter des Pianisten Vladimir Horowitz, dachte Henry, auch einer, den deutscher Größenwahn nach dreiunddreißig aus dem Land getrieben hatte.
»Ist das nicht ein jüdischer Name?«, fragte Bram van Buyten leise und giftig.
»…ich bin der Geschäftsführer dieses Hotels.« Horowitz’ Räuspern war seiner Aufgeregtheit geschuldet und machte die Spannung bedrohlicher. »Statt Sie herzlich zu begrüßen, wie Sie es verdient hätten, habe ich eine schreckliche Pflicht. Ich muss Ihnen eine… entsetzliche Nachricht… äh… überbringen. Der von uns allen… hochgeschätzte Mister Alan Amber, ein Wein… experte von… äh… internationalem Ruf und… äh… Ansehen, ein großer Mann, eine Persönlichkeit von Weltruf, wurde heute Morgen tot in seiner Suite….«
Da brach der Tumult los.
Tisch dreizehn, dachte Henry, verflucht, und dann noch dreizehn Flaschen, so ein Dreck. Es musste so kommen, sie werden ihn umgebracht haben, an Herzschlag ist er sicher nicht gestorben. Und er wunderte sich, dass sein Entsetzen sich in Grenzen hielt. Statt schockiert zu sein, erinnerte Henry sich an den Moment, als Frank Gatow heimlich das Foto von Amber am Spieltisch gemacht hatte. Er hatte ihn vor Augen, als man ihm die Jetons zum Weiterspielen zusteckte, er sah nur die Hände dessen, der sie ihm zugeschoben hatte, er sah Hände, dann ein Tablett, darauf die Flasche Spätburgunder mit dem Glas– es wird sein letzter gewesen sein, dachte Henry und hörte wieder das helle Klicken der Jetons auf dem grünen Filz…
1
Hecklers Kettenhund
»Nimm das nicht auf die leichte Schulter!«
»Ach was. Man darf derartigen Unsinn nicht überbewerten. Da spielt sich jemand auf.«
»Schon möglich, aber in diesem Fall glaube ich das nicht. Für mich hört sich das nach einer sehr konkreten Drohung an. Da meint es jemand ernst. Der Name des Absenders sagt dir nichts?«
»Welcher?«
»Na, der Absender dieser E-Mail. Wieso fragst du?«
Als Isabella zögerte, kam Henry ein Verdacht. Er blickte sich um, die Sonne war längst untergegangen, und er war der einzige Gast auf der Terrasse des »Parador« von Granada. Trotzdem drückte er sein Mobiltelefon fester ans Ohr und sprach leiser: »Gibt es mehr als diese eine Mail?«
Isabella schwieg einen Moment zu lang, um seinen Verdacht zu zerstreuen. Ihre Antwort kam ein wenig kleinlaut.
»Ja… die gibt es.«
»Wie viele?«
»Es ist wirklich erst die zweite, Henry. Ich weiß, ich hätte dir besser nichts davon erzählt. Mach bitte keine große Story daraus. Dahinter ist nichts, wirklich!«
Henry war zu besorgt, um sich zu ärgern, dass Isabella ihm die erste Drohung verschwiegen hatte. »Wie lange ist das her? Wann kam die erste?« Er spürte, dass er die Frage zu hart und auch zu barsch gestellt hatte, sofort tat es ihm leid. Ob Isabella die Sache wirklich so leicht nahm?
»Eine Woche erst…«
»Und– diese erste Nachricht– hatte denselben Inhalt?«
»So in etwa.«
»Was heißt das, so in etwa?«
»Bueno, es ging auch darum, dass ich aufhören soll, mich in diese Sachen einzumischen.«
»Und das tust du einfach so ab? Diese Leute sind gefährlich, Isabella. Wer war als Absender angegeben?«
»Beim ersten oder zweiten Mal?«
»Bitte, por favor, stell dich nicht an, du bist doch sonst nicht schwer von Begriff. Nimmst du das wirklich nicht ernst, oder überspielst du deine…« Henry hatte »Angst« sagen wollen, aber er wusste nicht, ob Isabella wirklich Angst hatte, und wenn dem so war, würde sie sich weiter sperren. Er jedenfalls nahm die Drohung ernst. Wenn es um die Exhumierung der Leichen des Franco-Regimes ging, kannten beide Seiten kein Pardon, weder Isabella noch ihre Gegner. Er empfand es als grotesk, dass sich sogar noch siebzig oder mehr Jahre nach den grauenhaften Ereignissen zwischen den Gräbern die alten Gräben des spanischen Bürgerkriegs auftaten, die alten Feindschaften aufflammten und die Angehörigen der Opfer mehr Angst hatten, offen darüber zu reden, als die Nachkommen der Täter von einst.
»Wie heißt denn nun der verdammte Absender?«
»Es war ein Komitee, ich habe den Namen bereits im Internet überprüft…«
»Im Internet steht auch nicht alles«, unterbrach er sie.
»…ich finde nichts dazu. Niemand kennt die ADP– Associación para la Dignidad de la Patria– den Verband für die Würde des Vaterlandes. Es ist unglaublich, mit welcher Frechheit die auftreten. Wir sprechen über Europa, und die reden übers Vaterland. Aber das sind die letzten Zuckungen des Faschismus.«
»Solche Zuckungen können sehr schmerzhaft sein, Isabella, Sterbende schlagen um sich…«
»Wer sagt, dass sie sterben? Schau nach Ungarn, nach Italien und Le Pen in Frankreich, die Morde in Deutschland…«
Henry stand nicht der Sinn nach einer politischen Debatte. »Und die E-Mail von heute?«, fragte er. »Von wem stammt die?«
»Xavier Blaspiñar ist der Name, die gesamte E-Mail-Adresse lautet [email protected]. Blas Piñar– so hieß General Francos Nachfolger bei den Falangisten.«
»Wie ich vermute, gibt es auch hier keine Rückschlüsse?«
»Richtig, Henry, ich habe es selbstverständlich gleich ausprobiert. Wie man den Weg dieser E-Mail zurückverfolgen kann, zum Absender oder zum Server, das weiß ich nicht.«
»Über die sogenannte IP-Adresse.«
»Da könnten wir einen Spezialisten mit beauftragen, unser IT-Berater…«
»Wenn du dich so weit reinhängst, nimmst du die Drohung also ernst!«
Isabellas Schweigen bestätigte Henrys Vermutung. Es gab nichts dagegen einzuwenden, dass sie als Historikerin neben der Arbeit in der Kellerei ihrer Familie, Bodegas Peñasco, die Toten des Bürgerkriegs ausgrub und mit dem Verband der Angehörigen die Opfer zu identifizieren versuchte. Im Gegenteil. Nur war sie kürzlich einen Schritt weiter gegangen, sie war auf der Suche nach den Verantwortlichen, sie bemühte sich, das Schweigen zu durchbrechen und die Täter zu finden. Damit hatte sie sich Feinde unter den Ultrarechten und dem spanischen Klerus gemacht. Es könnte zum Boykott der Kellerei in La Rioja führen. Und genau das bereitete Henry wie Isabellas Vater Sebastián, dem Firmenchef, Sorgen.
»Ich gebe diese Arbeit nicht auf!«, sagte Isabella in ihrer trotzigen Art.
Davon war Henry überzeugt. Von einer Sache, die sie sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht abzubringen. Diese Eigenschaft war, als sie sich kennengelernt hatten, wesentlich ausgeprägter gewesen; für ihre Verhältnisse war Isabella inzwischen geradezu entgegenkommend und zugänglich.
»Ich meine nicht, dass du klein beigeben sollst«, sagte er, ihren Protest vorwegnehmend. »Ich will nur, dass du die nötige Vorsicht walten lässt. Mir drängt sich ein ganz anderer Gedanke auf: Könnte es sein, dass Diego dich drangsalieren will, seine späte Rache auslebt?«
»Wie soll er aus dem Gefängnis heraus Drohbriefe schreiben?«
»Das wohl nicht, aber dein Bruder könnte jemanden damit beauftragt haben.«
»Aus dem Knast heraus?«
»Was spielt das für eine Rolle? Möglicherweise hat er jemanden draußen damit beauftragt. Geld genug hat er. Du, dein Vater, ihr alle arbeitet für ihn, in gewisser Weise sogar ich. Er wird mit jedem Jahr seiner Haftstrafe reicher. Er ist längst Millionär.«
»Glücklicherweise hat er kein Stimmrecht, andernfalls sähe es mit seinem Fünfundzwanzig-Prozent-Anteil böse für uns aus.«
»Setz dich auf jeden Fall mit Salgado in Verbindung. Er wird wissen, was zu tun ist.«
Henry seufzte, er wusste, dass Isabella es bei ihren Vorbehalten gegen jede Art von Staatsdiener und staatliche Institutionen ungern tun würde. Ach, »Vorbehalte« war das falsche Wort, es war das zutiefst empfundene Misstrauen, das in der Krise auch zigtausende anderer junger Spanier auf die Straßen trugen. Sein eigenes Verhältnis zum Staat war ähnlich. Aber Capitán Salgado war zuverlässig, er hielt Wort, und obwohl er Polizeioffizier war, war er überzeugter Demokrat.
»Bis wann seid ihr unterwegs?«, fragte Isabella unvermittelt. »Du fehlst mir.«
Henry erklärte ihr, dass die Reise zu den Weingütern in den Alpujarras und den Bergen um Malaga am Freitag endete, er würde abends wieder in Barcelona sein und sich gleich nach Durchsicht der Post ins Auto schwingen.
»Die Autobahn kannst du dir sparen, querido, ich bin am Wochenende in Madrid und stelle unsere Weine in zwei Restaurants vor.«
»Wieso macht das nicht dein Vater, wie sonst auch?« Henry wusste, dass sie Weinpräsentationen vor dem Publikum hasste, denn je mehr Sterne ein Restaurant besaß, desto überheblicher war häufig der Besitzer und desto mehr war das Publikum von sich eingenommen, um nicht zu sagen arrogant. Anders als er es aus Deutschland und Frankreich kannte, bedeuteten die Köche in Spanien wenig, die Inhaber der Restaurants dafür umso mehr.
»Sebastián kränkelt, er arbeitet zu viel, sein Arzt hat ihm eine Pause verordnet, und dann springe ich ein, ich fresse den Frosch.«
»Du meinst, du schluckst die Kröte.« Henry lachte über ihre Art, wie sie die deutsche Redensart abwandelte.
»Aber am Sonntagabend bin ich zurück. Wann fliegst du nach Deutschland? Du kommst doch vorher hier vorbei?«
Es war nicht die Bitte in ihrer Stimme, die Henry seine Reisepläne nach Baden-Baden und zum Kaiserstuhl umstoßen ließ, es war auch der Wunsch, sie zu sehen. Eine Wochenendbeziehung war kompliziert genug. Und wenn ein Wochenende ausfiel, weil er gerade in Südspanien unterwegs war, sahen sie sich zwei Wochen nur über Skype. Damit war es für Henry klar, dass er zuerst bei ihr in Logroño vorbeifuhr und dann von Bilbao nach Frankfurt fliegen würde.
Sie sprachen noch eine Weile über ihre Kellerei und Sebastiáns Gesundheitszustand. Sebastián war nur fünf Jahre älter als Henry und damit mehr ein älterer Bruder als ein »Schwiegervater«, wie Henry ihn manchmal scherzhaft nannte. Isabella war zwanzig Jahre jünger als Henry. Und seit sie in der Firma mitarbeitete, ein paar Anteile besaß (weniger als ihr krimineller Bruder) und mit Henry zusammen war, hatte sich das Verhältnis zu ihrem Vater in eine kollegiale Richtung entwickelt.
Zuletzt wagte keiner von beiden, das Gespräch zu beenden, auf den Knopf zu drücken oder den Hörer aufzulegen, denn in der Stille danach spürten sie das Fehlen des anderen besonders. Die Leere ließ sich greifen. War diese Einsamkeit ihrer beider Freiheit geschuldet, ihrer Individualität, oder war es Angst vor der Nähe und die Furcht, sich darin zu verlieren?
Henry steckte das Mobiltelefon in die Tasche seines Sakkos und hob den Kopf. Hatte er während des Telefonats auf die Büsche vor dem Geländer der Terrasse des »Paradors« gestarrt so sah er jetzt das nächtlich flimmernde Granada unter sich, dahinter einzelne Lichter in der sich öffnenden andalusischen Ebene und den allerletzten Schimmer der untergegangenen Sonne über den Wolken, die genauso gut ein Gebirgszug sein konnten. Die gewaltige Sierra Nevada stand dunkel hinter ihm. Darüber glitzerten die ersten Sterne. Henry erhob sich aus dem Korbstuhl, reckte sich und trat ans Geländer. Er schaute nach rechts hinüber zum Generalife. Weich und erhaben leuchteten der Torre de Ismail und der Mirador, versteckt dahinter lag der Patio de la Acequia, wo sich einst die Kalifen von Córdoba und heute er von der Hitze des Tages erholt hatten.
»Du weinst wie ein Weib um das, das du als Mann nicht verteidigen konntest«, soll die Mutter des maurischen Königs Boabdil bei der Flucht vor den spanischen Truppen aus der Stadt zu ihrem Sohn gesagt haben. So jedenfalls hatte es ihm Isabella erzählt, und wie Boabdils Mutter über ihren Sohn dachte sie über ihren Vater und ihre Familienehre. Nach fünf Jahren in Spanien verstand Henry allmählich, was mit Ehre gemeint war und wie sehr sie missbraucht werden konnte.
Aber der Duft der Rosen aus dem Patio de la Acequia verdrängte düstere Gedanken, das feine Plätschern der Springbrunnen dort drang an sein Ohr sowie das Gefühl eines kühlenden Luftstroms auf der Haut. Anders als die je nach Tageslicht oder von Scheinwerfern in Ocker, Gelb oder Beige getauchten Backsteinmauern und Türme der Alhambra waren die Bauten dieser wundervollen Gartenanlage weiß gestrichen, daneben still die Schatten riesiger Zypressen. Er dachte an das eilig fließende Wasser in den Handläufen der Geländer dort drüben und lächelte.
Es war schrecklich. Je länger Henry den Anblick genoss, desto mehr fehlte ihm Isabella. Lange vor ihrer Zeit war er hier gewesen, da hatten japanische Kameras diese Motive noch nicht entdeckt, da hatte niemand gewagt, eine leere McDonald’s-Packung im Löwenhof fallen zu lassen. Dann waren sie beide auf ihrer ersten gemeinsamen Reise hier gewesen, und Henry hatte zum ersten Mal nach einem zu eilig gelebten Leben überhaupt die wesentlichen Dinge der Welt mit einer Frau geteilt. Er wandte sich ab, wagte nicht einmal, in die Sterne zu sehen, dann hätte ihm Isabella noch mehr gefehlt. Er holte sich ein Glas kühlen Albariño von der Bar und setzte sich wieder. Die Ruhe, die ihn jetzt umgab, würde er in den nächsten Tagen nicht mehr finden, wenn die Journalisten eintrafen, mit denen er reisen würde. Für ihn war die Tour ein Heimspiel, die Kollegen hingegen bewegten sich im Ausland, und er war vor drei Jahren beim spanischen Wettbewerb um die Nariz de Oro, die Nase aus Gold, Sieger geworden. Er hatte in jenem Jahr am besten die Rebsorten, Jahrgänge und Herkunft aus den Weinen herausgeschnüffelt. Manchen focht es an, dass ein Ausländer das geschafft hatte, andere bewunderten ihn, und diejenigen, denen das völlig schnuppe war, waren Henry die liebsten.
Oliver Koch kam mit gezielten Schritten durch die Hotelhalle auf sie zu: angespannt, den Kopf im Nacken, herablassend der Blick aus dunklen Augen, lauernd die anderen betrachtend, indiskret eindringend und gleichzeitig für sie verschlossen. Er schien sich nicht auf die Reise zu freuen. Kellereien zu besuchen und Weine zu probieren war eine harte Aufgabe, eine Pflicht, der man sich in seiner Position unterziehen musste, und er schätzte es anscheinend auch nicht, mit interessanten Kollegen im Gebirge der südlichen Mittelmeerküste Winzer zu treffen. Bei Weinfabriken, wie Henry die Großproduzenten bekannter spanischer Marken nannte, hätte er diese Haltung verstehen können. Aber sie waren unterwegs zu Winzern, um sich anzusehen, was diese mit Herz und Sachverstand und auch Pioniergeist so auf die Flaschen brachten. Kochs Blick zeigte, dass er einer harten und schweren Pflicht entgegensah. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, ließen seinen Blick brennen.
Vier Tage würden sie zusammen reisen, dann würde Henry wissen, was da brannte. Dieser Blick ließ ihn auf der Hut sein. Koch hätte Araber sein können, einer jener historischen Assassinen, Fundamentalisten des arabischen Mittelalters, die für einen politischen Mord gerne mit dem Leben bezahlten, weil ihnen dann das Paradies offen stand.
Koch war ein hagerer Typ mit schwarzen Locken, mager mit hervorstechenden Gesichtsknochen, einer großen Nase, was bei seinem Beruf als Weinjournalist sicher ein Vorteil war. Aber die schmalen Lippen hoben den Vorteil wieder auf, denn Henry fragte sich, wie man ohne die Fähigkeit zum Genießen den Genuss beurteilen wollte. Jede Regung an diesem Mann, der die vierzig erreicht haben musste, wirkte kontrolliert, jeder seiner Blicke zog seine Bewertung nach sich, und es würde kaum jemanden unter ihnen geben, der vor ihm Bestand haben würde.
Er begrüßte alle mit Handschlag. Seine Kollegin aus dem Heckler-Verlag, Marion Dörner, bekam ein Kopfnicken mit einem angerissenen Lächeln.
»Und Sie sind– dieser Spanienexperte, die Goldnase, wie man mir berichtet hat?«
Oh, Koch war so wichtig, dass ihm »berichtet« wurde? Henry legte sein verbindlichstes Lächeln auf. »Genau, der bin ich. Exakt, Herr Koch, Nariz de Oro, wie wir das in Spanien nennen.«
Koch war allem Anschein nach auf Krawall gebürstet, er brauchte jemanden, den er übertrumpfen konnte.
»Da bin ich ja mal gespannt, wie wir die Weine auf der Reise bewerten, Sie– mit diesem– na sagen wir mal familiär-spanischen Hintergrund. Könnte es sein, dass Ihnen dabei die nötige Neutralität, die in unserem Beruf geboten ist, verloren geht?«
»Interessanter Blickwinkel«, sagte Henry mit einem Lächeln und einem Seitenblick auf Hecklers Kollegin Dörner, »aber bei welcher Bewertung lässt sich das eigene Interesse völlig ausschalten?« Er wusste, dass Koch seine Retourkutsche richtig zu deuten wusste. Der Heckler-Verlag bewertete Weine in seiner Zeitschrift Marktplatz Wein und finanzierte sich über Anzeigen eben auch jener Kellereien. Wollte man objektiv sein, verlor man Kunden, war man parteiisch, verlor man seine Glaubwürdigkeit. Es war ein Eiertanz.
Koch machte ein wichtiges Gesicht. »Wer das Verkosten professionell betreibt, versteht, den eigenen Geschmack außen vor zu lassen.«
Sie wurden von Rudolph Schneider unterbrochen, der die Reise im Auftrag des spanischen Handelsministeriums organisiert hatte, und aufgefordert, endlich den Bus vor dem Portal des Hotels zu besteigen. »Sie können diese sicher sehr interessante Debatte unterwegs fortsetzen…«
Die Koffer wurden verstaut, jeder suchte sich in dem Kleinbus einen Platz. Enttäuscht sah Marion Dörner, wie sich Henry zu dem Kollegen setzte, der in Mainz bei der Zeitschrift Wein & Terroir arbeitete, seinem früheren Arbeitgeber. Für ihn hatte er als Chefreporter gearbeitet bis er, nicht nur Isabellas wegen, nach Barcelona übersiedelt war, ein Entschluss, den er niemals bereut hatte. Aber mittlerweile wich er der Stadt aus, er war zufrieden, wenn er im Inland von Bodega zu Bodega unterwegs war und die Wochenenden mit Isabella in La Rioja verbrachte. Logroño war weniger anstrengend. In seiner Wohnung hielt er sich nur bei der Arbeit an seinem Newsletter VINOS IBERICOS auf und wenn er Freunde traf.
Sie verließen Granada über die Schnellstraße in Richtung Mittelmeer, links ließen sie die Alhambra hinter sich, weit überragt vom Mulhacén, Spaniens höchstem Berg. Auf der einen Seite stützte ihn der Caballo, das Pferd, auch im Sommer mit weißer Mähne. Auf der anderen gab ihm der Cerro Pelado den nötigen Halt, der Nackte Gipfel. Der weiter im Osten liegende Cerro de Revélez war schon deutlich unter dreitausend Meter. Aber diese Berge, noch mit Schnee bedeckt, die nördliche Grenze der Alpujarras, waren nicht ihr Ziel. Sie überquerten bald den Guadalfeo und schlängelten sich auf schmalen Bergstraßen an den Falten der Contraviessa hinauf, dem eigentlichen Küstengebirge gegenüber der Sierra. Sie erreichten den Treffpunkt, eine Kneipe an der einsamen Straße. Die Mandelbäume waren längst verblüht, aber der Ginster leuchtete noch strahlend gelb. Dort wartete im warmen Hauch von Rosmarin und Thymian Hilgard, ein deutscher Winzer, auf sie, ein ehemaliger Frankfurter Weinhändler, der gelassen dem Einfall der Journalistenhorde entgegensah.
Er stieg in seinen alten Landrover und fuhr voraus zu seinen Rebbergen. Sie lagen auf dreizehnhundert Metern Höhe, dem Scheitelpunkt der Contraviessa. Tief unten im Süden schimmerte das Mittelmeer. Afrika, das jenseitige Ufer, hüllte sich in Dunst. Im Norden hingegen öffnete sich das atemberaubende Bergpanorama der Sierra Nevada, es ließ dem Himmel nur wenig Raum. Und wuchtig, als wolle sie den Zugang verwehren, erhob sich im Osten die Sierra de Gádor. Hexen soll es dort gegeben haben, erinnerte sich Henry und fand es gar nicht so abwegig.
Hier standen sie jetzt auf einem der höchsten Weinberge Europas im trockenen Staub. Bis Oktober würde kein Tropfen Regen fallen, doch vierhundert Millimeter Niederschlag im Jahr ließen die Weinstöcke überleben. Sie wirkten gesund, üppig und grün. Vierzig Grad erreichte die Temperatur hier, im Schatten, wie der Winzer anmerkte, aber die Kühle der Nacht, vielmehr die Unterschiede waren das, was die Rebsorten Tempranillo, Cabernet Sauvignon und die wenigen Stöcke Merlot auf Hilgards acht Hektar schätzten. Sie standen auf Schiefer, von Lehm und Ton durchsetzt. Nach diesen Erklärungen fuhr man bergab, wenige Minuten nur, um in der kleinen Kellerei Los Barrancos das oben Gewachsene zu probieren.
Henry merkte, wie Marion Dörner ihn verstohlen beobachtete, aber sie lächelte jedes Mal, wenn ihre Blicke sich über dem Tisch trafen und sie dann wieder das Weinglas vor sich betrachtete. Henry war irritiert, beim Probieren ließ er sich ungern ablenken, auch nicht von einer gut aussehenden Frau, denn was Hilgard ihnen vorsetzte, war ausgezeichnet.
Bei einer vertikalen Probe durch die Jahrgänge rückwärts ließ sich wunderbar erkennen, was der Boden hergab, wie ein Önologe damit umging und wie sich der Wein im Laufe der Lagerung veränderte. Der Corral de Castro, eine Cuvée aus Tempranillo mit einem Anteil Cabernet, der ihm Struktur und Gerüst gab, war durchweg harmonisch, intensiv im Geschmack, fühlte sich weich an und zeigte ein schönes Beerenaroma. Der acht Jahre alte Wein gefiel Henry am besten, der neun Jahre alte verlor nicht nur Geschmack, sondern änderte auch die Farbe. Der Cerro de la Retama mit einem höheren Cabernet-Sauvignon-Anteil war Henry zu wenig spanisch, dafür war der Los Felipes genannte Wein, ein Mischsatz eben dieser Rebsorten, grandios. Deutlich unterschieden sich die Aromen von Beeren, Kirsche, Leder und Tabak, ein Hauch Schokolade kam hinzu. Das Geschmacksbild war klar und doch vielseitig, der Wein war kräftig, aber nicht schwer, und die Tannine verliehen ihm die nötige Härte. Bei der Hitze hier oben hätte Henry marmeladige Weine vermutet, schwer und satt machend, aber der Los Felipes war es nicht. Er setzte einen Standard, er war ein Maß, an dem sich die ihnen in den nächsten Tagen präsentierten Weine würden messen lassen müssen.
»Es ist selten, dass man gleich zu Beginn einer Weinreise den Schrittmacher vorgesetzt bekommt«, sagte Henry und erntete von Koch einen bösen Blick und von Marion Dörner ein Lächeln. War das Zustimmung, oder bedeutete das etwas anderes?
Er hätte sich gern länger hier aufgehalten, mit dem Winzer gesprochen, wie er es auf seinen eigenen Reisen tat, aber der Reiseplan, Rudolph Schneiders »Zeitfenster«, was für ein dämlicher Ausdruck, trieb sie weiter. Die nächste Probe fand unter dem Strohdach eines Landgasthofs statt, dort warteten bereits zwei Winzer mit ihren Gewächsen.
Cristina und Paco Calvace präsentierten ihnen den Weißwein Blanco de Alboloduy aus der Rebsorte Jaén Blanca. Sie war zugunsten roter Sorten aus der Mode gekommen.
Ein sehr feiner, frischer und fruchtiger Weißer war das, reife Aprikose schmeckte Henry heraus, Mango und Apfel, eigentlich behagte es ihm wenig, in seinem Newsletter das Geschmacksbild in Einzelteile zu zerlegen. Ein deutscher Weinwettbewerb hatte den Wein mit einer Goldmedaille prämiert– zu Recht, wie Henry empfand. Kochs Augen wanderten derweil von Marion Dörners Ausschnitt zu ihren Notizen– und er hatte offenbar etwas zu meckern. Es störte ihn keineswegs, dass alle anderen es merkten.
Anders als die französischen Roséweine waren die spanischen Rosados herb statt süß, so auch dieser Syrah oder Shiraz, den der Winzer und seine Frau ihnen vorsetzten. Auch diese Trauben waren oberhalb von eintausend Metern gewachsen. Erdbeere, Kirsche und Himbeere schnupperte Henry heraus. Der fast schwarze Wein zum Schluss war konzentriert und gehaltvoll und blieb dabei unerwartet leicht, er machte weder satt, noch kratzten seine Tannine am Gaumen, und in der fünfjährigen Reifezeit hatte die Süße der Holzfässer ihr dominantes Aroma glücklicherweise verloren. Einen solchen Wein hätte Henry hier nicht vermutet, aber je mehr er sich mit Spaniens Weinen beschäftigte und ihre Gleichförmigkeit beklagte, wofür er den Weinguru Alan Amber und sein Geschmacksdiktat nach dem Hundert-Punkte-Schema verantwortlich machte, desto mehr entdeckte er Weine, die sich dem sperrten, und Winzer, denen diese Bewertung gleichgültig war.
»Das ist nicht dem Selbstbewusstsein der Winzer zu danken«, merkte Koch ungefragt an, »bei den geringen Mengen, die diese Leute produzieren, gelangt kaum eine Flasche davon nach Deutschland!«
Spira hieß der nächste Wein, den sie vor dem Essen noch probieren sollten. Im Guia Penin, Spaniens wichtigstem Weinführer, hatte er in den letzten Jahren mal neunzig, dann einundneunzig, neunundachtzig und zuletzt wieder einundneunzig Punkte erhalten. Wie sich diese Bewertungen zusammensetzten, ob gezielt gemogelt, ob die Punkte gekauft waren oder ob eine »objektive« Jury dem Wein eine Goldmedaille verpasst hatte, war Henry egal, ihm kam es darauf an, wie er den Wein betrachtete, wie er ihn empfand, was er ihm sagte, wozu man ihn trinken konnte und wie er seine Entwicklungschancen beurteilte. So hatte er es damals bei der Zeitschrift Wein & Terroir gehalten, so hielt er es heute. Und zu den Weinen der Bodega seiner Freundin äußerte er sich nicht. Maßgeblich war sein eigenes Urteil und nicht das anderer, mochten sie nun Alan Amber oder Robert Parker heißen, Hugh Johnson oder GaultMillau, auch wenn man sich der Bewertung anderer stellen musste. Galt das nicht für Menschen ebenso? Wichtig war zu wissen, nach welchen und wessen Regeln gespielt wurde.
»Sie sind auch nach Baden-Baden eingeladen«, sagte Koch beim anschließenden Essen, »da bin ich auf Ihre Bewertungen gespannt.«
»Wie wollen Sie die beurteilen?«, fragte Henry.
»Wir prüfen die Weine nach den Regeln der OIV, der Internationalen Organisation für Rebe und Wein, da lässt sich hinterher feststellen, ob Sie für die Farbe vier, fünf oder sechs Punkte gegeben haben.«
»Und das bekommen Sie zu sehen?«
»Klar, wenn ich will«, meinte Koch selbstgefällig.
»Und wenn ich es anders sehe als Ihr Verlag, der den Wettbewerb ausrichtet?«
Sofort herrschte Stille am Tisch, auch die anwesenden Spanier bemerkten den Stimmungsumschwung, sie verstummten.
»Dann werden Sie kaum wieder eingeladen!« Koch überspielte den scharfen Ton mit einem Lachen, doch die Kollegen wussten, dass es ernst gemeint war. »Wie gefällt Ihnen der Wein, den wir zuletzt probiert haben?«, fragte Koch provokativ.
Danach war nur das Klirren der Gabel zu hören, die Henry genervt auf den Teller legte. »Sehr warm, sehr dicht, ein Wunder bei dem geringen Alkoholgehalt von nur 12,5Volumenprozent. Es ist ein korrekter, sehr moderner Wein…«
»…die Trauben werden bei Nacht gelesen…«
»…er ist aber nichts für Entdecker, Spaß macht er nicht, er trifft lediglich den gegenwärtigen Geschmack.« Damit schloss Henry seinen Kommentar, schlug die Kladde zu, in der er seine Beobachtungen notierte.
»…und den Geschmack gewisser Verkoster, die auf Massenprodukte setzen«, hatte er noch anfügen wollen, aber er wollte die Spannung zwischen sich und Koch nicht weiter erhöhen. Der Mann hatte ein Problem mit seinem Ego, irgendwann würde es knallen, laut und vernehmlich. Das minderte seine Vorfreude auf die Reise nach Baden-Baden. Dort würde es zum Knall kommen.
Im Bus nahm ihn Marion Dörner beiseite, sie setzten sich nach hinten, sie neigte sich Henry zu, so weit, dass ihm ihr unaufdringliches, nach Veilchen und würzigem Holz duftendes Eau de Toilette in die Nase stieg. Henry hatte einige Fragen zur BBWC.
»Ich kann Sie beruhigen. Koch ist nicht der Organisator des Wettbewerbs, dazu wurde eigens eine Tochtergesellschaft gegründet. Aber als verlängerter Arm von Heckler wird Koch die ganze Zeit über anwesend sein. Manche nennen ihn den ›Kettenhund‹«, sagte sie schmunzelnd hinter vorgehaltener Hand, »er knurrt und beißt. Unangenehmes wälzt der Verlagschef auf ihn ab. Ich bin zwar nicht berufen, gute Ratschläge zu geben, aber legen Sie sich nicht mit ihm an.«
Henry betrachtete fragend ihr von der Sonne leicht gerötetes Gesicht, ihre feinen Züge, ihre Zartheit, blickte ihr in die braunen Augen, die sie sofort niederschlug, und dachte, dass besonders sie sich vor Koch in Acht nehmen musste. Ihm hingegen war es gleichgültig, wie Koch zu ihm stand.
»Er hat ein Problem mit mir, nicht ich mit ihm!«
»Sie dringen in seine Domäne ein. Er hält sich für den absoluten Spanien-Kenner. Diese Geschichte mit der Nariz de Oro nagt an seinem Selbst, er nennt es spanischen Marketing-Quatsch. Gerade dass Sie den Wettbewerb gewonnen haben, so sagte er auf dem Flug hierher, sei ein Indiz dafür. Dabei wäre er gern selbst die Goldnase.«
Ein mitleidiges Achselzucken reichte Henry als Kommentar. Ob man ihn im nächsten Jahr wieder nach Baden-Baden einlud, brauchte ihn nicht zu interessieren. Er wollte lediglich wissen, wie diese Veranstaltung ablief, ob alles mit rechten Dingen zuging, ob und wie man schummeln konnte und ob die verteilten Medaillen, ob nun Silber oder Gold auf der Flasche, den Inhalt einigermaßen wiedergaben. Dreihundert Euro kostete in Spanien eine Goldmedaille unter der Hand, dreißigtausend konnte sie einbringen… Außerdem war er mit dem weltberühmten Weintester Alan Amber zu einem Interview verabredet. Er hatte die Gelegenheit genutzt, als klar war, dass auch Amber erscheinen würde. Aber das brauchte er weder Koch noch Marion auf die Nase zu binden.
»Alan Amber wurde von Ihnen eingeladen. Sie haben das in Ihrer Ankündigung der Challenge groß rausgestellt. Nimmt er am Wettbewerb teil– oder ist das deutscher Marketing-Quatsch?«
Statt einer Antwort wurde Marion Dörner blass, sie stand hektisch auf, schluckte und sah ihn entsetzt an. »Mir wird schlecht, ich halte die Schaukelei hier hinten nicht aus.« Sie hangelte sich zwischen den verdutzten Kollegen nach vorn und ließ sich nach Luft schnappend hinter dem Fahrer in einen Sitz fallen.
Der Bus bremste, drehte in der Serpentine eine enge Runde, über den Scheitel der Contraviessa hinab ins Tal des Guadalfeo. Man wurde nach außen gepresst, dann beschleunigte der Fahrer, um gleich darauf wieder zu bremsen und in die nächste Spitzkehre hineinzusteuern. Jetzt fielen alle nach der anderen Seite, und gleich darauf wiederholte sich das Manöver andersherum. Henry machte die Kurverei nichts aus, er bemitleidete Marion, die sich an ihren Sitz klammerte. Was für ein empfindsames Seelchen, dachte er und betrachtete ihr glattes, braun glänzendes Haar, das sich in den Kurven ebenfalls zur Seite neigte.
Sie wird es bei ihrer Empfindlichkeit im Verlag nicht leicht haben, sagte er sich. Ob sie die Probezeit hinter sich hat? Und wenn sie sich zu sehr mit mir abgibt, könnte Koch das als gegen sich gerichtet sehen. Das war kaum vorteilhaft für ihre Karriere.
Die nächste Station war Barranco Oscuro, die Bodega von Manolo Valenzuela, dem Pionier der Gebirgsweine. Er hatte vor etwa dreißig Jahren hier oben mit dem Weinbau begonnen und die besten Weine der Region geschaffen. Aber wie es hieß, »fielen die Pioniere zuerst«, und er war überholt worden, auch weil er sich zu sehr in seine Idee von ökologisch gemachten Weinen ohne jeden Schwefel verrannt hatte. Es gab Hefestämme im Holz der Fässer, denen man ohne Hochdruckreiniger und die reinigende Funktion des Schwefels nicht beikam. Er war ein Bestandteil von Aminosäuren im menschlichen Organismus und damit letztlich doch auch ein Naturprodukt.
Sie fuhren weiter ins Tal, durchquerten das Dörfchen Cadiar. Henry kannte es von einem früheren Besuch, es war nicht einmal groß genug, als dass sich eine Zahnarztpraxis lohnen würde, wie er leidvoll erfahren hatte. Und die Post öffnete täglich für drei Stunden, und das nur an zwei Tagen pro Woche. Dahinter begannen fünfzehn Kilometer Wüste, die ideale Western-Kulisse. Links oben am Hang der Sierra Nevada lagen die Weißen Dörfer: Yegen als Teil der Kette, eckige Häuser miteinander verklebt, verschachtelt, Knoblauch und Paprikaschoten auf den Dächern, Ziegen unten im Stall und alles so weiß wie die Dörfer der Berber auf der nordafrikanischen Seite im Atlasgebirge– ein wirklich altes Stück Spanien.
Gerald Brenan, ein junger intellektueller Brite, hatte nach dem Ersten Weltkrieg lange hier gelebt und darüber ein Buch geschrieben. »Südlich von Granada« hatte Henry wie kaum ein anderes Buch Einblick in jene Zeit gegeben. Virginia Woolf, Autorin und Freundin Brenans, später Heldin der Frauenbewegung, hatte es bei ihrem Besuch nur wenige Tage ausgehalten.
Ob das auch für Juan Palomar galt, auf dessen Bodega sie zusteuerten? Der Spanier lebte in den USA– und für die ließ er in Abwesenheit Wein produzieren, wobei der Süßwein aus Cabernet-Sauvignon-Trauben sein bester war– er war genauso gut wie das Olivenöl.
Sie ließen das Bergland hinter sich, fuhren über beste, EU-finanzierte Straßen durch scheinbar verwüstetes Land, das auf erschreckende Weise mit Plastikplanen bedeckt war. Als sie die Küste südlich von Almeria erreichten, war der Boden zur Gänze mit Kunststoff versiegelt, darunter »wuchsen« die Paprikaschoten, die Tomaten und Auberginen für ganz Europa– und nicht einer der Nordafrikaner, die hier arbeiteten, ließ sich rechts und links der Küstenautobahn blicken. Henry kannte die Entwicklung seit den Neunzigerjahren, doch dass diese Polyethylen-Pest sich so schnell sogar bis Malaga ausbreiten würde, hatte er nicht erwartet.
Der Bus taumelte kaum noch, die Straße war ausgezeichnet, das Meer lag still im öligen Dunst eines undramatischen Sonnenuntergangs. Marion gab Henry ein Zeichen, nach vorn zu kommen, als Koch sich zu einem Kollegen nach hinten begab. Es war eine Gelegenheit, sie weiter über die BBWC auszufragen.