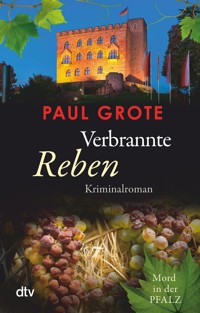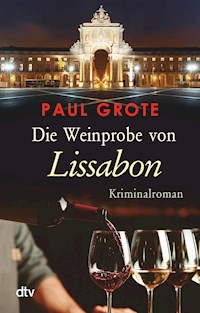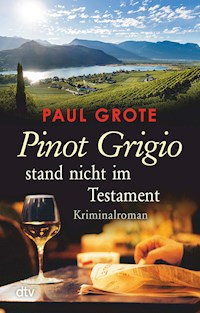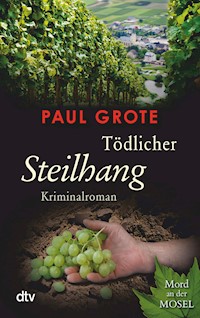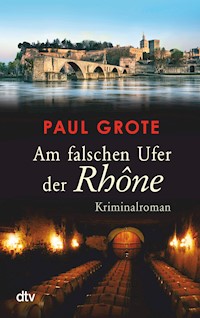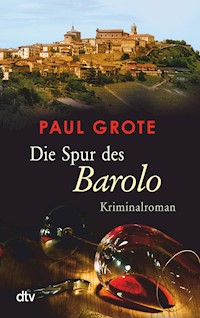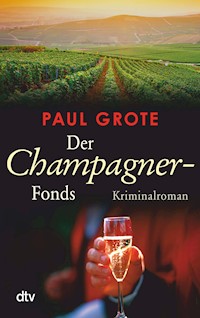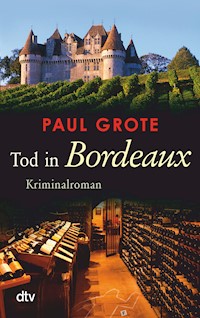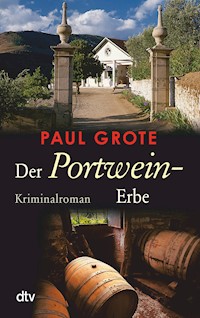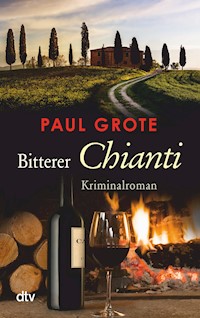Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der neue Band der erfolgreichen Weinkrimi-Reihe: Eine Reportage über eine junge Winzergenossenschaft führt den Journalisten Meyenbeeker in die Rioja. Mitten in die Auseinandersetzungen einer spanischen Großkellerei und einer jungen Kooperative (ihre ehemaligen Traubenlieferanten) platzt der deutsche Reporter Henry Meyenbeeker. Als sein Informant, der Önologe der Kooperative, mit seinem Wagen abstürzt, ist er alarmiert, doch ein Motiv für ein mögliches Verbrechen ist nicht zu finden. Je tiefer Meyenbeeker gräbt, desto mehr Akteure bringt er gegen sich auf. Freunde werden zu Feinden, schlagen hart zu, und Fremde helfen plötzlich weiter. Geht es um Wein oder Bodegas? Geht es um Macht oder um ganz andere Dinge? Der Tag des Stierkampfes rückt näher ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Grote,
Rioja für den Matador
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Dieser Roman ist Juan Carmona Rivera gewidmet,
geboren am 17.6.1925,
gestorben am 5.12.1941 in Mauthausen.
Caminante, no hay camino
Se hace camino al andar.
Wanderer, es gibt keinen Weg
Der Weg entsteht beim Gehen.
Antonio Machado
Prolog
»Umbringen könnte ich den Typen, einfach umbringen. So was Abgebrühtes. Eiskalt bügelt der jeden Einwand ab!« Wütend schlug Dorothea die Tür hinter sich zu – die dünnen Bürowände wackelten gefährlich. Die Redakteurin stellte die Kaffeetasse mit so viel Schwung auf ihrem Schreibtisch ab, dass der Kaffee überschwappte und sich über die Manuskripte ergoss.
Henry Meyenbeeker sah auf. »Wenn er eure Argumente nicht abbügeln könnte, wäre er nicht der Chefredakteur.«
Hektisch suchte Dorothea nach Papiertaschentüchern, riss eine Schublade nach der anderen auf, was den Kaffee wieder überschwappen ließ und die Weinflaschen auf dem Schreibtisch in heftiges Schlingern versetzte. Sie griff nach einer schwarzen Flasche, die auf die Tasse zu fallen drohte – und erwischte sie im letzten Moment: Es war ein Riesling von Reinhard Löwenstein, Jahrgang 2003, Rotschieferlage, über den sie heute noch einen Artikel zustande bringen musste.
Grinsend beobachtete Henry die verzweifelten Bemühungen seiner Kollegin. Es sah ganz so aus, als hätte er für diese mehr Verständnis als für ihre Worte.
Drohend wandte sich Dorothea ihm zu: »Weißt du, was mich am meisten aufregt?«, zischte sie bissig.
Henry schüttelte mit gespielter Unschuld den Kopf.
»Du regst mich auf! Du – und dein verdammtes Phlegma! Diese Gelassenheit, ekelhaft! Sitzt hier wie Buddha persönlich, nicht so fett, aber mit demselben Grinsen, als ginge es dich nichts an, dabei geht es um dich! Los, sag was, wenigstens jetzt. Du weißt, dass alle wollen, dass du …«
»Genau da liegt das Problem.« Henry verzog jetzt gequält das Gesicht und verfolgte, wie der Kaffee sich unter Plastikhüllen immer neue Wege auf dem Schreibtisch suchte. »Alle wollen, dass ich diesen Job mache. Dabei darf jemand, der beliebt ist, niemals Chef werden. Chefs muss man fürchten, hassen, beneiden, bewundern vielleicht, aber so jemand darf um Himmels willen nicht beliebt sein.«
Dorothea bemerkte, dass sie auch ihr hellgraues Kostüm bekleckert hatte, was sie noch wütender machte: »Dich bringt wohl gar nichts aus der Ruhe, was? Du hast ein so dickes Fell wie ein Wildschwein. Eine Zehn-Zentimeter-Schwarte mit Borsten, und was darunter ist, weiß niemand.«
Henry lehnte sich zurück und verschränkte die Hände im Nacken. »Das könnte der einzige Grund sein, der mich nach Ansicht der Geschäftsleitung geeignet erscheinen lässt. Ansonsten tauge ich nicht dafür. Stell dir vor, ich müsste dich entlassen, weil du die Manuskripte wichtiger Weinautoren mit Kaffee bekleckerst und Weinflaschen runterwirfst. Ich müsste mir den Redaktionsklatsch anhören … ich weiß, dass Olaf ständig an meinem Sessel sägen würde. Fischer sagt nie, was er wirklich denkt, und plötzlich fällt er mir in den Rücken. Wer hat den eigentlich in die Redaktion geholt?«
»Muss man immer gleich das Schlimmste annehmen?«
»Was schief gehen kann, Dorothea, das geht auch schief.«
»Lao-Tse?«, fragte sie bissig.
»Nein, Murphys Gesetz. Der Verlag braucht einen Chef, der konsequent sein kann, flexibel, rational gesteuert und karrierebewusst. Du kannst es opportunistisch, gefühlskalt und egozentrisch nennen. Mit solchen Eigenschaften wird Auflage gemacht. Aber nicht mit mir. Ich bin Reporter, ich will schreiben.«
»Du bist so widerlich edel, dass es weh tut«, warf Dorothea ein.
»Ach! Glaubst du, nur meinetwegen würde die Welt anders ticken? Du bist lange genug im Geschäft, meine Liebe, du weißt genau …« Henry verstummte, denn Schlussredakteur Olaf Winter, genannt das Nilpferd, schob seinen Bauch in den Raum; etwas später folgte der Rest.
Winter strich sich über den rasierten Schädel und tat, als ignoriere er die Anwesenheit des Chefreporters der Zeitschrift ›Wein & Terroir‹. »Was ist? Hast du ihn überzeugt?«, fragte er und blickte zurück in den Flur, bevor er die Tür schloss.
»Nur Mut, Olaf, da lauscht niemand.« Henry wippte auf seinem Stuhl und sah Dorothea herausfordernd an.
»Ein Kollegenschwein ist das«, murmelte sie so laut, dass Henry es hören musste, und wurde lauter: »Er will nicht. Angeblich muss er nach Spanien, in die Rioja, sich bei den Winzern einschmeicheln und die besten Weine abstauben – Gran Reservas für seinen feinen Keller – und uns überlässt er den Hyänen.«
Winter plumpste auf Meyenbeekers Schreibtisch; die Rahmenkonstruktion ächzte: »Ist dir bewusst, dass dich die Geschäftsleitung gehen lässt, weil sie dich aus dem Weg haben will?«
Henry sah den Kollegen provozierend an. »Na und? Ich selbst habe das Thema vorgeschlagen und den Zeitpunkt für die Reise auch. Bei LAGAR laufen Sachen, die wohl nicht koscher sind. Die Kooperative ist im Aufbau, daher extrem verletzlich, und da will ihr irgendjemand das Wasser abgraben. Der Önologe hätte nicht persönlich um Hilfe gebeten …«
Damit hatte Henry Dorothea nur neue Argumente gegeben: »Du Held. Und dein Engagement für uns? Hier, wo es um deinen eigenen Arsch geht, kneifst du!«
Zur Bestätigung nickte Olaf Winter wie der elektrische Sarotti-Mohr im Schaufenster eines Schokoladengeschäfts. Er hörte gar nicht mehr auf zu nicken, es fehlte ihm nur noch das Tablett in den Händen.
Meyenbeeker zuckte mit den Achseln. Er verstand die Reaktion einiger Kollegen durchaus. Gleichzeitig war einigen anderen nur deshalb an seinem Aufstieg gelegen, weil sie ihren eigenen damit verbanden. Doch die Herausgeber würden ihn niemals als Chefredakteur akzeptieren. »Journalisten sind dazu da, die Rückseiten der Anzeigen vollzuschreiben.« Das war die Devise der Geschäftsleitung, und der musste auch er notgedrungen folgen. Zwar schützte ihn seine Rolle als Chefreporter – seine Berichte wurden gelesen, das war seine Rettung –, aber nahm man ihn wirklich ernst? Themen, die er in der Konferenz vorschlug, stießen auf Ablehnung, waren sie doch eher brisant als Mainstream. Er fühlte sich nicht berufen, Massenweine schönzureden und Manager zu zitieren, denen es egal war, ob sie Waschmaschinen oder Wein verkauften.
»Holt eure Kohlen selbst aus dem Feuer«, sagte er und wippte weiter. »Wenn die Redaktion sich einig wäre, hätte der Verlag auch eine Linie, aber irgendeiner schießt immer quer, kriegt mehr Geld, bessere Spesen – und schwups ist Ruhe.«
Dorothea hatte sich gesetzt und nippte an dem Rest Kaffee. »Und in deiner spanischen Genossenschaft ist alles anders?«
Henry zuckte die Schultern. »Jaime Toledo, der Önologe von LAGAR, hat nichts von internen Schwierigkeiten verlauten lassen. Angeblich kommen die Angriffe von außen.«
»Das Schlimmste sind immer die Feinde im Inneren«, bemerkte Olaf Winter wichtigtuerisch.
Henry wunderte sich, dass gerade er das sagte, wo er bereits zweimal umgefallen war, als es darum gegangen wäre, Rückgrat zu zeigen.
»Das Schlimmste sind die lieben Kollegen – willst du sagen«, bemerkte Dorothea ironisch, als ihr Telefon klingelte. Sie hob ab, meldete sich und sagte dann zu Henry: »Du sollst ins Sekretariat kommen. Dein Ticket nach Bilbao ist da. Billigflieger, 99 Cent, der Leihwagen steht bereit.« Mit gespieltem Erstaunen riss sie die Augen auf. »Wirst du doch Chefredakteur? Man stellt dir einen Mercedes zur Verfügung.«
Bislang war Henry ruhig geblieben, aber jetzt sprang er ärgerlich auf. »Was soll der Unsinn? Mit so ’ner Kiste kann ich mich bei keiner Kooperative sehen lassen.«
Dorothea lachte spöttisch, und ihre Worte bekamen einen bösen Unterton: »Ja, ja, immer das passende Mäntelchen für die Reportage umhängen.«
»Ach, leckt mich doch alle!«, zischte Henry, war mit drei Schritten an der Tür und knallte sie hinter sich zu. Die Wand wackelte, er hörte Glas klirren. Drinnen war ein Bild heruntergefallen, das Porträt eines alten, vertrockneten Winzers. Der Mann hatte so etwas Verschlagenes im Blick. Erschrocken zögerte Henry einen Moment. Obwohl er das Bild nicht leiden konnte, war das ein verdammt schlechtes Omen.
1.Henry Meyenbeeker
»Es ist nicht mehr weit«, sagte die Frau hinter dem Tresen und blieb im Durchgang zur Küche stehen. »Du fährst nach links«, sie zeigte auf die Straße vor der Bar, »da vorn gabelt sich die Landstraße – auf keinen Fall rechts abbiegen, sonst kommst du nach Labastida –, also geradeaus, vielleicht noch fünf Kilometer durch den Wald, bis zum Steilhang der Sierra, da hast du das gesamte Tal vor dir, na ja, eigentlich eher unter dir. Dort ist ein Aussichtspunkt, ¿verdad? Die Leute fahren extra deshalb hin. Die Sierra fällt fast senkrecht ab, etliche hundert Meter. Wenn du unten am Fuß der Serpentinen bist, sind es höchstens noch zehn Minuten bis nach Laguardia, alles klar?«
Henry bedankte sich, eigentlich hatte er es gar nicht so genau wissen wollen, aber die Wirtin hatte anscheinend niemand anderen zum Reden. Er bezahlte den Kaffee und die madalenas. Er liebte die kleinen runden Kuchen und steckte gleich noch zwei ein. An der Tür machte er den Jugendlichen Platz, die johlend in die Bar drängten. Er verstand kein Wort von dem, was sie sprachen, absolut nichts, es war ein Drama mit den Basken. Selbst wenn er konzentriert hinhörte, konnte er nicht einmal raten, worum es ging. In Vitoria-Gasteiz hatte er geschwitzt, um die richtige Straße von der Provinzhauptstadt hierher zu finden, weil er sich für die schönere statt für die schnellere Strecke entschieden hatte. Aber bis er die spanisch-baskische Beschriftung der Schilder gelesen und begriffen hatte, war er längst an der Straße vorbei, wo er hätte abbiegen müssen.
Vor anderthalb Stunden bereits hatte er hier sein wollen, in … wie hieß das Nest? Urizaharra? Wer konnte sich so einen Namen merken? Auf Spanisch hieß das Peñacerrada, das war um einiges leichter, außerdem waren ihm die Buchstabenfolgen und Silben vertrauter. Aber Baskisch, euskara, wie sie es nannten? Dagegen war català, das in Katalonien um Barcelona herum gesprochen wurde, geradezu simpel.
Anderthalb Stunden Verspätung – die Verabredung mit Jaime Toledo konnte er für heute streichen. Morgen war auch noch ein Tag, mañana eben. Er würde den Önologen, der die Weinbauern der Kooperative LAGAR in Fragen des Weinbaus und der Kellerwirtschaft beriet, dann eben morgen auf der Baustelle ihrer neuen Kellerei aufsuchen.
Henry warf den Jugendlichen einen Blick hinterher, vielleicht ein wenig neidisch auf die Frechheit, mit der sie drängelten, sich lautstark unterhielten, sich über alle möglichen Regeln hinwegsetzten, was er sich kaum noch gestattete und was er sich insgeheim verübelte.
Nachdenklich öffnete er die Wagentür und schrak zurück. Ein Hitzeschwall kam ihm entgegen, als hätte er die Tür eines Backofens heruntergeklappt. Der Wagen hatte sich in der Sonne aufgeheizt, er würde hier stets nach Schatten suchen müssen. Henry riss die anderen Türen weit auf. Nach einer Weile war es im Inneren des Autos erträglich. Er fuhr mit offenen Fenstern los; von der Klimaanlage bekam er Halsschmerzen. Henry liebte die Hitze. Temperaturen auch über dreißig Grad bekamen ihm bestens, er fühlte sich agil, leistungsfähig, aber heute machte ihm der Klimawechsel zu schaffen. Nach dem verregneten Sommer und der Kälte Anfang September in Wiesbaden musste er sich erst an die hohen Temperaturen gewöhnen. Dabei wehte hier oben auf der 1300 Meter hohen Sierra ein angenehm kühles Lüftchen.
Henry befolgte die Anweisungen der Wirtin, um nicht an der falschen Stelle abzubiegen.
SchLAGARtig endete der Baumbestand. Henry kam auf einem Schotterstreifen neben der Straße zu stehen: Es war, als würde der Vorhang einer Bühne aufgezogen. Die Rioja bot einen erstaunlichen Anblick. Viele hundert Meter unter ihm breitete sich ein weites, lang gestrecktes Tal aus, eine Kulturlandschaft mit Feldern und Weingärten und dunklen Waldstücken am Horizont – und in der Mitte der Ebro. Die Dörfer auf den Hügelkuppen, verbunden durch Landstraßen und helle, sandige Wege, waren gut auszumachen. Eine Eisenbahnstrecke schlängelte sich am Flussufer entlang, mal sichtbar, mal verborgen hinter Galeriewäldern. Und die andere Seite des Tals begrenzte die Sierra Cebollera mit knapp 2000 Metern. Dort entsprang der Rio Duero, der dem Ribera del Duero, einem berühmten Wein, als Herkunftsbezeichnung diente.
Atemberaubend war dieser Anblick, überraschend, faszinierend die Weite des Tals. Henry hatte die Rioja gänzlich anders in Erinnerung. Beim letzten Besuch war er von Süden gekommen, hatte die Autobahn über Zaragoza genommen und war dem Lauf des Ebro flussaufwärts gefolgt. Es war März gewesen, windig, knochentrocken und eisig kalt. Er hatte die falsche Kleidung eingepackt gehabt und entsetzlich gefroren. Trocken war es jetzt auch, aber zumindest die Weinberge und Bäume waren so grün wie die Auen am Ebro.
Henry stellte den Motor ab, stieg aus, lehnte sich an den Wagen und betrachtete die Landschaft. Er hörte den Wind in den Bäumen, sah Vögel unter sich kreisen und genoss die roten Strahlen der Abendsonne, die sich rechts auf das Gebirge legten.
Er freute sich auf diese Reportage. Der Sachverhalt, um den es ging, war leicht zu durchschauen, die Fronten schienen geklärt. Er machte diese Berichterstattung ein wenig aus Sympathie gegenüber der Kooperative, die vor zwei Jahren gegründet worden war. Ihm gefielen Gemeinschaftsprojekte, und es sollte endlich mal wieder eine Story nach seinem Geschmack werden: kein stromlinienförmiger Bericht über ein aufstrebendes Weingut, das jeder Weinliebhaber kennen sollte, dessen Weine aber nur für wenige erschwinglich waren. Der Gefälligkeitsjournalismus, der immer auf die Anzeigenkunden schielte, hing ihm zum Halse raus. Es würde endlich wieder eine Reportage werden, wie er sie früher geschrieben hatte: direkt, klar, informativ und bissig.
Ihm wurde klar, weshalb er sich so entspannt fühlte. Die Redaktion war weit weg. Keine Debatten über Chefredakteure, keine diplomatischen Verrenkungen, keine Mauscheleien, kein plötzliches Schweigen, wenn der Falsche auf den Flur der Redaktion trat und zwei Kollegen im Gespräch entdeckte. Niemand würde hier über die Zukunft des Blattes spekulieren. ›Wein & Terroir‹ ging es finanziell gut, das Anzeigenaufkommen stieg, wie auch die Leserschaft. Niemand sägte an seinen Stuhlbeinen, er musste nicht auf jedes Wort achten, sich nicht ständig kontrollieren oder der Geschäftsleitung beweisen, dass er der geeignete Mann für den Chefsessel war. Niemand wusste besser als er selbst, dass er sich nicht dazu eignete, aber das durfte er niemals offen zugeben! Man war zur Karriere verdammt. Wer sich zufrieden gab, zeigte mangelndes Interesse. Nur die Bissigen wurden gebraucht, und mit wem es nicht aufwärts ging, mit dem ging es abwärts.
Henry hörte hinter sich einige Wagen vorbeikommen, er schaute ihnen nach, sah die Bremslichter aufleuchten, unten, wo die Straße sich dem Tal zuneigte. Weiter links, ganz unten, blinkte etwas, er sah den rötlichen Reflex auf einem Felsvorsprung. Zuerst hatte er es für den Widerschein von Rücklichtern gehalten, dann für den rötlichen Schimmer des Abendrots auf einem glatten Felsen, aber dann fiel ihm auf, dass das rötliche Licht in regelmäßigem Abstand über die Felsen strich. Er bekam Hunger und beschloss weiterzufahren. Außerdem wollte er nicht zu spät ins Hotel kommen – hoffentlich wurde die Reservierung lange genug aufrecht gehalten. Er ließ den Motor an, bemerkte im Rückspiegel einen Lkw und gab Gas, um nicht die gesamte Bergstrecke im Dieselqualm hinter ihm herschleichen zu müssen. Die Reifen drehten durch, aber er kam noch vor dem großen Fahrzeug weg.
An der schrägen Felswand hielt sich nur spärliche Vegetation. Verkrüppelte Bäume wuchsen aus Felsspalten, trockener Ginster, Steineichen und Kiefern gediehen auf weniger geneigten Flächen. Zypressen wechselten sich mit Agaven ab, deren meterhohe Blütenstände langsam vertrockneten. Dann begannen die Serpentinen. Die Straße war zwar gut, doch die Haarnadelkurven zwangen Henry dazu, bis in den ersten Gang hinunterzuschalten. Als er dort oben gestanden hatte, war ihm nicht aufgefallen, dass nicht ein einziges Fahrzeug heraufgekommen war, doch jetzt bemerkte er, dass jeglicher Gegenverkehr fehlte. Diese Straße war zwar nicht die schnellste, aber zumindest die kürzeste Verbindung zwischen Logroño, der Provinzhauptstadt von La Rioja, und Vitoria-Gasteiz als Hauptstadt der Provinz Álava. Also musste es – da war doch nichts passiert? Das würde ihm gerade noch fehlen, wenn er jetzt hier oben am Berg festsitzen würde, den Lkw im Nacken. Der war so dicht aufgefahren, dass Henry sogar den Schnurrbart des Fahrers erkennen konnte.
Wieder blitzte es unten rot auf; jetzt kam auch noch ein blauer Reflex dazu, der verdächtig an ein Blaulicht der Polizei erinnerte. Das Ende des Staus lag hinter einer Art Felsentor, zwei gewaltigen Blöcken, die sich oben aus der Felswand gelöst hatten und hier liegen geblieben waren. Henry fluchte, fuhr so weit nach rechts, wie es die Leitplanke zuließ, neben der es steil abwärts ging, und stellte den Motor ab, wie auch die Fahrer vor ihm. Der Lastwagen hing an seiner Stoßstange und nahm dabei fast die gesamte Breite der ohnehin schmalen Straße ein. Eine Unverschämtheit. Was sich hinter dem Lkw abspielte, konnte Henry wegen des breiten Aufbaus nicht sehen. Zum Wenden war es zu spät, an dem Zehntonner kam er unmöglich vorbei; der Fahrer hatte sich so idiotisch hingestellt, dass auch der Gegenverkehr kaum passieren konnte.
Es musste sich um einen schweren Unfall handeln, denn zu den beiden rotierenden Lichtern gesellte sich jetzt ein drittes, und unten am Fuß der Sierra, wo die Straße auslief, war weiteres Blaulicht im Anmarsch und blockierte den Zugang zur Passstraße. Wieso hatten sie die Straße nicht oben kurz hinter Urizaharra oder Peñacerrada gesperrt? Dann hätte er abbiegen können und sich die Warterei erspart.
Nachdem Henry die Straßenkarte mühsam wieder zusammengefaltet hatte, stieg er aus, um sich die Beine zu vertreten. Er warf einen Blick über die Leitplanke – und fuhr erschrocken zurück. Es ging senkrecht in die Tiefe. Henry spürte sofort das entsetzliche Ziehen im Bauch, es zog ihn förmlich nach unten, und er machte einen raschen Schritt zurück. Seine Höhenangst hatte er bislang stets mit Erfolg überspielt und sich eine Sammlung von Ausreden angelegt, um sich elegant von jedem Abhang zurückzuziehen. Er sah sich nach dem Lastwagenfahrer um. Der saß auf der Leitplanke über dem Abhang und rauchte eine Zigarette.
»Wissen Sie, was da vorn passiert ist?«, fragte Henry laut, als ihm einfiel, dass der Fahrer das so wenig wissen konnte wie er, außer er besaß CB-Funk. Aber wenn er den abgehört hätte, wäre er kaum in den Stau gefahren.
»Da passiert alle naselang was, die Leute fahren wie die Bekloppten. Sie lieben es zu sterben. Was glaubst du, in welchen Situationen ich überholt werde, nur um eine Minute früher zu Hause zu sein, und dabei kommt man am Ende nie an …«
Henry zuckte, als er das vertrauliche Du hörte. Diese Distanzlosigkeit störte ihn, und er musste sich erst wieder daran gewöhnen. Er hob zustimmend die Hand und wandte sich ab. Ihm fehlte der Nerv, sich die Ansichten eines Lastwagenfahrers über den Straßenverkehr anzuhören. Die Straße, die er entlang der Autoschlange bergab schlenderte, führte in einer scharfen Linkskurve durch das Felsentor. Etwa einhundert Meter dahinter war der Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, unglücklicherweise genau an jener Stelle, an der die Leitplanke fehlte. Schicksal? Zufall? Eine negative Fügung, oder war alles vorbestimmt?
Der Wagen hatte sich auf dem schrägen Hang mehrmals überschlagen, hatte dabei eine Spur wie ein Pflug hinterlassen und war zuletzt von kräftigen Büschen aufgefangen worden. Wo war der Fahrer …?
Weiter vorn bei den rotierenden Lichtern stand der Notarztwagen. Schaulustige sahen den Feuerwehrleuten und dem Notarzt zu, die sich am Hang abgeseilt hatten und an einem leblosen Körper hantierten. Wahrscheinlich war der Fahrer aus dem Wagen geschleudert worden. Am Straßenrand kommentierte eine Gruppe von Autofahrern das Geschehen. Die Männer machten auf Henry einen merkwürdig unbeteiligten Eindruck.
»Da ist jemand abgestürzt, in der Kurve …«, sagte Henry, um ein Gespräch zu beginnen.
»Wo sonst«, meinte einer der Männer lakonisch. »Hier gibt’s ja nichts anderes als Kurven.«
»Der Fahrer hat gepennt«, meinte ein anderer. »Der Wagen ist außer Kontrolle geraten.«
»Der war zu schnell oder abgefahrene Reifen. Da rutscht man sonst wohin. Qué mala suerte, so ein Pech auch, dass genau da die Leitplanke aufhört.«
»Die hätte dem auch nicht geholfen, schau dir bloß an, wie verrostet die anderen sind.«
»Mitnichten, mein Freund, das ist letztes Jahr alles erst erneuert worden. Man muss die Regierung nicht schlechter machen, als sie ist. Ich arbeite bei der Verwaltung, ich weiß das genau.«
»Perdona, aber weshalb fehlt dann das Stück, wo der Wagen abgestürzt ist?«, wollte eine junge Frau wissen, die sich ihre langen, schwarzen, vom Wind durcheinander gewehten Locken aus dem Gesicht strich.
»Vielleicht hat ihnen genau das Stück gefehlt, vielleicht wollten sie Feierabend machen und haben das letzte Stück nicht angeschraubt, so was gibt’s!«, meinte einer der wartenden Fahrer.
»Completamente absurdo«, meinte ein dritter, »die dachten, dass hier nichts mehr passiert, am Ausgang der Kurve.«
»Wer soll das gedacht haben?«, fragte die Schwarzhaarige, und Henry betrachtete sie genauer. Eine gut aussehende Frau.
»Na, die Arbeiter eben, die das gebaut haben.«
»Aber das sieht man doch«, sagte die Frau, »dass die Kurve nicht zu Ende ist, da ist der Wagen ja erst drei Viertel durch. Außerdem treffen Ingenieure diese Entscheidungen und nicht die Arbeiter.« Die Weise, in der sie es sagte, ließ keine Widerrede zu. Sie beugte sich über ihre weiße Lederhandtasche und kramte darin herum. Nach einer Weile zog sie eine Zigarette aus der Schachtel und zündete sie mit einem goldenen Feuerzeug an. Dabei blitzten die vielen Ringe an ihren Fingern. Als sie den ersten Zug nahm, trafen sich ihre Augen. Henry atmete tief durch …
Der Arzt und die Feuerwehrleute waren bei dem leblosen Körper angelangt, und aus den Handzeichen, die sie ihren Kollegen nach oben gaben, wurde deutlich, dass da nichts mehr zu machen war. Kurz darauf wurde eine Wanne nach unten gelassen, und die drei Feuerwehrleute bargen den Toten.
Die junge Frau schien die Einzige zu sein, die der Unfall zu einer emotionalen Reaktion veranlasste, zumindest beobachtete sie das Geschehen am Hang mit Interesse und knetete nervös ihre Hände. Henry beobachtete sie aufmerksam; sie gefiel ihm (viel zu jung für mich, dachte er), und er fragte sich, ob die Ringe nicht störten beim Kochen, Saubermachen oder Tippen. Eine Intellektuelle hatte er bestimmt nicht vor sich, eher den Typ, der zupackte, aber das verhinderten wohl die Ringe.
Sie fing seinen Blick auf, als sie sich die Lippen nachzog und über den Rand ihres goldenen Handspiegels schaute. Es war ihr aufgefallen, dass sie beobachtet wurde, und sie sah Henry geradeheraus an. Was willst du von mir?, schien sie zu fragen. Er hielt ihrem Blick stand. Zuerst war er überrascht, dann wurde daraus Neugier und zuletzt eine Art unbewusstes Kräftemessen; wer zuerst wegsah, hatte verloren oder zu wenig Interesse. Henry musste grinsen, und auch ihr huschte ein Lächeln übers Gesicht. Unwillkürlich rückte sie von der Gruppe ab, was als Aufforderung verstanden werden konnte, ihr ein wenig näher zu kommen.
Henry trat auf sie zu, gespielt absichtslos, als suche er Gesellschaft, aber keinesfalls die der Frau allein, nein, wie konnte nur jemand auf diese Idee kommen? Er mit Anfang vierzig und sie mit Ende zwanzig? Niemals. Am Ende stand er neben ihr und sah der Bergungsmannschaft zu.
»Wie schrecklich, nicht wahr?«
»Sí, realmente.«
Die Wanne mit der Leiche war oben angekommen, und Uniformierte beugten sich über den Toten. Ein weiterer Mann mit einem Drahtseil und einer Werkzeugkiste ließ sich jetzt hinunter, um das Auto vor dem Abrutschen zu sichern. Der Kranwagen kam in Sicht, hielt weiter unten. Inzwischen war auch die Guardia Civil eingetroffen, die mit ihren Geländefahrzeugen mehr an Paramilitärs als an eine zivile Polizei erinnerte.
»Trifft es eigentlich immer die Falschen?«, hörte Henry die junge Frau neben sich murmeln und wandte sich ihr zu:
»Was meinen Sie?«
»Ach nichts, ich habe nur laut gedacht«, sagte sie, ohne ihn anzusehen. »Ich frage mich nur, warum und wann es einen erwischt. Irgendwann auch uns, oder?« Jetzt blickte sie lächelnd zur Seite.
»Wir haben Zeit«, antwortete Henry, falls sie vom Tod sprach, und nicht von dem, was ihn viel mehr bewegte. »Sie bestimmt deutlich mehr als ich.«
»Woher willst du das wissen? So alt bist du doch gar nicht, dass du das Kokettieren nötig hättest.« Dabei musterte sie Henry von Kopf bis Fuß. Diese Frau erregte ihn, ihm wurde fast ein wenig flau. Wer war sie? Spielte sie? Waren die verzögerten Bewegungen echt, war die Handbewegung, mit der sie auf die Rettungsmannschaft zeigte, nun lasziv oder provokant? Störte sie der Wind im Haar tatsächlich oder wollte sie damit nur Interesse erregen? Und wenn, egal, er hatte Lust auf ein Spiel und sei es auch eins mit dem Feuer.
Die Männer aus der Runde rochen den Konkurrenten, knurrten, fletschten die Zähne, giftig, dass ihre Versuche gescheitert und sie abgemeldet waren.
»Hola, Victoria, ich glaube, das da unten ist der Wagen von Raúl.« Es war ein Versuch von dem Längsten aus der Runde, sie mit einem Appell an irgendeine Gemeinsamkeit zurückzugewinnen.
»Längst gesehen«, antwortete sie schnippisch und wandte sich ganz Henry zu. »Du bist nicht von hier, ¿verdad?«
»Das ist nicht schwer zu erraten. Aber woran haben Sie es bemerkt, an meiner Sprache, meinem Aussehen oder meiner Kleidung?« Und schon waren sie im Gespräch …
»Ich habe dich noch nie gesehen, und hier kennt jeder jeden, die Rioja ist leicht überschaubar. An der Sprache merkt man es natürlich auch. Wenn der südamerikanische Akzent nicht wäre, würde ich auf Nordeuropa tippen. Schweizer vielleicht, Belgier? Jetzt bin ich ganz verwirrt«, sagte sie und lächelte gewinnend. Damit war klar, dass sie sich auf das Spiel eingelassen hatte.
»Deutschland«, sagte er, holte Luft, um noch anzufügen, aus welcher Stadt und ob sie die kenne, aber es war interessanter, Fragen zu stellen, denn wer fragte, bestimmte den Verlauf des Gesprächs.
»Wann glauben Sie, dass es weitergeht, Señora?«
»Schwer zu sagen. Ich fahre hier häufig lang, bestimmt einmal die Woche, zu meiner Schwägerin. Sie hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, einmal jede Woche nehme ich ihr die Kinder ab, dann hat sie frei. Felipe ist erst jetzt in die Schule gekommen …«
»So alt ist der schon«, mischte sich der Lange wieder ein. Er konnte nicht aufgeben oder wollte es den anderen zeigen. »Ich dachte, Victoria, er ist erst vier, höchstens fünf …«
Victoria drängte Henry unauffällig ein wenig zur Seite. »Es ist schrecklich, hier herumzustehen und nicht zu wissen, wann es weitergeht. Wo steht dein Wagen?«
Henry wies auf das Felsentor. »Gleich dahinter, eingekeilt. Ein Lkw blockiert die Fahrbahn, ich kann nicht wenden. Dabei hätte man eine andere Strecke nehmen können …«
»Ja, über Labastida und Haro und von dort zur Autobahn nach Logroño. Na ja, jetzt ist es zu spät.« Victoria deutete nach rechts auf eine Ansammlung von Häusern in der Ferne. »Das ist Labastida, und dahinter liegt Haro mit seinen alten, bekannten Kellereien: Rioja Alta, Bodegas C. V.N.E. und López Heredia. Das sind die Klassiker. Früher war Haro die wichtigste Stadt für die Weine der Rioja.«
»Und welche ist es heute?« Henry fragte sich, ob sie wohl auch im Weingeschäft tätig war.
»Heute ist alles anders, es hat sich verteilt. Wo musst du hin? Ist es noch weit?«
»Nein, nur nach Laguardia.« Henry wies mit dem Kopf nach links, wo eine kleine mittelalterliche Stadt auf einem Hügel das Land zwischen Sierra und Fluss beherrschte. Laguardia schien so nah, dass man die Zufahrtsstraßen und die Stadttore erkennen konnte, und am Burghügel zogen sich die Weingärten hinauf. »Ich habe im Villa de Laguardia ein Zimmer reserviert. Und – wo willst du hin?« Das Du kam ihm schwer über die Lippen.
»Ich lebe in Logroño, ich habe da ein Appartement. Das Leben auf dem Land ist langweilig, jeder kennt jeden …«, sie verdrehte ihre ausdrucksvollen dunklen Augen, »… es sind nur ein paar Kilometer, die Stadt liegt hinter dem Hügel, man kann nur ihren Lichtschein sehen. Warst du schon einmal dort?«
Mehr als das hatte Henry nicht über sie in Erfahrung bringen können. Kaum hatte er das Wort Reporter ausgesprochen, war sie zurückgeschreckt, als hafte diesem Beruf etwas Anrüchiges an. Obwohl er bei ihr mehr als Sympathie zu spüren meinte, war es ihm nicht gelungen, Victoria für eine Verabredung zu gewinnen oder herauszufinden, womit sie ihr Geld verdiente oder wo sie arbeitete – keine Telefonnummer, keine Adresse. Hätte sie sich mit ihm verabredet, wenn die Männerrunde nicht alles mitbekommen hätte? Unter den Ringen an ihren Händen war nicht einer ohne Stein, also war sie zumindest nicht verheiratet, was ihn verwunderte, aber Spanien hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr gewandelt, auch die Frauen. Vieles gaben sie zugunsten eines Berufs auf, zugunsten von Freizeit und Vergnügen.
Vermutlich verstand sie einiges vom Wein, die Begriffe, die sie verwendet hatte, als sie über das Land unter ihnen sprachen, ließen darauf schließen. Wer vom Weinbau keine Ahnung hatte, wusste nichts von den unterschiedlichen Reifezyklen der hier angebauten Rebsorten, geschweige denn von aktuellen Traubenpreisen. Andererseits hatten die meisten Menschen in der Rioja von jeher eine starke Affinität zum Wein, einen Großvater, der ihn anbaute, einen Schwager in der Exportabteilung einer Kellerei oder eine Freundin, die zumindest mit einem Kellermeister verheiratet war. Aber Victoria hatte sich bedeckt gehalten und aufmerksam die Bergung des Toten verfolgt.
Es war völlig dunkel, als der Stau sich auflöste und Henry endlich die Unfallstelle passieren konnte, den Lastwagen noch immer gefährlich im Nacken. Ein Polizist winkte schwungvoll den Verkehr vorbei, der neben ihm abgestellte Wagen trug die Aufschrift ERTZAINTZA. War es den Basken so wichtig, dass ihre Polizeiwagen die Aufschrift in ihrer Sprache trugen? Der Wagen daneben, ein Geländefahrzeug der Guardia Civil, war wie üblich grün und weiß gestrichen. Ein Uniformierter mit Schirmmütze auf dem Kopf stand regungslos davor. Misstrauisch und als würde er die Nase rümpfen, musterte er Henry und blickte mit gesenktem Kopf in den Wagen. Dann war die Straße endlich frei.
Victoria hatte eine Viertelstunde vor ihm den Schauplatz des Dramas verlassen, und er hoffte, dass man seine Reservierung aufrechterhalten hatte, obwohl die Garantie für das Zimmer nur bis um 20 Uhr galt. Zu allem Unglück begann der Wagen zu rucken. Der Motor stotterte, als bekäme er zu wenig Benzin, oder lag es an der Zündung? Der Leihwagen hatte noch keine 10000 Kilometer auf dem Tacho. Knappe fünfzehn Minuten später erreichte Henry Laguardia.
Die Straße führte links am Ort vorbei; rechts tauchte hinter einer Kreuzung eine Tankstelle mit Werkstatt auf, ein bisschen weiter weg lag das Hotel am Ortseingang. Der Empfangschef entschuldigte sich, aber alles Reden nutzte nichts, Henry war zu spät, sein Zimmer anderweitig vergeben. Man sei mitten in der Weinlese, und ein anderes war in diesem Haus heute nicht zu bekommen. Morgen könne er gern wieder vorbeischauen, die Reservierung gelte ja für eine Woche. Man sah sich außerstande, ihm bei der Suche nach einer anderen Unterkunft behilflich zu sein, und schickte Henry nach Logroño. Das sei nicht weit, und dort fände sich immer etwas, meinte der Empfangschef.
Henry war es völlig egal, welche Art von Hotel er heute finden würde, die Hauptsache war ein sauberes Bett, möglichst in der Nähe, eine Dusche und kein Lärm.
»Da habe ich eventuell was für dich, in dieser Jahreszeit könnte es allerdings schwierig werden, die Weinfreaks kommen nämlich immer zur Lese in die Rioja. Dabei stören sie nur, und in den Bodegas kann sich kein Schwein um sie kümmern, niemand hat Zeit«, meinte der Tankwart, der sich über den Motor von Henrys Wagen beugte. »Eine Verwandte hat oben ein Hostal. Mir gefällt’s, Biazteri heißt es, in der Calle Mayor, gegenüber vom Konvent der Kapuziner. Da kommst du sogar mit dem Wagen hin – den musst du allerdings hier lassen, ich kümmere mich darum.«
»Jetzt, um diese Zeit?«, fragte Henry verblüfft.
»Wieso nicht? Ich arbeite gern in der Nacht, da habe ich meine Ruhe. Ich rufe mal oben an, ob sie …«
Sie hatten ein Zimmer frei, das Doppelzimmer konnte Henry sogar zum halben Preis bekommen, da er es ja allein benutzte – oder habe er noch jemanden bei sich?, fragte der Monteur augenzwinkernd über die Schulter. Henry dachte an Victoria und winkte ab.
»Kannst meinen Wagen nehmen, um dein Gepäck raufzubringen, aber du musst ihn wieder herbringen. Du kriegst oben wahrscheinlich keinen Parkplatz, aber kurz abstellen kannst du ihn auf jeden Fall. Da macht niemand Theater.«
Henry lud sein Gepäck und die Aktentasche mit den Arbeitsunterlagen und dem Recorder in den kleinen Seat des Mechanikers und fuhr durch die Weinberge hinauf. Die Straße war so angelegt, dass man jeden ungewollten Besucher mit einem Hagel von Steinen hätte eindecken können. Zuletzt stand Henry vor einem Tor der alten Umfassungsmauer, in die mehrere Karlistenkriege Breschen und später der Fortschritt Fenster hineingeschlagen hatten. Die Mauer war wuchtig und mindestens zwei Stockwerke hoch. Viereckige Laternen verbreiteten ein schummeriges Licht. Fast unheimlich wirkte das Städtchen.
Er fuhr durch einen der Rundbögen und stellte den Wagen direkt dahinter neben der Iglesia San Juan ab. Es war Millimeterarbeit, in der schwarzen Nische zwischen zwei Stützpfeilern der Kirche zu rangieren; die weichen Schatten unterschieden sich kaum von den harten Mauern.
In der nächtlichen Stille wirkte Laguardia wie aus der Wirklichkeit herausgelöst. Laut hallten die Schritte in den schmalen Gassen zwischen hohen Häusern aus alten Sandsteinquadern. Dunkle Nischen neben wuchtigen Holztüren, niedrige Tore in glatten Mauern, selten von einer Palme überragt. Schmale Fenster und Vorsprünge, davor kleinen Balkone mit schmiedeeisernen Gittern.
Das Verbot von Autos und Mopeds verstärkte das Gefühl, sich durch eine Traumwelt zu bewegen, zurück in ein Spanien, das es längst nicht mehr gab. Der Hall seiner Schritte, das Echo in den gepflasterten Gassen, erinnerte Henry an das Händeklatschen von Musikern, die einen Flamencotänzer begleiteten, dessen Absätze in trockenem Stakkato auf den Boden knallten.
Es waren nur wenige Schritte zum Hostal, einmal nach rechts, einmal nach links, einige Stufen hinab, es lag genau an einer Ecke. Man gelangte von der Calle Mayor ins Restaurant und durch einen zweiten Eingang in die Bar mit Rockmusik, Stimmengewirr und Zigarettenqualm. Der Junge hinter dem Tresen schickte ihn nach hinten ins Restaurant, wo die Hotelbesitzerin ihn empfing und sich entschuldigte, dass sie ihm nicht den Komfort eines 4-Sterne-Hotels bieten könne. Dafür gab es zwei weitere Zugänge, die in einem schmalen Durchgang mündeten, der die Calle Mayor mit der parallel dazu verlaufenden Calle Paganos verband. Ein wahrer Fuchsbau. Das gefiel Henry, man verschwand in einem Eingang, durchquerte die obere Etage, stieg eine andere Treppe wieder hinab, kaum auf dem Hof heraus und durch einen Gang auf die nächste Straße.
Das Zimmer war schlicht und bequem, nur ein Kühlschrank fehlte, aber es gab ja die Bar unten. Als Henry seinen Koffer auf die Ablage gelegt hatte, zog er die Jalousie auf. Keine zwei Meter von seinem Fenster lag das nächste Haus; die Balkontür stand offen, im Zimmer dahinter saß eine Familie beim Essen. Ein bisschen zu intim, zu viel Nähe vielleicht, aber die Familie grüßte freundlich herüber, Henry wünschte guten Appetit und bekam Hunger.
Die Chefin versprach, ihm trotz der vorgerückten Stunde noch etwas zu essen zu machen, wenn er von der Tankstelle wieder heraufkäme, aber nur, weil er ein Freund von Daniel sei. Henry nahm an, dass das der Mechaniker war. Wenig später war er wieder an der Tankstelle und dankte dem Tankwart. Er hatte richtig geraten, es war der Name des Mannes, der gerade die Benzinleitung wieder einbaute.
»Was willst du eigentlich hier?«, fragte dieser und wischte sich mit der öligen Hand den Schweiß von der Stirn. »Bist kein Tourist, oder?«
»Nein, Reporter, ich schreibe über Kooperativen.«
»Und über welche? Wir haben eine Menge hier.«
»Sie ist neu, erst vorletztes Jahr gegründet worden.«
»Dann kann es sich nur um LAGAR handeln.«
»So ist es«, antwortete Henry. »Morgen früh treffe ich den Önologen Jaime Toledo.«
Daniel ließ die Motorhaube herunterkrachen, richtete sich auf und blickte Henry ernst an. »Na, viel Spaß dabei.« Er lachte. »Viele Freunde wirst du dir dabei nicht machen …«
Dann nahm er einen Lappen und wischte sich die Hände ab.
2.Jaime Toledo
»Sie wollen LAGAR fertig machen! Nur einige Beispiele: Wer uns Baumaterial liefert, kommt auf die schwarze Liste. Wer für uns arbeitet, kriegt von ihnen keine Aufträge mehr, egal ob Elektriker oder Installateur. Jetzt haben wir Ärger mit der Bank, das ist ein offenes Geheimnis. Und mich würden sie am liebsten aus dem Weg räumen. Weißt du, wie sie mich nennen? El cabecilla, den Rädelsführer. Eigentlich könnte ich stolz darauf sein. Dass die Sache mal so ausgeht, hätte ich nicht gedacht.«
Jaime Toledo war sichtlich um Fassung bemüht. Er biss die Zähne zusammen, wobei seine Wangenknochen in dem ohnehin mageren Gesicht noch deutlicher hervortraten. Seine Augen waren zusammengekniffen, und Henry fragte sich, ob es an seiner augenblicklichen Verfassung lag oder ob er kurzsichtig war, denn vor ihm auf den Kacheln des Labortisches lag eine Brille. Der Önologe wirkte übernächtigt und gehetzt.
»In der Rioja Alavesa wirst du davon kein Wort hören«, fuhr er fort. »Bueno, die Trauben unserer Mitglieder wollen sie haben. Noch lieber wären ihnen unsere Weinberge. Wovon die Weinbauern dann leben, interessiert sie ’n Dreck. Aber wir brauchen die Trauben für unsere Produktion. Andererseits – die Preise sind hoch, hundertdreißigtausend Euro gibt’s pro Hektar. Das reizt einige, claro. Unsere Weinberge sind hervorragend, exzellente Böden, locker, kaum noch Rückstände von Spritzmitteln. Die meisten Weinstöcke haben genau das richtige Alter, mit sehr gehaltvollen Trauben, ¿comprendes?, bei guten Erträgen, nicht wie sonst bei alten Rebstöcken. Dafür sind die Trauben kleiner, die Schalen dicker, der Extrakt an Farbe und Geschmack dadurch höher …« Es klopfte, Toledo drehte sich um: »¿Sí? ¡Adelante!«
Ein Arbeiter streckte den Kopf zur Tür herein: »Jaime, Ramón ist da, mit den Trauben, Ramón Perelló, draußen, mit einem Hänger Tempranillo.«
Unwillig sprang der Önologe von seinem Barhocker, der ihm als Sitzgelegenheit diente. »Der sollte doch erst morgen kommen. Ich hatte ihm gesagt, er soll erst morgen lesen! Hört denn hier keiner mehr zu?« Ärgerlich warf er einen Stapel Listen mitten zwischen die Pipetten, Reagenzgläser und Messgeräte, hinter denen sich in heillosem Durcheinander beschriftete Plastikschüsseln mit Trauben stapelten. »Me cago en Dios … nie kann man hier was zu Ende machen, immer kommt einer, der irgendetwas will. Un momento, por favor.«
»Soll ich ein andermal wiederkommen?«, fragte Henry.
»Ach, das ändert auch nichts.« Toledo griff sich fahrig ins lange, glatte Haar, setzte die Brille auf und ging zur Tür. »Es ist einfach zu viel, der Lesebetrieb und gleichzeitig sind wir in der letzten Phase beim Bau der Kellerei.« Er winkte müde im Hinausgehen, ohne sich umzusehen.
Total überfordert, dachte Henry; anscheinend zu viel Arbeit, die gesamte Verantwortung für die Kooperative, dann die Bedrohung, von der er eben gesprochen hatte, und Streit in den eigenen Reihen. Er musste sich während der Lese um viele unterschiedliche Weinberge in gänzlich verschiedenen Lagen kümmern, wie er erzählt hatte. Eine falsche chemische Analyse konnte den gesamten Jahrgang verderben. Und dann die Mitglieder von LAGAR, von denen jeder seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte, und zusätzlich war ihm auch noch die Bauleitung der Kellerei in die Hände gelegt worden.
Jaime Toledo machte einen kompetenten Eindruck, wie Henry nach dem kurzen Gespräch befand. Der Önologe, Fachmann für Weinbau und Kellerwirtschaft, den er bis vor einer Stunde lediglich vom Telefon her gekannt hatte, wirkte sehr routiniert und war gut ausgebildet. Er hatte in Bordeaux studiert und mit vierunddreißig Jahren bereits zehn Jahre praktische Erfahrung gesammelt, zum einen bei Bodegas hier in der Rioja Alavesa, die zum Baskenland gehörte, zum anderen bei einer Kellerei in Rioja Alta, drüben auf der anderen Seite des Ebro und im Penedès. Er selbst stammte aus Rioja Baja, aus Calahorra, dem östlichsten und auch wärmsten Teil dieser D.O., der denominación de origen, wie man die spanischen Herkunftsgebiete nannte. Nur bei der Rioja war an das Kürzel D.O. noch ein »Ca« gehängt worden, was so viel wie »qualifiziert« bedeutete und die Besonderheit der Weine unterstrich.
Jemanden ohne Toledos Begabung und Wissen und ohne entsprechende Durchsetzungskraft hätten die zwanzig Gesellschafter der Kooperative LAGAR niemals zu ihrem Önologen und Geschäftsführer gemacht. Also musste er auch über diplomatisches Geschick verfügen, um zwanzig cooperativistas bei Laune und in Schach zu halten.
Henry hätte nicht mit ihm tauschen wollen, nicht einen Tag. Es würde noch schwieriger werden, wenn sie mit ihren Weinen auf den Markt gingen, denn bis heute war nicht ein einziger Jahrgang fertig; der erste reifte gerade in den Kellern, und der größte Teil des neuen Jahrgangs hing wohl noch als Traube an den Rebstöcken.
Jaime Toledo hatte bis jetzt keine Zeit gefunden, ihm den Betrieb vorzuführen. Und in Bezug auf die Drohungen und Anfeindungen war sich der Önologe bislang nur in Andeutungen ergangen. Henry durfte ihn nicht drängen, es musste sich erst ein vertrauensvolles Verhältnis einstellen, bevor Toledo heikle Fragen beantworten würde. Er hatte ihm nicht einmal gesagt, wer den Aufbau von LAGAR behinderte, wer sie »fertigmachen« oder ihn aus dem Weg haben wollte.
Die Gründe dafür konnte er sich denken, es war eigentlich immer dasselbe: Konkurrenz, Absatzmärkte, Streit um Kunden oder Lieferanten, Betriebsspionage, abgeworbene Mitarbeiter, Einflussgebiete und persönliche Eitelkeiten. Es war etwas handfester, anders als der zermürbende Kleinkrieg in der Redaktion, die Ungewissheit über den zukünftigen Weg von ›Wein & Terroir‹. Allerdings war es einfacher, etwas im Aufbau Befindliches zu zerstören, als einen funktionierenden Apparat zum Stillstand zu bringen, dessen Menschen aufeinander eingespielt waren. Eine junge Pflanze ließ sich leichter ausreißen als ein tief verwurzelter Weinstock.
Atemlos kam Toledo mit einer neuen Plastikschale voller Trauben zurück und machte sich sofort an die Analyse ihres Säurewerts und des Zuckergehaltes. Auch die physische Reife musste geprüft werden, die Farbwerte und der Extrakt. Danach war der pH-Wert dran – wichtig für die Beurteilung der chemischen Vorgänge, insbesondere der Wirksamkeit der Enzyme, was sich auf den Geschmack des Weins auswirkte.
»Sollen wir lieber ins Dorf fahren und erst mal einen Kaffee trinken«, fragte Henry, um den Önologen abzulenken.
»Unmöglich! Ich kann hier keine Minute weg. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Am besten, du weichst mir nicht von der Seite, irgendwann finden wir Gelegenheit zum Reden, so wie jetzt. Wir müssen eine finden. Die Situation verschärft sich von Tag zu Tag. Außerdem wird der Wein dann reif, wann er will.«
»… Chemiker werden auch das eines Tages hinkriegen«, unterbrach Henry.
»Ach, wie beim Gemüseanbau in Andalusien an der Küste? Weinanbau unter Plastikplanen? Drei Ernten pro Jahr? Schon möglich, irgendwann, aber das ist momentan nicht unser Problem.« Der Önologe schaltete sein Handy ab und legte es vor sich auf die Kacheln.
Henry fand ein Stück Pappe, das er als Unterlage verwenden konnte, um sich auf den Tisch zu setzen, denn die Kacheln waren kalt. »Wie bist du eigentlich auf mich gekommen? Es gibt viele Weinjournalisten und auch entsprechend viele Zeitschriften.«
»Ganz einfach.« Toledo leckte an einem Kugelschreiber, der nicht schrieb. »Ich habe in Bordeaux diesen Gaston Latroye kennen gelernt, einen Winzer aus St.-Émilion. Der hatte einen deutschen Freund, Bongers, Michael oder Martin mit Vornamen, aus Frankfurt. Ich bin mal da gewesen, als dieser Weinhändler zu Besuch war, ein sympathischer Kerl. Als bei uns die Schwierigkeiten anfingen, habe ich gedacht, wir müssten die Öffentlichkeit darüber informieren. Man sät Zwietracht, man gräbt uns das Wasser beziehungsweise jetzt auch das Geld ab – ich erkläre dir das später im Detail, und du kriegst auch die entsprechenden Dokumente. Hier bei uns wirst du kaum einen Journalisten finden, der darüber schreibt, vor allem niemanden aus dem Weinbereich. Die meisten haben Aktien in den Bodegas, kriegen ihr Weindeputat, werden eingeladen; man stopft ihnen den Mund – mit leckeren Sachen, ¿comprendes? Es kann also nur übers Ausland laufen, habe ich gedacht, damit es zurückschlägt und unsere Presse aufmerksam wird. In dem Zusammenhang habe ich mich an diesen Bongers erinnert.«
»Ist die Sache wirklich so brisant?« Henry überlegte bereits, wie er der Redaktionskonferenz die Reportage verkaufen konnte, damit sie überhaupt ins Blatt kam. Auch zu Hause wollte sich niemand die Anzeigenkunden vergraulen.
»Sie ist brisant, ja, es geht um eine neue Qualität in den Auseinandersetzungen. Du kennst den Spruch, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist? Und ich sage dir: Wirtschaft heute ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Die Methoden, die hier in unserem Fall angewendet werden, sind meines Erachtens illegal.«
»Wieso geht ihr nicht vor Gericht?«
»Bring du mal zwanzig Leute zu einer gemeinsamen Entscheidung. Genau da liegt ein Teil des … Verdammt, was ist denn jetzt wieder los? Kann man denn nie …?«
Die Tür zum Labor oder zu dem, was es bis jetzt davon gab, wurde aufgestoßen, Henry sah zunächst nur den Rücken eines Mädchens, das sich in der Tür drehte, und dann erst das Tablett mit den Pappbechern dampfenden Kaffees. Daneben lagen zwei Stück Kuchen.
Toledo sprang auf. »Perdona, Luisa, so war das nicht gemeint. Herzlichen Dank, stell das Tablett bitte hierher. Sie ist so fürsorglich. Aber kein Zucker, oder? Ich hasse Zucker im Kaffee.«
Das Mädchen schüttelte lächelnd den Kopf, stellte schüchtern das Tablett ab, ging wortlos hinaus und schloss unhörbar die Tür.
»Ach, sie ist goldig«, seufzte Toledo. »Man wird im Stress so ungerecht. Luisa, die Tochter eines unserer compañeros, unserer ›Genossen‹. Damit haben wir auch zu kämpfen. Sie beschimpfen uns als ›Rote‹, nur weil wir zusammenarbeiten, im ›Kollektiv‹, wie sie sagen.«
»Zieht das immer noch?«, fragte Henry.
»Das wundert dich, was? Gegen Rote haben sie im Bürgerkrieg gekämpft. ›Kollektiv‹, das heißt Enteignung, Kommunismus, da kommen ekelhafte Erinnerungen hoch. Dabei gibt es jede Menge Kooperativen. Aber uns diffamieren sie damit.«
»Was war denn nun mit diesem Bongers?« Diese Frage interessierte Henry besonders, denn sie betraf ihn persönlich.
»Ich wollte über ihn Kontakt zu einem verlässlichen deutschen Journalisten, Deutschland ist als Markt für Rioja-Weine sehr wichtig, die Deutschen mögen unsere Weine, deshalb rief ich bei Gaston an. Da war dieser Bongers am Telefon; der hatte das Weingut bereits übernommen und hat mir alles berichtet, das mit dem Mord und dem gefälschten Grand Cru vom Château Haut-Bourton und so weiter. Bongers sagte, du hättest darüber geschrieben, sehr korrekt, wie er meinte, nicht so sensationsgeil wie andere Blätter. Außerdem hättest du nichts dazugedichtet, nichts weggelassen. Reicht das?«
»Allerdings. Freut mich, das zu hören.« Henry schnüffelte an dem café con leche, der ihm noch zu heiß war. »Jetzt wieder zu euch, zu dir. Seit wann existiert eure Kooperative?«
»Gründungstag war der erste Mai vorletzten Jahres.«
»Noch eine Provokation? Der Tag der Arbeit. Kein Wunder, wenn man euch für Rote hält …!«
»Die Bank hat uns wegen bestimmter Zinsvorteile dazu geraten und wegen des Baubeginns für die Fundamente und Tanks, sie mussten zur Ernte im letzten Jahr fertig werden. Du wirst es beim Rundgang sehen, wir arbeiten wieder mit gemauerten Tanks. Die Gründe erkläre ich dir später. Also, der Ärger war vorprogrammiert. Jeder wusste, dass es dazu kommen würde, nur hat niemand darüber geredet. Die compañeros haben ihr Leben lang Wein angebaut, Tempranillo, klar, unsere wichtigste rote Rebsorte, 90 Prozent aller Rebflächen sind damit bestockt; dann Garnacha und ein wenig Mazuelo, also hauptsächlich rote Rebsorten. Graciano ist so gut wie vorbei, die Rebe stellt nicht mal mehr ein Prozent der Gesamtmenge in der Rioja.«
»Gibt es Verträge zwischen den Kellereien und den Weinbauern über die Lieferung der Trauben?«
»Nein«, Jaime Toledo winkte ab, »lediglich Absprachen, aber keine schriftlichen Verträge oder gar Kündigungsfristen. Alle wussten, wer zur Kooperative gehört, und mit Baubeginn war klar, dass wir unsere Trauben behalten, um unseren eigenen Wein zu machen. Also konnten sich die Käufer beizeiten andere Lieferanten suchen.«
»Das ist normal. Und die Käufer machen jetzt Ärger?«
»So ist es«, sagte Toledo und las an einem Röhrchen oder Thermometer einen Wert ab und trug ihn in eine Tabelle ein. In dem Moment erlosch die Neonröhre an der Decke, und durch die Glasbausteine in der Wand zum Korridor hin fiel nur noch ein Schimmer ins Labor.
»Teufel noch mal! Was ist denn jetzt wieder passiert? ¡Que diablo!« Toledo sprang auf, schaltete das Mobiltelefon ein und rannte los. Henrys Blick fiel auf die lose aus der Wand hängenden Kabel. Das hier war keine fertige Bodega, das war eine Baustelle, man konnte es sich aber nicht erlauben, die Produktion ruhen zu lassen.
»Komm mit«, rief Toledo von der Tür aus, »es kann länger dauern. Hoffentlich ist’s nur ’ne Sicherung. Dann muss ich mit dem Mann reden, der eben die Trauben geliefert hat. So geht das nicht. Wie die sich das vorstellen …«, schimpfte er.
Es war tatsächlich ein Kurzschluss, hervorgerufen durch einen defekten Betonmischer, wie sich herausstellte. Glücklicherweise war gerade der Elektriker verfügbar.
»Unser Vorteil ist gleichzeitig unser Problem. Die Gesellschafter sind nicht nur Weinbauern, mit einem Hektar hier, einem dort und zweien auf der anderen Seite des Dorfes. Jeder hat einen Beruf, als Bauhandwerker, Elektriker, arbeitet in einer anderen Kellerei, beim Staat oder in der Verwaltung; wir haben einen Tischler, Metallarbeiter, und alle helfen, nach Feierabend oder am Wochenende, auch die jungen Leute, besonders die sind engagiert, so wie das Mädchen eben, Luisa, die den Kaffee gebracht hat. Die macht die Büroarbeit, jeder sieht seine Chance, packt an – das macht Spaß.«
»Das heißt, ihr schafft eure eigenen Arbeitsplätze?«
»Wer auf Politiker wartet, ist verloren. Die interessieren sich nur für ihren eigenen Posten. Schwierig wird es nur dann, wenn jemand Verantwortung übernehmen muss, wenn was kaputtgeht; neuerdings halten zwei oder drei den anderen ihre Arbeitsleistung vor. Deshalb werde ich das System ändern. Wenn der Laden erst auf festen Beinen steht – la puta que te parió … da kommt Jesús …«
Dem Önologen war keine Pause vergönnt. Ein Traktor mit einem älteren Mann am Steuer und einem mit Trauben beladenen Anhänger tuckerte auf das Gelände und fuhr schnurstracks zur Wiegeanlage. Toledo war schon wieder auf 180, Henry hingegen gefiel, was er sah, denn es gab ihm ein unverfälschtes Bild der Situation.
»Ich habe dir gesagt, dass wir diese Trauben hier nicht haben wollen.« Toledo stand mit in die Hüften gestemmten Armen vor dem Traktor und schrie gegen den Motorlärm an.
»Für was ist mein Sohn eigentlich Mitglied, wenn ich seine Trauben hier nicht abladen darf?«, brüllte der Treckerfahrer zurück.
»Weil der Kontrolleur vom Consejo Regulador noch nicht da ist und weil die Trauben nicht gut genug sind!«
»Was?«
»Mach die Maschine aus und komm runter!«, rief der Önologe und winkte den Mann zu sich.
»Keine Zeit, wir haben noch viel mehr zu lesen …«
»Diese Trauben lädst du hier nicht ab, wir haben das beschlossen! Dein Sohn weiß das. Komm aus der Sonne, die Gärung setzt sonst ein; fahr die Trauben da rüber in den Schatten, und wir reden weiter.«
»Geht das hier jeden Tag so?«, fragte Henry, dem derartige Situationen fremd waren.
»Alle haben die Verträge unterschrieben. Wir wollen Qualität produzieren, wir wollen mit unserem Wein Geld verdienen, wir wollen die Wertschöpfungskette in der Hand behalten und die Trauben nicht wie früher an die Großkellereien abgeben. Aber wenn es konkret wird, wenn sie die Trauben loswerden wollen, die nicht ihrem eigenen Standard entsprechen, sind alle Vorsätze vergessen – Bauern eben, Bauern …«
Missmutig zog der Önologe eine zerdrückte Zigarettenschachtel aus der Hosentasche, nahm eine platt gesessene Zigarette heraus und zündete sie an. Unter Henrys missbilligendem Blick zuckte er mit den Achseln. »Hab wieder angefangen. Die Nerven, ¿comprendes?« Dann ging er zurück zum Hauptgebäude.
Links stand ein dreistöckiger Rohbau, rechts angelehnt die Halle mit den Tanks, wo die Trauben abgeladen wurden. Die Gebäude reichten drei Etagen tief in den leicht abfallenden Hang. Die Mauern waren unverputzt, die Fenster mit Plastikfolie abgedeckt und mit Holzlatten gesichert. Die Bereiche für Rasen und Rabatten hatte man zwar abgesteckt, doch überall waren Bauschutt, Zementsäcke, Schalbretter und Kabelrollen verstreut. Allerdings waren die Schächte an der Giebelwand der Halle, wo die Trauben abgekippt wurden, perfekt gekachelt und makellos sauber.
Der Treckerfahrer machte sich ans Abladen seiner Fracht, bis ein weiterer »Genosse« auf ihn einredete. Der Alte gab jedoch nicht auf. Er griff in die Brusttasche seiner blauen Drillichjacke und zog einen Zettel heraus. »Hier, der Beweis: Das sind die Trauben meines Sohnes, früher war das mein Weinberg. So, und ich habe mich an die Vorschriften gehalten.«
»Das streitet niemand ab, Don Jesús.« Dieses Mal hob Toledo flehend die Hände. »Aber die Weine von dieser Parzelle haben nicht die vorgeschriebenen Säurewerte, auf die wir uns geeinigt haben. Ich habe es selbst analysiert.«
»Dann hast du dich eben geirrt …«
»Nein! Ich irre mich nicht!«
»Nur Gott irrt nicht.«
»Ach – tatsächlich?«
»Mach’s noch mal, ich will dabei sein. Wer weiß, was du in deiner Hexenküche wirklich anstellst.«
»Du tust ja gerade so, als ob das alles hier für dich neu wäre. Nein, compañero, so Leid es mir tut …«
»Wenn du die Trauben nicht nimmst, kriegst du nie wieder welche.«
Henry zog Jaime zu sich: »Warum rufst du den Sohn nicht direkt an?«
»Weil das ein Trick ist. Jesús González kennt unsere Vereinbarungen. Der Sohn schickt den Vater vor, und der Alte tut so, als sei er ein bisschen blöde. Schon mal was von Bauernschläue gehört?«
Henry hoffte, dass die Männer ein Ende fanden, denn so kam er nicht weiter. Was lief hier wirklich ab? Wer oder was steckte hinter den Schwierigkeiten der Kooperative?
»Dann suche ich mir eben einen anderen Käufer«, räsonierte der Alte und kletterte auf den Trecker, »und ich weiß auch, wen!«
»Schon klar. Ich werde dich nicht daran hindern«, gab der Önologe bissig zurück, am Ende mit seiner Geduld.
»Es wird dir leid tun, Jaime Toledo, das verspreche ich dir. So hat mich noch nie jemand abgefertigt.«
»Es steht jedem von euch frei, die Trauben, die wir nicht verarbeiten wollen, anderweitig anzubieten.«
»Worauf du dich verlassen kannst – und zwar zu einem besseren Preis!«
»Viel Glück dabei, den Weg kennst du sicher noch, wie ich annehme …«
Vergeblich hatte Henry versucht zu erfahren, wer konkret etwas gegen die Kooperative unternahm und was die Gründe dafür waren. Jaime Toledo hatte angedeutet, dass es die Bodega war, der die cooperativistas bislang ihre Trauben verkauft hatten. Ihr fehlte jetzt der Rohstoff für ihren Wein, nur so ließ sich der Konflikt erklären. Aber im letzten Jahr, als die Weinbauern ihre Trauben zum ersten Mal selbst verarbeitet hatten, war es nicht zum Eklat gekommen. Was hatte sich verändert?
Aber kaum begann Jaime Toledo einen Satz, klingelte wieder das Telefon. Trauben wurden zur Analyse gebracht, eine Lieferung Zement blieb aus, und als Leute für die Arbeit am Sortierband fehlten, gab Henry sich geschlagen. Jaime und er verabredeten sich für den Abend in Toledos Wohnung, oben in Laguardia. Henry sollte um 21 Uhr zum Essen kommen, wobei Toledo grinsend offen ließ, ob er nach dem Essen noch gesprächsfähig war oder nicht vielmehr sofort einschlafen würde. Der Humor war ihm glücklicherweise noch nicht ganz abhanden gekommen.
Es war fast Mittag, als Henry die Baustelle in Elciego verließ. Jaime Toledo wollte ihm am nächsten Tag alles zeigen, auch die Baupläne, Geheimnisse gäbe es nicht. Es würde interessant sein, den Gebäudekomplex, der nach den Erfordernissen moderner Weinbereitung angelegt worden war, zu besichtigen und einige Fassproben zu machen. Nach einem knappen Dreivierteljahr im Barrique ließ sich über den Wein schon etwas sagen, wenn auch Crianza genannte Weine erst nach einem Jahr Fassreife abgefüllt werden durften und noch weitere zwölf Monate auf der Flasche reifen mussten.
Henry hatte Weine in ihrem Anfangsstadium kennen gelernt, während des Ausbaus im Barrique und nach der Abfüllung. Mittlerweile konnte er ihre Entwicklung bedingt vorhersagen, und bei lagerfähigen Kreszenzen ließ sich die Veränderung über Jahre verfolgen. Die meisten Winzer waren nicht kleinlich; oft wurde Henry der Wein nach dem Besuch des Weingutes förmlich aufgedrängt, wobei er sich angewöhnt hatte, nur solchen Wein als Geschenk zu akzeptieren, über den er mit gutem Gewissen schreiben konnte. Wenn er jedoch den Verdacht hatte, dass ihn jemand beeinflussen wollte, schlug er jede Flasche aus. Kollege Olaf Winter hatte in der Redaktion lauthals verkündet, dass er nur darauf warte, wann das »Geschenk« interessant genug sei, um auch Henry zu kaufen.
Fünf Jahre als Weinjournalist waren nicht viel, aber Henrys ausgeprägter Geschmackssinn und seine Begeisterung für gute Weine kamen ihm zu Hilfe. Außerdem war Wein schon immer sein Hobby gewesen, und die Ausgaben für den Weinkeller hatten für ständigen Streit mit seiner Ex-Frau gesorgt. Als Reporter war er um die ganze Welt gereist, manchmal war es öde gewesen, manchmal spannend, hochinteressant oder gefährlich, so gefährlich für Außenstehende, dass seine Frau in ständiger Angst um ihn gelebt hatte. Manchmal war er zwischen zwei Reisen nur einen Monat zu Hause gewesen, dann wieder hatte er von einem Tag auf den anderen aufbrechen müssen. Also wurden Freunde ausgeladen, Familienfeiern abgesagt, gemeinsame Vorhaben aufgegeben – Gisela hatte das nicht verkraftet. Er nahm es ihr nicht übel, wie auch? Sie hatte sich geängstigt, mit ihm gefühlt, war viel allein gewesen – und sie hatte ihn bedrängt, sich eine Stellung zu suchen, bei der er zumindest in Europa bleiben konnte. Wieso musste es wieder der Kosovo sein, wieso eine Reportage in Weißrussland? Weshalb hatte er über illegalen Holzeinschlag in Finnland recherchiert? Um sich von Holzfällern verprügeln zu lassen? Frauen, das war sein Fazit, liebten Abenteurer, aber mit deren Abenteuern konnten sie meist wenig anfangen.
Zu ›Wein & Terroir‹ hatte ihn ein Freund gebracht: ein guter Job als Reporter; Reisen ja, aber gefahrlos; interessante Menschen, Abwechslung – aber da war es bereits zu spät gewesen und die Liebe fast auf dem Nullpunkt angekommen. Respekt empfanden sie allerdings noch immer füreinander. Gisela hatte ihn verlassen, zugunsten eines Finanzbeamten der höheren Laufbahn, äußerlich ein Draufgänger, der seine Abenteuer im Fitnessstudio auslebte. Henry brauchte nur das Wort Finanzamt zu hören, um einen dicken Hals zu bekommen.