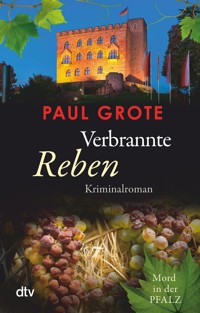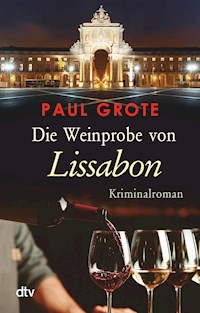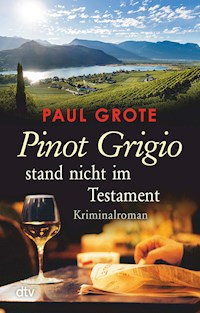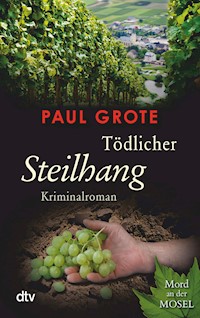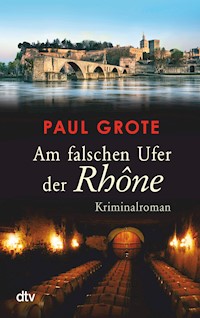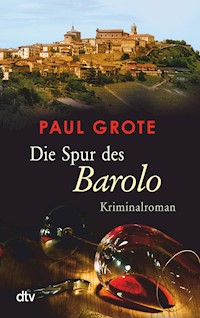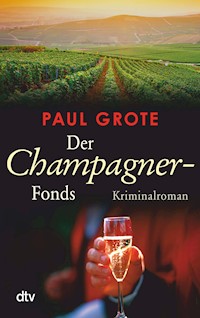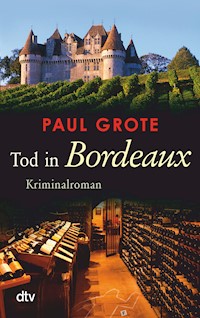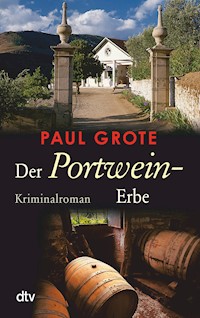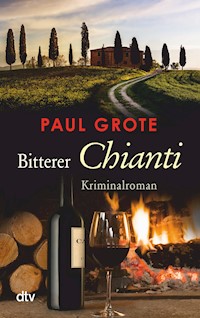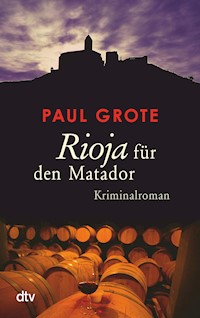9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Europäische-Weinkrimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mord auf Mallorca Ein deutscher Weinhändler will auf Mallorca ein Weingut erwerben, doch einige beunruhigende Ereignisse im Vorfeld des Kaufs lassen ihn zögern. Er schickt den orts- und weinkundigen Journalisten Henry Meyenbeeker auf die Insel, damit er die Lage sondiert. Nichts ahnend begibt sich Henry auf gefährliches Terrain …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Paul Grote
Die Insel, der Wein und der Tod
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
»Wenn man mit Narren lebt, muss man auch seine Lehrzeit als Verrückter durchmachen.«
Alexandre Dumas: Der Graf von Monte Christo
Der Roman ist Bernd Mattheis (†) gewidmet, ehemals Weinhändler in Tübingen und Winzer in der Toskana
Kapitel 1
»Brich ihm die Knochen! Du kannst alles Mögliche mit ihm anstellen. Nur bis zum Äußersten darfst du nicht gehen.«
Diego wählte seine Worte sehr vorsichtig, er durfte Rafael keinesfalls verärgern. Er brauchte ihn. Keiner der anderen Häftlinge war für den Auftrag besser geeignet. Er wusste, wie mit ihm umzugehen war, er kannte ihn seit genau sechs Jahren, seit Rafael hier einsaß. Obwohl sie ihn hier wie draußen el puño nannten, die Faust, obwohl dieser Name Programm war und er daher von allen Insassen respektiert und gefürchtet wurde, war er innerlich ein Seelchen und gefährlich leicht aus der Ruhe zu bringen. So brutal er sich einerseits gebärdete, so empfindlich reagierte er andererseits und prügelte schnell los, wenn man ihm zu nahe kam. Dann wurde er zur Faust, und jeder, der mit ihr in Berührung kam, hatte danach, falls er ohne Kieferbruch aus der Ohnmacht aufwachte, das Gefühl, von einem Vorschlaghammer getroffen worden zu sein.
Jedem anderen hätte Diego deutlichere Worte gesagt, aber er wusste, wie wichtig bei diesem Auftrag eine leise und kontinuierliche Aufbauarbeit war.
»Ich habe weder gesagt noch gemeint, dass du ihn umbringen sollst.«
Diego flüsterte, er bewegte beim Sprechen kaum die Lippen. Töten würde er ihn selbst, später, das wäre sein größtes Vergnügen, das gönnte er keinem anderen. Der Deutsche war es, der ihn hier reingebracht hatte, der Deutsche hatte ihm bisher fast ein Jahrzehnt seines Lebens geraubt, das vergaß er keinen Tag, keine Stunde. Sein Hass wuchs täglich, manchmal hatte er das Gefühl, vor ohnmächtiger Wut zu platzen. Der Deutsche war es, der die Firma ruinieren würde, die sein Urgroßvater und sein Großvater in Jahrzehnten aufgebaut und groß gemacht hatten und die an die Wand zu fahren sein Vater gerade dabei war, mithilfe dieser Drecksau.
Es würde der perfekte Mord werden, denn Diego wusste, wenn diesem Schweinehund etwas geschah, wäre er selbst der Erste, den man verdächtigen würde. Allein schon deshalb ließ er sich nicht allzu oft mit Rafa sehen, damit man sie nicht in Verbindung brachte, er kam ihm nur nahe, wenn sie unbeobachtet waren, denn den Kriminellen um ihn herum durfte man nicht trauen. Nein, keinem durfte man vertrauen, außer man war Mitglied einer Organisation wie dem Al-Akhirah-Syndikat, der Vázquez-Familie, oder man gehörte zu den Latinos. Und da waren die Kolumbianer ganz speziell. Um sie machte er einen großen Bogen, denn seine kleinen Kokain-Deals wickelte er hinter ihrem Rücken ab.
Und überall hockten die Spitzel dazwischen, für ihn Menschen niederer Gesinnung, die sich bei der Gefängnisleitung beliebt machen wollten, in ihrer Armseligkeit darauf spekulierten, ein halbes Jahr oder drei Monate früher entlassen zu werden. Und weil es Leute gab, die Worte von den Lippen ablesen konnten, hatte er sich die Sprechweise eines Bauchredners angewöhnt, wenn es um heikle Geschäfte ging. Über etwas anderes als Geschäfte redete er allerdings selten.
Diego Peñasco schüttelte den Kopf und lehnte sich seufzend an die kühle Betonmauer. »Du wirst dich zurückhalten, zu weit darfst du nicht gehen«, sagte er tonlos zu Rafa. »Er darf dir nicht unter den Händen wegsterben. Lass es wie einen Raubüberfall aussehen. Deine Schläge oder was dir sonst noch einfällt, müssen wohldosiert sein. Das kannst du, das weiß ich, und deshalb schätze ich dich!« Er wusste, wie sein Gegenüber auf Lob reagierte. »Jeden Tag seines beschissenen Lebens soll er daran denken, er soll den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde.« Diego presste die Worte zwischen den Zähnen durch, gleichzeitig war ihm die Vorfreude anzusehen, die Vorfreude auf den Moment, wenn man ihm die Nachricht überbringen würde, dass es geschehen sei. »Hit and run, zuschlagen und untertauchen. Er soll wissen, woher der Anschlag kommt, aber es darf keinen Beweis dafür geben, nicht eine einzige Spur.«
Aus dem Schatten der Mauer heraus konnten sie ungesehen den Hof überblicken, sie standen in dem Teil, der auch bei vierzig Grad im Sommer einigermaßen kühl blieb. Jeder hatte seinen Platz, jeder, der wichtig war. Die Belanglosen standen in der Sonne. Diegos besonderer Stellung unter den Gefangenen war es geschuldet, dass man beiseiteging, besonders dann, wenn er mit Rafa hier auftauchte. Die Marokkaner und die Schwarzen machten sowieso besser einen riesigen Bogen um diesen Teil des Hofes. Das kriminelle Gesocks sollte man sofort abschieben, dachte Diego im Vorbeigehen, statt sie hier auf Kosten der Steuerzahler noch zu ernähren. Schließlich zahlte auch er auf seine Gewinne Steuern, und das nicht zu knapp. Dabei ging es diesem Gesindel hier weitaus besser als in ihren verkeimten Ländern.
Ohne seine Unruhe nach außen dringen zu lassen, fuhr er sich wie gelangweilt mit beiden Händen durchs Haar, eine Geste, die mit der Zeit überflüssig werden würde, denn ihm fielen die Haare aus. Sehr zu seinem Verdruss bekam er eine Glatze, aber er wollte bei allen Teufeln nicht so aussehen wie die primitiven Ganoven, die sich den Schädel rasieren und tätowieren ließen.
Diego betrachtete das Haar, das zwischen seinen Fingern hängen geblieben war, unterdrückte seinen Zorn, denn auch dafür war er verantwortlich. Hatte Rafa tatsächlich das Zeug, den Auftrag in seinem Sinne auszuführen? Er durfte nicht zu weit gehen. Er fragte sich zum hundertsten Mal, ob er alles bedacht, nicht eine Kleinigkeit übersehen hatte, die seinen Plan zum Scheitern bringen würde und einen Beweis lieferte, dass er der Auftraggeber war.
Nein, auf Rafa konnte er unmöglich verzichten. Er war der Intelligenteste in dieser dumpfen Umgebung, er war ihm ergeben, er hatte ihn sich quasi herangezüchtet, seine Familie mit Geld unterstützt. Rafa hasste Ausländer und brachte das richtige Maß an Skrupellosigkeit mit, ohne die das Vorhaben nicht gelingen konnte. Nur an Fingerspitzengefühl und an der Fähigkeit, eine Situation schnell richtig einzuschätzen, mangelte es ihm manchmal.
»Du kennst mich jetzt lange genug, hombre, manchmal habe ich den Eindruck, du nimmst mich nicht für voll. Was denkst du dir eigentlich, wer du bist, Diego?« Rafa war angesäuert, besonders schnell regte er sich auf, wenn jemand an seiner Intelligenz zweifelte. »Klar habe ich kapiert, dass er am Leben bleiben muss, nur ordentlich was aufs Maul kriegen soll, und ab in den Rollstuhl.« Er sprach über das Attentat, als ließe er sich über Motorräder aus, sein Lieblingsthema.
Diego wusste: Zweifel blieben immer, einhundert Prozent Sicherheit gab es nicht, in keiner Hinsicht. Das hatte er von seinem Großvater gelernt, seinem großen Lehrmeister, um den er noch immer trauerte, obwohl Don Horácio seit zehn Jahren tot war. Nicht einmal sein Grab ließ ihn der verfluchte Richter besuchen.
Rafa hätte mit Don Horácio wenig anfangen können. Er war im Grunde ein Gangster, ein Schläger, nicht mit Kapuze, aber doch auch ein Hooligan, ein leidenschaftlicher Anhänger von Atlético Madrid, Mitglied der Frente Atlético – die härtesten Hooligans im Land. Er war jemand, den man gut gebrauchen konnte, wenn es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Und er war jemand mit der richtigen nationalen Gesinnung, den man nicht immer wieder überzeugen und aufs richtige Gleis führen musste. Er hatte nichts übrig für die maricónes, die Schwulen, die Sozialarbeiter und Psychologen hier im Knast von Valencia, die Resozialisierer, und dann konnte er, mit seinem eingeschränkten Horizont wohlgemerkt, sogar strategisch denken, planen und logisch handeln. Mit Drogen hatte er wenig im Sinn, er rauchte höchstens mal einen porro, um es sich mit den Marokkanern nicht zu verderben. Haschisch war nicht schädlich. Offene Feindschaft oder die Ablehnung der Araber hingegen konnten tödlich enden.
»Mach dir immer wieder den Zweck der Aktion klar. Es geht nicht um meine persönlichen Gefühle. Es geht darum, was unserer Bewegung dient.« Diego spielte auch die politische Karte, es hatte ihm immer genutzt. »Wir ziehen einen Feind aus dem Verkehr, und gleichzeitig kriegt er einen Denkzettel, der ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen wird. Er darf niemals vergessen, was er uns angetan hat, meinem Großvater und auch mir persönlich, dieser Hurensohn.«
Diego sagte den letzten Satz fast beiläufig, in einem Ton, der verbergen sollte, wie stark seine persönlichen Motive wirklich in diese Angelegenheit hineinspielten. De facto war Henry Meyenbeeker als Gegner oder Feind der nationalen Bewegung bedeutungslos, er mischte sich nicht in die Politik ein, was nicht hieß, dass er ungefährlich war. Doch Diego war es gelungen, den ehemaligen deutschen Journalisten als politischen Feind aufzubauen. Ressentiments gegen diese Berufsgruppe gab es genug, und er hatte ihm eine bedeutende Rolle angedichtet, die weit von jeder Realität entfernt war. »Du weißt, es ist wichtig für die Bewegung, er schadet ihr, wo er nur kann.«
»Hombre, das weiß ich alles längst, du langweilst mich …«
»Nein, einiges habe ich dir noch nicht gesagt.« Diego machte einen Schritt nach vorn, trat aus dem Schatten und zog Rafa am Arm mit. Er hatte den Eindruck, dass einer der Wärter zu lange zu ihnen herüberstarrte, und sie gingen in die Mitte des Hofes, vorbei an den Rumänen, die sich wieder lautstark stritten, und reihten sich in die Schlange vor dem Kiosk ein. Bis sein Dienst begann, war noch Zeit, und ein Café solo für sich und ein Cortado für Rafa würden die Wartezeit abkürzen.
»Hola hombre!« Der Mann vor ihnen in der Warteschlange wandte sich um. »Du bist Diego Peñasco, nicht wahr, el viticultor?«
Der Winzer, das war der Name, den man ihm angehängt hatte, und es war nicht mal falsch, er war Winzer, er hatte Weinbau und Kellerwirtschaft studiert, sah sich noch immer als Experten und Unternehmer, schließlich war er Mitinhaber einer großen Kellerei in La Rioja, und es erfüllte Diego immer wieder mit Stolz, so angesprochen zu werden. Doch nicht von diesem Mann. Der gefiel ihm gar nicht. Er war erst seit einem Monat hier, angeblich wegen Raubes, einer anderen Version nach hatte er seine Frau verprügelt und ihr den Arm gebrochen und ihrem Chef die Nase. Angeblich kam er aus Palma, der Hauptstadt Mallorcas, also einer von der Insel, damit war er ein halber Katalane, und denen durfte er selbst – als gebürtiger Baske – sowieso nicht trauen. Für ihn waren sie alle Spanier.
»Was willst du, qué quieres?«
»Man hat mir gesagt, du kennst dich mit Geld aus …«
»Du heißt Joan, nicht wahr, Joan Noriega? Von welchem Idioten hast du das gehört?«
»Weiß nicht, man erzählt es so, es wird viel geredet.«
»Eben, es wird zu viel geredet. Du kannst ja mal zu meiner Beratung kommen, von vier bis sechs in der Santander Central Hispano, die Filiale der Bank ist in der Gran Vía de Ramón y Cajal; ich nehme hundert Euro die Stunde.«
Diego wies lachend mit der Hand über die hohe Mauer des Gefängnisses in Richtung Stadt, und die Umstehenden lachten mit. Man war dankbar für jede noch so kleine Abwechslung.
»Ich werde mich erkundigen, darauf kannst du Gift nehmen.« Der Neue ließ sich nicht so leicht einschüchtern.
Ich werde mich mit diesem Joan beschäftigen müssen, dachte Diego, sein Gefühl sagte ihm, dass er ein Spitzel war. Es gab noch einen zweiten Mitgefangenen, von dem Diego sich in letzter Zeit beobachtet fühlte. Er konnte nicht vorsichtig genug sein.
Zumindest hatte er sich die gefährlichsten Leute seines Blocks mit Geld gefügig gemacht. Doch die Angst, mit einer Rasierklinge oder einem geschärften Stück Blech das Gesicht zerschnitten zu bekommen, war oft wirkungsvoller als jeder große Geldschein, wirkungsvoller noch als ein Briefchen Koks, außer bei den Süchtigen. Nach neun Jahren im Knast war ihm nichts mehr fremd, er lebte in der idealen Schule des Verbrechens. Es würde ihm nach seiner Entlassung im Geschäftsleben helfen. Egal, wo man sich befand, man musste lernen, mitnehmen, was sich kriegen ließ, auf Biegen und Brechen …
Die beiden Männer trennten sich, jeder mit seinem Kaffee in der Hand, um nach fünf Minuten auf der anderen Seite des Hofes wie zufällig wieder zusammenzutreffen. Noriega, von dem Diego sich beobachtet fühlte, war momentan außer Sicht, und die Wachhabenden waren damit beschäftigt, auf der anderen Seite des Hofes Streit zu schlichten.
»Du wirst nächste Woche entlassen, du Glücklicher«, fuhr Diego fort, den Hof weiter im Auge behaltend. »Klar, erst mal werdet ihr feiern, das verstehe ich, die Weine kriegst du natürlich von uns, da sorge ich für, ich lasse mich nicht lumpen …«
»Schick sie auf keinen Fall zu mir nach Hause, das fällt auf.«
Der Einwand war Diego lieb, zeigte er ihm doch, dass Rafa mitdachte. Die Arbeit des letzten Jahres war also nicht vergebens gewesen.
»Hältst du mich für so kurzsichtig? Die Kisten gehen an unseren Vertrauensmann bei der Zeitung La Razón. Wir, also die Kellerei, deklarieren es als Proben für die Presse, und er leitet dann die Kisten weiter.«
»Wie heißt der Mann?«
»Wozu musst du das wissen?«
»Schon verstanden.« Rafa winkte ab, dann hellte sich sein Gesicht auf. »Aber er kann sie bringen, er feiert mit, klar, er ist eingeladen. Ich hoffe nur, er säuft vorher nicht alles aus.« Es war ihm anzusehen, wie sehr er sich auf seine Entlassungsfeier freute, obwohl er nur sechs Jahre gesessen hatte. Denn von den gemeinschaftlichen Einbrüchen in die Villen von Ausländern an der Costa del Sol wusste die Staatsanwaltschaft nichts. In Rafas Bande war der gelernte Maschinenschlosser für die Fahrzeuge und den Ordnungsdienst verantwortlich gewesen, ein Posten, den er wieder einnehmen würde, wie man ihm zugesichert hatte.
»Was ich anfasse, das klappt auch, amigo.« Diego war von seinen eigenen Fähigkeiten absolut überzeugt. Die Fehler, die damals zu seiner Verhaftung geführt hatten, würde er niemals wiederholen. Nein, es waren keine Fehler, es war reines Pech gewesen. Nun, die neun Jahre hatte er ohne Schaden überstanden, bis auf den Haarausfall. Überlebt hatte er durch sein Verhandlungsgeschick, hatte mit seinem Geld hier so ziemlich jeden korrumpiert und durch seine Anlageberatung auch die Chefs der wichtigsten Gruppen auf seine Seite ziehen können. Noch nie hatte er Geld als so wichtig empfunden wie hier. Er war reich, wurde täglich reicher, und es befriedigte ihn immer aufs Neue, dass gerade Meyenbeeker ihm dabei half. Dem blieb gar nichts anderes übrig. Wenn der Deutsche die Firma nach vorn bringen wollte, verdiente er, Diego, an jeder Flasche mit. Obwohl er behauptete, Meyenbeeker würde die Firma ruinieren, konnte er die Augen nicht davor verschließen, dass sich die Kellerei seit dem Einstieg des Deutschen vor drei Jahren trotz der Krise bestens entwickelte. Mit diesem Widerspruch ließ sich ganz gut leben.
Immerhin gehörten Diego fünfundzwanzig Prozent der Kellerei, Prozente, die Don Horácio ihm kurz vor seinem Tode überschrieben hatte. Sein guter Name hatte Diego auch den Zugang zur Bewegung verschafft und das Vertrauen der Obleute der Alianza Nacional.
»Also – nicht töten. Brich ihm die Hände, dann kann er nicht mehr schreiben, für einen ehemaligen Journalisten so gut wie tödlich. So wie bei dem linksradikalen Sänger in Chile, Victor Jara, nach dem Putsch des großen Generals Pinochet. Dieser Musiker konnte nie wieder eine Gitarre halten, aber sie haben ihn später sowieso erschossen.« Diego lachte hämisch.
»Ich kann ihm auch was aufs Maul hauen, dann kann er nicht mehr reden …«
Diego überging den Einwand, er war unwichtig, und unwichtige Worte konnte man sich sparen. »Er soll sich jeden verdammten Tag seines beschissenen Lebens daran erinnern müssen. Meyenbeeker wird wissen, aus welcher Richtung die Schläge kommen.« Er legte Rafa freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Die Geste konnte auch als Drohung verstanden werden. Diego war es recht, ein wenig Druck konnte nicht schaden. »Glaub ja nicht, dass ich nicht wüsste, was draußen abgeht.«
Sollte Rafa einen Fehler begehen, würde er es erfahren, auch dafür hatte er vorgesorgt. Rafa würde sich nicht lange an dem Geld freuen, das er ihm zukommen lassen würde. Aber die Dreißigtausend waren ihm das Vergnügen wert. Geld spielte keine Rolle, es wurde täglich mehr.
»Oiga, hombre, was ist los?« Rafa hatte bemerkt, wie sich Diegos Gesicht verfinsterte.
Diego entspannte sich sofort, er durfte seine Gefühle nicht nach außen dringen lassen, wer sie zeigte, war verwundbar, und jeder beobachtete jeden, ununterbrochen, es gab nichts anderes zu tun. Aber sein Hass war so groß, dass er Meyenbeeker am liebsten mit eigenen Händen erwürgt hätte. Nicht nur, dass der ihn in den Knast gebracht hatte, nein, er hatte ihm auch den Großvater genommen, dem die Familie alles verdankte. Und zu allem Übel ging er mit seiner Schwester ins Bett. Aber die taugte sowieso nichts.
Er atmete tief, blickte über den Hof, bemerkte die Athleten drüben an den Sportgeräten. Eine Gruppe spielte Basketball, der Kiosk war umlagert wie immer, alle pafften, Rauchwolken stiegen auf und verflüchtigten sich im blassblauen Himmel über der fünf Meter hohen Mauer, die Sonne – nein, Flucht war nicht möglich, er konnte nicht einfach abhauen, in irgendein fremdes kriminelles Milieu eintauchen und so tun, als wäre er ein gewöhnlicher Verbrecher. Er gehörte hier nicht dazu. Das hier war Plebs. Er müsste schon nach Südamerika gehen. Papiere zu beschaffen war nicht das Schwierigste. Er würde sich an die Kolumbianer wenden, aber die wollten in erster Linie ihr Kokain loswerden, leider beschissen sie jeden mit gepantschtem Zeug. Er besaß genügend Erfahrung, er roch, ob der Stoff sauber war. Er hatte seine eigenen Kanäle und nahm nur, was sein Lieferant sich selbst reinzog. Aber wie komme ich in Südamerika an mein Vermögen?, fragte er sich. Es war eine unbeantwortete Frage. Er musste intensiver darüber nachdenken. Wenn er das tat, wenn er in Gedanken ein Problem zu lösen hatte, beruhigte er sich rasch.
»Wenn du draußen bist, Rafa, dann liegt für dich der Katalog von Bodegas Peñasco bereit, mein Anwalt hat ihn an deine Eltern geschickt, du findest ihn zu Hause vor. Das spart uns Zeit. Im Katalog findest du von allen Familienmitgliedern und von diesem Deutschen die aktuellen Fotos, natürlich auch auf der Website. Meine Gewährsleute bei Peñasco wissen, dass jemand kommt. Wie der Kontakt läuft, das weiß mein Anwalt, von dem bekommst du auch das neueste Smartphone.«
»Hoffentlich nicht auf meinen Namen registriert?«
»Müssen wir das Selbstverständliche erwähnen? Im Notfall zerstörst du das Ding, hackst es klein …«
»… die Geräte sind teuer …«
»Sicherheit hat ihren Preis, außerdem ist es mein Geld. Wir reden später weiter, ich muss in die Küche, also nachher wieder hier.«
Diego überquerte den Platz, er hoffte, dass sein langes Treffen mit Rafa nicht aufgefallen war. So lange redete er niemals mit jemandem, außer mit den Bossen. Jetzt musste er in die Küche, an seinen Arbeitsplatz, da konnte man die besten Teile für sich rauspicken und anderen, die es verdient hatten, Motten und Kakerlaken unter die Paella mischen.
Der Wärter am Eingang ließ ihn passieren, Diego grüßte freundlich, der Mann grüßte zurück. Auch einige Wärter holten sich von ihm Tipps für die Geldanlage oder liehen Geld, selbstredend zu niedrigeren Zinsen als die Mitgefangenen, man war ja schließlich kooperativ.
Guillermo, der Kolumbianer, ein dunkler Krauskopf, klein und verschlagen, sieben Jahre wegen Drogenhandels, arbeitete ebenfalls in der Küche. Diego hielt ihn für einen Schwätzer. Guillermo näherte sich von der Seite, als wäre das Zusammentreffen rein zufällig. Aus den Augenwinkeln bemerkte Diego, dass dieser Spitzel wieder in seine Richtung blickte, absichtlich oder unbeabsichtigt, wer konnte das wissen? Diego registrierte immer, wenn ihn jemand beobachtete.
»Es ist wieder was angekommen. Wenn du probieren willst?«
»Wenn du mir nicht diesen Dreck anbietest, den ihr den anderen verkauft, dann gern.« Diegos Gesicht zeigte nicht die geringste Regung.
»Ich weiß, keiner hat eine so gute Nase wie du, eigentlich ein Wunder bei deinem Konsum, aber es ist wirklich kein Levamisol drin …«
»Ist es über Afrika gekommen oder direkt?«, unterbrach ihn Diego. Er wusste, dass alles, was über die afrikanische Route kam, von minderer Qualität war, mit jedem nur möglichen Stoff gestreckt wurde, um noch mehr zu verdienen, wobei Zucker das Harmloseste war. Meist wurden Lidocain oder Benzocain druntergemischt, was einen betäubenden Effekt auf die Schleimhäute hatte und für einen schnelleren Wirkungseintritt sorgte.
»Wenn ich dir sage, es ist korrekt, dann ist es korrekt, klar?«
»Bleib cool, leg nachher was zwischen die Tabletts dort drüben.« Diego wies auf einen Stapel in der Küche, der selten benutzt wurde. »Ich probiere es aus. Du sagst mir den Preis, und in vier Tagen hast du das Geld auf dem Konto.«
Der Kolumbianer drückte Diegos Hand, in ihr blieb ein Briefchen zurück. »Zur Probe, nur für dich, dann klappt’s mit der Arbeit besser. Vielleicht kommen wir ins Geschäft.« Er zwinkerte Diego zu und blieb zurück.
Um sechzehn Uhr waren auch die Gefangenen auf dem Hof, die vormittags arbeiteten oder Unterricht besuchten, um die Zeit rumzukriegen. Die wenigsten versprachen sich davon nach der Entlassung einen Job. Diego trainierte eine halbe Stunde lang an den Geräten, morgens hielt er sich mit Seilspringen und Gymnastik fit, nachmittags war Gewichteheben dran. So kräftig und durchtrainiert wie jetzt war er nie im Leben gewesen, so wach, aber auch in ständiger Alarmbereitschaft, und in Bezug auf Wirtschaftsfragen konnte ihm hier nicht einmal der Direktor der Anstalt das Wasser reichen. Den Wirtschaftsteil von El Mundo, von ABC und die Gaceta de los Negocios las er täglich. In der Verwaltung ließ man ihn nicht arbeiten, denn er hätte binnen drei Tagen herausfinden können, wer in der Gefängnisleitung korrupt war, aber das wusste er sowieso.
Nachdem er sich den Schweiß abgewischt hatte, schlenderte er hinüber zum Kiosk, trank eine Cola, nahm eine zweite mit und ließ sich in die Richtung treiben, wo Rafa im Schatten auf einem Kaugummi herumbiss.
»Was wir besprochen haben hinsichtlich deines Verhaltens in La Rioja hast du dir gemerkt?« Die Wand, an die Diego sich lehnen wollte, war zu warm, er ließ sich im Schneidersitz auf den Betonboden nieder, den Hof im Blick.
»Alles.«
»Dann machen wir mit dem Typen weiter, mit Meyenbeeker. Halte ihn auf Abstand. Wenn du ihm zu nah kommst, bist du verloren. Er trainiert regelmäßig mit einem Spezialbullen, einem der härtesten Hunde von der internen Ermittlung, angesetzt auf andere Bullen. Den haben sie inzwischen kaltgestellt, der war sogar ihnen zu hart. Er ist ein kleiner Mann, wirkt unscheinbar, aber unglaublich clever und entschieden, gräbt sich in die Fälle ein wie eine Zecke. Einer von denen, die du nie kaufen kannst, sondern beiseiteschaffen musst. José Maria Salgado. Ist jetzt fünfundfünfzig. Mit dem arbeitet er zusammen, sie sind Freunde. Also, dieser Meyenbeeker, Enrique oder Henry, der ist ebenfalls Anfang fünfzig, aber das sieht man ihm nicht an. Er kennt sich bestens mit Wein aus, spricht perfekt Spanisch. Irgendein Verwandter von ihm stammt von hier, war Kommunist, ist vor dem Generalissimo abgehauen, die Flucht ist ihm leider geglückt, sonst hätten wir das Problem nicht …«
»Du kannst sicher sein, wir haben es nicht mehr lange.«
»Das hoffe ich sehr«, sagte Diego und dachte an den Tag, an dem sein Anwalt ihm die Nachricht brächte, das Problem Meyenbeeker sei gelöst. Er würde sich aufatmend zurücklehnen, würde sich eine gewaltige Nase geben, sich seine Frau kommen lassen und mit ihr einige Flaschen vom besten Wein seiner Kellerei niedermachen. Als er merkte, wie er sich in Fantasien verlor, in Zukunftsträumen, kam er ruckartig auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Amigo, der größte Fehler ist es, den Feind zu unterschätzen. Betrachte den Mann als unseren Feind, einen mit cojones pelados, er ist mit allen Wassern gewaschen. Sechs sind über ihn hergefallen und wollten ihn fertigmachen, und er hat es überlebt …«
»Das waren Anfänger.«
»Ich sagte, unterschätze ihn nicht!« Diego zwang sich zu einem gemäßigten Ton. Es machte ihn wahnsinnig, zu wissen, dass Meyenbeeker in aller Freiheit durch seine, Diegos, Weinberge stromerte, über Rebschnitt und Lese entschied, den Arbeitern Anweisungen gab. Es war Meyenbeeker, der mit den Bauern diskutierte, mit dem Kellermeister den Reifegrad des Weins in den einzelnen Barriques besprach, und nicht er. Meyenbeeker galt inzwischen als engster Vertrauter von Diegos Vater, und mit seiner Tante und seinem Onkel zogen sie das Andenken Don Horácios in den Dreck, finanzierten mit Isabellas Hilfe die Exhumierung der angeblichen Opfer Francos … Mierda, er verlor sich schon wieder. Diegos Gesicht verzerrte sich unwillkürlich, er biss die Zähne zusammen, bis sie knirschten.
»Eh, hombre, was ist los? Du siehst fürchterlich aus. Hab Vertrauen, ich regle das.« Beruhigend legte Rafa ihm die Hand auf den Arm.
Diego zog sie weg. Er durfte sich nicht gehen lassen. »Ach, es ist nichts, nur so ein Gedanke, ich würde die Sache liebend gern selbst ausführen, ja, ich beneide dich wirklich darum, dass du das erledigen darfst.« Schnell hatte er sich gefasst und wirkte wieder gelassen. Andere zu blenden und gegeneinander auszuspielen hatte ihm immer Spaß gemacht. Bei diesen Gedanken lächelte er, als müsste er in einem Nonnenkloster um ein Nachtlager bitten. Derweil suchten seine Augen nach den beiden Männern, die er für mögliche Spitzel hielt.
»Mein Anwalt wird dir auch die Namen von drei Leuten nennen, die in der Kellerei für mich arbeiten. Sie waren meinem Großvater verpflichtet, jetzt stehen sie mir gegenüber in der Schuld. Sie beobachten den Deutschen, sie wissen, wo er sich aufhält, kennen seinen Tagesrhythmus, kommen an die Reisepläne, denn er ist viel unterwegs, er kümmert sich um den Vertrieb. Meine Leute zeigen dir, wo er wohnt. Man kommt unauffällig an ihn heran, denn er bewohnt ein Apartment in der Gran Vía del Rey Juan Carlos I., wo sie auf die Calle Marqués de Murrieta trifft. Die Avenida ist sehr belebt, es gibt dort viele Straßencafés, um ihn zu beobachten. Er fährt täglich mit dem Wagen in die Kellerei, die ist ungefähr zehn Kilometer von Logroño entfernt. Die Straße weist einige ziemlich unübersichtliche Stellen auf. Du wirst das alles genau studieren. Im Grunde machst du dieselbe Arbeit wie die Bullen: jemanden observieren, seine Gewohnheiten kennenlernen, sich mit den Schwächen beschäftigen – seine sind die Frauen, besonders die jungen, auf die steht er. Meine Schwester ist knapp zwanzig Jahre jünger als er, damit ist er fast so alt wie mein Vater.«
»Was hat deine Schwester mit ihm zu tun? Arbeitet sie auch in der Kellerei? Ich denke, er …«
»Meine Schwester ist mit ihm verheiratet. Habe ich dir das nicht gesagt?« Diego tat so beiläufig wie möglich, er hatte das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, denn wenn die Familie ins Spiel kam, zuckte mancher zurück, egal, wie hart er sich auch sonst zu geben pflegte.
Rafa setzte an, um etwas zu entgegnen, aber er verkniff sich die Worte, denn ein Gefängnisbeamter bewegte sich auf sie zu. Es war Morales. Schweigend sahen sie ihm entgegen, genau wissend, dass in diesem Moment die Aufmerksamkeit aller Männer im Hof ausschließlich ihnen galt.
»Ist dir entgangen, dass du für heute deinen Anwalt bestellt hast? Brauchst du wieder eine besondere Einladung? Komm mit!« Die Handbewegung des Beamten war eine unmissverständliche Aufforderung, sich sofort zu erheben.
Wie üblich ließ sich Diego damit viel Zeit, womit er der Meute im Hof deutlich machte, dass ihn hier niemand herumkommandierte. Stöhnend erhob er sich, schüttelte die Beine aus, reckte sich und setzte sich provozierend langsam in Bewegung. Mit Morales kam er nicht gut aus, der Beamte ließ sich auf nichts ein, wahrte Distanz, war allen gegenüber misstrauisch und hielt sämtliche Insassen der Strafanstalt für Schwerverbrecher. Ginge es nach Morales, würden alle Gefangenen noch fünf Jahre extra einsitzen. Daher verbot sich mit ihm auch jedes Gespräch, während Diego sonst jede Gelegenheit nutzte, Kontakt mit den Wärtern aufzunehmen, um sie besser kennenzulernen und auf ihre Verwendbarkeit für seine Ziele hin abzuklopfen. Er schlenderte hinter dem Beamten her, die Hände in den Taschen seiner Jeans. Hier trug niemand Häftlingskleidung.
Die Besprechungen mit den Anwälten fanden unter Ausschluss des Gefängnispersonals in einem fensterlosen, schmuddeligen Raum statt, in dem lediglich ein Tisch und zwei Stühle standen. Es gab bislang keinen Hinweis, dass sie hier drinnen abgehört wurden.
Der Anwalt war es gewohnt, auf Diego zu warten. Doctor Miguel Angel Gurpegui Zapatero war ein großer Mann um die fünfzig, seine Körperfülle gab ihm ein gemütliches Aussehen, er saß friedfertig mit gefalteten Händen am Tisch, lächelte versöhnlich, aber die ruhelosen Augen taxierten alles und jeden. Darin ähnelte er seinem Klienten, der gut erzogen sofort nach Betreten des Raums die Hände aus den Hosentaschen zog und eine Verbeugung andeutete.
»Doctor!«
»Señor! Mucho gusto, es ist mir ein Vergnügen.« Zapatero stand auf, deutete ebenfalls eine Verbeugung an und bedankte sich bei dem Beamten, der den Gefangenen gebracht hatte. »Ich würde mich gerne mal mit Ihnen woanders treffen, ehrlich gesagt.«
»Sie sprechen mir aus der Seele, Doctor.« Nach der kurzen Einleitung erkundigte sich Diego nach seiner Familie, nach seiner Gesundheit, nach der Arbeit und fragte dann: »Wie sieht’s aus? Irgendwas Neues?«
»Machen Sie weiter wie bisher, die Gefängnisleitung hat einen guten Eindruck von Ihnen, doch Sie werden sich weiterhin gedulden müssen, ein paar Jahre auf jeden Fall, zwei, wenn nichts dazwischenkommt«, sagte der Anwalt vieldeutig.
Diego kam schnell zur Sache. »Ich habe zwei Aufträge für Sie. Zum einen möchte ich, dass Sie eine zivilrechtliche Klage anstrengen und den Beschluss der Gesellschafterversammlung der Kellerei Peñasco anfechten, dass man mir als Gesellschafter mit dem größten Anteil am Unternehmen das Stimmrecht entzogen hat …«
»Das Thema haben wir bereits durch die Instanzen getrieben, wenn ich nicht irre«, erklärte der Anwalt leicht gereizt. »Wir haben jedes Mal verloren.«
»Dann versuchen wir es eben ein weiteres Mal«, sagte Diego aufbrausend. »Wir müssen den Gesellschaftervertrag in Gänze anfechten.«
»Der ist mit Ihrem Herrn Großvater aufgesetzt worden!«
»Jetzt sind es meine Anteile, und über die bestimme ich allein.« Diegos Blick war hart, und seine Worte kamen scharf.
Zapatero reagierte verblüfft, diese Wendung hatte er offenbar nicht erwartet, er kannte die Hochachtung, die sein Klient sonst für den Großvater äußerte, sie grenzte geradezu an Heiligenverehrung.
»Rollen Sie das Verfahren neu auf, fangen Sie von vorne an, stellen Sie alles infrage. Es werden sich demnächst Veränderungen ergeben …« Diego tat wichtig und geheimnisvoll, die Chefallüren hatte er nie abgelegt. »Aber vielleicht lag der Misserfolg ja auch an der rechtlichen Vertretung?« Er provozierte gern, wenn er meinte, im Recht zu sein. »Vielleicht kennen Sie einen Anwalt, der in dieser Frage besser bewandert ist und entsprechende Erfolge vorweisen kann?«
Diego bluffte, denn auf Zapatero konnte er nicht verzichten. Der Anwalt wusste zu viel, doch das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er koordinierte Diegos Finanzen, schob Geld von einem Konto aufs nächste, ließ es verschwinden, anderen zukommen und wieder auftauchen. Außerdem war er der Anwalt der Bewegung und Mitglied der Alianza Nacional, die Diego finanziell großzügig unterstützte.
»Der Passus der sogenannten Geschäftsschädigung, der wegen meines missratenen Onkels in Chile eingefügt wurde, was man jetzt fälschlicherweise mir vorwirft, muss aus dem Vertrag gestrichen werden. Das Stimmrecht von diesem Deutschen muss ebenfalls gestrichen werden.«
»Um welche Entscheidungen in der Firma geht es Ihnen?«
»Um alle. Mein Vater ist krank, er kann die Geschäfte nicht mehr führen, meine Schwester ist mit anderen Dingen beschäftigt, und meine Tante ist zu dumm dafür, sie ist Sängerin. Hauptsächlich geht es mir darum, dass Meyenbeeker aus dem Vertrag gestrichen wird.« Mit dem rechten Zeigefinger machte er auf der zerkratzten Tischplatte das Zeichen eines Kreuzes.
Das schien Zapatero überhaupt nicht zu gefallen, er sah Diego durchdringend an, als hielte er das Vorhaben für kritisch und letzten Endes überflüssig. »Der Deutsche arbeitet gut, das wissen Sie.«
Das kann er auch vom Rollstuhl aus, dachte Diego und sagte laut: »Es ist so weit. Ende nächster Woche meldet sich bei Ihnen ein Mann namens Rafael Viadero. Es ist der, über den wir gesprochen haben. Er ist mein Vertrauter, er ist oder vielmehr war bei der Frente Atlético aktiv. Erfüllen Sie ihm jeden Wunsch. Händigen Sie ihm fürs Erste dreißigtausend Euro aus.«
»Dreißigtausend? Wofür?«
»Es ist besser, wenn Sie das nicht erfahren.«
»Dann kann ich Ihnen auch keinen Rat geben.«
»Wenn ich einen benötige, frage ich Sie.«
»Sie wissen, was Sie tun?«
»Sehr genau. Schicken Sie an die Adresse, die ich Ihnen gleich nenne, zwei Firmenkataloge.« Diego diktierte ihm die Anschrift. »Meine Leute in der Kellerei sollten wissen, dass jemand kommt, und sich bereithalten. Er nimmt Kontakt mit ihnen auf. Ach, fast hätte ich es vergessen: Es gibt da zwei Männer, über die müssen wir dringend Erkundigungen einziehen, am besten direkt bei der Gefängnisverwaltung oder über die Justizbehörde. Der eine heißt Joan Noriega, kommt aus Palma de Mallorca, der andere …«
Kapitel 2
Sie verabschiedeten sich auf dem Flur. Isabella blickte sich um, und als sie sicher war, dass niemand sie beobachtete, umarmte sie Henry noch einmal und hielt ihn einen Moment lang fest.
»Wir können heute leider nicht zusammen essen. Ich fahre mit Vater nach Bilbao. Wir haben einen Termin bei der Bank, du weißt, weshalb. Aber ich bin früh zurück, heute stehen weder Besuchergruppen noch Händler auf dem Programm, die uns den Abend kaputtmachen könnten.«
Als sie hörte, wie eine Tür geöffnet wurde, löste sie sich schnell aus Henrys Armen. Es war ihr unangenehm, wenn einer der Mitarbeiter der Kellerei sie in dieser sehr privaten Haltung sah. Es spielte für sie dabei weder eine Rolle, dass sie mit Henry verheiratet und die Tochter des Chefs war, noch dass sie zu den Inhabern des Familienunternehmens gehörte. Privates und Berufliches hielt sie strikt auseinander. Über die Ereignisse ihrer Kindheit, die sie menschenscheu hatten werden lassen, wussten nur die ihr Nahestehenden etwas.
Henry gehörte zu den Eingeweihten. Er hatte gelernt, mit ihrem teils schroffen und unnahbar erscheinenden Verhalten umzugehen und es nicht als gegen sich gerichtet zu begreifen. Er lächelte, strich ihr mit der Außenseite seiner Finger über die Wange und wünschte ihr viel Erfolg bei dem Termin, von dem er selbst profitieren würde – es ging um einen Kredit für den Kauf weiterer Weinberge. Er wandte sich ab und betrat sein Büro. Kaum schickte er sich an, das Sakko seines dunklen Anzugs über die Lehne des Schreibtischstuhls zu hängen, klopfte Luisa und trat ohne Aufforderung ein.
Seit er endgültig aus Barcelona nach La Rioja übergesiedelt war und sein Leben als Weinjournalist zugunsten der Tätigkeit als Vertriebsleiter in der Kellerei Peñasco aufgegeben hatte, arbeitete die junge Frau für ihn. Seinetwegen hatte sie die Arbeit in der Kooperative LAGAR aufgegeben. Henry war für sie der ideale Chef, mit dem sie auch eine tiefe Freundschaft verband. Sie verstanden sich ohne viele Worte, sie wusste genau, wie er reagierte, belächelte seine Launen, mokierte sich selten über sein Phlegma, schätzte ein offenes Wort, zumindest ihr gegenüber. Und auch die über sie beide kursierenden Gerüchte brachten Luisa nicht aus der Ruhe. Er war für sie der Retter der Kooperative gewesen und damit der Retter der Existenz ihrer Familie und ihrer Weinberge, mochten es auch nur drei Hektar sein. Doch mit Tempranillo bepflanzt und den über vierzig Jahre alten Rebstöcken stellten sie für Luisa ein Vermögen dar.
Für eine Spanierin war sie recht groß und schlank. Sie trug lachsfarbene Jeans und darüber ein blaues Polohemd mit dem Logo der Kellerei, der Schriftzug Peñasco über einer liegenden Flasche. Sie trug diese Hemden gern, denn sie identifizierte sich voll und ganz mit dem Unternehmen. Ihr schwarzes Haar trug sie kurz und in Stufen geschnitten, was ihr jungenhaftes Aussehen unterstrich. Doch von ihrem Temperament her war sie eher zurückhaltend und vorsichtig, außer wenn ein Kollege sich offenkundig dumm anstellte oder nachlässig war, dann konnte sie sich über die Maßen ereifern, zumal sie stets an der Seite ihres Chefs stand, was sie bei den Kollegen nicht sehr beliebt machte. Es dauerte lange, ihr Vertrauen zu gewinnen. Als Henry erwog, bei Peñasco als Teilhaber einzusteigen und den Vertrieb zu übernehmen, zögerte sie keinen Moment, seinetwegen die Kooperative zu verlassen. Sie war die ordnende Kraft in seinem Rücken, Henry der Mensch mit den Ideen.
Luisa trat mit einem Zettel in der Hand auf ihn zu. »Gerhard Schiller aus Tübingen hat angerufen. Du möchtest ihn bitte zurückrufen, so bald wie möglich – das hat er betont, es sei wichtig, und so hat es sich auch angehört.«
»Der Weinhändler aus Tübingen?« Henry kannte ihn seit einigen Jahren. Schiller war ein guter Kunde, sowohl was die klassischen Riojas von Peñasco betraf wie auch die für dieses Ursprungsgebiet neuen Weinexperimente von LAGAR. Als man die neue Kellerei gebaut hatte, war Henry nach Rioja gekommen, inzwischen stieß man bereits an die Kapazitätsgrenze, da viele Weinbauern sich um eine Mitgliedschaft bewarben. Als cooperativistas, die eigenen Wein produzierten, verdienten sie deutlich mehr, als wenn sie den großen Bodegas lediglich ihre Trauben lieferten. So konnte sich der Vorstand die fähigsten Bewerber aussuchen. Mit Schiller machte auch Peñasco sehr gute Umsätze, und er zahlte pünktlich. Man verkehrte eher freundschaftlich miteinander als geschäftsmäßig, und Henrys Besuche in Deutschland nutzte Schiller, um in seinem Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert Weinpräsentationen für ein ausgewähltes Publikum zu veranstalten, die lange im Voraus ausverkauft waren.
Henry legte den Zettel auf den Schreibtisch und blickte auf die Uhr, es war kurz nach neun. »Ist etwas passiert, dass er so früh anruft? Eigentlich macht er seinen Laden nie vor elf Uhr auf.«
Luisa sprach mittlerweile so gut Deutsch, dass Henry ihr die Gespräche mit den dortigen Kunden überlassen konnte und nicht mehr zum Übersetzen gebraucht wurde.
»Er hat nichts von Problemen gesagt, aber er schien ziemlich aufgeregt zu sein, es war ihm wichtig, dass du so schnell wie möglich zurückrufst.« Luisa reichte ihm den Zettel.
Henry nahm ihn entgegen, und während er sich langsam setzte, las er die Nachricht. Verblüfft sah er auf. »Das ist nicht die Vorwahl von Tübingen. Null-null-drei-vier ist die Vorwahl von Spanien, und sieben-eins-fünf – was ist das …?«
»Mallorca«, sagte Luisa und schien auf irgendeine Anweisung zu warten. Sie entschuldigte sich, weil sie ihn nicht gleich darauf hingewiesen hatte. »Es hörte sich dringend an, ich habe jedoch nicht alles verstanden, was er sagte, es ging um den Kauf eines Weingutes und dass er deine Hilfe braucht. Soll ich ihn …?« Sie streckte die Hand nach dem Zettel aus.
Henry winkte ab, sagte, dass er selbst anrufen würde, aber zuvor einen Kaffee trinken wolle. Er hasste es, im Büro sofort mit Verpflichtungen überfallen zu werden. Aus seiner Zeit als Journalist hatte er die Gewohnheit beibehalten, erst einmal die wichtigen Zeitungen zu lesen und dann die Arbeit zu beginnen. Er kam nur langsam in Fahrt, brauchte einen sachten Anfang, so hatte er sein Leben als Journalist geführt, bestimmt durch die Arbeit, durch die Aufgaben und nicht von Arbeitszeiten eingezwängt, die ihn sowieso nie interessiert hatten. Falls es nötig sein sollte, konnte er gut eine Nacht durcharbeiten. Gestern war es spät geworden, er hatte bis tief in die Nacht die Texte des neuen Flyers korrigiert, nein, besser umgeschrieben, den Entwurf schob er jetzt beiseite, um Platz für den Kaffee zu schaffen, den Luisa ihm hinstellte.
Dass sie seit einem Jahr verheiratet war, hielt sie nicht davon ab, ihm zwar nicht jeden, doch ziemlich viele Wünsche von den Augen abzulesen, nötigenfalls Überstunden zu machen, den Urlaub zu verschieben und ihren Mann warten zu lassen. Und sie sagte klar ihre Meinung und hatte sich als Tochter des Chefs der Kooperative voll in den Aufbau von LAGAR eingebracht, sie verstand vom Weinbau mehr als so mancher studierte Önologe. Ihr Mann war dagegen, dass sie überhaupt arbeitete, man habe es nicht nötig, wie er sagte, »dass du deine Arbeitskraft verkaufst«. Er verdiene genug für zwei, und so ging sie gegen seinen ausdrücklichen Willen täglich zu Peñasco, was der jungen Ehe nicht besonders gut bekam. Luisa brauchte ihre Unabhängigkeit, vom Geld ihres Mannes zu leben wäre für sie unerträglich gewesen. Henry verstand sie, schließlich arbeitete er in der Firma seiner Frau, wozu er sich erst nach etlichen Jahren hatte durchringen können. Der wichtigste Grund war, dass Isabella ihn brauchte, denn ihr Vater, mit dem er sehr gut zurechtkam, litt seit einigen Jahren unter Herzrhythmusstörungen – als Folge unbewältigter Probleme, so jedenfalls sah es Henry.
Er nippte an dem heißen Kaffee und starrte auf den Zettel. Was wollte Schiller? Was machte er in Spanien, wieso rief er ihn an? Gab es Schwierigkeiten mit anderen Lieferanten? Hatte mit der letzten Lieferung nach Tübingen etwas nicht gestimmt? Am Wein konnte es nicht liegen, der war in Ordnung. Wollte er mit ihm über Preise diskutieren? In letzter Zeit wollten alle Kunden über Preise diskutieren, wollten Billigangebote, wollten zwölf Flaschen für den Preis von zehn, um selbst zwölf zum Preis von elf zu verkaufen. Seit er bei Peñasco dem Exportleiter übergeordnet war und die Politik dieser mittelständischen Kellerei verteidigen musste, schlug er sich mit derart schrecklichen Fragen herum.
Er merkte, wie er sich vor dem Anruf drückte, er kannte Schillers Schliche. Etwas daran störte ihn, war ihm unangenehm, er konnte nicht benennen, was es war, zumal er Schiller gut leiden konnte, denn er schätzte ihn und seinen Weinverstand. Doch es war nicht mehr als eine gute geschäftliche Beziehung. Aber der Wunsch, sich vor etwas zu drücken, war für ihn auch eine Aufforderung, die Sache schleunigst hinter sich zu bringen, und er wählte die angegebene Nummer.
»Wo stecken Sie?« Die Telefonnummer war der erste Anknüpfungspunkt mit Schiller. »Ich vermutete Sie in Tübingen …«
»Weit gefehlt, Herr Meyenbeeker«, sagte Schiller, »aber danke, dass Sie so schnell zurückrufen«, und Henry merkte an seiner Stimme, dass der Grund des Anrufs nicht bei Peñasco zu suchen war. »Ich würde mich auch in Tübingen vermuten, aber meine Frau hat mich dazu gebracht, die Koffer zu packen und herzukommen.«
»Sie machen Ferien?«
»Da liegen Sie falsch. Wir sind hier, um uns ein Weingut anzusehen, das wir vielleicht kaufen wollen.«
Henry verschlug es die Sprache.
»Hallo? Meyenbeeker, sind Sie noch da?«
»Sind Sie verrückt?«
»Wieso …« Es klang entrüstet.
»Ein Weingut auf Mallorca?« Henry wiederholte seine Frage, als würde er an Schillers Geisteszustand zweifeln.
Jetzt war es Schiller, dem die Worte fehlten, sein Schweigen dauerte so lange, als wäre der Weinhändler sich auch nicht sicher, ob er im Begriff stand, eine riesige Dummheit zu begehen.
»Ist es zurzeit sehr heiß auf der Insel?«, fragte Henry und schickte ein Lachen hinterher, um der indirekten Frage nach dem Hitzschlag die unhöfliche Spitze zu nehmen.
Schiller stöhnte. »Sie meinen, ob ich zu lange in der Sonne war? Nein, verrückt bin ich nicht«, stammelte er, verwirrt von Henrys Reaktion, »meine Frau ist es, vielleicht. Sie wollte schon immer aufs Land, sie liebt das Landleben, sogar Tübingen ist ihr zu groß. Außerdem ist sie vernarrt in die Insel, und ich wollte schon immer den Wein selber machen, den ich später verkaufe. Mallorca muss es nicht sein, Provence wäre auch möglich. Aber wir haben ein sehr interessantes Angebot bekommen.«
»Die Unterschiede sind ihnen wohl bewusst?« Provence und Mallorca! Unterschiedlicher ging es kaum – Franzosen und Mallorquiner! Henry zwang sich zu einer verbindlicheren Ausdrucksweise, obwohl er Schillers Vorhaben für unrealistisch hielt, wenn nicht sogar für eine Schnapsidee. Ein wenig Wein im Garten anzubauen – gut –, als Hobby – vielleicht –, das war ganz hübsch und machte Spaß, aber ein Weingut, geführt nach betriebswirtschaftlichen Regeln? Schiller war verrückt.
Henry hatte in Deutschland für die Zeitschrift Wein & Terroir gearbeitet, hatte später ein halbes Jahr auf dem Weingut von Isabellas Onkel Cristóbal in Chile hospitiert, anschließend mehrere Jahre lang die wichtigsten Kellereien in Spanien und Portugal besucht und einen Newsletter über hiesige Bodegas, Weinbaumethoden und Weine herausgegeben. Seit drei Jahren war er nun in La Rioja – und verstand sich noch immer als Lernender. Unwille machte sich in ihm breit, er begann, sich über so viel Blauäugigkeit zu ärgern. Es war eine lächerliche Idee.
»Was habe ich damit zu tun? Weshalb rufen Sie mich an? Mir scheint, Sie haben sich längst entschieden. Wozu brauchen Sie dann noch meinen Rat? Macht Ihnen Ihre Vinothek nicht genug Sorgen, oder haben Sie zu viel Geld? Lassen Sie uns nach Jamaika fliegen und Reggae-Bands promoten, da hätten wir beide was davon, zumindest den Musikgenuss und gute Drinks am Strand. Das Geld wäre bei meinem Vorschlag genauso futsch!«
»Ihr Humor in Ehren, Herr Meyenbeeker. Wir meinen es ernst. Wir sind gegenwärtig auf der Insel und haben uns das Weingut Ses Palmes angesehen, darum geht es, es liegt im Osten bei Sineu und gehört zur Denominación Pla i Llevant.« Unmut war aus Schillers Stimme herauszuhören, die jetzt eindringlicher klang. Oder war es Hilflosigkeit? Er schien den Schrecken überwunden zu haben, den Henrys ablehnende Haltung ihm eingejagt haben mochte. »Ihre Meinung respektiere ich selbstverständlich, aber ich brauche Sie hier. Sie müssen kommen, unbedingt, ich wüsste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte.«
»Wozu, wenn bereits alles geklärt ist, so jedenfalls verstehe ich Sie …« Henry starrte das Großfoto an der Wand gegenüber seinem Schreibtisch an, es zeigte Frauen und Männer, die bis zum Hals in grünen Rebgärten standen und Wein lasen, die steil aufragende Sierra de Cantabria im Hintergrund. Sie alle arbeiteten hier, kannten das Land von Kindesbeinen an, Traube und Wein, uva y vino, das waren Worte, die sie bereits als Zweijährige gelernt hatten, vielleicht sogar früher, so wie Luisa. Und Henry sah den Berg Arbeit auf seinem Schreibtisch, Sebastián, sein Schwiegervater, war nur zur Hälfte einsetzbar, und Isabella war weder mit den Arbeiten im Keller noch im Weinberg vertraut. Sie konnte nicht gut mit den Männern umgehen. Außerdem stand wieder eine Reise zu den Exhumierungen in Andalusien an. Könnte Cristóbal, Sebastiáns Bruder aus Chile, einspringen?
Nein, der hatte Besseres zu tun, als Henry den Rücken frei zu halten, damit er einem deutschen Weinhändler dabei half, sich zu ruinieren, ihn dabei zu beraten, wie sich sein Vermögen am besten verbrennen ließ. Henry kannte die harten Seiten des Geschäfts. Schiller sollte sein Kapital in Euromünzen einwechseln und sie einzeln im Hafen von Palma ins Wasser werfen, dann hörte er es wenigstens platschen.
»Ich dachte auch, dass alles klar sei«, meinte Schiller nach einer Pause, »aber nach dem zweiten Gespräch mit der Besitzerin haben meine Frau Ulrike und ich ein komisches Gefühl dabei. Alles klingt gut, aber irgendetwas scheint uns faul an der Sache.«
Komische Gefühle hatte Henry ab und an auch, besonders dann, wenn er schlechten Wein trank oder mit Kunden zu spät essen ging, was ihm nicht bekam. Die spanische Manie, um zweiundzwanzig Uhr ein Restaurant aufzusuchen, war ihm ein Graus. »Wenn es so ist, dann lassen Sie’s einfach sein.« Das hätte er Schiller am liebsten gesagt, doch jetzt hütete er sich, seine Gedanken laut zu äußern.
»Was könnte der Grund für diese … Gefühle sein?«, fragte er diplomatisch. »Glauben Sie, dass man Sie betrügen will? Sie sagten, es handele sich bei dem Verkäufer um eine Frau? Da stellen sich doch tausend Fragen. Ist sie seriös?«
»Sie ist Deutsche …«
Das war für Henry kein Argument. »Weshalb will sie sich vom Besitz trennen? Wie groß ist das Gut, wie viel Land gehört dazu? Ist es ein funktionierendes Weingut, im Markt eingeführt, oder wurde es stillgelegt? Wie sieht es mit Hypotheken aus? Um Ihnen einen Rat zu geben, müsste ich mehr wissen.«
»Sie sollen mir keinen Rat geben, Sie sollen herkommen.«
»Wohin – nach Mallorca?«
»Wohin denn sonst? Nicht nach Tübingen!«
Schiller erzählte, dass seine Frau über eine Anzeige in einer Weinzeitschrift auf das Weingut aufmerksam geworden sei. Das Haus gefalle ihr, ebenfalls die Lage am Fuß eines Berges im Zentrum der Insel, Schiller wusste einiges über vorhandene Einrichtungen und einsatzbereite Maschinen zu sagen, nannte die Anzahl der Gärtanks, der Barriques sowie der großen Holzfässer und war über die Anzahl der gelagerten Flaschen informiert. Zwölf Hektar sollte die mit Weinstöcken bepflanzte Fläche betragen. Hinzu kamen Weideland für Ziegen und Schafe sowie Orangen- und Mandelbäume. Auch einen Gemüsegarten sollte es geben.
»Woher wissen Sie das alles, haben Sie das Inventar gezählt?«
Schiller lachte verschämt. »Nein, vor mir liegt die Projektbeschreibung.«
»Sie sind dort gewesen, wie Sie sagten. Haben Sie mit der Winzerin gesprochen?«
»Winzerin ist eigentlich das falsche Wort, sie ist die Frau des Winzers. Er ist vor einem halben Jahr gestorben, und sie fühlt sich überfordert, von Wein hat sie nicht viel Ahnung, wie sie zugab, und er interessiert sie auch nicht, sonst würde sie Ses Palmes weiterführen.«
Für Henry hörte sich alles normal an, zumal auch die Weine, wie Schiller bestätigte, im Handel eingeführt waren, wobei der größte Teil an Restaurants auf der Insel geliefert wurde. Und Laufkundschaft sollte es auch geben, deutsche Residenten, die dort ihren Vorrat auffüllten. Schiller konnte sich gut vorstellen, mallorquinische Weine in Deutschland zu verkaufen, obwohl er sie bislang nicht im Sortiment führte. Wer Mallorcas Weine auf der Insel kennen und schätzen gelernt hatte, trank sie auch gern nach der Rückkehr weiter. Obwohl sie dann längst nicht mehr so schmecken wie im Urlaub, räumte er ein.
Henrys Gedanken überschlugen sich. Schiller war nicht nur für Peñasco wichtig, auch für LAGAR, für die er die Vertriebswege nach Deutschland geöffnet hatte. Schiller zu verärgern, ihm einen Gefallen auszuschlagen, konnte auf ihn zurückfallen. Aber war eine Reise nach Mallorca nicht zu viel verlangt? Er selbst hatte keine Ahnung von den dortigen Weinen, auch nicht von den autochthonen, den inseltypischen Rebsorten, er war nur einmal vor vielen Jahren auf der Insel gewesen, die er völlig überlaufen fand, außerdem hasste er Salzwasser und langweilte sich am Strand. Und um einige Leute, die dort regelmäßig ihre Ferien verbrachten, machte er lieber einen Bogen.
Aber ob er hinfahren würde oder nicht, konnte er nicht selbst entscheiden. Nichts konnte er mehr allein entscheiden, immer waren sie zu dritt: Isabella und ihr Vater und er, wobei er den geringsten Stimmenanteil hatte, sogar noch geringer als La Cantora, Sebastiáns Schwester, die Sängerin, die sich in letzter Zeit häufiger in der Kellerei nützlich machte. Und da gab es noch die Ratte, Diego Peñasco, nur war ihm das Stimmrecht aberkannt worden, aber von jedem verdienten Euro bekam er fünfundzwanzig Cent – Henry selbst hatte nur Anrecht auf fünf, und das ärgerte ihn maßlos.
Er spielte sein letztes Argument aus. »Sie hatten meinen Newsletter abonniert. Ist Ihnen aufgefallen, dass ich nie über mallorquinische Weine geschrieben habe?« Henry wartete auf eine Entgegnung, aber die blieb aus. »Ich kenne die dortigen Weine nicht, Boden, Klima, Einfluss des Mittelmeeres, das alles ist mir fremd, außerdem verstehe ich kein Mallorquin, und die Insulaner sollen recht sonderlich sein, ein eigenbrötlerisches Volk, wie die Katalanen, die sich nicht gern mit Deutschen mischen.«
»Sie versuchen, mich mit allen Mitteln vom Kauf abzuhalten? Dabei kennen Sie die Situation nicht. Sie enttäuschen mich, Meyenbeeker. Aber zumindest sprechen Sie Spanisch, Sie könnten einiges für mich recherchieren.«
»Auf Mallorca spricht man Mallorquin!« Henry erinnerte sich an die fruchtlosen Diskussionen mit seinem Freund Daniel Pons in Barcelona über das Recht der Katalanen auf ihre eigene Sprache. Lange hatte er es für Unsinn und überflüssig gehalten, Katalan zu lernen, genauso überflüssig, wie es für jemanden, der sich in seiner Heimatstadt Mainz niederließ, war, Hessisch zu sprechen. Erst später hatte er begriffen, dass es hier um Identität ging, um den Widerstand gegen die endgültige Unterwerfung der Katalanen ebenso wie die der Basken unter die Zentralgewalt Madrids, Kastiliens. Ein Jahrhunderte währender Konflikt.
Schiller stieß hörbar die Luft aus. »Also bin ich doppelt auf mich gestellt. Sie wollen mich ins offene Messer laufen lassen?«
»Wer sollte Ihnen ein Messer auf die Brust setzen, Herr Schiller?« Wenn er es derart dramatisch sah, blieb Henry kaum etwas anderes übrig, als auf seine Bitte einzugehen.
»Ja, ich sehe es so. Wir hatten bislang zwei Treffen mit Gesine Fröhlich. Nach den Treffen war eigentlich alles klar, nur dieses Gefühl hat sich verstärkt, ich kann Ihnen nicht sagen, woher es kommt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich würde ja Erkundigungen in der Nachbarschaft einziehen, wenn ich könnte, aber ich würde wahrscheinlich von einem Fettnäpfchen ins nächste tappen und der Frau vielleicht Unrecht tun. Sie aber …«
Henry dachte an einige tausend Euro, die sie mit Schiller verdient hatten. »Gut, Herr Schiller, Sie haben mich überzeugt. Ich helfe Ihnen.«
»Na …«, plötzlich war es Schiller, der skeptisch reagierte, »sehr überzeugt klingt mir das nicht, mehr nach überredet, aber mir soll’s recht sein, Hauptsache ist, dass Sie kommen. Ich nehme Ihre Hilfe an. Außer Ihnen kenne ich niemanden, auf den ich mich in dieser Sache verlassen könnte. Wann können Sie hier sein?«
»Ich werde das mit meinen Partnern absprechen müssen. Ich hoffe nur, dass man mich entbehren kann. Wie viele Tage werden Sie mich brauchen, was glauben Sie?«
»Woher soll ich das wissen? Sie haben Erfahrung mit Recherchen, nicht ich. Möglicherweise sagen Sie mir bereits nach einem Tag, dass es eine Schnapsidee war, Ses Palmes zu kaufen. Aber bitte erst, nachdem Sie es gesehen haben.«
Das brauche ich nicht zu sehen, dachte Henry, nachdem das Gespräch beendet war. Im Gegensatz zu Schiller wusste er von massiven Grundstücksspekulationen auf Mallorca, von Korruptionsskandalen inklusive Dokumentenfälschungen, die Liste der Vergehen war lang, und etliche Beteiligte, auch Mitglieder der Inselregierung, saßen bereits in Untersuchungshaft oder waren auf Kaution entlassen. Schiller sollte sich dringend einen Anwalt nehmen. Nur woher sollte er wissen, ob der zuverlässig war oder ebenfalls korrupt und für die Gegenseite arbeitete? Verfahrensfehler einzubauen, deren negative Auswirkungen dann auf den Käufer zurückfielen, war ein Leichtes.
Er erklärte Luisa kurz, worum es ging. Auch sie hielt die Idee für unsinnig, aber sie würde ihm für übermorgen einen Flug von Bilbao nach Palma de Mallorca buchen. Er wäre lieber mit dem Wagen gefahren, nur war der Transfer von Barcelona aus mit der Fähre extrem teuer, außerdem würde Schiller auf der Insel für ihn den Fahrer spielen. Das war das Mindeste, was er erwarten konnte.
Kapitel 3
Isabella kam spät aus Bilbao zurück. Die Verhandlungen waren erfolgreich verlaufen, Peñasco würde die Kredite erhalten und die Weinberge wie beabsichtigt kaufen.
»Bei den heutigen Preisen wird es Jahrzehnte dauern, bis sie sich amortisiert haben«, unkte Henry beim Abendessen auf der Dachterrasse ihres Penthouse, obwohl er nicht zu den notorischen Bedenkenträgern gehörte.
»Heutzutage etwas anderes als Sachwerte zu erwerben wäre bei der katastrophalen spanischen Wirtschaftslage dumm«, meinte Isabella. Sie schlüpfte nach der Dusche vom grauen Kostüm in eine bunte Seidenbluse und Shorts, und das sonst streng nach hinten genommene Haar hing nass über ihre Schultern. Die Füße in Flipflops – nichts erinnerte mehr an die junge energische Geschäftsfrau, die eher hart als diplomatisch verhandelte. Ihre Argumente Henry gegenüber brachte sie häufig ähnlich kategorisch vor. »So bleibt der Besitz in der Familie.«
In Geldangelegenheiten und ökonomischer Weitsicht war Isabella Henry weit voraus, sie managte die Finanzen des Familienunternehmens mit kluger Hand. Dabei hatte sie zum Leidwesen der Familie nach dem bachillerato und dem frühen Tod ihrer Mutter spanische Geschichte studiert. Und um dieser Familie zu entgehen, besonders ihrem schrecklichen Großvater, Don Horácio, hatte sie Sevilla als möglichst weit entfernten Studienort gewählt und, wie sich erst später herausstellte, auch Wirtschaftswissenschaften belegt.
Henry kannte ihr gespanntes Verhältnis zur Familie, noch immer machte sie es ihrem Vater zum stillen Vorwurf, dass er sich gegen den seinen nicht durchgesetzt und dem geschäftsschädigenden Treiben seines Sohnes Diego tatenlos zugesehen hatte. Von der Familie Peñasco jedoch, in deren Händen der gesamte Besitz bleiben sollte, war nicht viel übrig. Nur Henry war hinzugekommen. Isabella sah sich noch zu sehr in ihrer eigenen Vergangenheit gefangen, als dass sie Kinder haben wollte, und Henry hatte die fünfzig bereits überschritten. Da waren mögliche Erben nicht in Sicht. Oder hat sich ihre Einstellung unbemerkt verändert, dachte Henry, wenn sie so redet? Wen meinte sie, wenn sie davon sprach, dass der Besitz in der Familie bleiben sollte?
Während des Essens berichtete er ihr von seinem Telefonat mit Schiller.
Mit dem Gedanken, dass Henry für einige Tage verreisen würde, konnte sich Isabella überhaupt nicht anfreunden. Sie hielt seine Gegenwart für unentbehrlich, zumal sie ihren gesundheitlich angegriffenen Vater schonen musste, wie sie betonte. Obwohl ihre Vorhaltungen mehr oder weniger berechtigt waren, gefielen sie Henry überhaupt nicht, der sich bereits mit der Idee einer kurzen Reise angefreundet hatte. Jetzt war er war neugierig, wie es auf Mallorca nach zwanzig Jahren aussah. Man las vieles, aber der eigene Eindruck war entscheidend. Mallorca war für ihn ein Kunstprodukt, ein Ferienklub, fest in deutscher Hand.
»Ist dir deine neue Aufgabe bereits zu langweilig? Brauchst du neue Abenteuer?« Isabellas Augen zeigten mehr Besorgnis als Ärger. »Wenn es so ist, wärst du besser nicht bei uns eingestiegen. Du bist wichtig, das Unternehmen muss mit dir rechnen können, ich muss es auch. Du bist doch oft genug unterwegs. Oder bricht etwa der Journalist wieder durch? Ich habe genau das befürchtet, genau das habe ich dir vorausgesagt, als du bei uns Verantwortung übernommen hast. Die gilt in erster Linie uns gegenüber, Vater und mir, dann kommen die Mitarbeiter, und erst an dritter Stelle kommt ein einzelner Kunde.«
Mit derart heftigem Widerstand hatte Henry nicht gerechnet. »Schiller zu helfen ist wichtig, es ist eine Sache, die letztlich ihm und damit sowohl Peñasco wie auch LAGAR nutzt, und die Genossen sind genau wie ich am Unternehmen beteiligt. Das hast sogar du damals eingefädelt, als die Sache mit den enteigneten Weinbergen herausgekommen war; du warst die treibende Kraft dahinter, dass die Genossen entschädigt wurden.«
»Du hast schon immer geschickt argumentiert.« Isabella schwankte zwischen Verständnis für ihren Mann und der Pflicht dem Unternehmen gegenüber, sie verkniff sich ein bewunderndes Lächeln, denn sie schätzte viele seiner Eigenschaften. Sie griff zu ihrem Glas, erhob sich, ging zur Brüstung und schaute über das nächtliche Logroño. In der Ferne erschienen die Dörfer der Rioja entlang des Rio Ebro lediglich als kleine Lichtflecken. Dunkel stand dahinter die Sierra de Cantabria. Isabella empfand die mehr als eintausend Meter hohe Steilwand als schützend und bedrohlich zugleich. Den größten Teil ihres Lebens hatte sie die Sierra vor Augen gehabt. »Du hättest Priester werden sollen, Henry, man könnte bei deiner Argumentation meinen, du hättest ein Jesuitenkolleg besucht.«
»So schlimm war die katholische Oberschule nicht, außerdem argumentierst du nicht weniger geschickt.«
»Das habe ich von dir gelernt.«
Henry nahm ebenfalls sein Glas zur Hand und stieß mit Isabella an, die ihrerseits zögerte. »Schlichtung?«
Er lachte. Er ließ sich ungern aus der Ruhe bringen, er hasste Streit und vermied ihn, wenn es nur irgend möglich war. Erst wenn es sich partout nicht vermeiden ließ, nahm er die Herausforderung an. Dann kämpfte er auch – nur nicht mit ihr, da brach er jede Debatte vor dem möglichen kritischen Punkt ab. Er ertrug es nicht, wenn sie ihm gram war, wenn sie unglücklich schien; und wenn sie zweifelte, tat er alles ihm Mögliche, diese Zweifel zu zerstreuen oder für eine rasche Klärung zu sorgen. Doch hier und heute meinte er das Richtige zu tun, nein, das einzig Mögliche.
»Es ist die Art und Weise, in der Schiller mich gebeten hat, ihm zu helfen. Wenn er sich mit dem Kauf verausgabt, wie soll er unsere Rechnungen bezahlen? Er wird sich in den Weinbau stürzen, dann kommen Anforderungen auf ihn zu, von denen er keinen blassen Schimmer hat, theoretisch vielleicht, aber die Praxis sieht immer anders aus, und er wird sein Geschäft in Tübingen vernachlässigen. Man kann sich nicht zerreißen. Beides richtig zu machen ist kaum möglich, jedenfalls für ihn. Er ist kein Manager. Er will selbst handeln, selbst seine Kunden bedienen, um ihre Wünsche zu verstehen und den Kontakt nicht zu verlieren. Und im Weinberg wird er nicht anders sein, da muss er sehen, fühlen, riechen und schmecken, er muss präsent sein!«
»Du hast gesagt, dass er zuverlässige Mitarbeiter hat.«
»Wie fähig die manchmal sind und wie wenig willens, sich entsprechend einzusetzen, weißt du selbst. Außerdem hat er erwähnt, dass sich zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch mit der Besitzerin etwas verändert haben muss, dass er das merkwürdige Gefühl gehabt hat, dass irgendetwas faul an der Sache sei.«
»Na bitte, da haben wir’s. Das ist der Knackpunkt. Henry Meyenbeeker, wie er leibt und lebt. Das ist es, was dich reizt, dass da was faul ist, vielleicht etwas Verborgenes, ungeahnte Hintergründe, das ist der Spürhund in dir, da geschieht etwas, dem du nachgehen musst. Wie damals, als du hergekommen bist. Versteh es bitte nicht falsch.«
Isabella sagte es, ohne vorwurfsvoll zu klingen, eher fatalistisch einem Wesenszug Henrys gegenüber, der nicht zu ändern war, bei dem ihr nichts anderes übrig blieb, als ihn zu akzeptieren. So war er, und er würde sich nie ändern. Und es war der Mann, den sie liebte.
»Langweilst du dich hier? Ist es dir zu wenig aufregend, Wein zu verkaufen, in Europa herumzureisen und Weinhändler zu treffen, dir Strategien zu überlegen, wie wir nach vorn kommen, mit den Freunden von LAGAR neue Produktlinien zu entwerfen, die Trauben wachsen zu sehen, auf den Regen zu warten, auf den Austrieb, dabei zu sein, wenn aus Trauben Weine werden, dabei mit unseren vielen Mitarbeitern umzugehen, an einer gemeinsamen Aufgabe zu arbeiten?« Isabella merkte, dass Henry bei den letzten Worten zu lächeln begonnen hatte. Diesen Ausdruck kannte sie aus anderen Debatten: Jetzt würde er mit unschlagbaren Argumenten kontern.