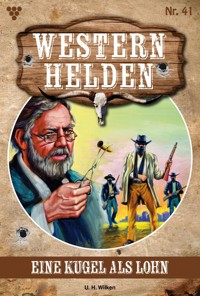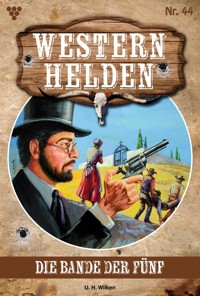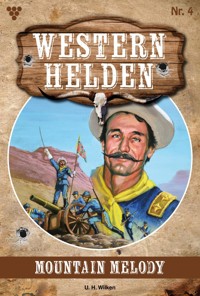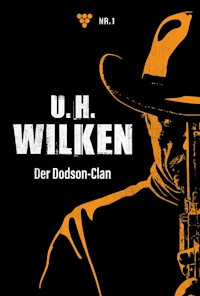
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: U.H. Wilken
- Sprache: Deutsch
U. H. Wilken war einer der ganz großen Autoren, die den Western prägten und entscheidend zum Erfolg dieses Genres beitrugen. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. U. H. Wilken ist zugleich einer der bestinformierten Autoren und kennt sich genau in der Historie des Wilden Westens aus. Was er schreibt, lässt sich hautnah belegen. Ein Meister seines Fachs, der mit Leidenschaft und Herzblut die großen Geschichten nachzeichnet, die sich in der Gründerzeit ereigneten. Das wilde Rudel jagt übers Land. Dicht vor den Hügelfalten zieht es sich auseinander. Und es taucht zwischen den Hügeln unter, und der Wind treibt den Staub davon. Im Norden tobt ein Unwetter, jenseits der Bergkette. Dort zucken grelle Blitze über den dunkel drohenden Horizont, krachen die Donnerschläge und geht der Regen prasselnd hernieder, vom Sturm gepeitscht. Und der Sturm holt die Reiter ein, faucht scharf übers Land, zerfetzt die Bergerlen und Lärchen, schlägt das graugrüne Blätterwerk der Sträucher ab und treibt den Sand von den Hügeln hoch, schleudert die harten Sandkristalle auf die Rücken der Reiter, die auf einmal verharren, die stumm und reglos auf den keuchenden Pferden hocken und einen großen offenen Halbkreis bilden. Sie alle starren auf ihren Boß, mit dem sie in die Hügel geritten sind. Langsam, zögernd und schwerfällig steigt Grant Dodson vom tänzelnden Pferd, läßt die Zügel los und geht mit schweren, schleppenden Schritten zu dem Cowboy, der neben der liegenden Gestalt steht. Nur die Schritte sind im Moment zu hören, das Mahlen der Stiefel im steinigen Sand. Dann steht Grant Dodson, als habe ihn plötzlich der eisige Blizzard getroffen und mitten in der Bewegung vereist. Und der Cowboy, der da vor ihm steht, hat Wasser in den Augen. Zu seinen Füßen liegt ein junger Mann, lang hingestreckt, mit dem Gesicht nach unten. Abgerissene, vom Sturm durch die Luft gewirbelte Blätter fallen auf den Toten, werden von neuen Windstößen erfaßt und davongetragen. Wind orgelt zwischen den Hügeln. Das Unwetter zieht näher. Die Reiter rühren sich nicht. Und Grant Dodson bewegt sich auf einmal um zwei Schritte weiter nach vorn, bis er mit den Stiefeln fast die Absätze des Toten berührt. Pferde schnauben. Der breite Rücken des Ranchers ist krumm; er hat sich nach vorn gebeugt, als trage er eine schwere Last. In seinen Fingern zuckt es.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
U.H. Wilken – 1 –Der Dodson-Clan
U.H. Wilken
Das wilde Rudel jagt übers Land. Dicht vor den Hügelfalten zieht es sich auseinander. Und es taucht zwischen den Hügeln unter, und der Wind treibt den Staub davon.
Im Norden tobt ein Unwetter, jenseits der Bergkette. Dort zucken grelle Blitze über den dunkel drohenden Horizont, krachen die Donnerschläge und geht der Regen prasselnd hernieder, vom Sturm gepeitscht. Und der Sturm holt die Reiter ein, faucht scharf übers Land, zerfetzt die Bergerlen und Lärchen, schlägt das graugrüne Blätterwerk der Sträucher ab und treibt den Sand von den Hügeln hoch, schleudert die harten Sandkristalle auf die Rücken der Reiter, die auf einmal verharren, die stumm und reglos auf den keuchenden Pferden hocken und einen großen offenen Halbkreis bilden.
Sie alle starren auf ihren Boß, mit dem sie in die Hügel geritten sind. Langsam, zögernd und schwerfällig steigt Grant Dodson vom tänzelnden Pferd, läßt die Zügel los und geht mit schweren, schleppenden Schritten zu dem Cowboy, der neben der liegenden Gestalt steht. Nur die Schritte sind im Moment zu hören, das Mahlen der Stiefel im steinigen Sand.
Dann steht Grant Dodson, als habe ihn plötzlich der eisige Blizzard getroffen und mitten in der Bewegung vereist.
Und der Cowboy, der da vor ihm steht, hat Wasser in den Augen.
Zu seinen Füßen liegt ein junger Mann, lang hingestreckt, mit dem Gesicht nach unten. Abgerissene, vom Sturm durch die Luft gewirbelte Blätter fallen auf den Toten, werden von neuen Windstößen erfaßt und davongetragen. Wind orgelt zwischen den Hügeln.
Das Unwetter zieht näher.
Die Reiter rühren sich nicht.
Und Grant Dodson bewegt sich auf einmal um zwei Schritte weiter nach vorn, bis er mit den Stiefeln fast die Absätze des Toten berührt.
Pferde schnauben.
Der breite Rücken des Ranchers ist krumm; er hat sich nach vorn gebeugt, als trage er eine schwere Last. In seinen Fingern zuckt es. Er ballt die Hände zu Fäusten und öffnet sie wieder. Schwer und mühsam geht sein Atem.
Kalter Wind fegt über das schweigende Rudel hinweg. Die Kälte läßt den Bergwinter ahnen.
Grant Dodson hebt den Blick.
Der Cowboy will sprechen – doch Dodson bewegt schwach die Hand.
Geh, heißt das, und laß mich allein.
Und der Cowboy geht in großem Bogen um den Toten herum und zu den Reitern, und er sieht kaum jemandem in die Augen. Er wollte alles sagen, wollte Dodson alles erklären. Wir fanden ihn, als wir nach entlaufenden Rindern suchten, wollte er sagen. Wir, Johnny und ich. Wir ritten hier zwischen den Hügeln umher und suchten. Da sahen wir zwei Reiter. Sie ritten nach Westen. Wir sahen ihre Federn, ihre Pferde – es waren Indianer. Und wir ritten weiter und vergaßen die Indsmen. Aber dann stießen wir auf Cliff. Er war schon tot, Boß. Und Johnny ritt sofort zur Ranch.
Er sagt es nicht, geht stumm durch die Kette der Reiter und bleibt zwischen den Felsen stehen, starrt auf die Rücken der Reiter und sucht dann Grant Dodson. »Mein Junge«, flüsterte Grant mit zerrissener Stimme, »mein Sohn Cliff. Großer Gott, warum...«
Niemand hört ihn.
Das Unwetter brüllt. Die Pferde sind unruhig. Grau und verhangen ist der Himmel, und von Norden zieht es tief und schwarz heran. Blitze erhellen sekundenlang das wilde, zerklüftete Land mit fahlem, bleichem Licht, und die Hügel treten dann jäh aus dem tristen verschwommenen Dunst hervor wie wilde Tiere, die sich plötzlich aufbäumen.
Dodson nimmt den durchgeschwitzten Stetson ab, hält ihn in der schlaffen Hand und bewegt die Lippen.
Und dann dreht er sich um und blickt die Reiter an. Jeden einzeln und nacheinander, als suche er den Mörder unter ihnen. Es sind hartgesottene Burschen, rauhe Kerle – aber sie alle fühlen sich furchtbar flau und scheußlich, als er sie alle so forschend anstarrt.
»Wo sind seine Brüder?« fragt er mit rauher fremder Stimme. »Wo sind sie, Tate, Lance?«
»Ich bin hier, Dad«, sagt Tate ganz rechts mit verzerrter Stimme.
»Und Lance?«
Dodson fragt ruhig, so ruhig und leidenschaftslos, wie er sonst immer spricht, wenn er die Mannschaft einteilt, um die Männer auf die große Weide zwischen den Hügeln und Bergen zu schicken.
»Lance ist weggeritten, Boß – vor Stunden schon«, antwortet ein Reiter leise.
Um Dodsons Mund zuckt es.
»Nach Bear River, nicht wahr?« fragt er klanglos. »Nach dieser höllischen Schienenstadt, die...« Er schweigt.
Der Reiter nickt.
Da sieht es so aus, als falle Dodson in sich zusammen.
»Meine Söhne«, sagt er bitter, »meine Söhne.«
Und jeder weiß, daß er die Schienenstadt Bear River haßt und verabscheut und daß er seinem Sohn Lance niemals erlaubt hat, auch nie gestatten wird, nach Bear River zu reiten. Und jetzt, da er seine Söhne braucht, fehlt Lance, angelockt vom wilden ungezügelten Leben des riesigen Camps der Union Pacific.
Als Tate zögernd näher tritt, sagt der Rancher schwer:
»Bringen wir Cliff zur Ranch. Faß an, Tate.«
Sie heben den Toten an und tragen ihn vorsichtig durch den strömenden Regen zu den Pferden.
Grant Dodsons Antlitz ist so reglos wie aus Stein. Hinter der zerfurchten Stirn hämmern die quälenden Gedanken auf ihn ein. Das Unwetter umtobt ihn, und alles um ihn herum ist nur noch düsterer, noch schlimmer.
Cliff Dodson ist tot – aus dem Hinterhalt ermordet!
Es gibt hier in den Bergen von Wyoming, weit südlich der mächtigen Wind River Range, kaum einen Rancher und Mann, der mächtiger ist als Grant Dodson. Er hat die Macht in seinen Händen. Die Treue seiner Reiter reicht bis in die Hölle.
Er wird es nicht still hinnehmen, daß man ihm den Sohn getötet hat. Er wird die Mörder suchen.
Die Zeit ist schlimm geworden, seitdem die Union Pacific ihren Weg aus Stahl durch dieses Land treibt, um sich in Ogden im Utah-Territorium mit der Central Pacific Railroad zu treffen.
Bear River ist die Hölle.
Und der Tod ist überall.
*
Ein Mann kommt durch das weite Tal geritten. Er lenkt sein Reittier langsam nach der Dodson Ranch, und selbst der Regen kann ihn nicht zur Eile antreiben.
Der Mann ist groß, schlank und sehnig. Sein wetterhartes Gesicht zeigt viele Falten und Furchen. Die Augen sind zusammengekniffen und von einer eisigen Kälte und nur wenn dieser Mann lächelt, kommt heller Glanz in die Augen.
Schon von weitem erkennt er, daß die Ranch ohne Reiter ist. Im grauen Tageslicht sieht er den Hof leer und öde zwischen Ranchhaus und Schlafbaracke liegen. Und als er näher kommt, hört er die Luke klappern und eine Tür schlagen, vom Wind bewegt.
Sie sind alle im Sattel, denkt er nur und zügelt sein Tier unter dem hervorstehenden Dach des großen Pferdestalls. Er sitzt ab, streift den Zügel über und geht über den Hof, und die ledernen Chaps schlagen klatschend aneinander.
Die Tür des Ranchhauses ist zu. Er klopft mit dem Coltkolben an, wartet und horcht, und als sich niemand sehen läßt, öffnet er die Tür und geht ins Haus. Wind faßt hinter die Tür und drückt sie weg. Regenfäden kommen herein. Der Mann packt die Tür fester, zieht sie hinter sich zu. Und er verharrt horchend im Haus, hört das Rauschen des Regens auf dem Dach und das leise Knacken des Holzes.
»Ethan ist hier!« ruft er mit rauher Stimme. »John Ethan!«
Er bekommt keine Antwort.
Da geht er weiter, und dann kommt er in den großen Wohnraum der Dodson Ranch. Und hier erstarrt er schlagartig und hält den Atem an.
Dort auf der Ledercouch liegt Cliff Dodson! Nur das bleiche reglose Gesicht ist zu sehen; der Körper wird von einer Decke verhüllt.
Ethan wendet sich ab und geht hinaus. Und als er aus dem Haus tritt, sieht er Belle Dodson und ihre Tochter Ruth auf dem Hof im Regen stehen.
Die Ranchersfrau sieht ihn fast leblos an.
John Ethan atmet schwer ein.
Das Girl aber verzerrt das Gesicht zu erzwungenem Lächeln und ruft mit erstickter Stimme:
»Onkel Ethan!«
Und es läuft zu ihm, der gar nicht sein Onkel ist und nur so genannt wird, weil er mit ihm ins Land gekommen ist, vor vielen Jahren schon. Sie kamen mit Prärieschonern ins Land, und als die Achsen und Räder brachen, spannten sie die Zugochsen aus und schlugen Bäume, um sich eine Heimstätte zu bauen.
Seit jener Zeit ist Onkel Ethan ihr Onkel, und er hat bestimmt nichts dagegen. In seinen Augen ist ein eigenartiges Flackern, als sich das fast schon erwachsene Girl an ihn preßt und zu weinen beginnt. Er legt die große Hand auf Ruths zitternden Rücken, versucht, sie zu beruhigen. Dabei sieht er auf Belle Dodson, die mit steifen, abgehackten und mühsamen Bewegungen näher kommt.
Sie bleibt dicht vor ihm stehen und blickt zu ihm auf mit Augen, die keine einzige Träne mehr hervorbringen können. Sie will sprechen, hebt dabei die Hand und läßt es dann sein. Und sie geht weiter, an ihnen vorbei und ins Haus.
»Ruth«, murmelt er. »Ruth, Mädel, was ist geschehen? Ich war im Haus, ich habe ihn gesehen.«
Er spürt, wie sie sich zusammenreißt und wie sie sich strafft.
»Sie haben ihn umgebracht!« sagt sie laut und anklagend und hat das Gesicht noch immer halb an ihn gepreßt, so daß er ihren heißen Atem durchs nasse Hemd hindurch spürt. »Umgebracht, diese Mörder!«
»Wer, Ruth?«
»Indsmen!« stöhnt das Mädel.
John Ethan umfaßt Ruth Dodsons Schultern und drückt sie sanft von sich weg, so daß er in ihr Antlitz sehen kann.
»Wo ist dein Vater, wo sind deine Brüder und die Männer, Ruth?«
»Sie sind weggeritten«, sagt sie mühsam. »Sie haben Cliff hergebracht und sind dann sofort wieder davongeritten. Sie wollen die Mörder suchen! Und mein Vater will Lance aus Bear River holen. Himmel, warum mußte das geschehen, Onkel Ethan? Mein Bruder war ein feiner Kerl, das weißt du doch auch. Ich...«
Sie wirft sich an ihn.
»Wir leben in einem grausamen Land, Mädel«, murmelt Ethan schwer. »Der Tod lauert überall. Deine Mutter darf nicht allein sein. Seid ihr beide allein auf der Ranch?«
»Nein, drei Ranchhelfer sind hier. Du siehst sie nur nicht, weil sie auf dem Hügel dort sind. Von dort haben sie einen weiten Blick ins Tal. Sie haben dich erkannt, Onkel Ethan.«
»Ja. Gehen wir, Ruth.«
Sie gehen ins Haus. Belle Dodson steht am Fenster und blickt hinaus. Und sagt mit schwankender Stimme:
»Er ist anders geworden. Er will die Mörder finden, und er wird über das Land reiten und suchen, suchen, suchen, bis er die Mörder gefunden hat. Und dann wird er zurückkommen und kein Herz mehr haben. Ethan, du mußt zu ihm. Hol ihn zurück, bevor es zu spät ist! Du bist sein Freund. Nur du kannst das schaffen; nur auf dich wird er hören. Er will seinen Sohn nicht eher beerdigen, bevor er die Mörder gefunden hat! Er glaubt, sie schnell zu finden – aber es werden Tage vergehen, ich spüre es. Ethan, du mußt sofort zu ihm reiten!«
Sie dreht sich mit heftiger Bewegung herum und blickte ihn flehentlich an. Ihre Hände zittern.
»Mam’!« Ruth geht zu ihr und hält sie.
»Wir sind noch stark genug, Ethan«, sagt Belle Dodson mühsam. »Wir können warten. Aber morgen, Ethan, morgen...«
Er nickt.
»Heute nacht bin ich zurück«, murmelt er, »mit Grant!«
Er macht kehrt und geht hinaus. Sie hören seine Chaps schlagen. Er überquert den regennassen Hof, sitzt auf und reitet davon, ins Tal hinaus.
Und Belle Dodson und ihre Tochter stehen am Fenster und sehen dem Reiter nach.
»Onkel Ethan läßt die eigene Ranch allein, Mam’«, flüstert Ruth bedrückt. »Wenn nun die Indsmen die Ranch angreifen? Dann ist Rico allein. Er hat doch nur Rico, seinen Sohn!«
»Mein Gott!« Belle Dodson erschrickt und wird noch grauer im Gesicht. »Ich hab’ ihn hinausgeschickt, und er tut es, weil er unser Freund ist. Die Freundschaft ist ihm soviel wert! Und sein Junge ist allein auf der Ranch! Um Himmels willen, was habe ich da getan?«
»Onkel Ethan, wird seinen Sohn nicht vergessen, Mam’«, sagt Ruth nachdenklich. »Er wird an Rico denken. Rico ist älter als ich, zwei Jahre sind viel, vielleicht denkt Onkel Ethan daran, und vielleicht ist Rico erwachsen und stark genug, um die Sioux oder Cheyennes so lange zurückhalten zu können, bis Onkel Ethan zurückkommt. Und bis jetzt ist auch kein Überfall erfolgt. Wir sehen schon Gespenster, Mam’!«
»Das ist kein Wunder«, sagt die Frau gequält. »Oh, ich hoffe nur, daß dein Vater heute noch zurückkommt. Allein halt ich es in diesem Haus nicht länger aus!«
Ihr Blick sucht das Totenlager und haftet am blassen Gesicht des Sohnes. Und sie geht hin und setzt sich zu ihm. Als Ruth das sieht, wendet sie sich schnell ab und läuft hinaus. Und der Regen trifft sie, rauscht vom grauen Himmel und prasselt auf die geteerten Dächer. Das Wasser sammelt sich auf dem engen Hof und an den Hauswänden. Laut platscht das Wasser vom Vordach des Pferdestalls.
John Ethan ist schon nicht mehr zu sehen. Der Regenvorhang ist zu dicht.
Das Mädel steht in seinen derben Reithosen reglos im Regen und fürchtet sich vor der Rückkehr ins Haus. Das Tal liegt trist und trostlos unter dem lichtlosen Himmel. Irgendwo draußen stehen die unbewachten Herden. Und dort hinter dem Hügel liegt Bear River City, säumen Hunderte von Bretterbuden und Zelten den Schienenstrang nach Westen.
*
»Mach endlich das verdammte Licht an!« brüllt jemand heiser und schlägt mit der Faust auf den verschmutzten Tisch, »oder ich brenn dir die Bude ab!«
Der Keeper hinter der langen Theke aus Kisten und Brettern gibt zwei Männern am Ausgang einen Wink. Die Burschen setzten sich sofort in Bewegung, nähern sich dem Gast, packen ihn plötzlich und schlagen zu. Aufstöhnend bricht er zusammen. Sie zerren den Bewußtlosen hoch und zur Tür hinaus. Draußen stoßen sie ihn in den Dreck der breiten Straße.
»Bastard!« sagt einer verächtlich.
Sie gehen zurück.
In der Saloonbude tobt, brüllt, lacht und lärmt es. Tische, Hocker und Theke sind besetzt. Bier und Whisky wird in Unmengen getrunken. Scharfer Geruch von Schweiß und erstickender Tabakrauch füllen den engen Saloon. Animiergirls eilen behende umher.
Irgendein Mann, der zu diesem Saloon gehören mag, stellt die brennenden Lampen auf. Alkohollachen bedecken manchen Tisch.
»He – Dodson!« ruft jemand durch den verräucherten Saloon.
Am hinteren Tisch richtet sich ein junger blonder Bursche auf. Alkohol hat seinen Blick betrübt.
»Was zum Teufel willst du?« brüllt er zur Tür hinüber. Er muß sich am Tisch festhalten. Ein Glas kippt um und rollt vom Tisch, zerspringt klirrend. Die Spieler am Tisch werfen sich schnelle Blicke zu. Sie wissen, daß sie diesen Ranchersohn nun ausnehmen können.
»Dein Alter ist in Bear River! Ich hab’ ihn hinten an den Schienen gesehen!« antwortet der Mann an der Tür, lacht heiser und verschwindet.
Lance Dodson setzt sich schwer.
»Mein Alter ist hier!« sagt er schleppend. »Ich muß verschwinden. Wenn er mich hier sieht, ist es aus, für immer! Ich muß weg, hört ihr? Verschwinden, sofort – sonst ist es zu spät!«
»Erst das Spiel zu Ende!« sagt einer der Kartenhaie kalt.
»Ihr Hunde!« zischt der Ranchersohn wütend. »Ihr wollt mich fertigmachen, wie? Ich...«
Da bohrt ihm der Nebenmann den Coltlauf hart in die Seite.
»Halts Maul! Nimm die Karten wieder! Wird’s bald? Hier wird gespielt, wie es sich gehört!«
Er muß gehorchen!
Das Spiel geht weiter.
Wieder kommt ein Schwung verschwitzter Männer herein. Draußen an den Schienen hat die nächste Schicht begonnen. Diese Männer haben zwölf Stunden Arbeit hinter sich. Und jetzt kommen sie in diesen Saloon und in viele andere dieser wilden, ungezügelten Stadt, um sich auszutoben, um vergessen zu wollen.
Lance Dodson blickt starr zur Tür. Erst als der letzte Arbeiter im Saloon ist, sieht er wieder auf die Karten.
»Dein Alter findet dich schon nicht«, höhnt einer der Spieler. »Und wenn er doch hereinkommen sollte, dann nehmen wir dich schon in Schutz.«
Die anderen lachen hämisch.
Lance schluckt trocken. Wut macht ihn unruhig. Er spürt, wie es in ihm kocht.
Im Raum schlagen sich zwei Männer um einen kleinen Platz. Tische stürzen, Hocker fallen, Gläser zerklirren, und nur die trockenen Schläge sind zu hören, das Keuchen der Raufbolde und ihr haßerfülltes Knurren.
An vier Tischen wird gespielt. Keiner der Spieler sieht zu den Streitenden hinüber. Das Spiel ist wichtiger.
Lance Dodson spürt, wie die Karten kleben. Schweiß springt aus den Poren, steht auf der Stirn. Ihm wird heiß. Das Hemd klebt ihm am Körper. Er blickt schnell hoch, die Spieler an – er sieht in ausdruckslose Gesichter. Und dieser Anblick läßt ihn wieder nüchtern werden.
Er horcht. Die Streitenden schlagen sich gegenseitig zusammen. Ein paar Gäste beginnen zu hetzen und zu johlen. Lance Dodson sieht zur Tür hin. Noch immer nicht halten Reiter auf der Straße vor dieser großen schäbigen Bretterbude. Er empfindet beklemmende Furcht vor dem Vater.
»He, Mister!« sagt sein Gegenüber ungeduldig.
Er schluckt, starrt auf die Karten, ist wieder beim Spiel. Und er begreift schon jetzt, daß er dieses Pokerspiel verlieren und viel Geld bezahlen wird. Jetzt fällt die Meute im Saloon über die Kämpfenden her und drischt auf sie ein. Sie zerrt die beiden Kerle hinaus, lärmt und flucht. Und gegenüber krachen ein paar Schüsse, dort, wo der andere Saloon steht.
Es ist Abend in Bear River City, die Nacht wird schon sehr bald anbrechen, eine von vielen wilden Nächten und längst nicht die letzte für diese unbarmherzige Schienenstadt, die von Tag zu Tag mehr wächst im weiten Bett des White Sulphur Creek. Man sagt, daß Bear River schlimmer sei als Julesburg, Benton und Blue Creek – eine Hölle am Schienenstrang der Union Pacific! Bear River City liegt nicht still; die tausend Bretterbuden, Zelte, Verschläge und Wagen wandern den Scharen von Schwellenlegern und Bahnarbeitern nach, wie ein böser Fluch, der sie nicht mehr losläßt.
Diese Stadt vergiftet jede Seele, selbst die Seele des Teufels noch!
Reiter kommen die Straße herauf.
Grant Dodsons Gesicht ist eine reglose Maske aus Staub und Schweiß. Nur die Augen bewegen sich, suchen, sehen manchmal nach den weiten Hängen empor, wo Hunderte von Lagerfeuern brennen, wo überall Zelte aufgeschlagen worden sind.
Hinter ihm reiten ein paar Cowboys.
Zwischen den vielen Bretterhütten der Saloons, Bars und Etablissements, der Pferdeställe, Lagerschuppen und Wohnbuden nistet tiefer Schatten, verwischt die Konturen. Licht fällt aus vielen Häusern auf die Fahrbahn. Stimmen grölen.
Neben einem Telegrafenmast zügelt Dodson sein Pferd, und die Reiter flankieren ihn.
Vor ihnen tobt die wilde Meute, hat die beiden Männer zusammengeschlagen und macht nun kehrt, um in den schäbigen Saloon zurückzukehren.
Mit kalten Augen beobachtet Dodson die Männer. Tiefe Abneigung ist in seinem Blick. Er sieht zum Saloon hinüber.
»Geht hinein!« sagt er zu den Männern, die für ihn reiten. »Vielleicht ist er da drinnen.«
»Okay, Boß.«
Sie lenken die Pferde zum Saloon, sitzen davor ab und rücken fast gleichzeitig an ihren Waffengurten. Einer der Cowboys bleibt bei den Pferden; die anderen gehen hinein.
Dodson wartet. Die Drähte über ihm summen. Das Pferd stampft und scharrt mit dem Vorderhuf.
Plötzlich kracht im Saloon dumpf und schwer ein Coltschuß.
Der Rancher rührt sich nicht. Er macht den Eindruck eines Mannes, der gelassen auf die Nacht wartet und sehr viel Zeit hat. Und er sieht ruhig zum Saloon.
Dort ist es auf einmal unheimlich still geworden, totenstill.
Schritte dröhnen über die wenigen Bretter an der Tür, und ein Cowboy kommt hervor, winkt heftig.
Da treibt Dodson sein Pferd scharf an und jagt hinüber, springt vom Pferd und wirft dem Cowboy die Zügel zu. Mit einem einzigen Griff hat er die Volcanic Rifle aus dem Gewehrschuh. Er senkt das Gewehr erst dicht vor der Tür, stößt die Holzflügel auf und geht hinein. Und dicht neben der Tür verharrt er und nimmt alles mit einem schnellen Blick wahr.