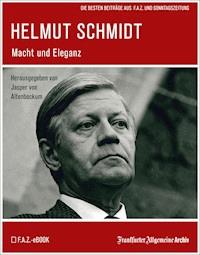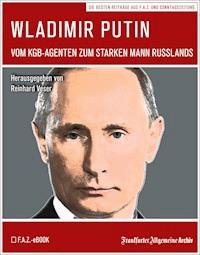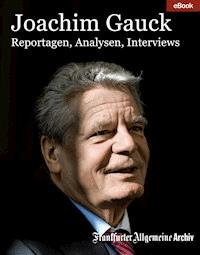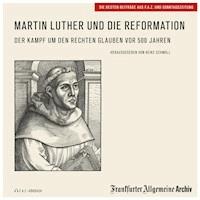Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begann, ahnte niemand, mit welcher Vehemenz die Frage von Schuld und Verantwortung für diese Menschheitskatastrophe noch nach einem Jahrhundert diskutiert werden würde. Auch in den Beiträgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat diese Diskussion einen großen Raum eingenommen. Der Schwerpunkt liegt in der Aufarbeitung der Politik in den Monaten unmittelbar vor dem Kriegsausbruch. Folglich beginnt auch diese Artikelsammlung mit Bewertungen der Ausgangssituation im Europa der Jahre 1913 und 1914. Wollten Politik und Militär das gleiche? Verfolgten Frankreich und Großbritannien ihre außenpolitischen Ziele auf vergleichbarem Weg wie die Reichsregierung? Der zweite Teil dieses eBooks widmet sich den wichtigen Kriegsschauplätzen. Ein Besuch auf den Schlachtfeldern an der Somme, eine Wanderung an der früheren Dolomitenfront, der See-krieg und der Friedenschluss in Versailles sind weitere Stationen dieser Zeitreise. Die auch nach 100 Jahren anscheinend unlösbare Kriegsschuldfrage wird auch hier diskutiert. Vor allem die im Jubiläumsjahr erschienenen Bücher rund um den Kriegsausbruch werden dabei einer detaillierten Bewertung unterzogen. Literarisch-kulturelle Fundstücke, ein ausführlicher Litera-turteil, eine Chronik und eine Statistik des Krieges, ein Verzeichnis der wichtigsten Akteure der kriegsführenden Staaten sowie Lese- und Filmtipps bilden den Abschluss des eBooks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Erste Weltkrieg
Debatten und Materialien
F.A.Z.-eBook 32
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher und Birgitta Fella
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2014 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Foto: Flandern 1917. Hermann Rex/Kriegs- Bild- und Filmamt. Photographisches Bild- und Film-Amt.
ISBN: 978-3-89843-227-6
Vorwort
Der Erste Weltkrieg in Beiträgen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Von Hans Peter Trötscher
Als vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begann, ahnte selbstverständlich noch niemand, mit welcher Vehemenz die Frage von Schuld und Verantwortung für diese Menschheitskatastrophe noch nach einem Saeculum diskutiert werden würde. Auch in den Beiträgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat diese Diskussion einen erstaunlich großen Raum eingenommen. Dabei liegt – wie auch schon in den Debatten der vergangenen Jahrzehnte – der Schwerpunkt in der Aufarbeitung der Politik in den Monaten unmittelbar vor dem Kriegsausbruch. Folglich beginnt auch diese Artikelsammlung mit Bewertungen der Ausgangssituation im Europa der Jahre 1913 und 1914. Wollte die Politik das gleiche wie das Militär? Verfolgten Frankreich und Großbritannien auf vergleichbarem Weg ihre außenpolitischen Ziele wie die Reichsregierung?
Im zweiten Abschnitt wenden wir uns wichtigen Schauplätzen des Kriegsverlaufs zu. Noch heute erfüllt es uns mit Grausen, wenn wir erfahren, dass die Bevölkerung entlang des Rheins beständig das Kanonengrollen der Front als dumpfes, entferntes Brummen hören konnte. Ein Besuch auf den Schlachtfeldern der Somme, deren Landschaft noch immer die scheinbar unauslöschlichen Spuren der Gewalt trägt, eine Wanderung an der früheren Dolomitenfront, die noch heute schreckliche Geheimnisse birgt, der Seekrieg und der Friedenschluss in Versailles sind weitere Stationen dieser Zeitreise. Der auch nach 100 Jahren anscheinend unlösbaren Kriegsschuldfrage nähern wir uns im nächsten Kapitel. Vor allem die im Jubiläumsjahr erschienenen Bücher rund um den Kriegsausbruch werden dabei einer detaillierten Bewertung unterzogen. Literarisch-kulturelle Fundstücke, ein ausführlich bewertender Literaturteil, eine Chronik des Krieges sowie ein Verzeichnis der wichtigsten Akteure der kriegsführenden Staaten bilden den Abschluss des eBooks.
Der Weg in die Katastrophe
Heldenopfer und Massensterben
Wie das kaiserliche Deutschland und das republikanische Frankreich sich in Stellung brachten
Von Rainer Blasius
Vor hundert Jahren, im August 1907, fand in Stuttgart der Internationale Sozialistenkongress statt. Zu den prominentesten Teilnehmern zählte der Sozialistenführer Jean Jaurès, der darauf hoffte, dass die internationale Arbeiterbewegung bei Kriegsgefahr durch Massenstreiks und Androhung von Aufständen die nationalen Regierungen zu einer Friedenspolitik zwingen könnte. Seine pazifistische Haltung kostete ihn am 31. Juli 1914 – unmittelbar vor Kriegsbeginn – das Leben, als ein Fanatiker in Paris ein Attentat auf ihn verübte. So lässt sich nur darüber spekulieren, ob sich Jaurès der »Union sacrée« in Frankreich angeschlossen hätte, jenem propagandistischen Gegenstück zum »Burgfrieden« in Deutschland. Den Begriffen und ihrer Wirkung widmete sich in Stuttgart eine Tagung, zu der Wolfram Pyta deutsche und französische Historiker und Literaturwissenschaftler eingeladen hatte. Einleitend sprach er davon, dass beide Gesellschaften »in hohem Maße fragmentiert« gewesen seien, bis der Krieg im Sommer 1914 eine Welle der nationalen Integration auslöste. Diese verdiene einen Vergleich, der Kulturgeschichte und Politikgeschichte miteinander verbinde, um die »symbolische Repräsentationsfähigkeit als eine zentrale Voraussetzung zur Erlangung politischer Legitimation« zu erfassen. Der moderne Politiker müsse nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch in der Lage sein, »die umlaufenden kulturellen Zuschreibungen symbolisch zu verdichten« und daraus politische Herrschaft abzuleiten.
Georges-Henri Soutou (Paris) leuchtete den Mythos vom »Burgfrieden« und von der »Union sacrée« aus. Kaiser Wilhelm II. kündigte den »Burgfrieden« mit den Worten an: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.« In Frankreich erklärte der Präsident der Abgeordnetenkammer, Paul Deschanel: »Gibt es noch Gegner? Nein, es gibt nur noch Franzosen.« Und der Präsident der Republik, Raymond Poincaré, beschwor in seiner Botschaft an die zwei Kammern die »Union sacrée«, die dem Feind trotzen werde. Wilhelm II. schärfte den Deutschen ein: »Wir kämpfen gegen eine Welt von Feinden«, während Poincaré im Parlament ausrief, Frankreich stehe noch einmal »vor der Welt für Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft« und erhalte dafür »aus allen Gegenden der zivilisierten Welt . . . Sympathie und Glückwünsche«. »Burgfrieden« und »Union sacrée« seien vergleichbar, aber nicht ähnlich. Der »Burgfrieden« habe dem Mythos der nationalen Eintracht, der »Sehnsucht für eine vormoderne Einheit der Gesellschaft und der Nation«, der »Ablehnung der Spaltung und des Wettbewerbs der liberalen Demokratie« entsprochen – hingegen die »Union sacrée« der »Einheit der Nation Jakobiner Prägung, die Nation des allgemeinen Willens – volonté générale –, der nicht den Willen jedes Einzelnen oder verschiedener Parteien, Klassen oder Gruppierungen unbedingt widerspiegelt, sondern der Nation als ganzen«. In Frankreich sei es vor allem um die Katholiken gegangen, die weitgehend ausgeschlossen waren vom politischen Leben seit der Trennung von Staat und Kirche im Jahr 1905, außerdem – wie in Deutschland – um die Sozialisten, die nicht länger als »vaterlandslose Gesellen«, sondern endlich als vollwertige Bürger anerkannt worden seien. Bis 1917 habe Reichskanzler von Bethmann Hollweg im Rahmen des »Burgfriedens« problemlos regieren können. Olivier Forcade (Amiens) referierte über Zensur und öffentliche Meinung in Frankreich. Über die Höhe der eigenen Verluste habe man die Bevölkerung nicht informiert, wohl aber über die Anzahl deutscher Kriegsgefangener. In der Diskussion machte Georges-Henri Soutou darauf aufmerksam, dass die französischen Kriegstoten erst im Mai 1919 mit 1.300.000 beziffert worden seien. Diskussionsleiter Gerd Krumeich (Düsseldorf) meinte, während des Krieges sei der Tod nur »sektorial erfahren« worden, also die Gefallenen der eigenen Kompanie, nicht darüber hinaus die anderer Einheiten: »Wenn man die wirklichen Verluste gewusst hätte, das Massensterben, dann hätte der Krieg nicht so lange gedauert.« Dem stimmte Jean-Jacques Becker (Paris) zu. Gewusst habe man von vielen Gefallenen, aber keine Vorstellung von den enormen Verlusten gehabt: »Ohne Zensur wäre es anders gelaufen.«
»Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft« – die von Frankreich verteidigten Werte der Zivilisation beschwor Staatspräsident Poincaré vor dem Parlament, als der Krieg unmittelbar bevorstand. Foto: Fotografische Reproduktion eines Gemälde von Pierre Carrier-Belleuse.
»Ich kenne nur noch Deutsche«. Der von Wilhelm II. ausgerufene »Burgfriede« ist in Deutschland zum negativ besetzten Synonym für affirmative, machtpolitisch motivierte Oppositionspolitik geworden. Foto: T H Voigt, 1902. Bildnummer HU 68367, Imperial War Museum, London.
Almut Lindner-Wirsching (Frankfurt am Main) sprach über Krieg als nationale Erfahrung bei deutschen und französischen Schriftstellern. Das Wort »Opfer« habe zu den Schlüsselbegriffen gehört, insbesondere in Frankreich, aber auch bei Walter Flex und Fritz von Unruh: »Der Soldatentod wurde häufig als Imitatio Christi gedeutet: Das gegenwärtige Leiden der Soldaten wurde als Lösegeld für eine bessere Welt, für eine im Krieg noch nicht verwirklichte brüderliche Gemeinschaft oder gerechtere soziale Ordnung verstanden.« Unruh sprach »explizit vom Ostergang der Verdunkämpfer«, und Henri Barbusse »parallelisierte« in »Le Feu« mehrere Soldaten mit Christus. Französische Frontautoren hätten an den »Bürger in Uniform«, den »soldat citoyen« mit seiner revolutionär-jakobinischen Tradition angeknüpft.
Steffen Bruendel (Essen) ging der Entwicklung vom »Burgfrieden« zur »Volksgemeinschaft« nach: »Der euphorische Jubel der bürgerlichen Deutungselite über die Zustimmung der Sozialdemokraten zu den Kriegskrediten im August 1914 galt der Atmosphäre gesamtgesellschaftlicher Eintracht, die als Geist von 1914 bezeichnet und zur Grundlage des Burgfriedens wurde.« Als Gegenentwurf zu den »Ideen von 1789« und ihren Werten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hätten »Deutsche Freiheit«, Kameradschaft und Sozialismus gestanden. »Deutsche Freiheit« sei als freiwillige Einordnung in die Gesamtheit der Nation interpretiert worden, Kameradschaft als kollektive Pflichterfüllung ohne Änderung der sozialen Hierarchie und »nationaler Sozialismus« als spezifisch deutsche Form von Brüderlichkeit und Einheit, die den »westlichen Konkurrenzkapitalismus« durch eine Gemeinschaftsverpflichtung aller »Volksgenossen« beseitigen sollte. Damit bestand ein »semantisches Identifikationsangebot für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen«: »Die deutsche Volksgemeinschaft sollte der nationalen Überlieferung entsprechen, aber auch den Lebensbedingungen in einer industrialisierten Massengesellschaft durch neue Formen der Organisation, der Integration, der Repräsentation und der Partizipation gerecht werden. Zwar wurde das Volksgemeinschaftsparadigma seit 1916 von der politischen Rechten radikalnationalistisch-exklusiv umgedeutet, aber bis 1918 und darüber hinaus nicht zu ihrem ideologischen Alleinbesitz. Bis zu ihrer eliminatorischen Radikalisierung nach 1933 blieb die Volksgemeinschaft eine konkrete Utopie der Deutschen.« Gerd Krumeich gab zu bedenken, dass »Volksgemeinschaft« im Ersten Weltkrieg nicht geläufig gewesen sei, sondern meistens nur der Begriff »Gemeinschaft«.
Pyta stellte heraus, dass in beiden Staaten von 1914 bis 1918 die Idee der Nation die politisch-kulturelle Leitvorstellung darstellte. In Deutschland seien weder der Kaiser als Reichsoberhaupt noch der Reichstag imstande gewesen, daraus einen »symbolischen Mehrwert zu generieren«. Daher sei die symbolische Repräsentation der Nation einer Person zugefallen, »die nach streng legalem Verständnis von Herrschaft gar kein politisches Amt ausübte, die aber gerade deswegen eine enorme herrschaftliche Potenz besaß: der Feldmarschall Paul von Hindenburg«. Im Gegensatz dazu habe sich in Frankreich der Parlamentarismus als stark genug erwiesen, »um alle politischen Verselbständigungstendenzen der Militärs im Ansatz zu ersticken« und die Idee der Nation symbolisch zu repräsentieren.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27.7.2007
Seiner Majestät Nachrüster
Reichskanzler Bethmann Hollweg rechnete mit einem Krieg zwischen »Slawen und Germanen«
Von Rainer Blasius
Beim »Kriegsrat« vom 8. Dezember 1912 war viel über den nächsten Waffengang gesprochen und vom Chef des Generalstabs sogar die Devise »Je eher, je besser« ausgegeben worden. Ein Entschluss, etwa im Sommer 1914 den Krieg zu entfesseln, fiel bei dem Treffen des Kaisers mit hohen Militärs aber nicht – zumal weder der Reichskanzler noch der Staatssekretär des Auswärtigen Amts zugegen waren. Die »einzige, in ihren Auswirkungen freilich kaum zu unterschätzende Folge« der Versammlung war dann – so der Potsdamer Historiker Michael Epkenhans – die Entscheidung, eine Vorlage zur Heeresverstärkung auf den Weg zu bringen.
Schon Anfang Dezember 1912 hatte das preußische Kriegsministerium beim Generalstab eine Denkschrift in Auftrag gegeben, die dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg am 21. Dezember vorlag. »Über die militärische Lage und die sich aus ihr ergebenden Forderungen für die weitere Ausgestaltung der Deutschen Wehrkraft« hieß das Memorandum, das die Unterschrift des Generalstabschefs Helmuth von Moltke (des Jüngeren) trug, jedoch inhaltlich die »Handschrift« seines Gehilfen Oberst Erich Ludendorff. Der spätere Weltkriegs-Großstratege wies darauf hin, dass Deutschland wegen seiner zentralen Lage immer genötigt sein werde, »nach mehreren Seiten Front zu machen«; daher müsse es sich »nach einer Seite mit schwächeren Kräften defensiv halten«, um »nach der anderen offensiv werden zu können. Diese Seite kann immer nur Frankreich sein. Hier ist eine rasche Entscheidung zu erhoffen, während ein Offensivkrieg nach Russland hinein ohne absehbares Ende sein würde. Um aber gegen Frankreich offensiv zu werden, wird es nötig sein, die Belgische Neutralität zu verletzen.« Nur so lasse sich Frankreichs Heer »in freiem Felde angreifen und schlagen«. Damit enthüllten die Militärs dem Kanzler und dem Kriegsminister erstmals und eher beiläufig den von Alfred von Schlieffen entworfenen fatalen Operationsplan.
Ludendorffs militärische Schlussfolgerungen lauteten: Erhöhung der Friedenspräsenzstärke des Heeres (bisher 754.000 Soldaten) um 300.000 Mann, Verbesserung der Ausrüstung der Reserveformationen durch zusätzliche Maschinengewehre und Geschütze, Erweiterung der Fliegertruppe und Ausbau der Grenzbefestigungen im Osten. Moltke hatte ursprünglich offengelassen, »ob und in welchem Zeitraum die vorstehend gestellten Forderungen durchgeführt werden können«. Diesen Satz strich Ludendorff – wie sein Biograph Manfred Nebelin hervorhebt – aus der Endfassung und machte aus einem Fernprogramm ein Sofortprogramm. Nach scharfen internen Auseinandersetzungen musste der Generalstab jedoch seine Vorstellungen von der Heeresverstärkung herunterschrauben: 1.170.00 Mann, 15.000 Unteroffiziere und 4.000 Offiziere. Am 25. Februar 1913 legte das Kriegsministerium dem Kanzler den Gesetzentwurf vor. Der Bundesrat stimmte am 11. März zu, so dass am 7. April die erste Lesung im Reichstag stattfand.
Die Defensivstrategie im Osten trug Generalstabschef Moltkes Handschrift. Anwendungsfähig gemacht wurde sie von seinem Gehilfen Ludendorff. Foto: Agence Rol, cb14944579, Bibliothèque Nationale de France. Copyrigh: domaine public.
Bethmann Hollweg stellte eingangs die Frage, ob sich Deutschland den Luxus leisten wolle, »auf Zehntausende von ausgebildeten Soldaten zu verzichten, die wir haben könnten, die wir aber jetzt nicht einstellen«. Nach menschlicher Voraussicht werde »kein europäischer Krieg entbrennen, in den nicht auch wir verwickelt sein werden«. Eine »europäische Konflagration«, die »Slawen und Germanen einander gegenüberstellt«, sei ebenfalls nicht auszuschließen. Insgesamt bezeichnete er die Beziehungen zu Russland als freundschaftlich, die zu Frankreich als gut, und gegenüber Großbritannien kehre das Vertrauen wieder zurück, »das lange Zeit zum Schaden beider Länder und der Welt gefehlt hat«, weil es wegen des britischen und des deutschen Schiffsbaus zu einer »Flottenhetze« gekommen sei. Wie kein anderes Land müsse Deutschland auf der Hut sein, weil es trotz des Dreibundes mit Österreich und Italien »eingekeilt« sei zwischen der »slawischen Welt« und »den Franzosen«. Der Kanzler unterbreitete die Wehrvorlage, »weil wir Frieden haben, und weil, wenn Krieg kommt, wir Sieger bleiben wollen«. Der »Gedanke des Wettrüstens« liege ihm fern.
Der preußische Kriegsminister Josias von Heeringen erläuterte Einzelheiten einer verbesserten »Ausnutzung unserer allgemeinen Wehrpflicht« einschließlich der Auswirkungen auf die Waffengattungen sowie auf die Eisenbahntruppen und das Luftfahrtwesen: »Luftschiffe und Flugzeuge sind wichtige und brauchbare Kriegswerkzeuge geworden, und angesichts der Fortschritte auf diesem Gebiete bei unseren Nachbarn ist es ein unbedingtes Gebot, dass wir unsere Luftstreitkräfte in raschem Tempo ausbauen.« Hinsichtlich der Vermehrung der Offiziere und Unteroffiziere sehe der Entwurf »die Erweiterung von Kadettenhäusern und Kriegsschulen und die Gründung einer Anzahl von neuen Unteroffiziersschulen vor«.
Schlieffens Zweifrontenstrategie funktionierte nur in der Theorie. Der »Weltkriegs-Großstratege« Ludendorff musste sie irgendwie zum Funktionieren bringen. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R41126.
Für die SPD nahm Hugo Haase, der seit 1911 neben August Bebel Parteivorsitzender war, Stellung. Er warf dem Kriegsminister vor, vom Volke ungeheuerliche Opfer in »allgemeinen Redewendungen« zu verlangen: »Es ist die Schablone, nach der man ebenso gut eine Forderung von 10.000 Mann wie eine Forderung von 136.000 Mann neuer Truppen aufstellen kann.« Die Regierung biete eine Vorlage, »die das Volk in seinen Tiefen aufwühlt, die das Ausland beunruhigt und die einschneidendsten politischen Wirkungen hat«. Der Kanzler führe den Abgeordneten »die große Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen der slawischen und der germanischen Welt vor Augen«: »Ich habe nicht erwartet, dass der Reichskanzler seine Vorlage damit begründen würde. Hörte man ihm zu, so musste man glauben, dass die Balkanvölker eine germanische Macht niedergeschlagen haben und nicht das Osmanische Reich.« Die Militärvorlage sei »das Produkt der Agitation des Wehrvereins und jener Blätter, wie der ›Post‹, der ›Rheinisch-Westfälischen Zeitung‹, der ›Täglichen Rundschau‹, und so weiter, die von dem Tage ab, wo im Vorjahre die Heeresvorlage im Hause angenommen war, mit den Forderungen einsetzte, die sich gegenwärtig in der Regierungsvorlage finden. Der Herr Reichskanzler ist bereits dieser kleinen Minorität im Deutschen Reiche unterlegen.«
Aus Presseartikeln sei der Grund für die Rüstungen zu entnehmen: »Es soll Ellenbogenfreiheit geschaffen werden für die imperialistische Weltpolitik!« Es handele sich »nicht um den Schutz unserer Grenzen, sondern um die Einschüchterung der anderen, die, ebenso wie unsere Imperialisten, Eroberungspolitik treiben«. Haase sprach vom »Moloch des Militarismus« und von den hohen Kosten. Der Volkswirtschaft werde »durch die Entziehung der Arbeitskräfte« ein unermesslicher Schaden zugefügt. Und: »Jedes Rüsten eines Staates erweckt im anderen Staate das Misstrauen. Das Misstrauen ist die Quelle politischer Verwicklungen; in ihm liegt die Gefahr eines Krieges.« Die Wehrfähigkeit sei nach Auffassung des Kanzlers »der beste Gradmesser für die moralische Kraft eines Volkes«. Dem widersprach Haase: Die Tätigkeit, »die ein Volk auf dem Gebiet der Kultur und der Zivilisation entfaltet, ist der Gradmesser für seine moralische Kraft. Und wenn man unser Volk immer als das Volk der Dichter und Denker bezeichnet, dann, muss ich sagen, ist diese Vorlage, die wir bekommen haben, geradezu ein Schlag in das Gesicht dieses Volkes.«
Am 25. April stimmte die hinter verschlossenen Türen tagende Budgetkommission – auf Grund von Nachbesserungen bei der Finanzierung – der umfangreichsten, teuersten Heeresverstärkung zu, die das Kaiserreich bis dahin gesehen hatte. Das Gesetz passierte am 30. Juni in dritter Lesung mit großer Mehrheit den Reichstag und trat am 3. Juli in Kraft.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8.4.2013
Freundschaftsbesuch oder Kriegsrat?
Kurz vor dem Attentat von Sarajevo: Der deutsche Kaiser trifft den österreichischen Thronfolger
Von Rainer Blasius
Viel Gemeinsames verband den 1859 geborenen deutschen Kaiser und den 1863 geborenen österreichisch-ungarischen Thronfolger. Beide interessierten sich für die Jagd, für Kriegsschiffe und für die Kunst. Doch während Wilhelm II. im Jahr 1914 seit 26 Jahren regierte, befand sich der fast gleichaltrige Franz Ferdinand in Wartestellung. Immerhin verfügte er über weitgehende Befugnisse, nachdem ihn sein Onkel, der greise Kaiser Franz Joseph, 1913 zum »Generalinspekteur der gesamten bewaffneten Macht« ernannt hatte.
Ende Mai 1914 berichteten Zeitungen erstmals darüber, dass der Kaiser nach Konopischt reisen wolle, das ein Ortsteil der zirka 37 Kilometer südlich von Prag gelegenen Stadt Beneschau ist. Das dortige Schloss hatte Franz Ferdinand im Stil der Neugotik aufwendig restaurieren lassen. Brisanz erhielt die Ankündigung der Visite durch einen Begleiter: Großadmiral Alfred von Tirpitz, Chef des Reichsmarineamtes und »Vater« der – von Großbritannien als Herausforderung empfundenen – deutschen Hochseeflotte. Ihn wolle der Erzherzog »schon lange« kennenlernen.
Am 12. Juni um 9 Uhr morgens traf der kaiserliche Sonderzug auf dem Bahnhof in Beneschau ein. Franz Ferdinand trug zur Begrüßung die Uniform des 10. preußischen Ulanenregiments – als besondere Reverenz an den Gast aus Berlin, der ohne Kaiserin Auguste Viktoria kam. Sie war vierzehn Jahre zuvor über die unstandesgemäße Hochzeit des Erzherzogs empört gewesen und wollte so wenig wie nur möglich mit der Thronfolger-Gattin – der früheren Gräfin Sophie Chotek von Chotkowa, die sich jetzt Herzogin von Hohenberg nennen durfte – zusammentreffen. Die Herzogin und ihre drei Kinder Sophie (geboren 1901), Maximilian (geboren 1902) und Ernst (geboren 1904), die von der Thronfolge in der Doppelmonarchie ausgeschlossen waren, warteten ebenfalls am Bahnhof: »Die Begrüßung war ungemein herzlich. Der Kaiser und der Erzherzog küssten einander, und der Kaiser küsste der Frau Herzogin die Hand. Nach der Vorstellung der Gefolge reichte Kaiser Wilhelm der Frau Herzogin seinen Arm und verließ in Begleitung des Erzherzogs durch den in einen Blumenhain umgestalteten Hofwartesalon den Bahnhof. In diesem Augenblick wurden aus dem Geschütz in der Tuzinka, im Jagdschloss des erzherzoglichen Reviers, 21 Salutschüsse gelöst«, so die »Neue Preußische Zeitung«. Die Prager Zeitung »Bohemia« erwähnte, wie Franz Ferdinand den Großadmiral, »eine hünenhaft gebaute Gestalt mit wallendem Vollbart«, begrüßte.
Jeweils am Abend des 12. und 13. Juni gab es ein Dinner im Schloss, während die Gäste tagsüber ein umfangreiches Besichtigungsprogramm absolvierten: Jagdrevier, Tiergarten, Baumschule und so weiter. Am Nachmittag des zweiten Tages ließen sich der Kaiser und der Erzherzog im Schlosspark mit allen Gästen und dem gesamten Gefolge fotografieren. Vor und nach dem Abendessen hatten sie unter vier Augen noch eine »politische Aussprache«, über die der Kaiser den Gesandten Karl Georg von Treutler in Kenntnis setzte, der eine Aufzeichnung für das Auswärtige Amt in Berlin anfertigte. Themen waren die aktuelle Lage in Europa, insbesondere die österreichfeindliche Stimmung in Rumänien und der Dreibundpartner Italien, sowie die k. u. k. Innenpolitik.
Franz Ferdinand soll »die ungarischen Zustände als völlig anachronistisch und mittelalterlich« dargestellt haben. Der ungarische Ministerpräsident István Tisza sei »schon Diktator in Ungarn und strebe danach, auch in Wien als solcher aufzutreten«. So beklagte sich der Erzherzog beim Kaiser: »Seine Majestät hat den Thronfolger unterbrochen, um ihm zu sagen, dass er selbstverständlich Tisza missbillige, wenn er höre, dass er unbotmäßig sei und danach strebe, zu Ungunsten Österreichs das Schwergewicht der Monarchie zu verlegen.« Über das Ende des Gesprächs hieß es: »Russland ist nach des Erzherzogs Meinung nicht zu fürchten; die inneren Schwierigkeiten seien zu groß, um diesem Lande eine aggressive äußere Politik zu gestatten.« Der Wiener Politiker und Professor Josef Redlich hielt zum Treffen in seinem Tagebuch fest: »Die Zeitungsnachrichten, die an Tirpitz‘ Teilnahme anknüpfend von Mittelmeerpolitik und Dreadnoughts reden, gehen ganz in die Irre. Es ist ein rein persönlich-dynastisches Interesse, das diesen Besuch verursacht.«
Zwei Wochen nach dem Besuch fielen Franz Ferdinand und Sophie einem Pistolenattentat in Sarajevo zum Opfer, weitere fünf Wochen später begann der Krieg in Europa. In den nächsten Jahren gab es allerlei Mutmaßungen über die letzte Begegnung des Kaisers mit dem Thronfolger in Konopischt, wobei ausgerechnet das Foto vom Nachmittag des 13. Juni eine Rolle spielte. Wladimir Aichelburg, der Mitbegründer des Erzherzog-Franz-Ferdinand-Museums in Artstetten und Autor dickleibiger Chroniken, erinnerte jüngst daran: »Ententeblätter« hätten später das Bild reproduziert und »als Beweis für den in Konopischt abgehaltenen Kriegsrat hingestellt«, indem sie die Anwesenheit des Großadmirals Tirpitz, des deutschen Reichskanzlers Theobald Bethmann Hollweg und des österreichisch-ungarischen Außenministers Leopold Graf Berchtold behaupteten. Doch der angebliche Bethmann Hollweg war »in Wirklichkeit« Hans Graf Wilczek, der angebliche Berchtold war Adolf Graf von Waldstein.
Die Kriegsrat-These hatte der Historiker Fritz Kern bereits 1925 zurückgewiesen: Vornehmlich Serben und Franzosen seien für das »Märchen von Konopischt« verantwortlich, das die Entente-Propaganda im Weltkrieg verbreitete. Die Anwesenheit von Tirpitz habe die »Phantasie der Geheimnisschnüffler« angeregt, zumal der russische Botschafter in Wien Mitte Juni 1914 nach St. Petersburg meldete, »in ausgiebigen Besprechungen zwischen Franz Ferdinand und Tirpitz« sei ein »Geheimprogramm für Schiffbau besprochen« worden.
Dagegen stützte sich Kern auf einen Aktenfund aus den Papieren des Großadmirals vom Juni 1914. Tirpitz schrieb damals: »Politisch wurde fast gar nichts verhandelt, außer einem Gespräch des Kaisers mit dem Erzherzog.« Übrigens teilte Tirpitz die Begeisterung des Kaisers für Franz Ferdinand nicht: Der Thronfolger sei »gefürchtet und im ganzen wenig beliebt«; hinter dessen »Reserviertheit« könne man »nicht die Hoffnung auf Taten« finden: »Vom Schloss [ist] noch nachzuholen, dass es sehr wertvolle Waffensammlung enthält, mehr Kuriosität als System. Ferner große Halle, in der alles, was von Ritter St. Georg zu sammeln möglich war, vom großen Reitersmann bis zu kleinen Statuetten, aufgebaut war. Charakteristisch für die Sammelwut. Ähnlich in einem Muster-Försterhaus von Tiroler Schnitt, wo alle möglichen Bauern- und Försterkuriositäten aus Tirol angesammelt waren.« Auch solche Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass es sich in Konopischt wohl vor allem um ein Treffen zweier Freunde handelte.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 14.6.2014
Schnell und siegreich?
Vor 100 Jahren befürworteten deutsche Militärs einen Präventivkrieg, den Politiker ablehnten
Von Rainer Blasius
Ü