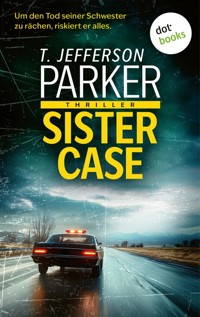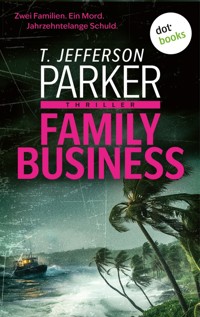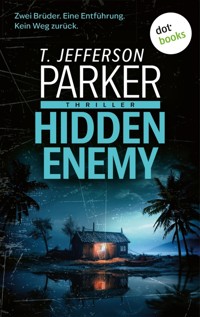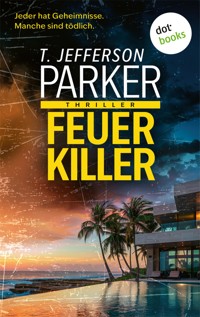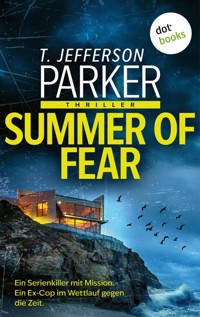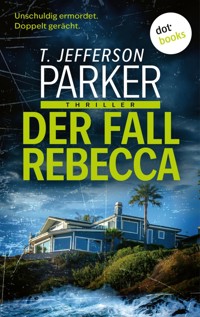
9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
Wer tötete die Frau, die er liebte? Ein FBI-Agent auf Rachefeldzug Der FBI-Agent Josh Weinstein kann es noch immer nicht fassen: Journalistin Rebecca, die Liebe seines Lebens, wurde auf dem Parkplatz vor ihrem Büro erschossen. Weinsteins unbändige Trauer verwandelt sich schnell in ein obsessives Verlangen nach Vergeltung. Bei seiner Jagd nach dem Mörder findet er heraus, dass Rebecca gar nicht das eigentliche Ziel des Anschlags sein sollte, sondern ihre Chefin, die mit ihren provokanten Meinungen viele Leser gegen sich aufhetzte. Was ihn jedoch viel mehr schockiert ist die Erkenntnis, dass Rebecca einen Liebhaber hatte: ihren Kollegen John Menden. Doch ausgerechnet auf dessen Hilfe ist Weinstein angewiesen, um Rebeccas Mörder zu finden … »Parker schreibt so abgebrühte Prosa, dass er Raymond Chandlers Kochtopf geerbt haben könnte.« – USA Today Ein Agent, der nichts zu verlieren hat und alles riskiert – ein fesselnder Noir-Thriller für Fans von James Ellroy und Michael Connelly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der FBI-Agent Josh Weinstein kann es noch immer nicht fassen: Journalistin Rebecca, die Liebe seines Lebens, wurde auf dem Parkplatz vor ihrem Büro erschossen. Weinsteins unbändige Trauer verwandelt sich schnell in ein obsessives Verlangen nach Vergeltung. Bei seiner Jagd nach dem Mörder findet er heraus, dass Rebecca gar nicht das eigentliche Ziel des Anschlags sein sollte, sondern ihre Chefin, die mit ihren provokanten Meinungen viele Leser gegen sich aufhetzte. Was ihn jedoch viel mehr schockiert ist die Erkenntnis, dass Rebecca einen Liebhaber hatte: ihren Kollegen John Menden. Doch ausgerechnet auf dessen Hilfe ist Weinstein angewiesen, um Rebeccas Mörder zu finden …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »The Triggerman’s Dance« bei Hyperion, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Weinsteins Mission« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by T. Jefferson Parker
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 der deutschsprachigen Ausgabe bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Pixiels Park und AdobeStock/Jason, pbnash1964
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-98952-979-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
T. Jefferson Parker
Der Fall Rebecca
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helmut Splinter
Widmung
Für Mary Ann und Mae,
Sam und Emily,
Katie und Susan
Motto
Weise wird der Mensch auch
gegen seinen Willen
Äschylus
Kapitel 1
Auf dem Foto, das danach am häufigsten veröffentlicht wurde, liegt Rebecca neben einem Pflanzentrog aus Ziegelsteinen. Ihre Arme hält sie graziös gespreizt, ihr Gesicht ist in die Kamera gerichtet, die Beine sind geschlossen, aber entspannt. Ihre Schuhe schauen unter den pastellfarbenen, vom Regen stark mitgenommenen Blättern des Island-Mohns hervor, der zwei Wochen zuvor zu blühen begonnen hatte. Über ihr hängen müde die wie Krummsäbel gebogenen Blätter an den weißen Ästen eines dickstämmigen Eukalyptusbaums. Rebecca scheint sich mit ihrem schmalen Rücken gegen die Ziegelsteine zu lehnen. Aber nein, eine Hüfte reckt sich zum Himmel empor, und ihr Oberkörper ist zur Seite gedreht, so daß ihre Schultern flach auf dem Asphalt liegen, während die Arme über ihrem Kopf ruhen. Ihre linke Hand – gewölbt, aber nicht geschlossen – scheint den Regen auffangen zu wollen. Sie trägt keinen Ring. Immer noch ist sie in den Regenmantel gehüllt, den sie aufgrund des sich ankündigenden Sturms getragen hatte. Der Hut sitzt noch auf ihrem Kopf, und ihr blondes Haar quillt darunter hervor.
Das Bild war nur Augenblicke nach dem Zwischenfall von einem Fotografen des Journal aufgenommen worden, der noch kurz zuvor in der Dunkelkammer mit Lösung hantiert hatte. Ein Fotoredakteur stürmte herein und erzählte ihm, daß auf dem Parkplatz gerade »etwas passiert« sei. Wie jeder professionelle Fotograf griff auch dieser hier nach seiner Kamera und rannte aus dem ewig roten Zwielicht des Labors hinaus, um vielleicht diesmal das Foto zu machen, mit dem er es zu etwas bringen könnte.
Es war sein Glückstag. Druck 1B26 des Probeabzugs entpuppte sich als das beste Bild, das von ihm oder von sonst jemandem geschossen worden war. Es erschien nicht nur im Orange County Journal, wo Rebecca Harris ein Volontariat absolviert hatte, sondern auch in Zeitungen quer über den Globus verteilt: New York, London, Tokio, Sydney und in vielen Orten dazwischen. Es ist eines jener Bilder, die einfach alles zu bieten haben: ein ansprechendes Thema, perfekte Belichtung, vollendete Komposition und die visuelle Ruhe, die vielen großen Fotografen eigen ist.
Dieser erhabene Anblick wird ergänzt durch die Personen im Hintergrund. Es sind die fünf ungenannten Angestellten des Journal, die als erste eintrafen und das Geschehene erfaßten. Diese Zuschauer bilden einen Chor, der im Abseits neben dem Pflanzentrog in Stellungen fotografiert wurde, wie sie Tizian gemalt hätte. Eine Frau schluchzt mit vorgehaltener Hand, während sie mit der anderen ihren Kopf vor dem Regen zu schützen versucht. Eine andere rennt zur Eingangshalle des Journal zurück, wurde aber mitten in ihrer Bewegung so aufgenommen, als wünschte sie nichts sehnlicher, als diesem Bild zu entkommen. Ein uniformierter Wachmann spricht mit theatralisch geöffnetem Mund in ein tragbares Funkgerät. Aus der Mitte dieses Fünferchors schreitet ein junger Mann mit langem Ledermantel und Filzhut durch den Regen auf Rebecca zu. Sein Ausdruck ist undurchschaubar, aber die breiten Schultern und der wachsame Winkel seines Kopfes deuten an, daß etwas geschehen kann und wird, um diesen ... Fehler zu korrigieren. Dieser Mann scheint für die vielen Millionen Menschen zu sprechen, die das Foto später sahen. Er ist die Hoffnung selbst. Natürlich war sein Verhalten in den Augen einiger ausländischer Beobachter nur ein weiteres Beispiel für die traurig verdrehte Auffassung, daß die gute Absicht genügt, um alles wieder in Ordnung zu bringen.
Die Polizei von Costa Mesa traf zuerst ein, gefolgt von den Sheriffs von Orange County. Die jungen Polizeibeamten befragten zuerst die beiden Zeugen, die beim ersten Schuß am nächsten bei Rebecca Harris gestanden hatten, dann versuchten sie den Schauplatz des Verbrechens abzusperren, indem sie schwarz-gelbe Klappböcke von den Ladeflächen ihrer Streifenwagen zerrten und den Ort des Geschehens mit gelben Bändern umspannten.
Aber es klappte nicht so recht, weil die Reporter und Fotografen, die sonst während ihrer Arbeit die strengen Vorschriften bei polizeilichen Untersuchungen befolgen mußten, meinten, dieses Ereignis – auf ihrem eigenen Parkplatz – gäbe ihnen das Recht zu tun, was sie wollten. Und das taten sie. Der Fernsehsender des Journal nutzte Rebeccas mit einem Tuch verdeckten Körper als Hintergrund für einen Live-Bericht vor Ort. Fotografen stellten innerhalb der Absperrung Scheinwerfer und Reflektoren auf und schossen ein Bild nach dem anderen. Es wurde über den besten Winkel diskutiert, Reporter machten sich Notizen oder sprachen auf Kassettenrecorder. Die jungen Polizeibeamten wurden ignoriert.
Durch diese regennasse Szene marschierte die am meisten gefeierte Kolumnistin des Journal, eine hochgewachsene und kräftige Frau namens Susan Baum. Ihr leichtes Hinken verlieh ihr eine Art von kampfbereiter Würde. Ihr folgte der Herausgeber des Journal, Neben ihm liefen der Chef der Gebäudewache und der Chefredakteur. Sie gingen auf Rebecca zu, die neben dem Pflanzentrog lag.
»Ma’am«, sagte einer der Polizisten, »bitte bleiben Sie hinter der Absperrung.«
»Halten Sie Ihren Mund, Sie Trottel«, entgegnete Susan Baum und sah den Polizisten derart feindselig an, daß dieser tatsächlich nickte und zurücktrat.
Susan Baum drängte sich am Fernsehteam vorbei und platzte in die Aufnahme. Die attraktive Live-Reporterin Ensley Moffett schüttelte den Kopf, duckte sich unter den Schirm eines Assistenten und beobachtete die Kolumnistin mit respektvoller Resignation.
Susan Baum stand etwa drei Meter von Rebecca entfernt und sah auf den Körper hinab. Zuerst legte sie ihre Hand an die Lippen und beugte sich leicht nach vorn wie jemand, der die Tiefe eines Lochs abschätzt. Dann schob sie die Hände in die Taschen ihres Mantels, zog einen kleinen Notizblock heraus und kritzelte etwas darauf. Sie schaute am Pflanzentrog vorbei zum mächtigen Gebäude des Journal und richtete anschließend ihren Blick auf den jungen Mann mit Filzhut und Ledermantel. Sie hatte nicht gewußt, daß er da war, nur zehn Meter entfernt wie ein Pfosten im Regen stehend. Der Sportredakteur, dachte sie – John? Jim? Mike?
Sie wandte sich zum Herausgeber um und sagte mit ruhiger Stimme: »Ich bat Rebecca, mir meinen Wagen zu holen, damit ich in dem Sturm nicht hinausmußte. Mit Sicherheit war ich damit gemeint.«
Sie nickte in Richtung des Lincoln, der ihr von ihrem Arbeitgeber als Zeichen ihres hohen Ansehens zur Verfügung gestellt worden war. Er stand gleich rechts vom Pflanzentrog. Ein kleines rundes Loch oben im Fenster auf der Fahrerseite war von vielen Rissen und dem umrahmt, was nur das Blut von Rebecca Harris sein konnte. Eine unhandliche Schlüsselkette hing vom Türschloß herab.
Bei diesem Anblick rannen zwei dicke Tränen über ihre bewegungslosen Wangen, und Susan Baum sah ein letztes Mal zu ihrer Teilzeitassistentin neben dem Pflanzentrog. Dann ging sie auf das Fernsehteam zu, weil sie zu Recht annahm, daß sie interviewt werden sollte. Das Hinken aufgrund der chronisch schlechten Blutzirkulation in ihrem linken Fuß war heute wegen des naßkalten Wetters stärker als sonst.
Innerhalb einer Stunde hatte die örtliche Polizei ein paar Fakten zusammengetragen. Rebecca Harris war durch mindestens zwei Schüsse getroffen worden, einem in den Rücken, als sie den Wagen von Susan Baum aufschloß, und einem zweiten in die Brust. Der zweite Schuß könnte getroffen haben, als sie sich nach dem ersten umdrehte, oder nachdem sie gegen den Pflanzentrog gefallen war. Im Polizeilabor würde man das Kaliber der Waffe feststellen. Jemand von der Spurensicherung hatte bereits eine Kugel aus dem Inneren des Autos neben dem Lincoln entfernt. Sie hatte offensichtlich die junge Frau und den Lincoln bis zum Acura Legend daneben durchdrungen. Sie war in der Limousine auf der rechten Seite des Armaturenbretts aus poliertem Holz steckengeblieben. Für die Polizei sah sie nach einer großkalibrigen Gewehrkugel aus, aber das war nur eine Vermutung.
Sie war wahrscheinlich aus einer der beiden .30/06-Patronen- hülsen abgefeuert worden, die im Rinnstein des Fairway Boulevard gelegen hatten, wo der Parkplatz endete und die Wohnhäuser anfingen. Diese Ecke war knapp über hundert Meter vom Lincoln entfernt, was auf einen sehr guten Schützen mit einer sehr guten Waffe schließen ließ.
Die Hülsen zeigten eine gekonnte Gravierung. Der Schriftzug war fließend, als wäre er handgeschrieben. Er sah aus wie die Gravierung in einem Ehering, nur größer.
Auf einer Hülse stand: »Wenn es im Verlauf der menschlichen Geschehnisse ...«
Auf der anderen: »... notwendig werden sollte ...«
»Der kennt die amerikanische Verfassung«, sagte ein Polizist. »Das ist die Unabhängigkeitserklärung«, meinte ein anderer. Eine Anwohnerin gab an, sie habe ein älteres weißes Chevrolet-Wohnmobil gesehen, das auf der Straße geparkt habe, bevor die Schüsse abgegeben worden seien. Es seien zwei, drei, vier oder fünf Schüsse gewesen, sie sei sich nicht sicher. Das Wohnmobil habe vor den Schüssen »mindestens zwanzig Minuten« dort gestanden. Es sei auf dem Fairway Boulevard Richtung Westen verschwunden, nachdem die Schüsse verklungen seien. Sie habe keinen Blick auf die Insassen geworfen, weil sie im parkenden Wohnmobil niemanden gesehen habe, und als sie nach den Schüssen ans Fenster getreten sei, habe es sich bereits in den Verkehr auf dem Fairway Richtung Interstate eingefädelt. Es sei auch möglich, daß die Schüsse gar nicht aus dem Wohnmobil gekommen seien. Nummernschilder oder auffällige Merkmale habe sie nicht wahrgenommen.
Der gesamte Schauplatz änderte sein Aussehen, als ein neuer Ford auf den Parkplatz raste und schleudernd und mit quietschenden Reifen direkt vor dem gelben Band zum Stehen kam.
Zwei Personen sprangen aus dem Auto, liefen geduckt unter dem Band hindurch und direkt auf die Leiche zu. Sie machten lange, sichere Schritte wie Menschen, die sich unentbehrlich fühlen. Ein Polizist aus Costa Mesa näherte sich ihnen, und sie zeigten ihm ihre Marken, ohne langsamer zu werden oder gar stehenzubleiben. Die Frau war groß, Anfang Dreißig, hatte sehr dunkles, welliges Haar, ein sonnengebräuntes Gesicht und Waden wie ein Gewichtheber. Der Mann, kaum so groß wie sie, war blaß und dünn und hatte kurzgeschorenes schwarzes Haar. Adamsapfel, Nase und Ohren standen weit hervor, und man konnte ihn auf fünfundzwanzig oder fünfunddreißig schätzen. Er verströmte um sich herum die Art von Ruhe, mit der ein Berglöwe die Gegend beobachtet.
Er näherte sich der Leiche, blieb stehen und sah zu den Fotografen, die sich immer noch auf dem Gelände herumtrieben. »Wenn Sie auch nur ein Bild von mir schießen, werde ich den Film und die Kamera konfiszieren«, verkündete er. Für einen dünnen, blassen Mann war seine Stimme ziemlich klar und tief. Zur Betonung seiner Worte hob und senkte sich sein Adamsapfel. Seine Partnerin stemmte ihre Arme in die Hüften. Mit einer langsamen Drehung blickte sie kurz in die Augen derjenigen, die eine Kamera hatten. Keiner rührte sich.
Er ging hinüber zu der mit einem Tuch bedeckten Gestalt, kniete nieder, sah noch einmal hinauf in die drohende Dunkelheit und hob dann das Tuch. Er betrachtete sehr lange Rebeccas Gesicht. Er berührte ihre Lippen, dann ihre Stirn, schob eine nasse blonde Locke zurück unter den Hut, küßte seine Fingerspitzen und berührte damit noch einmal ihre Lippen.
Schließlich erhob er sich langsam und stand über ihr, aber für viele Beobachter – und sie waren geübte, professionelle Beobachter – war der Mann, der neben Rebecca Harris gekniet hatte, nicht derselbe Mann, der ein paar Minuten später wieder aufstand. Dieser Mann hier hatte eine ganz andere Haltung. Er war leicht gebeugt, wohingegen das Original ganz aufrecht gewesen war. Sein Gesicht war nicht mehr einfach nur blaß, sondern elfenbeinfarben und hart, als wäre es in eine Form gegossen oder modelliert. Ganz eindeutig war er kleiner. Und mit Sicherheit hatte der Mann, der sich zuvor der Leiche genähert hatte, nicht diese riesigen schwarzen Augen, die nun für jedes der anwesenden Gesichter eine Bedrohung waren – Augen so voller Wut und Schmerz, daß einige Journalisten sie nicht ansehen, geschweige denn ein Bild machen konnten.
Susan Baum, die von allen Journalisten des Journal den schärfsten Instinkt besaß, kramte in ihrer Tasche nach dem Notizblock und dem Stift und trat auf die Statue mit Brille zu, die über Rebecca gebeugt stand.
Der junge Mann mit Ledermantel und Filzhut hatte sich aus dem Gedränge vor das gelbe Band zurückgezogen, blieb allein auf Abstand zu den anderen und beobachtete diesen Neuankömmling mit der dröhnenden Stimme. Und er fragte sich: Ist es er?
Der blasse Mann entfernte sich ein paar Schritte von der Leiche und ließ einen Blick über die zahlreichen Menschen wandern – Polizisten, Mitarbeiter des Sheriffs, Angestellte des Journal, Gebäudewachen –, die sich immer noch dies- und jenseits der Absperrung aufhielten. Er hob eine Hand, in der er seine Marke hielt, und zeigte sie herum.
»Mein Name ist Joshua Weinstein vom FBI-Büro des Orange County. Dies ist meine Partnerin Sharon Dumars. Jeder ... jeder, der sich in den nächsten zehn Sekunden nicht hinter das Band begeben hat, wird festgenommen und angezeigt.« Erstaunlicherweise fing er tatsächlich an zu zählen.
Es entstand ein Gemurmel, aber alle innerhalb der Absperrung bewegten sich auf das Band zu. Alle außer Susan Baum, die bei der Zahl Zehn direkt vor Weinstein stand und ihm voll in die Augen blickte.
»O Gott, Joshua«, flüsterte sie. »Sie hat mir von Ihnen erzählt.«
»Gehen Sie hinter die Absperrung, Mrs. Baum.«
»Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, war die Hochzeit für Juni geplant.«
»Ihr Gedächtnis trügt Sie nicht. Jetzt gehen Sie hinter die Absperrung.«
Eine Tragödie schlägt Wellen, und Wellen können Menschen mit sich forttragen. Für die Beteiligten änderte sich alles mit jenen Schüssen, die gegen 16.45 Uhr am Mittwoch, dem 22. März, abgegeben worden waren. Rebecca Harris, vierundzwanzig, eine fröhliche, liebenswürdige junge Frau mit kindlichem Herz am Anfang ihres jungen Erwachsenseins, war gleich darauf tot gewesen. Ihr Verlobter, Joshua Weinstein vom FBI-Büro von Orange County in Kalifornien, wurde von einer Welle in eine Reise solch tiefen Hasses fortgetragen, daß er laut derer, die ihn kennen, von dieser Reise noch nicht zurückgekehrt ist. Rebeccas Vater wurde von einer anderen Welle fortgetragen, direkt drei Wochen danach, zu einem Herzversagen. Der junge Mann mit dem langen Ledermantel und dem Filzhut, ein talentierter, wenn auch nicht sehr produktiver Redakteur beim Journal namens John Menden, glitt auf einer ganz anderen Welle fort von Rebecca. Er kündigte und segelte drei Monate lang im Südpazifik umher, bis sein Geld und seine Leber beinahe verbraucht waren, und kehrte schließlich zurück, um in einem alten zerbeulten Wohnwagen draußen in der rauhen Wüste Südkaliforniens zu wohnen. Der Wachmann mit dem Funkgerät wurde gefeuert. Eigentlich wurde der Vertrag zwischen dem gesamten Unternehmen und dem Journal aufgelöst – finanzielle Wellen aus finanzieller Besorgnis. Der Fotograf, der das nun berühmte Bild von Rebecca geschossen hatte, gewann einen Preis, dann noch weitere. Die einzigen lebenden Dinge, die dem Ereignis nahegestanden hatten und unberührt blieben, waren der Eukalyptusbaum und der Island-Mohn in dem Pflanzentrog, neben dem Rebecca ins Herz getroffen und taumelnd niederfiel und im prasselnden Regen starb.
Sechs Monate gingen ins Land.
Während dieser Zeit wurde der Fall aufgrund der neuen Bestimmungen über haßmotivierte Kriminalität dem FBI als führende verantwortliche Stelle übertragen. Sie arbeiteten mit der Polizei und den Sheriffs und zeitweise auch mit der Abteilung für Alkohol, Tabak und Waffen zusammen. Josh Weinstein nahm seinen gesamten Urlaub in Anspruch und gleich darauf fast ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub. Er sagte, er gehe nach Israel, und verschwand, ohne sich kaum bei jemandem zu verabschieden.
Fünf Monate später war er zurück; seine Blässe war durch eine gesunde Hautfarbe ersetzt, aber seine Augen waren immer noch traurig. Seine FBI-Partnerin Sharon Dumars stellte fest, daß Josh viele seiner Überstunden über Rebecca Harris’ Akten verbrachte – einem Fall, bei dem seine offizielle Beteiligung aufgrund der FBI-Bestimmungen verboten war. Aber da Joshua zwölf Stunden täglich arbeitete, konnte er leicht mal eine Stunde hier, ein paar Stunden da abzwacken, um sich auf sein geheiligtes und nicht gebilligtes Terrain zu wagen. Sharon Dumars sah, daß Joshuas eigene private Akte, die er jeden Abend, bevor er ging, sorgfältig wegsperrte, immer dicker wurde.
Von Neugier getrieben, warf sie einmal einen Blick auf seine Zeitkarte und stellte fest, daß Joshua keine einzige Stunde für seine privaten Ermittlungen aufgeschrieben hatte. Vielleicht war sie die einzige, die davon wußte. Doch sie war mit Sicherheit nicht die einzige, die von seinen langen Telefonaten wußte, da alle Anrufe vom und zum FBI aufgezeichnet und für eine unbekannte Dauer gespeichert wurden.
Bei einigen dieser längeren Telefonate sprach er fast unhörbar, den Rücken ihr zugewandt. Dann legte er auf und drehte seinen Stuhl herum, um sie mit einer Art grimmiger Unbekümmertheit anzuschauen, bevor er sich wieder an die Arbeit machte.
An einem strahlenden Septembermorgen sechs Monate nach dem Tod seiner Verlobten beendete Joshua Weinstein eines seiner fast lautlosen Telefongespräche, sah Sharon einen Augenblick direkt in die Augen, stand auf, schloß seine Akten weg und zog sein Jackett an.
»Komm mit«, sagte er.
Joshuas Aufforderung folgend, verließ sie das Gebäude mit ihm, vergaß sogar, sich auszutragen oder irgendjemandem ein Wort zu sagen. Niemals in den drei Jahren beim FBI hatte sie etwas getan, das so gegen die Vorschriften verstieß.
Kapitel 2
Sharon Dumars nahm ihren weißen FBI-Ford, weil Joshua sie darum gebeten hatte. Schweigend fuhren sie Richtung Riverside, dann weiter nach Süden auf der Interstate 15 nach Temecula, bis sie schließlich auf die State 79 nach Südosten abbogen.
»Wohin willst du, Josh?«
»Unsere Fahrt hat einen bestimmten Grund.«
»Welchen Fall kann ich diesem Grund zuordnen?«
»Freizeit.«
»Es gibt keinen Fall, der Freizeit heißt, soweit ich weiß.«
»Paß einfach auf, und später sagst du mir, was du davon hältst.«
Nach einer Weile erreichten sie die State 371, die sie nach Osten und in höhere Regionen brachte. Hier draußen gab es nur noch vereinzelt ein paar Häuser, die weit hinten mitten in den steinigen Hügeln lagen. Sie sahen bewohnt aus.
»Ich denke, die Leute, die hier rausziehen, wollen niemanden um sich herum haben«, sagte Sharon.
»Oder niemand will um sie herum sein«, entgegnete Joshua abwesend.
Sie fuhren an einem Schild mit der Aufschrift »Cahuilla Indian Reservation« vorbei, dann ein paar Kilometer weiter an einem Schild, das in Richtung Anza Valley zeigte, eintausendeinhundertneunzig Meter über dem Meeresspiegel und eine weniger als dreimal so große Bevölkerung.
Die Stadt tauchte vor ihnen auf. Sharon verringerte die Geschwindigkeit. Sie fuhren an einem geschlossenen Immobilienbüro und einem geöffneten Haushaltswarenladen vorbei, dann an einem Spirituosenladen.
»Wir wollen in Olie’s Saloon. Er liegt auf der linken Seite«, erklärte Joshua.
Sie fuhren hinter einem Mercury, der so tief hing, als hätte er Bowling-Kugeln geladen. Sie sahen durch die schmutzige Heckscheibe eine Gruppe dunkelhäutiger Kinder auf dem Rücksitz, eine große Frau mit schwarzem Haar hinter dem Steuer und neben ihr einen grauhaarigen Kopf, der unter seinem Cowboyhut verloren wirkte. Sharon dachte an den gegenwärtigen Krieg in Orange County zwischen zwei Stämmen, die Ansprüche auf das Land erhoben – die Gabrielenos und die Juanenos –, an all die Verleumdungen, an die Korruption und den Betrug im Namen der Bundeszuschüsse und vielleicht eines Bingo-Palastes.
»Gehört das Land hier zu einem Reservat?«
»Die Stadt nicht. Aber alles drumherum.«
Olie’s Saloon war eine wacklig aussehende Konstruktion aus dunklem Holz mit einem durchhängenden Dach und einer Anschlagsäule davor. Auf dem schmutzigen Parkplatz standen mehrere Laster. Entweder war das Haus so gebaut, daß es wie aus dem Jahre 1870 aussah, oder es war tatsächlich so alt. Sie parkte dort, wo Joshua hindeutete. Ein Indianer in einem weißen Hemd beobachtete sie, als sie durch die Türen im Saloon-Stil in die bereits am späten Nachmittag dunkle Bar gingen.
Sie setzten sich an einen Tisch an der Wand. Laut Speisekarte war heute das Chili-Käse-Omelette im Angebot. Die Kellnerin, eine Frau Mitte Fünfzig, kam zu ihnen, und sie bestellten alkoholfreie Getränke.
»Du kommst oft hierher?«
»Ich möchte, daß du zuhörst und mich bestätigst, wenn du kannst. Und wenn wir hier fertig sind, möchte ich eine ehrliche und hoffentlich hilfreiche Meinung von dir.«
»Hat das was mit Rebecca zu tun?«
»Das hat mit allem was zu tun. Er wird in zehn Minuten hier sein.«
Aber er war in weniger als zehn Minuten da. Er ging geradewegs auf eine lange Reihe von Barhockern zu, die entlang einem Fenster mit Blick auf die Straße standen. Seinen Filzhut legte er auf die Theke neben sich.
Joshua hatte Sharon absichtlich so Platz nehmen lassen, daß sie den Mann beim Eintreten sehen konnte. Er selbst beobachtete John Menden, früher Redakteur beim Journal, im Spiegel über der Bar, wie dieser zur üblichen Zeit eintrat, zu einem bestimmten Barhocker ging und seinen Hut neben sich legte. Menden, vierunddreißig Jahre alt, sah aus wie immer, groß und eher schmal, mit dem leichten, gleitenden Gang eines Athleten oder, wie Joshua wußte, eines Jägers. Er trug die lange Denim-Jacke, die er bei warmem Wetter gern anzog, die abgewetzten Stiefel mit dünnen Sohlen, das Arbeiterhemd und die braune Baumwollweste. Joshua wußte ehrlich gesagt nicht, was er von John Mendens Kleidungsstil halten sollte. Er wirkte vielleicht wegen des Hutes wie eine Mischung aus Cowboy und Verbrecher. Joshua hatte John, der hier täglich seinen Feierabend verbrachte, an insgesamt fünf Abenden beobachtet. Dabei war er in verschiedenen Aufmachungen gekommen, als Geschäftsmann, Golfspieler, Tourist oder Ortsansässiger, weil er wollte, daß sich weder John Menden noch die Stammgäste des Olie’s an ihn erinnerten. Joshua stellte weiterhin fest, daß Johns Haar eine Mischung aus Braun und Blond war, wie man es oft bei Menschen findet, die viel Zeit im Freien verbringen. Seine Augen waren blaßgrau, und er ging wie viele große Menschen leicht vornübergebeugt. Er lächelte selten, wirkte aber entspannt. Doch Joshua hatte auch bemerkt, daß seine Augen immer wachsam und beschäftigt waren. Und er war zu dem Schluß gekommen, daß John Mendens physische Unbekümmertheit eine gute Tarnung für seine gierigen, suchenden Augen war.
Die Kellnerin trat auf John mit einem herzlichen »Hallo, Hübscher« zu.
»Hi, Süße«, entgegnete John wie üblich.
Joshua schielte durch das verschmierte Fenster zu John Mendens Pickup draußen im Schatten und zum braunen Labrador Retriever, der auf der Ladefläche stand. Der große Hund ließ die Saloon-Tür, durch die sein Herrchen verschwunden war, nicht aus den Augen. John nannte ihn Boomer. Neben Boomer stand eine kleinere gelbe Labrador-Hündin. Das mußte Bonnie sein. Und nicht zu sehen, aber irgendwo auf der Ladefläche des Wagens lag mit Sicherheit noch der alte schwarze Labrador namens Belle. Joshua hatte John noch nie ohne seine Herde gesehen.
Ja, John Menden war in allem berechenbar. Das müßten sie ändern.
Doch das war nicht Joshuas größte Sorge in bezug auf John Menden. Ihn störte am meisten, daß Johns Charme und sein verdammt gutes Aussehen – was er beides sehr geschickt bei Frauen einsetzte – das Werkzeug eines Mannes waren, der keinem Druck standhielt. Ein Feigling. Und seine Trinkerei. Der Kerl konnte das Zeug nur so wegkippen.
In der Zeit, in der er und Sharon je eine Cola tranken, brachte die Kellnerin John zwei Bier und einen Schnaps.
Abrupt erhob sich Joshua Weinstein und ging quer durch den Raum auf John Menden zu.
Er hatte sich diesen Moment fast zwei Monate lang ausgemalt. Als er sich ihm näherte, spürte er, wie sein Herz schneller schlug und seine Ohren wärmer wurden, wie immer, wenn etwas wichtig oder gefährlich war oder er es sich allzusehr wünschte.
Kurz darauf stand er neben dem Hocker mit dem Hut darauf und sah zum ersten Mal den Mann aus der Nähe, von dem er hoffte, er könne ihm eines Tages dabei helfen, die größte Mission seines – Joshua Weinsteins – Leben zu erfüllen.
»Ich möchte mit Ihnen reden«, sagte er.
John Menden schaute ihm direkt ins Gesicht, dann wanderte sein Blick hinab zu Joshuas schwarzen Schuhen. Anschließend musterte er ihn lange.
»Dann ist es besser, wenn Sie loslegen. Das ist das fünfte Mal, daß Sie hier sind, wenn ich richtig gezählt habe.«
»Ich bin vom FBI. Mein Name ist Weinstein, und ich möchte mit Ihnen über Rebecca Harris sprechen.«
»Sehr schön.«
Der Ton hörte sich für Joshua falsch an, und wieder fragte er sich, was Rebecca John Menden erzählt hatte und was nicht. »Ich sitze da drüben am Tisch. Dort ist jemand, mit dem ich Sie gerne bekannt machen möchte. Bitte.«
John nahm seinen Hut und sein halbvolles Bierglas und folgte Joshua zum Tisch. Joshua stellte ihn Sharon Dumars vor, die aufstand und ihm die Hand reichte. Er beobachtete sehr aufmerksam, wie sich ihre Blicke begegneten, da es für alles weitere entscheidend sein konnte, wie sich ein Mensch in solch einem allerersten Moment des Gegenüberstehens verhält. Johns Augen verrieten wenig.
Als die Kellnerin kam, bestellte Joshua noch ein Bier und einen Schnaps für seinen Gast und für sich und Sharon jeweils nur ein Bier. Er mochte keinen Alkohol, aber er war sich auch des irrationalen Mißtrauens bewußt, den Menschen, die Alkohol trinken, denjenigen gegenüber hegen, die es nicht tun. Nachdem die Kellnerin die Getränke gebracht hatte, nahm er sein Glas, berührte mit dessen Boden leicht den Rand von Johns Glas, dann das von Sharon, und trank einen Schluck. »Das tut gut«, murmelte er ohne Überzeugung.
John Menden trank ebenfalls und nickte.
»Ich würde gerne eine Weile reden und möchte, daß Sie zuhören. Haben Sie, sagen wir, ein, zwei Stunden für uns Zeit?«
»Ich gebe Ihnen genau eine Minute.«
»Genauso vergehen die Stunden, Mr. Menden.«
Später, als Sharon Dumars darüber nachdachte und ihr schließlich klar wurde, was Joshua Weinstein vorhatte, mußte sie zugeben, daß sie ihn noch nie so voller Leidenschaft bei einer Sache gesehen hatte. Konzentriert, das ja, weil er immer konzentriert war, ernsthaft, ja – der Mann schien keinen Funken Humor zu besitzen, und falls doch, dann war dieser in den letzten sechs Monaten auch noch erloschen. Überzeugend, und zwar total, denn egal, was Joshua Weinstein sagte, es war schwierig zu glauben, daß es etwas anderes als die Wahrheit war. Aber die Erregung war neu an ihm, zumindest für Sharon. Als sie am Abend allein in ihrem Bett in der Vorstadtsiedlung von Irvine lag, während ihre große Tigerkatze Natalie auf ihrem Bauch schnurrte, fragte sie sich, ob Erregung das richtige Wort dafür war. Sie probierte andere Substantive aus: Überzeugung, Gefühl, Wunsch, Hoffnung. Aber keines traf zu. Kurz bevor der Schlaf sie überkam, gelangte sie zu der Erkenntnis, daß es nicht echte Leidenschaft war. Es war ein tief empfundener Haß.
Und was sie zu Joshua gesagt hatte, war: »Er ist perfekt.«
Kapitel 3
»Wie Sie wissen, Mr. Menden, wurde vor etwas mehr als einem halben Jahr, am 22. März, Rebecca Harris auf dem Parkplatz des Journal ermordet. Sie wurde aus weiter Entfernung erschossen. Die Kugeln waren für ihre Chefin Susan Baum gedacht. Wer auch immer die Schüsse abfeuerte, wußte entweder nicht genau, wie Susan Baum aussieht – was unwahrscheinlich ist – oder konnte sie aus so großer Entfernung nicht von Rebecca unterscheiden, denn sie trug einen Regenmantel und einen Hut, und ihre Hautfarbe und Statur waren der von Susan Baum ähnlich. Und sie wollte in Susans Auto steigen. Als der Killer die Luft aus seinen Lungen strömen ließ, um seinen Abzugsfinger ruhig zu halten, dachte er nicht eine Sekunde, daß die Frau in seinem Fadenkreuz nicht die richtige sein könnte. Rebecca starb; Susan tat es nicht. Es war eines jener Geschehnisse, die als Tragödie bezeichnet werden können, da Rebecca einen tragischen Fehler begangen hatte, der sie sterben ließ. Ihr Fehler war, daß sie freundlich, rücksichtsvoll und aufmerksam war. Sie hatte sich bereit erklärt, Susan Baums Wagen vorzufahren. Ich glaube, nichts von dem, was ich erzähle, ist neu für Sie.«
John nahm noch einen Schluck von seinem Bier. »Ich war mal Reporter, aber eine Neuigkeit ist immer eine Neuigkeit.«
»Stimmt. Nun, ich will Ihnen erzählen, was wir, das FBI, in den sechs Monaten seit Rebeccas Tod herausgefunden haben. Einiges davon haben Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen, doch das meiste garantiert nicht. Aber zuerst brauche ich von Ihnen ein Versprechen. Sie geben die Zeitung von hier heraus, die Anza Valley News. Richtig?«
»Ja, richtig.«
»Ich brauche Ihr Wort, daß nichts von dem, was ich Ihnen erzähle, jemals in diesem Blatt oder irgendeinem anderen erscheinen oder über Ihre Lippen kommen wird – ganz gleich, wieviel Schnäpse und Biere Sie an einem Freitagabend gekippt haben; ganz gleich, wie teilnahmslos die Indianer, mit denen Sie an einem ruhigen Samstagnachmittag hier reden, auch sein mögen; ganz gleich, wie nahe Ihnen eine Geliebte stehen mag.«
John lächelte mit einer nicht zu übersehenden Herablassung, trank seinen Schnaps aus und winkte der Kellnerin nach einem neuen.
»Habe ich Ihr Versprechen?«
»Wenn es das ist, was Sie brauchen.«
»Sonst würde ich nicht fragen.« In diesem Moment sah Joshua zu Sharon, und sein Gesichtsausdruck forderte das gleiche von ihr – ein Versprechen. Sie vermutete, daß die Aktion, das Büro so plötzlich zu verlassen und sie in ihrer »Freizeit« hierherzubringen, ohne sich abzumelden, ohne zu sagen, wo sie hingingen, und ohne außer dem Funkruf eine Nummer für den Notfall zu hinterlassen, eine Möglichkeit sein sollte, die Geschichte offiziell aus dem FBI herauszuhalten. Sie wandte ihren Blick von Joshua ab und hoffte, daß er dies als ein eingeschränktes Ja verstand.
»Bis jetzt«, fuhr Joshua fort, »ist nur eins sicher: Die Geschosse hatten das Kaliber .30/06, waren abgerundet und von Hornady hergestellt. Sie stammten nicht aus den Hülsen, die am Tatort gefunden wurden. Sie haben von den Dingern gehört, nehme ich an.«
John schüttelte den Kopf.
»Auf einer steht: ›Wenn es im Verlauf der menschlichen Geschehnisse ...‹, und auf der anderen: ›...notwendig werden sollte ...‹ Die Gravierung sieht aus wie vom Fachmann, kann aber auch von einem begabten Amateur stammen.«
John runzelte die Stirn und nahm noch einen Schluck. »Aber sie wurden nicht abgefeuert?«
»Nein. Die Hülsen hätten uns als Beweismaterial dienen können, doch sie wurden nicht zugelassen. Gott allein weiß, wo die Waffe im Augenblick steckt. Vielleicht auf dem Grund des Pazifik. Der Killer nahm die richtigen Patronenhülsen mit und hinterließ zwei glänzende Messinghülsen mit der kleinen Warnung darauf. Seine patriotische ... Unterschrift.«
»Sein Ruf nach Revolution.«
»Diese Leute sind keine Revolutionäre, das sind Agenten des Status quo«, entgegnete Joshua.
»Wie Sie.«
Die Kellnerin brachte den Schnaps. Als sie weg war, sagte Joshua: »Das habe ich fürs erste überhört. Ich werde später darauf zurückkommen. Wir haben noch mehr, allerdings nicht viel. Das vermutlich von den Tätern benutzte Wohnmobil wurde fünfzehn Kilometer vom Tatort entfernt hinter einem Donut-Laden in Westminster gefunden. Es waren alte Nummernschilder dran, wahrscheinlich von einem Schrottplatz, Nummernschilder, die seit zehn Jahren nicht benützt wurden und bis 1985 an einem VW-Käfer waren, der damals einen Totalschaden hatte. Niemand sah das Wohnmobil auf den Parkplatz fahren, niemand sah, wer den Fahrer und vielleicht die Beifahrer mitgenommen hat. Wir haben innen und außen Fingerabdrücke gefunden, aber sehr wenige und unvollständige, außerdem Spuren von Talg auf dem Lenkrad und den Türgriffen innen, den Fensterkurbeln und der Gangschaltung.«
»Der alte Trick mit den Latexhandschuhen.«
»Wahrscheinlich. Die Untersuchung der Haare und Fasern ergab nichts Interessantes.«
»Haare zur DNA-Untersuchung?«
»Das geht mit Haaren nicht«, entgegnete Joshua, »nur mit dem Gewebe, in dem sie stecken. Wir haben Haare, aber keine Haut. Außerdem war das Wohnmobil vorher auf vier verschiedene Halter angemeldet gewesen, ehe es aus einer Werkstatt gestohlen wurde. Aber die Werkstatt hatte von dem Diebstahl gar nichts bemerkt, weil es zwar repariert, aber weder bezahlt noch abgeholt worden war. Es hatte im Hof schon zwei Monate lang Staub gesammelt. Wir haben alle früheren Besitzer unter die Lupe genommen, alle, die die Besitzer kannten, und alle Mitarbeiter in der Werkstatt.«
Joshua Weinstein zwang sich zu einem weiteren Schluck Bier. »Und?«
»Ich komme später darauf zurück, wenn nötig. Der chronologische Ablauf ist hier nicht wichtig. Bis jetzt irgendwelche Fragen?«
»Warum Susan Baum?«
»Vom linken Flügel. Eine Jüdin. Eine Frau. Eine Unruhestifterin auf Weltklasseniveau. Eine brillante Unruhestifterin. Sie stößt immer noch eine Menge Leute vor den Kopf, genau dort auf der ersten Seite des Orange County Journal, drei Tage in der Woche – Geschäftsmänner, Republikaner, altmodische Patrioten, Kirchen, Jäger, Raucher, Fleischesser, Trinker, Heteros. Sie kennen die Litanei. In gewisser Hinsicht ist sie die Revolutionärin. Außerdem ist sie eine amerikanische Bürgerin, die ihr verfassungsmäßiges Recht auf Meinungsfreiheit ausübt. Man versuchte sie dafür zu töten, und das sagten sie, als sie uns die Patronenhülsen mit den Gravierungen daließen.«
»Sind Sie sicher, daß sie nicht hinter der Ermordeten, hinter Mrs. ... äh ... Harris her waren?«
»Wir haben diese Möglichkeit verfolgt«, antwortete Joshua, »sind aber auf nichts gestoßen.«
In den darauffolgenden Sekunden der Stille schien Joshua nicht bei der Sache zu sein. Sharon merkte an seinem Gesichtsausdruck, daß er mit seinen Gedanken bei Rebecca war. Auch Johns Gesicht zeigte Trauer.
Es war John, der das Schweigen brach. »Hat jemand Kontakt mit Ihnen aufgenommen? Gibt’s jemanden, der sich zu der Tat bekennt, ein Anruf, irgendetwas?«
Joshua kam in die Gegenwart zurück. »Achtundsechzig Briefe, zwölf Postkarten und hundertvierzehn Anrufe. Das überraschte mich. Ich wußte, daß Orange County konservativ ist, aber ich wußte nicht, daß es hier so viel Haß gleich unter der Oberfläche gibt. Haß und Angst. Genaugenommen erschien uns nur ein Brief glaubwürdig – der Rest steht in keinem Zusammenhang, da sind wir ziemlich sicher. Und die meisten sind nicht unterschrieben. Der Brief, den wir ernst nehmen, ist von Leuten, die sich selbst ›The Freedom Ring‹ nennen. Hier ist eine Fotokopie.«
Joshua zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus seiner Jackentasche. John Menden kippte seinen Schnaps hinunter, dann schob er die Gläser aus dem Weg und legte das Blatt auf den Tisch.
Rebecca war ein Fehler, der uns leidtut. Baum ist das Geschwür, das wir beseitigen wollten. Was Miss Harris passiert ist, kann jedem passieren, der versucht, unsere Rechte einzuschränken. Wir werden nicht zulassen, daß Amerikas Fundamente von Menschen eingerissen werden, die von unserem System profitieren, nur um es zu verachten.
The Freedom Ring
John gab Joshua das Blatt zurück, der es wieder in seine Jackentasche steckte. »Nun, Mr. Weinstein, haben Sie einen Verdacht oder nicht?«
»Haben wir.«
Joshua sah Sharon Dumars an, während er dies sagte, und bemerkte mit einiger Befriedigung das Erstaunen auf ihrem Gesicht. Sie nahm die Neuigkeit wie einen schlechten Witz auf, schüttelte ihr welliges dunkles Haar mit einem Ruck ihres Kopfes nach hinten und griff nach ihrem Bierglas. Sie ist dabei zu lernen, dachte er, doch im Moment würde ihre elektrische Ladung einen Lügendetektor zum Explodieren bringen. »Aber ich darf nicht wissen, wen Sie im Verdacht haben«, vermutete John.
»Nein«, erwiderte Joshua. »Das dürfen Sie nicht wissen ... noch nicht.«
John zuckte mit den Schultern und lehnte sich zurück. »Warum sind Sie dann hier?«
»Ich bin hier, Mr. Menden, weil ich möchte, daß Sie mir zuhören.«
»Warum sollte ich Ihnen zuhören? Die ganze Welt ist voller Menschen, die Geschichten erzählen. Warum sollte ich mir also Ihre Geschichte anhören?«
Seine Stimme und sein Blick wirkten so selbstgefällig, daß Sharon Dumars nicht sagen konnte, ob John Menden schlau, unschuldig oder möglicherweise einfach nur total dumm war. »Weil Sie Rebecca geliebt haben, Sie arroganter Scheißkerl.« Sharon Dumars verschluckte sich und mußte husten. Sie konnte ihre Augen nicht von Joshua Weinstein abwenden. Seine Ohren waren knallrot. Der arme Mann war in seinem Inneren aufgewühlt wie ein Vulkan. Und seine unersättlichen dunklen Augen fixierten Johns Gesicht und ließen es nicht los. Sie schienen etwas nahezu unsichtbar Kleines erkennen zu wollen. John blickte mit äußerster Ruhe zurück.
»Ich war mit ihr verlobt, wie Sie in den Zeitungen gelesen haben«, fuhr Joshua fort. »Und während ich das war, haben Sie ihr beim Journal, wo sie beide arbeiteten, den Hof gemacht. Sie sprachen mit ihr, Sie gingen mit ihr zum Mittagessen, und später war sie bei Ihnen auf dem Sun Valley Drive in Laguna Canyon zu Hause. Sie empfanden etwas für sie, von dem Sie glaubten, es noch nie zuvor für eine Frau empfunden zu haben. Sie liebten sie, oder nicht? Das zu erkennen war für mich leichter als alles andere, was ich bisher in meinem Leben getan habe. Es war leichter als atmen. Ich liege doch nicht verkehrt, oder?«
Als Sharon endlich zu John Menden hinüberblicken konnte, war sein Ausdruck unverändert. Sie sah ihn genau an, aber trotz aller Schulung und des Scharfblicks, trotz des verblüffenden Zusammenhangs, der sich ihr offenbarte, stellte sie bei ihm keine Reaktion fest. Es war fast unglaublich.
»Antworten Sie nicht«, sagte Joshua. »Was Sie antworten, ist für mich nicht wichtig, weil ich weiß, was passiert ist, und die Wahrheit kenne. Die Wahrheit, Mr. Menden, ist, daß Rebecca auch in Sie verliebt war. Überrascht? Dann ist es mit Sicherheit eine angenehme Überraschung. Erinnern Sie sich an das Bild, das von Rebecca im Regen neben dem Pflanzentrog veröffentlicht winde? Natürlich tun Sie das. Sie waren da drauf, obwohl Sie nicht zu erkennen waren. Haben Sie sich nicht gewundert, warum der Ring, den Rebecca acht Monate lang an der linken Hand getragen hatte, plötzlich weg war? Ich werd’s Ihnen sagen. Sie nahm ihn an jenem Morgen ab und gab ihn mir mit den Worten zurück, es gebe jemand anderen. Sie weinte, sie tobte, sie raste. An jenem Abend, an dem Abend, an dem sie starb, ging ich in ihre Wohnung und fand zwei Briefe, die sie geschrieben hatte. Hier ist Ihrer.«
Joshua zog einen schmalen Umschlag heraus, rosa mit einem zarten Blumenmuster, und legte ihn auf den Tisch. Er war versiegelt. Und auf den Umschlag legte er etwas, das selbst im trüben Licht von Olie’s Saloon warm glänzte.
Joshua Weinsteins Stimme drückte tiefe Bitterkeit aus. »Nehmen Sie auch den Ring. Berühren Sie ihn. Denken Sie an den perfekten Finger, der ihn trug. Denken Sie an die Zeit, die Sie zusammen verbrachten. Geben Sie ihn mir zurück, wenn Sie damit fertig sind. Er gehört mir. Er hat mich viel gekostet, und ich rede nicht von Geld.«
Sharon wandte ihre Aufmerksamkeit erneut John zu. Lange Zeit schaute er auf den Umschlag und den Ring. Er blinzelte zweimal, blickte auf sein leeres Schnapsglas und sah dann Joshua Weinstein an. In seinen Augen zeigte sich eine Feuchtigkeit, die ein oder zwei Sekunden zuvor noch nicht dagewesen war.
Dann stand Joshua auf. »Rebecca liebte Sie«, sagte er. »Man hat ihr durchs Herz geschossen, und sie starb allein auf einem verdammten Parkplatz im Regen. Deswegen wollten Sie mir zuhören. Danke für Ihre Zeit.«
Er knallte ein paar Geldscheine auf den lisch und war bereits draußen, als sich Sharon ihre Tasche über die Schulter hängte und Joshua folgte.
Kapitel 4
Im Frühjahr 1971 kauften Johns Eltern ein Flugzeug. John war neun, und er saß mit ihnen im Büro der Martin Aviation auf dem Flughafen von Orange County, während sein Vater die Papiere unterzeichnete. Der Verkäufer, ein schlanker, braungebrannter Mann mit weicher Stimme, hieß seinen Vater, seine Mutter und sogar ihn selbst in einem Eliteverein von Fliegern willkommen. Im Büro hingen Fotos von dem Verkäufer in verschiedenen Flugzeugen. Der Lärm der Passagierflugzeuge draußen ließ die Bilderrahmen an der Wand vibrieren, und die surrenden Tenöre der Privatflugzeuge durchschnitten beim Starten und Landen die Luft.
John verstand, daß es ein kleines, ziemlich altes Flugzeug war, das aber absolut in Ordnung war und zu einem vernünftigen Preis verkauft wurde – das perfekte Anfängerflugzeug für einen Luftfahrttechniker mittleren Alters, der schon früh in seinem Leben vom Reiz des Fliegens gepackt worden war und es sich nun erlauben konnte, die Schulden in Kauf zu nehmen, um dem nachzugeben, was manche Menschen »eine Schwäche« nannten.
»Die einzige gute Schwäche, die ein Mann haben kann«, meinte der Verkäufer und blickte zu Johns Mutter. »Oder eine Frau. Dieses kleine Flugzeug wird Ihnen eine Welt eröffnen, die es bisher nur in Ihrer Phantasie gab. Jede Minute in der Luft ist wie eine Stunde Träumen.«
»Sehr schön gesagt«, pflichtete sein Vater bei, der schnell die Verkaufsvereinbarungen unterschrieb. »Ich würde gerne wissen, ob wir uns den Weg zu weiteren sechs Monaten Kundendienst erträumen können.«
»Ich werde Herb fragen, Mr. Menden.«
»Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar, Lew.«
Seine Mutter lachte bloß. Auf diese Weise lachte sie immer, wenn sie jemandem seinen Willen lassen wollte, wie John mit der Zeit herausgefunden hatte. John gefiel es, wenn sie lachte, wenn plötzlich ihre großen Zähne zum Vorschein kamen und ihr sonst ziemlich strenges Gesicht wie die Sonne erstrahlte. Sein Vater sah gut aus, war groß und verströmte eine majestätische Selbstgefälligkeit, die durch seine fröhliche Art liebenswert wurde. Männer fügten sich ihm immer, und Johns Klassenkameraden hatten instinktiv Angst vor ihm. John gefiel das Bild, das sein Vater und seine Mutter zusammen abgaben.
Er stand im Schatten des Martin-Gebäudes und beobachtete, wie sein Vater zur Startbahn gebracht wurde. Die kleine Piper war in hellem Gelb und rot abgesetzt gestrichen, und Johns Mutter hatte sich für ein geschmackvoll theatralisches Kostüm entschieden – roter Seidenschal, Fliegerbrille und eine Bomberjacke aus Leder –, in dem sie ihren Jungfernflug in der eigenen Maschine erleben wollte. John fragte sich, warum sie einen Zweisitzer und nicht einen Dreisitzer gekauft hatten, aber er gewöhnte sich an die Tatsache, daß seine Eltern ihm nur formal Zutritt in ihre Gegenwart gewährten. Es war eine warme Formalität, hinter der John oft Liebe spürte. Aber ihre Beziehung war nie eine Sache, in die man einfach hineinplatzte.
Seine Mutter winkte, als sie es sich im Cockpit bequem gemacht hatte, und Lew half ihnen, sich zurechtzufinden.
John setzte sich auf eine Bank und wartete auf die Rückkehr des Flugzeugs. Er sah es bereits als hellen Fleck am westlichen Himmel, als es sich zum Landen nach unten neigte. Nach der Landung positionierte er sich auf das Hallenvorfeld und winkte es mit den knappen, militärischen Bewegungen des Bodenpersonals herein, das er so sehr bewunderte. Sein Vater, mit dem Funkgerät an seinem Kopf, lächelte ihm durch das kleine Seitenfenster zu. Die Piper blieb stehen.
Seine Mutter kletterte mit Lews Hilfe heraus und umarmte John. Als Lew John ins Cockpit half, wo sich sein Vater Flugnotizen in ein kleines Buch machte, trat sie zurück. Sein Vater streckte die Hand aus, und John schüttelte sie.
»Auf geht’s, mein Sohn.«
»In das wilde Blau da hinten.«
»Zieh den Schultergurt richtig fest. Ich will nicht, daß mein Kopilot rausfliegt.«
Das Funkgerät gab bei den atmosphärischen Störungen ununterbrochen Rülpser von sich, die sein Vater aber wunderbarerweise zu verstehen schien.
Fünf Minuten später erhoben sie sich in die Luft. John war überrascht, daß sich das Flugzeug nicht nur auf und ab und nach rechts und links bewegte, sondern sich auch irgendwie drehte, als rutschte es auf dem Bauch. Der Motor hat schwer zu kämpfen, dachte er, und der Ausblick ist nicht so gut, wie er hätte sein können, weil die Fenster etwas zu hoch sind.
Er blickte auf Orange County hinab. Von hier oben wirkten die Flächen, Parzellen und Wäldchen viel organisierter als von unten. Von oben waren sie alle ein Teil eines großen Bildes. Er sah ein nierenförmiges Schwimmbecken. Würde man einen Sprung dort hinein – vorausgesetzt, man springt bei angespanntem Körper mit den Füßen zuerst und landet in der tiefen Seite – überleben oder nicht?
Sein Vater lenkte das Flugzeug hinaus über den Pazifik. John war sich sicher, daß man bei einem Sprung ins Meer, würde man alles richtig machen, auch dort landen und überleben würde. Er blickte hinab und erkannte die beiden Anlegeplätze von Balboa und Wedge, wo er stundenlang den Surfern zugesehen hatte, die über die halsbrecherischen und gegen die Felsen knallenden Wellen geritten waren.
Dann beobachtete er eine Weile nichts anderes als die Unterarme seines Vaters und bewunderte aufs Neue die kräftigen Arme, die unter den hochgekrempelten Ärmeln hervorkamen, die vielen Haare, die bis hinab zu seinen Handgelenken liefen und schließlich hinter der ersten Knöchelreihe auf den Fingern wieder auftauchten. Wuchsen sie zwischendrin unter der Haut weiter? Er sah, wie sich die Sehnen an den Handgelenken zusammenzogen, als sein Vater Kurs zurück in Richtung Osten nahm. Beiläufig ließ er eine Hand über sein eigenes Handgelenk gleiten, um den dünnen goldenen Flaum zu begutachten.
»Was denkst du, Johnny?«
»Daß es schön ist. Würde man überleben, wenn man in eins von diesen Schwimmbecken springen würde, aber mit den Füßen zuerst, und wenn man richtig steif bleiben würde?«
»Ich würd’s nicht probieren.«
»Der Wind würde einen wahrscheinlich auf ein Dach oder so was pusten.«
»Wahrscheinlich. Schau auf dieses Land runter, mein Sohn. Es gehört dir. Ist das nicht ein schöner Gedanke?«
»Es kann mir doch gar nicht gehören, Dad.«
»Doch, das tut es. Es gehört jedem, der hier Wurzeln faßt. Bei deiner Mutter und mir ist das so. Bei dir wird das auch so sein. Wenn du von hier oben hinunterschaust, merkst du, daß das Land gar nicht so riesig ist. Es ist wie ein Hinterhof. Es gehört dir, damit du darin spielen und leben und es versorgen kannst. Sieh dir das Meer an. Sieh dir die Berge an. Es ist ein gutes Land, John – du kannst dich glücklich schätzen, daß du hier aufwachsen darfst.«
»Ich wette, man überlebt, wenn man ins Meer springt.«
»Vielleicht. Aber auch nur vielleicht.«
John lehnte sich zurück, spürte das Dröhnen des Motors und blickte in den Himmel hinaus. Er hörte seinem Vater zu, der über Funk mit dem Bodenpersonal sprach. Er fühlte sich gut, wie er hier saß, neben seinem Vater als Teil seiner Welt. Ein Vater ist jemand, dachte er, der Macht über die Dinge hat, über ein Flugzeug, ein Land, den Himmel.
John blickte auf seine dünnen dunklen Beine hinab, auf seine Füße, seine kurzen Hosen. Dann betrachtete er seinen Vater. Er sah all die Veränderungen, die er durchmachen mußte, um wie sein Vater zu werden, aber konnte es nicht abwarten, bis sie einsetzen würden. Alles wuchs so langsam, nur ein paar Zentimeter im Jahr. Er versuchte sich vorzustellen, so groß wie sein Vater zu sein, mit all den Haaren und der rauhen Haut und der Art, wie die Luft um einen herum schneller verdrängt wird, wenn man größer ist. Er entspannte sich auf seinem Sitz und legte einen Arm wie beiläufig auf ein angezogenes Knie.
»Stimmt«, sagte er, »das Land gehört mir.«
»Nimm den Fuß vom Sitz, John.«
Auf dem Rückweg zum Flughafen stellte John sich vor, sie würden nur für ein paar Minuten landen, um seine Mutter einsteigen zu lassen. Dann würden alle drei zusammen in einen langen Urlaub an einem gefährlichen Ort fliegen, aber an einen Ort, an dem Baseball gespielt wurde. Er liebte diese Tagträumerei, und er glaubte so lange daran, bis er nach hinten sah und bemerkte, daß es insgesamt nur zwei schmale Sitze gab. Das ist wirklich dumm von Dad, ein Flugzeug zu kaufen, in dem es nicht genügend Platz für uns alle gibt. Oder hat er das vielleicht mit Absicht getan?
Kapitel 5
Zwei Tage nach dem Treffen im Olie’s warteten Joshua Weinstein und Sharon Dumars vor Johns Wohnwagen, als er nach Hause kam. Es war kurz nach sechs, und die rote Sonne am blauen Septemberhimmel verstrahlte noch großzügig ihr Licht.
John erblickte den Hubschrauber auf einem flachen Stück der Wüste nicht weit vom Wohnwagen entfernt.
»Die Geheimagenten«, begrüßte er sie mit einem angedeuteten Lächeln.
»Der Redakteur aus der Stadt«, grüßte Joshua zurück, ohne zu lächeln.
Boomer beschnupperte ihre Schuhe, während John drei Gartenstühle aus Plastik aufklappte, die er für Gäste gekauft hatte, aber noch nie gebraucht hatte. Bonnie sah hinter dem Wohnwagen hervor, die schwarze Belle schlief bereits neben ihr. John wischte den Staub mit der Hand von den Stühlen und bot den beiden Platz an. Dann machte er die Fenster des Wohnwagens von innen auf und kam mit Bier wieder heraus.
Er öffnete die Flaschen, gab je eine seinen Besuchern und setzte sich.
»Hübscher Wohnwagen«, meinte Joshua, ohne sich zu diesem umzudrehen. Stattdessen ließ er seinen Blick über Johns Stiefel mit den flachen Absätzen, seine abgetragene Jacke, die braune Weste und den Filzhut wandern.
»Danke«, entgegnete John.