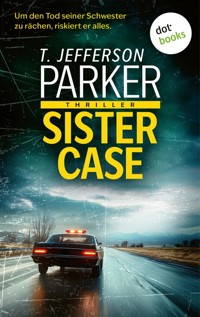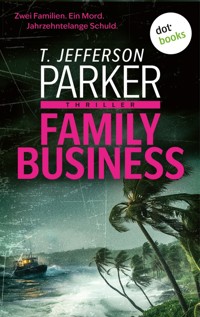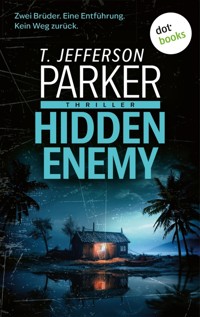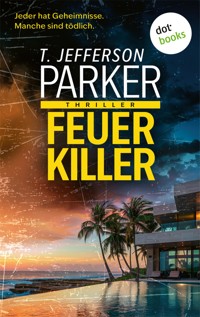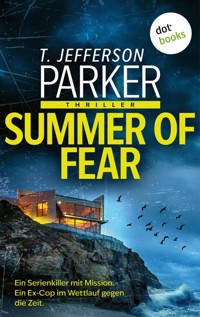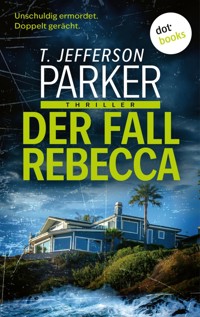9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
Stille Wasser sind tödlich Vom Leben gezeichnet – dieser Satz passt in mehrfacher Hinsicht zu Joe Trona: Als Kind von seinem eigenen Vater mit Säure entstellt, fand er Rettung bei Will Trona, dem charismatischen Politiker, der ihn adoptierte. Für Joe wird Will fortan zum Helden und zur Vaterfigur. Blind folgt er ihm in eine Welt aus Macht, Gier und Korruption und wird als »stiller Joe« zur diskreten und loyalen Rechten Hand seines Stiefvaters, bereit, ihn um jeden Preis zu schützen. Doch als Will ermordet wird, bricht für Joe eine Welt zusammen. Getrieben von Wut und Trauer schmiedet er einen Racheplan, der ihn nicht nur zu den Mördern führen wird, sondern auch zu einer schmerzhaften Wahrheit über sich selbst … »Ein weiteres Meisterwerk eines versierten Autors.«― Kirkus Review Ein erstklassiger Thriller-Noir von Bestsellerautor T. Jefferson Parker – für Fans von Harlan Coben und Michael Connelly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vom Leben gezeichnet – dieser Satz passt in mehrfacher Hinsicht zu Joe Trona: Als Kind von seinem eigenen Vater mit Säure entstellt, fand er Rettung bei Will Trona, dem charismatischen Politiker, der ihn adoptierte. Für Joe wird Will fortan zum Helden und zur Vaterfigur. Blind folgt er ihm in eine Welt aus Macht, Gier und Korruption und wird als »stiller Joe« zur diskreten und loyalen Rechten Hand seines Stiefvaters, bereit, ihn um jeden Preis zu schützen. Doch als Will ermordet wird, bricht für Joe eine Welt zusammen. Getrieben von Wut und Trauer schmiedet er einen Racheplan, der ihn nicht nur zu den Mördern führen wird, sondern auch zu einer schmerzhaften Wahrheit über sich selbst …
eBook-Neuausgabe September 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Silent Joe« bei Hyperion, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2001 by T. Jefferson Parker
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Pixiels Park und AdobeStock/Matthew
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-69076-042-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
T. Jefferson Parker
Der stille Mann
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Klaus-Dieter Schmidt
Für Fritz und Flo,
die mich noch immer zu sich einladen,
obwohl sie mich länger kennen als ich mich selbst
Kapitel eins
»Drück auf die Tube, Joe. Mary Ann leidet mal wieder unter Depressionen; deshalb will ich bis zehn zu Hause sein.«
Das war mein Boss, Will. Will Trona, Verwaltungschef des ersten Bezirks von Orange County. Mary Ann war seine Frau.
»Ja, Sir.«
»Erzähl mir was, während du fährst. Bist du bewaffnet?«
»Wie üblich.«
Will war angespannt. Das war er in letzter Zeit öfter. Er setzte sich wie immer neben mich. Hinten nahm er nur Platz, wenn er eine Besprechung hatte. Sonst saß er vorn, wo er die Straße, das Armaturenbrett und mich im Auge behalten konnte. Er hatte ein Faible für Geschwindigkeit und liebte es, wenn ich aus einer Kurve heraus beschleunigte, so dass sein Kopf in die Kopfstütze gepresst wurde. Ständig fragte er mich, wie ich es schaffte, die Kurven so schnell zu nehmen, ohne von der Straße abzukommen.
Ich gab ihm immer die gleiche Antwort: »Langsam hinein, schnell heraus.« Das lernt man in der Fahrschule als Erstes über das Kurvenfahren. Aber mit einem guten Auto kann man Dinge anstellen, die kaum jemand für möglich hält.
Wir fuhren von Wills Haus in Tustin Hills die Berge hinunter. Es war Mitte Juni und vor der Abendsonne hing ein pinkfarbener Schleier aus Wolken und Smog. Oben in Tustin Hills gab es eine Menge neuer Häuser, aber Wills Haus gehörte nicht dazu. Verwaltungschefs verdienen zwar anständig und genießen darüber hinaus einige Vergünstigungen, doch Orange County ist eine der teuersten Gegenden des Landes. Im Vergleich zu den Häusern der Umgebung wirkte Wills Haus abbruchreif. Doch eigentlich war es nur alt und schlicht. Ansonsten gab es nichts an ihm auszusetzen. Tatsächlich war es ein gutes Haus. Mehr als gut. Ich muss es wissen, denn ich bin in ihm aufgewachsen. Will ist mein Vater, gewissermaßen.
»Der erste Halt ist der Kulturverein«, sagte er mit einem Blick auf seine Uhr. »Medina traut sich wieder raus.«
Er sah mich nicht an, während er sprach. Stattdessen hatte er den Kopf zurückgelegt und die Augen halb geschlossen. Aber sie bewegten sich. Für gewöhnlich machte er den Eindruck, als würde ihm missfallen, was er sah. So als würde er es beurteilen und herauszufinden versuchen, wie man es verbessern konnte. Aber auf seinem Gesicht lag auch etwas wie Zuneigung. Und Besitzerstolz.
Jetzt griff er nach der zwischen seinen Füßen stehenden Aktentasche aus Leder, ließ sie aufschnappen, nahm einen schwarzen Terminkalender heraus, stellte sie wieder auf den Fußboden und begann sich Notizen zu machen. Er hatte die Angewohnheit, beim Schreiben zu reden. Manchmal nur mit sich selbst, manchmal mit mir. Da ich bei ihm lebte, seit ich fünf Jahre alt war, und abends für ihn arbeitete, seit ich sechzehn war, hatte ich zu unterscheiden gelernt, wann er Selbstgespräche führte und wann er mit mir sprach.
»Medina hat angeblich fünfhundert illegale Einwanderer in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen, die einem Reporter der Times erklärt haben, sie seien zwar illegal hier, dürften aber trotzdem in den Vereinigten Staaten wählen. Das habe Medina ihnen erzählt. Und sie alle würden für mich stimmen, weil Medina es ihnen gesagt hat. Wie soll ich mich jetzt verhalten?«
Ich hatte schon darüber nachgedacht. »Distanziere dich davon«, antwortete ich mit einem Blick in den Rückspiegel. »Fünfhundert Stimmen sind den Skandal nicht wert.«
»Das ist kurzsichtig, Joe. Bösartig und dumm ist es. Dank Medina bekomme ich die Stimmen der Latinos und du meinst, ich sollte ihm den Laufpass geben? Wer hat dir beigebracht, so mit deinen Freunden umzugehen?«
Will spielte immer den Lehrer. Ständig testete er, prüfte, diskutierte – oder sprach etwas aus, nur um zu hören, wie es sich anhörte und ob er es selbst glaubte oder nicht.
Manche Dinge sah ich mittlerweile genauso wie er, in anderen würde ich nie mit ihm übereinstimmen. Will Trona hatte mich zu dem gemacht, was ich war, aber selbst er hatte seine Grenzen. Ich war nicht einmal halb so alt wie er. Ich hatte noch viel vor mir.
Doch eines hatte er mich gelehrt: dass man sich schnell entscheiden und mit seiner ganzen Kraft hinter dieser Entscheidung stehen muss. Und wenn man später seine Meinung ändert, sollte man mit aller Kraft diese Entscheidung vertreten. Man darf keine Angst haben, sich zu irren. Will hasste zwei Dinge: Unentschlossenheit und Halsstarrigkeit.
Also sagte ich: »Du brauchst die Latinostimmen, um den ersten Bezirk zu gewinnen. Das ist klar. Aber diese Stimmen werden dir nicht verloren gehen. Die Leute lieben dich.«
Will schüttelte den Kopf und schrieb weiter. Er war ein ansehnlicher Mann, gut gebaut, kräftiger Nacken, breite Brust und Hände, die durch die Sommer, in denen er auf dem Bau gearbeitet hatte, um nach der Rückkehr aus Vietnam sein Studium zu finanzieren, stark und dunkel geworden waren. Zurückgekämmte schwarze Haare, die an den Schläfen grau wurden. Blaue Augen. Wenn er einen ansah, dann mit dem gleichen Ausdruck wie im Auto, den Kopf leicht zurückgelegt, fast schlafend, aber mit aufmerksamem Blick. Und wenn er lächelte, dann gaben die Spuren von vierundfünfzig Jahren seinem Gesicht einen Ausdruck, der die Leute davon überzeugte, dass er sie kannte und mochte. In den meisten Fällen stimmte das auch.
»Joe, achte heute Abend auf Medina. Mund zu, Augen auf. Du könntest etwas lernen.«
Mund zu, Augen auf. Du könntest etwas lernen. Eine von Wills ersten Lektionen.
Er klappte den Terminkalender zu und steckte ihn wieder in die Aktentasche. Nachdem er die Tasche geschlossen hatte, warf er einen Blick auf seine Uhr. Dann lehnte er sich an die Kopfstütze, senkte die Augenlider halb herab und verfolgte, wie der Boulevard der weißen Mittelschicht von Tustin zur Straße der Latinos von Santa Ana wurde.
»Wie war die Arbeit heute?«
»Ruhig, Sir.«
»Dort ist es immer ruhig. Bis es einen Kampf gibt oder Rassenunruhen ausbrechen.«
»Ja.«
Tagsüber war ich Deputy der Polizei von Orange County. Wie alle neuen Deputys arbeitete ich im Zentralgefängnis. Vier Jahre Gefängnisdienst hatte ich schon hinter mir. Noch ein Jahr, dann würde ich zum Streifendienst versetzt werden und ein richtiger Polizist werden. Ich war vierundzwanzig.
Deputy war ich geworden, weil Will es so gewollt hatte. Bevor man ihn zum Verwaltungschef gewählt hatte, war auch er Polizist gewesen. Er fand, Polizist zu sein sei das Richtige für mich. Außerdem hielt er es für nützlich, ein »Ohr« im Büro des Sheriffs zu haben.
Die Räume des Hispano-Amerikanischen Kulturvereins befinden sich in der Fourth Street, nicht weit vom Zentralgefängnis. Es ist Jaime Medinas Terrain. Der Kulturverein tut Gutes – er verteilt Geld und Waren an arme Latinos, gewährt bedürftigen Studenten Stipendien, hilft bei der Einbürgerung, bietet Familien in Notlagen Schutz und so weiter.
Aufgrund des Missverständnisses über das Wahlrecht von Medinas Beinahe-Staatsbürgern spielte der Bezirksstaatsanwalt allerdings mit dem Gedanken, den Verein wegen Verschwörung und Wahlbetrug schließen zu lassen. Letzte Woche hatte man die Vereinsräume durchsucht und auf den Titelseiten der Zeitungen waren Fotos von Anzugträgern erschienen, die Kartons zu einem Lieferwagen trugen.
Wegen des schwebenden Verfahrens hätte Will nicht dorthin gehen sollen. Zudem war er mit Philip Dent, dem Bezirksstaatsanwalt, befreundet – ein Grund mehr, sich herauszuhalten, solange die Untersuchung lief. Aber Will vertrat im Verwaltungsrat Medinas Bezirk und der war ohne die Stimmen der Latinos und ohne ihre Dollars nicht zu gewinnen. Eine politische Zwangslage, eine von Tausenden im Leben eines Verwaltungschefs. Früher oder später würde er Stellung beziehen müssen, denn Politik, das hatte Will mir früh beigebracht, bedeutete, Entscheidungen zu treffen.
»Jennifer wird etwas für uns haben, Joe. Schließ es in den Kofferraum ein, während ich mit Medina rede.«
»Ja, Sir.«
Ich bog vom Boulevard nach links ab, warf wieder einen Blick in die Spiegel und sah die zapateria an der einen Ecke und das Brautausstattungsgeschäft mit den in weiße Spitze gekleideten Puppen im Schaufenster an der anderen. Dann musterte ich die hinter uns fahrenden Autos und die Leute auf dem Bürgersteig. Auch ich war an diesem Abend etwas nervös. Lag etwas in der Luft? Vielleicht, wenn auch nichts Offensichtliches.
Trotz der hochgekurbelten Fenster und der laufenden Klimaanlage konnte man die mexikanische Musik aus der discoteca hören. Eine Polka auf Meskalin. Ein dunkelhäutiger Mann mit weißem Cowboyhut und weißen Stiefeln blieb am Bordstein stehen, um uns vorbeizulassen. Vielleicht erkannte er Will Tronas Auto, vielleicht auch nicht. Sein walnussfarbenes Gesicht war ausdruckslos; es hatte alles gesehen und nichts konnte es mehr beeindrucken.
Dann fuhr ich auf einen schmutzigen Parkplatz, der im Schatten eines riesigen Pfefferbaums auf der Rückseite des Kulturvereinsgebäudes lag. Wir traten in die angenehme Wärme hinaus und Will ging, die Aktentasche in der Hand, voran. Er trug wie üblich einen dunklen Anzug.
Die Hintertür war verschlossen, also hämmerte Will dagegen.
»Machen Sie auf, Jaime! La Migra – die Einwanderungsbehörde!«
Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit und schwang dann ganz auf.
»Ihre Scherze sind noch nie gut gewesen.« Jaime war ein schlanker junger Mann mit hängenden Schultern und Schildpattbrille. Seine Khakihose schien ihm zwei Nummern zu groß zu sein. »Die Rassisten überfallen mich und Sie hauen ab.«
»Nun, jetzt bin ich wieder da. Kommen wir zum Geschäft. Ich hab’s eilig.«
Medina drehte sich um und lief, mit Will und mir im Schlepptau, den Korridor hinunter.
Als sie ins Büro gingen und Jaime die Tür hinter ihnen zuzog, gab er durch ein kurzes Nicken zu verstehen, dass er meine Anwesenheit bemerkt hatte. Ich bin daran gewöhnt, übersehen zu werden, und habe nichts dagegen. Mit einem Gesicht wie meinem will man nicht, dass die Leute einen beachten. Gleich am Anfang hatte Will mir klar gemacht, dass die Leute wesentlich weniger darauf erpicht waren, mich anzustarren, als ich gedacht hatte. Er sagte, die meisten hätten Angst, auch nur hinzusehen. Er hatte Recht. Das war vor neunzehn Jahren, als er mich zum ersten Mal zu sich nach Hause mitnahm.
Ich ging durch eine Schwingtür am Ende des Korridors und sah mich in dem Raum um. Er enthielt sechs Arbeitsplätze: Schreibtisch, Telefon, Papierstapel und jeweils drei Stühle für Klienten. An einer Wand hing die amerikanische Flagge, an der gegenüberliegenden die mexikanische. Dazu Reiseplakate, Fußballposter, Stierkampffotos.
Stille.
Seit der Razzia kamen keine Hilfesuchenden mehr und außer Jennifer, Jaimes Stellvertreterin, arbeitete auch niemand mehr hier.
»Guten Abend, Miss Avila.« Ich nahm meinen Hut ab.
»Mr Trona. Guten Abend.«
Sie kam zu mir herüber, um mir die Hand zu geben. Sie war eine schwarzhaarige Schönheit, dreißig, geschieden, zwei Kinder. Sanfte Finger. In den Bund ihrer Jeans war ein weißes Baumwollmännerhemd gestopft. Schmale Taille, hübsche gerade Schultern, schwarze Stiefel. Vor ein paar Monaten hatte sie nach einem Jahr ihren zimtbraunen Lippenstift gegen einen kirschroten eingetauscht.
»Will muss hier sein.«
»Sie sind in Jaimes Büro.«
Sie sah automatisch an mir vorbei in den Korridor, dann ging sie zu ihrem Schreibtisch zurück. Sie hatte etwas mit dem Boss. Das war eins der vielen Geheimnisse, die ich eigentlich nicht kennen sollte. Die Welt war voll von ihnen.
»Die Sachen für Sie stehen drüben an meinem Stuhl.«
»Ich werde sie holen, danke.«
Es war eine Tennistasche mit US-Open-Aufdruck, ein großes schwarzes Ding mit einem grellgelben Ball darauf. Und schwer. Ich trug die Tasche zum Auto hinaus und stellte sie auf dem Asphalt ab, während ich die Alarmanlage ausschaltete und den Kofferraum öffnete. Dann hob ich sie hinein, schloss den Kofferraum wieder ab und aktivierte die Alarmanlage.
Zurück im Haus, holte ich mir eine Zeitschrift aus dem Empfangsraum, rollte einen Schreibtischstuhl in den Korridor und setzte mich vor Jaimes Büro.
Medina: Sie müssen mit Phil Dent reden, Mann ...
Will: Ich kenn ihn nur, Jaime. Er gehört mir nicht.
Medina: Richtig ... das ist nicht Ihr Job, mein ... Freund ...
Jennifer ging, in eine frische Duftwolke gehüllt, an mir vorbei und steckte den Kopf durch die Bürotür, ohne vorher anzuklopfen.
»Kaffee, Bier? Hallo, Will.«
»Kaffee, bitte.«
Ohne einen Blick für mich übrig zu haben, rauschte sie wieder an mir vorbei und kam eine Minute später mit zwei Bechern in der einen Hand und einem Milchkännchen in der anderen zurück.
Nachdem sie im Büro verschwunden war, hörte ich Will irgendetwas murmeln, und alle drei lachten. Dann kam sie wieder heraus, schloss die Tür und sah mich an, als wäre ich gerade erst angekommen.
»Wollen Sie auch etwas, Mr Trona?«
»Nein, danke. Mir geht’s gut.«
Sie stolzierte an mir vorbei zu ihrem Arbeitsplatz zurück.
Ich breitete die Zeitschrift auf meinen Knien aus, schaute aber nicht hinein. Meine Aufgabe war es, zu sehen und zu hören, nicht zu lesen. Mund zu, Augen auf.
Ich hörte den Verkehr auf dem Boulevard und das Summen der Klimaanlage. Draußen fuhr ein Auto vorbei, dessen Subwoofer so laut wummerte, dass ich die Bässe in der Brust spürte. Ich hatte noch immer das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wusste aber nicht, wieso. Vielleicht hatte Wills Stimmung auf mich abgefärbt. Ich ertappte mich oft dabei, dass ich seine Stimmungen nachempfand. Vielleicht weil er mich adoptiert hatte.
Ich hörte Jennifer eine Telefonnummer wählen.
Medina: Da ist doch das ganze Geld aus dem Tabakvergleich, Mann ... ungefähr eine Milliarde, und Sie sind –
Will: Diese Milliarde gehört nicht mir, sondern der Verwaltung, Jaime. Ich kann sie nicht einfach in einem Kopfkissenbezug weitergeben. Haben die neunzig nicht geholfen?
Jennifer: Gib mir Pearlita.
Medina: Jedes bisschen hilft. Aber was soll ich tun, wenn es alle ist?
Dasitzen und zusehen, wie der Verein den Bach runtergeht? Wir brauchen das Geld für unsere Arbeit, Will. Wir brauchen es für Ausbildungsplätze, Anwälte, Lebensmittel – Mann, wir brauchen es für ...
Jennifer: Okay, okay. Ja, er ist gerade hier.
Medina: ... wir können nicht einmal etwas tun, wenn eine arme schwangere Latina einen Block von ihrer Wohnung entfernt überfahren wird. Wir können nichts tun, wenn ein guatemaltekischer Junge von faschistischen Strandcops aus Newport umgelegt wird. Uns sind die Hände gebunden, Mann. Uns steht das Wasser bis zum Hals.
Will: Was passiert ist, ist schrecklich, Jaime. Ich weiß.
Medina: Dann finden Sie gemeinsam mit uns einen Weg, wie wir ihnen helfen können, Will.
Ich hörte, wie Jennifer auflegte. Sie drehte sich zu mir um, aber ich sah nicht von der Zeitschrift auf.
Will: Sie haben mir geholfen, Savannah zu finden, also wird sich Jack vielleicht Ihrer Sache annehmen. Und der Reverend wird auch ein gutes Wort für Sie und den Kulturverein einlegen. Ich habe es schon getan.
Medina: Wir brauchen mehr als gute Worte, Will.
Die Bürotür öffnete sich und Medina führte uns mit verkniffener Miene den Flur entlang. An der Hintertür gab er uns beiden die Hand. Dann brachte Jennifer uns hinaus.
Will nickte mir zu, ich ging zum Auto, ließ den Motor an und schaltete die Klimaanlage ein. Ich konnte sie im Seitenspiegel sehen: Will in seinem dunklen Anzug und Jennifer in Jeans, Stiefeln und leuchtend weißem Hemd. Sie standen im Licht, das durch die offene Hintertür fiel, und redeten eine Weile miteinander. Will hatte seine Aktentasche auf dem Asphalt abgestellt.
Dann gab er ihr die Hand, wie er schon Millionen Hände geschüttelt hatte: mit offener Handfläche und vorgestrecktem Arm, den Kopf zum Zeichen des Willkommens und der Besitzergreifung lächelnd zurückgelegt.
»Ich liebe dich«, sagte sie.
Ich konnte es wegen der Klimaanlage zwar nicht hören, aber es war nicht schwer, die Worte von ihren kirschroten Lippen abzulesen.
Will griff in die Tasche und gab ihr die Geldscheine, die ich für ihn gezählt, gerollt und mit einem Gummiband zusammengebunden hatte. Die Rolle hatte ungefähr die Größe einer halb aufgerauchten Churchill – zwei Riesen, mit denen Jennifer einigen ihrer Freunde aus der Klemme helfen konnte.
»Ich liebe dich auch«, erwiderte er.
Wir verließen Santa Ana und fuhren nach Tustin zurück. Will dirigierte mich zur Highschool und ließ mich an den Tennisplätzen anhalten. Zu dieser Tageszeit war dort nicht viel los. Nur zwei waren belegt.
»Joe, nimm die Tennistasche aus dem Kofferraum und bring sie zum mittleren Platz. Dort stellst du sie auf die Bank.«
»Ja, Sir.«
Als ich zurück war, saßen wir ein oder zwei Minuten schweigend nebeneinander. Will schaute auf seine Uhr.
»Was ist in der Tasche, Dad?«
»Ruhe.«
»Ist das eine Antwort oder ein Befehl, Sir?«
»Reverend Daniel im Grove«, sagte er.
Der Grove Club wird von seinen Mitgliedern nur Grove genannt. Er liegt versteckt in den Bergen, an der Mautstraße 241, von der eine gewundene Privatstraße abgeht, die zu einem Tor führt, an dem zwei bewaffnete Männer Wache schieben – für gewöhnlich ein Nebenjob für Deputys. Von öffentlichen Straßen aus ist der Grove nicht zu sehen und ein Schirm aus riesigen Palmen, Platanen und Eukalyptusbäumen schützt ihn vor Blicken aus der Luft. Deshalb ist in der Presse oder den Fernsehnachrichten noch nie ein Bild von ihm veröffentlicht worden.
Das erste Stück der 241 legten wir mit hundertvierzig Stundenkilometern zurück. »Nehmen Sie die Mautstraße – denn das Leben ist kurz!«, verkündete eine elektronische Anzeigetafel. Von einigen anderen Autos abgesehen, waren die Leuchtbuchstaben das einzige Licht weit und breit.
Politisch hatte Will gegen alle vier Mautstraßen gekämpft, weil sie sich – obwohl die Öffentlichkeit sie reparieren und unterhalten sowie für ihre Benutzung exorbitante Mautgebühren zahlen muss – in Privatbesitz befinden. Die Gewinne fließen in die Kasse der TRA, der Mautstraßenagentur. TRA klingt nach einer Behörde, aber es ist keine, sondern ein Konsortium superreicher Bauunternehmer, die an den Mautstraßen schon Gebäude hochziehen, noch bevor der Asphalt trocken ist. Im Süden von Orange County kann man erleben, wie über Nacht eine halbe Stadt aus dem Boden gestampft wird.
Doch das war noch nicht alles. Die TRA hatte das Repräsentantenhaus des Staates dazu gebracht, nicht mehr für die Instandhaltung bestimmter öffentlicher Autobahnen in Orange County zu sorgen. Bis 2006 sollten sie weder ausgebaut noch repariert werden, was Benutzer auf die Mautstraßen trieb, da die verwahrlosten Autobahnen gefährlich und zudem sechs Stunden am Tag verstopft waren.
Obwohl Will diese Schlacht verloren hatte, war er nicht wirklich traurig. Schließlich konnte man auf den brandneuen Mautstraßen richtig Gas geben, und da Will dichten Verkehr hasste und Geschwindigkeit liebte, benutzten wir sie ständig.
Als wir die erste Mautstation passiert hatten, beschleunigte ich auf hundertneunzig Stundenkilometer. Will beugte sich herüber, um einen Blick auf den Tacho zu werfen, dann lehnte er sich wieder zurück und lachte leise in sich hinein.
»Gut so, Joe«, sagte er.
Ein halbes Jahr zuvor hatten sich Will und die anderen Verwaltungschefs eine zweihundertprozentige Erhöhung ihres Fahrzeugbudgets genehmigt, so dass Will einen BMW 750IL leasen konnte. Der Motor holt aus zwölf Zylindern 350 PS heraus. Es ist ein gutes Auto, nicht sehr wendig, aber schnell – der Motor erwacht bei neunzig Stundenkilometern zum Leben und macht über zweihundertfünfzig Spitze. Für eine große Limousine liegt der Wagen gut in der Kurve. Von null auf hundert schafft er es jedoch nicht sehr schnell – erst letzte Woche hatte mich eine Saleen Cobra an einer Ampel glatt stehen lassen.
»Ah«, stieß er leise hervor, »das tut gut.«
Als ich das Gaspedal voll durchtrat, schien der Wagen einen Augenblick innezuhalten, dann schoss er förmlich nach vorn. Die Tachonadel stieg auf zweihundertzwanzig und weiter auf zweihundertfünfundzwanzig. Bei zweihundertfünfzig wurde bei diesem Modell der Motor automatisch heruntergeregelt – jedenfalls sah es die Werkseinstellung so vor. Doch auf Wills Geheiß hatte ich einen Dinan-Chip eingebaut, der den Regler überbrückte. Außerdem erhöhte er die PS-Zahl auf dreihundertsiebzig. Ebenso wie ich liebte Will das gedämpfte Kreischen, das der Motor bei Vollgas von sich gab. Wenn die deutschen Pferde mit voller Kraft laufen, gibt es nichts, was ihnen gleichkommt.
»Manchmal, mein Sohn, wünschte ich, die Straße wäre zehntausend Kilometer lang. Dann könnten wir stundenlang so weiterfahren. Weg vom Grub. Ich hasse den Grub.«
Grub war Wills Abkürzung für den Grove Club. Er sah wieder auf seine Uhr.
»Ich weiß«, sagte ich.
Trotzdem war Will Mitglied des Klubs. Er musste es sein. Jemand wie er, der nicht davor zurückschreckte, den Einfluss des freien Unternehmertums zu beschneiden, war zwar nicht gerade der typische Grovianer, aber immerhin war er ein Politiker, der sich einen sündhaft teuren Wagen bewilligt hatte, um sich mit kriminellem Tempo zu quasiberuflichen Terminen chauffieren zu lassen, und das machte ihn zu einem Grovianer. Außerdem gehörte er – der Verwaltungschef des mächtigen ersten Bezirks – zur Regierung und die Regierung konnte ihren Einfluss im Sinne des Grove Clubs einsetzen. Also brauchte der Grove meinen Boss.
Will hatte mir anvertraut, dass er jeden Monat zwei Riesen Mitgliedsbeitrag zahlte, die vollständig von seinen Gönnern aufgebracht wurden, da kein ehrlicher Staatsdiener sich diesen Beitrag leisten konnte. Der größte Teil des Geldes wird in den Grove Trust eingezahlt, der es an sein Entwicklungs- und Aktionskomitee weiterleitet, eine nicht gewinnorientierte und daher von Steuern befreite Organisation.
Jahr für Jahr spuckt der Trust Millionen für Projekte und Verbände aus, die nach seiner Einschätzung für ihn von vitalem Interesse sind. Seine Interessen sind Macht und Profit. Doch er interessiert sich auch für andere Dinge. Letztes Jahr, zum Beispiel, hat er dem Kinderheim Hillview sechzigtausend Dollar gespendet, genug, um zwei Stellen mit mittlerem Einkommen für ein Jahr zu finanzieren. Ich halte viel von dem Heim und weiß, wie sehr es um Geld kämpfen muss. In Hillview habe ich den größten Teil der ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht.
Zwei Polizisten außer Dienst kontrollierten uns und öffneten dann das Tor. Das Klubhaus lag anderthalb Kilometer vom Eingang entfernt in einem Tal zwischen den Bergen. Es ist im Stil einer Hazienda um einen großen Hof errichtet. Die von Bougainvilleen umrankten Rundbögen der Kolonnaden bestehen aus Ziegeln und Hohlsteinen. Das Haus selbst ist überwiegend in dunklen Farben gehalten.
Ich parkte den Wagen und folgte Will zum Eingang, wo ein weiterer Polizist außer Dienst unsere Namen in seine Kladde schrieb. Er wollte mich schon nach meinem Namen fragen, als ich meinen Hut zurückschob, um ihm zu zeigen, wer ich war. Aufgrund meines Gesichts besitze ich eine gewisse Bekanntheit. Es ist unverkennbar. Was mit ihm geschah, war eine große Sache, als ich ein Baby war.
Will ging voran in den Speiseraum, wo er einige Hände schüttelte. Ich hielt mich im Hintergrund und faltete meine vor dem Körper. Es war ein normaler Abend im Grove: An der Hälfte der Tische saßen überwiegend ältere Ehepaare; eine Menge graue Haare und Diamanten hoben sich von Smokingjacken und Abendkleidern ab. Drei große Bauunternehmer – einer baute Geschäfts-, die beiden anderen Wohnhäuser. Ein Lobbyist der Bauindustrie, der früher einmal Verwaltungschef gewesen war. Zwei Abgeordnete, ein Senator, der Topberater des stellvertretenden Gouverneurs. Ein Quartett von Risikokapitalgebern. Ein Tisch mit Männern in den Dreißigern, die 1999 durch die Nasdaq zu Milliardären geworden waren.
Wir gingen in die Lounge hinauf, einen großen Raum mit einer Bar in der Mitte, Billardtischen und Nischen am Rand. Will setzte sich in seine übliche Nische, während ich ein Queue auswählte und zum nächstgelegenen Billardtisch ging, an dem ich mir die Zeit vertreiben und gleichzeitig lauschen konnte, ohne Wills Gesprächspartner nervös zu machen.
Ich schaute zum zweiten Stockwerk hinauf. In meinem Blickfeld befanden sich eine polierte Treppe und die Tür einer der Empfangssuiten, an die gerade ein Kellner klopfte. Dort oben ging es um die verschwiegeneren Dinge. Reiche Männer und ihre öden Geheimnisse. Ich war schon in all diesen Suiten gewesen.
Ich spielte ein gutes Break und verfolgte, wie drei Kugeln in den Taschen verschwanden.
Reverend Daniel Alter, ein gepflegter, grauhaariger Mann, war pünktlich auf die Minute. Er berührte im Vorbeigehen meinen Arm, sagte aber nichts. Ich beobachtete, wie er Will die Hand schüttelte, sich ihm gegenüber in die Nische schob und dann den Vorhang zuzog.
Reverend Alter betreibt eine riesige »Fernsehpfarrei«. Die Sendungen entstehen in seiner viele Millionen teuren »Kapelle des Lichts« hier in Orange County und werden in zahlreichen Ländern ausgestrahlt. Bestimmt haben Sie ihn schon gesehen, wie er eine seiner enthusiastischen Predigten hält. In seiner Show verkauft er christliche Produkte – von CDs und Erleuchtungsvideos bis zu tatsächlich aufleuchtenden »Kapelle des Lichts«-Schlüsselanhängern. Das eingenommene Geld ist steuerfrei und niemand weiß, wohin es geht, nicht einmal Will Trona. Das hat er mir jedenfalls gesagt.
Reverend Alter: Hier, nimm schon.
Will: Gut, gut.
Reverend Alter: Die Reserve bringt uns noch um.
Will: Dann mach mehr Runs. Ich habe die Tasche von Jaime bekommen.
Reverend Alter: Hast du sie?
Will: Ich weiß, wo sie ist. Aber ich bin nicht sicher, ob ich den Leuten, die sie haben, trauen kann.
Reverend Alter: Was meinst du damit?
Will: Das wird sich zeigen.
Reverend Alter: Du hast deine Sache großartig gemacht, Will. Und Jack hat seinen Teil erledigt. Es wird alles gut gehen.
Danach trat eine lange Pause ein, während ich die Zweierkugel quer über den Tisch stieß und in einer Ecktasche versenkte.
Reverend Alter: Ich zähle auf dich. Möge Gott durch dich dieses Wunder vollbringen.
Will: Ich glaube nicht, dass dein Gott für dich irgendwelche Wunder vollbringen will, Daniel. Du hast ihn schon zu oft bemüht.
Reverend Alter: Hab dich nicht so, Will. Ich dachte, das wäre etwas für dich. Ist alles bereit?
Will: Es ist alles vorbereitet, Dan. Kein Bange.
Reverend Alter: Du weißt, Will, die Wege des Herrn sind unerforschlich.
Damit zog Reverend Daniel den Vorhang auf und sie traten beide heraus. Der Reverend warf einen Blick auf den Billardtisch und schenkte mir dann die Andeutung eines Lächelns.
»Ich würde die Sechs empfehlen«, meinte er. »Mit viel Nachlauf.«
Will klopfte ihm auf die Schulter und der Reverend ging zur Bar hinüber.
Will blickte auf seine Uhr. »Gehen wir, Joe. Wir holen noch ein Paket ab, liefern es aus und dann ist endlich Feierabend. Was für ein Tag!«
Als wir die Lounge verließen, saß der Reverend neben einer Frau mit glänzenden schwarzen Haaren an der Bar und schaute uns nach.
Während sich die Abendluft abkühlte, zog Nebel in dicken Schwaden vom Pazifik herauf. Typisches Juniwetter. Unten an der Küste nannten sie es Junitrübnis. Als die Berge hinter uns lagen und unsere Mobiltelefone wieder Empfang hatten, klingelte Wills Handy.
»Trona«, meldete er sich und lauschte dann einen Moment. »Du hast es bekommen, oder?«
Er hörte wieder zu, dann beendete er das Telefonat.
»Joe, das Paket ist in Anaheim, Lind Street 33. Gib dieser grandiosen Blechkiste die Sporen und bring uns hinüber. Junge, was bin ich froh, wenn dieser Tag vorbei ist.«
»Ja, Sir.« Ich warf einen Blick in die Spiegel und fragte: »Was ist in dem Paket, Boss?«
»Wir versuchen, Gutes zu tun.«
Als wir die Stadtgrenze von Tustin erreichten, klingelte Wills Telefon erneut. Er nahm das Gespräch an, hörte kurz zu und sagte dann: »Es geht alles seinen Gang. Ich tue, was ich kann. Aber auch ich kann Kohle nicht in Diamanten verwandeln.«
Seufzend klappte er das Handy zu.
Wir hatten Anaheim fast erreicht, als er eine Nummer wählte. »Sieht aus, als würden wir es pünktlich schaffen.«
Es war ein Wohnblock im hässlichen Teil von Anaheim. Will sagte mir, ich solle in der Gasse auf der Rückseite parken. Sie war so schmal, dass ein zweites Auto nur an mir vorbeikommen konnte, wenn ich den Wagen halb auf den Gehweg fuhr. Linkerhand lag eine Reihe von Carports und auf der rechten Seite erhob sich eine mit Graffiti bedeckte Betonsteinmauer. Nirgends rührte sich etwas. Nur der Nebel wallte durch die Gasse.
»Sei unfreundlich«, wies Will mich an. Das pflegte er zu sagen, wenn er mit Schwierigkeiten rechnete oder wenn er wollte, dass ich irgendwelche Leute einschüchterte.
Er blieb hinter mir stehen, als ich mit der Linken an die Tür klopfte. Die Rechte hatte ich unter die Jacke an den Griff einer der beiden fünfundvierziger Automatikcolts geschoben, die ich für gewöhnlich bei mir trage.
»Ja? Wer ist da?«
»Öffnen Sie die Tür«, sagte ich.
Die Tür ging einen Spaltbreit auf und eine dicke Frau blinzelte uns an. Als sie mich sah, riss sie die Augen auf.
Ich drängte sie in die Wohnung. Ihre Hände waren leer und hinter ihr bewegte sich nichts. Nur der Fernseher lief.
Sie betrachtete mein Gesicht, bis ich ihr zeigte, was ich unter meiner Jacke trug. Ihr Blick wanderte von der Kanone zu meinem Gesicht und wieder zurück. Gefangen gehalten von zwei Horrorbildern, beschloss sie, die Hände zu heben und die Augen auf den Fußboden zu senken.
Die Wohnung roch nach Speck und Zigaretten. Vor den Fenstern hingen Laken und der Teppich war bis auf die Dielen durchgetreten.
»Ich weiß nichts darüber, Mister. Sie sagen, ich soll kommen und Mädchen gucken, also ich komme und gucke. Ich weiß nicht ...«
»Ganz ruhig, Señora«, unterbrach Will ihren Redefluss. »Sie ist okay, Joe. Wo sind sie?«
Sie nickte in Richtung des Schlafzimmers. »Sie hier. Er nicht hier. Sie gucken fern.«
»Bleiben Sie stehen«, befahl ich ihr. »Was soll ich tun, Boss?«
»Hol sie her.«
Das Mädchen stand vom Fußboden auf, als ich hereinkam. Sie war klein, blond und blass und steckte in Jeans, weißen Turnschuhen und einem Cirque-du-Soleil-T-Shirt. Vielleicht zwölf Jahre alt.
Sie musterte mein Gesicht. Kinder tun das manchmal – mich einfach so anstarren. Viele schneiden eine Grimasse, einige fangen an zu weinen, andere rennen weg. Ich sah, wie Angst in ihre Augen stieg und ihr Kinn zu zittern anfing.
»Ich bin Joe.«
»Ich bin Savannah«, sagte sie leise.
Dann machte sie einen Schritt auf mich zu und streckte mir ihre kleine, zitternde Hand entgegen. Ich schüttelte sie. Dann zog ich die Hutkrempe etwas tiefer in die Stirn, um ihr weniger Angst einzuflößen.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht genau. Kommst du trotzdem mit mir?«
Sie warf einen Pocahontas-Rucksack über die Schulter und ging voran. Auf der Treppe zur Gasse auf der Rückseite des Hauses griff ich wieder nach der Pistole. Will nahm das Mädchen an die Hand.
Ich öffnete die Türen auf der Beifahrerseite für sie und wartete, während Will Savannah den Rucksack abnahm, sie anschnallte, den Gurt für ihre Größe anpasste und ihr zeigte, wie die Armlehne aus dem Sitz geklappt wurde.
Angesichts dessen, was er sonst alles war – Ehemann, Politiker, Agitator, Manipulator, Träumer –, vergesse ich leicht, dass er auch Vater war – Adoptivvater und der großzügigste Vater, den man sich vorstellen kann.
Er hatte dem Mädchen die Hand auf die Schulter gelegt und sprach leise mit ihr, während einer seiner Füße aus dem Auto hing.
Scheinwerfer schwenkten in unsere Richtung und ich hörte, dass sich ein Auto von vorn näherte. Ohne Hast, nicht bedrohlich – wahrscheinlich ein Mieter auf dem Weg zu seinem Carport.
»Sir, wir sollten fahren.«
»Ich rede mit ihr.«
Ich hörte hinter uns ein zweites Auto und sah, wie das Scheinwerferlicht den glänzenden schwarzen Kofferraum des BMW erfasste.
Ich trat näher an die Fondtür heran. »Du solltest lieber einsteigen, Boss.«
»Ich rede mit Savannah.«
Ich sah mich um. Die Wagen näherten sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Ohne Hast, ohne aufzublenden. Ohne uns zu bedrohen? Plötzlich hielten sie an. Fünfundzwanzig Meter vor uns, fünfundzwanzig Meter hinter uns. Sie verschwanden in einer Nebelschwade, tauchten wieder auf. Marke oder Modell der Autos konnte ich nicht erkennen, von den Nummernschildern ganz zu schweigen.
»Hier lauert Gefahr, Sir.«
»Wo?«
»Überall.«
Ich trat Wills Fuß ins Auto, schmiss erst die hintere und dann die Beifahrertür zu, während ich die Fernbedienung aus der Tasche zog.
Autotüren öffneten sich. Das Scharren von Füßen auf Asphalt.
Im Scheinwerferlicht des Autos vor uns sah ich drei Gestalten durch die Nebelschwaden auf uns zukommen. Eine große und zwei kleinere – lange Mäntel, hochgeschlagene Kragen, verborgene Gesichter.
Ich riss die vordere Tür auf, schaltete die Scheinwerfer ein und warf die Tür hinter mir zu. Dann verriegelte ich alles mit der Fernbedienung und griff mit der Rechten nach einer meiner Fünfundvierziger. Als ich mich umsah, tauchten im Scheinwerferlicht des Autos zwei weitere Mäntel auf. Ich legte die Linke auf den Griff der anderen Automatik, so dass ich die Arme vor der Brust gekreuzt hatte, als ob mir kalt wäre.
Vor uns ertönte eine tiefe, volle Stimme. Weil sie in der engen Gasse zwischen Mauer und Carports widerhallte, war sie kaum zu orten, dafür aber umso besser zu hören.
»Will! Ah, Will Trona! Lassen Sie uns reden!«
Will war aus dem Auto gesprungen, bevor ich ihn zurückhalten konnte.
»Pass auf Savannah auf!«, rief er mir zu. »Ich werde uns diesen Abschaum vom Hals schaffen.«
Ich stieg aus, schloss die Tür und trat hinter ihn. Aber er fuhr herum und zischte mir zu: »Ich sagte, pass auf das Mädchen auf, Joe! Also pass auf sie auf!«
Ich blieb zurück und beobachtete, wie er sich von mir entfernte. Im Kreuzfeuer der Scheinwerfer sah er wie ein bleicher Schatten aus.
Der Große trat vor. Sein Gesicht war nicht zu erkennen; ich konnte noch nicht einmal sein Alter schätzen. Die Hände hatte er in den Manteltaschen vergraben.
Die beiden Typen hinter mir hatten sich nach links bewegt, so dass ich zwischen ihnen und unserem Wagen stand. Ihre Maschinenpistolen hielten sie mit gesenkten Läufen dicht an den Mänteln.
Sie rührten sich nicht.
Wir saßen in der Falle und es gab nichts, was ich hätte tun können, außer dazustehen und die Augen offen zu halten.
Will blieb zwei Meter vor dem Mann stehen, stemmte die Fäuste in die Hüften und stellte die Füße ein wenig auseinander.
Mit den Motorengeräuschen und Abgasen wehten Worte zu mir herüber. Ich entriegelte mit der Fernbedienung die Wagentüren, beugte mich ins Auto und schaltete die Innenbeleuchtung aus.
»Was ist los, Joe?«, fragte das Mädchen. »Ich kann nichts sehen.«
»Sei jetzt still. Ganz still.«
» Okay.«
» ... schwer, mit Ihnen Schritt zu halten, Will Trona ...«
Die Stimme hatte einen merkwürdigen Tonfall, eine fast fröhliche Betonung der Silben. Es wirkte künstlich, wie eine Fremdsprache, die der Sprecher irgendwann gelernt hatte.
Will: Wer, zum Teufel, sind Sie?
... das Mädchen im Auto?
Will: Gehören Sie zu Alex? – Sie gehören zu Alex. Lachen. Der kleine Scheißkerl hat wohl die Hosen zu voll, um sich zu zeigen, was?
Dann wieder Will: Wir haben einen Deal. Machen Sie, dass Sie hier wegkommen.
Jetzt ist das der Deal.
Damit beugte sich der Große vor und eine scharfe Explosion krachte durch die Gasse. Will fiel auf die Knie und sackte nach vorn.
Ich riss die Fondtür auf, sprang ins Auto, öffnete Savannahs Gurt und schob sie über die Sitzbank auf die andere Seite.
Durch die Windschutzscheibe sah ich, wie der Große einen Schritt nach vorn machte. Ich drückte die gegenüberliegende Tür auf, kletterte um Savannah herum und zog sie an einem Arm aus dem Auto.
»Was ist los? Ist mit Will alles in Ordnung?«
»Pscht.«
Während ich das Mädchen herauszog, sah ich mich um, gerade rechtzeitig, um mitzubekommen, wie der Arm des Großen nach unten zielte. Ein zweiter lauter Knall. Wills Kopf zuckte einmal und Rauch stieg im grellen Scheinwerferlicht in den Nebel auf.
»Savannah«, flüsterte ich, »gleich musst du rennen! Wenn es zweimal hupt, bin ich das. Zweimal hupen, das bin ich!«
Damit hob ich sie hoch, schwenkte sie über die Betonsteinmauer und ließ sie los. Ich hörte, wie sie auf dem Boden aufkam. Dann schnelles Trappeln.
Die Schritte der Männer hinter mir wurden lauter. Ich ließ mich aufs Pflaster fallen, zog eine Pistole und glitt in den Fond des dunklen Wagens zurück. Die beiden Männer kamen schnell näher, die Maschinenpistolen im Anschlag. Sie schauten auf die Mauer, dorthin, wo sie mich zuletzt gesehen hatten.
Als sie nah genug waren, erschoss ich sie. Der Linke fiel wie vom Schlag getroffen um. Der Rechte zuckte zusammen, blieb stehen und gab eine wilde Salve ab, wodurch die Waffe hochgerissen und in sein eigenes Gesicht geschleudert wurde. Dann klapperte es metallisch und ich hörte ein Stöhnen.
Gebückt schob ich mich aus dem Auto und legte mich auf die Straße. Dann presste ich mich an den Wagen und kroch mit ausgestreckter Pistole auf Ellbogen und Knien zur Motorhaube vor.
Trotz aufgeblendeter Scheinwerfer konnte ich die Männer nur schemenhaft erkennen. Der Große kam zusammen mit den beiden anderen auf mich zu. Hinter ihnen lag Will am Boden. Aber jedes Gefühl für Entfernung und Perspektive war verloren gegangen. In diesem Nebel schien sich alles aufzulösen.
Verdammt, was war das?
Dann wieder die tiefe Stimme: Seht nach!
Ich richtete meine Fünfundvierziger auf die Stimmen und versuchte, den Nebel mit meinen Augen zu durchdringen.
Ich glaube, da liegen zwei, drüben am Auto.
Seht nach!
Ich richtete die Waffe nach links. Von dort waren die Stimmen gekommen.
Dann hörte ich näherkommende Schritte, von zwei Paar Füßen. Im Scheinwerferlicht konnte man zwei Umrisse erkennen.
Ich kann überhaupt nichts sehen!
Die Schritte stoppten.
Scheiße ... Das sind Nix und Luke. Sie sind alle, Mann. Ich geh da nicht hinein ...
Der Nebel lichtete sich für einen Moment und verdichtete sich dann wieder. Merkwürdig aussehende Männer.
Ich hörte den Großen hinter ihnen. Dann durchschnitt seine klare Stimme den Nebel: Kommt zurück. Jetzt! Beeilung!
Ich hörte die Männer rennen. Ihre Umrisse bewegten sich durch das Scheinwerferlicht.
Hierher! Wieder der Große.
Nix und Luke sind tot, Mann.
Es knallte zweimal und ich hörte zwei Körper auf der Straße aufschlagen. Dann knallte es wieder zweimal, während aus der Hand des Großen kurz nacheinander zwei orange Flammen Richtung Pflaster zuckten.
Kurz darauf setzte das Auto mit quietschenden Reifen zurück. Der Wagen wippte so stark, dass die Scheinwerferkegel übers Pflaster zu hüpfen schienen. In ihrem Licht sah ich hinter Will die beiden Männer liegen – einer von ihnen bewegte sich, der andere rührte sich nicht. Dann war das Auto aus der Gasse heraus und brauste mit aufheulendem Motor die Straße auf der anderen Seite der Häuser, an denen ich entlangrannte, hinunter.
Will hockte, die Arme um die Taille geschlungen, auf den Knien und war vornüber gesunken, so dass seine Stirn auf dem Pflaster lag. Überall war Blut – an seinem Kopf, an seinen Kleidern und auf der Straße.
Ich legte ihm die Hand auf den Rücken.
»Oh«, murmelte er.
»Nicht reden, Boss. Du bist in Ordnung.«
Ich rannte zum Auto zurück und fuhr es ein Stück vor. Dann schleppte ich Will auf den Beifahrersitz. Er saß aufrecht da, immerhin. Feucht und schwer. Es roch nach Metall. Dort, wo sein Kopf geruht hatte, als ich ihn trug, war Blut auf meinem Gesicht.
Einer der Männer, auf die der Große geschossen hatte, bewegte sich noch, als ich den großen Wagen um ihn herumsteuerte. Ich raste, ohne auf die nächtlichen Ampeln zu achten, auf den Lincoln Boulevard, die Hand auf der Hupe festgeklebt, während draußen Nebelschwaden vorbeijagten.
»Du bist okay, Will. Du wirst okay sein.«
Sein Kopf lag an der Kopfstütze und seine Augen waren weit aufgerissen. In ihnen flackerte ein mattes Licht. Schulter, Hemd und Schoß waren voller Blut.
»Halt durch, Dad. Bitte, halt durch. Wir sind gleich da.«
»Mary Ann.«
Ich raste mit hundertsechzig Sachen südwärts. Die Autos fielen hinter uns zurück, als ständen sie. Wills Kopf wackelte, wenn ich über die Spurteiler fegte. Dann beugte er sich vor, wie er es immer tat, um die Instrumente und mich zu beobachten.
»Alle«, stieß er hervor.
»Alle was, Dad?«
Er hustete eine rote Masse auf die Windschutzscheibe und hing dann vorgebeugt in seinem Gurt. Rücklichter huschten vorbei.
Ich raste die Chapman-Abfahrt hinunter, überfuhr drei rote Ampeln, bog mit ausbrechendem Heck auf den Parkplatz der Notaufnahme des Krankenhauses ein und kam mit rauchenden Reifen an der Krankenwagenrampe zum Stehen.
Will lehnte zusammengesackt an der Tür. Ich rannte um den Wagen herum, und als ich die Tür aufriss, fiel er mir in die Arme. Ich trug ihn die Rampe hinauf, auch wenn ich fühlte, dass er keinen Arzt mehr brauchte.
Meine Knie gaben nach, aber ich wankte nicht, denn das war das Einzige, was ich für ihn tun konnte, und das wollte ich richtig machen. Zwei Leute von der Notaufnahme rannten uns mit einer Trage entgegen.
Zu warten ist die Hölle.
Ich ging im Warteraum und auf den Fluren auf und ab und erledigte die nötigen Anrufe – zuerst bei meiner Mutter, Mary Ann, dann bei meinen Brüdern Junior und Glenn.
Es waren die schwersten Anrufe meines Lebens. Ich konnte ihnen weder sagen, dass Will sterben, noch, dass er überleben würde. So presste ich mit schwerer Zunge nur hervor, dass er angeschossen worden sei.
Ich fuhr den Wagen von der Rampe weg und stellte ihn auf dem Parkplatz ab. Im Innern des Autos roch es stark nach Blut und Leder und der hässlichen Ausdünstung menschlicher Panik.
Zwanzig Minuten später teilte mir ein Arzt der Notaufnahme mit, dass wir Will verloren hatten.
Verloren.
Das Wort drang wie eine Kugel in mein Herz. Ich sagte mir, dass Will jetzt gegangen sei, für immer gegangen. Ich hielt mir vor, dass ich den Menschen, den ich auf der Welt am meisten liebte, im Stich gelassen und bei meiner wichtigsten Mission versagt hatte. Und während die Kugel sich qualmend durch mein Herz bohrte und in die Nacht hinausschoss, schwor ich mir, dass ich diejenigen, die Will das angetan hatten, finden und mit ihnen abrechnen würde.
Irgendwie schaffte ich es, noch einmal bei meiner Mutter und meinen Brüdern anzurufen. Um die Kugel durch sie hindurchzujagen.
Zu spät natürlich, denn sie waren bereits auf dem Weg zum Krankenhaus.
Gegen den Protest eines Arztes und zweier Polizisten stieg ich in Wills Auto und fuhr zu dem Haus in der Lind Street zurück.
Rote Lichter, gelbes Absperrband, überall Nachbarn und drei Decken, unter denen Leichen lagen. Die Polizei von Anaheim war vor Ort. Ein Streifenpolizist kam mit einer Taschenlampe auf meinen Wagen zu und winkte mich weg.
Ich setzte zurück und fuhr auf der Suche nach dem Mädchen durch die dunklen Nebenstraßen und die breiten leeren Hauptstraßen. Mit fünfzehn Stundenkilometern schlich ich dahin und drückte wieder und wieder auf die Hupe, zweimal, ganz leicht. So fuhr ich herum, langsam, mit eingeschalteter Innenbeleuchtung und heruntergekurbelten Fenstern. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Der Nebel war noch immer so dicht, dass ich häufig nicht einmal einen Block weit sehen konnte. Alle paar Minuten fuhr ich an die Seite, hielt an, hupte und horchte. Spähte in den Nebel.
Schließlich erreichte ich per Handy meine Mutter. Offenbar war sie kurz davor durchzudrehen. Sie war im Krankenhaus und man ließ sie nicht zu ihm. Ich tat mein Bestes, um sie zum Weiterreden zu bewegen und zu beruhigen. Dann sagte ich ihr, sie solle Reverend Alter anrufen.
Gerade als ich den Wagen wendete, um zum Krankenhaus zurückzufahren, hielt ein Streifenwagen der Polizei von Anaheim mich an. Als ich meine Marke vorzeigte, ging ein Ruck durch beide Polizisten und sie legten die Hand an ihre Waffen.
»Was, zum Teufel, tun Sie hier, Deputy?«
»Nach einem Mädchen suchen.«
»Ist das da im Auto Blut?«
»Ja.«
»Steigen Sie, bitte, aus. Langsam! Und die Hände weg vom Körper, Mr Trona.«
Kapitel zwei
Die nächsten drei Stunden verbrachte ich auf dem Polizeirevier von Anaheim mit zwei Beamten der Mordkommission – der große Blasse war Guy Alagna und die stämmige Dunkle hieß Lucia Fuentes.
Sobald ich ihnen von Savannah erzählt hatte, verließ Fuentes den Verhörraum und blieb eine halbe Stunde weg. Alagna, dessen Hakennase wie ein scharfer weißer Schnabel aus seinem Gesicht ragte, fragte mich zum dritten Mal, ob ich den großen Killer beschreiben könne.
»Es war zu dunkel«, erklärte ich zum dritten Mal. »Zu viel Nebel. Sie trugen alle lange Mäntel.«
Ich war es leid. Mir wurde langsam bewusst, was sich alles verändert hatte. Verändern würde. Den Rest meines Lebens würde ich ohne ihn verbringen müssen. Für immer. Die Welt war für mich völlig neu und ich hasste sie.
»Kommen wir noch einmal zu diesen Mänteln, Joe. Wie sahen sie aus?«
Ich beschrieb ihm zum dritten Mal die langen Mäntel. Dabei sah ich auf meinen Hut hinunter, den ich auf die Knie gelegt hatte.
»Ihre Farbe?«
»Es war Nacht, Detective Alagna. Nebel. Keine Farbe zu erkennen.«
»Okay, in Ordnung.«
Er legte eine lange Pause ein und ich spürte seinen Blick auf meinem Gesicht. Früher oder später mussten die Leute einfach hinschauen.
Ich trank miesen Kaffee aus einem Styroporbecher und blickte auf den Einwegspiegel, während ich mir das Bild der Männer, die durch den Juninebel auf Will zugingen, wieder vor Augen rief. Junitrübnis, in der sich die Klinge des Mordes verbarg. Ich bemühte mich, einen Blick auf das Gesicht des Großen zu erhaschen – nur ein Merkmal, irgendetwas, an das ich anknüpfen konnte. Nichts. Nebel. Bewegung. Aufsteigende Abgase, Stimmen. Der höhnische Knall der Pistole. Und dann noch einmal.
Alle paar Minuten baute sich in meinen Ohren ein Donnern auf, das leise begann, wie die Wellen an einem fernen Strand, dann aber immer lauter wurde, bis ich das Gefühl hatte, neben einer Düsenjetturbine zu sitzen. Aber es war keine Turbine, nur eine Stimme und die sagte immer wieder dieselben Worte, lauter und lauter: Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht ...
Hör auf! Erinnere dich. Augen auf, Mund zu.
Ich werde uns diesen Abschaum vom Hals schaffen. Woher wusste Will, dass die Leute Abschaum waren? Will! Ah, Will Trona! Lassen Sie uns reden!
Die tiefe, volle Stimme hallte mit beängstigender Klarheit in meinem Kopf wider. Ich hörte diesen merkwürdigen, fast fröhlichen Klang der Worte.
Kannte der Killer ihn oder hatte er nur so getan?
Gehören Sie zu Alex?
»Und Sie sind sicher, dass sie ihm nichts weggenommen haben?«, fragte Alagna.
»Sie haben ihm das Leben genommen.«
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er mich fixierte. Doch als ich mich ihm zuwandte, schaute er weg. Die Menschen schämen sich, wenn ich sie dabei ertappe, wie sie mein Gesicht mustern.
»Sie wissen, was ich meine, Joe.«
»Soweit ich gesehen habe, nichts, Detective.«
»Zurück zum Wagen. Haben sie etwas aus dem Auto genommen?«
»Sie haben es nicht einmal berührt.«
»Okay, in Ordnung. Also, um ganz sicher zu sein – der Täter hat Will beim Namen genannt. Und Will hat ihn gefragt, ob er zu Alex gehöre. Und er hat gesagt, ein Deal sei ein Deal, oder etwas in der Art, und dann hat der Typ ihm in den Bauch geschossen?«
»Der Täter sagte: ›Jetzt ist das der Deal.‹«
Dann fragte er mich wieder nach den beiden Männern, auf die ich geschossen hatte und die beide tot waren, als die Polizei auftauchte. Ich erzählte ihm noch einmal in allen Einzelheiten, was passiert war. Die Namen der beiden oder andere Informationen über sie wollte er mir nicht geben.
»Sie konnten also nicht gut genug sehen, um den Mann zu beschreiben, der Ihren Vater erschossen hat, aber gut genug, um mit zwei Schüssen zwei Männer niederzustrecken, die sich noch dazu bewegten.«
»Wie gesagt, Sir, sie waren nicht weit weg – vielleicht sechs Meter.«
»Ich vermute, Sie sind ein guter Schütze.«
»Bin ich.«
Alles, was ich Alagna und Fuentes gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Ein paar Dinge hatte ich allerdings nicht erwähnt. Zum Beispiel Wills Aktentasche. Er ging selten ohne sie aus dem Haus und so enthielt sie die Spuren seines Lebens. Mehr als Spuren. Sie enthielt seinen Terminkalender, Notizen und Briefe, Entwürfe und Berichte, eine Liste der Dinge, die er erledigen wollte, sein Gekritzel. In dieser alten Ledermappe trug er alles mit sich herum, was er im Verlauf eines Tages möglicherweise brauchen konnte – von einem Diktiergerät bis zu Zahnbürste und Zahnpasta. Ich hatte die Aktentasche in den Verhörraum mitgenommen und neben meinem Stuhl abgestellt, als wäre es meine. Und niemand hatte nach ihr gefragt.
Auch die Tennistasche, die wir beim Hispano-Amerikanischen Kulturverein abgeholt hatten, ging Alagna meiner Ansicht nach nichts an. Ich würde einem Cop, den ich nicht kannte, so einem Bleichgesicht, das sich dreimal erklären ließ, wie ein Mantel aussah, doch nicht alles auf die Nase binden, was ich wusste.
Deshalb vergaß ich auch das Geschenk zu erwähnen, das Will an diesem Abend Jennifer Avila gemacht hatte – die zweitausend Dollar, die ich gezählt und gerollt hatte. Ebenso wenig erzählte ich etwas von den privaten Worten, die sie gewechselt hatten.
Bei Wills Treffen mit Jaime Medina und Reverend Daniel Alter hatte ich angeblich nicht mehr als hallo und auf Wiedersehen gehört. Die kurzen Telefongespräche, die er nicht lange vor seiner Ermordung geführt hatte, blieben gleichfalls mein Geheimnis. Im Stillen fragte ich mich, wie ich bei der Telefongesellschaft an die Liste dieser Anrufe herankommen könnte. Für einen Beamten der Mordkommission wäre das kein Problem, aber für einen Deputy im vierten Jahr? Es würde ein bisschen dauern.
Ferner vergaß ich zu erwähnen, dass meine Adoptivmutter Mary Ann in letzter Zeit depressiv gewesen war und dass Will unbedingt vor zehn Uhr zu Hause sein wollte.
All das war allein Wills Angelegenheit und ging Alagna nichts an.
Lucia Fuentes stürzte in den Raum. »Einer der Täter hat überlebt. Er hat keine Papiere dabei, aber er lebt.«
Alagna warf mir einen Blick zu. »Vielleicht kann er einige der gewaltigen Lücken in Mr Tronas Darstellung füllen.«
Ich nickte, sagte aber nichts. Stattdessen blickte ich auf Wills Aktentasche. Neben dem Griff entdeckte ich einen getrockneten Blutfleck. Ich hoffte, dass Alagna ihn nicht bemerkte, glaubte aber nicht, dass er ihm auffallen würde.
»Aber was das Mädchen betrifft«, fuhr Fuentes fort, »habe ich nichts über ein vermisstes Mädchen namens Savannah gefunden. Weder das nationale Kinderschutzzentrum noch das FBI, noch nicht einmal Joes Sheriffs hier – niemand sucht nach ihr. Vielleicht ist es ein Deckname.«
Alagna starrte mich an. »Ich bezweifle, dass ihr Vater sie nach Einbruch der Dunkelheit mit fünfzigjährigen Typen um die Häuser ziehen lässt.«
»Vielleicht ist es aber auch genau das, was ihr Vater macht«, meinte Fuentes.
»Joe, wissen Sie, ob der Verwaltungschef Neigungen in dieser Richtung hatte?«
Jetzt erwiderte ich Alagnas Blick und seine wächserne Haut färbte sich rot.
»Er war ein guter Mann, Detective Alagna«, erklärte ich. »Und ich werde so tun, als hätten Sie diese dumme Frage nicht gestellt.«
»Große Worte für einen Deputy im vierten Jahr.«
»Wir können unsere Differenzen auf jede Art austragen, die Ihnen genehm ist, Sir.«
»Ich trage gar nichts aus.«
»Hört auf, ihr Arschlöcher«, fuhr Fuentes dazwischen. »Was ist mit dir los, Guy?«
Alagna wandte den Blick ab, während seine Ohren rot anliefen. Sie standen in auffallendem Kontrast zu seiner weißen Hakennase.
Was mit ihm los war? Er hatte Angst vor mir und das machte ihn wütend. Nichts auf der Welt scheint gesunde, harte Polizisten mehr zu reizen als ein vierundzwanzigjähriges Monster, das sich nicht einschüchtern lässt.
Ich habe nicht nur ein Gesicht, das aussieht, als wäre es in der Hölle modelliert worden, sondern bin auch groß und kräftig. Darüber hinaus bin ich mit den meisten Waffen vertraut und habe fast mein ganzes Leben damit zugebracht, mich in Selbstverteidigung zu üben – in jeder Methode und Schule, jeder Technik, die man sich vorstellen kann. Nie wieder soll passieren, was mir passiert war, als ich neun Monate alt war. Ich habe mir geschworen, dass es nie wieder geschehen wird.
Doch meine beste Waffe ist der Eindruck, den ich vermittle. Die Menschen glauben, ich hätte vor nichts Angst. Vielleicht liegt es an der Narbe. An meinen Augen. Meiner Stimme. Ich weiß es nicht.
Tatsächlich gab es zwei Dinge, vor denen ich Angst hatte. Das eine war mein Vater, mein wirklicher Vater, derjenige, der mir das angetan hatte, als ich neun Monate alt war. Er hieß Thor Svendson und war irgendwo da draußen. Sollte er jemals auftauchen, wäre ich bereit. Ich hatte fünf schwarze Gürtel, zwei regionale Golden-Glove-Titel und eine Schützennadel der Polizei, die belegten, dass ich bereit war.
Das andere, was mir Angst einflößte – auch wenn es mir erst bewusst wurde, als die Situation eintrat –, war die Aussicht, ohne Will zu leben. Und von beiden Dingen war das Leben ohne Will die weitaus schlimmere Variante.
Doch mit meinem ruinierten Gesicht und meiner offensichtlichen Furchtlosigkeit mache ich den meisten Menschen Angst. Das ist seit meiner frühesten Jugend so gewesen. Als ich mich daran gewöhnt hatte, versuchte ich es durch gute Manieren zumindest teilweise wettzumachen. Ich kam zu der Überzeugung, dass gute Manieren für einen Mann mit meinem Gesicht unerlässlich waren, und habe an ihnen fast so hart gearbeitet wie an der Beherrschung von Kenpo-Karate oder den Rückstoßnuancen des Colt .45 ACP.
»Also, Joe«, sagte Fuentes. »Erzählen Sie uns etwas über das Mädchen. Wenn Ihr Vater nicht so war, was hatte er dann mit ihr zu schaffen?«
»Ich weiß nicht genau. Er sagte, er versuche Gutes zu tun.«
Sie wechselten einen Blick.
Dann schwoll die Stimme in meinem Kopf wieder an: Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht Du hast ihn umgebracht ...
Ich hatte das Gefühl, wieder in diesem Nebel zu stecken, der vergangene Nacht durch die Straßen gewabert war. Geheimnisnebel. Mördernebel. Ich hätte gewünscht, ihn wegblasen und in etwas Klares und Sonniges, etwas Wahres treten zu können. Das war unmöglich, aber ich hatte einen ruhigen Ort, an den ich gehen konnte. Dorthin konnte ich jederzeit gehen. Also machte ich mich auf den Weg.
»Ich habe Ihnen erzählt, was ich weiß«, sagte ich, indem ich den Hut in die Hand nahm und aufstand. »Rufen Sie mich an, wenn Sie wieder meine Hilfe brauchen. Ich würde gern wissen, wer das Mädchen ist, und ihm helfen. Entschuldigen Sie mich, aber ich muss jetzt zur Arbeit. Ich will nicht zu spät kommen.«
Alagna sah Fuentes an, als erwarte er, dass sie mich aufhielt. Doch sie starrte mich nur an wie jemand, der den Bus verpasst hat.
Als ich vor die Tür trat, ging gerade die Sonne auf. Die Reporter stürzten sich auf mich und ich war froh, sie zu sehen. Denn ich teilte ihnen zwar nur das Notwendigste mit, hob dabei aber hervor, dass seit vergangenem Abend ein Mädchen namens Savannah vermisst werde. Ich beschrieb sie genau, einschließlich ihrer Kleidung, des Rucksacks, ihres guten Benehmens und der feinen glatten Haare. Ich zeichnete auf meinem Notizblock sogar ein Porträt von ihr, so gut ich konnte. Das war besser als nichts.
Den Reportern gefiel die Sache: Vielleicht konnten sie das Mädchen ja finden und etwas Gutes tun. Nur Polizisten sind noch zynischer als Journalisten.
Über Orange County ging die Sonne auf und ich saß allein in Wills Wagen. Die Straßen waren bereits verstopft; die Leute verhielten sich, als wäre Will noch am Leben. Was war los mit ihnen? Und was war mit Alagna und Fuentes los, dass sie mich mit einem Auto davonfahren ließen, das eine Rolle in einem Mordfall gespielt hatte? Warum hatten sie es nicht sichergestellt?
Ich erreichte meine Mutter wieder über das Handy. Reverend Daniel Alter hatte sich mit ihr im Krankenhaus getroffen. Im Augenblick hatte sie sich in die Kapelle des Lichts zurückgezogen und ein leichtes Beruhigungsmittel genommen. Ihre Stimme klang hell und unwirklich. Da sie sich zu benommen fühlte, um selbst zu fahren, würde einer der Hilfspfarrer sie nach Hause bringen. Ich bot ihr an, sie abzuholen, aber sie bestand darauf, dass ich arbeitete: Beschäftige dich, bleib tätig. Daraufhin sagte ich ihr, dass ich nach meiner Schicht nach ihr schauen würde.
Nachdem ich mich in der Sporthalle der Polizei geduscht und rasiert und meine Uniform angezogen hatte, ging ich über den Gefängnishof zu meiner Arbeitsstelle.
Das Gefängnis von Orange County ist das sechstgrößte des Landes. Dreitausend Insassen, dreitausend orange Overalls. Siebzig Prozent von ihnen Schwerverbrecher. Auf der anderen Seite hundert Wärter wie ich, überwiegend junge Kerle, die versuchen, nur mit Pfefferspray bewaffnet, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Täglich kommen Hunderte neuer Häftlinge hinzu, insgesamt siebentausend im Jahr. Gleichzeitig werden jeden Tag Hunderte in die Gesellschaft entlassen. Rein und raus. Rein und raus. Wir nennen es »Looping«. Das Gefängnis ist ein riesiger rotierender Wirbel, ein Sturmsystem aus Demütigung, Wut, Gewalt und Langeweile.
Tagsüber ist das Männergefängnis meine Welt, eine Welt der strengen Ordnung, die für gewöhnlich schweigend eingehalten wird. Macht und Unterwerfung. Die Guten sind grün, die Bösen orange. Steck die Hände in die Taschen, Blick geradeaus, Mund zu. Zieh die Taschen raus, zeig die Socken. Sie und wir.
Es ist auch eine Welt der Stichwaffen, die aus Bettgestellen gebastelt werden, eine Welt der Schlagstöcke, die aus mit Seifenstücken gefüllten verknoteten T-Shirts bestehen, eine Welt des Fusels, der aus Brot und Obstresten gebraut wird, die aus dem Speisesaal herausgeschmuggelt worden sind, eine Welt des Rauschgifts, der schwarzen Tätowierungen und der Kassiber – Mitteilungen, die von den Bossen in Zelle 29 in Trakt F oder den Schutzhäftlingen in Trakt J heimlich an Häftlinge der untersten Sicherheitsstufe geschickt werden, damit diese sie an Freunde und Komplizen draußen weiterleiten. Es ist eine Welt des Schweigens, eine Welt schwach beleuchteter Wachstationen, damit die Häftlinge nicht beobachten können, wie wir sie beobachten, eine Welt nach Rassen getrennter Gangs, eine Welt der Ehre und Rache, der ständigen Lügen und des Drecks.
Ich mag sie. Ich mag meine Freunde und Kollegen und das merkwürdige Verhältnis zu den Insassen. Gelegentlich mag ich auch den einen oder anderen Häftling. Ihre Tricks sind clever und sie schaffen es immer wieder, mich zu überraschen. Am meisten mag ich jedoch, dass es so ordentlich zugeht: die Klingeln und Glocken, Zeitpläne und Vorschriften, die schweren Schlüssel, das Essen, das wir im Personalspeiseraum zu uns nehmen. Das sind Anstaltsdinge und als jemand, der aus einer Anstalt kommt, habe ich mich daran gewöhnt, mich auf sie zu verlassen. In den vier Jahren, die ich im Kinderheim Hillview zugebracht habe, sind mir diese Dinge derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich sie nicht mehr missen möchte.
An diesem Vormittag war ich zum Dienst in Trakt J eingeteilt, der den Schutzhäftlingen vorbehalten ist, den besonders Gefährlichen und Berüchtigten, denen, die Kinder missbraucht haben, und den anderweitig sexuell Abartigen, die die Wut der gewöhnlichen Insassen auf sich ziehen würden, und manchmal auch Gesetzeshütern, die sich für einige Zeit auf der anderen Seite der Gitter wiederfinden.
Trakt J besteht aus vier Sektionen mit zusammen hundertsiebzig Insassen. Es ist ein großer Kreis, in dessen Mitte sich unsere Wachstation befindet. Zwischen den Zellen und der Wachstation liegen die Tagesräume, in denen Bänke und Tische im Picknickstil und jeweils ein Fernsehgerät stehen. Durch die Fenster der schwach beleuchteten Wachstation können wir in sämtliche Zellen sehen und mit Hilfe der Kameras, die in den Zellen angebracht sind, können wir jeden Häftling vom Monitorpult in der Wachstation aus beobachten; zudem werden die Zellen durch Mikrofone überwacht.