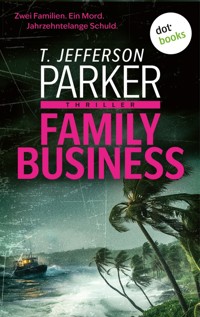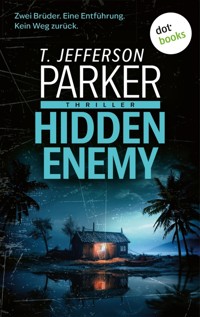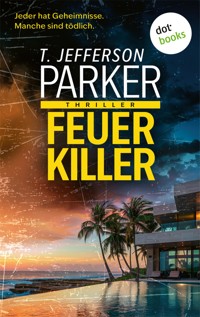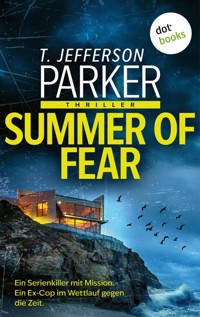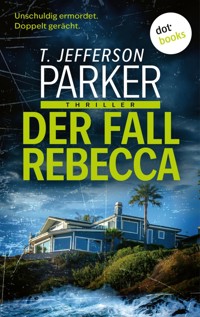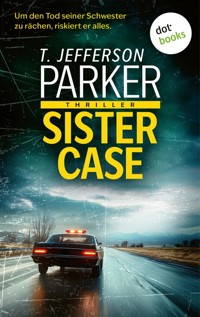
9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
Er wird nicht ruhen, bis er den Mörder seiner Schwester findet … Nach langen Monaten in einem mexikanischen Knast kehrt Ex-Cop und Bergungstaucher Jim Weir in seine Heimatstadt Newport Beach zurück. Doch die Freude über das Wiedersehen mit seiner Familie währt nicht lange, denn kurz darauf wird seine schwangere Schwester Ann auf grausame Weise ermordet. Fassungslos und von Rachedurst getrieben nehmen Jim und sein Schwager, der hochrangige Polizist Raymond Cruz, die Jagd nach dem Täter auf. Als der einzige Zeuge aussagt, der Mörder sei in einem Streifenwagen der Newport Beach Police geflohen, traut Jim seinen Ohren kaum. Verrat im eigenen Revier? Will sich deshalb niemand außer Raymond mit dem Fall befassen? Verzweifelt sucht Jim in Anns Vergangenheit nach Antworten –und stößt auf ein dunkles Geheimnis, das ihm bald zum Verhängnis zu werden droht … »Schreiben auf höchstem Niveau«―Chicago Sun-Times Niemand schreibt so fesselnd über die Abgründe Kaliforniens wie Bestsellerautor T. Jefferson Parker – erstklassige Spannung für Fans von Harlan Coben und Michael Connelly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
eBook-Neuausgabe September 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Pacific Beat« bei St. Martin’s Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Todesrosen« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 T. Jefferson Parker
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Pixel Park und AdobeStock/Daniel
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-69076-041-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
T. Jefferson Parker
Sister Case
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Thomas A. Merk
Für Catherine Anne Mit all der Liebe, die der Himmel zuläßt
Kapitel 1
Eigentlich dreht sich hier alles um den Pazifik. Auf lange Sicht läuft alles, das Land und die Leute hier, immer wieder auf ihn hinaus. Auf kurze Sicht allerdings kann eine Menge passieren.
Die Franziskaner haben die Indianer zugrunde gerichtet, die Mexikaner haben die Spanier davongejagt, bis schließlich die Angloamerikaner die Mexikaner hinauswarfen und die Stadt Newport Beach tauften. Schwimmbagger machten das Hafenbecken tiefer, und die Leute lebten vom Ozean. Es gab eine Fischereiflotte, eine gute Konservenfabrik und Männer und Frauen, die dort und auf den Trawlern arbeiteten. Es waren starke, unabhängige Menschen, ungebildet, aber nicht dumm.
Dann verschwand der Thunfisch, die Netze verfaulten, und die Fischer verfielen dem Suff und der Trägheit. Zwei Kriege kamen und gingen. Dann brachen die Touristen ein, John Wayne zog hierher, und die Preise für Grundstücke stiegen ins Unermeßliche. Jetzt gibt es in Newport Beach mehr Porsche-Automobile als in deren deutschem Vaterland und mehr Schönheitschirurgen als in Beverly Hills. Newport Beach ist genau so, wie man sich eine südkalifornische Stadt vorstellt. 66 453 Leute leben hier, und die meisten von ihnen sind, wie in jeder anderen Stadt auch, anständig.
Jim Weir wuchs auf Newports Balboa-Halbinsel auf, in einem Haus direkt an der Bucht, das seit neunzig Jahren seiner Familie gehörte. Der erste männliche Weir, der in die Neue Welt kam, war vor dem heutigen Provincetown von der MAYFLOWER ins Meer gefallen und ertrunken. Die Nachkommen seiner schwangeren Frau zogen mehr als zweihundert Jahre später, zur Zeit des Goldrausches, in den Westen. Jims Urgroßvater hatte auf der Thunfischflotte von Newport gearbeitet und war zufrieden gestorben, falls es so etwas überhaupt gibt. Sein Großvater hatte in denselben Gewässern gefischt, als sie noch fischreich waren. Doch bis der Erfolg der Familie Jims Mutter, Virginia, erreicht hatte, war er schon merklich bescheidener geworden. Virginia führte mit hartnäckiger Tüchtigkeit ein Café namens Poon’s Locker. »Poon« hatte Weirs Vater mit Spitznamen geheißen; er war vor zehn Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Jims älteren Bruder hatte ein nordvietnamesischer Heckenschütze in Nhuan Duc mitten durchs Herz geschossen. Seine Schwester Ann betrieb einen kleinen Kindergarten zwei Blocks vom Elternhaus der Weirs entfernt, und abends bediente sie in einer Bar.
Jim war Bergungstaucher von Beruf, davor hatte er zehn Jahre für den Sheriff gearbeitet: ein Jahr als Gefängnisaufseher, zwei als Streifenpolizist, fünf bei der Hafenpatrouille und zwei als Kriminaler. Danach hörte er auf, übernahm Bergungsaufträge in der Nähe und suchte nach einem englischen Piratensegler mit Namen BLACK PEARL , der im Jahre 1781 vor der Küste Mexikos von spanischen Kriegsschiffen versenkt worden war. Aber sosehr er auch suchte, bisher hatte Jim noch nicht einmal eine Spur des Wracks gesehen. Seitjim erwachsen war, hatte er fast immer an Bord der LADY LUCK auf dem Liegeplatz B – 420 im Hafen von Newport gelebt.
Von seinem Vater hatte er die buschigen Augenbrauen und schwarzen Haare geerbt, den humorlosen Gesichtsausdruck, eine kräftige Figur, der man es nicht ansah, daß Jim eine Menge Gewicht mit sich herumschleppte, und jene äußere Ruhe, die manche Leute fälschlicherweise als Trägheit interpretieren. Von seiner Mutter stammten die blauen Augen, seine großen Hände, die immer zehn Jahre älter als der Rest von ihm aussahen, und sein aufbrausendes Gemüt, das unter einer ruhigen Oberfläche lag. Wie viele gebürtige Kalifornier war er merkwürdig reserviert und pflegte die Art wissender Zurückhaltung, die die Leute von der Ostküste immer ein wenig amüsiert und die nichts mit der landläufigen Parodie von »Coolsein« zu tun hat. Wirklich cool zu sein bedeutet, ständig bereit zu sein. Jim war siebenunddreißig, kräftig gebaut, unverheiratet und hatte nicht immer einen Job. Was die wichtigen Dinge des Lebens betraf, wartete er immer noch auf den großen Durchbruch.
Er stand auf der Fähre, die über die Bucht von der BalboaInsel zur gleichnamigen Halbinsel glitt. Lichtreflexe zitterten auf dem schwarzen Wasser, und in der ganzen Bucht war das Klappern der Takelage von Segelbooten zu hören. Eine frische Maibrise wehte vom Meer herein und legte sich wie kalte Hände auf Jims Gesicht. Droben am Himmel schwirrte der Polizeihubschrauber von Newport Beach, bis er abdrehte und mit seinem Scheinwerfer woanders nach Verbrechern suchte. Jim sah hinüber zu den Häusern am jenseitigen Ufer, und fast hätte er vor sich hingelächelt: Tut verdammt gut, dachte er, wieder zu Hause zu sein.
Die vergangenen sechs Monate hatte Weir in Mexiko nach der BLACK PEARL getaucht, wobei er die letzten vierunddreißig Tage als Ehrengast der mexikanischen Polizei im Gefängnis von Zihuatanejo verbracht hatte. Jeden Tag in der Dämmerung, wenn er vom Krähen der Hähne in der stinkenden Dunkelheit aufwachte, hatte er mit dem Daumennagel einen Strich in die Zellenwand geritzt. Bei diesem Aufenthalt hatte Jim fünfzehn Pfund abgenommen, zweitausend Dollar Bargeld, seine hervorragende Bergungs- und Tauchausrüstung und sein Heim, die LADY LUCK verloren. Die Anklage gegen ihn war erlogen, hatte etwas mit Drogen zu tun und wurde aus Gründen, die man Weir nicht mitteilte, fallengelassen. Als ihn die Beamten der policia schließlich gehen ließen, besaß er noch seine Armbanduhr, die Kleider, in denen er verhaftet worden war, und ein Busticket nach San Diego. Die mexikanische Polizei galt noch nie als besonders menschenfreundlich.
Die Fähre ächzte, wurde langsamer und schmiegte sich an den Anlegesteg. Jim trat mit unsicheren Schritten an Land. Eine Diät aus Bohnen und schlechtem Wasser fordert auch von den stärksten Muskeln ihren Tribut. Jim ging den Bürgersteig entlang, schlängelte sich durch die Touristen und sog die salzige Luft, die sich mit den Abgasen der im Leerlauf auf die Fähre wartenden Autos und dem Geruch von Seetang vermischte, tief ein. Vom Vergnügungspark fiel rosarotes Licht auf den Gehsteig und irgendjemand schrie hoch oben auf dem Riesenrad. Die Touristenmädchen waren so hübsch wie immer. Wurden sie eigentlich immer jünger, oder täuschte er sich da? Er hörte die Tritte seiner Stiefel auf dem Pflaster, spürte, wie seine geschwächten Beine bei jedem Schritt zitterten, und abermals hätte er fast gelächelt: Mom war bestimmt im Whale’s Tale und trank ein Glas Wein, das Ann ihr serviert hatte. Wenn Raymond Nachtschicht hatte, ging er wahrscheinlich gerade Streife. Daheim, Mann, daheim!
Er hatte sich nicht geirrt. Seine Schwester stand in einem albernen Matrosenkleidchen, das ihre Beine voll zur Geltung brachte, an einem Fenstertisch und schwatzte mit Virginia. Seine Mutter trug eine blaßgelbe Windjacke, die zur Farbe ihrer Haare paßte. Ann drehte ihm den Rücken zu. Jim ging mit schnellen Schritten hinüber zu ihr, schlang seine Arme um ihre Hüften, steckte seine Nase tief in ihre hübschen blonden Locken und grunzte wie ein Schwein. Sie stieß ihm einen Ellenbogen in die Rippen, drehte sich um und drückte ihn fest an sich. Er legte einen Arm um sie und sah hinunter zu Virginia, die einen Schluck Wein trank und ihm ein warmes Lächeln schenkte.
Ann fuhr herum und drückte ihn in einen Stuhl an Virginias Tisch. »Wieso warst du zwei Monate fort, ohne wenigstens eine Postkarte zu schreiben? Hast du das Piratenwrack gefunden? Warum hast du nicht geschrieben? Mein Gott, du bist ja ganz mager. Bist du okay? Weiß Ray, daß du zurück bist?«
»Ja, nein, Gefängnis, ja, nein. Mann, habe ich einen Hunger!«
»Gefängnis? Mein Gott, Jim!« Ann legte ihm die Hand auf die Stirn wie eine Mutter, die sie nie sein würde. Jim sah die drei dunklen Punkte in der blauen Iris ihres linken Auges, die ihm immer wie Inseln im Meer erschienen waren. Ann war zwei Jahre älter als er, sah aber fünf Jahre jünger aus. Virginia legte eine ihrer großen, knochigen Hände an Jims Rippen. «Was ist passiert, Sohn?«
»Kann ich zuerst was zu essen haben?«
Anns Unterkiefer fiel in gespielter Entrüstung herunter. »Ich komme sechs Monate lang fast um vor Sorgen, und du willst was zu essen. Hier, iß das!« Sie wedelte ihm mit einer dunkelblauen Serviette vor dem Gesicht herum.
»Du bist ja ganz schön aufgekratzt!«
»Ach, bin ich das? Dann werde ich jetzt meiner Lebensaufgabe nachgehen und dir was zu essen besorgen.«
»Gut schaust du aus, Annie. Du hast ja richtig rote Bäckchen.« Jim kam es so vor, als hätte sie abgenommen und als wären die Ärgerfalten zwischen ihren Augen tiefer geworden, er sagte aber nichts.
»Ach, das ist nur mein Make-up. Aber trotzdem, danke für das Kompliment. Jetzt mußt du mich aber entschuldigen, die am Vierertisch in der Ecke geben keine Ruhe.«
Jim aß Muschelsuppe mit viel Brot, gegrillten Schwertfisch und zum Nachtisch Käsekuchen und trank dazu fast einen ganzen Liter roten Hauswein. Wann immer Ann Zeit hatte, an den Tisch zu kommen, berichtete er in Etappen von seinem unglücklichen mexikanischen Abenteuer. Daß man ihn am Abend seiner Festnahme verprügelt hatte, ließ er aus. Es hatte ihm damals zu weh getan, als daß er jetzt drüber sprechen konnte.
Weir hatte schon vor langer Zeit herausgefunden, daß Worte manche Dinge nur noch schlimmer machen, daß Schweigen sogar den Teufel verwirrt und daß das Abladen von Seelenmüll auf die Leute, die man liebt, in etwa dasselbe ist, als wenn man aufs Klo geht, ohne die Toilettentür zu schließen. Was Jim in Mexiko wirklich das Herz zerrissen hatte, waren nicht die Prügel gewesen, auch nicht, daß es ihm nicht gelungen war, die BLACK PEARL zu finden, oder der Dünnpfiff, den er sich im Gefängnis von Zihuatanejo geholt hatte. Es war die Tatsache, daß er sein Boot – sein Zuhause – und alles, was darauf gewesen war, dort hatte zurücklassen müssen. Erst jetzt, als er wieder in den Staaten war, kam ihm dieser Verlust richtig zu Bewußtsein. Bisher hatte die Angst alle anderen Gefühle überlagert, jetzt aber war Jim ein wenig angetrunken. Carlos Fuentes hatte recht: Als Gringo in Mexiko konnte man sich ebenso gleich erschießen. Bevor Jim seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, hatte er sich in seiner Phantasie ein Dutzend Mal auf brutale Art an seinen Peinigern gerächt. Trotz dieser leidenschaftlichen Gedanken war Jim so müde, daß er kaum die Augen offenhalten konnte.
»Du mußt schlafen, mein Sohn. Bleib bei mir im Großen Haus. Dein Bett ist immer noch gemacht. Übrigens habe ich deinen Wagen jede Woche bewegt, so, wie du es wolltest. Becky würde sich über deinen Besuch freuen.«
Ann beugte sich herunter und umarmte ihn. »Du bleibst schön sitzen, bis meine Überraschung kommt. Und weißt du, was? Ray und ich geben am Freitag eine Party. Wenn du nett bist, lade ich dich dazu ein.«
Jim fragte nach dem Anlaß, aber Ann antwortete ausweichend und verschlossen, wie es oft ihre Art war. Eine Tasse Kaffee später schaute Jim auf und sah Anns Ehemann, seinen ältesten und besten Freund, auf den Tisch zugehen. Lieutenant Raymond Cruz von der Polizei von Newport Beach bewegte sich mit langsamen, geschmeidigen Schritten durch den Raum. Mit Revolver, Gummiknüppel, Funkgerät und anderen Ausrüstungsgegenständen, ordentlich am Gürtel aufgereiht, kam er so überladen daher wie alle Streifenpolizisten. Jim war nicht gefaßt auf das Glücksgefühl, das ihn auf einmal durchfuhr. Ray grinste breit, riß die Arme auseinander – linke Hand unten, rechte Hand oben – und drückte Jim an sich wie ein Grizzlybär. Weir spürte die Kraft in Rays Händen, als sie ihm auf den Rücken schlugen. Es war eine Umarmung voller Dankbarkeit dafür, daß Jim wieder da war. Raymond löste sich als erster und betrachtete Weir. »Du siehst ganz schön fertig aus.«
Jim nickte. »Du hattest recht. Sie haben mir alles weggenommen.«
Ein Schatten huschte über Raymonds Augen. Seine erste Reaktion war vermutlich, sofort hinunterzufahren und alles zurückzuholen. Er küßte Ann, beugte sich zu Virginia hinunter und gab ihr ebenfalls einen flüchtigen Kuß, dann wandte er sich wieder mit einem Ausdruck des Unverständnisses an Jim. »Wie oft muß ich es dir denn noch sagen?«
»Bitte nicht noch mal. Ich will es nicht schon wieder hören.«
»Du läßt dir nichts sagen, du willst einfach nicht hören. Mein Freund, du bist so dumm wie Bohnenstroh. Warum ist es nur so verflucht schön, dich wiederzusehen?« Einen Moment stand er da und schaute mit seinem klaren, offenen Blick in Jims Gesicht. Dann sah er hinüber zu Ann, die auf einmal völlig unvermittelt zu strahlen anfing.
»Sag’s ihm«, sagte sie.
»Sag du es ihm, Ann.«
Sie trat auf Jim zu, nahm seine Hand und legte sie auf ihren Bauch. »Na, wie klingt das: ›Onkel Jim‹?«
Einen Augenblick lang war Weir sprachlos. Ann konnte keine Kinder bekommen, ganze Heerscharen von Ärzten hatten ihr das immer wieder gesagt, und zwanzig Ehejahre hatten es bestätigt. Und jetzt, plötzlich, war das Unmögliche eingetreten – das Wunder stand ihr im Gesicht geschrieben.
Dann sprudelte sie die Einzelheiten hervor und gebrauchte dabei Worte, die sie noch vor kurzem vor Neid hätten erstarren lassen: In sieben Monaten ist es soweit, ein Dezemberbaby, am Morgen war ihr schlecht, sie muß noch ein Kinderzimmer einrichten, und einen Namen müssen sie auch noch finden.
Jim sah, daß sie bereits tief in einer Welt lebte, in die ihr kein Mann folgen konnte, im Universum der Mutterschaft. Er hatte sie noch nie so von Grund auf glücklich gesehen. Sogar Virginia legte eine gewisse Fröhlichkeit an den Tag. Raymonds Haltung hatte sich verändert, er hielt jetzt den Kopf ein wenig höher, den Nacken ein wenig gerader, und seine schmalen lateinamerikanischen Gesichtszüge sahen auf einmal ungewohnt rundlich aus.
»Annie«, sagte Jim, »du wirst bestimmt die beste – äh, die zweitbeste Mutter in der ganzen Welt werden. Wenn man beim Heimkommen so etwas hört, hat sich die ganze Scheiße in Mexiko direkt gelohnt.« Solange er sich erinnern konnte, hatte Ann sich ein Kind gewünscht. Sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben.
Anns Lächeln war so frisch, als wäre ihr die Gnade, deren sie teilhaftig geworden war, eben erst zu Bewußtsein gekommen. Sie fing sich schnell wieder, zügelte ihre Freude und schlug vor, am nächsten Morgen im Großen Haus zusammen zu frühstücken, damit Jim erzählen konnte, »was da drunten in Mexiko wirklich passiert ist«. Nachdem das ausgemacht war, gab ihr Raymond noch einen zarten Kuß und sah auf die Uhr. »Ich muß zurück in den Straßendschungel von Newport«, sagte er. »Schön, daß du wieder da bist, Jim. Wir sehen uns morgen früh.«
Er ging zur Tür, drehte sich noch einmal um, mit einem Lächeln, das eigentlich Jim hätte gelten sollen, aber schnell zu seiner Frau glitt.
Fünf Minuten später spürte Weir, wie die Erschöpfung die Oberhand gewann. Er trank sein noch halbvolles Glas Wein aus und stand auf. »Wehe, wenn mich jemand vor Mittag weckt.«
Mühsam schleppte er sich die Treppe hinunter und trat hinaus in die feuchte Dunkelheit der Halbinsel. Am Himmel zogen sich Nebelschwaden zusammen, und in seinen Knochen spürte er die Kälte der Frühlingsnacht.
Aber Weir ging nicht zum Haus seiner Mutter, sondern daran vorbei zu den kleinen Häusern und ruhigen Nebenstraßen direkt am Wasser, in denen er fast seine ganze Jugend verbracht hatte. Die Gegend war still. Die flachen Häuschen standen eng beieinander zwischen Hecken aus Oleander und Bougainvilleen, und die winzigen Gärten davor sahen ein wenig verwildert aus. Einen halben Block weiter war Poon’s Locker, das Familienunternehmen, das für Poon und Virginia so viel Geld abgeworfen hatte, daß sie drei Kinder großziehen konnten.
Das Café wirkte massiv, wie es so im Dunkeln dalag, und Jim blieb einen Moment stehen und schaute durch eines der beiden O des Neonschriftzugs, der seit 1963 im Fenster hing. Drinnen konnte er gerade die Umrisse von Stühlen und Tischen und den Postkartenständer neben der Tür sehen. DIE DICKSTEN FISCHE FÄNGT MAN BEI Poon! An den Wänden erkannte Jim die ausgestopften Fischköpfe, er sah die Theke und die alte Registrierkasse. Viel hätte nicht mehr gefehlt, und Jim hätte Jake vor sich gesehen, wie er als Kind unter Poons wilden Flüchen durchs Lokal tobte.
Wieder einen halben Block weiter kam Weir bei Anne’s Kids, dem Kindergarten seiner Schwester, vorbei. Schon lange dachte Jim, daß sie ihn in Ermangelung einer eigenen Familie betrieb. Würde sie die Tagesstätte Anfang Dezember schließen? Das Haus war klein und alt, und das Grundstück war von einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun umgeben, wohl um die lieben Kleinen beim Spielen drinzuhalten. Der Hof hatte einen Betonboden, und Jim sah Dreiräder und Bauklötze sauber neben der Vordertür aufgereiht. All das machte auf Jim den Eindruck, als würde es bald der Vergangenheit angehören.
Dann ging er am Haus von Ann und Raymond vorbei, einem netten kleinen Bungalow mit zwei Schlafzimmern und einer Holzveranda, die mit alten Fischernetzen voller Seesterne, Muscheln, Seeigel und Schwimmern aus Kork dekoriert war. Vom Gehsteig aus gesehen schienen diese Gegenstände in der Luft zu schweben. Ann, dachte er, sammelte die kleinen Schätze des Lebens.
Jim ging drei Häuser weiter zu einem Grundstück, das sich hinter einer hohen Hecke aus weißblühendem Oleander verbarg. Er blieb einen Augenblick stehen, atmete tief durch und fand im Blätterdickicht das Gartentor. Er griff darüber, hielt die kleine Messingglocke fest, damit sie nicht klingelte, und öffnete langsam das Tor. Kaum war er drinnen, blieb er stehen. Der kleine Garten war sehr gepflegt, und die Luft roch süß von den Blüten des Orangenbaums in seiner Mitte. Frühlingsblumen wippten träge in ihren Töpfen. Die flachen Steine des Gartenpfads waren sauber gefegt. Er endete bei einem kleinen Haus, aus dem Licht drang.
Die hölzerne Eingangstür stand offen, aber die Tür aus Fliegengitter dahinter war geschlossen, und Jim konnte die Frau sehen, die mit dem Rücken zu ihm im Eßzimmer saß, den Kopf in die linke Hand gestützt, während sie in der rechten einen Bleistift hielt und etwas auf einen Block schrieb. Als sie sich umdrehte und in Jims Richtung sah, leuchteten ihre hellbraunen Locken im Lampenlicht, der Rest ihres Gesichts aber blieb im Schatten. Jim drückte sich in die Oleanderhecke. Unentdeckt beobachtete er, wie sie aufstand und durch das Zimmer auf ihn zukam, eine schöne, kräftige Frau in einem Kleid aus grüner Seide. Sie blieb, die Hände in die Hüften gestützt, an der Fliegengittertür stehen und sah hinaus. Weir hatte das Bedürfnis, auf sie zuzugehen und etwas zu sagen, aber er wußte nicht, was, und seine Beine verweigerten ihm den Dienst. Aus tiefster Seele stieß er einen Seufzer der Erleichterung hervor, einen Seufzer, den er die langen sechs Monate in Mexiko nicht hatte hervorbringen können. Wie hatte er sich die ganzen vierunddreißig Tage im Gefängnis von Zihuatanejo, in denen er in seiner Zelle immer wieder an diese Frau gedacht hatte, nach diesem Augenblick gesehnt! Auf einmal ging das Licht auf der Veranda aus, und die Haustür wurde geschlossen. Jim hörte, wie der Sicherheitsbolzen ins Schloß schnappte.
Der erste Anruf weckte ihn um ein Uhr morgens. Jim lag in seinem alten Zimmer und warf sich im Halbschlaf, schweißnaß und von Magenkrämpfen geplagt, von einer Seite auf die andere. Einen Moment lang wußte er nicht, wo er sich befand. Es war Ray.
»Jim, hast du Ann gesehen?«
»Nein.«
»Bist du gegangen, bevor sie aushatte?«
»Ja. Um zehn oder so. Ist was nicht in Ordnung?«
»Sie ist nicht zu Hause. Sie ist sonst immer da, wenn ich komme. Ich habe noch mal im Restaurant vorbeigeschaut, wo man mir sagte, daß sie um halb elf gegangen sei, eine halbe Stunde vor Dienstschluß. Sie ist nicht hier. Also dachte ich –«
»Vielleicht ist sie im Locker, oder vielleicht wollte sie noch einen Spaziergang machen«, murmelte Jim, dessen Magen sich in Krämpfen wand. Raymond machte sich immer zuviel Sorgen über alles Mögliche. Er schien das zu brauchen.
»Ein zweistündiger Spaziergang auf der Halbinsel? In diesem Kleidchen, das sie dort tragen muß? Außerdem ist es neblig draußen. Ich schau’ mal im Lorfor vorbei.«
»Also, ich weiß nicht, wo sie sein könnte, Ray.«
Ganz genau wußte Weir hingegen, daß Becky Flynn, als sie das erste Mal nicht zu ihm nach Hause gekommen war, mit einem anderen Mann ausgegangen war. Sie hatte, nachdem sie und Jim sich getrennt hatten, diesen Mann dann auch tatsächlich geheiratet, und Jim hatte sich nie entscheiden können, ob er das als Trost empfinden sollte oder nicht. Jim sagte Raymond nichts davon, sondern fluchte insgeheim über sich selbst, weil er seine eigenen Erfahrungen mit enttäuschter Liebe auf seine Schwester und seinen Freund projizierte.
Aber in dem Augenblick der Stille, die folgte, spürte er, daß Raymond sich ähnliche Gedanken machte. »Nun, sie hat so was noch nie gemacht.«
»Probier’s im Locker, Ray.« Jim hatte immer gedacht, daß Ray alles an eine zu kurze Leine legte, Annie eingeschlossen. Das war typisch und verständlich für einen Polizisten.
»Entschuldige bitte. Schlaf wieder ein.«
»Gut’ Nacht, Ray.«
Eine Stunde später, um zwei Uhr fünf, rief Raymond wieder an. »Jim, sie ist immer noch nicht da. Und im Locker ist sie auch nicht. Ihr Auto ist fort. Bist du sicher, daß sie nicht bei Virginia ist?«
Weir hatte gerade von seiner Zelle im Gefängnis von Zihuatanejo geträumt. Er hatte die fauligen Wände gerochen und gespürt, wie Kakerlaken über seine nackten Füße krabbelten, so tief war der Traum gewesen. »Ich schau’ mal schnell nach unten«, sagte er.
Anns Mädchenzimmer war leer, ebenso das Wohnzimmer und Jakes alte Bude. Eine Straßenlaterne warf ein Rechteck aus weichem Licht auf den Fußboden des Elternschlafzimmers, in dem Virginia tief und fest schlief. Einen winzigen Moment lang dachte Jim an die alten Tage, als Jake und sein Vater noch gelebt hatten und im Haus immer alles drunter und drüber gegangen war.
Er warf sogar einen Blick in die Garage, sah dort aber nichts, außer seinem Pick-up-Truck, Virginias altem VW und einem Haufen Gerümpel. Sein Magen grollte, als er die Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg. »Nein, hier ist sie nicht«, sagte er zu Ray.
»Es ist schon nach zwei, Jim!«
»Hast du die Streife angerufen?«
»Ja. Nichts. Vielleicht sollte ich selbst herumfahren.«
»Nein, bleib am Telefon. Sie weiß, wo du bist, Ray. Sie ruft bestimmt an.«
»Ich habe ein schlechtes Gefühl.«
Weir überkam eine ähnliche Empfindung, die aber gleich wieder verging. »Laß es nicht übermächtig werden. Sie kommt sicher bald nach Hause.«
»Entschuldige. «
Weir konnte nicht mehr schlafen. Um drei Uhr fünfundzwanzig klingelte das Telefon erneut. »Sie ist immer noch nicht hier, Jim.«
»Ich bin in fünf Minuten bei dir.«
Jim zog sich in der Dunkelheit an und ging nach unten. Seine Mutter saß aufrecht mit kerzengeradem Rücken und erhobenem Kopf in ihrem Lieblingsstuhl im Wohnzimmer und hatte beide Arme auf die Lehnen gelegt. Sie saß da wie Abraham Lincoln. Sie fragte Jim, was los sei, und er sagte, daß Ann noch nicht zu Hause sei.
»Ruf im Whale’s Tale und im Locker an«, schlug sie vor.
»Das hat Ray schon getan.«
»Dann probier es bei Sherry, der Kollegin vom Restaurant.« «Sie hätte angerufen, wenn sie bei einer Freundin wäre.«
»Dann ruf beim Wachhabenden der Polizei an.«
»Auch das hat Ray schon getan.«
Virginia war für einen Moment still. »Das gefällt mir nicht. So was hätte vielleicht dein Vater getan. Annie hat mehr von Poon, als du und als Jake gehabt hat. Deshalb habe ich ihr als erstes beigebracht, wie man als Frau auf sich aufpaßt.«
»Aber das bringt sie jetzt auch nicht nach Hause, Mom.«
»Geh zu Ray. Ich rufe bei Becky an.«
Jim schloß leise die Tür hinter sich und ging am Ufer der Bucht nach Norden. Als er bei Ann’s Kids vorbeikam, sah er, daß die Vordertür einen Spalt offenstand. Weir blieb stehen und sah auf die Uhr: Es war drei Uhr siebenunddreißig, Dienstag morgen, sechzehnter Mai. Er ging zum Hoftor, das verschlossen war, und kletterte schließlich über den Zaun.
Auf der anderen Seite sprang er hinunter und kam hart auf. Der Maschendraht schwirrte etwas, aber beruhigte sich gleich wieder. Sechs Schritte waren es zur Tür, die Absätze seiner Stiefel klackten auf dem Beton, das Haus war dunkel. Er drückte mit dem Zeigefinger gegen die Tür, die leicht und ohne ein Geräusch nach innen schwang.
Weir trat ins Haus und knipste das Licht an. Er stand im Spielzimmer mit seinem sauberen Holzboden. Spielzeug jeglicher Art – Plastikeimer und -schaufeln, Puppen und Puppenhäuser, große Holzwürfel mit aufgemalten Buchstaben – war an einer Wand ordentlich aufgereiht. Ein Schaukelpferd stand da, als wäre es mitten im Galopp erstarrt. An einer anderen Wand befand sich ein niedriges Regal voller Bilderbücher. Daneben war ein kleiner Korb voller Kreisel, Jojos und Springseile und ein größerer, in dem die großen roten Bälle waren, die nach Gummi riechen und beim Aufspringen einen schönen Schwirrton von sich geben.
Das zweite Zimmer war der Ruhe- und Videoraum. Die Küche daneben war sauber. Jim stieß mit der Fußspitze die Tür zu Anns Büro auf: ein Schreibtisch, drei Klappstühle, Schreibmaschine, Telefon, Anrufbeantworter. Neben dem Telefon stand eine Blumenvase ohne Blumen, aber halb voll mit Wasser. Jim roch daran. Das Wasser war frisch.
Jim blickte durch ein Fenster hinaus in den Hinterhof und sah ein Spielhaus, einen Kaninchenkäfig und einen Sandkasten.
Er schaltete das Licht aus und verschloß die Vordertür, kletterte wieder über den Zaun und fragte sich, warum die Tür offengestanden hatte und warum auf Anns Schreibtisch eine halb mit frischem Wasser gefüllte Blumenvase ohne Blumen stand.
Vier Häuser weiter ging er durch ein schmiedeeisernes Tor und einen kurzen Gartenweg entlang. Die feuchten Bodenbretter der hölzernen Terrasse vor der Haustür bogen sich unter seinen Tritten durch. Ray öffnete, bevor Jim klopfen konnte.
»Die Tür des Kindergartens stand offen, Ray.«
»Ich weiß. Ich war dort, habe mich umgesehen und alles so gelassen, wie es war. Hast du die Tür geschlossen?« Jim nickte.
Raymond sah ihn scharf an. Schweiß glänzte auf seiner Stirn, und die Haare um seine Ohren waren feucht. »Ich hoffe, du hast keine Spuren verwischt.«
Auf einmal wurde Jim klar, daß Ray wirklich in Panik war.
»Der Kindergarten ist doch kein Tatort.«
»Irgendwas stimmt nicht. Ich spüre das. Wenn man zwanzig Jahre lang verheiratet ist, weiß man, wenn etwas nicht stimmt.«
Jim stand im Wohnzimmer, und Ray goß ihm eine Tasse Kaffee ein. Das Haus war klein, mit zwei Schlafzimmern, niedrigen Decken und Wänden aus astigem Kiefernholz, das dunkel aussah wie Nußbaum. Die beiden hatten das Haus vor zehn Jahren gemietet, und damals war es eine Verbesserung gegenüber ihrem alten Appartement gewesen. Jetzt zogen sie nicht aus, weil sie in der Gegend wohnen bleiben wollten und die Mieten mittlerweile nicht mehr so preiswert waren wie früher. Das zweite Zimmer war das Arbeitszimmer, wo Raymond oft über seinen Büchern saß. Im schwachen Licht einer Schreibtischlampe sah Jim Stapel von dicken Wälzern, einen Schreibblock und eine grüne Kaffeedose, aus der ein Dutzend gespitzter Bleistifte ragte. Seit zwei Jahren, als Jim aufgehört hatte, für den Sheriff zu arbeiten, studierte Ray in Abendkursen Jura. Er sagte Weir immer, daß, verglichen mit dem Studium, die Polizeiarbeit auf der Straße direkt eine Erholung sei. Im nächtlichen Dickicht der Straßen fand er sich besser zurecht als im Paragraphendschungel. Für Jim hatten Ann und Ray mit vielen Leuten aus dieser Arbeitergegend eines gemeinsam: Sie waren ungemein fleißig, hatten aber nicht viel davon. Rays Studium war seine Fahrkarte in eine bessere Zukunft. Virginia finanzierte es.
Weir wußte, wie schwer es für Raymond war, aus seiner Situation auszubrechen, weil er selbst das gleiche getan hatte. Als er seinen Job als Detektiv an den Nagel gehängt hatte und Schatzsucher geworden war, hatten ihm alle Leute aus der Nachbarschaft viel Glück gewünscht, aber Weir hatte trotzdem dabei auch eine gewisse Verachtung gespürt, die unterschwellige, nie geäußerte Andeutung, daß er einen Verrat begangen hatte.
In gewisser Hinsicht stimmte das auch, aber er hatte es nicht wegen des Geldes getan, sondern für seine Freiheit. Keine Polizisten mehr, keine Stechuhren, keine kleinlichen Bürokraten, kein stundenlanges Warten mehr in den Gängen des Gerichtsgebäudes, um schließlich gegen immer dieselben Leute auszusagen, die immer für dieselben trübseligen, gemeinen und dummen Verbrechen verurteilt wurden. Es mußte mehr geben als das.
Raymond verstand seinen Entschluß, hatte ihn immer verstanden, aber ihre Freundschaft, die sie schon fast dreißig Jahre verband, ging viel tiefer als ein gemeinsames Streben nach mehr. Es herrschte ein Vertrauen zwischen ihnen, wie es nur über lange Zeit wachsen kann. Sie hatten miteinander gewetteifert und sich doch die Treue gehalten. Viele Jahre waren es, die sie als Jungen gemeinsam und als Männer getrennt voneinander verbracht hatten, Jahre, in denen Ann der gemeinsame Nenner ihres Lebens gewesen war. Schon vor langer Zeit hatte Jim – mit Schrecken – festgestellt, daß Raymond im Ernstfall bereit wäre, sein Leben für ihn zu opfern. Zuerst hatte es Jim der Tatsache zugeschrieben, daß sie beide Kollegen in einem Job gewesen waren, in dem man auch getötet werden konnte, später dann einer gewissen Opferbereitschaft, die Raymond Cruz einfach im Blut lag. Schließlich hatte er es als das angesehen, was es wirklich war: als Produkt von Rays freundschaftlicher Liebe. Weir glaubte, daß er, sollte es einmal dazu kommen, dasselbe auch für Raymond tun würde, aber er wußte auch, daß man so etwas nie voraussagen konnte.
Das Telefon klingelte in der Küche. Als Raymond abhob, beobachtete Jim sein Gesicht. Ray starrte Weir an und sagte kein Wort, bis er den Hörer wieder auflegte. Er atmete tief durch. »Sie haben Ann gefunden.«
Kapitel 2
Der Nebel legte sich auf die Scheiben von Raymonds Wagen, als sie auf dem Pacific Coast Highway in Richtung auf die Brücke fuhren. Das Pflaster glänzte, und die Feuchtigkeit tanzte in winzigen Tröpfchen durch das Licht der Scheinwerfer. Der Schaufelraddampfer REUBEN E. Lee lag in seinem Dock, Lampengirlanden zeichneten seine Umrisse in das schwarze Wasser der Bucht. Eine Baustelle im gleißenden Flutlicht von Halogenstrahlern drückte den Verkehr auf eine Fahrspur zusammen.
Raymond sagte kein Wort. Jim sah ihn ein paarmal an, bemerkte sein feuchtes Gesicht und seine wäßrigen Augen, die nicht blinzelten. Jim hatte einen solchen Ausdruck oft genug in Gesichtern gesehen: Es war die Maske der Tragödie. Seine Hände waren auf einmal ganz kalt.
Raymond bog in die Dover Street ab und fuhr über Westcliff und Westwind Street in die Morning Star Lane. Hier war die Back Bay, der hintere Teil der Bucht. Niemand aus den Millionen-Dollar-Häusern in der Umgebung war um diese Zeit hier draußen, dachte Jim, die Gegend gehörte ausschließlich den Pennern und Fischern. Ein seichter Meeresarm lief hier zwischen zwei Steilufern eine Meile ins Landesinnere. Die beiden Ufer lagen an ihrer weitesten Stelle etwa eine Meile auseinander. Aus dem flachen Brackwasser hatte man früher Salz gewonnen, aber dieses unbedeutende Gewerbe war schon vor vielen Jahren aufgegeben worden, so daß die Back Bay jetzt den Joggern, Seevögeln und Fischen gehörte, die mit der Flut kamen und mit der Ebbe gingen. Und natürlich Leuten wie Virginia, die sich mit den Baulöwen einen Kampf um die Zukunft der Gegend lieferten. Für Weir hatte dieser Ort immer etwas Merkwürdiges an sich gehabt – die Back Bay war weder Meer noch Land, weder Salz- noch Süßwasser, weder flüssig noch fest, weder schön noch häßlich.
»Was ist los, Ray?«
Raymond drehte sich zu ihm, und seine Augen sagten alles. Jim konnte Anns Haare riechen, ihren Ellenbogen spüren, den sie ihm vor – er sah auf seine Uhr – sechs Stunden in die Rippen gerammt hatte. Ein Gefühl der Unwirklichkeit begann sich über seine Gedanken zu legen. Als er vor Jahren von Jakes Tod erfahren hatte, war das schwierigste für ihn gewesen, klare Gedanken zu fassen. Er haßte dieses Gefühl mehr als jedes andere. Es war stark und ließ nicht nach, ein Heroin der Seele. Eine dichte Nebelwand erschien vor dem Wagen, umhüllte ihn und teilte sich wieder.
Zwei Streifenwagen standen am Ende der Morning Star Lane. Das Rotlicht des einen durchzuckte obszön die Nacht. Bei dem anderen stand die Fahrertür offen. Ein Polizist saß halb drin, halb draußen und sprach mit jemandem über Funk. Jim sah an einem der großen Häuser in der Nähe ein gelb leuchtendes Fenster und zwei Umrisse – Mr. und Mrs. Normalbürger – brave Leute, die aufgeschreckt nebeneinanderstanden und auf das Geschehen herabstarrten.
Als der Polizist in dem Wagen Raymond erblickte, stieg er rasch aus, legte den Hörer auf und führte ihn und Jim auf einem schmalen Pfad die Uferböschung hinunter. Eiskraut glänzte auf beiden Seiten des Weges, und das Wasser der Bucht schlug in kleinen schwarzen, schnell aufeinander folgenden Wellen ans Ufer. Der Nebel zog in dichten Schwaden vorbei, die jeder neuerliche Windstoß nach oben wirbelte.
»Sie ist dort drüben«, sagte der Polizist leise.
Sie gingen über den unkrautbewachsenen Sand, der zum Wasser führte, fünfzig Meter nach Osten. Jim spürte, wie der feuchte Boden unter seinen Stiefeln nachgab, wie er auf den nassen Pflanzen ausglitt und wegrutschte. Weit voraus bewegten sich zwei Gestalten und Lichtkegel von zwei Taschenlampen. Weirs Magen preßte etwas Widerliches nach oben in seine Kehle.
Der Polizist, der vorausging – sein Name war Bristol –, blieb schließlich am Strand in ein paar Metern Entfernung vom Wasser stehen. Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe glitt an einer dunkelgrünen Decke entlang, die über einen auf dem Boden liegenden Körper gebreitet war. Noch war der Ort nicht markiert worden.
»Ein Fischer hat sie an Land gebracht und uns um drei Uhr fünfzig verständigt. Nachdem er seine Aussage gemacht hatte, ließen wir ihn wieder gehen. Ich habe die Tote gleich erkannt und so schnell, wie ich konnte, bei Ihnen angerufen, Sir.«
Jim und Raymond traten zusammen an die Decke heran, knieten sich nieder und schlugen sie jeder auf seiner Seite zurück. Anns Gesicht war bleich und friedlich, ihr blondes Haar floß auf die feuchte Erde. Ihre glanzlosen Augen machten den Eindruck, als starrten sie auf etwas Riesengroßes direkt vor ihnen. Sie trug einen kurzen roten Rock, der schwer und naß an ihren Beinen hing, eine weiße, langärmelige Bluse und am linken Fuß einen Leinenschuh in derselben Farbe wie der Rock. Ihre Arme lagen entspannt neben dem Körper, die Flächen ihrer Hände zeigten nach oben, und die Finger waren gekrümmt. Ihre Beine waren ein wenig gespreizt, so daß die Zehen fast in entgegengesetzte Richtungen zeigten. Im Bund ihres Rocks steckte ein Strauß purpurroter Rosen, deren Stängel dadurch nicht sichtbar waren. Die patschnassen Blüten lagen wie eine schwere dunkelrote Masse auf Anns Rippen. Unter dem Saum ihres Rocks ragte ein einziger Stengel hervor, und Jim konnte sich an seinem Winkel ausrechnen, wo die dazugehörige Blüte stecken mußte. Anns weiße Bluse war von hellrotem Blut durchtränkt und klebte eng an ihrem Körper. In dem Stoff waren so viele dünne, rechteckige Einschnitte, daß Jim der Atem im Hals steckenblieb und er sich mit einem Plumps auf den Boden fallen lassen und die Augen schließen mußte.
Das hier war nicht Ann. Ann konnte doch nicht einfach ein Ding sein, das da auf der feuchten Erde lag. Durch das Geräusch der an den Strand schwappenden Wellen hörte er Raymonds schnelles, flaches Atmen. Als Jim die Augen wieder öffnete, kniete Ray vor Ann und hielt ihren Kopf in seinen Armen. Er preßte seine Wange an die ihre und wiegte sie langsam und schweigend hin und her. Jim sah, wie dabei die Rosenblüten auf ihrer Brust wackelten. Officer Bristol stand rücksichtsvoll abseits. Die Strahlen der Lampen in der Ferne näherten sich langsam. Von Raymond waren jetzt dumpfe, gequälte Laute tiefen Schmerzes zu hören. Einmal sah er auf zu Jim, sein Gesicht war düster und tränenüberströmt.
Weir nahm Anns zusammengezogene Finger in seine Hand und drückte sie, als wären sie alles, was er hatte.
Jim stand zehn Meter entfernt von Ann und Raymond bei Officer Bristol. Er wußte nicht mehr genau, wie er zu ihm gekommen war. »Sagen Sie mir alles, was Sie wissen«, sagte er mit einer Stimme, die er kaum selber hören konnte.
Bristol dröhnte los, als führe er ein Ferngespräch: »Um zehn vor vier hat die Zentrale uns über Funk hierher beordert. Ein Fischer aus der Gegend hat etwa fünfzig Meter vor dem Strand die Leiche treiben sehen. Er war mit seiner Frau und seinem Sohn auf dem Weg zur Arbeit und wollte bei Sonnenaufgang an der Landenge von Catalina sein. Er zog sie mit einem Bootshaken an Land, dann fuhr er hinüber zur Brücke und rief uns von der Telefonzelle an der Mobil-Tankstelle aus an. Als wir seine Aussage aufnahmen, mußte seine Frau sich ein paarmal übergeben, und so ließen wir die beiden gehen. Wir wissen alles, was er weiß. In der Nachbarschaft haben wir bisher noch nicht herumgefragt. Es hat aber auch noch niemand bei uns angerufen.« Bristol blickte hinüber zu Raymond und Ann. »Es tut mir so leid, Mr. Weir.«
»Hat der Bootshaken sie so zugerichtet?« Ich muß das fragen, Annie.
»Der Fischer sagte, er habe sie am Ärmel erwischt und so sanft, wie er nur konnte, ans Boot gezogen. Also nein.«
»Trieb sie mit dem Gesicht nach unten?« Es ist wichtig, daß wir das wissen, Annie.
»Ja, Sir. Er versuchte, sie sowenig wie möglich zu bewegen.«
»Haben Sie sie berührt?« Sie hätten dich nicht berühren dürfen, geliebte Schwester.
»Ich habe ihren Puls gefühlt, dann habe ich die Decke über sie gelegt.«
»Haben Sie den anderen Schuh gesehen?« Es macht dir doch nichts aus, Annie, oder?
»Wir suchen noch danach, Sir. Ich weiß, daß Sie für den Sheriff als Detektiv gearbeitet haben, drüben im Hafen. Wie schnell treibt Ihrer Meinung nach zu dieser Zeit eine Leiche im Wasser?«
Weir hörte sich selbst antworten: »Kommt drauf an, wo sie hineingeworfen wurde, ... nahe an der Küste, bei dieser Ebbe, vielleicht zweihundert Meter in der Stunde ... weiter draußen natürlich schneller.« Sie haben sie umgebracht. Jemand hat meine Schwester Ann umgebracht. Schließ die Augen, Jim, es ist nur ein Alptraum. Du bist immer noch in Mexiko. Du phantasierst im Fieber. Fang diese Nacht noch einmal von vorne an.
»Würde sie denn an die Küste treiben, wenn man sie weit draußen hineingeworfen hätte?«
»Nicht so bald.«
»Dann müßte der Tatort also ostwärts von hier sein?«
Weir wartete auf seine Antwort, aber sein Körper ging einfach weg, näher zu Ann. Sie sah so geschändet aus, so verletzt, so unwiderruflich ohne Leben.
»Sir ... wenn er sie hier getötet hätte, dann hätte er sie doch wohl kaum die Bucht hinauf nach Osten transportiert, um sie dort ins Wasser zu werfen, oder?«
»Nein. Aber halten Sie doch jetzt endlich den Mund, verdammt noch mal.«
Zehn Minuten später tauchten Dwight Innelman und Roger Deak, zwei Tatortspezialisten der Polizei von Newport Beach, aus dem Nebel auf. Innelman war ein großer, schlaksiger Mann um die Fünfzig, den Weir schon seit seiner Zeit beim Sheriff kannte. Deak war klein und dick und sah nicht älter aus als zweiundzwanzig. Er hatte einen ganz kurz geschnittenen Stiftenkopf und trug in jeder Hand einen schweren Koffer. Innelman und er führten Raymond von Anne fort und begannen ihre Arbeit mit Foto- und Videoaufnahmen.
Jim stand neben seinem Schwager am Wasser. Raymond zuckte heftig, und im ersten schwachen Morgenlicht konnte Jim sehen, wie weiß sein Gesicht war. Sein Atem war hastig, beim Einatmen stockend und unregelmäßig. Jim kannte diese Symptome.
»Laß uns zum Auto gehen und uns hinsetzen, Ray.«
»Ich bleibe hier.«
»Nein, wir gehen jetzt zurück zum Auto.«
Ray machte drei Schritte, bevor seine Knie weich wurden und er sich auf den schmutzigen Boden setzen mußte, die Beine wie ein Kleinkind von sich gestreckt. Sein Gesicht war kalt wie Eis. Jim ließ sich von Bristol eine Decke geben und sagte ihm, er solle einen Krankenwagen rufen. Als Weir wieder bei Raymond war, zeigte dieser die ersten Anzeichen eines schweren Schocks. Jim konnte nichts für ihn tun, außer ihn hinzulegen, zuzudecken und beruhigend auf ihn einzureden.
Jim erzählte ihm von Zihuatanejo, vom traumhaft blauen Wasser und dem weißen Sand dort, davon, wie er langsam auf fünfundzwanzig Meter Tiefe hinabgetaucht war und dort von dem plötzlichen Kichern, dem ersten Anzeichen des gefährlichen Tiefenrauschs, überfallen wurde. Er erzählte Ray von den vielen Tauchgängen, auf denen er auch nicht das allerkleinste Stückchen von der BLACK PEARL gefunden hatte, von der erfundenen Drogenanklage, von seinen Tagen im Gefängnis. Weir spürte, wie er selbst nur zu gern im Geist hinüber nach Mexiko glitt, denn hier war eine Hölle, von der er bis jetzt nicht gewußt hatte, daß sie auf Erden existierte.
Raymonds Zähne klapperten, und sein Körper erschauerte in Schüben wie unter Elektroschocks. Seine Augen waren weit aufgerissen und blinzelten nicht. Jim redete weiter, baute einen Hafen aus Worten in diesem Sturm der Verzweiflung und schaute die ganze Zeit über den Strand hinüber zu Ann und den Blitzlichtern, die ihren bleichen Körper schlagartig für Zehntelsekunden aus dem Dämmerlicht rissen wie ein billiger Lichteffekt aus irgendeiner Provinzdiskothek. Einen Moment lang hatte Weir das Gefühl, als stünde er allein am Bug eines Schiffs und steuere einen Kurs, der von einer schwarzen Küste zur nächsten führte. Ann, ich verspreche dir, jetzt, in diesem Augenblick, daß ich ihn finden werde. Es war die traurigste Verpflichtung, die er in seinem Leben übernommen hatte, und Weir wußte es.
Als die Sanitäter endlich kamen und Raymond mitnahmen, hatte der Nebel in seinem Kampf mit der Sonne ein graues Unentschieden erreicht. Jim saß mit über den Knien gekreuzten Armen am Meer und beobachtete, wie Ann Cruz, neununddreißig Jahre alt, von zwei Männern, die sie nie gesehen hatte, auf eine Bahre gelegt wurde. Ein roter Schuh schaute unter der Decke hervor auf ihrem Weg zur ersten einer Reihe von Stationen, die sie durchlaufen mußte, bevor sie die letzte Grenze, die zu ihrem Grab, überschreiten durfte.
Jim ging zu Raymonds Auto, nahm den Wagenheber aus dem Kofferraum und ging hundert Meter den Strand hinunter, bis er etwas fand, das senkrecht aus dem Sand ragte. Es war ein Schild, auf dem TAUCHEN VERBOTEN stand, aber als Jim zu erschöpft war, um mit seinen blutig gescheuerten Händen noch weiter zuzuschlagen, war es nur noch verbeulter Schrott und zersplittertes Holz. Er schrie seine Flüche geradewegs zum Himmel hinauf, Gott mitten ins Gesicht. Er schrie Dinge, die ihm selber Angst machten.
Dann ging er zurück zu Raymonds Auto, wo er den Wagenheber in den Kofferraum warf, und weiter zum Wagen des Leichenbeschauers. »Ich fahre mit ihr«, sagte er.
»In Ordnung«, erwiderte der Fahrer.
Kapitel 3
Als Weir drei Tage später um zwei Uhr nachmittags ins Büro des Polizeichefs kam, war Raymond schon da. Die Sekretärin schloß die Tür hinter ihm. Raymond war unrasiert und immer noch weiß wie die Wand. Er sah Jim an und sagte nichts.
Ein wenig seitlich von dem großen, metallenen Schreibtisch saß ein Mann, den Weir bisher noch nie gesehen hatte. Er hatte die Beine affektiert übereinandergeschlagen, den Rücken kerzengerade durchgestreckt und die Haare mit Pomade streng nach hinten gekämmt, so daß sich tiefe Geheimratsecken erkennen ließen. Seine Nase war scharf geschnitten und spitz; sie gab seinem Gesicht ein energisches Aussehen. Sein Anzug hatte einen betont europäischen Schnitt. Bevor er sich erhob, musterte er Jim durch eine runde, randlose Brille.
Auch Brian Dennison, der Interims-Polizeichef von Newport Beach, stand auf, reichte Jim die Hand und sagte: »Es tut mir leid, es tut mir so leid, Jim.«
Jim hatte kaum geschlafen oder gegessen. Eigentlich hatte er so gut wie überhaupt nichts getan, seit er Anns erstarrten Körper auf der dunklen Erde am Strand gesehen hatte. Er hatte alles wie mechanisch gemacht: Er hatte die Fragen einer Reihe von Polizeibeamten beantwortet, er war per Anhalter zurück zu Raymonds Wagen gefahren, er hatte Virginia mitgeteilt, was passiert war, und hatte ihren vor Schreck starren Körper in einer langen Umarmung fest an sich gepreßt, von der er wußte, daß sie den erhofften Trost nicht spenden konnte. Es war Jim unmöglich, aus sich herauszugehen. Er konnte sich einfach nicht an die schreckliche neue Ordnung der Dinge gewöhnen.
Das Große Haus war in den folgenden Tagen der Dreh- und Angelpunkt der Familientrauer geworden. Virginias Bruder hatte zu einem nachmittäglichen Besuch kommen wollen und war dann doch zwei Tage geblieben. Poons Schwester hatte dasselbe getan. Eine große Abordnung der Familie Cruz war aufgetaucht und hatte in Schlafsäcken auf dem Boden der EIGHT PESO CANTINA , der Bar, die Raymonds Eltern gehörte und die wegen des Trauerfalls geschlossen war, übernachtet. Die Vorbereitungen für das Begräbnis hingen davon ab, wann die Autopsie beendet war. Das Haus füllte sich mit Blumenbouquets und den verschiedenen Gerüchen der Familie. Das alles verband sich für Weir zu einem unsichtbaren, beklemmenden Käfig.
Gerade als er kurz davor war auszubrechen – wohin, das wußte er nicht –, griff Virginia durch und warf alle hinaus. Sie stopfte den größten Teil der Blumen in die Mülltonne hinter Poon’s Locker und stellte von da ab wieder die ihr eigene verbissene Tüchtigkeit zur Schau. Lange Stunden saß Jim einfach nur so mit ihr im Wohnzimmer und ließ wortlos die Zeit in lähmender Langsamkeit vorbeiziehen. Manchmal schien Virginia sprechen zu wollen, dann überlegte sie es sich anders, fiel in sich selbst zurück und kämpfte weiter mit ihren ganz persönlichen Dämonen.
Weir hatte seine eigenen Pflichten so schnell erledigt, wie es ihm möglich war. Wenn er mit sich allein war, besonders wenn er im Bett lag und darauf wartete, daß der Schlaf ihn erlöste, vergoß er Tränen, die seinen Schmerz nicht verringerten, sondern ihn immer wieder aufs neue aufbrechen ließen. Jim fühlte sich dann, als wäre sein Körper von innen nach außen gekrempelt worden, als wären alle Nerven und Organe schutzlos der kalten Luft, dem kratzigen Stoff des Betts, der ganzen Rauheit einer Welt ohne Trost ausgesetzt. Zweimal hatte Raymond Jim gebeten, mit ihm tauchen zu gehen. Zweimal hatten sie in Diver’s Cove die Ausrüstung angelegt, waren durch die Brandung gestapft und hinaus zu den Felsen geschwommen. Dort waren sie schließlich hinabgetaucht in eine schweigende Welt voller unbeteiligter Meerestiere, die ihnen irgendwie geholfen hatte, die große Spannbreite des Lebens zu erkennen, das auch ohne Ann weitergehen mußte.
»Danke«, war alles, was Jim dem Polizeichef jetzt antwortete. Brian Dennison war ein Mann mit einem gewaltigen Brustkasten und einem merkwürdig lebhaften Gesicht, ein Mann, der ständig bemüht war, gutes Benehmen an den Tag zu legen. Seit Jim ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte er zugenommen. Dennison stellte den Mann mit den Geheimratsecken als Lieutenant Mike Paris vor. Paris war der Pressesprecher der Polizei. Dieser Job, das wußte Weir, war etwas für lahme Enten – oder jemanden, der eine Karriere bei der Stadtverwaltung anstrebte. Paris nickte und drückte Jims Hand so vertraulich, als begrüße er ein neues Mitglied eines exklusiven Geheimklubs. »Ich möchte Ihnen im Namen der ganzen Abteilung mein Beileid ausdrücken.«
Weir setzte sich neben Raymond und sah ihn abermals an. Es war ein Blick von einer persönlichen Hölle in eine andere.
Dennison stolzierte hinter seinen Schreibtisch, setzte sich und schaute die drei Männer vor sich nacheinander an. Dann stand er wieder auf und ging zum Fenster. Dort wandte er sich an Jim. »Wir haben ...« sagte er, aber er beendete den Satz nicht. Er atmete hörbar aus, sah wieder aus dem Fenster und sammelte sich erneut.
Jim war während seiner zehn Jahre beim Sheriff ein paarmal mit Brian Dennison zusammengetroffen, meistens auf Partys und auf Polizeiseminaren. Dennison war aalglatt und aggressiv und konnte mit unerschütterlicher Selbstsicherheit gleichermaßen auf der Straße prügeln wie bei seinen Vorgesetzten arschkriechen. Weir war er immer wie das Musterbeispiel eines Newport-Beach-Polizisten vorgekommen. Dennison war bei den Reichen beliebt, denn seine Beamten patrouillierten in deren Wohngebieten mit offen zur Schau gestelltem Nachdruck. Das einfache Volk hielt Chief Dennison – wie seinen Vorgänger – für arrogant und hart. Diese Einschätzung war wohl nicht so ganz falsch, denn er hatte sich oft genug wegen Brutalitäten und Einschüchterung von Zeugen vor Gericht verantworten müssen. Auf der Balboa-Halbinsel, von der auch Jim stammte, gab es in Newport Beach den meisten Zoff, weil dort die Arbeiter manchmal Dampf abließen und die Touristen sich häufig wie Schweine benahmen.
Dennisons offizieller Titel war Interims-Polizeichef, denn sein Vorgänger war vor sieben Monaten – ein paar Wochen bevor Jim nach Mexiko aufgebrochen war – plötzlich einem Herzanfall erlegen. Weir hatte die Geschichte in den Zeitungen mitverfolgt: Dennison war auf Widerruf zum Captain befördert worden und mußte noch vom Stadtrat in dieser Funktion bestätigt werden. Da aber bei der Wahl im kommenden Monat auch der Stuhl des Bürgermeisters neu besetzt werden sollte, war die Ernennung eines neuen Polizeichefs zurückgestellt worden, weil Dennison – plötzlich und ohne die sonst üblichen Gerüchte und Spekulationen – seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters angemeldet hatte.
Weir hatte mit Interesse diese Entwicklung in der Zeitung mitverfolgt und war von Dennisons Drang nach oben beeindruckt gewesen. Dennison war aus dem Nichts, praktisch über Nacht, Interims-Polizeichef geworden und hatte diesen Aufstieg gleich in sein politisches Debüt umgemünzt – und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, die diese Verwandlung als die natürlichste Sache auf der Welt erscheinen ließ. Jim hatte auf seinem Weg zur Polizei auf einem städtischen Bus ein riesiges Foto von Dennison gesehen, und auf irgendeine unerklärliche Weise hatte es dort ausgezeichnet hingepaßt.
Jetzt bemerkte Weir ein großes Plakat mit der Aufschrift Wachstum ist Wohlstand an der Wand des Büros. Er konnte sich gut vorstellen, warum ein Polizeibeamter, der beabsichtigte, Bürgermeister zu werden, sich mit den Baulöwen gut stellen wollte: höhere Steuereinnahmen, ein höherer Gemeindehaushalt, mehr Macht. Höchstwahrscheinlich finanzierten sie seinen Wahlkampf.
Das war es, wogegen Virginia kämpfte, dachte Jim. Sie trat zusammen mit anderen Bürgern für ein langsames Wachstum der Stadt ein. Sie hatten es geschafft, daß ihre Vorstellungen bei der Wahl im Juni auf dem Wahlzettel als »Vorschlag A« zur Abstimmung standen. Jim fragte sich, ob Anns Tod das Ende von Virginias Engagement bedeutete. Einen Augenblick lang sah er wieder ihr Gesicht, als er ihr die schreckliche Nachricht überbracht hatte.
Er versuchte, seine Gedanken zurück ins Zimmer zu zwingen, aber dazu brauchte er einen Punkt, um sich festzuhalten. Sein Blick fiel auf das BÜRGERMEISTER-BRIAN-DENNISON- Plakat, und einen Moment lang blieb er an den großen schwarzen Pupillen der Augen hängen. Reiß dich zusammen, dachte er; bleib am Ball.
Er versuchte, sich Dennisons Gegenkandidatin vorzustellen. Die Rechtsanwältin Becky Flynn war im selben Viertel wie er aufgewachsen und hatte dort als Schönheit gegolten. Jim hatte, seit er vor zwei Jahren beim Sheriff aufgehört hatte, um die BLACK PEARL zu suchen, ihren Aufstieg fast ausschließlich in den Zeitungen verfolgt. Damals hatte er auch mit Becky Schluß gemacht und sie mit ihm. Beckys gelegentliche Anrufe seitdem waren vorsichtige Sondierungen gewesen. Er sah sie jetzt ohne Mühe vor sich, wie sie in einem grünen Kleid im Licht der Veranda ihres Bungalows stand. Becky war, bis jetzt, die größte Liebe in Jim Weirs Leben gewesen.
Der Interims-Polizeichef schaute kurz auf sein WACHSTUM-IST-WOHLSTAND- Plakat. Dennisons lebhafte Augenbrauen schienen wie immer die Ruhe seiner blassen, gemächlichen Augen Lügen zu strafen. Auch jetzt fuhren sie in einer Mischung aus Sorge und Hilflosigkeit in die Höhe. »Jim, wir befinden uns in einer ... einer sehr – äh – interessanten Situation. Ich habe mit Mike und Raymond darüber gesprochen, und wir haben beschlossen, einen Versuch zu wagen. Es ist etwas, was wir bisher noch nie versucht haben. Nie versuchen mußten...«
Weir wartete und dachte bei sich, wie sehr sich Dennison doch bemühte, wie ein Politiker zu sprechen.
»Jim, wir haben einen Zeugen«, fuhr Dennison fort
Weirs Geistesabwesenheit wich kristallklarer Wachheit.
»Nun ja, so eine Art Zeugen. Er heißt Malachi Ruff. Sagt Ihnen das etwas?«
»Einer von den Pennern, die in der Bucht herumlungern.«
»Richtig. Mackie hat in jener Nacht drunten im Galaxy Park geschlafen – ein paar hundert Meter östlich von dem Ort, wo wir ... Ann fanden.«
»Was hat er gesehen?«
Dennison ging langsam zur Kaffeemaschine hinüber. »Wollen Sie auch einen, Jim?«
»Was hat er gesehen?«
Dennison rührte mit einem roten Plastiklöffel Sahne in seinen Kaffee, während er Malachi Ruffs Geschichte erzählte. Ruff hatte geschlafen, und natürlich war er besoffen gewesen, denn Mackie ist immer besoffen, wenn er nicht gerade im Knast sitzt. Er wachte vom Schreien einer Frau auf, schaute über die Büsche, in denen er lag, aber er konnte nichts sehen, denn es war neblig. Mackie dachte, er habe geträumt. Er legte sich wieder hin. Dann hörte er drunten am Wasser Schritte – etwa dreißig Meter entfernt –, und er erhob sich wieder und schaute herum. Die Schritte klangen, als laufe jemand, gleichmäßig, wie ein Jogger. Er konnte immer noch kaum etwas durch den Nebel sehen, aber schließlich erhaschte er doch einen Blick auf einen Mann, der hinauf zur Straße rannte. Dann hörte Mackie, wie eine Autotür geöffnet und zugeschlagen wurde. Der Motor wurde angelassen, und eine Sekunde später fuhr – laut Mackie – ein Wagen den Galaxy Drive hinunter in Richtung auf den Pacific Coast Highway.
Jim sah zu, wie Dennison seinen Kaffee trank, zu Paris hinüberschaute und dann wieder an seinen Schreibtisch ging. Er rückte irgendetwas auf dem Tisch gerade und sah wieder zu Paris.
»Mackie behauptet, es sei ein Streifenwagen gewesen«, sagte der Chief. »Einer von den unseren – weiß, viertürig, mit einem Emblem auf der Seite.«
Raymond starrte auf seinen Daumennagel. Weir sah, daß Dennisons dickes, schweres Gesicht ganz rot geworden war. Paris saß mit übergeschlagenen Beinen bewegungslos da. Das war eine morsche Sprosse in der Leiter zum Amt des Bürgermeisters, dachte Weir. Er sagte nichts.
Dennison setzte sich und schaute hinüber zu Raymond. Jim kam es so vor, als hätten sich die drei schon auf etwas geeinigt. Als nächster sprach Raymond mit leiser, gleichbleibender Stimme. »Du weißt ebensogut wie wir, daß Mackie Ruff so ungefähr der unzuverlässigste Zeuge ist, den man überhaupt finden kann. Aber im Moment ist er alles, was wir haben. Wenn wirklich vor drei Nächten ein Polizist aus Newport Beach auf Patrouille Ann umgebracht hat, dann sind wir als Polizei nicht mehr in der Lage, den Fall zu untersuchen. Wir glauben, daß Mackie sich geirrt hat. Aber niemand hier darf eine solche Aussage auf die leichte Schulter nehmen, selbst wenn sie von einem Säufer kommt.« Jetzt erhielt Mike Paris einen Blick von Dennison, schlug seine Beine auseinander und schaute zu Weir. »Gleichzeitig«, sagte Paris, »stecken wir in einer Zwickmühle, Jim. Einerseits wollen wir nicht, daß irgendetwas von der Geschichte nach außen dringt, auf der anderen Seite wollen wir aber die Sache auch nicht polizeiintern untersuchen lassen, solange wir nicht mehr als das Wort eines Säufers haben. Die Presse, die Verdächtigungen – die Moral der Polizei wäre beim Teufel. Wenn es wirklich einer unserer Leute getan hat, dann werden wir ihn finden. Bis dahin wollen wir weder die Presse noch die Öffentlichkeit, noch sonst irgendjemanden Spekulationen anstellen lassen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß alles nach innen und nach außen seine Ordnung hat. Wir gehen zunächst davon aus, daß Mackie Ruff nur Mist erzählt, und stellen, solange wir es vermeiden können, seinetwegen nicht die ganze Abteilung auf den Kopf.«
Raymond stand auf und ging zum Fenster. »Wir könnten einen Außenstehenden gebrauchen, jemanden, der etwas von dem Geschäft versteht, der weiß, wie man Spuren nachgeht, und der einen halbwegs plausiblen Grund hat, auf eigene Faust Untersuchungen in dieser Sache anzustellen. Ich habe dabei an dich gedacht.«
»Und ich halte das für einen guten Vorschlag«, sagte Dennison. »Sie haben das Handwerkszeug, weil Sie zwei Jahre für den Sheriff Detektiv gespielt haben, und Sie können Fragen über den Tod Ihrer Schwester stellen, ohne allzu große Aufmerksamkeit zu erwecken.«
Über den Tod Ihrer Schwester. Die Worte berührten Jim merkwürdig, als wäre Ann in Sekundenbruchteilen von einem Menschen aus Fleisch und Blut zu einem Aktenzeichen geworden. Und in Wirklichkeit war sie das ja auch. Etwas Kaltes regte sich in ihm und blieb dann in wachsamer Erwartungshaltung hocken. »Ich kann kaum stichhaltige Beweise beschaffen, die vor Gericht Bestand hätten«, erwiderte er. »Nicht als Zivilist.«
»Wenn Sie irgendetwas finden, was uns auch nur in die Nähe eines Gerichts bringen könnte, würde sich die gesamte Polizei von Newport Beach darauf stürzen«, sagte Paris.
»Und nur darum geht es«, ergänzte Dennison. »Sobald Sie etwas finden, das faul ist, übernehmen wir die Geschichte sofort. Sie sollen sich bloß ein paar Tage lang umsehen, das ist alles.«
Weir schaute hinüber zu Raymond, der ans Fenster gelehnt stand.
»Wir brauchen dich, Jim«, sagte er.
Weir blieb stumm. Er wußte, daß er sich, sollte wirklich ein Polizist aus Newport Ann getötet haben, mitten in einem Krieg befand. Und selbst wenn das nicht der Fall war, würde er sich wohl trotzdem recht schnell in ziemliche Schwierigkeiten bringen. Aber im Grunde genommen hatte er gar keine andere Wahl. »Ich mache mit«, erklärte er schließlich.
Dennison nickte und blickte Jim aus seinen sanften grauen Augen intensiv an. »Drei Dinge müssen wir noch klären, bevor Sie anfangen. Erstens: Kein Wort von Ihnen zu irgendjemandem, nach wem Sie suchen, wonach Sie suchen. Sollten irgendwelche Gerüchte aufkommen, lassen wir Sie im Regen stehen. Zweitens: Wir zahlen Ihnen hundert Dollar die Stunde, unter der Hand – keine Quittungen, keine Steuern, niemand weiß, daß wir Sie beschäftigen. Drittens: ... Cruz, wollen Sie das nicht übernehmen?«
Raymond setzte sich wieder neben Jim und beugte sich in seinem Stuhl nach vorn. »Sowohl Brian als auch ich sind uns bewußt, daß wir in diesem Fall genauso verdächtig sind wie jeder andere Polizist. Wir erwarten von dir, daß du auch uns überprüfst, und schlagen vor, daß du mit deinen Untersuchungen beim Chief und mir anfängst, da du uns schließlich auch Bericht erstatten wirst und –«
»Wir schlagen es nicht vor«, unterbrach Paris, mehr zu Dennison als zu Jim gewandt. »Wir verlangen es.«