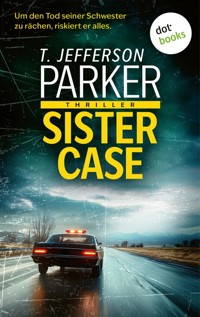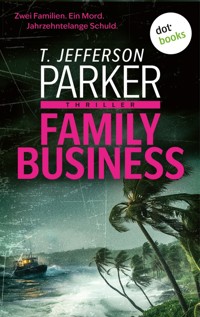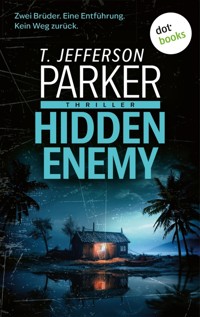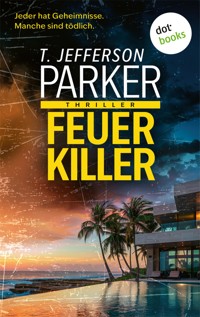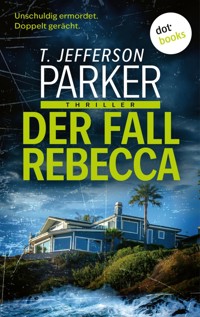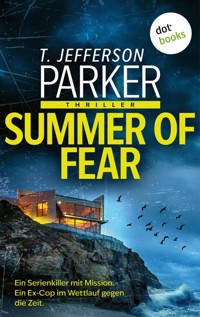
9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
Hinter der glitzernden Fassade Südkaliforniens lauert das Böse … Eine Serie grausamer Morde an Liebespaaren erschüttert das vornehme Orange County, doch die Polizei scheint noch zu leugnen, dass die Fälle zusammenhängen. Nur Krimiautor Russ Monroe erkennt die Handschrift eines eiskalten Serienkillers und wittert einen Fall, der selbst den Stoff seiner härtesten Thriller in den Schatten stellen würde. Was ist die makabere Mission des Mörders? Als seine Ex-Geliebte Amber unter den Opfern ist, beginnt Russ auf eigene Faust zu ermitteln. Bei seiner Recherche stellt er fest, dass der Polizeichef den Mord an Amber vertuschen will – nur warum? Die Wahrheit, auf die er schließlich stößt, ist erschreckender als jeder Albtraum … »Eines der besten Bücher, die Sie je lesen werden.« – Chicago Sun-Times Ein Autor, der die dunkle Seite des Sunshine States kennt – ein fesselnder Noir-Thriller für Fans von James Patterson und Harlan Coben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Serie grausamer Morde an Liebespaaren erschüttert das vornehme Orange County, doch die Polizei scheint noch zu leugnen, dass die Fälle zusammenhängen. Nur Krimiautor Russ Monroe erkennt die Handschrift eines eiskalten Serienkillers und wittert einen Fall, der selbst den Stoff seiner härtesten Thriller in den Schatten stellen würde. Was ist die makabere Mission des Mörders? Als seine Ex-Geliebte Amber unter den Opfern ist, beginnt Russ auf eigene Faust zu ermitteln. Bei seiner Recherche stellt er fest, dass der Polizeichef den Mord an Amber vertuschen will – nur warum? Die Wahrheit, auf die er schließlich stößt, ist erschreckender als jeder Albtraum …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Summer of Fear« bei St. Martin’s Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Sommer der Angst« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by T Jefferson Parker
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 für die deutschsprachige Ausgabe Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pixel Park, schankz; AdobeStock/Michael
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-98952-980-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
T. Jefferson Parker
Summer of Fear
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Thomas A. Merk
Widmung
Für Cat
Kapitel 1
In schlimmen Nächten bläst hier im Canyon der Wind so stark, daß ich manchmal das Gefühl habe, er könne jeden Augenblick unser Haus zum Einsturz bringen.
Das Ding steht hoch oben am steilen Osthang des Laguna Canyons auf hohen Stelzen, die von der Straße aus betrachtet wie die zerbrechlichen Beine eines Moskitos aussehen und keinesfalls massiv genug, um ein ganzes Haus zu tragen. Ein starker Wind kann hier, zwischen den eng beieinanderstehenden Canyonwänden, hundertmal pro Minute seine Richtung ändern. Weil ihm der Platz fehlt, sich auszutoben, wird der Sturm von den Berghängen zurückgeworfen und rauscht mit lautem, frustriertem Heulen von der anderen Seite um unser Haus, das unter seinen verrückten Kapriolen zu schwanken beginnt. Die Fensterscheiben erzittern, und die Balken ächzen laut. Manchmal, wenn die Elemente besonders schlimm wüten, erwarte ich, daß die Hand des Herrn mich fort von dieser Erde nimmt und hinein in die düster gähnende Unendlichkeit stößt. Ab und zu setze ich mich in diesen Sturmnächten hinaus auf die Terrasse, spüre das starke Schwanken meiner Behausung und starre hinunter auf die in tiefer Dunkelheit liegenden Sandsteinfelsen zehn Meter unter mir. Seltsam, denke ich dann, wie rasch in der Natur Ordnung ins Chaos umschlagen kann. Für gewöhnlich halten wir die Natur für bewundernswert geordnet und glauben, daß nur die wenig segensreichen Eingriffe des Menschen ihr harmonisches Gleichgewicht durcheinanderbringen. Aber das stimmt nicht immer. Wenn ich so in einer dunklen, windigen Nacht auf meiner Terrasse sitze – je windiger, desto besser-, wird mir bewußt, daß die Natur weder sauber geordnet noch makellos perfekt ist. Manchmal ist sie nicht viel anders als die Welt, die wir Menschen uns geschaffen haben, nämlich blutgierig und grausam. Die Leute wollen immer »zurück zur Natur«, ohne sich bewußt zu sein, daß die Natur sich manchmal mit brutaler, alles vernichtender Gewalt am Menschen rächt. Was für eine befreiende, alles hinwegfegende Kraft sie dabei entfesseln kann, wird einem erst in einer dunklen Nacht so richtig bewußt, in der der Wind durch den Canyon peitscht.
Nächsten Monat gehen meine Frau und ich nach Mexiko. Mir bleiben noch dreißig Tage, um dieses Buch zu schreiben, unsere Sachen zu packen und zum Flughafen zu fahren.
Mein Name ist Russ Monroe, und ich schreibe Kriminalromane. Früher war ich Polizist, bis ich vor zehn Jahren den Dienst quittierte, um zu schreiben. Zuerst waren es Zeitungsartikel, später dann ganze Bücher. Bereits das erste davon – Die Reise flußaufwärts: Geschichte eines Serienmörders – hatte einen nicht unbeträchtlichen Erfolg. Es bekam recht gute Kritiken und erreichte sogar eine zweite Auflage. Das kann man von meinen beiden letzten Büchern leider nicht sagen. Vermutlich haben Sie von ihnen noch nie etwas gehört – ich selbst finde sie gelegentlich auf Ramschtischen oder beim Bücherbazar irgendeines Wohltätigkeitsvereins, häufig noch mit dem Namen des ursprünglichen Käufers auf der ersten Seite. Eigentlich sollte ich mich nicht über so etwas aufregen, aber ich tue es trotzdem, was sicherlich einer meiner größten Fehler ist. Zeitungsartikel schreibe ich übrigens nach wie vor. Anders käme ich finanziell nicht über die Runden.
Dieses Buch hier ist die Geschichte eines Sommers der Angst. Der Sommer der Angst. Der Titel war meine Idee. Nicht besonders phantasievoll, möglicherweise, aber muß denn ein Titel immer phantasievoll sein?
Ein paar Dinge sollten Sie über mich wissen. Einerseits, weil es wichtige Hintergrundinformationen sind, andererseits deshalb, weil ich zum ersten – und, wie ich hoffe, auch zum letzten – Mal, seit ich Kriminalschriftsteller bin, in einer meiner eigenen Geschichten eine Hauptrolle spiele. So etwas ist eine schreckliche Belastung für einen Autor. Aber es ist nichts im Vergleich zu der Belastung, unter der wir in diesem Sommer alle gelitten haben, ich und die gut zweieinhalb Millionen weiterer Einwohner von Orange County. An keinem von uns ist dieser Sommer spurlos vorübergegangen.
Ich bin vierzig Jahre alt, ziemlich groß und dunkelhaarig. Meine Familie lebt in diesem County seit 1952, als es hier noch mehr Orangenhaine als Neubau Siedlungen gab und das Leben noch viel angenehmer war als heute. Mein Urgroßvater heiratete während des großen Goldrauschs oben am Yukon ein Mädchen aus einem Tanzpalast und hatte mit ihr einen Sohn, der später Sprengstoffexperte wurde. Er erfand einen Zündmechanismus für Dynamit, der heute noch in Gebrauch ist und für den er sogar ein Patent bekam. In seiner Freizeit schrieb mein Großvater Science-Fiction-Geschichten. Ich weiß das, weil ich sie eines Tages in seinem Nachlaß fand. Die Geschichten waren allesamt ziemlich grausam und waren wohl eher als eine Art Therapie für die ganz persönlichen Ängste meines Großvaters gedacht als zur Unterhaltung anderer oder gar für eine Veröffentlichung in irgendeinem Verlag. Einen ihrer Titel borgte ich mir für mein zweites Buch aus. Es hieß Im Zeichen des Skorpions und wäre – zumindest nach Meinung der Kritiker – in der großen, alten Werkzeugkiste, in der mein Großvater seine Manuskripte aufbewahrte, besser aufgehoben gewesen als auf dem Buchmarkt. Mein Vater war Ranchverwalter für die SunBlesst Company und hatte deren Zitrusplantagen hier im Orange County unter sich. Nach und nach zog sich SunBlesst aber immer mehr aus der Landwirtschaft zurück und verpachtete ihr Land an Spekulanten, die dort neue Wohnsiedlungen aus dem Boden stampften. Später dann, etwa ab den sechziger Jahren, begann die Firma, ihre Zitrushaine ganz offen an den Meistbietenden zu verkaufen. Das allmähliche Verschwinden seines kleinen Königreichs machte aus meinem Vater einen bitteren Mann. Früher, daran erinnere ich mich noch gut, ritt er nach Dienstschluß täglich noch einmal seine Haine ab. Er war ein großer, drahtiger Mann, der im Sattel eine gute, fast schon militärisch wirkende Figur abgab. Stolz, wie er war, wehrte er sich mit Händen und Füßen dagegen, daß er innerlich ebenso schrumpfte wie die immer kleiner werdenden Zitrusplantagen unter seiner Obhut.
Aber natürlich konnte er nichts dagegen tun, und so wurde er von Jahr zu Jahr verbitterter und immer mehr in sich gekehrt. Vor fünf Jahren ging er schließlich in Pension und zog in einen abgelegenen Trabuco-Canyon, der seinen Namen von den primitiven Feuerwaffen hat, die die Spanier im achtzehnten Jahrhundert hierhergebracht hatten. Noch heute lebt mein Vater dort in seiner kleinen Hütte im Schatten verwunschener, uralter Eichen.
Von meiner Mutter habe ich eine gewisse Selbstversunkenheit und eine nicht allzutief unter meiner normalerweise ruhigen und ausgeglichenen Oberfläche schlummernde Liebe zum Chaos geerbt, ebenso wie ein gesundes Mißtrauen gegenüber jeglicher Form von Autorität, das mir seinerzeit meinen Beruf als Polizist nicht gerade erleichtert hat. Mutter war ein Einzelkind und hatte in ihrer Jugend auf der Farm ihrer Eltern viele Stunden allein mit ihrer kleinen Ziege Archie verbracht und sich dabei die phantasievollsten Geschichten ausgedacht. Sie lebte so sehr in ihrer eigenen Welt, daß sie die meisten Dinge des realen Lebens als eine unerbetene Einmischung ansah. Als meine Mutter siebzehn war und gerade eben als eine der jüngsten Absolventinnen ihren High-School-Abschluß gemacht hatte, tippte sie eines Tages mit geschlossenen Augen auf eine Karte der Vereinigten Staaten. In Denver, wohin ihr Finger gezeigt hatte, nahm sie sich ein Zimmer im Verein Christlicher Junger Frauen und suchte sich eine Stelle als Sekretärin. Ab und zu bekam sie auch einen Job als Mannequin für das Kaufhaus Daniels & Fisher. Eines Tages sah mein Vater im Vorbeigehen, wie sie gerade im Schaufenster Kleider vorführte, und verliebte sich Hals über Kopf in sie. Keine zwei Monate später waren die beiden verheiratet und zogen nach Kalifornien, wo mein Vater gerade seinen neuen Job antrat. Ein Jahr später setzten sie Russell Paul Monroe in diese Welt.
Auch Mutter lebte in einem abgelegenen Canyon, der dem meines Vaters nicht unähnlich war, bis sie vor drei Jahren starb, und zwar auf den Tag genau ein Jahr nach der Scheidung von meinem Vater. Sie war erst fünfundfünfzig Jahre alt. Ich fand es sehr bezeichnend für meine Eltern, daß sie nach ihrer Scheidung beide aus dem Gebäude der SunBlesst-Ranch, in dem ich meine Jugend verbracht hatte, auszogen und sich ihre jeweiligen Canyons suchten, wo sie dann, nur ein paar Meilen Luftlinie voneinander entfernt, für sich allein dahinlebten. Sie behaupteten damals beide unabhängig voneinander, daß sie getrennt viel glücklicher wären als jemals zu Zeiten ihrer Ehe. Mir persönlich kam es allerdings eher so vor, als wollten sie nur nicht zugeben, wie einsam sie in Wirklichkeit waren. Aber vielleicht war das ja auch bloß die Wunschvorstellung eines Sohnes, der es einfach nicht glauben kann, daß seine Eltern sich nicht mehr lieben.
Mutter starb im Schlaf, vermutlich an einer krankhaften Erweiterung einer Arterie. Ich habe damals – hauptsächlich auf Drängen meines Vaters hin – auf eine Autopsie verzichtet. Der Gedanke daran, daß irgendwelche Ärzte den Kopf dieser außergewöhnlichen Frau aufsägten und darin nach irgendeinem Blutpfropfen suchten, war uns beiden gleichermaßen ein Gräuel.
Außerdem hatte Mutter schon seit vielen Jahren an zu hohem Blutdruck gelitten.
Jetzt ist es Winter, aber nichts ist mehr so wie zuvor – weder hier in unserem Haus noch zwei Meilen weiter südlich in der Stadt Laguna Beach, wo sich so viel von dem Grauen zugetragen hat, noch irgendwo anders in diesem County, das Disneyland beherbergt und dessen Flughafen sich mit dem Namen des Westernhelden John Wayne schmückt. Hier, wo sich ein blühendes Waffengeschäft hinter dem klingenden Namen Raumfahrtindustrie versteckt und die Grundstückspreise zu den höchsten in den gesamten Vereinigten Staaten gehören, hat der Sommer der Angst uns alle verändert.
Er hat uns gezeigt, daß es, tief verborgen in unserem Inneren, bei uns allen etwas gibt, das uns möglicherweise zu grauenvollen, schrecklichen Taten treibt.
Das Nachtauge – ich war es übrigens, der die Öffentlichkeit mit seinem Namen vertraut machte – war nicht der erste Massenmörder in der Geschichte des Orange County. Aber bisher haben wir diese Leute immer wie Raubtiere angesehen, die anderen Menschen brutal und gnadenlos nachstellten. Sie haben traurige Berühmtheit erlangt, diese Monstren, die ihre Opfer nachts in ihren Schlafzimmern erwürgen, sie in dunklen Seitenstraßen abstechen oder ihnen aus nächster Nähe eine Kugel in den Leib jagen. Ein jeder hier hat die Geschichte von den ahnungslosen Trampern gelesen, die vertrauensselig einen Schluck aus einer mit K.o.-Tropfen präparierten Bierflasche nahmen und im daraus resultierenden Zustand der Bewußtlosigkeit bestialisch ermordet wurden. Dann gab es noch die von dem Pentagramm, das toten Pennern in die Handfläche geritzt wurde, oder von den gräßlich zugerichteten Überresten getöteter Soldaten, die man in Plastiktüten neben dem Highway und in den Wäldern an der Grenze des County gefunden hatte – ein paar davon übrigens ganz in der Nähe des Canyons, in dem jetzt mein Vater lebt.
Auch Sie haben sicherlich von diesen Mördern gehört – vom Highwaywürger (zehn Opfer), vom Nachtgespenst (vierzehn Opfer) oder von Randy Kraft (siebzehn Opfer). Die drei sollen übrigens im Hochsicherheitstrakt des Zuchthauses von Vacaville zusammen eine Bridge-Runde gegründet haben, zumindest habe ich das erst kürzlich ausgerechnet im Vanity Fair gelesen. (Angeblich gewinnt Kraft die meisten Spiele, und der Highwaywürger, den er behandelt wie ein kleines Kind, soll ihm tierisch auf die Nerven gehen. Das Nachtgespenst wiederum wird in dem Artikel als ein schlechter Verlierer beschrieben, dessen Schwäche es sein soll, daß er zu unbedacht ausspielt. Dennoch bewundert Kraft an ihm angeblich seine aggressive Spielweise.)
Diese drei Männer haben wir als Außenseiter betrachtet. Selbst Kraft, ein wohlerzogener, freundlicher Computerprogrammierer, der hier im County aufgewachsen ist, kam uns ziemlich fremd vor. Kein Wunder, denn schließlich waren alle seine Opfer junge Männer, die er vor ihrem Tod ausnahmslos entweder zum Geschlechtsverkehr verführt oder vergewaltigt hatte. Als Homosexueller gehörte Kraft in eine seltsame, geheimnisvolle Welt, zu der sich wohl nur die allerwenigsten der Normalbürger des County zugehörig gefühlt hätten. Nach dem Motto: Gott sei Dank bin ich nicht schwul, also habe ich von diesem Serienmörder auch nichts zu befürchten. Bei den paar Gesprächen, die ich mit Kraft während seines Prozesses führen durfte, hatten mich jedes Mal aufs neue seine Intelligenz, seine Bescheidenheit und seine Offenheit verblüfft. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß man bei seiner Festnahme auf dem Vordersitz von Krafts Wagen einen toten Gefreiten der Marines und eine Liste mit Namen und Beschreibungen der Männer gefunden hat, die er mit Drogen betäubt, vergewaltigt, in Stücke gehackt und dann an verschiedenen Orten fortgeworfen hatte. Viele Einträge auf der Liste bezogen sich auf Männer, die von der Polizei als vermißt geführt wurden. Trotz all dieser schauerlichen Details schaffte Kraft es nie, bei den Menschen des County im Unterbewußtsein soviel Schrecken zu verbreiten wie das Nachtauge in diesem Sommer der Angst.
Das Nachtauge war einer von uns. Wir haben es geboren und aufgezogen. Zum Schluß, glaube ich, dachten die Leute sogar, daß das Nachtauge so wie wir war und daß wir, wenn auch natürlich in weitaus geringerem Umfang, so waren wie das Nachtauge.
Jetzt ist es Winter, und das County fängt langsam an, diesen Alptraum zu vergessen.
Eines allerdings ist mir in diesem Sommer klargeworden. Etwas, das ich nie vergessen werde: Die Kenntnis der Wahrheit hat nicht immer etwas Befreiendes an sich.
Kapitel 2
Warum ich Amber Mae Wilson in der Nacht von Samstag, dem dritten Juli, anrief, weiß ich selber nicht mehr genau. Sicher, ich war einmal ihr Liebhaber gewesen, aber das war nun schon über zwanzig Jahre her. Es stimmt auch, daß ich die ganzen zwanzig Jahre über – mal mehr, mal weniger – hin und wieder an sie gedacht habe, aber die letzten fünf dieser Jahre war ich glücklich und ohne eine Spur des Bedauerns mit meiner Frau verheiratet.
Vielleicht lag es an dem Traum, den ich in der Nacht zuvor gehabt hatte, in dem die vier Jahre alte Amber Mae Wilson splitterfasernackt bei mir auf der Veranda gestanden war und gesagt hatte: »Ich heiße Amber Mae. Ich bin drei Jahre alt und wohne in dem weißen Haus da drüben. Schenkst du mir einen Keks?«
Das war eine wahre Geschichte, jedenfalls hat Amber das damals, als wir zusammen waren, immer wieder behauptet. Ich glaube es sogar, denn in dem Vorfall zeigen sich gleich mehrere von Ambers grundlegenden Charaktereigenschaften: Ihr Mut, ihre Unschuld, ihre Bereitschaft, etwas zu ändern und ihre Nacktheit. Andererseits wurde mir in den beiden kurzen Jahren unserer Liebesbeziehung aber auch klar, daß Amber ständig irgendwelche Geschichten über sich erfand. Sie schuf sich damit – das ist mir erst in diesem Sommer richtig klargeworden – eine Amber Mae Wilson, mit der sie selbst besser auskam als mit der realen. Sie sah die Wahrheit niemals als etwas Statisches oder Absolutes, nie als etwas Unumkehrbares oder Bindendes an. Die Wahrheit war für Amber Mae wie ein Kleidungsstück, das sie wechseln konnte, wann immer es ihr gelegen kam.
Als ich Amber in jener schwülen, feuchtheißen Julinacht von einer Bar aus anrief, war nur ihr Anrufbeantworter dran. Es war zwanzig Minuten nach Mitternacht, und ich bildete mir ein, eine Aufgabe zu haben.
Und so fuhr ich zu ihrem Haus im Süden der Stadt und starrte aus meinem Wagen auf Ambers Garten mit seinen von Strahlern beleuchteten Palmen und seinem schmiedeeisernen Tor. Hinter den Gitterstäben konnte ich sehen, wie aus dem Maul eines springenden Marmordelphins ein dünner Wasserstrahl in einen Brunnen plätscherte. Dahinter brütete, hoch über dem Pazifischen Ozean, Ambers großes Haus in der Dunkelheit. Zwei Komma acht Millionen Dollar hatte sie, wenn man den Zeitungsartikeln glauben konnte, für diesen Schuppen und die eineinhalb Hektar Grund hinblättern müssen. Dafür standen hier, in dieser exklusiven Gegend in den Küstenbergen, die Häuser gut hundert Meter auseinander.
Es war schon das dritte Mal innerhalb einer Woche, daß ich spät nachts hierherkam.
Seit fünf Jahren wohnte Amber nun schon in diesem Haus, und das dürfte für sie eine Art persönlichen Rekord darstellen. In dieser Zeit hat sie dreimal den Garten umgemodelt. Zuerst sah es hier so aus, als habe irgendein reicher Spinner sich Cape Cod nachgebaut – überall waren Wege aus Terrakottaplatten, kupferne Wetterhähne und hölzerne Blumenkübel. Als nächstes kam eine Wüstenlandschaft mit jeder Menge Kakteen und Wegen aus verwittertem Granit, und jetzt zeigte der Garten ein kalifornisch-mediterranes Gesicht. Ich wußte das alles nur deshalb, weil ich bei meiner Arbeit viel im County herumkomme. Da kann man bestimmte Dinge einfach nicht übersehen.
Wie schon gesagt, die Nacht war schrecklich heiß. Ich kurbelte sämtliche Fenster herunter, lehnte den Kopf an die Nackenstütze und dachte an meine Frau Isabella, die jetzt zu Hause war und schlief. Isabella, die Frau meines Lebens, die mich gelehrt hat, was wahre Liebe ist, lag jetzt in ihrem Bett und hatte, trotz der Hitze, eine Wollmütze auf, um ihren Kopf warm zu halten. Neben dem Bett standen ihr Rollstuhl und ihr Gehstock. Die weißen Papierbecher mit den Medikamenten für die Nacht befanden sich griffbereit auf einem niedrigen Regal, so daß Isabella, die von der letzten Dosis noch ganz schläfrig und benommen war, nicht lange suchen mußte, wenn es an der Zeit war, die nächsten Pillen zu schlucken.
Isabella war achtundzwanzig Jahre alt und litt in dieser Nacht des dritten Juli, in der ich schon zum dritten Mal in einer Woche vor Amber Mae Wilsons Haus im Wagen saß und mich fragte, ob ich wohl den Mut aufbringen würde, zum Tor zu gehen und zu klingeln, nun schon seit etwas mehr als eineinhalb Jahren an einem bösartigen Gehirntumor.
Vermutlich meinen Sie jetzt, daß dieser Russell Monroe Ihnen ein paar Erklärungen schuldig ist.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele.
In jener feuchten, heißen Nacht des dritten Juli aber war ich nicht gewillt, irgendjemandem irgendetwas zu erklären, am allerwenigsten mir selbst. Ich weigerte mich ganz einfach, denn Erklärungen wären mir bei dem, was ich vorhatte, nur lästig gewesen. Schließlich war ich gerade dabei – so hoffte ich zumindest – ein geheimes Doppelleben zu beginnen.
Ich öffnete das Handschuhfach, holte meinen silbernen Flachmann mit der Gravur: »In ewiger Liebe, Isabella« heraus und nahm noch einen Schluck Whisky. Isabella. Ich legte den Flachmann zurück, zündete mir eine Zigarette an und lehnte mich in meinem Sitz zurück. Während ich wieder hinüber zu Ambers Garten blickte, versuchte ich, alle unangenehmen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen und stattdessen in Erinnerungen an Amber und eine Zeit zu schwelgen, in der wir noch jung gewesen waren und geglaubt hatten, die ganze Welt würde uns offenstehen. Gibt es nicht für jeden von uns ein paar Jahre so um die Mitte Zwanzig herum, die einem dann in der Erinnerung wie die glücklichsten des ganzen Lebens vorkommen?
Während ich so vor mich hinsinnierte, sah ich, wie Ambers Haustür sich öffnete und schloß und jemand sich quer durch den Garten auf das schmiedeeiserne Tor zu bewegte.
Es war ein Mann, der das Tor, bevor er es hinter sich ins Schloß fallen ließ, sorgfältig mit einem Taschentuch abwischte. Dann hakte er die Daumen in die vorderen Taschen seiner Jeans und ging eiligen Schrittes fort. Das Taschentuch hatte er in der rechten Faust zusammengeballt. Er überquerte die Straße, stieg in einen am gegenüberliegenden Gehsteig geparkten schwarzen Firebird jüngeren Baujahres und fuhr fort.
Der Mann sah mich nicht, aber ich sah ihn. Und ich kannte ihn gut.
Sein Name war Martin Parish. Captain Martin Parish, der Chef der Mordkommission beim Sheriff von Orange County. Früher einmal war er zunächst ein Bekannter von mir gewesen, dann wurde er mein Freund, und daran hat sich seit zwanzig Jahren nichts geändert.
Marty Parish war ein großer Mann mit gütigen blauen Augen und einer brennenden Leidenschaft für die Vogeljagd.
Marty Parish und ich haben miteinander im Winter 1974 die Abschlußprüfung an der Sheriffsakademie gemacht.
Marty Parish war es, der mir bei unserer Einstandsfeier beim Sheriff Amber Mae Wilson vorgestellt hat.
Marty Parish war der einzige von ihren Männern, den Amber je geheiratet hat. Diese Ehe lag jetzt fünfzehn Jahre zurück und hatte nur ein Jahr gedauert. Und jetzt hatte Marty eben mitten in der Nacht Ambers Haus verlassen und seine Fingerabdrücke vom Griff des Gartentors gewischt.
Ich sah zu, wie die Rücklichter des Firebird in der Dunkelheit verschwanden, und fragte mich, ob Martin Parish wohl auf dieselben Gedanken gekommen war wie ich. Ich hatte ihn eigentlich immer für willensstärker gehalten als das. Auf einmal überkam mich eine Woge der Scham. Aber vor wem schämte ich mich? Vor Martin? Oder vor mir selbst?
Vom Autotelefon aus rief ich noch einmal Amber an, aber es war wieder bloß der Anrufbeantworter dran. Was für eine einladende, verschwörerisch klingende Stimme Amber auf dem Band doch hatte.
Ich nahm noch einen Schluck aus meinem Flachmann und legte ihn wieder ins Handschuhfach, bevor ich die Fenster hochkurbelte und ausstieg.
Tu das nicht, sagte eine leise Stimme tief in mir, es gibt keinen Grund dafür, auch wenn du eine Million Entschuldigungen dafür zu haben meinst – aber ich war schon fast an Ambers Gartentor angelangt. Es war nicht abgesperrt. Das Haus war dunkel, nur aus einem Fenster, das möglicherweise zur Küche gehörte, drang ein ganz schwacher Lichtschein. Ich klopfte, klingelte und klopfte noch einmal. Die Tür war verschlossen. Auf einem Gartenweg aus runden Betonplatten gelangte ich um das Haus herum in den hinteren Teil des Gartens. Im bläulichen Licht des Halbmonds konnte ich den sanft hügeligen Rasen und den kleinen Orangenhain am Ende des Gartens erkennen. Vom Rand eines abgedeckten Whirlpools aus Beton stieg feiner Wasserdampf auf.
Die gläserne Schiebetür ins Haus stand weit offen, ebenso wie die Fliegengittertür davor. Offen! Das Herz sackte mir in die Hose, aber ich bemühte mich, an nichts zu denken. Fängt so ein geheimes Doppelleben an? Die Vorhänge waren aufgezogen, vermutlich, um die Nachtluft ins Haus zu lassen. Klimaanlagen hatten Amber schon immer Kopfschmerzen verursacht. War Marty auf diesem Weg ins Haus gekommen? Als ich mir das Fliegengitter näher besah, entdeckte ich einen etwa zwanzig Zentimeter langen, vertikalen Schlitz etwas links und knapp oberhalb des von innen zu öffnenden Schlosses. So einen Schlitz hätte man problemlos mit einem Tafelmesser machen können. In meinem Inneren begannen sich auf einmal Dämonen zu regen; ich konnte direkt spüren, wie sie durch meine Arterien wirbelten und sich um meine Wirbelsäule wanden. Sie fühlten sich an wie Monstren aus den Tiefen des Meeres, in die nie ein Lichtstrahl hinabfällt – mit Zähnen scharf wie Rasiermesser, plumpen Köpfen und farbloser Haut. Ich spürte, wie mir das Blut in den Schläfen hämmerte.
Was ich als nächstes tat, war total konträr zu dem, was ich als Polizist gelernt hatte, was mir mein Instinkt als Schriftsteller sagte und was die Logik der Situation geradezu gebot. Es war sogar gegen die Emotionen, die jetzt in mir hochstiegen. Aber irgendwie drehte ich durch und geriet in Panik. Meine Angst brauchte einfach ein Ventil. Aber vielleicht war es ja auch aus Sorge um Amber Mae Wilsons Wohlergehen – das jedenfalls rede ich mir jetzt manchmal ein.
Ich stürmte ins Haus, tastete nach einem Lichtschalter und rief ihren Namen.
»Amber.«
»Amber.«
Amber!
Nichts. Ich rannte durch sämtliche Zimmer im Erdgeschoß – sie waren alle leer. Überall schaltete ich wahllos Lichter an. Als ich die Treppe hinaufhastete, kam ich ins Stolpern und schlug mit dem Schienbein schmerzhaft an eine Treppenstufe. Oben angekommen, war ich völlig außer Atem. In dem trügerischen Licht gab es Winkel und Nester voller Dunkelheit, in denen sich weiß Gott was verbergen konnte. Überall in diesen Schatten kam es mir so vor, als bewege sich etwas. In einem Zimmer, das offensichtlich Ambers Arbeitszimmer war, rannte ich gegen einen niedrigen Schrank. Ein Stapel Zeitschriften fiel zu Boden, die Lampe daneben fiel um, und die Birne zersprang mit einem leisen Knall.
Amber!
Schließlich rannte ich auf eine halb offene Tür am Ende eines langen Ganges zu. Die Gemälde an den Wänden sausten an mir vorbei, und die Decke kam mir auf einmal erdrückend niedrig vor. Mein Herz hämmerte jetzt so wild, daß es kaum mehr Pausen zwischen den einzelnen Schlägen gab. Dann war ich an der Tür und stürzte in den Raum. Der Lichtschalter befand sich genau dort, wo ich vermutet hatte, und plötzlich war das Zimmer hell erleuchtet. Alles hätte ich hier erwartet, nur nicht das, was ich sah.
Zuerst dachte ich, es wäre Blut. Dann korrigierte ich mich: Es war rote Sprühdosenfarbe. Die größten Buchstaben befanden sich auf den Spiegeltüren des begehbaren Kleiderschranks:
SO JAH SEH
Dann, auf der gegenüberliegenden Wand über dem Kopfteil des Bettes:
WACHT AUF ODER STERBT IN UNWISENHEIT
Und auf der Wand mir gegenüber:
DAS NACHTAUGE IST WIEDER DA
Dazwischen war überall das Peace-Zeichen gesprüht, dieses häßliche Henkelkreuz aus den sechziger Jahren, das mich immer an einen Krähenfuß oder an ein modifiziertes Kruzifix erinnert. In stark verzogenen, krude hingesprühten Kreisen zog es sich über alle Wände des Zimmers. Und dann dieses SO JAH SEH. Ich brauchte eine Weile, bis ich kapierte, was es bedeutete. Es war die lautmalerische Umsetzung eines bekannten Rastafari-Spruchs. So Jah says. So spricht Jah. Und Jah heißt bei den Rastas Gott. SO SPRICHT GOTT.
Amber lag mit grotesk abgespreizten Armen und Beinen neben dem Bett auf dem Fußboden. Sie trug einen Morgenmantel aus blauer Seide. Ihr volles braunes Haar war auf den Teppich hingebreitet, und dazwischen konnte ich weiße und rosa Fetzen sehen, die einmal Ambers Hirn und Schädeldecke gewesen sein mußten. Noch schlimmer war ihr Gesicht, Ambers schönes, altersloses und verführerisches Gesicht – es hing nur noch mit einem Fetzen Haut am Schädel und war zur Seite geklappt, als habe es sich selbständig gemacht und betrachte die in einer großen Blutlache schwimmenden, braunen Haare.
In meinen ganzen zehn Jahren als Polizist habe ich nie ...
In den zehn Jahren als Kriminalschriftsteller habe ich nie ...
Nie. Nicht ein einziges Mal habe ich etwas gesehen, das dem hier auch nur nahegekommen wäre.
Ich erinnere mich noch, wie ich dastand und mit zitternden Hüften mein Gewicht auf die Fersen verlagerte. Ich blickte hinauf zur Decke und wartete darauf, daß sich meinem Mund ein Schrei entwand, aber er blieb mir vor lauter Grauen in der Kehle stecken. Dieser erstickte Schrei kam tief aus meinem Inneren, direkt aus meinen Zehen und drängte mit Gewalt nach oben. Ein fürchterlicher Schmerz stieg mir vom Magen die Speiseröhre empor, meine Augen begannen zu tränen und die Peace-Zeichen an den Wänden schienen auf einmal in wildem Reigen um mich herumzutanzen.
Ich beugte mich hinab zu Ambers weggeklapptem Gesicht und blickte in ihre matten grauen Augen. Sie waren abwesend und leblos wie altes, stumpf gewordenes Glas.
Niemals, in all den vielen Jahren ...
Aus dem roten Schleier heraus, der mich umgab – alles was ich sah, war auf einmal in Rot getaucht, hatte rote Umrisse, leuchtete rot – legte ich einen Finger auf meine Lippen und streckte ihn nach denen von Amber aus. Die Entfernung von meinem Mund zu dem ihren kam mir fast unendlich vor. Wie weit entfernt Amber auf einmal zu sein schien. Als ich meinen Finger schließlich doch auf ihre kalten grauen Lippen legte, zitterte er wie Espenlaub.
Ich stand auf, ging ins Badezimmer und holte mir eine Handvoll Toilettenpapier. Als ich zurückkam, sah ich mich etwas gründlicher in dem Zimmer um. Auf dem Fußboden neben der Tür entdeckte ich zwei offenstehende, gepackte Koffer. Wohin hatte Amber gewollt? Ich zwang mich dazu, sie noch einmal anzusehen. Dann kniete ich mich neben sie und wischte nach kurzem Zögern mit dem Toilettenpapier ihre Lippen ab. Dasselbe tat ich mit dem Lichtschalter, wobei ich gleichzeitig das Licht ausknipste. Nacheinander wischte ich auch alle anderen Schalter ab – sogar die, von denen ich mir ganz sicher war, daß ich sie nicht berührt hatte. Schließlich nahm ich mir den Haken der Fliegengittertür und den Türknopf der Eingangstür vor, bis ich ein paar Sekunden später in meiner rötlich gefärbten Trance den Messinggriff des Gartentors blankrieb, den Martin Parish nicht lange vor mir ebenfalls abgewischt hatte.
Es kam mir so vor, als wäre der Weg zu meinem Wagen über zehntausend Meilen lang.
Ich fuhr zur Main Beach und watete dort durchs knietiefe Wasser. Ich vergrub meine Hände im nassen Sand und spritzte mir das salzige Meerwasser ins Gesicht. Lange Zeit stand ich so da und steckte immer wieder meine Arme in den leicht schmirgelnden, tropfnassen Schlick. Was sollte ich tun? Ich könnte natürlich die Polizei anrufen und ihr einen anonymen Tip geben. Ich könnte ihnen auch meinen Namen nennen und sagen, daß Martin Parish seine Exfrau umgebracht hatte. Oder ich konnte mich totstellen, abwarten und darauf bauen, daß die Polizei ihre Arbeit tat. Aber eines würde ich garantiert nicht tun – und wenn die Sache noch so sehr nach Mord roch –, ich würde niemals zugeben, daß ich jemals bei (geschweige denn in!) Amber Mae Wilsons Haus gewesen war. Das war ich Isabella schuldig, sagte ich mir. Das war ich uns beiden schuldig.
Und dann kam mir noch ein Gedanke. Und obwohl der mir als das so ziemlich Düsterste vorkam, was mein Kopf je produziert hatte, muß ich zugeben, daß er mir einen kleinen Schauer der Erregung den Rücken hinunter und in das Chaos meines Herzens jagte. Als ich so dastand und meine Hände immer wieder im scheuernden Sand des Pazifik vergrub, wurde mir auf einmal bewußt, daß mir eben möglicherweise die größte Geschichte meines Lebens über den Weg gelaufen war. Phantastisches Material, das nur mir allein gehörte. Mach was draus, sagte ich mir. Denn das hier war mehr als ein geheimes Doppelleben, mehr als eine Zerstreuung. Hier hatte ich einen Vorfall an der Hand – und was für einen Vorfall. –, der, wenn ich nur das richtige daraus machte, meiner Karriere sehr viel mehr nützen konnte als ein Dutzend zweitklassiger Kriminalromane. Ich kannte diese Leute. Und ich war am Schauplatz des Verbrechens gewesen. Als ich auf einmal meinem eigenen Ehrgeiz mit all seiner mir bisher verborgen gebliebenen Gier direkt in die Augen sah, wurde mir fast ein wenig schlecht. Dennoch wollte in mir, während sich die Kühle des Ozeans langsam in meinen Armen und Beinen bemerkbar machte, kein so richtiges Gefühl der Scham aufkommen. Was war so ein Gefühl denn auch schon im Vergleich zu dem schrecklichen Anblick von Ambers Gesicht, der mir noch immer tief in meinem Inneren die Seele aufwühlte?
Schließlich ging ich im Licht des Halbmonds quer über den Strand zurück zu meinem Wagen. Pärchen schlenderten Arm in Arm umher und küßten sich auf der Strandpromenade. Ein Hund trabte an mir vorbei.
SO JAH SEH
So spricht Gott.
Auf einmal verspürte ich das übermächtige Verlangen, zu Hause zu sein, im Bett neben Isabella. Diese Sehnsucht überkam mich mit solcher Heftigkeit, als wäre in mir auf einmal ein Damm gebrochen. Bitte, Gott, bring mich zurück. Ich fuhr, so schnell ich nur konnte, hinaus in den Canyon und die schmale, kurvige Straße hinauf, die vor unserem Haus auf seinen wackeligen Stelzen endet.
In der Küche untersuchte ich meine Knie auf Blutflecken. Obwohl ich keine fand, sprühte ich meine Hose zur Sicherheit mit Flecklöser ein. Oben zog ich dann alle meine Sachen aus und warf sie in den Wäschekorb.
Dann duschte ich eine kleine Ewigkeit lang – zuerst heiß und schließlich kalt.
Als ich neben Isabella ins Bett glitt, stöhnte sie leise und legte ihren Arm über meine Brust. Ihr Gesicht war ganz nahe an dem meinen, so daß ich ihren verschlafenen Atem riechen konnte. »Dein Herz klopft ja ganz stark«, flüsterte sie.
»Ja, wegen dir.«
Sie machte »hmm«, und ich wußte, was das bedeutete: ein kleines, zärtliches Lächeln huschte jetzt über ihr Gesicht, während sie bereits wieder in den Schlaf zurücksank, aus dem sie eben für ein paar Sekunden aufgewacht war.
»Es ist spät, R-R-Russ.«
»Ich habe nur noch ein paar Bierchen getrunken.«
»Hmm ...«
»Ich liebe dich, Isabella.«
»Ich dich auch.«
»Ich liebe dich wirklich, von ganzem Herzen.«
»Hmm. Du bist mein großer, starker Held.«
Mein Herz klopfte immer stärker. Ich erinnere mich noch, daß es lauter und immer lauter wurde, bis es mir wie das Geräusch von schweren Tritten vorkam, das mich hinübergeleitete in die Stille wirrer Träume.
Kapitel 3
Den nächsten Vormittag verbrachte ich auf der Polizeistation von Laguna Beach und wartete auf den Anruf. Obwohl Ambers Haus sich außerhalb der Stadtgrenze befand, war die Polizei von Laguna für Notrufe und Einbruchsmeldungen aus dieser Gegend zuständig. Um meine Anwesenheit in der Station zu rechtfertigen, schmierte ich dem Polizeichef Honig ums Maul, indem ich ihm Tips für ein Buch gab, das er schreiben wollte. Mitten in der Unterhaltung mußte ich aufs Klo und mich übergeben. Noch nie zuvor in meinem ganzen bisherigen Leben hatte ich vor lauter Ekel kotzen müssen.
Mein Bedürfnis, über das zu sprechen, was ich gesehen hatte – also quasi ein Geständnis abzulegen –, war so stark, daß es mir wie ein Schmerz vorkam, der in meiner Brust ein paar Zentimeter rechts vom Herzen saß. Auf einmal konnte ich verstehen, wie sich ein Täter bei einem Verhör fühlen muß. Und wie ich das verstehen konnte. Da sprach ich im Brustton der Überzeugung mit den Detectives über irgendein belangloses Thema – ich glaube, es war die andauernde Dürre in ganz Kalifornien –, und dabei wurde mir innerlich so schlecht, bis ich schließlich noch einmal auf die Toilette ging und mich übergeben mußte. Danach sprach ich noch mit einem Drogenfahnder, mit dem Wachhabenden, dem Mann in der Notrufzentrale und ein paar Politessen. Bei allen hatte ich das Gefühl, daß sie mich mißtrauisch beäugten.
Der Anruf wollte einfach nicht kommen. Kein Mord wurde aus der Ridgecrest Road, Hausnummer 1316, gemeldet. Es war ein ruhiger Vormittag, dafür, daß es der vierte Juli, der Nationalfeiertag, war. Vermutlich wartete ich vergeblich, dachte ich. Es konnten Tage vergehen, bis endlich jemand Ambers Leiche fand.
Außerdem war die Polizeistation von Laguna ohnehin nicht der richtige Platz für mich. Ich wollte viel lieber Marty Parish direkt in die Augen sehen, wenn er von der Sache erfuhr. Gegen Mittag konnte ich mich schließlich nicht mehr zurückhalten und fuhr zum Verwaltungsgebäude des County in Santa Ana, in dem auch der Sheriff mit seinen Leuten untergebracht ist.
Als ich in Martys Büro trat, saß er am Schreibtisch und schnitt sich die Fingernägel. Ich hatte mich also nicht getäuscht, er war auch am vierten Juli hier. Marty arbeitete immer an Feiertagen, denn da bekam er mit Zuschlägen fast doppelt soviel bezahlt wie üblich und außerdem einen zusätzlichen freien Tag, den er dann im Herbst, wenn die Jagdsaison eröffnet war, gut gebrauchen konnte.
Ich stellte meine Aktentasche vor ihm auf den Schreibtisch und nahm drei Schachteln mit nagelneuen Schrotpatronen heraus. »Die habe ich mir aus Versehen gekauft«, sagte ich und mußte dabei nicht einmal lügen. »Sind leider ein zu großes Kaliber für meine Flinte. Aber du kannst sie doch sicher für deine Browning gebrauchen. Ich schenke sie dir.«
Marty nickte und legte die Nagelschere weg. Dann stand er auf und gab mir die Hand. Seine blauen Augen waren leicht blutunterlaufen. Das linke Augenlid hing ein wenig weiter herab als das rechte, was seinem Gesicht einen Ausdruck leicht verschlafener Berechnung verlieh. Seine Haut war braun und wettergegerbt wie immer. Er war zweiundvierzig Jahre alt, sah aber aus wie Anfang Fünfzig.
Marty war der geborene Jäger. Er hatte hervorragende Augen, ein gutes Gehör und einen kräftigen, muskulösen Körper, den er erstaunlich schnell und wendig bewegen konnte. Er war ein ausgezeichneter Schütze, dem das exakte Berechnen von Entfernung und Geschoßbahn im Blut zu liegen schien. Vor Jahren, als wir noch zusammen auf die Jagd gingen, haben wir uns eines Tages jeweils gegenseitig eine Kühltruhe geschenkt und dann jedes Jahr einen Preis dafür ausgesetzt, welche von den beiden am Ende der Jagdsaison mit den meisten Vögeln gefüllt war. (Der Preis ging immer an Marty.) Parishs dicke Hände erinnerten mich mit ihren plumpen Fingern immer an einen Zimmermann, aber ich habe nie herausgefunden, ob er wirklich mit Hammer und Säge umgehen kann.
Die Tränensäcke unter Martys blutunterlaufenen blauen Augen waren dunkel und dick. Er mußte sich beim Rasieren geschnitten haben, denn aus einem kleinen, horizontalen Strich oberhalb seines Adamsapfels war etwas Blut auf den Kragen seines offenen Hemdes getropft. Sogar hier, im vollklimatisierten Gebäude der Countyverwaltung, war etwas von der Hitze des vierten Juli zu spüren.
»Wie geht es Isabella?«
»Gut. Sie ist stark.«
»Sie ist eine unglaubliche Frau. Eigentlich viel zu schade für dich.«
»Das sagt mir jeder.«
»Die Chemotherapie müßte doch schön langsam mal vorbei sein, oder?«
»Noch ein Zyklus, dann sehen wir weiter.«
»Ich bewundere dich, Russell. Du hast das alles wirklich gut durchgestanden.«
»Mir blieb gar keine andere Wahl.«
»Manche Burschen würden einfach aufgeben und sich aus dem Staub machen.«
»Ich nicht.«
Marty war immer schon zurückhaltend gewesen, und als Amber ihn vor vielen Jahren verlassen hatte, war er noch ruhiger geworden. Nur wenn er betrunken war oder sich extrem aufregte, konnte er ziemlich laut und überschwänglich werden. Ansonsten kam er den meisten Leuten – mich eingeschlossen – fast ein wenig langweilig vor. Aber auch wenn Marty Parish nicht ganz so schnell von Begriff war wie andere, brauchte man ihm nie etwas zweimal sagen. Manchmal kam es mir sogar so vor, als zeuge Martys brütendes, breitgesichtiges Schweigen von einem tieferen Verständnis der Welt. Martin Parish, davon war ich hundertprozentig überzeugt, war ein zutiefst moralischer Mann.
Nach der Scheidung von Amber heiratete er eine sehr hübsche Frau namens JoAnn, und diese Ehe hielt nun schon seit fast vierzehn Jahren. Sie hatten zwei Töchter, und Marty liebte seine Familie sehr. Vermutlich kam das daher, daß er in Bezug auf eheliche Untreue keinen Spaß verstand. Martin Parish war ein Familienmensch, aber er trank zuviel.
Jetzt deutete er auf einen Stuhl, und ich setzte mich. »Na, was gibt’s sonst noch so?«
Ich hielt mich zurück, obwohl meine Neugier fast übermächtig war. »Es geht um die Ellisons«, sagte ich. Es war wirklich seltsam und schrecklich zugleich, das gesehen zu haben, was ich gesehen hatte – und Marty, das wußte ich, hatte ja genau das gleiche gesehen –, und nicht ein einziges Wort darüber zu verlieren.
»Schlimme Sache«, sagte er.
»Haltet ihr das wirklich für einen Raubmord?«
»Es war einer. Zumindest war es am Anfang so geplant gewesen.«
»Wenn du meinst.«
»Nix ›wenn du meinst‹, Monroe. Ein Raubmord bleibt nun mal ein Raubmord, ganz gleich, was am Ende dabei herauskommt. Willst du mal die Tatortfotos sehen?«
»Ich dachte schon, du würdest mich niemals fragen.«
Er warf mir einen braunen Briefumschlag in den Schoß. Ich öffnete ihn.
Mr. und Mrs. Ellison – Cedrick und Shareen – waren sogar noch im Tod vereint. Shareen lag etwa in der Mitte ihres Schlafzimmers auf dem Holzboden. Eine ihrer Wangen war fest auf die Dielen gepreßt, und ihr Ehemann lag über ihr. Sie waren beide nackt. Irgendjemand hatte mit ihren Schädeln und Gesichtern dasselbe angestellt wie mit dem von Amber Mae Wilson. Ich spürte, wie mir der kalte Schweiß aufs Gesicht trat und die Ader an meiner Schläfe wieder zu klopfen begann.
Tatortfotos sind oft schlimmer als der Tatort selbst. Das liegt vielleicht an dem kleinen Maßstab, der das Grauen einerseits auf engstem Raum konzentriert und andererseits entpersonalisiert. Und dann hat man auch noch ständig das Gefühl, daß man ohne wirklichen Grund eine fürchterliche, traurige Intimsphäre verletzt. So seltsam es auch klingen mag, an einem wirklichen Tatort hat man – als Polizist zumindest – wenigstens das erleichternde Gefühl, daß man dort ist, um zu helfen. Bei diesen speziellen Bildern kam zu dem Grauen noch hinzu, daß man nicht richtig erkennen konnte, was nun Blut war und was nicht, denn die Ellisons waren beide schwarz, und ihre Hautfarbe hob sich nicht so gut von der des Blutes ab wie die von Weißen oder Asiaten. Ihre jungen, schlanken Körper waren so verdreht, daß sie auf eine gräßliche Weise sogar anmutig aussahen.
»Was meinst du? Ein Täter oder zwei?« fragte ich Marty.
»Zwei. Einer hätte ganz schön zu tun gehabt, den beiden fast gleichzeitig die Schädel einzuschlagen.«
»Gibt’s schon irgendwelche Beweise ... dafür, daß es ein Täter war und nicht zwei, meine ich.«
Marty sah mich finster an und nahm seine Nagelschere wieder zur Hand. Wir näherten uns jetzt einem seiner wunden Punkte, das wußten wir beide genau. Als ich meinen Job beim Sheriff aufgab, um reich und berühmt zu werden (ha, ha!), dachten Polizisten wie Marty, daß sie mir jetzt aus Prinzip keine Informationen mehr geben dürften. Es war immer dasselbe Spiel: Wenn sie einen Verdacht hatten, von dem sie nicht wollten, daß er in der Zeitung stand (schließlich arbeitete ich nebenbei für das Orange County Journal), versuchten sie, mich in eine andere Richtung zu lenken. Wenn ich etwas mit neunzigprozentiger Sicherheit wußte, dementierten sie es. Und wenn ich an der richtigen Sache dran war, versuchten sie, mich auf einen Holzweg zu schicken. Ein nettes Spiel.
Aber der Punkt, auf den wir beide jetzt wieder einmal in vollem Bewußtsein zusteuerten, war kein Teil dieses Spiels. Er war so ernst wie nur gerade irgendwas.
»Natürlich haben wir Beweise. Wir hocken nicht hier herum und saugen uns irgendwas aus den Fingern, verdammt noch mal!«
»Wenn es ein Raubmord war, was haben die Täter dann mitgenommen?«
»Das darf ich dir nicht sagen.«
»Wirklich nicht?«
»Wirklich nicht.«
»Und was ist mit den beiden Fernandez?«
»Was soll mit denen sein?«
»Kann ich mir von denen mal die Tatortfotos ansehen?«
Marty wußte genau, daß mir der stellvertretende Gerichtsmediziner die Fotos zeigen würde, wenn er es nicht tat.
Wir warfen uns gegenseitig die Umschläge mit den Fotos zu. Dann besah ich mir die Tatortfotos von Sid und Teresa Fernandez, beide sechsundzwanzig Jahre alt, denen man in ihrer Wohnung im Schlaf die Schädel eingeschlagen hatte. Das Bett war dabei kaum zerwühlt worden. Sid lag noch unter seiner Decke zusammengerollt wie ein Arbeiter nach einem langen, anstrengenden Tag in der Fabrik.
Fernandez war Autolackierer. Sein Schädel klaffte weit auf, und das meiste von dem, was vorher drin gewesen war, lag jetzt neben seinem Gesicht auf dem Kopfkissen. Teresa lag von Sid weggedreht neben ihm. Ihr Gesicht hing ebenso wie ihr rechter Arm über den Rand der Matratze, und der Inhalt ihres eingeschlagenen Schädels hatte sich auf dem Boden vor dem Bett verteilt. Es sah so aus, als wären in ihren Köpfen Dämonen herangewachsen, die dann von innen die Hirnschale gesprengt hatten und nach draußen gesprungen waren. Ich mußte unwillkürlich an Isabella denken und fragte mich, wie groß ihr Tumor jetzt wohl sein mochte. Vor dreizehn Monaten war er noch so groß wie ein Golfball gewesen. War das, was den Fernandez und den Ellisons passiert war, nicht doch ein viel besserer Weg zu sterben? Unerwartet und plötzlich, anstatt langsam, Zelle für Zelle, dahinzusiechen? Schon wieder brach mir der kalte Schweiß aus, und obwohl ich heute früh noch einmal geduscht hatte, stank ich wie ein Mann, der zuviel wußte.
»Und das war natürlich ein Einzeltäter«, sagte ich. »Das könnt ihr bestimmt beweisen.«
»Wir sichern lediglich die Spuren. Die Schlüsse daraus muß der Bezirksstaatsanwalt ziehen.«
»Du weichst mir aus.«
»Worauf willst du denn hinaus?«
»Auf einen Serientäter.«
»Zwei Morde machen noch keinen Serientäter. Du hoffst doch bloß auf Stoff für ein neues Buch, gib’s zu.«
»Betrachte die Sache doch mal so, Marty. Vier Menschen wird innerhalb eines Monats hier im County der Schädel eingeschlagen. Und zwar immer um Mitternacht herum. Beide Male kommt der Täter durch eine Schiebetür, die wegen der Hitze offensteht. Du sagst, bei den Ellisons sei es ein Raubmord gewesen, aber bisher ist nicht bekannt, was gestohlen wurde. Ich habe letzte Woche mit ein paar Leuten von der Spurensicherung gesprochen. Die haben in der Nachttischschublade eine vierzig Zentimeter lange Perlenkette gefunden.«
»Diesen Burschen sollte mal jemand ihre Plappermäuler stopfen.«
»Damit du mir dann weismachen kannst, daß es sich um einen Raubmord handelt? Mr. und Mrs. Fernandez wurden auf dieselbe Art umgebracht, aber bei denen sagst du nicht, daß es ein Raubmord war. Sieh dir den Ellison-Mord doch mal genauer an. Könnte es nicht so gewesen sein, daß der Mörder wie bei den Fernandez ins Schlafzimmer kam und erst ihm eins über den Schädel gab, um ihn auszuschalten. Dann aber wachte die Frau doch schneller auf, als er dachte, und rannte davon. Als sie schon fast ums Bett herum war, erwischte sie der Mörder schließlich doch und schlug auf sie ein. Inzwischen aber rappelte sich Mr. Ellison wieder auf und griff ihn von hinten an. Aber Ellison war nackt und noch ganz benommen vom ersten Schlag, und außerdem hatte er keine Waffe. Und so streckte ihn der Mörder direkt neben seiner Frau nieder.«
Auf einmal glaubte ich, direkt vor mir, auf dem Fußboden von Martys Büro Ambers Leiche liegen zu sehen. Sie schien mir so nahe, daß ich meinte, ihre Lippen noch einmal berühren zu können. Die Vorstellung schnürte mir die Kehle so stark zu, daß ich mich räuspern mußte, um sie wieder freizubekommen.
Marty schien es auch nicht viel besserzugehen als mir. Seine Augen hatten jenen matten Schimmer, der von zu wenig Schlaf herrührt. Und er starrte auf dieselbe Stelle am Boden wie ich auch. Ganz am Rande meines Bewußtseins, wo sich Angst und logisches Denken vermischen, spielte ich einen Augenblick lang mit dem Gedanken, daß Martin Albert Parish nicht nur Amber, sondern aus die Ellisons und Mr. und Mrs. Fernandez getötet haben könnte. Es war ein häßliches Konstrukt, eine von jenen Kopfgeburten, die das Herz, wenn sie langsam nach unten sinken, wie wild schlagen lassen. So, wie es auch schlägt, wenn man eine fürchterliche Wahrheit erfährt. Vom Polizisten zum Killer – der neue Tatsachenroman von Russell Monroe.
Gott im Himmel.
»Hast du vor, im Journal über diese Morde zu schreiben?«
»Bis jetzt noch nicht.«
»Vermutlich können die sich dich gar nicht mehr leisten.«
»Möglicherweise hast du ja recht, und diese Morde haben wirklich nichts miteinander zu tun.«
»Was willst du dann von mir?«
»Zeig mir die Beweise, die du hast.«
»Das kann ich nicht.«
»Wieso nicht? Weil du in Wirklichkeit gar keine hast?«
»Oh, wir haben welche, darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Und wenn wir die beiden Mordfälle miteinander in Verbindung bringen können, dann werden wir das auch tun, verlaß dich drauf. Wenn das der Fall ist, dann wirst du es schon noch früh genug erfahren, zusammen mit allen anderen Menschen hier im County. Aber ich schreie doch nicht Feuer, solange ich nicht weiß, ob es überhaupt brennt, verstehst du das, Monroe? Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Geschichten zu tun. Es gibt nun einmal eine Menge Spuren, die darauf hinweisen, daß wir es bei den Ellisons mit zwei, möglicherweise sogar drei Tätern zu tun haben und bei den Fernandez’ nur mit einem. Die Untersuchungen dauern noch an. Wir haben der Presse alles gesagt, was wir konnten. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir die Leute unnötig in Panik versetzen.«
»Aber es bringt noch viel weniger, sie bei dieser Hitze mit offenen Fenstern schlafen zu lassen, solange auch nur eine entfernte Möglichkeit besteht, daß da draußen vielleicht doch ein Serientäter sein Unwesen treibt.«
Marty Parishs wettergebräuntes Gesicht nahm eine kränkliche, graurosa Farbe an. Er blickte wieder auf die Stelle auf dem Boden, wo mir vorhin die tote Amber erschienen war. Langsam nahm er seine kleine Nagelschere in die Hand und fuhrwerkte damit an seinem linken Daumen herum.
»Mist«, sagte er und nahm den Daumen in den Mund. Offensichtlich hatte er sich geschnitten. »Danke für die Patronen, Russ. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammen auf die Wachteljagd gehen. Im Oktober habe ich ein paar Tage frei.« Damit wollte Marty mich wohl verabschieden, aber ich bewegte mich nicht. »Okay«, sagte ich. »Behalte deine Untersuchungsergebnisse für dich und vielen Dank für die kleine Peep-Show. Aber jetzt sei ehrlich zu mir: Glaubst du das, was du mir eben erzählt hast, tatsächlich, oder plapperst du nur die offiziellen Verlautbarungen des Herrn Sheriff nach?«
»Du kannst mich mal, Russ. Wenn du wirklich wissen willst, was hier beim Sheriff vor sich geht, hättest du nicht den Dienst quittieren dürfen.«
»Und was hast du bei den Morden für ein Gefühl?«
»In welcher Zeitung werde ich das morgen lesen können?«
»In keiner. Ich habe dich noch nie hingehängt, ebensowenig wie irgendeinen von deinen Leuten.«
»Erik Wald hast du hingehängt.«
»Der gehört nicht offiziell zum Sheriff.«
»Genausowenig wie du. Aber schön, ich will dir eines sagen, obwohl der Sheriff eigentlich über die Ellison- und Fernandez- Morde eine strikte Nachrichtensperre verhängt hat: Die Beweislage ist bei beiden Fällen vollkommen unterschiedlich – das ist die Wahrheit. Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Verbrechen und mit mindestens zwei verschiedenen Tätern zu tun und nicht mit ein und demselben. Aber ich will dir auch ganz ehrlich sagen, daß an keinem der beiden Tatorte etwas geklaut wurde.« Mir kam langsam die Idee, daß Marty ein komisches Spiel mit mir trieb und mich nur deshalb mit falschen Informationen fütterte, um mich auf eine falsche Fährte zu locken oder zumindest aus seinem Büro hinauszuexpedieren. Es kam mir auf einmal merkwürdig vor, daß unter den Tatortbildern, die er mir vorhin so großzügig gezeigt hatte, keine einzige Weitwinkelaufnahme gewesen war. Weder Gesamtaufnahmen der Zimmer noch Fotos von den Wänden. Alles, was ich zu sehen bekommen hatte, waren Nahaufnahmen der Leichen gewesen. Aus welchem Grund?
»Sonst hast du keine Informationen über den Täter, Marty?«
»Die Täter, Russ.«
»Na schön, meinetwegen. Dann über die Täter.«
»Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß.«
»Und wenn wieder so ein Mord passiert, wie kannst du dir dann noch ins Gesicht sehen?«
»Das war’s, Russ. Und wenn ich auch nur eine einzige Zeile über diese Sache lese, dann warst du das letzte Mal hier bei mir. Ist das klar?«
»Mach dir keine Sorgen.«
Ich stand auf. Marty untersuchte den Schnitt an seinem Daumen.
»Hast du eigentlich Amber in letzter Zeit mal wieder gesehen?« fragte ich.
Parish schüttelte den Kopf und vermied es, mich anzusehen. Das Telefon klingelte. Bevor Marty abhob, wischte er sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn.
Ich blieb noch einen Augenblick stehen, um mitzubekommen, von wem der Anruf war. Vielleicht war ja mittlerweile Ambers Leiche entdeckt worden.
»Hallo, Liebling«, sagte Marty.
Kapitel 4
Vom Autotelefon aus rief ich meine Redakteurin beim Journal an. Man sagt Autotelefonen ja immer nach, daß sie für Leute seien, die sich für wichtiger nehmen, als sie wirklich sind, aber außerdem sind sie geradezu ideal für Leute, die nicht dabei gesehen werden wollen, wenn sie gewisse Anrufe machen. So Anrufe wie den um null Uhr zweiundvierzig gestern nacht bei Amber und wie diesen hier.
Meine Redakteurin heißt Carla Dance und ist eine kleine, etwas dickliche Frau. Außerdem ist sie hochintelligent und bewahrt auch bei den chaotischsten Geschichten immer einen klaren Kopf. Immer, wenn ich in den vergangenen zehn Jahren knapp bei Kasse war, hatte Carla mir einen Auftrag zugeschanzt. Carlas Vater hat Krebs, und wenn Carla nicht gerade in der Redaktion ist, pflegt sie ihn. Als vor neunzehn Monaten der Tumor bei Isabella diagnostiziert wurde, ging ich mit Carla ein paar Nachmittage hintereinander in eine Bar in der Nähe der Redaktion, wo ich ihr mein Herz ausschüttete. Die vernünftige Art, mit der Carla an die Dinge heranging, war mir eine große Hilfe. Carla wußte damals schon, was ich mittlerweile auch erfahren habe: Wenn jemand, den man sehr liebt, an schlimmem Krebs leidet, überschreitet man als Angehöriger jeden Tag tausendmal im Zickzack die dünne Linie, die Hoffnung und Verzweiflung voneinander trennt. Und dieses Hin und Her kann einen richtig wahnsinnig machen. Es dauerte nicht lange, bis mir klarwurde, was für eine in sich geschlossene Gesellschaft wir darstellten. Wir – das sind diejenigen, die sich ständig um eine geliebte Person sorgen, die an Krebs erkrankt ist. Nach außen strahlen wir ungetrübten Optimismus aus, aber wenn wir unter uns sind, können wir voreinander zugeben, daß der von uns geliebte Mensch vielleicht nicht mehr annähernd so lange unter uns weilen wird, wie wir es gerne hätten. Hier, in dieser Gemeinschaft von hilflosen Helfern, brauchen wir uns deswegen nicht schwach und verzweifelt fühlen. Was uns verbindet, ist eine Art Schützengrabenmentalität und die Fähigkeit, einander jenen Trost zu spenden, den ich vor vielen Jahren einmal im Gebet gefunden habe.
»Möglicherweise habe ich eine tolle Geschichte für dich«, sagte ich zu Carla.
»Wenn sie nicht zu grausig ist, könnte ich sie mit in die Sonntagsbeilage nehmen, da bekommst du das meiste Geld.«
»Grausig ist die Geschichte schon. Und brutal. Sehr brutal sogar.«
»Richtig schlimm?«
»Ja.«
»Geht es um die Ellisons?«
Ich vergaß zu erwähnen, daß Carla außerdem einen sechsten Sinn für Nachrichten hat.
»Richtig.«
»Und was möchtest du schreiben?«
»Daß der Mörder wieder zuschlagen wird.«
»Wir müssen da sehr vorsichtig sein, Russ. Mit so einer Geschichte könnten wir leicht gewissen Minderheiten auf die Zehen treten.«
»Aber wenn du sie dir entgehen läßt, dann tritt dir dein Chefredakteur auf die Zehen.«
»Eins zu null für dich. Du kannst die Story schreiben.«
»Aber vorher müßtest du mir noch einmal Platz für einen Artikel über Dina geben. Er kann ruhig etwas weiter hinten im Blatt stehen.«
»Wieso denn schon wieder was über Dina?«
»Weil sie nächste Woche damit richtig loslegen wollen.« Dina war der Spitzname für den Apparat zur DNS-Analyse, den das gerichtsmedizinische Institut des County im letzten Jahr angeschafft hatte. Obwohl er achthunderttausend Dollar gekostet hatte, war mit seiner Hilfe bisher nicht ein einziger Täter überführt worden. Noch schlimmer als das war der Umstand, daß es bei den Strafverteidigern des County langsam in Mode kam, den »genetischen Fingerabdruck« als eine viel zu komplizierte und unausgereifte Prozedur zu brandmarken, für die es noch keine verbindlichen Standards gab. Zwei Urteile aus Orange County, die in den vergangenen sechs Monaten von höheren kalifornischen Gerichtshöfen aufgehoben worden waren, und ein Freispruch, den die Geschworenen aufgrund der von der Verteidigung vorgebrachten Zweifel gefällt hatten, hatten die Methode des genetischen Fingerabdrucks darüber hinaus ins Gerede gebracht. Dabei hätte Dina die Verbrechensbekämpfung im County revolutionieren sollen, aber ihre Vorschußlorbeeren waren verwelkt, noch bevor die Maschine auch nur ein einziges Mal ihre wahren Qualitäten hatte unter Beweis stellen können. Niemand im gerichtsmedizinischen Institut, beim Sheriff oder beim Bezirksstaatsanwalt hatte es bisher geschafft, die immer heftiger geäußerte Kritik an Dina zum Schweigen zu bringen.
Nächste Woche sollte Dina nun zum ersten Mal mit Erfolg vor Gericht zum Einsatz kommen, und zwar im Vergewaltigungsfall Ballard. Am Schluß dieses Prozesses würde nicht nur ein Urteil über den Angeklagten gefällt werden, sondern auch eines über Dina. Ein Dina-freundlicher Artikel von Russell Monroe im Journal konnte da vielleicht ein bißchen Stimmung für die Maschine machen. Für mich war dieser Artikel ein Pfund, mit dem ich wuchern konnte.
»Kann denn der Sheriff die Morde an den Ellisons mit denen an dem ersten Paar in Verbindung bringen?« fragte Carla. »Erst heute haben wir einen Artikel gebracht, in dem stand, daß er es nicht könne.«
»Können würde er schon, aber er will nicht.«
»Ach so ist das. Na schön, wenn dein Dina-Artikel dafür sorgt, daß wir es als erste Zeitung erfahren, wenn der Sheriff es sich anders überlegt, dann kannst du ihn von mir aus schreiben.«
»Danke.«
Carla sagte noch, ich solle auf mich aufpassen, und legte auf. Ich wußte, daß sie sich nicht nach Isabella erkundigen würde, und zwar aus demselben Grund, warum ich mich nicht nach ihrem Vater erkundigte: Das Thema Krebs war viel zu ernst, um darüber noch rasch am Ende eines geschäftlichen Anrufes zu reden, selbst wenn es sich bei diesem Anruf um etwas so Ernstes wie Mord gedreht hatte. Darüber sprachen wir bei anderen Gelegenheiten.
Als nächstes rief ich Marty Parishs Chef, Sheriff Dan Winters, an und schlug ihm einen Handel vor: Ich würde dafür sorgen, daß ein positiver Artikel über Dina erschien, wenn er mir dafür versprach, mich als ersten zu informieren, falls es beim ... (fast hätte ich »Nachtauge-Fall« gesagt) ... Mordfall Ellison etwas Neues gäbe.
Winters tat so, als wäre ich ein aufdringlicher Idiot, aber damit hatte ich ebenso gerechnet wie damit, daß er mein Angebot in Bausch und Bogen ablehnte. Ich hatte ihm ja auch nur einen Floh ins Ohr setzen wollen, nur das war der Zweck meines Anrufes gewesen. Außerdem erinnerte ich Winters dezent daran, daß ich mit meiner bescheidenen Berühmtheit (und meinen noch bescheideneren finanziellen Mitteln) vor zwei Jahren seine Wiederwahl zum Sheriff unterstützt hatte. Mittlerweile hatte sich die Presse ganz schön auf Dan eingeschossen: Die Gefängnisse waren überfüllt und die Verbrechensrate stieg, während die Mittel für die Ordnungshüter immer spärlicher flossen. Zu allem Überfluß liefen auch noch etliche Verfahren gegen seine Beamten wegen Übergriffen im Amt. Da mußte mein Angebot, endlich einmal etwas Positives über ihn zu schreiben, dem Politiker Dan Winters doch geradezu verlockend erscheinen, zumal es ihn ja auch nicht allzuviel kostete. Kein Wunder, daß er mir am Ende unseres Gesprächs versprach, daß er sich die Sache durch den Kopf gehen lassen werde.
Nachdem ich aufgelegt hatte, schaltete ich mein Gerät zum Abhören des Polizeifunks ein und wartete darauf, daß endlich die Leiche in Ambers Haus gemeldet würde. Ich habe mehrere dieser Geräte; zu Hause bei mir steht in jedem Zimmer eines. Diesen zweifelhaften Luxus leistete ich mir von dem Geld, das ich für die Filmrechte von Die Reise flußaufwärts bekommen hatte. In meiner Anfangszeit als Journalist ließ ich die Dinger buchstäblich die ganze Zeit über eingeschaltet, sogar wenn ich schlief. Isabella machte kurz nach unserer Hochzeit Schluß mit diesem Unfug. Weil ich viel lieber Isabellas sanft rauchiger Stimme zuhörte als irgendwelchen Beamten in der Notrufzentrale, die laufend irgendwelche codierten Anweisungen für Streifenwagen herunterbeteten, fiel es mir nicht schwer, diese Angewohnheit aufzugeben.
Es war jetzt schon halb sechs, und noch immer war die Nummer einhundertsiebenundachtzig, die im Behördencode das Auffinden einer Leiche bedeutete, nicht durchgegeben worden. Langsam wurde mir die Sache unheimlich.