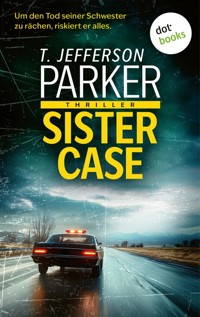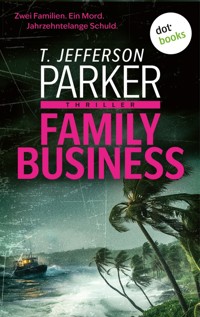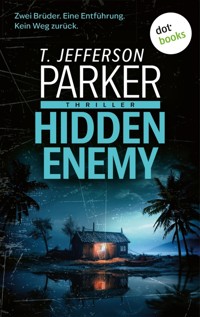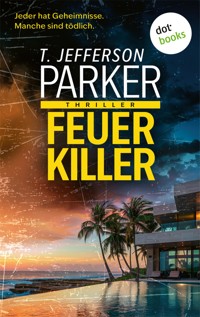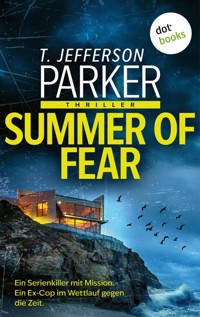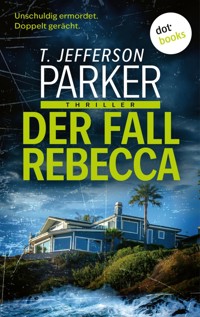2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Orange County Morde
- Sprache: Deutsch
Für die Wahrheit ist diese Ermittlerin bereit, alles zu riskieren … Zwei Schüsse. Eine tote Ehefrau. Ein Polizist, der um sein Überleben kämpft. Als die Frau von Deputy Archie Wildcraft ermordet aufgefunden wird und er selbst mit einem Kopfschuss schwer verletzt im Krankenhaus liegt, scheint der Fall klar: Archie hat seine Frau im Streit erschossen und wollte sich im Anschluss selbst töten. Doch Merci Rayborn, Kommissarin bei der L.A. Police, spürt, dass etwas nicht stimmt. Gegen den Widerstand ihrer Kollegen, die in Archie bereits den Täter sehen, kämpft sie für die Wahrheit. Dann flieht Archie aus dem Krankenhaus. Die meisten sehen darin sein Schuldgeständnis – aber Merci Rayborn ahnt, dass Archie selbst die die Jagd nach dem Täter aufgenommen hat. Sie folgt seiner Spur, die in L.A. dunkelste Ecken führt … »Parker hat nur einen Rivalen – Thomas Harris« Washington Post Fesselnde Krimispannung mit der taffsten Ermittlerin Kaliforniens – für Fans von Michael Connelly und Lee Child! Alle Bände der Reihe: Band 1: Dunkelstunde Band 2: Rote Schatten Band 3: Nachtspur Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwei Schüsse. Eine tote Ehefrau. Ein Polizist, der um sein Überleben kämpft. Als die Frau von Deputy Archie Wildcraft ermordet aufgefunden wird und er selbst mit einem Kopfschuss schwer verletzt im Krankenhaus liegt, scheint der Fall klar: Archie hat seine Frau im Streit erschossen und wollte sich im Anschluss selbst töten. Doch Merci Rayborn, Kommissarin bei der L.A. Police, spürt, dass etwas nicht stimmt. Gegen den Widerstand ihrer Kollegen, die in Archie bereits den Täter sehen, kämpft sie für die Wahrheit. Dann flieht Archie aus dem Krankenhaus. Die meisten sehen darin sein Schuldgeständnis – aber Merci Rayborn ahnt, dass Archie selbst die die Jagd nach dem Täter aufgenommen hat. Sie folgt seiner Spur, die in L.A. dunkelste Ecken führt …
eBook-Neuausgabe August 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »Black Water« bei Hyperion, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Schwarze Wasser« bei Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2022 by T. Jefferson Parker
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pixel Park; AdobeStock/sarun und Midjourney
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-98952-852-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
T. Jefferson Parker
Nachtspur
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Möllemann
Eins
Archie schaltete in den dritten Gang und legte seine Hand auf ihr Knie. Coast Highway, Richtung Süden. Der Mann im Mond fett und ganz nah, als neigte er den Kopf, um besser in das Cabrio hineinsehen zu können. Archie warf einen Blick nach oben, es war nicht zu erkennen, ob der Bursche lächelte oder die Stirn runzelte. Es war ihm auch egal, denn Gwens Haut fühlte sich warm an durch das Kleid, ein paar Grad wärmer als die Brise, die den Wagen durchströmte.
Er warf einen Blick auf den Tacho, dann schaute er sie an. Ihre Haare flatterten im Wind, und im roten Schein der Armaturenbrettbeleuchtung zeichneten sich die Umrisse ihres Gesichts ab. Sie lächelte ihn an, eine silbrige Sektflöte in der Hand.
Archie tat so, als hätte er sie nie zuvor gesehen. Tat so, als wollte er eigentlich etwas völlig anderes in Augenschein nehmen – etwa das Fischerboot weit draußen vor Crystal Cove in einer Pfütze aus weißem Licht –, nur um das Gefühl zu erleben, dass dieses Gwen-Geschöpf urplötzlich und wie ein Spezialeffekt in seinem Leben auftaucht. Und da war sie schon. Was hatte er für ein Glück!
Er schob den Saum ihres Kleids über die Knie und ließ seine Hand darunter gleiten. Sie lehnte sich ein wenig im Sitz zurück, er hörte, wie sie den Atem anhielt. Er schnupperte ihren Duft, vom Wind abgeschwächt, aber unverkennbar. Archie hatte eine gute Nase, und das, was sie ihm übermittelte, gefiel ihm. Gwens Geruch nach Milch und Orangenblüten war der Bass-Duft seines Lebens. All die anderen Duftnoten – der Küstensalbei und der Ozean, das Leder in seinem neuen Wagen – waren lediglich Begleitung.
Sie lächelte und warf den Plastiksektkelch in die Luft, der geräuschlos von der Nacht verschluckt wurde. Dann legte sie eine Hand auf seine, knöpfte das Baumwollkleid auf, bis es auseinanderfiel wie eine Tagesdecke, dabei fuhr sie mit einem Finger seinen Unterarm entlang bis zum Handgelenk.
»Noch ganz schön weit bis nach Hause, Archie.«
»Fünf lange Meilen.«
»Was für ein Abend. Es ist wunderbar, seine Freunde zusammenzubringen und zu sehen, dass sie sich verstehen.«
»Sie sind alle großartig. Priscilla hat eine Menge getrunken.«
»Deine Kollegen haben auch gut zugelangt. Danke, Archie. Das muss ein Vermögen gekostet haben.«
»Das war es mir wert. Schließlich wirst du nur einmal sechsundzwanzig. «
Gwens Locken flogen im Wind und sie zog seine Hand ein bisschen näher heran. Eine ganze Weile sagte sie nichts. »Sechsundzwanzig. Hab ich ein Glück. Liebst du mich auch noch, wenn ich sechsunddreißig bin? Und erst mit sechsundachtzig?«
»Klar doch.«
»Tut mir leid wegen vorhin.«
»Vergiss es einfach. Spielt keine Rolle. Meine verdammte Unbeherrschtheit.«
Sie lauschten dem Dröhnen des Motors, wussten, dass alles vergeben und vergessen war.
»Ich kann’s kaum erwarten, nach Hause zu kommen, Archie. Ich werde dich ordentlich rannehmen, schließlich ist heute mein Geburtstag. Ich hab doch noch Geburtstag, oder?«
»Noch ungefähr drei Minuten.«
»Hmmm. Dann fahr doch lieber rechts ran.«
Archie schaltete herunter und hielt Ausschau nach einer Abfahrt vom Highway. Es gab eine zum Strand, eine zum Campingplatz und eine weiter hinten am Getränkekiosk. Sie hatten sie alle schon ausprobiert. Es im Auto zu treiben, gehörte zu ihren heimlichen Vergnügungen. Dabei setzte sie sich mit dem Rücken zu ihm auf seinen Schoß. In der erhöhten Position wirkte sie wie eine Touristin, die nach irgendetwas Ausschau hielt, eine Hand auf der Armlehne, die andere auf das Armaturenbrett gestützt. Das Schöne an dem neuen Cabrio war, dass Archie abwechselnd Gwen und über ihren Kopf hinweg die Sterne betrachten konnte, während er seine Nase in ihrem Haar vergrub oder an ihrem Hals rieb und sich fragte, womit er sie eigentlich verdient hatte. Archie war zwar noch relativ jung, aber mit seinen dreißig Jahren hatte er immerhin begriffen, dass er absolut nichts geleistet hatte, um so eine Frau zu verdienen. Er hatte Schwein gehabt, so einfach war das.
»Da ist die Abfahrt«, sagte sie.
»Ich liebe dich«, erwiderte er.
»Ich liebe dich, Archie. Du wirst immer zu mir gehören, nicht wahr?«
Archie gab ihr keine Antwort, denn er wusste, dass das nicht als Frage gemeint war. Er bremste und lenkte den Wagen vom Highway in die Dunkelheit.
Vier Stunden später wurde Deputy Wildcraft durch ein lautes Geräusch im Wohnzimmer aus dem Schlaf gerissen.
Gwen hatte nichts davon mitbekommen, und Archie legte ihr eine Hand auf den Mund, als er sie weckte. Ihre Augen weiteten sich, als er ihr ins Ohr flüsterte, was er gehört hatte. Er schob sie aus dem Bett in Richtung Badezimmer, denn er hatte ihr immer eingeschärft, sich bei Gefahr dort zu verschanzen. Archie lauschte angestrengt in die Dunkelheit, doch es war nichts zu hören, weder im Wohnzimmer noch sonst wo im Haus.
Er sah zu, wie Gwen ihren neuen roten Bademantel vom Boden aufhob und leise im Bad verschwand. Archie holte seinen 9-mm-Selbstlader unter dem Bett hervor und legte ihn auf das Kissen. Er zog sich seine Unterhose an – Boxershorts mit der Aufschrift: »Viel Glück zum Geburtstag, ich gehöre dir« und einer neckischen roten Schleife über dem Eingriff. Gwen hatte sich darüber kaputtgelacht. Er auch, und dann hatten sie sich noch einmal geliebt und waren verschwitzt in den zerwühlten Laken eingeschlafen.
Er schlüpfte in seinen Bademantel und nahm die Waffe in die Hand. Unter der Badezimmertür war ein schmaler Lichtstreifen zu sehen. Archie öffnete die Tür, drückte Gwen das Telefon in die Hand und flüsterte: Keine Sorge, wenn das ein Einbrecher ist, hat er sich das falsche Haus ausgesucht, vielleicht wars ja auch nur ein Vogel, der gegen die Scheibe geflogen ist, falls was schief geht, ruf 911 an, aber zuerst will ich mich umsehen.
Ich ruf lieber sofort an, Archie.
Erst wenn ich’s dir sage. Mach das Licht aus, die Zweiundzwanziger liegt unter dem Waschbecken, das Magazin ist voll und eine Kugel ist im Lauf, die Entsicherung ist neben dem Abzugshahn, drück drauf, bis das Rote zum Vorschein kommt.
Sei vorsichtig.
Ich pass schon auf.
Archie nahm die Taschenlampe und trat in den Flur. Auf dem Teppichboden machten seine nackten Füße kaum ein Geräusch. Am Ende des Flurs neben dem Eingang zum Wohnzimmer befand sich ein Lichtschalter. Er schaltete das Licht ein, blieb in der Tür stehen und suchte über seine Automatik hinweg den Raum ab – von rechts nach links und wieder zurück: Wand, Sofa, die Jalousie mit einem großen Loch in der Mitte, Sessel, Wand mit Gemälde, Gwens Geburtstagsgeschenke auf dem Boden.
Er warf einen Blick auf den großen Stein, der mitten im Zimmer auf dem Teppichboden lag. So groß wie eine Pampelmuse. Er sah die Glasscherben, die neben der gläsernen Schiebetür funkelten. Sah, wo die hölzerne Jalousie gesplittert war, die der Stein durchschlagen hatte. Er löschte das Licht und lauschte. Der Kühlschrank brummte und in der Ferne war Straßenverkehr zu hören.
Archie schlich in die Küche und schaltete auch hier das Licht ein. Alles war unverändert, auch die Sitzecke mit dem Fernseher und dem Kamin, nur die Digitaluhr des Videorekorders leuchtete. 4:28 Uhr.
Er sah in der Toilette und im Wäscheraum nach. Ging zurück ins Wohnzimmer und richtete den Strahl der Taschenlampe auf den Stein. Wie ein abgerundeter Würfel, rot und glatt, durchzogen von transparenten Marmorschichten, die aussahen wie Fett. Gneis, dachte Archie, mit Quarzadern. Nichts Besonderes.
Er fragte sich, wer so etwas Kindisches und Vandalisches getan haben mochte. Wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen, die keinen Schimmer hatten, wer hier überhaupt wohnte, die einfach irgendwas zerstören, ihr Werk auf Video aufzeichnen und anschließend damit angeben wollten. Oder vielleicht irgendein Ganove, den er im Gefängnis von Orange County ein bisschen zu hart angepackt hatte, als er vor acht Jahren in den Polizeidienst eingetreten war. Polizisten machten sich täglich Feinde, Archie war da keine Ausnahme. Sie fielen ihm alle ein, aber niemand im Besonderen. Die Jungs im Labor würden den Stein auf Fingerabdrücke untersuchen.
All das raste Archie durch den Kopf, als er die Haustür entriegelte, hinausschlüpfte und die Tür leise wieder hinter sich schloss.
Der Mond war verschwunden. Archie schaltete seine Taschenlampe ein und suchte die Veranda und die Büsche ab. Ein plötzliches Geräusch im Laub ließ Archie zusammenzucken – ein Kaninchen. Er ging weiter bis zum Gartenweg, der von chinesischen Flammenbäumen, gelbem Hibiskus und Strelitzien gesäumt wurde. Die herunterhängenden Zweige der Flammenbäume bildeten einen Tunnel. Archie folgte dem Weg bis hinter das Haus, die Taschenlampe in der linken Hand, die Neunmillimeter in der rechten.
Dann weiter um den Swimmingpool herum. Die Wasseroberfläche glänzte wie ein Spiegel, und zum millionsten Mal sagte sich Archie, in was für einem wunderschönen Haus sie jetzt lebten, das groß war, aber voller Charme, auf einem doppelten Baugrundstück in den Hügeln mit diesem Pool und einer Garage für drei Autos und fünfzehn Meter hohen Palmen, die die Auffahrt säumten. Ein Zimmer extra für die Betrachtungssteine, ein Zimmer für Gwens Musik. Und ein Zimmer für das Baby, das sie vielleicht irgendwann haben würden.
Er ging weiter den gewundenen Gartenweg entlang bis zu der Glasschiebetür, durch die der Stein geworfen worden war. Im Strahl der Taschenlampe konnte Archie das große gezackte Loch und die schimmernden Risse in der Scheibe erkennen. Er sah keine Fußabdrücke und auch kein niedergetretenes Gras.
Er blieb reglos stehen und lauschte, schaltete die Lampe aus. Er hatte keinen Wagen wegfahren hören. Jugendliche, dachte er wieder. Wahrscheinlich hatten sie den Stein geworfen, waren kichernd entlang des Zauns auf der Westseite abgehauen, an der Ecke zurückgeklettert und den Hügel hinuntergerannt, noch bevor er Gwen ins Badezimmer bugsiert hatte. Er stellte sich vor, wie sie im Morgenmantel im kalten Licht dastand, die Haare ganz zerzaust, und ängstlich wie ein Vogel auf jedes noch so kleine Geräusch lauschte, während die Zweiundzwanziger vermutlich immer noch im Schrank unter dem Waschbecken lag, weil sie Waffen nicht ausstehen konnte. Und er musste daran denken, dass er sich auf der Party mal wieder wie ein eifersüchtiges kleines Arschloch aufgeführt hatte. Seit acht Jahren waren sie nun verheiratet, und noch immer schwoll ihm der Kamm, wenn seine Freunde Gwen umarmten und küssten.
Sie fehlte ihm. Er fragte sich, was zum Teufel er hier draußen eigentlich zu suchen hatte – in seinen Geburtstagsshorts mit einer Waffe in der Hand, während seine Frau dreißig Meter weiter in einem verschlossenen Badezimmer vor Angst zitterte.
Er drehte sich um und ging den Weg zurück. Am Pool vorbei. Durch den Tunnel der Flammenbäume. Plötzlich schoss ihm ein greller Lichtstrahl in die Augen, und bevor er den Schalter der Taschenlampe fand, war es zu spät.
Direkt vor und über ihm eine rote Explosion.
Gleißend weißes Licht, und Archie sah sich selbst, wie er da hineinflog, ein Käfer im Universum, ein Mann auf dem Weg nach Hause.
Zwei
Sergeant Merci Rayborn nickte den beiden Deputys zu, die an der Eingangstür des Wildcraft-Hauses standen. Einer der beiden überreichte ihr eine Liste, in die sich jeder vor Betreten des Hauses einzutragen hatte, und sie unterschrieb nach einem Blick auf die Uhr. Sie war groß und hatte ihre dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der sich über die orangefarbenen Buchstaben hinten auf ihrem Anorak hochschob, während sie sich eintrug, und wieder senkte, als sie das Klemmbrett zurückgab.
»Welche Leute waren zuerst hier und wo sind sie jetzt?«»Crowder und Dobbs, Sergeant. Ich glaube, in der Küche.« Der andere Uniformierte schaute wortlos an ihr vorbei.
In der Diele blieb sie stehen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Der Geruch von Möbelwachs und Holz. Blumenduft. Stimmengemurmel. Sie betrachtete den Spiegel in der Diele, die Wohnzimmermöbel, den Teppichboden. Sie sah das Loch in der lalousie, das ein Loch in der Glasscheibe dahinter vermuten ließ, und den Stein von der Größe eines Babykopfs, der mitten im Zimmer lag. Den kleinen Stapel mit Geschenkeschachteln. Keine Alarmanlage – die befand sich vielleicht in der Küche.
»Merci.«
Paul Zamorra kam auf sie zu. Leichtfüßig, aber schweren Herzens, dachte Merci. Er bewegte sich mit der höflichen Bedächtigkeit eines Leichenbestatters. Und dazu trug er den passenden schwarzen Anzug.
Sie wandte sich zu ihrem Partner um. »Hallo, Paul. Kennst du diesen Mann?«
»Nicht gut. Ich erinnere mich an sein freundliches Gesicht. Wir haben ab und zu ein paar Worte gewechselt.«
»Wildcraft. Bestimmt hab ich auch schon mal mit ihm gesprochen.«
Eigentlich war sie sich dessen gar nicht so sicher. Ihre Kollegen im Department ließen sich einteilen in Leute, die guthießen, was Merci Rayborn getan hatte, und die, die es ihr übel nahmen. Eine Meinung dazu hatte jeder. Einige Deputys redeten nicht mehr mit ihr, und sie redete auch nicht mit ihnen, außer wenn es sich nicht vermeiden ließ. Das schmerzte Merci zutiefst, als würden sich die beiden Hälften ihres Herzens gegenseitig verabscheuen. Mittlerweile misstraute sie allen Meinungen, selbst ihrer eigenen.
Aber Deputy 2 Archie Wildcraft? Sie konnte sich lediglich an seinen ungewöhnlichen Namen erinnern. Jetzt lag er im Krankenhaus mit mindestens einer Schusswunde im Kopf und wenig Überlebenschancen.
»Seine Frau ist das andere Opfer, Merci. Gwen Wildcraft. Sie ist im Badezimmer.«
Merci ging voraus den Flur entlang, registrierte die Schwarzweißfotos des Yosemite-Parks in Rahmen aus gebürstetem Edelstahl, die Strahler, die die Fotos erst richtig zur Geltung brachten. Am Raumthermostat blieb sie stehen und stellte fest, dass er auf einundzwanzig Grad eingestellt war. Sie ging an einem weiteren Deputy vorbei in ein riesiges Schlafzimmer mit einer doppelten, verglasten Terrassentür und hauchdünnen Vorhängen. Ein breites Schlittenbett mit zerwühlten Decken. Der Geruch nach Parfüm und Menschen.
Die Badezimmertür stand offen. Der Türrahmen war gesplittert und das Schloss baumelte nur noch an zwei Schrauben. Merci beugte sich über das Absperrband und schaute hinein.
Hier schlugen ihr ganz andere Gerüche entgegen – der scharfe Geruch nach verbranntem Pulver und irgendetwas schwach Metallisches und Süßliches. Gwen Wildcraft lag neben der Toilette rücklings auf dem Boden, den Kopf in einem unnatürlichen Winkel an die Wand gelehnt. Augen geschlossen, Mund geöffnet, Arme und Beine ausgestreckt. Bekleidet war die Tote mit einem dunkelroten Morgenmantel in beinahe der gleichen Farbe wie das Blut an der Wand, auf dem Fußboden, der Duschtür, der Kommode und dem Spiegel. Blut lief ihr aus Nase und Mund. Im Waschbecken rechts neben Gwen lag ein Handy.
Das hier war Rayborns siebenundsechzigster Mordfall als Ermittlerin im Orange County Sheriff Department. Zum siebenundsechzigsten Mal befahl sie sich, zu sehen statt zu fühlen. Zu denken statt zu fühlen. Zu arbeiten statt zu fühlen. Aber nicht zum ersten Mal in ihrem Leben sagte sich Merci, dass sie nicht mehr hinsehen mochte.
»Lass uns Crowder und Dobbs herholen.«
»In Ordnung«, erwiderte Zamorra.
Sie standen zu viert in der Essnische. Bei einem Blick in die Küche bemerkte Merci die volle Kanne auf der Warmhalteplatte der noch eingeschalteten Kaffeemaschine. Der Kaffee war unberührt. Eine Zeitschaltuhr, dachte sie, wie selbstverständlich darauf programmiert, Kaffee zu machen, den Archie und Gwen Wildcraft nicht mehr trinken würden. Ein Durchschlag voller Apfelsinen stand auf der Anrichte, und an einem geschnitzten Holzständer hing ein Bündel unreifer Bananen. Wie so oft kam ihr das Wort Verschwendung in den Sinn.
Crowder war ein massiger, grauhaariger Mann mit einem strengen Fünfziger-Jahre-Bürstenschnitt. Er erinnerte Merci an einen Mann, den sie vor vielen Jahren einmal geliebt hatte – genau gesagt vor drei Jahren. Crowder musterte sie, als sie einen neuen blauen Notizblock und ihren Füller hervorholte, und sie fragte sich, ob auch er gegen sie eingenommen war.
»Wir waren gerade in Moulton und wollten einen Kaffee trinken. Über Funk kam die Meldung von einer möglichen Schießerei in Hunter Ranch. Es war zwar kein Notruf über 911, aber wir sind trotzdem hingefahren. Es war zehn nach fünf. Wir sind ohne Sirene hergefahren. Ist ja ein anständiges Viertel hier und wir hatten schließlich keinen Notruf erhalten. Um vierzehn nach fünf sind wir hier angekommen. Von außen war am Haus nichts Auffälliges zu entdecken. Niemand war zu sehen, keine Nachbarn, gar nichts. In ein paar Zimmern brannte Licht.«
»Außen auch?«
»Nein.«
»In der Auffahrt?«
»Nein.«
Sie fragte deshalb so genau nach, weil zwei Scheinwerfer eingeschaltet gewesen waren, als sie die Auffahrt der Wildcrafts hinaufgegangen war. Das war kurz nach sechs gewesen, kurz vor Sonnenaufgang.
Merci machte sich Notizen in verschnörkelter Kurzschrift, die Themen unterteilt durch Schrägstriche, wie Gedichtzeilen, die in einer Rezension zitiert wurden. ÜP bedeutete überprüfen, immer in Großbuchstaben und unterstrichen, manchmal eingekreist, wenn ihr die Frage besonders wichtig schien. Sie schrieb: Auffahrtlicht BewMel? ÜB/, dann schaute sie Zamorra an.
»Paul, wie viele Autos standen in der Auffahrt, als du angekommen bist?«
»Vier.«
»Lass uns den Boden ansehen, auf dem keine stehen, bevor wir hier verschwinden. Der Beton ist ziemlich frisch, er könnte Spuren aufweisen. Kümmer dich darum, dass die Tatortspezialisten ihn untersuchen, bevor die ganze Mannschaft wieder aufbricht.«
»In Ordnung.«
Crowder schaute aus einem der Kreuzsprossenfenster in der Essecke. Merci folgte seinem Blick auf einen riesigen ein- gezäunten Garten, die Terrasse und die Orangenbäume; das Licht dieses Augustmorgens ließ alle Farben deutlich hervortreten.
Dobbs seufzte kurz auf. Er war jung, hatte ein energisches Kinn, muskulöse Arme, die sein grünes Uniformhemd gut ausfüllten, und ein glattes rötliches Gesicht. »Es war so: Nachdem wir Archie auf der anderen Seite des Hauses gefunden hatten, haben wir sofort Verstärkung angefordert und den Notarzt gerufen. Dann haben wir das Haus durchsucht und die Frau im Bad entdeckt. Anschließend haben wir den Tatort mit Absperrband gesichert. Mittlerweile war die Auffahrt voller Fahrzeuge, frischer Beton hin oder her.«
Merci schaute ihn durchdringend an. »Denken Sie das nächste Mal nach, bevor Sie einen Parkplatz freigeben.«
Dobbs wandte sich ab.
»Wie auch immer«, sagte Crowder. »Wir haben geklingelt, aber niemand hat sich gemeldet. Die Verandabeleuchtung war ausgeschaltet, aber drinnen brannte Licht. Also sind wir ums Haus herumgegangen, um nachzusehen. Wildcraft lag hinter dem Haus rücklings auf dem Weg mit einer blutenden Kopfwunde, aber er atmete noch. Er hatte einen Morgenmantel an, neben ihm lag eine Schusswaffe. Dann haben wir, wie Dobbs schon gesagt hat, Verstärkung angefordert, sind ins Haus gegangen und haben seine Frau entdeckt. Ich habe zwei Fußabdrücke und einen Knieabdruck irgendwo im Bad hinterlassen. Na ja, ich habe ihren Puls gefühlt, aber da war nichts mehr.«
»War das Licht im Bad an, als Sie reingegangen sind?«
»Ja«, erwiderte Crowder. »Und es roch noch nach Schießpulver.«
In der Essnische roch Merci nichts davon, nur den leichten Duft nach Holzpolitur und Kaffee.
»Ist Ihnen auf Ihrer Fahrt hierher irgendetwas aufgefallen?«, fragte Zamorra.
Dobbs verschränkte seine kräftigen Arme. »Ja, Sir. Als wir hier hochfuhren, ist ein schwarzer, relativ neuer Cadillac auf der Jacaranda Street in Richtung Norden abgebogen. In so einem Viertel ist diese Art Auto nichts Ungewöhnliches, allerdings war es kurz nach fünf am Morgen. Zwei weiße Männer – Anfang, Mitte dreißig, plus oder minus fünf. An der Kreuzung steht eine Straßenlaterne, aber sie leuchtet nicht sehr hell.«
»Konnten Sie die Gesichter sehen?«
»Nur sehr kurz, Sir. Der Beifahrer war dunkelhaarig, hatte einen Bart, ein breites Gesicht und eine dicke schwarze Brille auf der Nase – also ich meine, das Gestell war schwarz und dick. Schwergewichtig, dachte ich so bei mir. Der Fahrer war blond, und ich dachte: Geschäftsmann. Ich meine, das waren nur kurze Eindrücke, Sir, bloß ... Momentaufnahmen. Aber sie sahen beide eher ungewöhnlich aus.«
»Inwiefern?«, fragte Merci.
Dobbs reagierte nicht auf sie, redete nur mit Zamorra.
»Ungewöhnliche Gesichtszüge.«
»Was meinen Sie damit?«, wollte Zamorra wissen.
»Na ja, Sie wissen schon, so wie man auf der Strandpromenade unten in Laguna sofort die Touristen aus anderen Ländern erkennt. Allein die Gesichter und die Art, wie sie sprechen. Ich hab mal in einer Zeitschrift gelesen, dass das daran liegt, dass bei unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Gesichtsmuskeln für die Aussprache gebraucht werden. Na, Sie wissen schon, so wie sich das Gesicht eines Franzosen von dem eines Amerikaners unterscheidet, weil er andere Gesichtsmuskeln zum Sprechen benutzt.«
»Es waren also Franzosen?«, fragte Zamorra mit der Andeutung eines Lächelns.
Dobbs lachte in sich hinein. »Das kann ich nicht sagen, Sir.«
»Was vermuten Sie denn?«, fragte Merci.
»Bei den wenigen Anhaltspunkten möchte ich lieber nichts vermuten«, erwiderte Dobbs und sah Merci schließlich an. »Das wäre zwecklos.«
Merci spürte, wie die Wut in ihr hochstieg. Auch nach siebenunddreißig Jahren vergeblicher Mühe gelang es ihr immer noch nicht, das zu verhindern, aber immerhin hatte sie gelernt, ihre Wut im Zaum zu halten, indem sie sie in Gedanken verpackte. Was manchmal ganz amüsant war. In Bezug auf Dobbs und seine herablassende Art dachte sie nur: Unter die Guillotine mit ihm.
»Wo Sie doch so viel Wert auf Zweck legen, Dobbs, welchen Zweck haben Sie denn damit verfolgt, Ihren Wagen in der Auffahrt eines Tatorts zu parken und auch nichts dagegen zu unternehmen, dass alle anderen ebenfalls ihre Fahrzeuge dort abstellen?«
Es war nicht nett, darauf herumzureiten, aber irgendwas musste sie sagen, es war ihr mehr oder weniger herausgerutscht. Es sah ihr ähnlich, sich an etwas festzubeißen. Wenn Dobbs ihr übel nahm, was sie getan hatte, dann sollte das umso mehr Grund für ihn sein, sich ins Zeug zu legen, Fehler zu vermeiden und seine Arbeit zu tun. Das war jedenfalls Mercis Meinung.
»Hören Sie, Sergeant Rayborn«, sagte Crowder. »Das nehme ich auf meine Kappe. Der Beton ist mir aufgefallen, aber ich hab gedacht, das ist bestimmt mal wieder ein Fehlalarm wegen eines Feuerwerkskörpers oder einer Fehlzündung. Ich hätte etwas sagen sollen. Aber ich habe ihn einfach parken lassen, wo er wollte. Bis uns klar war, was sich hier abgespielt hat, waren die Kollegen und der Notarztwagen schon da. Und wir waren im Badezimmer.«
»Verstehe«, erwiderte Merci.
Sie ging um den zierlichen kleinen Esstisch herum, baute sich vor Dobbs auf und sah ihm direkt in die Augen. Genüsslich nahm sie seine Unsicherheit wahr.
»Ich hätte vielleicht auch dort geparkt«, sagte sie. »Die Auffahrt interessiert mich nicht. Vergessen Sie’s. Was mich interessiert, ist, dass Sie Ihre Kollegen mit Respekt behandeln und nicht wie lästige Schmeißfliegen. Es heißt immer noch wir und die anderen, Deputy. Wenn Sie mich nicht leiden können, kein Problem. Wenn Ihnen nicht passt, was ich getan habe, bitte sehr. Aber behalten Sie es gefälligst für sich, dann können wir alle besser arbeiten. Sie haben Gwen und Archie gesehen. Ich denke, wir haben größere Probleme als unsere persönlichen Animositäten. Was meinen Sie, Deputy?«
»Sie haben Recht, Sergeant«, erwiderte Dobbs.
Dobbs’ Antwort klang schon weniger feindselig. Mehr konnte sie nicht erwarten. Seit sie ihr geliebtes Department vor einem Jahr öffentlich bloßgestellt hatte, hielt sie sich weitgehend zurück. Sie hatte unter Eid die Wahrheit ausgesagt. Danach hatte sie nicht mehr viel zu sagen und niemanden, dem sie es sagen wollte. Und sie hatte festgestellt, dass Schweigen den Feind in Verwirrung brachte.
Aber wenn es so weit kam, dass ein Untergebener sie vor Kollegen herabzusetzen versuchte, dann konnte sie sich das nicht bieten lassen. Es war nicht das erste Mal, dass das passierte. Im Verlauf des vergangenen Jahres hatte sie gelernt, dass Konfrontationen wie Frisuren waren – es gab gute und schlechte, aber an der grundlegenden Wahrheit konnten sie alle nichts ändern. Und die grundlegende Wahrheit war, dass es eine Menge Leute im Department gab, die das, was sie getan hatte, niemals vergessen und auch niemals vergeben würden.
Wenn der Mann also jetzt ein wenig zurücksteckte, reichte ihr das.
»Danke«, sagte sie.
»Mir geht das hier ziemlich an die Nieren, Sergeant. Archie war zwar kein enger Freund von mir, aber ich habe ihn gemocht. Er war ein netter Kerl.«
»Dann lassen Sie uns zusammenarbeiten und das Schwein, das ihm das angetan hat, auf den elektrischen Stuhl bringen.«
»Ja.«
»Also noch mal – Franzose, Deutscher, Litauer, Kroate, Russe, Finne oder Däne? Ich bin sicher, dass jeder Polizist in Orange County das morgens um fünf unter einer trüben Straßenlaterne innerhalb von zwei Sekunden feststellen könnte.«
Dobbs lächelte, aber errötete leicht. Merci wandte sich grinsend ab.
»So, Leute«, sagte sie. »Lassen Sie das Fahrzeug im ganzen County zur Fahndung ausschreiben. Nur über das Sheriffs Department. Sie sollen nur die Computer und nicht den Funk benutzen, denn Sergeant Rayborn will keine neugierigen Gaffer haben. Die haben zwar eine Stunde Vorsprung, aber einen Versuch ist es wert. Wenn es Touristen sind, hängen sie vielleicht irgendwo in unserem berüchtigten Verkehr fest.«
»Alles klar«, antwortete Dobbs.
»Anschließend bringen Sie mir den Nachbarn, der angerufen hat. Wenn er nicht herkommen will, sagen Sie ihm, ich werde sehr bald und sehr laut an seine Tür klopfen. Auf dem Rückweg sollte einer von Ihnen die Schritte von dort bis hierher zählen.«
In ihr kleines blaues Notizbuch – blau, weil der Mann, der ihr beigebracht hatte, wie man als Detective in der Mordkommission arbeitete, ebenfalls ein blaues benutzt und sie ihn geliebt hatte – kritzelte sie den Namen und die Adresse des Anrufers, der berichtet hatte, Schüsse gehört zu haben, riss die Seite heraus und reichte sie Dobbs.
»Horchen Sie ihn auf dem Weg hierher ruhig schon mal ein bisschen aus.«
Dobbs schien zu begreifen, dass sie ihm einen Vertrauensvorschuss gab und ihn ermutigte, den Zeugen informell zu befragen. Bei dem Gedanken daran, was der muskulöse, aber nicht sonderlich helle Dobbs bei seinem informellen Verhör herausfinden würde, legte sich ihre Stirn in Falten. Aber die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass zwei Versionen aus dem Munde desselben Zeugen besser waren als eine, weil Widersprüche sofort ins Auge fielen.
Dobbs nickte und machte sich mit Crowder auf den Weg. An der Eingangstür blieben sie stehen, um den Bezirksstaatsanwalt Clay Brenkus und einen seiner Ermittler, Ryan Dawes, eintreten zu lassen.
Merci musste schlucken und hoffte, dass ihr Blutdruck nicht verrücktspielen würde. Dawes war der aggressivste und beste Ankläger der Staatanwaltschaft, seine Erfolgsquote betrug sechsundneunzig Prozent. Er war Mitte dreißig und sah gut aus, zumindest nach den Standards von Männermagazinen, dachte Merci. Ein »Extrem«sportler, was immer das sein mochte, Rocksurfing oder Sky Skiing oder etwas in der Art. Sein Spitzname war Jaws und darauf war er stolz. Er war der Einzige in der Bezirksanwaltschaft, der sich öffentlich geäußert hatte, als Merci vor weniger als einem Jahr die berufliche und persönliche Hölle durchgemacht hatte. Jaws hatte gegenüber dem Orange County Journal die Meinung vertreten, Merci habe sich nur wichtigmachen wollen, und ihr Verhalten als »Schande« bezeichnet.
Rayborn und Zamorra sahen zu, wie die Spurensucher Videoaufnahmen und Fotos von Gwen Wildcraft und vom Tatort machten. Die Gerichtsmediziner packten ihr Thermometer wieder ein und stülpten durchsichtige Plastikbeutel über die Hände, die Füße und den Kopf des Opfers. Danach waren die Spurensucher wieder an der Reihe, maßen den Abstand der Leiche zur Wand, zur Tür, zur Badewanne, etc. Ächzend und fluchend mühten sich dann vier Kollegen auf dem vom Blut schlüpfrigen Boden ab, die Leiche in einen Plastiksack zu verstauen. Merci entdeckte an Gwen zwei kleine runde Wunden – eine am Haaransatz, direkt über der linken Schläfe, die andere direkt unter ihrer linken Brust.
Sie empfand zugleich Abscheu und Mitleid für die menschliche Gattung. Sie stellte sich eine rosafarbene Casita an einem weißen Strand in Mexiko vor. Sie war noch nie an einem solchen Ort gewesen, aber es gefiel ihr, ihn sich auszumalen. Jetzt hatte sie das Bild genau vor Augen. Sie sah ihren Sohn, von dem sie sich vor weniger als einer Stunde verabschiedet hatte, neben dem rosafarbenen Haus glücklich im Meer planschen. Sie beobachtete, wie der Verlobungsring an Gwens Finger, ein kleiner Diamant in Rubine gefasst, mitsamt ihrem Arm in dem Plastiksack verschwand.
»Rektale Temperatur sechsunddreißig Grad, Sergeant Rayborn«, sagte der Gerichtsmediziner.
»Dann ist sie weniger als eine Stunde tot.«
»Vielleicht länger, wenn sie eine hohe Körpertemperatur hatte.«
Ein Spurensucher, mit dem Merci bisher noch nicht zusammengearbeitet hatte, überreichte ihr zwei kleine durchsichtige Spurensicherungsbeutel. Jeder enthielt eine leere Patronenhülse – offenbar Kaliber neun Millimeter. Auf dem einen Beutel stand »1«, auf dem anderen »2«. Der Mann starrte auf die Beutel, als er sie ihr übergab. Die Aufschrift am Boden der Hülsen bestätigte ihre Vermutung: S&W 9 mm.
»Ich habe die Lage der Hülsen auf den Fußbodenfliesen mit eingekreisten schwarzen Ziffern und die Richtung der Öffnungen mit Pfeilen markiert. Damit nicht darauf herumgetrampelt wird und sie verloren gehen, habe ich sie aufgehoben. Beide lagen rechts neben dem Opfer. Eine in der Ecke und eine neben dem Knie. Ich habe hier eine Skizze davon, wo und wie sie gelegen haben. Der Zeitpunkt, an dem das Opfer gefunden wurde, ist vermerkt. Die Video-Leute haben Nahaufnahmen gemacht.«
Merci betrachtete die Glastüren der Duschkabine, um festzustellen, ob die Hülsen, nachdem sie aus einer Automatikpistole abgefeuert worden waren, vielleicht abgeprallt waren und einen Kratzer oder eine Delle hinterlassen hatten. Aber das Licht spiegelte sich im Glas und sie konnte keinerlei Spuren sehen. Nur schwach ihre eigenen Konturen: breite Schultern, kräftiger Körperbau, ein beinahe hübsches Gesicht.
Der Spurensucher hatte in die Öffnung eines jeden Beutels ein kleines Knäuel Toilettenpapier gestopft, damit sich darin keine Feuchtigkeit bildete und mögliche Fingerabdrücke ruinierte.
»Wie heißen Sie?«
»Don Leitzel.«
»Ich bin Merci Rayborn. Danke, gute Arbeit.«
Sie warf einen Blick auf die Kommode im Schlafzimmer der Wildcrafts und bemerkte die Saphir-Ohrringe in der noch geöffneten Schachtel.
Sie standen im Steinzimmer. Dutzende von Steinen, die meisten dunkelfarbig, alle auf eine Weise erlesen, die Merci nicht hätte beschreiben können. Manche so klein wie Golfbälle, andere einen Meter lang. Viele davon lagen auf passenden Ständern, von denen einige aus Holz waren. Andere Ständer waren aus Gips oder Ton, manche sogar aus gebürstetem Stahl.
»Wozu dienen diese Sachen?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, erwiderte Zamorra.
»Sie sehen japanisch aus«, sagte Merci. »Vielleicht weiß Bob was darüber.«
»Ich geh ihn holen.«
Sie warteten in dem stillen Zimmer. Mercis Blick wanderte von einem Stein, der aussah wie eine Insel mit Buchten, zu einem Stein, der sie an überhaupt nichts erinnerte. Sammlungen beunruhigten Merci, da sie einmal einen Mann verhört hatte, der bemalte Vogeleier sammelte. In einer nahegelegenen Wohnung hatte er eine ganze Sammlung ausgestopfter, bemalter Leichen. Aber während sie den Stein betrachtete, der nach nichts aussah, dachte sie, dass es das ästhetischste Nichts war, das sie je gesehen hatte.
Bob Fukiyama und Zamorra traten rechts und links neben sie.
»Suiseki«, sagte der stellvertretende Pathologe. »Betrachtungssteine.«
»Was macht man damit?«, fragte Merci.
»Man betrachtet sie. Genießt den Anblick. Man meditiert.«»Und dann?«
»Wie bitte?« .
»Und was macht man dann?«
»Ich glaube, das ist alles.«
Merci sah den Pathologen ungläubig an. Sie hatte noch nie meditiert. Über Dinge nachgedacht, das schon, wie über einen schwierigen Fall, den sie bearbeitete, aber das machte jeder. Einen Augenblick genießen, gut, das kam auch vor. Sie genoss es, ihren Sohn zu betrachten, aber Tim Jr. war kein Stein.
»Suiseki zu sammeln und auszustellen ist ein uraltes Hobby in Japan«, erklärte Fukiyama. »Mein Großvater hat Steine gesammelt. Es gibt heute noch Vereine, Wettbewerbe und Ausstellungen. Suiseki können sehr wertvoll sein. Einige sehen aus wie Inseln. Manche wie Gebirge mit Schnee und Flüssen. Andere sind eher abstrakt. Die Menschen in überfüllten Städten bewahren sie in ihren Häusern auf, denken über ihre Formen nach und was sie bedeuten. Die Steine entführen sie aus der Stadt in die Natur.«
»Gibt es denn noch welche?«, fragte sie abwesend. Sie betrachtete versunken einen Stein, der aussah wie ein ruhender Wasserbüffel, den Kopf auf der Flanke.
»Was meinen Sie damit, Sergeant?«, fragte Fukiyama.
»Ich meine in Japan, Bob. Sie sagen, es ist ein uraltes Hobby, und das Land ist klein. Haben sie nicht inzwischen alle guten Steine eingesammelt?«
»Ich glaube nicht, Sergeant. Außerdem werden sie auf der ganzen Welt gesammelt.«
»Mir gefällt der Büffel.«
Fukiyama trat einen Schritt vor und betrachtete ihn. »Also, das ist wirklich ein guter Stein«, sagte er. »Wenn ich mich recht erinnere, sind Wasserbüffel eine ganz eigene Kategorie. Sehr schwer zu finden. Der von meinem Großvater war auch gut, aber weder so schön noch so groß wie dieser hier. Und auch nicht so jadeartig.«
»Siehst du«, meinte Zamorra. »Du verstehst Suiseki, du weißt es nur nicht.«
»Ich erkenne einen guten Stein, wenn ich einen sehe«, erwiderte sie, immer noch in den Anblick des Wasserbüffels vertieft.
Die Männer lachten leise, nur Merci nicht. Sie roch immer noch bei jedem Atemzug Gwen Wildcrafts Blut.
Auf der anderen Seite des Flurs befand sich ein Musikzimmer. Merci ließ den Blick über das Keyboard, die Lautsprecher und das Mischpult schweifen, dann über das Kabelgewirr und die Stecker und Steckdosen.
Es gab zwei Türme voller CDs. Merci sah sich die Rückseiten mit den Namen der Künstler an, kannte jedoch keinen davon.
»Wie alt war sie?«
»Sechsundzwanzig«, antwortete Zamorra. »Gestern war ihr Geburtstag.«
Eine musikinteressierte Frau, die zehn Jahre jünger war, hörte wahrscheinlich ganz andere Musik als sie selbst, dachte Merci.
»Und Archie?«
»Dreißig.«
An den Wänden hingen farbenfrohe Ölgemälde von Stränden und Bergen. Sie schienen aus der Hand ein und desselben Künstlers zu stammen und Merci entdeckte auf dreien in der rechten unteren Ecke die Signatur GK. Sie machte sich eine Notiz, dass sie Gwens Geburtsnamen überprüfen musste.
Es gab mehrere Fotos von Archie und Gwen. Archie hatte einen kräftigen Hals, ein breites, freundliches Gesicht und ausgeprägte Grübchen. Glatte kurze Haare. Gesunde Zähne. Gwens Gesicht war glatt und fest, wohlproportioniert mit einer hohen Stirn. Ausdrucksstarke Augen. Intelligent und sinnlich. Acht der Fotos waren professionelle Porträts, auf deren unterem Rand Messingplättchen mit dem jeweiligen Datum angebracht waren. Das erste trug die Jahreszahl 1994 und stammte von Gwens und Archies Hochzeit.
Merci betrachtete die Fotos und das jeweilige Datum, an denen sich gut ablesen ließ, wie die Wildcrafts gemeinsam Jahr für Jahr älter geworden waren. Zuerst sahen sie aus wie ein Paar auf einem High-School-Ball. Zuletzt wirkten sie wie eins dieser Paare in Hochglanzmagazinen. Dazwischen lagen sechs Jahre, in denen sich nach und nach gutes Aussehen und Schönheit entwickelt hatten.
Tot in ihrem Badezimmer in der Nacht nach ihrem Geburtstag. In den Kopf geschossen im eigenen Garten.
Einer von uns.
Merci trat an den Synthesizer und blickte auf die Tasten und Knöpfe, dann auf die Regler des Mischpults. Sie bemerkte das Mikrophon an einem Ständer neben dem Keyboard. Die schwarze Farbe auf dem Metallgitter war von Gwen Wildcrafts Lippen abgenutzt, stattdessen hatte sich dort rote Farbe abgelagert, wohl von ihrem Lippenstift.
»Ich schalte das Bandgerät ein«, sagte Zamorra.
Die Lautsprecher knisterten, und Merci sah ihm zu, wie er die Lautstärke herunterdrehte. Ein sanftes viertaktiges Intro, dann ein weiteres, intensiveres, als probierte die Musizierende beim Spielen, was besser klang. Dann setzte eine hohe, klare Frauenstimme ein. Nicht kraftvoll, eher gehaucht und zart:
We went out and got it all
Gold and diamonds wall to wall
And I got you and you got me
We’re who everybody wants to be
Turn it up loud turn it up high
Do what you have to
But dont say good-bye
Dont even joke about saying good-bye
Merci nahm ihr blaues Notizbuch heraus und schrieb auf: Dep. 2, 30, $40T Jahresgeh/Frau, 26, malt & macht Musik/Haus 1 Mio aufwärts/Pool, Einr teuer/ÜP$.
Zamorra schaltete die Musik mitten im Stück aus.
Einen Moment lang stand Merci in der schrecklichen Stille. Als ein grün uniformiertes Muskelpaket das Zimmer betrat, drehte sie sich um. »Der Zeuge wartet draußen. Einhundertfünfzig Schritte von der Stelle, wo er den Schuss gehört hat, bis zu dieser Haustür.«
»Gute Arbeit, Dobbs.«
Drei
»Es war eine großkalibrige Handfeuerwaffe«, sagte der Zeuge.
Sein Name war William Jones, achtundsechzig Jahre alt, Lehrer im Ruhestand. Er sah aus wie Dean Martin, fand Merci, und benahm sich auch so. Die Trunkenheit war allerdings nicht gespielt. Sie roch es an seinem Atem. Er trug braun karierte Shorts, ein blau kariertes Hemd und gefütterte Stiefel. Seine Beine waren käseweiß und dürr. Es war mittlerweile 7.34 Uhr und sie standen auf der Straße gegenüber der Auffahrt zum Haus der Wildcrafts. Einige Nachbarn hatten sich vor dem Absperrband versammelt.
»Woher wissen Sie das?«
»Als junger Mann war ich ein leidenschaftlicher Schütze. Zweiundzwanziger. Achtunddreißiger. Fünfundvierziger. Von einundfünfzig bis dreiundfünfzig war ich in der Armee. Mit Schusswaffen kenne ich mich aus. Und der Schall trägt weit hier in den Hügeln.«
Jones erklärte, er lebe in der Garage seines Sohnes in Hunter Ranch. Er könne zwar auch im Haus wohnen, aber er habe die Garage vorgezogen, ein Mann brauche seine eigenen vier Wände. Außerdem komme er mit seiner Schwiegertochter nicht zurecht, aber das stehe auf einem anderen Blatt. Er sei schon gegen fünf Uhr wach gewesen, denn er habe einen leichten Schlaf und leide an Magenschmerzen.
Den Schuss habe er um exakt 5.06 Uhr gehört und sofort gewusst, was es war.
Er sei in das Haus seines Sohnes gegangen, habe die Nummer des Sheriff’s Department vorn im Telefonbuch gefunden und angerufen.
Merci erinnerte sich, dass Crowder die Meldung um zehn nach fünf entgegengenommen hatte. Die Aussage war also korrekt.
William Jones fuhr fort: »Nach dem Anruf bin ich ins Bad, hab mich erleichtert und mir die Hände gewaschen. Dann bin ich zurück in die Küche gegangen – von wo ich telefoniert hatte –, habe aus dem Fenster gesehen und darauf gewartet, dass die Polizei erscheint.«
Merci schrieb alles mit, dann sah sie Jones an. Er zündete sich eine Zigarette an und musterte sie neugierig durch den Rauch.
»Sind alle wohlauf?«, fragte er.
»Archie wurde angeschossen, lebt aber noch. Seine Frau ist tot.«
»Gwen? O verdammt, sie waren so ein nettes junges Paar. O verdammt.«
Jones erstarrte einen Moment, dann trat er wütend in die Luft, glühende Funken lösten sich aus seiner Zigarette. Seinen Stiefel hätte er beinahe verloren, und Jones balancierte auf einem dünnen Bein, um den Fuß wieder in den Stiefel zu bekommen. Als er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, schaute er seufzend zum Haus der Wildcrafts, dann zu seiner Garage, dann zu Merci.
»Scheiße«, sagte er. »Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen?«
Er holte einen Flachmann aus seiner Gesäßtasche, nahm einen Schluck und verstaute die Flasche wieder. Canadian Mist, stellte Merci fest.
»Was haben Sie gesehen?«, fragte sie.
»Zuerst nichts. Dann, als ich aus dem Bad zurückkam, habe ich einen schwarzen Cadillac STS wegfahren sehen. Mit Autos kenne ich mich auch aus. Da war es elf nach fünf.«
Merci blickte Jones durchdringend an, hoffte, dass er ein brauchbarer Zeuge war. Er trinkt schon morgens um sieben Whiskey, dachte sie. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht geradeaus sehen kann.
»Kalifornisches Kennzeichen, und die ersten beiden Buchstaben konnte ich erkennen«, sagte Jones und musterte Merci erneut. »OM.«
»Haben Sie den Fahrer erkannt?«, fragte Zamorra.
»Nein. Hab überhaupt niemand gesehen. Es war viel zu dunkel.«
»Wie schnell ist er gefahren?«, fragte er.
»Gut dreißig. Aber er hat beschleunigt.«
»So als würde er gerade von dem Haus kommen?«, fragte Zamorra mit einem Blick auf Merci.
»Ganz genau. Aber er kam nicht aus der Auffahrt. Das hätte ich bemerkt. Vielleicht hat er auf der Straße gegenüber dem Haus der Wildcrafts geparkt, aber der Magnolienbaum vor meinem Fenster verstellt die Sicht auf diese Stelle. Der Wagen ist den Hügel hinuntergefahren, direkt gegenüber von Archies Haus, als ich ihn zuerst gesehen habe. Ich hab aus dem Fenster geschaut und da war er.«
Merci ließ den Blick über die teure Gegend schweifen: große Grundstücke, hohe Bäume, Pferdekoppeln und Boxen, von der Straße ein Stück entfernt liegende Häuser, kaum sichtbar. Auf einem der Grundstücke gab es sogar einen Teich. Die Morgensonne tauchte alles in goldenes Licht. Sie entdeckte Jones’ Garage auf der anderen Straßenseite am Ende einer langen Auffahrt, die von hohen italienischen Zypressen gesäumt war.
Einhundertfünfzig Meter vom Haus der Wildcrafts bis zu Jones’ Ohr, dachte sie, mehr oder weniger. Und vom Badezimmer der Wildcrafts war es noch weiter, dazu kamen die Wände und Decken, was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass Jones die Schüsse, die Gwen getötet hatten, nicht hatte hören können.
»Was ist mit der Beleuchtung der Auffahrt?«, fragte sie.
Jones erwiderte, sie sei eingeschaltet gewesen. Er kniff die Augen zusammen, und zuerst glaubte Merci, das läge am Sonnenlicht. Aber die Sonne stand hinter dem Magnolienbaum und der Baum stand hinter Jones.
»Nein«, sagte er.
»Was nein?«
»Nein. Ich glaube nicht, dass es so ein Mord-Selbstmord-Ding war«, sagte er.
Selbstmord war ihr als Erstes in den Sinn gekommen, als sie erfahren hatte, dass sie es mit zwei Schussopfern zu tun hatten. Und dann wieder, als sie erfuhr, dass es sich um einen Polizisten und dessen Frau handelte. Merci wusste, dass weitaus mehr Polizisten durch Selbstmord starben als in Ausübung ihres Dienstes. Früher hatte sie geglaubt, dass das Selbstmordproblem der Polizei mit den niedrigen Eignungsstandards zu tun hatte. Dann, vor einem Jahr, war Paul Zamorra nahe dran gewesen, Selbstmord zu begehen, was Merci von ihrer eingeschränkten Sichtweise abbrachte.
»Warum nicht?«
»Archie ist in Ordnung, Sergeant Rayborn. Intelligent. Sieht aus wie der junge Gary Cooper. Und seine Frau war nicht nur schön, sie war so liebreizend, wie ein Mädchen nur sein kann. Manchmal hört man ja von perfekten Paaren, also, die waren eins. Sie hatten alles.«
»Wir wissen nicht, was vorgefallen ist«, sagte Merci.
»Das können Sie auf jeden Fall ausschließen«, beharrte Jones.
»Haben Sie sie mal streiten gehört?«
»Hin und wieder.«
»Wie oft ist ›hin und wieder‹?«
Jones überlegte. »Zweimal im halben Jahr.«
»Und wann war das letzte Mal?«
»Gestern Nachmittag, gegen drei. Ich war beim Unkrautjäten. Es kam aus ihrem Garten.«
»Was kam aus ihrem Garten?«
»Geschrei. Vor allem von ihr. Gwen schrie, aber Archie war ruhig. Er hat nicht viel gesagt.«
»Wer hat was gesagt?«
»Ich habe kein Wort verstanden, nur zwei Leute miteinander streiten hören. Ich bin reingegangen und hab mir noch ein Bier geholt. Ich kann es nicht leiden, wenn Paare streiten. Das ist für mich das schlimmste Geräusch. Erinnert mich an meine Ex.«
Sie bedankten sich bei ihm, aber Jones blieb einfach stehen und starrte auf das Haus der Wildcrafts.
Merci betrachtete die kleine Menschenmenge, die sich hinter dem Absperrband gebildet hatte. Sie und Zamorra nahmen sich ein paar Minuten Zeit, sich zu den Leuten zu gesellen und herauszufinden, ob jemand etwas gesehen oder gehört hatte. Nichts. Für alle Fälle ließ sie sich Namen, Adressen und Telefonnummern geben.
Dann gingen sie wieder zum Haus zurück.
Einer der Spurensicherer ging langsam die Auffahrt entlang – mit langen Schritten, den Kopf gebeugt, die Mütze tief ins Gesicht gezogen – und suchte den Beton ab. Er erinnerte Merci an ihren Vater, wie er früher auf der Suche nach Forellen durch den East Walker River gestapft war.
Sie blieb stehen und beobachtete den Mann. Seine Konzentration und Intensität gefielen ihr. »Paul, ich finde, wir sollten den schwarzen Caddy in ganz Südkalifornien zur Fahndung ausschreiben lassen – einen Wagen, dessen Kennzeichen mit OM anfängt. Ich weiß, dass es vielleicht schon zu spät ist. Ich weiß, dass da möglicherweise überhaupt nichts dran ist. Ich weiß, dass Jones sein Frühstück in flüssiger Form zu sich nimmt. Aber es ist einen Versuch wert.«
»Ich kümmere mich darum, Merci.« Zamorra zögerte. »Glaubst du, Archie war’s?«
»Ich hoffe nicht.«
Im letzten Jahr war Zamorra zum Berater für suizidgefährdete Mitarbeiter im Department ernannt worden. Merci hatte viel Gutes über Pauls Arbeit gehört, auch wenn er selbst kaum mehr als ein paar beiläufige Sätze darüber verloren hatte.
»Was meinst du, Paul?«
»Ich möchte mich mit seinen Freunden unterhalten. Mit seinen Angehörigen, falls er welche hat. Als Erstes soll Gilliam einen Techniker ins Krankenhaus schicken. Wir sollten Wildcraft auf Schmauchspuren untersuchen, bevor er gewaschen wird. Und seine Kleidung auf Blutspuren überprüfen.«
Schmauchspuren, dachte Merci. Man würde Spuren mit einem Klebeband abnehmen, einen Abstrich machen und diesen dann in ein Lösungsmittel geben. Wenn man Barium, Blei oder Antimon fände, wäre das ein deutlicher Hinweis darauf, dass Wildcraft eine Waffe abgefeuert hatte. Wenn man Schmauchspuren und Spuren von Gwens Haut und Blut auf Archies Kleidung und Händen fand, dann sah es ganz schlecht aus.
Wildcraft konnte aber auch an dem Tag auf dem Schießplatz gewesen sein, dachte Merci, um mit seiner Dienstwaffe zu üben. Ebenso war es möglich, dass er in unmittelbarer Nähe seiner Frau gestanden hatte, als sie von einem anderen erschossen wurde, um sein Leben gerannt war und es bis nach draußen geschafft hatte.
Oder es war ihm gelungen, dem Mann, der ihn angeschossen hatte, eine Kugel zu verpassen.
»In Ordnung.«
Merci stand in dem Tunnel aus Ästen und betrachtete die Blutflecken, die Wildcraft hinterlassen hatte. Bei einem erwachsenen Mann, der einen Kopfschuss überlebt hatte, hätte sie mehr Blut erwartet. Dennoch war die Menge beträchtlich. Das meiste Blut hatte sich in einer Lache gesammelt, ein Hinweis darauf, dass er sich kaum noch bewegt hatte. Zamorra hielt sich etwas hinter ihr, da der Gehweg zu schmal war, um nebeneinander zu stehen. Hinter Zamorra standen Crowder und Dobbs.
»Archie lag auf dem Rücken«, sagte Crowder. »Die Arme ziemlich nah am Körper. Als wäre er nicht mal dazu gekommen, sie zu heben, als wäre er einfach umgefallen. Soweit ich erkennen konnte, hat er sich nicht mehr gerührt. Er lag so, dass seine Füße von uns wegzeigten.«
Merci hockte sich vor die Pistole, die nicht weit von der Blutlache entfernt lag. Eine S&W-Automatik – eine Neunmillimeter. Einen Meter davon entfernt lag eine lange schwarze Stablampe halb auf dem Gehweg, halb im Dreck. Sie war ausgeschaltet.
»Wo genau am Kopf wurde er von der Kugel getroffen?«, fragte sie.
»Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ob es überhaupt eine Schussverletzung war. Bei all dem Blut und den Haaren war die Wunde nicht zu sehen. Ich wollte die Blutung stoppen, deshalb habe ich meinen Anorak um seinen Kopf gewickelt. Ich dachte, vielleicht war es ein Schuss durchs Auge. Aber plötzlich hat er beide Augen geöffnet und sie sahen so weit okay aus.«
»Hat er irgendwas gesagt?«
»Nein. Die Pupillen stark geweitet, totaler Schockzustand.« Sie betrachtete das Gefälle des schmalen Wegs und kam zu dem Schluss, dass Wildcraft mit dem Gesicht zur Haustür gestanden haben musste, als auf ihn geschossen wurde. Er hatte also eine Steigung vor sich, deshalb war er nach hinten gestürzt, so wie man ihn gefunden hatte. Aber genauso gut konnte er auch vom Haus weggegangen und nach vorn aufs Gesicht gefallen und anschließend auf den Rücken gerollt sein. Oder er hatte sich durch die Wucht des Schusses gedreht. Oder er war getaumelt und hatte sich dabei um hundertachtzig Grad gedreht. Oder er war spastisch geworden und hatte unvorhersehbar reagiert, wie es häufig bei Schussopfern vorkam.
Vielleicht wacht Archie ja in ein paar Stunden auf und erzählt uns, was passiert ist, dachte sie. Kopfverletzungen bluten wie verrückt. Vielleicht hat die Kugel nur eine Fleischwunde verursacht und ihn außer Gefecht gesetzt, das Gehirn aber intakt gelassen. Vielleicht ist sie ja vom Schädel abgeprallt.
Sie musste an einen Fall denken, mit dem sie in ihrem ersten Jahr als Streifenpolizistin zu tun hatte. Ein kleiner Ganove hatte einen Kopfschuss aus einer Neunmillimeter abbekommen, aber die Kugel wurde im Oberschenkel gefunden. Sie war dort gelandet, nachdem sie vom Schädelknochen abgeprallt war, sich durch Muskeln und Knorpel gefressen hatte und dann weiter durch festes Gewebe getrudelt war – wie ein außer Kontrolle geratenes Monster. Und genau das, dachte Merci, ist ein Geschoss, wenn es erst einmal in einen Körper eindringt: ein Monster. Der Mann hatte schließlich bekommen, was er verdiente: Er wurde wegen Drogenhandels verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Cortera, erinnerte sich Merci – Reuben Cortera. Das war schon zehn Jahre her, aber den Namen eines Verbrechers vergaß Merci nicht. Niemals.
Sie erhob sich und warf einen Blick auf die Bäume. Die Stämme standen ein paar Meter vom Gehweg entfernt, und die Morgensonne hing noch so niedrig, dass die Strahlen ihren Weg unter den Blättern hindurch fanden. Vom Gehweg aus schob Merci ein paar Zweige zur Seite und ließ den Blick über den dunklen Boden und ein paar Veilchen und Steinkraut schweifen, die es irgendwie schafften, in nahezu vollständigem Schatten zu überleben. Dieser Teil des Gartens war kürzlich bearbeitet worden. Es waren Harkspuren zu erkennen und einer der Sprenkler war mit einem nagelneuen Messingkopf versehen.
Dann entdeckte Merci zu ihrer Überraschung in weniger als einem Meter Entfernung zwei Schuhabdrücke. Sie befanden sich direkt nebeneinander und zeigten in ihre Richtung. Nah. Deutlich. Groß. Als hätte dort jemand gewartet oder als stünde da in diesem Moment ein unsichtbarer Mann, der ihr die Hand zur Begrüßung hinstreckte. Oder eine Waffe auf ihren Kopf richtete. Links von Archie, falls Archie den Weg hinaufgegangen war. Drei Meter weiter entdeckte sie noch mehr Fußspuren. Mehrere Teilabdrücke und Überlappungen – Anzeichen von Bewegung. Aber dort war der Boden härter und die Abdrücke waren nicht so gut zu erkennen.
Sie gab Zamorra mit dem Kopf ein Zeichen. Zamorra schob die Zweige noch ein bisschen weiter aus dem Weg und inspizierte den Boden.
»War hier jemand drin?«, fragte er.
»Nein, Sir«, sagte Dobbs. »Darf ich mal sehen?«
Merci trat zur Seite und ließ den jungen Polizisten einen Blick auf die Stelle werfen.
»Ausgezeichnete Spuren«, sagte er.
Crowder kam als Nächster und gab nur ein leises hmmm von sich.
»Das wird Ike gefallen«, sagte Merci. Ike war einer der guten Spurensucher, einer von denen, die damals für sie Partei ergriffen hatten. Er war Spezialist für das Anfertigen von Gipsabdrücken. »Bitte sagen Sie ihm, dass ich ihn hier brauche, Deputy Dobbs.«
»Jawohl, Sergeant«, erwiderte er und eilte in Richtung Haus. Sie wusste nicht, ob er sich über sie lustig machte oder ob er sich bemühte, effizient zu sein, aber es war ihr eigentlich auch egal. Mercis Herz hatte einen Satz gemacht, als sie die Fußspuren entdeckt hatte, und nun klopfte es immer noch laut und kraftvoll, während sie dachte: Mit diesem Abdruck kriege ich dich dran, du verdammtes Schwein.
Zehn Minuten lang suchten Merci und Crowder in der Nähe der Fußabdrücke nach Patronenhülsen. Sie hockten am Rand des betonierten Wegs, reckten sich vor und benutzten ihre Kugelschreiber, um Veilchenblüten anzuheben und die mit feinen Härchen bedeckten Blüten des Steinkrauts wegzuschieben. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, setzten sie auch mal einen Fuß auf das Laub, stets bemüht, den Abdrücken nicht zu nahe zu kommen. Sie sahen aus wie zwei Botaniker. Merci scherte sich nicht darum, was für ein Bild sie abgab, Hauptsache, ihre Mühe hatte letztlich Erfolg. Ihre Seite schmerzte. Die von der Schussverletzung herrührende Narbe war jetzt acht Monate alt, glatt und hart, wie ein dünnes Stück Aluminium, das in ihre Haut eingewachsen war.
Einmal blickte sie sich nach Zamorra um. Er stand immer noch auf dem Gartenweg, entspannt und lässig wie eine Katze, mit dem Rücken zur Sonne und die Hände in den Taschen seiner schwarzen Anzughose.
Es war Zamorra, der die glänzende 9-mm-Hülse neben einer Veilchenblüte entdeckte. Er zeigte mit dem ausgestreckten Finger darauf. Die Hülse stand aufrecht und gerade, wie eine Turnerin in der Abschlusspose. Sie befand sich drei Meter vom Weg entfernt, in entgegengesetzter Richtung zu den Fußabdrücken. Nicht dort, wo der Riese unter dem Baum gewartet hatte.
Merci betrachtete das Blut auf dem Beton und die Patronenhülse in etwa drei Metern Entfernung. Genau dort, wo sie gewesen sein musste, wenn Wildcraft sich selbst erschossen hatte.
Merci und Zamorra sahen zu, wie Ike fotografierte und anschließend Abdrücke der gut sichtbaren Schuhspuren anfertigte. Zuerst besprühte er den Boden mit Haarspray, um die losen Erdpartikel zu fixieren, dann ließ er flüssigen Gips über ein Kittmesser in die wertvollen Bodenvertiefungen laufen. Die Ränder stützte er mit abgebrochenen Zungenspateln ab, bevor er dann die flacheren Dellen bis oben hin auffüllte. Als er fertig war, setzte sich Ike hin, zündete sich eine Zigarette an und wartete, dass der Gips aushärtete.
Die Spurensucher nahmen die Stelle, an der Archie Wildcraft gefunden worden war, auf Video auf, fotografierten und skizzierten sie.
Währenddessen erkundigte sich Merci telefonisch nach dem Gesundheitszustand des verwundeten Polizisten: alle paar Minuten, immer wieder vergeblich, er war noch nicht ansprechbar.
Und immer noch keine Spur von dem schwarzen Cadillac STS mit den Buchstaben OM im Kennzeichen.
Merci und Zamorra sahen den Spurensuchern im Bad und Schlafzimmer bei der Arbeit zu. Wie erwartet gab es überall reichlich Fingerabdrücke. Unter dem Waschbecken hatten die Spezialisten eine Zweiundzwanziger Automatik gefunden, die sie in eine Papiertüte verpackt und für Merci auf der Kommode deponiert hatten. Sie nahm die Tüte und schaute sich die schwere kleine Waffe an. Glänzender Edelstahl, Perlmuttgriff. Eine Damenpistole. Sie fragte sich, warum Gwen sie nicht benutzt hatte. Die Chancen, dass Gwen Wildcraft damit umzugehen wusste, lagen bei fünfzig zu fünfzig.
Sie legte den kleinen Selbstlader zu den anderen Beweismitteln und dachte über die Waffe nach, die sie draußen neben Archie Wildcraffs Hand gefunden hatten. Mord-Selbstmord-Waffe oder die Privatwaffe des Deputys? Vielleicht beides? Wieder zog sich ihr Magen zusammen bei dem Gedanken, Archie Wildcraft könnte zuerst seine Frau erschossen und anschließend versucht haben, sich selbst zu erschießen.
Man konnte sich das Szenario auf verschiedene Weise ausmalen, dachte sie: Wildcraft hört, wie der Stein durchs Fenster geschleudert wird. Er schnappt sich seine Waffe und eine Taschenlampe und geht raus, um nachzusehen. Und als er den Weg entlangkommt, steht der Hüne unter dem Baum, jagt ihm eine Kugel in den Kopf und nimmt Archies Neunmillimeter an sich, geht ins Haus und erschießt Gwen. Danach drückt er Archie die Waffe wieder in die Hand. Ziemlich unwahrscheinlich.
Eine andere Variante: Der Stein liegt bereits da, irgendwann vorher in einem Wutanfall vom Ehemann oder seiner Frau geworfen – in dem Streit, den William Jones nachmittags gehört und der vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Kriminalwissenschaftlich ausgedrückt: der auslösende Stressfaktor. Vielleicht hatte es irgendetwas mit ihrem Geburtstag zu tun. Als seine Frau sich zum Schlafengehen fertig macht, kocht Archie vor Wut. Sie nimmt das Telefon mit ins Bad und schließt sich ein. Fühlt sich sicher. Aber er tritt die Tür ein und schießt so schnell, dass ihr das Telefon aus der Hand fliegt, bevor sie dazu kommt, 911 zu wählen. Danach rennt er nach draußen, stolpert herum und jagt sich schließlich selbst eine Kugel in den Kopf.
Merci ging wieder hinaus auf die Einfahrt. Die Autos waren weg. Auf der Straße standen mittlerweile Übertragungswagen – von zwei überregionalen und zwei lokalen Sendern. Die Anzahl der neugierigen Nachbarn war angewachsen, darunter viele Kinder auf Tretrollern. Über dem Dach von William Jones’ Garage flimmerte die feuchte Augusthitze.
Merci schritt das große Rechteck ab, wo die Auffahrt frisch betoniert war, kniete sich hin und überprüfte eine raue Stelle in der Oberfläche. Dabei musste sie an die Frau im Badezimmer denken, die von zwei Kugeln getroffen worden war.
Die Scheinwerfer für die Auffahrt waren unter dem Dachvorsprung an der Garage angebracht. Merci schaute hoch zu dem Sonnenlicht-/Bewegungsmelder. Sie holte ihr blaues Notizbuch heraus und notierte sich: ÜP BewMel nach Dunkelheit.
Was hatte den Bewegungsmelder aktiviert? Jones hatte um fünf Uhr elf gesehen, dass das Licht eingeschaltet war, aber Crowder hatte drei Minuten später gesehen, dass es aus war. Keiner hatte einen Wagen in der Auffahrt bemerkt.
Sie ging zurück um das Haus herum bis zur Glastür, durch die der Stein geschleudert worden war. Weit und breit waren weder Steine dieser Art noch überhaupt irgendwelche Steine zu sehen, bis auf eine Reihe sehr großer, runder grauer Steine, die um einen Whirlpool herum einbetoniert waren. Außerdem gab es eine kleine überdachte Veranda mit einem Bistrotisch und zwei Stühlen, Pflanzen in Kübeln, ein Schwimmbecken, ein Stückchen leuchtend grünen Rasen, dann ein abschüssiges Wildblumenbeet, das bis zu einem weißen Koppelzaun reichte.
Merci folgte einem Fußweg aus Eisenbahnschwellen, der durch die Blumenbeete führte. Zwischen den Schwellen lag Kies, und die Blumen wuchsen bis an die Holzeinfassung heran. Bienen summten in den Blüten herum, und einen Moment lang war es Merci, als hätte sie eine Szene aus Tim Juniors Puh-der-Bär-Geschichten vor sich. Sie dachte an ihren kleinen Jungen und wünschte, sie könnte mit ihm in eine dieser Szenen hineingehen und für ein oder zwei Jahre dort bleiben.
Sie folgte dem Pfad bis zum Zaun, ging dann zurück bis zur Veranda, ohne auch nur einen einzigen Stein zu entdecken, der sich zum Werfen geeignet hätte. Sie fragte sich, ob der Stein, der das Fenster durchschlagen hatte, vielleicht aus Wildcrafts Sammlung von Betrachtungssteinen stammte.
Zamorra saß am Tisch auf der Veranda, die Beine übereinandergeschlagen, und starrte auf das Loch in der Glastür.
»Lass uns den ganzen Ablauf morgen nachstellen«, sagte er.
»In Ordnung.«
»Bis dahin wissen wir, ob Archie die Waffe abgefeuert hat oder nicht.«
»Stimmt.«
Er musterte sie mit seiner irritierend ruhigen Art. »Sei unvoreingenommen, Merci. Er könnte es getan haben.«
»Ich weiß. Ich geb mir ja Mühe.«
Merci dachte daran, wie leicht man sich irren konnte. Sie wusste, wie falsch sie bei einem Polizisten namens Mike McNally gelegen hatte und welch fürchterlichen Preis sie beide dafür gezahlt hatten. Mike war ein Teil dessen, was vor einem Jahr geschehen war, eigentlich der Mittelpunkt. Deshalb sagte sie nichts weiter. Denn selbst wenn sie sich wieder irrte – selbst wenn ihr Herz sie genau wie damals auf eine falsche Fährte lockte –, so bedeutete das immerhin, dass es wieder mit ihr sprach.
Außerdem und vor allem, dachte sie, ist Wildcraft einer von uns. Wir sind Freunde und Helfer. Wir tun, was getan werden muss. Wir greifen hart durch.
Wir töten nicht unsere Liebsten und anschließend uns selbst.
»Ich weiß, dass du dir Mühe gibst, Merci.«
Um neun Uhr abends kehrte Merci noch einmal in das Haus der Wildcrafts zurück. Sie hatte mit ihrem Sohn und ihrem Vater zu Abend gegessen, mit Tim Junior gespielt, ihm aus seinen drei Lieblingsbüchern vorgelesen und ihn dann ins Bett gesteckt.
Sie war zwar hundemüde, wollte aber unbedingt noch etwas überprüfen. Sie würde keinen Schlaf finden, solange sie keine Klarheit hatte.