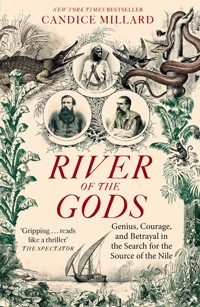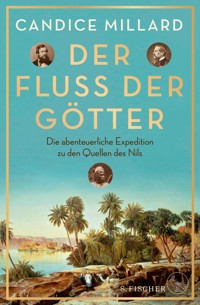
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Antike Kulturen, Heldenmut und ein unverzeihlicher Verrat: Die größte Abenteuergeschichte des 19. Jahrhunderts - Der »New York Times«-Bestseller in wunderschöner Ausstattung Während die europäischen Großmächte zahllose Entdecker entsenden, um die unbekannten Winkel der Welt zu erforschen, entflammt auf dem Kontinent eine rauschhafte Faszination für das Alte Ägypten. Um das jahrtausendealte Geheimnis um den Ursprung des Nils zu lüften, begeben sich der exzentrische Richard Burton, ein Sprachgenie und dekorierter Soldat, und der fromme Aristokrat und passionierte Jäger John Speke im Auftrag der englischen Krone auf eine gefährliche Mission. Als wahrer Held ihres Abenteuers entpuppt sich jedoch der befreite Sklave Sidi Bombay, dessen Mut und Einfallsreichtum von der imperialen Geschichtsschreibung vergessen wurden. Vor dem Hintergrund der europäischen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents erzählt Candice Millard in »Der Fluss der Götter« mitreißend und fundiert von einer der wichtigsten Expeditionen der Geschichte. Mit Goldveredelung, gestaltetem Vorsatzpapier und Bildteil. »Millard ist eine herausragende, historisch versierte Erzählerin, die die Gabe besitzt, längst vergessenen Geschichten neues Leben einzuhauchen.« Bookreporter »Millards Recherche und ihre sehr lesbare Erzählweise sind bewundernswert.« Wall Street Journal »New York Times«-Bestseller und bestes Buch des Jahres 2022 u.a. bei »Washington Post«, Amazon, Barnes & Noble, »NPR« und »Goodreads«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Candice Millard
Der Fluss der Götter
Die abenteuerliche Expedition zu den Quellen des Nils
Über dieses Buch
Antike Kulturen, Heldenmut und ein unverzeihlicher Verrat: Die größte Abenteuergeschichte des 19. Jahrhunderts
Während die europäischen Großmächte zahllose Entdecker entsenden, um die unbekannten Winkel der Welt zu erforschen, entflammt auf dem Kontinent eine rauschhafte Faszination für das Alte Ägypten. Um das jahrtausendealte Geheimnis um den Ursprung des Nils zu lüften, begeben sich der exzentrische Richard Burton, ein Sprachgenie und dekorierter Soldat, und der fromme Aristokrat und passionierte Jäger John Speke im Auftrag der Royal Geographical Society auf eine gefährliche Mission. Als wahrer Held ihres Abenteuers entpuppt sich jedoch der befreite Sklave Sidi Bombay, dessen Mut und Einfallsreichtum von der imperialen Geschichtsschreibung vergessen wurden.
Vor dem Hintergrund der europäischen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents erzählt Candice Millard in »Der Fluss der Götter« mitreißend und fundiert von einer der wichtigsten Expeditionen der Geschichte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Candice Millard, geboren 1968, ist freie Autorin und Journalistin. Ihre historischen Sachbücher wurden in Amerika allesamt zu Bestsellern und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Award für Research Nonfiction des PEN Zentrums der USA und dem Edgar Allan Poe Award für Best Fact Crime. Sie war langjährige leitende Reporterin des »National Geographic« und schreibt regelmäßig für »The Guardian«, »TIME« oder »New York Times Book Review«. Mit »Der Fluss der Götter« erscheint zum ersten Mal ein Buch der Autorin, die für ihre historische Genauigkeit und große Erzählkunst bekannt ist, in deutscher Übersetzung. Um den Spuren von Richard Francis Burton, John Hannig Speke und Sidi Mubarak Bombay zu folgen, recherchierte sie in Kenia, Sansibar, Tansania, Uganda und England. Millard lebt in Kansas City, Kansas.
Irmengard Gabler war nach dem Studium der Anglistik und Romanistik in Eichstätt und London einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für romanische Literaturwissenschaft an der Universität Eichstätt tätig. Seit 1993 übersetzt sie Belletristik und Sachbücher aus dem Englischen, Französischen und Italienischen (u.a. Cristina Campo, Serena Vitale, Philippe Blasband, Christopher J. Sansom, John Dickie, Adam Higginbotham). Die Übersetzerin lebt in München.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »River of the Gods. Genius, Courage, and Betrayal in the Search for the Source of the Nile« im Verlag Doubleday, New York
© Candice Millard
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde im Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Für die deutsche Ausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491791-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog Obsession
Teil I Ein furchtloses Herz
1. Ein strahlendes Licht
2. Schatten
3. Bürge für unser Blut
4. Der Abban
5. Wir sind umzingelt
Teil II Was wäre nicht alles möglich gewesen
6. In den Schlund der Hölle
7. Was für ein Fluch ist doch ein Herz
8. Horror Vacui
9. Bombay
10. Der Tod stand ihm ins Gesicht geschrieben
11. Ein alter Feind
12. Tanganjika
13. Ans Ende der Welt
Teil III Wut
14. Das Messer steckt in der Scheide
15. Da schoss er auf mich
16. Traum eines Exilanten
17. Hart wie Stein
Teil IV Die bösen Zungen von Freunden
18. Der Prinz
19. Verdamme ihre Seelen
20. Neston Park
21. Und so erkaltet das müde Herz
Epilog Asche
Dank
Bibliographische Angaben
Abbildungsnachweis
Register
Tafelteil
Zu den Anmerkungen
Manuskriptquellen
Abkürzungen der Titel
Meinen Kindern
Der See kräuselte sich von einem Ende der Welt zum anderen.
Weit wie ein Ozean, geborgen in der Hand eines Riesen.
– »Sidi Mubarak Bombay« von Ranjit Hoskoté
PrologObsession
Als ein junger britischer Offizier mit Namen William Richard Hamilton im Herbst des Jahres 1801 das sagenumwobene Alexandria betrat, fand er sich in einer erstaunlichen Szenerie wieder – tiefstes Elend vor der Kulisse der verlorenen Pracht der Pharaonen. Die Stadt Alexandria, einst ruhmreiches Zentrum der Gelehrsamkeit, war jetzt eine brennende Ruine, gefangen in einem Krieg, den Europa auf afrikanischem Boden austrug. Nach dem niederschmetternden Sieg der Briten über das napoleonische Frankreich vegetierten verwundete Soldaten sterbend in der sengenden Sonne; aus ihren Kerkern befreite Häftlinge schleppten ihre zerschundenen Leiber durch die Gassen; ausgehungerte Familien kämpften um die letzten toten Armeepferde. Für Hamilton jedoch bot sich just in diesem Moment die Chance seines Lebens. Der vierundzwanzigjährige Cambridgeabsolvent und Altphilologe war zu einem ganz bestimmten Zweck nach Ägypten geschickt worden: Er sollte den Stein von Rosette aufspüren.
Nachdem sie jahrhundertelang von den europäischen Eliten ignoriert worden war, die nur der glorreichen Geschichte Griechenlands und Roms huldigten, rückte neuerdings die noch ältere ägyptische Kultur mit ihren erstaunlichen Errungenschaften immer mehr in den Fokus wissenschaftlichen Interesses und wurde somit zu einer neuen, besonders begehrten Trophäe für die nach militärischer und kultureller Vorherrschaft strebenden Großmächte Europas. Drei Jahre zuvor, im Sommer 1798, war Napoleon Bonaparte in der Hoffnung, Großbritannien durch die Blockade des Landwegs nach Indien zu schwächen, an der ägyptischen Küste gelandet. Dieser militärische Schachzug war zwar nicht außergewöhnlich, doch er ebnete auch einer weitaus kühneren wissenschaftlichen und kulturellen Eroberung den Weg. Im Kielwasser seiner Invasionstruppen schickte Napoleon noch eine weitere gut ausgebildete Armee ins Land – die der Gelehrten. Um Frankreich die Oberhoheit über die altägyptische Kultur zu sichern, hatten diese ehrgeizigen jungen savants den Auftrag erhalten, alles an sich zu nehmen, was sie den Gräbern und dem Erdreich zu entreißen vermochten. Sie vermaßen das Haupt der Großen Sphinx, kartographierten Kairo und weitere Städte und bildeten alles ab, was sich nicht zusammenrollen und fortschaffen ließ. Diese Männer – Botaniker und Ingenieure, Künstler und Geologen – lebten, wie einer von ihnen aufgeregt nach Hause schrieb, »im Zentrum eines flammenden Kerns[1] der Vernunft«. Und in ihren Augen gab es nichts, was die militärische und geistige Überlegenheit Frankreichs besser hätte symbolisieren können als die Beschlagnahmung des Steins von Rosette.
Obwohl seine fein säuberlich eingeritzten Hieroglyphen zur damaligen Zeit noch nicht entziffert werden konnten, verhieß dieser Stein den europäischen Gelehrten Zugang zu den spektakulären Geheimnissen, die am Ufer des Nils ihrer harrten – Geheimnisse aus uralter Zeit, noch gänzlich unerforscht, Geheimnisse, die ihnen ein völliges Umschreiben der bisher bekannten Geschichte ermöglichen würden. Zwei Jahre zuvor hatten französische Soldaten, die im Hafen von Rosette am Westufer des Nils eine baufällige alte Festung auszubessern suchten, die 1,12 Meter hohe Stele ausgegraben. Die Offiziere erkannten sofort den außerordentlichen Wert des dunkelgrauen Steins: Forscher hofften oft ein Leben lang vergebens auf einen solchen Fund. In seine Stirnseite war ein zweitausend Jahre alter Gesetzeserlass eingeritzt, verfasst in drei verschiedenen Sprachen: zwei davon waren unbekannt – das Demotische, einst die Alltagssprache der Ägypter, sowie die verlockend mysteriöse Sprache ihrer Priester in Hieroglyphen –, die dritte hingegen bekannt, das Altgriechische. Mit seiner Hilfe würden sich die beiden anderen zu gegebener Zeit entschlüsseln lassen. Die Nachricht von dem Fund hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, und schon bald sprachen Gelehrte und Wissenschaftler in ganz Europa mit gedämpfter Stimme über den Stein von Rosette.
Dass Napoleon einen so kostbaren Wegweiser zu antiker Weisheit besaß, war Frankreichs imperialem Rivalen Großbritannien schier unerträglich. Nachdem die Briten aus der blutigen Belagerung Alexandrias als Sieger hervorgegangen waren, forderten sie nun entsprechend ihre Rechte als Eroberer ein: jeden Sarkophag, jede Skulptur, jeden goldglänzenden Skarabäus und – vor allem – den Stein von Rosette. Den besiegten Franzosen blieb nichts anderes übrig, als die Stele zu verstecken. Und so hatten Napoleons Soldaten sie ungeachtet ihres Umfangs und Gewichts – Schätzungen zufolge eine Dreivierteltonne – bereits dreimal bewegt, zuerst vom Fundort in ihr Lager, dann nach Kairo und schließlich nach Alexandria. Dort befand sie sich in einem Lagerhaus, verborgen zwischen Stapeln unauffälliger Frachtkisten und mit Matten bedeckt. Um die Briten zu täuschen, streuten die Franzosen das Gerücht, der Stein habe das Land bereits verlassen; er sei an Bord eines Schiffes geschmuggelt worden, welches im Schutz der Nacht die Segel gesetzt und nach Europa aufgebrochen sei, genau wie Bonaparte selbst es getan hatte, als die Niederlage unausweichlich schien.
William Richard Hamilton weigerte sich jedoch, dergleichen Ausflüchte gelten zu lassen. Er wühlte sich durch die Trümmer der Stadt, da er nicht glauben mochte, dass der Stein von Rosette Ägypten verlassen hatte, und bestand darauf zu erfahren, wo er versteckt sei. Der kommandierende französische General, der einen Großteil der kulturellen Plünderungen persönlich überwacht hatte, geriet angesichts der irritierenden Beharrlichkeit des jungen Mannes außer sich, und warf den Briten vor, ihm gleichzeitig die Daumenschrauben anzulegen und die Pistole auf die Brust zu setzen. Dabei gab er einen Satz zum Besten, der als ewige Karikatur imperialer Doppelmoral in die Geschichte eingehen würde: »Wir haben nirgendwo je geplündert!«, schimpfte er verächtlich. Bald darauf stieß Hamilton, der keine Sekunde daran gezweifelt hatte, dass es so kommen würde, auf das Versteck des Steins. Und fünf Monate später erreichte dieser an Bord der beschlagnahmten französischen Fregatte HMS L’Égyptienne endlich London, wo er sogleich zum kostbarsten Schatz des British Museum erklärt wurde.
Mit der Ankunft des Steins von Rosette war Europas Interesse an den Geheimnissen des Nils noch längst nicht erloschen. Der »Orientalismus«, eine jahrzehntelange Leidenschaft für das alte Ägypten und die Kulturen des Nahen Ostens, war entfacht. Als es zwanzig Jahre später einem französischen Gelehrten namens Jean-François Champollion endlich gelang, die Hieroglyphen zu entschlüsseln, steigerte sich die Begeisterung der Europäer für die Geschichte Ägyptens und das Niltal zur regelrechten Raserei. Kaum waren die kryptischen Geheimnisse der vergessenen Sprache der Pharaonen gelüftet, öffneten sich die Schleusen des wissenschaftlichen Forscherdrangs, dessen Erkenntnisse sich wiederum bis in die Populärkultur ergossen. Archäologie und Kunst, Poesie und Mode erlagen nach und nach dem Zauber dieser glanzvollen versunkenen Hochkultur. Generationen von Aristokraten investierten Zeit und Geld, um im Wettstreit miteinander immer wieder neue Erkenntnisse über diese antike Welt zu gewinnen und sie mit der klassischen griechischen und römischen Literatur und Geschichte abzugleichen, die ihren Schulalltag geprägt hatte. Zu den reizvollsten Geschichten, die sie gelesen hatten, gehörten die verschiedenen Theorien zu den Quellen des Nils, von den Spekulationen des griechischen Historikers Herodot bis hin zu den gescheiterten Expeditionen der Prätorianergarden Kaiser Neros.
Hamilton hatte sein Land an die Spitze des neuen Trends katapultiert und seine Faszination für die Geheimnisse des Nils, die er mit dem Rest der Welt teilte, wuchs stetig. Mit zunehmendem Alter intensivierte er seine Forschungen und veröffentlichte eine eigene Übersetzung der griechischen Inschrift auf dem Rosetta-Stein. Außerdem half er dabei, die Parthenon-Skulpturen vom Meeresgrund zu bergen – eines der Schiffe, die sie transportiert hatten, war gesunken –, und ergänzte damit seine ohnehin schon beachtliche Bilanz um eine weitere umstrittene kulturelle Ikone. 1830 trug er dazu bei, Großbritanniens nationales Interesse in einer Institution zu verankern, indem er zunächst Gründungsmitglied, später dann Präsident der Royal Geographical Society wurde. Auch ihr lateinisches Motto – Ob terras reclusas, »Der Erschließung neuer Gebiete« – entstammte seiner Feder.
Großbritannien, das seine klügsten Köpfe und ein gewaltiges Vermögen darauf verwendete, den Ursprüngen der Menschheit nachzuspüren, nahm in den neuen Forschungsbereichen, die sich dabei auftaten, schon bald eine führende Rolle ein. Als Hauptorganisatorin und -fürsprecherin in diesem Zusammenhang fungierte die Royal Geographical Society. Doch während sie das British Museum mit Artefakten bestückte, derer man sich mit imperialer Gewalt bemächtigt hatte, scheiterte die Society in ihrem Bestreben, dem antiken Ägypten bis zu den Quellen des Nils nachzuspüren, an der schieren Länge des majestätischen Stroms, des längsten der Welt, der sich bereits unzähligen Vorstößen zu seinen Ursprüngen widersetzt hatte. Unermesslich weite, unerforschte, von indigenen Völkern und zahllosen Widrigkeiten der Natur heftig verteidigte Gebiete, die angeblich das geheime Erbe der gesamten modernen Welt bargen, vereitelten jeden Erkundungsversuch.
Anstatt sich stromaufwärts zu kämpfen, nur um dann entscheiden zu müssen, welcher der verwirrend vielen Zuflüsse als eigentliche Nilquelle in Frage kam, fassten Entdecker einen kühnen Alternativplan: Sie würden an der Ostküste Afrikas anlegen, weit unterhalb des Äquators, und von dort aus ins Landesinnere vordringen. Irgendwann, so ihre Hoffnung, würden sie auf die Wasserscheide stoßen, von der aus ein einzelner Fluss seine über sechstausend Kilometer lange Reise gen Norden begann, nach Ägypten. Diese epochal neue Taktik speiste sich aus den Gerüchten um eine riesige Seenlandschaft, die angeblich in Zentralafrika existierte. Außerdem wurde sie von der wachsenden militärischen Stärke Großbritanniens zu Wasser und zu Lande begünstigt, die es den Forschungsreisenden ermöglichen würde, Vorräte und Ausrüstung per Schiff zu zentralen Häfen und Verteilungspunkten wie Aden und der sagenumwobenen Insel Sansibar zu transportieren. Von einem circa vierzig Kilometer breiten Streifen Wasser geschützt, lag diese jenem Küstenort gegenüber, von dem aus eine Expedition ihren Weg ins Landesinnere antreten müsste.
Indem die Unternehmung britische Forscher in direkten Kontakt mit Afrikas Landesinnerem brachte, würde sie Menschen von einem jüngeren Schauplatz der Kulturgeschichte tatsächlich wieder mit dem Ursprung ihrer eigenen Migrationsvergangenheit verbinden, wie DNA-Analysen später zeigen sollten. Die Expedition ermöglichte somit die »Entdeckung« von Regionen, die im Gegensatz zu London oder Paris schon seit Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Jahren kontinuierlich von Menschen besiedelt gewesen waren. Wie jedoch ähnliche Begegnungen auf Hispaniola oder in Peru hinlänglich bewiesen hatten, lag im ungleichen Kräfteverhältnis zwischen beiden Seiten das Potenzial für Tragödien und Ausbeutung. Welche Konsequenzen diese gefährliche Asymmetrie nach sich ziehen konnte, hatte sich in Afrika bereits in früheren Jahrhunderten gezeigt. Damals hatten europäische, amerikanische und arabische Händler, die sich zwischen zwei Welten bewegten, aus ihrer Macht Kapital geschlagen, indem sie afrikanische Menschen versklavten und gewinnbringend verkauften. Für Forschungsreisende war dieses grausame Unrecht ebenso allgegenwärtig wie die geographischen oder klimatischen Bedingungen vor Ort, weil es sich in die Region eingeschrieben hatte, vom Standort der Häfen über die Verfügbarkeit von Nahrung bis hin zu den Pfaden, denen sie folgten. Ihre eigenen Bemühungen würden zweifellos zur Ausbeutung der Gebiete beitragen, die sie zu erkunden hofften. Wie der britische Forscher Samuel Johnson nach Captain Constantine Phipps’ Expedition zum Nordpol kaum ein Jahrhundert zuvor geschrieben hatte: »Ich wünsche den Entdeckungen[2] kein Glück, weil ich immer befürchte, sie werden Landnahme und Ausbeutung nach sich ziehen.«
Ungeachtet der wachsenden imperialen Stärke Großbritanniens und seiner wissenschaftlichen Errungenschaften war das Vorhaben, in einer so unwirtlichen, unerforschten Gegend nach der Quelle eines fernen Flusses zu suchen, derart schwierig und abschreckend, dass es nach wie vor unmöglich schien. Als aber in den 1850er Jahren der Nationalstolz der Briten herausgefordert war und das Prestige bahnbrechender wissenschaftlicher Entdeckungen sowie die Pläne für eine Ausweitung des Empire auf dem Spiel standen, beschloss die Royal Geographical Society doch, eine der kompliziertesten und anspruchsvollsten Expeditionen auf die Beine zu stellen, die jemals unternommen wurde. Auch wenn sie renommierte Wissenschaftler vom Format eines Charles Darwin oder David Livingstone zu ihren Mitgliedern zählte – für diese Aufgabe, das wusste die Society, wären mehr Erfahrung und Einsicht erforderlich als bei allen bisherigen Missionen. Abgesehen von sachkundigen Afrikanern, deren Hilfe bei der Orientierung und beim Transport von Lasten unverzichtbar war, aber selten die verdiente Anerkennung erhielt, gälte es, eine ganz außergewöhnliche Entdeckerpersönlichkeit zu finden: Sie müsste Wissenschaftler und Gelehrter, Künstler und Sprachgenie, begabter Schriftsteller und ehrgeiziger, leidenschaftlicher Forscher zugleich sein – ein Heer von savants in einer Person.
Teil IEin furchtloses Herz
1.Ein strahlendes Licht
1854 saß Richard Francis Burton in seinem kleinen Pensionszimmer im ägyptischen Sues auf einem dünnen Teppich und sah seelenruhig zu, wie fünf Männer seine karge Habe kritisch in Augenschein nahmen. Die Männer, die er gerade auf dem Hadsch kennengelernt hatte, der alljährlichen islamischen Pilgerreise nach Mekka, »besahen sich meine Kleider, inspizierten meinen[1] Medizinkasten und kritisierten meine Pistolen«, schrieb Burton. »Meine Uhr im Kupfergehäuse ließ sie nur verächtlich schnauben.« Sollten sie dahinterkommen, dass er mitnichten Scheich Abdullah war, ein in Afghanistan als Moslem geborener indischer Arzt, sondern ein zweiunddreißigjähriger Leutnant in der Armee der britischen Ostindien-Kompanie, stünde nicht nur seine sorgfältig geplante Expedition auf dem Spiel, dann wäre sein Leben in Gefahr. Burton jedoch blieb gelassen. Nicht einmal als seine neuen Freunde den Sextanten entdeckten, sein absolut unverzichtbares, doch eindeutig westliches Forschungsinstrument, fürchtete er um seine Sicherheit. »Zweifellos ein Fehler«[2], wie er später einräumte.
Burton hatte sich zum Ziel gesetzt, etwas zu tun, was noch kein Engländer vor ihm gewagt hatte und wozu wohl nur wenige die notwendige Befähigung oder Kühnheit mitgebracht hätten: Er wollte als Moslem verkleidet nach Mekka reisen. Ein solcher Plan nahm zwar zur Kenntnis, was gläubigen Muslimen das Allerheiligste war, missachtete aber zugleich ihr Recht, es vor Ungläubigen zu schützen. Burton, der sich mit jeder Religion intensiv auseinandersetzte, aber keine einzige respektierte, konnte einer solchen Versuchung nicht widerstehen: Mekka, Geburtsstadt des Propheten Mohammed, ist der heiligste Ort im Islam und Nicht-Muslimen als solcher verboten. »Um durch das Heilige Land der Muslime zu reisen,[3] musste man ihrem Glauben von Geburt an anhängen oder sich dazu bekehrt haben«, wusste Burton. Den Hadsch als Konvertit durchzuführen, wäre ihm dennoch nie in den Sinn gekommen. »Man überlässt einem ›neuen Moslem‹, zumal einem Franken [Europäer], nicht gern Informationen – seine Bekehrung könnte vorgetäuscht oder erzwungen sein –, sondern betrachtet ihn als Spion und gewährt ihm möglichst wenig Einblick in das Leben«, schrieb er. »Ich hätte das geliebte Projekt lieber aufgegeben als mir zu solch einem Preis einen zweifelhaften Teilerfolg zu erkaufen.« Als unfreiwilliger Oxfordabbrecher, wissenschaftlicher Autodidakt, zwanghafter Forscher und außerordentlich begabter Polyglotter wünschte sich Burton uneingeschränkten Zugang zu jeder heiligen Stätte, die er erreichte, das Vertrauen eines jeden Mannes, dem er begegnete, und eine Antwort auf jedes Mysterium, auf das er stieß. Er wolle »das Leben der Muslime von innen her« erfassen, schrieb er, nicht mehr und nicht weniger. Lebend nach England zurückkehren wollte er allerdings auch.
Indem er sich als Moslem ausgab, riskierte Burton den gerechten Zorn all jener, für die der Hadsch das heiligste aller Glaubensrituale war. Obwohl »weder Koran noch Sultan[4] die Ermordung jüdischer oder christlicher Eindringlinge vorschreiben, wäre keine Obrigkeit, sobald ein Pilger sich als Ungläubiger zu erkennen gäbe, noch imstande, ihn zu beschützen«. Ein einziger Fehler konnte ihn das Leben kosten. »Ein Missgriff, eine hastige Bewegung, eine unüberlegte Äußerung,[5] ein Gebet, eine Verneigung, nicht das exakt richtige Losungswort«, schrieb er, »und meine Knochen würden jetzt den Wüstensand bleichen.«
Burtons Plan erforderte zudem die Durchquerung der Rub al-Chali, der »leeres Viertel« genannten größten Sandwüste der Welt, in seinen Worten ein »riesiger weißer Fleck«[6] auf den Landkarten des neunzehnten Jahrhunderts. So ehrgeizig war sein Vorhaben, dass Sir Roderick Impey Murchison, damals Präsident der Royal Geographical Society, auf die Expedition aufmerksam wurde. Für Murchison, der die Geographische Gesellschaft fast ein Vierteljahrhundert zuvor gemeinsam mit William Richard Hamilton gegründet hatte, war Burtons Mission exakt die Art von Forschung, die es zu fördern galt. Er »erwies mir die Ehre«,[7] so Burton, »mein Gesuch auf drei Jahre Beurlaubung wegen eines Sonderdienstes … aufs freundlichste zu unterstützen«. Die Ostindien-Kompanie hingegen, eine zweihundertfünfzig Jahre alte Privatgesellschaft mit eigenen Truppen, wollte ihn nicht länger freistellen als ein Jahr. Die Reise sei zu gefährlich, so ihr Argument, und Burton habe sich während seiner Militärzeit mehr Feinde als Freunde gemacht. Dennoch blieb die Royal Geographical Society bei ihrem Versprechen, die Expedition finanziell unterstützen zu wollen. Nach Murchisons Ansicht war Burton für eine Herausforderung dieser Größenordnung wie kein anderer »bestens qualifiziert«.[8]
Obwohl die Mitglieder der Royal Geographical Society von Burtons Leistungen beeindruckt waren, hegten die meisten doch gewisse Vorbehalte gegen diesen ungewöhnlichen jungen Mann, der nur dem Namen nach Brite zu sein schien. Burton war in der südenglischen Grafschaft Devon geboren, am Ärmelkanal, hatte aber weitaus weniger Zeit in seiner Heimat verbracht als auf Reisen durch die Welt. Dieses Muster hatte bei ihm schon sehr früh eingesetzt: Sein Vater Joseph Netterville Burton, ein pensionierter Oberstleutnant der British Army, war bereits vor Richards erstem Geburtstag mit seiner Familie nach Frankreich übersiedelt. In den darauffolgenden achtzehn Jahren[9] waren die Burtons weitere dreizehnmal umgezogen, von Blois nach Lyon, von Marseille nach Pau, von Pisa nach Siena, dann nach Florenz, Rom und Neapel, und stets nur kurz geblieben. Als Erwachsener empfand sich Burton aber weniger als Weltbürger denn als Mann ohne Heimat, und er teilte dieses Gefühl mit seinen jüngeren Geschwistern Maria und Edward. »Da wir im Ausland aufgewachsen[10] waren, konnten wir die englische Gesellschaft nie so recht verstehen«, schrieb er, »so wenig wie sie uns verstand.«
Nicht nur, dass Burton sich nicht als Brite fühlte, man ließ ihn auch des Öfteren wissen, und das auf wenig schmeichelhafte Weise, dass er nicht sonderlich britisch aussah. Wer ihm einmal begegnet war, der vergaß sein Gesicht nie mehr. Dracula-Autor Bram Stoker war von seiner ersten Begegnung mit Burton tiefbeeindruckt: »Der Mann fiel mir sofort ins Auge.[11] Er war dunkel und kraftvoll, herrisch und ruchlos. … Einen wie ihn hatte ich noch nie gesehen. Wie aus Stahl! Er ging einem durch und durch, wie ein Schwert!« Der Dichter Algernon Charles Swinburne schrieb, sein Freund Burton habe »den Kiefer eines Teufels und die Stirn eines Gottes«,[12] während sein Blick ein »unbeschreibliches Grauen« hervorrufe. Burtons schwarze Augen, ein Erbe seines englisch-irischen Vaters, schienen jeden in ihren Bann zu schlagen, der ihn traf. Freunde, Feinde und Bekannte beschrieben sie im Wechsel als magnetisch, gebieterisch, aggressiv, brennend oder gar schrecklich, und zogen Parallelen zu jedem gefährlichen Raubtier, das ihnen einfiel – vom Panther bis zur »giftigen Schlange«. Nicht minder auffällig waren sein dichtes schwarzes Haar, seine tiefe, sonore Stimme und sogar sein Gebiss. Letzteres diente möglicherweise als Inspiration für den berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte: Wie sich Burtons Oberlippe beim Sprechen bedrohlich anhob, so Stoker, werde er niemals vergessen. »Sein Fangzahn zeigte sich in voller Länge«, schrieb er begeistert, »wie ein blitzender Dolch.«
Burton hatte sich von klein auf geprügelt, in den Gassen, in der Schule und mit aufgebrachten Hauslehrern. Obwohl sein Vater die Familie auf dem Kontinent von einer Stadt in die nächste geschleppt hatte, sollten seine Kinder eine britische Schulbildung erhalten, die in einem strengen Internat in Richmond ihren Anfang nahm. Burton erinnerte sich später, in dieser Schule, die er mit Charles Dickens’ Fabrik[13] für Stiefelwichse verglich, vor allem zweierlei gelernt zu haben: »den Gebrauch der Fäuste und einen allgemeinen Hang zur Grobheit. Ich prügelte mich immerzu; einmal hatte ich zweiunddreißig Ehrenhändel zu begleichen.« Nachdem ein Ausbruch der Masern etliche Schüler das Leben gekostet und die Schließung der Schule zur Folge hatte, durften Edward und er nach Boulogne zurückkehren, und die beiden schockierten die übrigen Schiffspassagiere, weil sie darüber jubelten, England endlich hinter sich zu lassen: »Wir kreischten, jauchzten, tanzten[14] vor Freude, reckten die Fäuste gegen die weißen Klippen und äußerten lautstark die Hoffnung, sie niemals wiederzusehen«, so Burton. »Wir ließen Frankreich hochleben und pfiffen auf dieses England, in dem die Sonne niemals untergeht.«
Sein Vater brachte Burton[15] das Schachspiel bei, doch abgesehen davon lernte er fast alles, was er wusste, von einer Reihe entweder angsteinflößender oder angstgebeutelter Hauslehrer. Und fachunabhängig hatten sie alle die Erlaubnis, ihre Schüler zu züchtigen, bis diese alt genug wären zurückzuschlagen. In späteren Jahren sollte Burton den verheerenden Schaden bedauern, den der unkluge Ausspruch des weisen Salomo,[16] »Wer sein Kind liebt, der züchtigt es«, angerichtet hatte. Als Jugendlicher setzte er sich zur Wehr. Der arme, nervöse Musiklehrer, der Burton Geigenunterricht erteilen sollte – »fleischlose Nerven, die an Drähten hingen«,[17] wie Burton ihn später verächtlich beschrieb, »nur Haare und kein Hirn« –, kündigte den Dienst, nachdem sein Schüler eine Geige auf seinem Kopf zertrümmert hatte.
Der einzige Lehrer aus Kindertagen, den Burton respektierte, war sein Fechtmeister, ein ehemaliger Soldat mit nur noch einem Daumen. Den anderen hatte er in der Schlacht eingebüßt. Richard und sein Bruder traten mit solchem Ungestüm gegeneinander an, dass ihre Übungen fast in einer Tragödie geendet hätten. »Wir lernten bald, niemals ohne Maske[18] zu fechten«, schrieb Richard. »Ich habe Edward mein Florett in den Schlund gestoßen und hätte um ein Haar sein Gaumenzäpfchen zerstört, was mir viel Kummer bereitete.« Die Lektionen machten sich bezahlt, denn sie brachten einen der geschicktesten Fechter Europas hervor. Burton erwarb den begehrten Titel Maître d’Armes,[19] perfektionierte zwei Florettstöße und verfasste zwei Bücher – The Book of the Sword und A Complete System of Bayonet Exercise –, die von der britischen Armee im selben Jahr veröffentlicht wurden, in dem Burton nach Mekka aufbrach. Wie er später einräumen würde, war ihm das Fechten stets »ein großer Trost im Leben«.[20]
Als er älter wurde, entwickelte Burton ein weiteres, stark ausgeprägtes Interesse, das ihn durch sein Leben begleiten, der gutbürgerlichen Gesellschaft allerdings noch mehr entfremden würde: Sex. Zunächst hatte er vor allem Affären mit schönen Frauen von Italien bis Indien, doch schon bald erwuchs daraus ein seiner Forschernatur entsprechendes Vordringen in erotische Gefilde, die im viktorianischen England weit weniger Akzeptanz fanden. Als junger Offizier im Sindh, heute eine Provinz im Südosten Pakistans, erkundete er die homosexuellen Bordelle und verfasste dann einen Bericht für seinen Kommandanten, von dem Burton später behauptete, dass er seine Karriere sabotiert hätte. Seine ethnologischen Studien, die ihn von Asien über Afrika bis nach Nordamerika führen würden, konzentrierten sich nicht nur auf Kleidung, Religion und Familienstrukturen seiner Studienobjekte, sondern schlossen auch deren Sexualpraktiken mit ein. Die unverblümten und detailreichen Schilderungen von Polygamie, Polyandrie, Päderastie und Prostitution schockierten seine Leser. Burton jedoch hatte nichts übrig für die Prüderie der Briten. Was er als »Unschuld der Worte, nicht der Gedanken«[21] bezeichnete, als »Tugend der Zunge, aber nicht des Herzens«, interessierte ihn nicht.
Auch wenn Burton sich seiner nomadischen Kindheit und skandalösen Neigungen wegen als Außenseiter empfand, den seine Landsleute misstrauisch beäugten, so hatte er in dieser Zeit doch eines über sich gelernt: »Er war in der Lage, sich eine Fremdsprache gleichsam im Handumdrehen anzueignen«, wie einer seiner verblüfften Lehrer es ausdrückte. Am Ende beherrschte er mehr als fünfundzwanzig verschiedene Sprachen und dazu noch mindestens ein Dutzend Dialekte. Bis zu einem gewissen Grad war Burtons Sprachtalent das Produkt natürlicher Begabung und früher Übung. »Ich war zum elenden Dasein[22] eines Wunderknaben verdammt«, erklärte er, »und begann mit drei Jahren Latein, mit vier Jahren Griechisch zu lernen.« Zu einem der begabtesten Sprachforscher der Welt wurde er jedoch dank seines Interesses an fremden Kulturen und seines methodischen Verstandes. Er hatte schon früh ein System entwickelt, mit dessen Hilfe er die meisten Sprachen binnen zwei Monaten erlernen konnte, und schien nicht zu begreifen, warum andere sich dabei so schwertaten. »Ich arbeite nie länger als eine Viertelstunde[23] am Stück, weil danach das Gehirn an Frische verliert«, schrieb er. »Wenn ich an die dreihundert Wörter gelernt habe, was in einer Woche gut zu schaffen ist, überfliege ich ein einfaches Buch (eines der Evangelien lässt sich fast überall leicht besorgen), und unterstreiche jedes Wort, das ich mir zu merken wünsche, um danach einmal am Tag meine Bleistiftereien durchzugehen. … Der Sprache ist damit das Genick gebrochen, und Fortschritt stellt sich von nun an rasch ein.«
Nachdem er seinen Rauswurf aus Oxford provoziert hatte, wo man ihn lächerlich gemacht, ignoriert und letztlich gelangweilt hatte, war Burton der 18. Native Bombay Infantry beigetreten, einem Regiment der Ostindien-Kompanie. Da er im Übersetzen eine der schnellsten Methoden[24] sah, um durch die Ränge aufzusteigen, brachte er sich in sieben Jahren zwölf Sprachen bei. Nach seiner Ankunft in Indien hatte er sofort mit Hindustani begonnen, legte schon sechs Monate später mit vielen anderen Sprachbegabten die Prüfung ab und überflügelte sie alle mit Leichtigkeit. In den folgenden Jahren[25] ergänzte er die lange Liste der Sprachen, die er beherrschte, stetig und kontinuierlich – um Gujarati, Marathi, Armenisch, Persisch, Sindhi, Punjabi, Paschtunisch, Sanskrit, Arabisch, Telugu und Türkisch – und schnitt dabei, trotz talentierter Konkurrenten, selten als Zweiter ab.
Im Sog seiner Leidenschaft für Sprachen vergaß Burton oft, dass nicht alle seine übergroße Begeisterung teilten. Sein Buch über die Falknerei – Falconry in the Valley of the Indus, eines von fünf Büchern, die er zwischen 1851 und 1853 verfasste – war mit so vielen indischen Dialektbegriffen gespickt, dass ein britischer Rezensent sich offen über ihn lustig machte: »Wäre der Autor nicht derart stolz auf seine Kenntnis[26] orientalischer Sprachen, dass er es für wünschenswert erachtet, besagtes Wissen durch unentwegte Beimengung fremdländischer Vokabeln in den Text zur Schau zu stellen, könnte dieses Buch als ein durchaus erfreulicher Beitrag zur Zoologie und Falknerei des Orients gelten. … Wir finden seine Affektiertheit schier unerträglich«, rügte der Rezensent, »und wünschen uns inständig, er möge sich für den Rest seines irdischen Daseins mit dem Gebrauch von verständlichem Englisch begnügen.« Burton dachte nicht daran; für seine Leidenschaft würde er sich nicht beschämen lassen. »Ich befasse mich seit Jahren[27] mit der Literatur und Sprache des Sindh«, konterte er. »Ein Land immerhin von der Größe Englands.« Er schrieb sogar einen offenen Brief an die Bombay Times, um an den Sprachprüfungen innerhalb der Ostindien-Kompanie Kritik zu üben, die seiner Ansicht nach für einen ernsthaften Studenten keine große Herausforderung darstellten. »Die Aufgabe mag furchteinflößend scheinen,[28] aber dieser Schein trügt«, schrieb er. »Jeder Mann mit moderaten Fähigkeiten dürfte mit ein wenig Fleiß und ohne nennenswerten Aufwand binnen Jahresfrist in der Lage sein, besagte Prüfung zu bestehen.«
Dass er die legendär schwierigen und stark kompetitiv ausgerichteten Prüfungen derart achselzuckend abtat, trieb Burtons Offizierskameraden, die sich oft jahrelang mit dem Erwerb einer Sprache abmühten, in den Wahnsinn. Einer reagierte besonders gereizt auf Burtons lässige Überheblichkeit – und würde dessen Behauptung, Linguisten seien »eine gefährliche Spezies«,[29] letztlich bestätigen: Christopher Palmer Rigby galt als eines der herausragendsten Sprachtalente in der Ostindien-Kompanie. Mit gerade einmal zwanzig Jahren hatte er die Prüfungen in Hindustani und Marathi bestanden und seine Sprachkenntnisse noch vor dem dreißigsten Lebensjahr um das Kanaresische, Persische und Arabische erweitert. 1840, während seines Aufenthaltes in Aden, lernte er nicht nur Somali, sondern verfasste zudem das Buch An Outline of the Somali Language and Vocabulary, das Burton bewunderte und zu dem Zeitpunkt, da er selbst die Sprache erlernte, ausgiebig nutzte. Als Rigby seine Gujarati-Prüfung ablegte,[30] ging man dementsprechend davon aus, er werde als Bester abschneiden. Doch zur Überraschung aller, nicht zuletzt der seinen, musste er diese Ehre an Richard Francis Burton abtreten.
Jahre später würde Rigby seinem Konkurrenten beweisen, dass Linguisten nicht nur eine gefährliche, sondern auch eine äußerst nachtragende Spezies waren. Burton sollte die Prüfung im Arabischen, das ihm so vertraut war, dass er es als »meine Muttersprache«[31] bezeichnete, erst 1855 ablegen. In der Annahme, sie mühelos bestanden zu haben, verließ er gleich darauf das Land. »Ich darf wohl ohne Überheblichkeit[32] von mir behaupten«, schrieb er, »dass ich bereits mehr Vokabeln wieder vergessen habe als die meisten Arabisten jemals zu lernen imstande sind.« Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass er in Wahrheit durchgefallen war, weil die Rahmenbedingungen laut Aussage des Prüfungskomitees in Bombay nicht dem Standard entsprachen. Der Arabist George Percy Badger würde Burton siebzehn Jahre später in einem Brief erklären, er habe auf »die Absurdität verwiesen,[33] dieses Komitee über Ihre Befähigung urteilen zu lassen, denn meiner Ansicht nach besaß keines seiner Mitglieder auch nur ein Zehntel Ihrer Arabischkenntnisse.« Der Präsident des Komitees zum fraglichen Zeitpunkt hieß Christopher Palmer Rigby.
Burton wusste, dass sein Arabisch, selbst wenn es tatsächlich dem eines Muttersprachlers gleichkäme, nicht genügen würde, um in Mekka seine Tarnung zu gewährleisten, und so hatte er seine Reise Monate im Voraus sorgfältig geplant. Noch in England hatte er in aller Stille die Identität von »Scheich Abdullah« angenommen, sich den Kopf geschoren, einen Bart wachsen lassen, in weite Gewänder gehüllt und mit Hilfe von Walnussöl einen dunkleren Teint zugelegt. Er hatte sich sogar beschneiden lassen,[34] wohlweislich nach dem arabischen, nicht dem jüdischen Ritus. In Kairo angekommen, hatte Burton, der doch bereits Persisch, Hindustani und Arabisch sprach – die drei Idiome, die es seiner Ansicht nach zu beherrschen galt, um »jeder Prüfung standzuhalten« – und über solch detaillierte Islamkenntnisse verfügte, dass er den Koran zu einem Viertel auswendig rezitieren konnte, einen ehemaligen Chatíb angeheuert, einen islamischen Freitagsprediger, der ihm helfen sollte, seine Grammatik zu verfeinern und sein theologisches Wissen zu erweitern. Schließlich hatte er wie alle Pilger sein Geld sorgfältig aufgeteilt: Eine gewisse Summe hatte er in einen Ledergürtel eingenäht und den Rest in Kisten verpackt, da er davon ausgehen musste, auf den stark frequentierten Pilgerwegen des Hadsch von Wegelagerern überfallen zu werden. »Finden sie ausreichend Bares[35] im Gepäck, sehen sie von einer Durchsuchung des Pilgers ab«, erklärte Burton seinen Lesern. »Werden sie dagegen nicht fündig, gehen sie zur Leibesvisitation über, und sollte sein Gürtel leer sein, sind sie durchaus geneigt, ihm den Bauch aufzuschlitzen, da sie annehmen, er habe ein besonders raffiniertes Versteck für seine Wertsachen gefunden.«
Doch selbst die gewissenhafteste Vorbereitung, selbst die sorgfältigste Planung kann von einem einzigen Fehler zunichtegemacht werden. Nachdem Burton den Männern, die jetzt in seinem Zimmer saßen und seine Taschen inspizierten, zum ersten Mal begegnet war,[36] hatte er ihre Freundschaft wochenlang gehegt und gepflegt, ihnen Geld für die Pilgerreise geliehen, sie in lange, weitschweifige Gespräche verwickelt und mit seiner umfangreichen Kenntnis der islamischen Theologie und Literatur beeindruckt. Sie hatten Burton daher längst nicht nur freudig, sondern geradezu überschwänglich als Mitpilger akzeptiert. Nun jedoch beäugten sie argwöhnisch seinen Sextanten.
Gegen den Rest seiner Habseligkeiten hatten die Männer nichts einzuwenden: einige Kleidungsstücke, eine Pistole, ein Degen, der Koran, drei Wasserschläuche, ein mit roten und gelben Blumen verzierter, schier unverwüstlicher erbsengrüner Arzneikasten, außerdem von ihm »Hausfrau« genanntes Nähzeug, das Geschenk einer Verwandten, bestehend aus einer »Rolle groben Leinens,[37] mit Nadeln und Zwirn gespickt, Schusterpech und Knöpfen«. Ansonsten hatte er alles zurückgelassen, was Misstrauen[38] erregen konnte und verzichtbar war. Den Sextanten jedoch benötigte er dringend für seine wissenschaftlichen Messungen in Mekka. Also hatte er ihn so gut es ging getarnt, indem er sein goldenes Behältnis durch ein geschwärztes, mit arabischen Ziffern versehenes ersetzt hatte. Als die Männer das Instrument entdeckten, veränderten sich ihre Mienen jedoch schlagartig, und aus unbefangener Kameradschaft wurde schwelender Argwohn.
Niemand sprach ein Wort. Doch gleich als Burton den Raum verlassen hatte, verriet ihn sein einziger Diener, ein untersetztes ägyptisches Milchgesicht namens Mohammed al-Basyúni. Er war zwar kaum achtzehn Jahre alt, aber außerordentlich klug – weitgereist, gut im Feilschen und in der Lage, sich jeder Situation im Handumdrehen anzupassen. »Er konnte ausgezeichnet fluchen«,[39] schrieb Burton über Mohammed, und »betete voller Inbrunst«. Burton hatte von seinem Diener nicht viel verlangt: »Gesund sollte er sein, gerne reisen, außerdem ein wenig kochen, nähen und waschen können, notfalls kämpfen und regelmäßig beten.« Bekommen hatte er einen blitzgescheiten[40] jungen Mann, der stets ein waches Auge auf ihn hatte. Und Mohammed hatte tausend Gelegenheiten erhalten, Burton bei einem Fehltritt zu ertappen: die Art und Weise, wie er seine Gebetsperlen hielt, auf einem Stuhl saß oder sein Glas hob, um einen Schluck Wasser zu trinken – Situationen voller Komplikationen und potenzieller Fallstricke. Um durchführen zu können, wozu er gekommen war – Mekka nicht nur zu sehen, sondern zu erkunden, zu vermessen, zu skizzieren und ausführlich zu beschreiben –, hatte Burton jede nur erdenkliche List angewandt. Er hatte sogar seinen Stift mit einer Art Führungsdraht präpariert, um sich im Dunkeln, sobald Mohammed eingeschlafen war, Notizen machen zu können.
Mohammed habe ihm »von Anfang an misstraut«,[41] würde Burton später einräumen. Und als sich ihm nun endlich die Gelegenheit bot, den scheinbar frommen Scheich Abdullah zu überführen, griff er zu. Er wandte sich an die Männer, die auf den Sextanten starrten, und zögerte keine Sekunde, seinen bösen Verdacht zu äußern. »Dieser Möchtegern-Hadschi«,[42] erklärte er, »ist ein Ungläubiger.« Doch zu Mohammeds Erstaunen stellten sich die Männer, anstatt ihm beizupflichten, auf die Seite ihres Freundes. Einer schwor sogar, dass das »Licht des Islam meine Züge erhelle«, sollte Burton später erfahren. Ein anderer, der am selben Morgen einen Brief gesehen hatte, den Burton an einen muslimischen Freund schrieb – heikle theologische Angelegenheiten betreffend –, »fühlte sich berufen, die Ansicht des jungen Mohammed ex cathedra für haltlos zu erklären«. Gleich darauf hagelte es verbale Schläge: Der verblüffte Bursche wurde als »Hungerleider« beschimpft, als »Fakir, Eule, Abgeschnittener, Fremdling …, weil er es gewagt hatte, die Frömmigkeit eines Glaubensbruders in Zweifel zu ziehen.«
Burton war vorerst gerettet. Dank seines über die Jahre erworbenen Wissens war es seinen Freunden unmöglich zu glauben, dass er ein anderer sein könnte als der, der zu sein er vorgab – ein frommer indischer Moslem. Er wusste jedoch, dass diese Galgenfrist ein Opfer verlangte. Er konnte den Sextanten nicht behalten. Dabei wäre ihm in den kommenden Tagen nichts von größerem Nutzen gewesen als dieses Instrument. »Ich beschloss also schweren Herzens,[43] ihn zurückzulassen«, schrieb er, »und betete fast eine Woche lang fünfmal am Tag.«
Mohammed hatte Burton zweifellos auch weiterhin in Verdacht, ließ ihn aber während des Hadsch nicht im Stich. Stattdessen führte er ihn nicht nur nach Mekka, sondern mitten hinein ins Herz des Islam: vor die Kaaba, einen Schrein im Zentrum der al-Haram-Moschee, der meistbesuchten Moschee der Welt. Burton, den erbitterte Puritaner zeit seines Lebens der Blasphemie bezichtigen würden, war von Religion als Studienobjekt schon immer fasziniert gewesen. Er widmete sich dem Verständnis der Weltreligionen mit derselben inbrünstigen Neugier, demselben systematischen Ansatz, mit dem er sich den Sprachen und Kulturen annäherte. Für die westliche Vorstellung, das Christentum sei die einzige ernstzunehmende Religion, hatte er nur Verachtung übrig. »Welche Nation, ob im Westen oder im Osten,[44] darf sich rühmen, ihre Zeremonien vom alten Götzenglauben gänzlich reingewaschen zu haben? Was ist denn der Mistelzweig, die irische Totenwache, der bretonische Pardon, der Karneval?«, fragte er. »Man sollte die rituelle Pilgerfahrt nach Mekka also eher im Lichte einer zum Tugendkanon gewandelten Teufelsanbetung betrachten, als über das Seltsame daran zu salbadern und sich zu blamieren, indem man sie als belanglos abtut.« Obwohl er sich in seinen Studien vor allem dem Islam gewidmet hatte, war Burton von allen Religionen fasziniert, vom Katholizismus bis zum Judentum, vom Hinduismus, Sufismus, Sikhismus bis hin zum Spiritismus und sogar Satanismus. Tatsächlich erwog er kurz, eine Biographie Satans zu verfassen, seiner Ansicht nach »der wahre Held des Verlorenen Paradieses,[45] gegen ihn sind Gott und Mensch überaus gewöhnlich«. Für Burton war nichts tabu oder unrein; er hatte keine Angst vor der himmlischen Verdammnis – und erst recht nicht vor der irdischen. Der einzige Aspekt an Religion, der ihm zuwider war, bestand in der Vorstellung, es gebe wahre Gläubige. »Je mehr ich mich mit Religion befasse«,[46] schrieb er, »desto mehr gelange ich zu der Überzeugung, dass der Mensch immer nur sich selbst anbetet.«
Obwohl Burton ein Spion war, dazu ein Ungläubiger und Agnostiker, konnte er der Macht dieser religiösen Erfahrung nicht widerstehen, die zu den profundesten der Welt zählt. Er schloss sich den vielen tausend Männern an, die sich im Innenhof der Moschee drängten, umkreiste die Kaaba siebenmal gegen den Uhrzeigersinn und berührte die Kiswa, ein großes schwarzes Seidentuch, das den Schrein verhüllte. Nach jahrelangen Studien wusste er genau, was in Gegenwart der Kaaba zu sagen und zu tun war, doch die überwältigenden Emotionen, die nun in ihm aufwallten, entsprangen nicht etwa religiösem Eifer, sondern seinem persönlichen Triumph. »Ich darf wohl mit Fug und Recht behaupten,[47] dass keiner der Gläubigen, die sich weinend an den Vorhang klammerten oder ihre pochenden Herzen gegen den Stein drückten, in diesem Moment tiefer bewegt war als der Hadschi aus dem fernen Norden«, schrieb er. »Und doch, so viel Demut vor der Wahrheit muss sein: Das ihre war das hehre Gefühl religiöser Verzückung, das meine die Ekstase befriedigten Stolzes.«
Selbst inmitten der frommen Inbrunst, die ihn umgab und mitriss, vergaß Burton keinen Augenblick den Zweck seines Kommens. Er ließ den Blick schweifen, um sich nur ja jedes Detail zu merken, damit er es zu Papier bringen konnte, sobald er allein war. Seine Konzentrationsfähigkeit wurde jedoch auf eine harte Probe gestellt, als er im Innenhof stand, die heiße Septembersonne auf seinem unbedeckten Haupt und den bloßen Armen spürte, und plötzlich erfuhr, dass nach ihm geschickt worden war. »Ich dachte: ›Jetzt ist es um mich geschehen‹«,[48] schrieb er später, »sie haben Verdacht geschöpft.« Da hörte er jemanden rufen: »Gebt den Weg frei für den Hadschi, der das Haus betreten möchte«, woraufhin ihn drei Männer zum Eingang der Kaaba emporhoben, der sich in gut zwei Metern Höhe an ihrer nordöstlichen Wand befand: Vier Arme schoben ihn von unten, zwei zogen von oben. Obwohl dieses seltene Privileg von Mohammed arrangiert worden war und die Krönung sowohl Burtons aufwendiger List als auch all seiner Studien darstellte, wusste er gleichzeitig, dass nichts ihn »vor den gezückten Messern[49] erzürnter Eiferer hätte bewahren können, wäre er im Haus enttarnt worden«.
Kaum war Burton in die Kaaba gelangt, packte ihn die Angst, die er bis zu jenem Augenblick erfolgreich verdrängt hatte. »Ich will nicht leugnen«, schrieb er, »dass meine Gefühle angesichts der fensterlosen Wände[50] und der Wächter an der Tür denen einer gefangenen Ratte gleichkamen.« Nachdem er von einem Wächter befragt worden war, dem er erfolgreich auf Arabisch geantwortet hatte, konzentrierte er sich, betrachtete die schweren Säulen, den Marmorboden, die mit Inschriften verzierten Wände und die mit rotem Damast bespannte, »mit goldenen Blüten durchwirkte Decke«. Schließlich gab er vor zu beten,[51] holte dabei langsam einen Stift hervor und skizzierte auf dem weißen Leinen seines Ihram-Gewandes einen groben Plan vom Inneren des allerheiligsten Schreins des Islam.
Bald nach seiner Besichtigung der Kaaba, erleichtert, nicht enttarnt worden zu sein, »sehnte sich Burton danach, Mekka zu verlassen«.[52] Er war »völlig ausgezehrt und erschöpft,[53] nicht zuletzt von der sengenden Hitze«, und fand, es sei an der Zeit, die lange Rückreise anzutreten. Während seine Mitpilger die Bürde ihrer Sünden in Mekka abgestreift hatten, war Burton zumute, als habe seine Last sich vervielfacht. Obwohl er stolz war, den Hadsch vollzogen zu haben, glaubte er nicht so recht an religiöse Neugeburten, die seiner Meinung nach ohnehin nur von kurzer Dauer waren. Dies gelte nicht nur für Muslime, sondern für Anhänger jeder Glaubensrichtung, argumentierte er, »sowohl für den Calvinisten,[54] der nach dem sonntäglichen Gebet bereits am Montag wieder inbrünstig sündigt, als auch den Katholiken, der nach Beichte und Buße sogleich wieder mit Lust deren Ursachen verfällt«. Alle, die am Fuß der Kaaba neben ihm gebetet hatten, waren »›weißgewaschen‹ – ihr Sündenregister eine tabula rasa«, schrieb er, doch »manch einer hatte im Nu ein neues Konto eröffnet.«
Burton wusste, dass er kein echter Gläubiger war und dass seine Dämonen, auch wenn er die Kaaba betreten hatte, nicht einmal vorübergehend gebannt waren. Er hatte außerdem kein richtiges Zuhause, zu dem er zurückkehren konnte. Sein Erfolg in Mekka würde ihm in England Ruhm einbringen, Bewunderung seitens der Royal Geographical Society, und Möglichkeiten in seinem Heimatland eröffnen, die sich zuvor nicht geboten hatten, doch nichts von alledem würde etwas daran ändern, dass er stets ein Außenseiter bleiben würde. Er erwartete keinen Heldenempfang, doch ebenso wenig sollten seine Landsleute ihn neugierig begaffen, um sich sogleich wieder von ihm abzuwenden. »Es ist großartig, wenn ein kleiner Teil[55] der weiten Welt unsereinen stolz willkommen heißt, weil unsere Errungenschaften auch ihm zur Ehre gereichen«, schrieb er. »Geschieht dies nicht, ist man ein heimatloser Streuner; ein strahlendes Licht ohne Fokus. Außerhalb des heimischen Herds schert sich kein Mensch um einen.«
Als Burton endlich in See stach, noch immer als Scheich Abdullah verkleidet, zog es ihn nicht nach England, wo ihn Ehrungen erwarteten, sondern ins altehrwürdige Ägypten. Er durchsegelte das schmale Rote Meer, reiste weiter gen Westen und dann in nördlicher Richtung nach Kairo, der Stadt, an der sich auf seiner mäandernden Reise von seiner noch immer mysteriösen Quelle in Tausenden Kilometern Entfernung aus der Nil vorüberwälzte. Burton sehnte sich nach Ruhe und Einsamkeit, um die Geschichte seiner eigenen Reise niederzuschreiben und seine nächste Expedition zu planen, wohin auch immer sie ihn führen mochte.
2.Schatten
Richard Burton hielt sich noch immer in Kairo auf, als er erfuhr, dass der deutsche Missionar und Entdecker Johann Krapf in Ägypten angekommen war, mit Geschichten von den Mondbergen und der Quelle des Nils im Gepäck. Burton hatte sich im Shepheard Hotel verkrochen, einem massiven Steingebäude, das »eher einer grimmigen alten Baracke« glich, schrieb ein amerikanischer Generalkonsul, »als einem Hotel«. Mit zunehmender Prachtentfaltung[1] im Laufe der Jahre würde es eines Tages Persönlichkeiten wie T.E. Lawrence, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, den Aga Khan und den Maharadscha von Jodhpur willkommen heißen. Hundert Jahre später, in den Unruhen am Vorabend der Revolution, würde es in Flammen aufgehen und neu aufgebaut werden, aber im Herbst 1853 erhob sich das Shepheard Hotel inmitten der üppigen, anmutigen Gärten, in denen Napoleon während des Ägyptenfeldzugs seine Soldaten stationiert hatte. Von seinem Balkon aus[2] blickte Burton auf eine lange Biegung des Nils, der sich durch die Stadt wand.
Burton brauchte die Gewänder nicht mehr, die ihn auf dem Hadsch begleitet hatten, trug sie aber weiterhin. Noch Monate nach seinem Aufenthalt in Mekka weigerte er sich, seine Tarnung aufzugeben, sprach Arabisch und unterzeichnete die Briefe an seine Freunde, selbst Schreiben an die Royal Geographical Society mit Scheich Abdullah. Eines Abends schlenderte er mehrmals an einer Gruppe britischer Offiziere vorbei, die vor dem Hotel herumsaßen. Mit jedem Mal kam er den Männern, von denen er mehrere kannte, ein wenig näher, bis sein Gewand schließlich einen von ihnen streifte. Der Mann verfluchte, was er für die Unverschämtheit eines Arabers hielt, und rief aus: »Beim nächsten Mal verpass ich ihm einen Tritt!« Da hielt Burton abrupt inne, und zur Überraschung aller warf er dem Mann in makellosem Englisch hin: »Verdammt nochmal, Hawkins,[3] begrüßt man so einen Kameraden, den man zwei Jahre lang nicht gesehen hat?«
Den Großteil seiner Zeit in Ägypten verbrachte Burton aber nicht mit alten Freunden, sondern allein mit seinen Gedanken, die meisten finsterer Natur. Sein Hochgefühl war in tiefe Schwermut umgeschlagen. Trotz seines Erfolges in Mekka konnte er nur daran denken, dass er die Arabische Halbinsel nicht, wie ursprünglich geplant, durchquert hatte. In einem Brief an Norton Shaw, den Sekretär der Royal Geographical Society, gab er zu, seit seiner Rückkehr nach Kairo an der Ruhr zu leiden. »Ich will nicht behaupten, dass meine Abscheu[4] über mein eigenes Versagen meinen Zustand verschlimmert hat, aber seien wir ehrlich: Die ›Physis‹ eines erfolgreichen Mannes unterscheidet sich doch grundlegend von der des armen Teufels, der versagt hat.« Dennoch war diese gedrückte Stimmung letztendlich weniger seinen Niederlagen als seinen Erfolgen geschuldet. Dass seine Leistungen von argwöhnischen Landsleuten und missgünstigen Rivalen in Frage gestellt und kritisiert würden, hatte er gewusst – und es war ihm gleich. Was ihm jedoch zu schaffen machte, war die Gewissheit, nun nichts mehr zu haben, worauf er seine Gedanken und Talente konzentrieren konnte. »Wie betrüblich ist doch der Erfolg«,[5] würde er später schreiben. »Während das Scheitern uns anspornt, lehrt das Gelingen uns die traurige, nüchterne Lektion, dass all unsere Herrlichkeiten nichts weiter sind als ›substanzlose Schatten‹.« Er brauchte eine neue Herausforderung, einen Ausweg aus dieser andauernden, quälenden Düsternis, und den hatte Johann Krapf ihm soeben geliefert.
Krapf hatte die vergangenen siebzehn Jahre in Ostafrika verbracht. Wie Burton war auch er von Sprachen fasziniert, befasste sich mit dem Altäthiopischen, dem Amharischen und mit Swahili. Nachdem in rascher Folge zuerst seine beiden Töchter und dann seine Frau gestorben waren, deren von Krankheit gezeichneten Leichnam er unweit von Mombasa auf einem Scheiterhaufen verbrannt hatte, gründete er in New Rabai, etwa vierundzwanzig Kilometer die Küste hinauf, eine Missionsstation. Zwei Jahre später[6] hatte sich ein weiterer Missionar aus Deutschland zu ihm gesellt, Johannes Rebmann, und gemeinsam erkundeten die beiden Männer die Region und erblickten als erste Europäer die zwei höchsten Berge Afrikas – das Mount-Kenya-Massiv und den Kilimandscharo.
Burton hatte wenig übrig[7] für europäische Missionare, deren Tätigkeit er bestenfalls wertlos und schlimmstenfalls grausam fand, interessierte sich jedoch sehr für Krapfs Forschungen, vor allem für seine Reisen mit Rebmann und einem weiteren deutschen Missionar namens Jakob Erhardt. Letzterer hatte sich Krapf und Rebmann vier Jahre zuvor angeschlossen, und zusammen hatten sie die ostafrikanische Küste so detailliert erforscht wie kein Europäer vor ihnen. Sie waren außerdem Elfenbein- und Sklavenhändlern begegnet, die ihnen nicht nur von schneebedeckten Bergen, sondern von gewaltigen Seen im Landesinneren erzählt hatten. Burton hatte auf seiner Pilgerreise[8] ähnliche Geschichten von arabischen Händlern gehört und alles, was sie ihm berichtet hatten, auf kleine Papierstreifen gekritzelt, die er im Saum seines Gewandes verbarg. Vom Shepheard Hotel aus schrieb er einen Brief an die Royal Geographical Society, in dem er zugab, dass Krapfs Geschichten »an die eines Wahnsinnigen erinnerten«, er aber nichtsdestotrotz fest entschlossen sei, ihn aufzuspüren, um herauszufinden, was genau die drei erreicht hatten. »Ich habe ihn noch nicht gesehen,[9] gedenke mir das Spektakel aber nicht entgehen zu lassen, vor allem will ich aus ihm herauspressen, was schon getan ist und was noch zu tun bleibt.«
Im neunzehnten Jahrhundert gab es über den gesamten Globus verstreut Forschungsreisende, die mit Kompassen und Sextanten bestückt versuchten, Landkarten zu ergänzen und geographische Rätsel zu lösen, und zwar von Afrika bis Australien, von Asien bis in die Antarktis. Ungeachtet der Tatsache, dass es über fast jeden Winkel der Erde nach wie vor viel zu lernen gab, herrschte doch Einigkeit darüber, was als der Heilige Gral der Erkundung galt. Über dieses Mysterium hatten sich Astronomen, Philosophen, Historiker und Forscher der vergangenen zweitausend Jahre die Köpfe zermartert: Wo entsprang der Nil?
Die Begeisterung für den Nil war nicht nur deshalb stetig gewachsen, weil er der längste Strom der Welt ist und sein Becken gut fünf Millionen Quadratkilometer umspannt, ein Zehntel des afrikanischen Kontinents, sondern weil er eine der ältesten und reichsten Zivilisationen auf Erden überhaupt erst ermöglicht hat. Die fruchtbare grüne Schneise der Überschwemmungsebene des Nils bedeckt nur fünf Prozent von Ägypten, ernährt aber mehr als 96 Prozent seiner Bevölkerung. Das übrige Land besteht aus Wüste. So belebend sind die alljährlichen Überschwemmungen, dass die alten Ägypter ihre Kalender nach ihnen richteten: Jedes neue Jahr begann mit dem ersten Tag der Nilschwemme.
Obwohl immer beruhigend vorhersehbar war, wann die Überschwemmungen einsetzen würden, war ihr Ausmaß stets unkalkulierbar. War der Pegelstand des Nils zu niedrig, fehlte es nicht nur an Wasser, sondern auch an den darin enthaltenen notwendigen Nährstoffen, die den Boden des Tals überhaupt erst fruchtbar und seine Erträge üppig machten. War er zu hoch, trat der Fluss über die Ufer und riss große Streifen Ackerland und ganze Dörfer mit sich fort in Richtung Meer. Es war eine Frage von fundamentaler Bedeutung, die jahrhundertelang die klügsten Köpfe bewegt hatte. »Der Nil steigt im Durchschnitt[10] um sechzehn Ellen (8,2 Meter) an«, hatte der römische Gelehrte Plinius der Ältere im ersten Jahrhundert geschrieben. Stiege der Fluss nur um zwölf Ellen, so seine Warnung, wäre die Konsequenz eine Hungersnot. Zwei weitere Ellen dagegen bedeuteten »Fröhlichkeit, fünfzehn absolute Zuversicht und sechzehn Glück«. Siebzehn, so Plinius, könnten dagegen einer Katastrophe gleichkommen.
Die Ängste um die Nilschwemme[11] und die Bemühungen, sie zu begreifen, hatten die Frage nach dem Ursprung des Flusses aufgeworfen. Zu Beginn gab es sehr unterschiedliche Theorien: So hatte der griechische Historiker Herodot von ägyptischen Priestern erfahren, dass der Nil aus einer unergründlichen Höhle hervorquoll. Sowohl Alexander der Große als auch dreihundert Jahre später Vergil mutmaßten zwischenzeitlich, dass der Fluss seinen Ursprung in Indien haben müsse. Zu den berühmtesten frühen Spekulanten über die Quelle des Nils gehört der legendäre ägyptische Mathematiker, Astronom und Geograph Ptolemäus. Er berief sich hauptsächlich auf Berichte eines griechischen Händlers namens Diogenes, der von der afrikanischen Ostküste aus fünfundzwanzig Tagesmärsche ins Landesinnere unternommen hatte, als er die Nilquelle in zwei großen Seen verortete, die aus einer schneebedeckten Bergkette hervorströmten. Diogenes hatte sie Mondberge getauft. Nachdem man in Europa Ptolemäus’ Landkarten und Schriften aus dem zweiten Jahrhundert zwischen dem fünften und vierzehnten Jahrhundert weitgehend ignoriert hatte, war in der Renaissance das Interesse an seinem Werk neu erwacht. Im achtzehnten Jahrhundert galt es schließlich als eine der maßgeblichen Quellen für die Forscher der Neuzeit.
Seit langem war bekannt, dass sich der Nil aus zwei Hauptsträngen zusammensetzt, dem Blauen und dem Weißen Nil. Der längere der beiden, der Weiße Nil, so benannt wegen des hellgrauen Schlicks, der seinen Wassern eine milchweiße Färbung verleiht, vermählt sich im Sudan, unweit der Hauptstadt Khartum, mit dem dunkleren, schnelleren Blauen Nil, ehe beide Stränge gemeinsam dem Mittelmeer zuströmen. 1770 hatte der Schotte James Bruce, nachdem er den Tana-See im nördlichen Äthiopien erreicht hatte, behauptet, als erster Europäer den Ursprung des Blauen Nils entdeckt zu haben. Als er erfuhr, dass ihm der spanische Jesuit Pedro Páez, der den Fluss bereits hundertfünfzig Jahre früher bis zu seiner Quelle erkundet hatte, zuvorgekommen war, weigerte er sich wütend, die Ehre an ihn abzutreten. Das Rätsel um den Ursprung des Weißen Nils hingegen war auch zweihundert Jahre nach Páez und fast hundert Jahre nach Bruce noch ungelöst.
Wie jeder, der ihn erkunden wollte,[12] schnell erfahren musste, hütete der Weiße Nil seine Geheimnisse gut. Das römische Sprichwort, das eine Situation beschreibt, in der man mit einer unlösbaren Aufgabe konfrontiert ist, heißt Facilius sit Nili caput invenire – »es wäre einfacher, die Quelle des Nils zu finden«. Jeder Versuch, den Flusslauf von Nord nach Süd zu erforschen, war an einem riesigen Binnensumpf namens Sudd, eine Anlehnung an das arabische Wort für »Schranke«, gescheitert. Die ausgedehnte Ebene aus Mooren und Sümpfen erstreckt sich über Hunderte Kilometer durch den heutigen Südsudan und wird überwuchert von hohem Schilfgras, Papyrus, diversen Sumpfpflanzen und Wasserhyazinthen, die eine Durchquerung per Boot verunmöglichen. Eine Expeditionsarmee, die vom römischen Kaiser Augustus ausgesandt wurde, gab auf, noch ehe sie den Äquator erreicht hatte. Über fünfzig Jahre später wurden Neros Zenturionen von eben jenem Marschland aufgehalten, das ihren Berichten zufolge so undurchdringlich war, dass selbst die Menschen, die dort lebten, keine Ahnung von seinen Ausmaßen hatten. Erst im neunzehnten Jahrhundert, als der türkische[13] Offizier Selim Bimbashi zwischen 1839 und 1842 drei Expeditionen nilaufwärts sandte, wurde der Sudd überwunden. Zwei von Bimbashis Truppen gelangten bis zu einer Stelle, die etwa achthundert Kilometer südlich des Sumpfes lag, damit aber immer noch unvorstellbar weit von der Quelle des Flusses entfernt war.
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hatten die Forscher allmählich begriffen, dass sie ihre Suche nach der Nilquelle nicht stromaufwärts im Norden, sondern über den Landweg im Süden beginnen mussten. Von ihrer an der Ostküste gelegenen Basis in New Rabai aus hatten die deutschen Missionare Krapf, Rebmann und Erhardt genau das getan. Krapf, seit langem kränkelnd, musste nach Europa zurückreisen und machte in Ägypten einen Zwischenstopp. Man hatte ihm prophezeit, er werde sterben, wenn er noch länger in Afrika verweilte. Erhardt und Rebmann dagegen blieben in Ostafrika, vorerst zumindest. Erhardt, dessen Gesundheitszustand nicht viel besser war als der von Krapf, würde im darauffolgenden Jahr ebenfalls nach Deutschland zurückkehren, allerdings mit einer Landkarte im Gepäck, die er gemeinsam mit Rebmann erstellt hatte. Während eines Gesprächs über die seit langem ungeklärten Fragen zur Quelle des Nils war ihnen spontan ein Licht aufgegangen, wie Erhardt es nannte. »In ein und demselben Moment[14] stand uns beiden die Lösung vor Augen«, würde er später schreiben, »und zwar durch die schlichte Annahme, dass wir dort, wo geographische Hypothesen bislang eine riesige Gebirgslandschaft vermutet hatten, stattdessen nach einem ausgedehnten Tal und einem Binnenmeer suchen mussten.«
Ein Jahr zuvor hatte der Präsident der Royal Geographical Society, Roderick Murchison, verkündet, dass wer immer »die wahre Quelle des Weißen Nils«[15] fände, »zu Recht zu den größten Wohltätern dieses Zeitalters geographischer Entdeckungen« gezählt würde. In der von der Gesellschaft herausgegebenen, renommierten Zeitschrift Journal of the Royal Geographical Society of London hatte der britische Naturforscher Colonel William Sykes vorhergesagt, es brauche »ein furchtloses Herz,[16] um die Lösung all jener geographischen Rätsel anzugehen, die sich der Forschung seit Menschengedenken stellen«. Burton, endlich aus seiner Erstarrung erwacht, die ihn seit seinem Erfolg in Mekka und den einsamen Tagen in Kairo nicht mehr losgelassen hatte, konnte sich kein furchtloseres Herz denken als das seine. »Wie ich höre, spricht man in der Geographical[17] von einer Expedition nach Sansibar«, schrieb er an Norton Shaw. »Ich werde alles daransetzen, sie zu leiten.«
Auf dem Weg nach Mekka war Burton zum ersten Mal auf dem Nil gefahren und, ungeachtet der erhabenen Geschichte des Flusses, nicht sonderlich beeindruckt gewesen. Die umgebende Landschaft hatte ihn an seine Zeit in Indien erinnert, in der heißen, staubigen Provinz Sindh. »Für mich war die Landschaft in zweifacher Hinsicht[18] eintönig«, hatte er geschrieben. »Morgendunst und Mittagsglut; derselbe heiße Wind, dieselben Hitzewolken, dieselben feurigen Sonnenuntergänge, dasselbe Abendglühen; dieselben Staubsäulen und ›Sandteufel‹, die wie Riesen über die Ebene stieben; dasselbe trübe Wasser.« Die Vorstellung, die Quelle dieses Flusses aufzuspüren und damit das größte geographische Rätsel seiner Zeit zu lösen, erfüllte ihn hingegen mit einer schier überwältigenden Abenteuerlust und der Vorahnung, etwas wahrhaft Großartiges zu leisten.
Obwohl er von der Ruhr, die ihn seit seiner Rückkehr aus Mekka plagte, noch nicht vollständig genesen war und schon bald nach Bombay würde segeln müssen, da seine Beurlaubung von der Ostindien-Kompanie sich ihrem Ende zuneigte, würde Burton sich von keinem Hindernis, sei es körperlich oder beruflich, davon abhalten lassen, nach der Quelle des Weißen Nils zu suchen. Eine Gelegenheit wie diese bot sich nur einmal im Leben, mehr noch, sie war nur wenigen Männern in der Geschichte der Forschungsreisen vergönnt. Endlich hätte er »die Möglichkeit«, schrieb er,[19] »meinen Kompass auf jene ›Mondberge‹ auszurichten, deren Existenz zweitausend Jahre lang im Ungewissen gelegen hatte, und erst kürzlich bewiesen wurde – eine Bergkette, die selbst in der Glut des afrikanischen Sommers weiß war von ewigem Schnee. Angeblich hat sie den mysteriösen Nil geboren und ist kurz gesagt ein Gebiet, das die Romantik wilder Fabeln und altertümlichste Geschichte atmet; bis zum heutigen Tag gilt es als das lohnendste Studienobjekt, dem der Mensch Tatkraft und Unternehmungsgeist widmen kann.«
Burton hatte bereits einen Plan. Er brauchte lediglich »ein paar gute Männer,[20] die mich begleiten (einen für die Vermessung, einen zweiten für Physik und Botanik)«, schrieb er an Shaw. »Ich zweifle nicht an unserem großartigen Erfolg.« Er wollte Krapf immer noch aufsuchen, um »über seine Entdeckungen auf dem Laufenden zu sein«, wie er gestand, doch obwohl er den Missionar achtete und seinen Rat brauchte, fürchtete er keine Konkurrenz. Krapf mochte als Erster Informationen über die Binnenseen nach Europa gebracht haben, aber Burton wäre der erste Europäer, der sie tatsächlich finden würde, und mit ihnen die Quelle des Nils. Johann Krapf, ließ er Shaw wissen, »ist lediglich mein Johannes der Täufer«.[21]
3.Bürge für unser Blut
Als das Direktorium der Ostindien-Kompanie im Sommer 1854 schließlich einwilligte, Burton für die Suche nach der Quelle des Nils freizustellen, tat sie es unter zwei Bedingungen: Die eine bezog sich auf zu erwartende Geschäfte, die zweite auf die Gefahr für Leib und Leben. Entsprechend würde Burton seine Reise in Aden beginnen, einer sich in britischer Hand befindlichen Hafenstadt an der Südspitze der Arabischen Halbinsel. Alsdann würde er den Golf von Aden durchqueren und Somaliland erreichen, wie es damals hieß, um von dort aus ins Landesinnere Afrikas vorzudringen. Somaliland, am Horn von Afrika, war für Großbritannien nicht zuletzt deshalb interessant, weil es an der Handelsroute von Bombay nach Sues lag und noch weitgehend unerforscht war. Es galt allerdings als äußerst gefährlich, was zur zweiten Bedingung führte: Die Ostindien-Kompanie würde keinerlei Verantwortung für Burtons Leben übernehmen, solange er sich in der Gegend aufhielt. Sie würde ihn mit »den erforderlichen Gerätschaften ausstatten und seine Hin- und Rückreise finanzieren«. Außerdem würde sie für die anfallenden Reisekosten aufkommen, doch abgesehen von dieser finanziellen Unterstützung und einer beruflichen Freistellung wäre Burton auf sich gestellt. Er wäre zwar nach wie vor Offizier der Ostindien-Kompanie, »reist aber als Privatperson«,[1] hieß es in der Übereinkunft. »Die Regierung gewährt ihm nicht mehr Schutz als jedem anderen Individuum.«