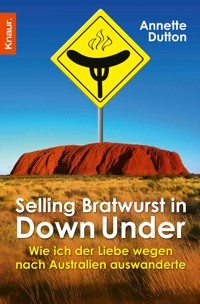6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die nicht sein darf. Ein Kind, das seiner Mutter entrissen wird. Eine Frau, die ihre Wurzeln entdecken muss … Nach dem Tod ihrer Mutter stößt Natascha in deren Nachlass auf ein verwirrendes Dokument. Ihre Familie soll Aborigine-Vorfahren haben? Neugierig geworden, macht sie sich in Australien auf die Suche nach ihren Wurzeln. Sie ahnt noch nichts von jenem dunklen Geheimnis, das dem Leben der deutschen Auswanderin Helene Junker zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Stempel aufdrückte – und das auch Nataschas Leben eine entscheidende Wende geben wird … Begeisterte Leserstimmen: »Ein toller Schmöker!« »Ich liebe dieses Buch!« »Ein Meisterwerk über die Liebe im Gestern und Heute.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Annette Dutton
Der geheimnisvolle Garten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach dem Tod ihrer Mutter stößt Natascha in deren Nachlass auf ein verwirrendes Dokument. Ihre Familie soll Aborigine-Vorfahren haben? Neugierig geworden, macht sie sich in Australien auf die Suche nach ihren Wurzeln. Sie ahnt noch nichts von jenem dunklen Geheimnis, das dem Leben der deutschen Auswanderin Helene Junker zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Stempel aufdrückte – und das auch Nataschas Leben eine entscheidende Wende geben wird …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Townsville, September 1958
Berlin, 28. September 2009
Meena Creek, 8. März 1911
Brisbane, 14. März 1911
Der Hafen von Brisbane, 21. März 1911, ein Uhr mittags
Cairns, 20. Januar 2010
Brisbane, 25. März 1911
Moondo, 21. Januar 2010
Rosehill, April 1911
Zionshill, im Winter 1903
Rosehill, 21. Januar 2010
Rosehill, April 1911
Cairns, Regenzeit 1905/1906
Meena Creek, 1906
Magnetic Island, 23. Januar 2010
Palm Island, Ende Januar 2010
Rosehill, April 1911
Meena Creek, Ende Oktober 1909
Adelaide, Anfang Februar 2010
Rosehill, April 1911
Port Adelaide, Südaustralien, September 1902
Cairns, Anfang Februar 2010
Neu Klemzig, 1903–1904
Magnetic Island, 6. Februar 2010
Neu Klemzig, Januar 1905
Neu Klemzig, Februar 1904
Zionshill, Mai 1904
Brisbane, 10. Februar 2010
Neu Klemzig, Juni 1905
Rosehill, April 1911
Neu Klemzig, Mai 1904
Neu Klemzig, 1905
Cairns, 11. Februar 2010
Innisfail, 8. März 1911,1 Uhr mittags
Cairns, 11. Februar 2010
Palm Island, 8. März 1911,10 Uhr abends
Meena Creek, Januar 1912
Berlin, 18. März 2010
Epilog Moondo, Juli 1949
Nachwort
Danksagung
Quellenhinweise
Literaturhinweise
Deutsche Siedler in Südaustralien
Untergang der Yongala
Aborigines
Die Zuckerindustrie in Australien
Siedler in Far North Queensland
Australien um 1900
Für Carla und Matthias, meine Eltern
Selbst ein Stück trockenes Holz kann uns spirituell heilen. »Trocken«, hab ich gesagt, nicht »tot«, denn wenn wir diesen sogenannten toten Baum anzünden, erwecken wir ihn wieder zum Leben. Und wenn wir später seine Kohle anzünden und du immer noch denkst: »Mann, die ist doch mausetot!«, dann hol diese Kohlen mal mit deinen Händen aus dem Feuer! Du würdest mich glatt für verrückt erklären, wenn ich dich darum bäte!
Djarla Dulumunmun vom Stammder Yuin Nation, Victoria
Aborigines glauben, dass es nichts zwischen Mensch und Gott gibt; dass jeder Mensch auch ein spirituelles Wesen ist. Wir alle, sagen sie, sind eine Familie, sind Brüder und Schwestern, die sich das Universum teilen.
Geburt, Vereinigung mit den Geistern, Wiedergeburt: Dies, so glauben die Ureinwohner Australiens, ist das ewige Gesetz.
Nur wer das Gesetz anerkennt, wird spirituelle Heilung erfahren. So war es immer, so ist es immer und so wird es immer sein.
Aborigines sind die älteste noch lebende Kultur auf dieser Erde.
Townsville, September 1958
Die alte Dame im Flugzeug starrte seit einigen Minuten regungslos aufs Meer hinab. Die See war spiegelglatt, nur weiter draußen, wo der Südpazifik vom Riff gebrochen wurde, sah sie, wie unzählige winzige Gischtkronen die Oberfläche der Korallenformation umtanzten. Obwohl nur eine laue Brise wehte, konnte sie Segelboote erkennen. Mindestens fünfzehn, schätzte sie. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. An einem Tag wie diesem spielte es ja auch keine Rolle, wie lange die Segler von der Insel zum Festland unterwegs waren oder umgekehrt. So ein Segeltörn am Samstag, das war reiner Selbstzweck, recreation. Es dauerte eine Weile, bis ihr das deutsche Wort dafür einfiel: Freizeitaktivität.
Seltsam, dachte sie, im Englischen schwingt noch so viel mehr mit: recreation, das hieß auch »Wiederherstellung«, »Wiedererschaffung«.
Sie lehnte sich seufzend in den Ledersitz zurück. Mitte September, Frühling! Sie hätte sich keinen besseren Tag für ihr Vorhaben aussuchen können. Sie schloss die Augen. Durch das Surren des Propellers hindurch vernahm sie gestotterte Funkmeldungen, die immer mit einem Knarzen endeten. Ein Sonnenstrahl, der schräg ins Fenster fiel, ließ rote Lichter hinter ihren Lidern tanzen; wieder verfiel sie ins Dämmern.
»Miss, möchten Sie einmal einen Blick nach vorne werfen?«
Die ältere Dame setzte sich auf, fuhr sich über die Augenlider.
»Oh, sorry, Miss, ich wollte Sie nicht wecken!«
Der Pilot hob entschuldigend die Hand. Sie lachte.
»Schon gut, Craig! Ich bin ja nicht zum Schlafen hier. Was gibt’s denn? Sind wir etwa schon da?«
Craig verneinte mit einer Bewegung seines kantigen Kinns.
»No, Ma’am, aber schauen Sie mal, Humpbacks! Eine Mutter mit Kalb, gleich da vorne, auf halb zwei!«
Die alte Frau zog sich in ihrem Sitz nach oben und reckte den Kopf. Sie war plötzlich aufgeregt wie ein Teenager, was in ihrem Alter natürlich lächerlich war. Sie musste über sich selbst lächeln. Die Tatsache, dass sie sich mit ihren achtundsiebzig Jahren noch so begeistern konnte, stimmte sie froh. Es war ein Geschenk. Solange noch dieser Funken in ihrem Herzen glühte, würde die alte Maschine hoffentlich noch weiter Tag für Tag zuverlässig anspringen.
Sie straffte ihren Rücken, um vollen Ausblick auf die Buckelwale zu haben. Mutter und Kalb tollten ausgelassen miteinander herum, klatschten mit den Schwanzflossen auf die Wasseroberfläche, die sich daraufhin hoch aufspritzend zerteilte. Ihr Spiel zog die Segelboote an, die sich allmählich in sicherem Abstand um die majestätischen Tiere gruppierten.
»Oh, Craig, das ist wundervoll! Danke, dass Sie mich geweckt haben! Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Wale gesehen habe.«
Craig drehte sich kurz zu ihr um.
»Na, an den Walen kann es jedenfalls nicht liegen, Ma’am. Die kommen jedes Jahr um diese Zeit zum Kalben in die Bucht.«
Die Frau nickte wissend und warf einen letzten Blick auf das Spektakel, bevor die Maschine abdrehte und Kurs aufs Riff nahm. In wenigen Minuten würden sie sich über Kap Bowling Green befinden, ihr Ziel lag irgendwo zwischen dem Kap und dem Broadhurst Riff.
»Ich kann Ihnen leider nicht genau sagen, wo das Wrack liegt, Ma’am. Besser, Sie werfen mal ein Auge aufs Wasser und halten Ausschau!«
Craig drehte an den Knöpfen über seinem Kopf und schaute dann konzentriert aufs Echolot.
Sie wusste nicht, wonach genau sie Ausschau halten sollte. Man hatte ihr gesagt, das Wrack läge so tief, dass es aus der Luft gar nicht zu sehen sei. Schließlich hatte sie für teures Geld Craig angeheuert! Sie schluckte einen Anflug von Verärgerung hinunter, atmete langsam aus, beruhigte sich, sah hinaus. Ihre dunklen Augen waren in den letzten Jahren ein wenig wässrig geworden, ihr Weiß durchzogen von einem spinnenfeinen Adernetz. Eine Brille hatte sie trotzdem nie gebraucht. Sie kniff die Lider zu einem Schlitz zusammen und scannte die hellere, silbrig blaue Oberfläche des Wassers, bis ihre Schläfen vor Anstrengung zu pulsieren begannen und sich ein stechender Schmerz hinter ihren Augen breitmachte. Sie kannte das schon; diese Kopfschmerzen überfielen sie mit hässlicher Regelmäßigkeit, seit sie denken konnte. Sie rieb sich kurz die pochenden Seiten, ohne dabei ihren Blick vom Wasser zu wenden. Sie musste weitermachen, das hatte sie der Schwester versprochen, sie war es ihr schuldig.
Und hatte sie es sich nicht auch selbst geschworen? Sie würde finden, wonach sie so lange gesucht hatte. Um der Schwester willen – und ja, auch um ihrer selbst willen. Sie brauchte einen Abschluss, brauchte Gewissheit. Schuld war eine Sache, die Fakten eine andere.
Der dumpfe Schmerz senkte sich nun tief hinter ihre Augenhöhlen. Sie zwang sich, ihrer Befindlichkeit keine weitere Beachtung zu schenken. Stattdessen griff ihre Hand nach der ledernen Tasche, die auf dem Nebensitz lag. Sie öffnete den Reißverschluss und zog einen weißen Briefumschlag aus dem Innenfach. »Für Maria«, las sie. Behutsam fingerte sie den Brief aus seiner Hülle und entfaltete vorsichtig den Briefbogen. Sie strich das Papier glatt und legte es auf die neueste Ausgabe der Women’s Weekly, einer australischen Frauenzeitschrift.
Sie kannte die Zeilen des Briefes längst auswendig, es waren ihre eigenen Worte, die sie schon seit Jahrzehnten im Kopf immer wieder aufs Neue formulierte. Heute endlich hatte sie den Mut gefunden, sie aufzuschreiben, und nun las sie das Ende des Briefes ein letztes Mal, bevor sie ihn unterschreiben und zukleben würde:
Maria, ich weiß, dass Du dunkle Tage durchlebt hast. Die Mächte, die uns in diesem Leben zuweilen ergreifen und mit uns spielen wie der Wind mit einer Vogelfeder, sind viel zu oft jenseits unserer Kontrolle. Kriege, Stürme, Verfolgung – ich glaube, wir haben beide in unserem bescheidenen Leben mehr mit diesen Kräften zu tun gehabt, als uns lieb war. Ich denke oft an die schweren Stürme, die uns hier im tropischen Australien regelmäßig heimsuchen. Sie können fürchterlich wüten, Bäume entwurzeln und ganze Häuser zerstören. Sie können unser Leben völlig durcheinanderwirbeln, doch wenn ich heute auf die See schaue, sehe ich nur tiefblaues Wasser, so ruhend und friedvoll, als hätte es nie zuvor ein Unwetter gegeben.
Die Dame suchte jetzt nach ihrem Stift, um hinter dem letzten Satz ein Sternchen einzufügen. Dann drehte sie das Blatt um, zeichnete ein weiteres Sternchen und schrieb langsam wie ein Erstklässler, um die Vibrationen der Maschine aufzufangen:
Ich habe heute Wale gesehen. Sie kommen jedes Jahr zum Kalben in diese eine Bucht, ob es einen Sturm gegeben hat oder nicht. Es kümmert sie nicht, sie tun das, was ihnen die Natur eingegeben hat. Sie leben, das ist ihre Bestimmung.
Sie überlegte, ob sie das eben Geschriebene streichen sollte. Es las sich schwülstig, doch sie fand nach einiger Überlegung, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben angelangt war, an dem sie sich gewisse Sentimentalitäten erlauben durfte. Zustimmend nickend, unterstrich sie sogar noch den letzten Satz. Dann drehte sie den Briefbogen wieder um, unterschrieb schnell, schob das Blatt in den Umschlag und klebte diesen zu, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Sie steckte den Brief in die Tasche, deren Reißverschluss sie mit einem Ruck zuzog, und legte die Tasche unter den Sitz, gerade noch rechtzeitig, um Craigs Hinweis Aufmerksamkeit zu schenken.
»Ma’am, da, geradeaus, auf zwölf Uhr, sehen Sie das? Ich glaube, wir haben es gefunden.«
Sie versuchte, dem Zeigefinger des Piloten mit ihrem Blick zu folgen, doch die tiefstehende Sonne blendete sie; ihre Augen brauchten ein wenig Zeit, um sich an die auf der Wasseroberfläche grell flirrenden Reflexionen zu gewöhnen. Sie zwinkerte, schloss dann für den Bruchteil einer Sekunde die Lider, und als sie sie wieder öffnete, sah sie unter sich eine silbrig glänzende Verwerfung, die sich im Wasser immer wieder rasant wendete und blinkte wie eine hoch in den blauen Himmel geworfene Silbermünze.
»Ist sie das? Ist das die Yongala? Aber wieso bewegt sie sich?« Die alte Dame war sichtlich erregt, erhob sich, so gut es in der engen Maschine ging, aus ihrem Sitz, um eine bessere Sicht aufs Meer zu haben. Doch sie fiel wieder ins Leder zurück, was sie nicht daran hinderte, es erneut zu versuchen. Mit zittrigen Armen stützte sie sich auf den Armlehnen ab.
»Ich schätze, das sind Barrakudas, die nach Thunfischen Ausschau halten.« Craig pfiff durch die Zähne. »Oh, Mann, jede Menge Leben da unten.« Er bemerkte ihren fragenden Blick. »Ungewöhnlich viele und große Fische für eine Stelle im offenen Meer. Das heißt, dass es hier ein Korallenriff oder etwas Ähnliches geben muss, in dem all diese Fische leben. Auf meinen Karten ist aber keines verzeichnet, was bedeutet, dass es an dieser Stelle wahrscheinlich ein künstliches Riff gibt. Die Yongala zum Beispiel.«
»Die Yongala ein künstliches Riff? Was genau meinen Sie damit?« Sie hatte ihre Arme nun durchgedrückt und fühlte, dass sie sich in dieser halbwegs aufrechten, wenn auch instabilen Position eine Weile halten konnte.
»Das Schiff liegt schon seit über vierzig Jahren auf dem Meeresgrund. Wenn vom Wrack nach all den Jahren überhaupt noch etwas übrig sein sollte, dann sind das mit Sicherheit die Korallen, die auf ihm wuchern.«
Die alte Dame wusste, dass es genau so sein musste, dennoch öffnete sie erstaunt den Mund. Gewiss, es war unsinnig, doch wann immer sie an die Yongala dachte, sah sie im Geiste ein vollkommen intaktes Schiff vor sich, das sich auf dem weichen Meeresgrund nur von den Strapazen einer schweren Reise ausruhte. Kein Bullauge war zerbrochen, keine Planke zerstört. Und irgendwo im Bauch dieses Schiffes ruhte die Schwester, zugedeckt mit den für heutige Verhältnisse sicherlich viel zu kräftig gestärkten Leinenbetttüchern der Adelaide Steamship Company. Sie hoffte jedenfalls, dass der Zyklon die Schwester erst im Schlaf überrascht hatte, so dass sie und die Kinder erst gar nicht hatten kämpfen müssen.
»Sie meinen, von der Yongala selbst ist vielleicht gar nichts mehr übrig?«
»Ich bin kein Experte, aber auszuschließen ist das nicht. Der Rost wird einiges vom Eisen weggefressen haben und das Holz größtenteils vermodert sein. Aber wer weiß schon genau, was noch geblieben ist? Das Wrack wurde ja erst vor einem Monat gefunden, und solange die Taucher der Reederei nicht unten waren, kann man nur spekulieren. Aber die sollten sich meines Erachtens ganz schön sputen.«
Was sollten ein paar Tage mehr oder weniger schon ausmachen, fragte sie sich, und als ob Craig ihren Einspruch hätte hören können, fuhr er fort: »Wenn die es nicht tun, dann kümmern sich andere darum, und glauben Sie mir, viel wird nicht mehr übrig sein, wenn diese Halunken erst damit fertig sind. Diese Räuber bergen und verkaufen alles: Nachttopf, Zahnstocher, Rasierpinsel, Schiffsglocke, Anker – einfach alles.«
Sie schüttelte unweigerlich den Kopf und fasste noch im selben Augenblick den Entschluss, diese Plünderei mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. Jetzt, da man den Ort der Tragödie endlich gefunden hatte, wollte sie ihn schützen. Noch heute würde sie an die Reederei schreiben.
Mit einem Mal fühlte sie eine ungewohnte Leichtigkeit. Der Schmerz, dieser andauernde Schmerz – er war verschwunden. Sie fühlte sich gut wie schon lange nicht mehr. Wie zum Triumph ballte sie ihre Rechte zur Faust, so fest, dass sich die Knöchel weiß abzeichneten. Endlich. Das Warten hatte ein Ende. Wie hatte sie nur jemals daran zweifeln können?
»Ma’am, Sie müssen sich wieder hinsetzen und den Gurt anlegen. Zu gefährlich. Eine Windböe, und Sie purzeln mir durch die Gegend, schlagen sich vielleicht den Kopf auf, und ich wandere für den Rest meines Lebens ins Gefängnis.«
»Sie haben recht, entschuldigen Sie, bitte! Es ist nur … ich habe so viele Jahre auf diesen Moment gewartet. Dieser Flug, das Schiff, es bedeutet mir sehr viel.« Sie schloss den Gurt, ohne den Blick vom Meer zu wenden. Sie wusste nicht, ob Craig sie nicht verstanden hatte oder ob er aus Takt schwieg, jedenfalls fragte er sie nicht weiter nach ihren Verbindungen zur Yongala, und dafür war sie ihm dankbar.
»Müssen wir gleich zurück?«
Craig schüttelte den Kopf, ließ den Finger über seinem Kopf rotieren. »Wir können noch ein paar Minuten kreisen, aber nur wenn Sie brav sitzen bleiben!« Er schenkte ihr ein Lächeln. Die Maschine beschrieb einen weiten Bogen und flog dann tiefer über das Wrack. So tief, dass sie im fließenden Silber der Barrakudaschule einzelne Fische erkennen konnten, die nun blitzartig auseinanderstoben.
Die Dame nickte. Es stimmte wohl, was Craig gesagt hatte. Vielleicht gab es die Yongala wirklich nicht mehr, oder wenn, dann sicherlich nicht so wie in ihrer Vorstellung. Wenn sich die Natur das Schiff tatsächlich zurückgeholt hatte, dann hatte es sich nun in etwas Neues verwandelt, einen Ort voller Leben. Craig zog zwei weitere Schleifen, was der Dame Gelegenheit gab, die Stelle aus allen Richtungen zu betrachten.
»Wir müssen zurück, Ma’am, der Sprit.«
Sie lächelte jetzt.
»Ja, Craig. Ich habe mehr gesehen, als ich hoffen konnte. Fliegen wir zurück!«
Berlin, 28. September 2009
Natascha gab sich einen Ruck und öffnete die Wagentür. Sie konnte es unmöglich noch länger hinauszögern. Fast eine halbe Stunde hatte sie schon hinter dem Lenkrad ihres geparkten Autos gesessen, unschlüssig, ob sie aussteigen oder einfach davonfahren sollte. Schließlich siegte ihre praktische Seite. Sie wollte diese letzte Chance nutzen. Wenn sie es heute nicht schaffte, die Schränke ihrer Mutter nochmals gründlich durchzusehen, würden die Wohnungsauflöser morgen früh alles mitnehmen, was sie vorfanden. Die vertrauten Gegenstände ihrer Kindheit, am Montag um acht wären sie unwiederbringlich verloren, abgeholt und in einer Industriehalle untergestellt, bis man sie irgendwann an irgendjemanden verscherbelte, der einen günstigen Tisch oder einen Wandschrank brauchte. War sie deshalb eine schlechte Tochter? Natascha wusste nicht, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. War es falsch, den Haushalt der Mutter aufzulösen? Sollte sie sich nicht an jedes Stück klammern, es bis an ihr eigenes Lebensende wertschätzen? Wieder einmal wurde ihr schmerzlich bewusst, dass sie keine Geschwister hatte, mit denen sie sich hätte beraten, die sie hätten trösten können. Andererseits gab es so auch keinen Streit. Das wäre das Schlimmste, was sie sich in so einem Fall vorstellen konnte.
»So ein Fall«, sagte sie nun laut, und es klang bitter. Als Journalistin sollte sie sich nun wirklich präziser ausdrücken. Der Fall – das war der verfrühte Tod ihrer Mutter Regina, die »nach langem Leiden einer schweren Krankheit erlegen war«, wie man so schönfärberisch sagte und wie Natascha es auch für die Todesanzeige übernommen hatte. Es war ihr schwergefallen, diese übliche Floskel zu verwenden, doch das Leid des vergangenen Jahres wäre sowieso nicht mit einem Satz zu fassen gewesen, und sie selbst hatte einfach nicht mehr die Kraft gehabt, etwas Ehrlicheres und Treffenderes zu formulieren. Die letzte Chemotherapie hatte die Mutter abgebrochen, in ihrer sanften, aber bestimmten Art hatte sie der Tochter ihren Entschluss mitgeteilt. Natascha kannte diesen Ton in der Stimme der Mutter, der keinen Widerspruch duldete, und so hatte sie ihren Wunsch respektiert. Natascha schluckte. Wie oft hatte sie sich seither gefragt, ob es richtig gewesen war, Regina so kampflos ihrem Schicksal zu überlassen? Wäre es nicht ihre Pflicht als einziges Kind gewesen, die Mutter am Aufgeben zu hindern? Hätte die Mutter am Ende doch noch gesund werden können?
Tränen stiegen Natascha jetzt in die Augen, und sie hatte Mühe, gegen ihre Gefühle anzukämpfen. Sie spürte wieder diese ohnmächtige Verzweiflung, wie damals, als die Mutter sie mit ihrer unerschütterlichen Entscheidung konfrontiert hatte. Doch was hätte sie schon sagen können? Ihre Mutter war Ärztin, sie wusste besser als die Tochter, wie ihre Chancen standen. Und es war ihr Schmerz, ihr Leben und auch ihr Tod, und den konnte sie der Mutter nicht abnehmen.
Natascha schüttelte sich, als könnte sie ihre Gewissensbisse auf diese Weise loswerden. Sie trug in letzter Zeit schwer an ihren Gefühlen, die aus allen Richtungen an ihr zu zerren schienen.
»Verdammt!«, rutschte es ihr raus. Sie war nämlich auch wütend auf ihre Mutter. Wenn sie schon nicht für sich selbst hatte kämpfen wollen, warum, verdammt noch mal, konnte sie dann nicht wenigstens für Natascha überleben wollen? Wie konnte sie einfach so gehen und die einzige Tochter allein zurücklassen? Tränen liefen jetzt über Nataschas Wangen. So hatte sie sich zuletzt als Mädchen gefühlt, als die Mutter einen – wie sich später herausstellte – harmlosen Unfall gehabt hatte und sie deshalb nicht von der Schule abholen konnte. Eine halbe Ewigkeit hatte Natascha vor dem Schultor gewartet, bis endlich eine Lehrerin sie ins Schulgebäude zurückführte und ihr behutsam vom Unfall berichtete. Natascha erinnerte sich nur zu gut an das schreckliche Gefühl. Es war, als ob ihr mit einem Mal der Boden unter den Füßen fortgerissen worden wäre. Dass die Sonne so hoch am Himmel stand, hatte sie damals wie Hohn empfunden, als sie mit hängenden Armen vor der Lehrerin stand und nicht wusste, was sie fühlen oder sagen sollte.
Natascha rief sich in Erinnerung, weshalb sie hier war. Sie wollte ein letztes Mal die Schränke und Schubladen nach persönlichen Dingen der Mutter durchsuchen. Wieder überkamen sie die schon bekannten Zweifel: Sollte sie die Möbel nicht doch besser behalten? Doch wohin damit? Ihre eigene Wohnung war zu klein, um mehr als Mutters alten Familienesstisch, das zwölfteilige Tafelgeschirr und den wuchtigen Schlafzimmerschrank unterzubringen. Warum sie ausgerechnet dieses Monstrum von einem Möbel behalten wollte, war ihr selbst nicht ganz klar. Lag es daran, dass sie sich dort als Kind immer gern versteckt hatte, wenn sie was ausgefressen hatte? Sicher, sie hätte die anderen Möbel erst einmal einlagern können, aber was dann? Es war nicht abzusehen, dass Natascha in den nächsten Jahren eine größere Wohnung oder gar ein Haus besitzen würde. Ihre gemütliche Altbauwohnung genügte ihr vollkommen, sie war Single, hatte keine Familie. Was sie hatte, reichte.
Doch so oder so, Reginas Tod hatte Handlungsbedarf geschaffen. Wenn die Möbel erst mal draußen waren, wollte sie das Haus zunächst vermieten. Immerhin war sie sich sicher, dass ihre Mutter diese Entscheidung gutgeheißen hätte. Von ihr hatte sie schließlich die praktische Seite geerbt, und wenn Regina gewollt hätte, dass aus ihrem Haus mal ein Mausoleum würde, dann hätte sie dies ihre Tochter schon beizeiten und unmissverständlich wissen lassen. Viel Miete würde Natascha für das dreißig Jahre alte Fertighaus wohl nicht bekommen, aber sie konnte es sich nicht leisten, das Haus von Grund auf zu renovieren. Obwohl es verdammt nötig wäre, dachte Natascha seufzend, als sie unentschlossen in den engen Flur trat. Sie musste sich ducken, um sich nicht die Stirn am Flurlicht zu stoßen. Selbst die Tapete mit dem irritierenden Rautenmuster kannte sie noch aus Kindertagen. Natascha atmete durch und öffnete die geriffelte Rauchglastür, die ins kombinierte Ess- und Wohnzimmer führte. Dann wollen wir mal, redete sie sich Mut zu. Sie hatte einen Karton mitgebracht, den sie auf den Wohnzimmertisch stellte. Sie erwartete nicht, noch viel zu finden, was sie behalten wollte. In den sechs Wochen, die seit der Beerdigung vergangen waren, war sie mehrmals im Haus gewesen, hatte nach und nach die Schränke ausgeräumt. Regina hatte zudem von langer Hand Vorbereitungen getroffen und der Tochter vor ihrem Tod persönlich die Dinge übergeben, die ihr etwas bedeutet hatten. Der Schmuck, ihre Approbationsurkunde, Fotos, Bücher, alte Briefe von Natascha und vom Vater, der noch vor Nataschas Geburt tödlich verunglückt war. Alles hatte in die zusammenklappbare Einkaufsbox gepasst, die Mutter immer im Kofferraum hatte, solange sie noch in der Lage war, Auto zu fahren. Seltsam, was von einem Menschenleben übrig blieb. Wie wenig es doch war, das am Ende wichtig genug erschien, um es weitergeben zu wollen!
Natascha hatte die gelbe Plastikkiste damals unter ihr Gästebett gestellt, ohne auch nur einen Blick auf den Inhalt zu werfen. Es wäre zu schmerzhaft gewesen. Doch am Abend nach der Beerdigung goss sie sich ein großes Glas Merlot ein, zog die Kiste unterm Bett hervor und setzte sich daneben.
Nataschas Augen füllten sich mit Tränen, als sie an die Beerdigung und die darauffolgende Nacht zurückdachte. Sie hatte gelacht und geweint, am Ende hatte sie die meisten Fotos und Briefe um sich herum verteilt, die Flasche geleert und schließlich in ihren Jeans im Gästebett geschlafen. Gott, wie sie ihre Mutter vermisste!
Natascha klatschte einmal energisch in die Hände, wie um sich in die Gegenwart zurückzurufen. Sie wollte gerne noch vor Mitternacht fertig werden, zumal es für einen Septemberabend schon mächtig kalt und die Heizung ausgeschaltet war. Natascha ging systematisch vor, öffnete und durchsuchte erst alle Schubladen und Fächer der Möbel in der unteren Etage, um sich dann im oberen Stockwerk an die Arbeit zu machen. Sie kam schneller voran, als sie dachte, was daran lag, dass die Schränke bis auf ein Set Korkuntersetzer und ein Dutzend noch originalverpackter Schnapsgläser, die sie bei ihrem letzten Besuch übersehen hatte, leer waren. Oben gab es nicht mehr viel zu kontrollieren: Das Badezimmerschränkchen und der Schuhschrank waren vollständig ausgeräumt und ausgewischt. Für das Bücherregal in Mutters Lesezimmer genügte ein kurzer Blick, um sich zu vergewissern, dass sich dort nichts mehr verbergen konnte.
Dieser letzte Rundgang war weniger schlimm, als Natascha befürchtet hatte. Insgeheim hatte sie die Angst beschlichen, sie könnte vor Kummer zusammenbrechen. Dabei fühlte sie sich viel weniger aufgewühlt als erwartet. Sie fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis sie wirklich begriff, dass sie nun allein war. Ihre Mutter war ihre einzige noch lebende Verwandte gewesen. Großmutter Maria starb vor fünf Jahren, der Großvater kurz darauf, und außer Natascha selbst gab es keine Nachkommen. Sie wusste das alles natürlich, aber es löste keine Emotionen bei ihr aus. Ob das so war, weil sie die Gegenwart der Mutter hier in diesem Haus so stark spürte?
Natascha schaute auf die Uhr. Wenn sie sich beeilte, könnte sie es sogar noch mit den Kollegen ins Kino schaffen. Die Kulturredaktion hatte zwei der begehrten Premierenkarten zu vergeben gehabt, und Natascha war eine der Glücklichen, die bei der hausinternen Verlosung der Tickets gewonnen hatten. Sie klappte ihr Handy auf und wählte Lisas Nummer.
»Hi Lisa, Natascha hier. Tut mir leid für deine Schwester, aber ich werde ihr das Ticket wohl nicht abtreten. Ich bin nämlich gleich fertig hier bei meiner Mutter.«
Natascha hörte eine Weile zu, was Lisa fröhlich schnatternd antwortete, dann schüttelte sie den Kopf und lachte:
»Ja, ich weiß, dass du deiner Schwester das Ticket eh nicht gegönnt hast, du kleines Miststück! Hätte ich es mir ansonsten anders überlegt? Bis gleich also.« Auf dem Bettrand im Schlafzimmer sitzend, lächelte sie über das Gespräch mit Lisa. In Gedanken versunken, öffnete sie schwungvoll die obere Schublade des Nachttischchens, die daraufhin krachend auf dem Holzboden landete. Natascha zuckte zusammen. Sie hatte für einen Moment vergessen, dass das gute Stück – wie das meiste hier im Haus – nicht mehr neu war.
»Mist!« Natascha bückte sich leise stöhnend und hob die Schublade auf. Unter ihr auf dem Boden lag eine Art Anhänger. Natascha nahm ihn auf, betrachtete ihn von allen Seiten. Er war faustgroß, elfenbeinfarben und zeigte ein geschnitztes Muster aus weichen Linien. Über das Material war sie sich nicht sicher, doch der Schmuck wog nicht schwer in ihrer Hand. Muscheln? Holz? Knochen? In der Mitte war ein blauer Edelstein eingefasst. Ein Opal vielleicht? Sie legte den Anhänger zur Seite. Der Boden der Schublade hatte sich an einer Seite gelöst, und Natascha hielt die Lade über ihren Kopf, um sich den Schaden von unten zu besehen.
Merkwürdig. Von unten sah die Schublade heil aus. Natascha setzte die Lade auf ihrem Schoß ab und griff unter die lose Seite, die sich anstandslos heraushebeln ließ. Gerade wollte sie den Boden zur Seite legen, da ließ sie etwas innehalten. Was war das? Sie blickte auf zwei Bündel Briefe oder das, was von ihnen übrig geblieben war, denn die Ränder der Umschläge sahen ziemlich verkohlt aus, so als hätte sie jemand gerade rechtzeitig vor einem Feuer gerettet. Vorsichtig nahm Natascha die mit einfacher Kordel verschnürten Päckchen aus ihrem Versteck und legte sie aufs Bett. Wieder hob sie die Schublade hoch und besah sie ungläubig von unten, dann von oben. Das gab es doch gar nicht – ein doppelter Boden! So was kannte sie bislang nur aus Spionageromanen, aber im Schlafzimmer ihrer Mutter? Was hatte sie da nur gefunden? Alte Liebesbriefe etwa, von einem geheimen Liebhaber? Das konnte sich Natascha beim besten Willen nicht vorstellen. Nach dem Tod ihres Vaters hatte die attraktive Ärztin zwar zwei, drei ernsthafte Beziehungen gehabt, aber daraus hatte sie vor ihrer Tochter nie einen Hehl gemacht, warum auch? Sie konnte schließlich tun und lassen, was sie wollte. Heimliche Liebespost, nein, das passte einfach nicht zu Regina.
Nachdem Natascha diese Möglichkeit ausgeschlossen hatte, schob sie nun ohne Gewissensbisse die Kordel des dünneren Bündels sachte zur Seite; für das dickere würde sie eine Schere benötigen. Sie griff nach dem großen Umschlag, entnahm ihm ein Schreiben, das nach einem Dokument aussah – es hatte einen Stempel und so etwas wie eine Registrierungsnummer. Natascha verstand sofort: Es waren die Adoptionspapiere aus Australien, ausgestellt in Brisbane im Jahre 1912. Die offiziellen Dokumente ihrer Großmutter Maria, die damals in Australien von einem deutschen Missionarsehepaar adoptiert worden war. Sie wollte das Papier schon zur Seite legen, um den nächsten Umschlag zu öffnen, als sie plötzlich stutzte. Obwohl der untere Rand des Dokuments verkohlt war, konnte sie den Rest gut lesen. Unter »Rasse« stand im Dokument aboriginal und in Klammern halfcaste, was so viel wie »Mischling« oder »Halbblut« hieß. Was war denn hier los? Ihre Großmutter hatte kein bisschen Ähnlichkeit mit einer Aborigine, ihre Haut war viel zu hell. Sie hatte zwar dunkle Haare und braune Augen gehabt, wie Regina und Natascha auch, dennoch sahen sie alle eindeutig europäisch aus. Natascha ließ langsam das Papier sinken und starrte aus dem Fenster. Langsam sickerte die Erkenntnis in ihr Bewusstsein, was dieses Dokument für sie bedeutete.
Sie suchte nun erst gar nicht mehr nach einer Schere, sondern zerrte ungeduldig die Kordel vom dickeren Bündel. Dann öffnete sie einen der Umschläge; ihre Hände zitterten, während sie das Blatt entfaltete. Der Brief war kaum mehr zu entziffern, Brandspuren und Wasserflecken hatten den Text fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Woher rührten nur diese zerstörerischen Spuren? Enttäuscht öffnete Natascha rasch den nächsten Brief, doch auch hier konnte sie kaum einen vollständigen Satz ausmachen. Rechts oben sah sie eine Jahreszahl. 1915. Mein Gott, diese Briefe waren richtig alt, sie hatten zwei Kriege hinter sich. Wer weiß, wo Großmutter die Briefe in all der Zeit aufbewahrt hatte.
Natascha bezweifelte keine Sekunde, dass Großmutter Maria die Briefe erst an ihre Tochter weitergegeben hatte, als sie im Sterben lag. Wieso hatte ihre Mutter nicht dasselbe getan und ihr die Briefe samt der gelben Kiste vererbt? Oder hatte sie die Briefe etwa schlicht vergessen? Hatte womöglich Oma selbst bereits die Briefe vergessen?
Natascha entschloss sich, alle Briefe zunächst zu öffnen, bevor sie versuchen wollte, sich einen Reim aus den lesbaren Absätzen und vereinzelten Jahreszahlen zu machen.
Eine Viertelstunde später hatte sie die Briefe auf dem Bett in einer Reihenfolge sortiert, von der sie annahm, dass sie einigermaßen chronologisch sein mochte. Sie las den ersten Brief:
Moondo, im Februar 1914
(Unleserlich) Die Älteren des Orta-Stammes baten mich nun, Ihnen zu schreiben, um Sie zu fragen, welche Fortschritte Maria macht. (Unleserlich) Ich habe mit den Stammesälteren die Missionsstation auf Palm Island besucht, wo ich viel von Ihrer Güte gehört habe. (Unleserlich) Da Sie Maria adoptiert haben, können wir natürlich nicht erwarten, dass Sie mit uns in Kontakt bleiben, doch wir wären äußerst dankbar, wenn Sie die Zeit fänden, uns hin und wieder über Marias Entwicklung zu unterrichten.
Mit freundlichen Grüßen im Namen der Orta-People,
Helen Tanner
PO Box 12 (unleserlich)
Helen Tanner. Wer war diese Frau? Offensichtlich eine Vertraute der Orta. Im folgenden Brief von 1915 bedankte sie sich für einen Brief, den sie von Marias Adoptiveltern erhalten haben musste. Sie schrieb:
Als ich den Ortas erzählte, dass Maria nun Deutsch spricht, waren sie voller Bewunderung für das kleine Mädchen. Es macht sie glücklich, dass sie zur Schule geht. Viele Kinder hier haben diese Möglichkeit ja nicht. Ich hoffe, ich darf erneut auf einen Bericht hoffen. Ich verstehe natürlich, wenn der Kriegsausbruch die Erfüllung meiner Bitte unmöglich machen sollte.
Den Rest des Schreibens konnte Natascha nicht entziffern, auch die nächsten Briefe waren so zerstört, dass die lesbaren Textstellen keinen Sinn mehr ergaben. Der letzte Brief, den Natascha zumindest in Teilen lesen konnte, war auf 1918 datiert:
Lieber Herbert, liebe Irmtraud,
die Stammesälteren sind sehr dankbar, dass Ihr ihnen trotz des schrecklichen Krieges über Maria berichtet habt. (Unleserlich) Wir sind froh, dass Ihr und Maria den Krieg gut überstanden habt. (Unleserlich) Die Stammesälteren möchten, dass Ihr wisst, dass sie Euch und Maria mittels ihrer Tänze und ihrer Gedanken ihren Schutz übersandt haben. (Unleserlich) Eure Briefe sind ein großer Trost für uns.
Herzliche Grüße,
Helen Tanner
Die dreizehn weiteren Briefe des Bündels waren völlig unbrauchbar.
Natascha legte ihren Kopf in den Nacken, starrte an die Decke. Das Mädchen, um das es in dieser Korrespondenz zwischen Aborigines und den Adoptiveltern ging, war zweifellos ihre eigene Großmutter. Maria hatte nie von der Zeit vor Deutschland gesprochen, aber sie war ja auch erst sechs oder sieben Jahre alt gewesen, als sie mit den Missionaren das Land verlassen hatte. Wieder begann es in Nataschas Kopf zu schwirren. Wenn dieser Stamm eine so enge Bindung an Maria hatte und diese – wie es in der Adoptionsurkunde stand – ein Halbblut war, bedeutete das dann nicht, dass zumindest ein Elternteil von Maria bei den Orta aufgewachsen sein musste? Wenn, dann wahrscheinlich die Mutter. Der weiße Vater würde sich wohl schnell aus dem Staub gemacht haben, vermutete Natascha. Vor ihrem inneren Auge flackerte ein fremdes Leben auf, die wahre Geschichte ihrer Großmutter.
In Reginas Wandschrank hatte ein altes Foto gestanden, auf dem Maria im weißen Kleidchen zu sehen war, vom Missionarsehepaar an den Händen gehalten. Sie hatte so zerbrechlich gewirkt.
Vielleicht war es nur Nataschas journalistischer Instinkt, der sich ungefragt rührte, aber sie spürte, dass sie dem allen nachgehen musste. Es musste doch Verwandte geben oder sonst irgendjemanden, der von Marias Geschichte wusste. Sie griff zu dem kleineren Bündel, das neben der Adoptionsurkunde noch einen weiteren Brief enthielt. Es war der jüngste Brief von allen, und da er erst weit nach Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde, hegte Natascha die unbestimmte Hoffnung, dass sie daraus mehr erfahren würde.
Townsville, September 1958
Meine liebe Maria,
Du hast mich gebeten, keinen Kontakt mehr zu Dir aufzunehmen, trotzdem muss ich Dir noch dieses eine Mal schreiben. Dies ist mein letzter Brief an Dich. Meine Hand zittert, während ich schreibe, doch meine Gedanken sind klar und ruhig.
Maria, ich weiß, dass Du dunkle Tage durchlebt hast. Die Mächte, die uns in diesem Leben zuweilen ergreifen und mit uns spielen wie der Wind mit einer Vogelfeder, sind viel zu oft jenseits unserer Kontrolle. Kriege, Stürme, Verfolgung – ich glaube, wir haben beide in unserem bescheidenen Leben mehr mit diesen Kräften zu tun gehabt, als uns lieb war. Ich denke oft an die schweren Stürme, die uns hier im tropischen Australien regelmäßig heimsuchen. Sie können fürchterlich wüten, Bäume entwurzeln und Häuser zerstören. Sie können unser Leben völlig durcheinanderwirbeln, doch wenn ich heute auf die See schaue, sehe ich nur tiefblaues Wasser, so ruhend und friedvoll, als hätte es nie zuvor ein Unwetter gegeben.
Vor vielen Jahren habe ich mich eng mit den Orta-People befreundet, sie sind zu meiner Familie geworden. Diese Menschen haben Dich voller Zuversicht gehen lassen, weil sie Dir vertraut haben. Die Orta sind Dir nahe wie ein enger Freund, auch wenn Du sie weder hörst noch siehst.
Ich verstehe, dass Du Dein eigenes Leben in Deutschland führst, aber vielleicht magst Du manchmal an diese Freunde aus dem großen Land denken.
Ich möchte, dass Du weißt, wie wichtig es ist, sich an die zu erinnern, die ein Teil von Dir sind. Aus diesem Grund schreibe ich Dir.
Eines Tages, so hoffe ich nämlich, wirst Du oder werden Deine Kinder oder vielleicht sogar Deine Enkelkinder hierherkommen, um das zu finden, was ich kenne und liebe. Es gibt eine Geschichte hier, die zu entdecken sich lohnt.
Meine Gedanken und Hoffnungen sind oft bei Dir, liebste Maria.
Von denen, die Dich immer geliebt haben,
Helen
Und auf der Rückseite des Blattes fand Natascha noch eine Ergänzung, geschrieben in einer anderen Handschrift, ganz zittrig:
Ich habe heute Wale gesehen. Sie kommen jedes Jahr zum Kalben in diese eine Bucht, ob es einen Sturm gegeben hat oder nicht. Es kümmert sie nicht, sie tun das, was ihnen die Natur eingegeben hat. Sie leben, das ist ihre Bestimmung.
Natascha ließ ihre Hand langsam sinken. »Von denen, die Dich immer geliebt haben.« Wollte oder konnte sich diese Helen nicht klarer ausdrücken? Was erzählte sie da so mysteriös von Stürmen, deren Natur angeblich dem Schicksal Marias so glich? Welche Geschichte sollte es in Australien zu entdecken geben?
In den Briefen ihrer Großmutter hatte Natascha deutlich mehr Fragen als Antworten gefunden. Frustriert schob sie die Briefe zu einem kleinen Stapel zusammen, den sie dann in ihren Karton legte. Das Handy klingelte, sie hatte Lisa vollkommen vergessen.
»Tut mir leid, ich schaff’s doch nicht zur Premiere, ich erklär dir den Grund ein anderes Mal. Kannst du deine Schwester noch erreichen?«
»Sag mal, bist du etwa blöd? Keine Sekunde lässt mich die Kurze aus den Augen. Sie verfolgt mich wie die Pest das Mittelalter, seit sie von dem Ticket weiß. Jetzt muss ich sie also tatsächlich mit ins Kino schleppen? Na, herzlichen Dank, Natascha! Warte mal eben. Hörst du das Gekreische? Ich glaub, ich muss ihr genau jetzt eine runterhauen, damit sie wieder normal wird. Die reinste Hysterie hier. Matt Damon ist gerade angekommen. Ich mach dann mal Schluss. Ciao.«
Natascha blickte ungläubig aufs Handy, aber Lisa hatte schon aufgelegt. Dabei hatte sie noch nach dem Namen des Reisebüros fragen wollen, von dem Lisa nach ihren letzten Ferien so geschwärmt hatte. Natascha überschlug kurz ihre Möglichkeiten. Sie hatte noch einiges an Urlaubstagen offen. Den guten Willen ihres Chefs vorausgesetzt, sollte es eigentlich möglich sein, dass sie sich vier Wochen freinahm. Doch diese Überlegungen konnten bis morgen warten.
Meena Creek, 8. März 1911
Helene saß auf der Bank unter ihrem Fenster, neben sich eine Tasse Tee. Auf dem Schoß hielt sie eine verbeulte Blechschüssel, deren hellblaue Emaille an einigen Stellen abgeplatzt war. Die Regenzeit ging ihrem Ende zu; es war zwar noch immer sehr warm, doch nicht mehr ganz so stickig wie im Februar. Das Atmen fiel allmählich wieder leichter, die Feuchtigkeit begann, sich aus der Luft zu verziehen. Die Vögel sangen, als gehöre ihnen der Garten. Nur manchmal übertönte ein breitschnäbeliger Kookaburra den Gesang der anderen mit seinem vorwitzigen Lachen. Ob Trocken- oder Regenzeit, irgendetwas blühte immer in den Tropen. Helene hatte in den letzten Jahren oft ungläubig den Kopf schütteln müssen, wenn sie wieder mal eine neue Blume entdeckt hatte, die in ihrer übertriebenen Üppigkeit um Aufmerksamkeit zu heischen schien. Doch Helene gestand sich nur zu gerne ein, dass ihr diese natürliche Prunksucht gefiel, sehr sogar. Die exotischen Namen konnte sie sich allerdings nur selten merken, ganz im Gegensatz zu Katharina: Die botanischen Kenntnisse der Schwester verblüfften sie immer wieder. Helene selbst scherte sich nicht besonders um all die lateinischen Bezeichnungen. Ihr Unwissen tat der Freude an dem sinnlichen Duft und dem Feuerwerk an Farben schließlich keinen Abbruch. Evodia – diesen einen Namen hatte sie sich allerdings gemerkt. Sie drehte den Kopf nach links, wo die Ableger, die sie vor vier Jahren gemeinsam mit Katharina gepflanzt hatte, zu recht respektablen Bäumen herangewachsen waren. Doch obwohl sie die korrekte Bezeichnung wusste, nannte sie sie meist nur »Schmetterlingsbäume«. Helene stellte die Schüssel mit den Erbsen zur Seite und betrachtete die blauen Schmetterlinge, die sich eifrig an den fedrigen Kugelblüten zu schaffen machten. Vor drei Wochen hatten die Zweige begonnen, sich mit dem mauvefarbenen Blütenkleid zu bedecken, und seither waren sie wieder da, ihre blauen Schmetterlinge.
Diese Stunde am Vormittag, in der sie draußen Vorbereitungen fürs Mittagessen traf, genoss sie mit den Jahren auf Rosehill ganz besonders. Es war so wunderbar still hier hinterm Haus, wenn die Kinder entweder in der Schule waren oder, wie ihre Tochter Nellie, die für die Schule noch zu jung war, sich am Vormittag im Wintercamp des Orta-Stammes aufhielten, das am Rande des Regenwaldes ungefähr auf halbem Wege zwischen Tanners Farm und Rosehill lag. Die Aborigine-Frauen suchten dort, außerhalb des Dschungels, hauptsächlich nach essbaren Wurzeln wie Yam oder nach den Körnern einer wildwachsenden Pflanze, die Weizen nicht unähnlich war und aus denen sie ihre Fladen buken.
Helene nahm einen Schluck Tee und lehnte ihren Kopf an die sonnenwarme Hauswand. Drinnen hörte sie das gedämpfte Klappern von Kochgeschirr und dazwischen immer wieder mal ein Lachen, das Katharinas Sohn Peter galt. Katharina. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die entfremdete Schwester einmal zu ihrer Retterin werden würde?
Helene war noch ein Teenager gewesen, gerade erst sechzehn, als der Vater die sechs Jahre ältere Schwester vom Hof in Salkau jagte, weil sie sich in einen Katholiken verliebt hatte. Die Schwester so plötzlich zu verlieren war ein großer Schock gewesen, und es dauerte lange, ehe Helene wirklich begriff, dass Katharina nicht zurückkehren würde. Fortan musste sie ohne deren Rat auskommen und war ohne geschwisterliche Fürsprache, wenn die Eltern sie mal wieder beim Trödeln ertappten. Wie oft wohl hatte Katharina die kleine Schwester vor dem Zorn des Vaters geschützt, wenn er sie statt beim Melken mit der Katze spielend im Garten fand? Noch bevor Vater mit der Hand ausholte, stand Katharina vor ihr und log das Blaue vom Himmel herunter, bis er schließlich den erhobenen Arm sinken ließ und wütend davonstapfte. Helene lächelte, als sie jetzt an Katharinas Worte von damals dachte: »Das war das allerletzte Mal, dass ich für dich die Kohlen aus dem Feuer hole«, hatte sie böse gezischt und ihr den Zeigefinger gegen die Brust gedrückt. »Oder was glaubst du, wie viele Male ich den Eltern noch weismachen kann, ich hätte dich auf die Suche nach einem Eimer oder der Schöpfkelle geschickt?« Helene senkte den Kopf und gelobte Besserung. Katharina jedoch winkte nur ab. »Spar dir die Worte, es passiert ja doch wieder.« Schon am übernächsten Tag war die Schwester aus ihrem Leben verschwunden, ohne ein Wort des Abschieds. Helene vermisste die Ältere schrecklich, versteckte jedoch ihre Sehnsucht vor den Eltern, denn sie fand wie alle anderen in der Gemeinde auch, dass der Vater recht gehandelt hatte. Ausgerechnet einen Katholiken! Wo doch jeder Lutheraner wusste, dass der Papst der Teufel war! Katharina aber ließ sich vom väterlichen Rauswurf nicht von ihrem Glück abhalten und heiratete Matthias Jakobsen. Drei Jahre später waren Katharina und Matthias zusammen mit ihren Töchtern dem Ruf eines Freundes nach North Queensland in Australien gefolgt, um sich dort in den Tropen eine Zuckerrohrfarm aufzubauen. Eine größere Entfernung hätte Katharina wahrlich nicht zwischen sich und Salkau legen können.
Im Nachhinein konnte Helene ihre Schwester für ihre Entschiedenheit nur bewundern. Vielleicht, so dachte sie, war Katharina schon immer die Stärkere von uns beiden gewesen. Dieser Gedanke war Helene erst gekommen, seit sie selbst die wahre Liebe kennengelernt hatte. Erst dann konnte sie sich ein Bild davon machen, wie es in Katharina ausgesehen haben musste. Es war keineswegs Feigheit, sondern im Gegenteil großer Mut, der die Schwester für eine Liebe einstehen ließ, die gegen Gottes Gesetz war. Einen Mut, den Helene in einer ähnlichen Lage nicht aufzubringen vermocht hatte. Wäre sie vor sechs Jahren mutiger gewesen, wäre sie gar nicht erst zur Schwester nach Rosehill gegangen. Sie hätte einen anderen Weg gewählt.
Katharinas Lachen holte Helene in die Gegenwart zurück. Die Schwester schimpfte im Scherz mit Söhnchen Peter, dem bestimmt wieder etwas aus den Händchen gefallen war. Katharina konnte sich nämlich nicht durchringen, ihren Sohn Amarina, Helenes engster Aborigine-Freundin, anzuvertrauen und ihn mit den Orta-Kindern spielen zu lassen. Erst hatte Helene noch versucht, mit der Schwester zu reden, ihr klarzumachen, wie harmlos die Aborigines seien und wie sehr sie Kinder liebten. Doch am Ende akzeptierte sie, dass Katharina ihre Haltung nicht teilen konnte.
Im Gegensatz zu Katharina kannte Helene den Stamm der Orta aus nächster Nähe, ihre Tochter war bei ihnen zur Welt gekommen. Nicht, dass sie sich das ausgesucht hätte. Es war eine Notwendigkeit gewesen, ihr Kind und auch sie selbst hätten ohne die Orta die Geburt nicht überlebt. Helene schauderte noch heute, wenn sie sich an die Panik erinnerte, die damals von ihr Besitz ergriffen hatte, dieses schreckliche Gefühl nahenden Unheils. Doch die intensive Begegnung mit den Orta hatte sich für sie und für Nellie als Segen erwiesen.
Ihre Tochter Nellie war nun vier Jahre alt. Sie liebte es, mit den Orta-Kindern in der freien Natur herumzutollen. Den halben Tag verbrachten sie am Wasserloch. Sie kletterten auf die Paperbarks am Ufer und schwangen sich an Lianen übers Wasser, bis sie sich schließlich, vor Freude kreischend, mitten hinein plumpsen ließen. Nellie hatte ihr dunkles Haar geerbt, das der Tochter in widerspenstigen Locken über den gebräunten Rücken fiel. Irgendwann hatte Helene es aufgegeben, auf die korrekte Kleidung der Kleinen zu achten, und ließ sie wie die anderen Kinder nackt spielen. Es war eine helle Freude, ihnen zuzuschauen. Dabei überraschte und beeindruckte es Helene, dass ihre Tochter mit den Aborigines in deren Sprache redete. Auf Rosehill sprachen sie Deutsch untereinander. Es wäre den Schwestern unnatürlich vorgekommen, mit den eigenen Kindern in einer fremden Sprache zu reden. Nur wenn sie sich mit Nachbarn unterhielten oder den Einheimischen irgendwelche Anweisungen gaben, taten sie dies auf Englisch. Die Sprache der Aborigines jedoch beherrschte keiner der Siedler. Schon jetzt hätte Helene den Kindergesprächen zwischen Nellie und ihren Aborigine-Freunden nicht mehr ohne Probleme folgen können, obwohl sie selbst mehr als nur ein paar Brocken des Orta-Dialekts sprach. Manchmal, wenn sie dort am Ufer des Wasserlochs gesessen hatte, um den Kindern zuzuschauen, erschien ihr das deutsche Salkau wie ein ferner Traum, und es fiel ihr schwer zu verstehen, wie sehr sich ihr Leben verändert hatte, seit sie damals in Hamburg an Bord des Dampfschiffs gegangen war.
Sie fuhr aus ihren Erinnerungen hoch, als John Tanner sie ansprach. Seit etwa drei, vier Monaten kam ihr Nachbar am Vormittag regelmäßig auf eine Tasse Tee vorbei, sofern seine Arbeit es erlaubte.
»Herrlicher Tag heute. Wie gemacht zum Träumen, nicht wahr?«
Als er sah, dass sie zusammenzuckte, entschuldigte er sich sofort: »Sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Sie schüttelte den Kopf und wies auf den Platz neben sich.
»Ist nicht Ihre Schuld. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ich war nur mal wieder tief in Gedanken, bei den Orta.« John setzte sich und legte seinen Hut neben sich auf die Bank.
»Ich kenne keinen Weißen, der den Schwarzen jemals so nahegekommen wäre wie Sie.«
Helene nickte und schien sich wieder in ihren Gedanken zu verlieren, dann schlug sie sich vor die Stirn und sprang auf.
»Ihr Tee! Da denke ich wieder mal nur an mich und lasse Sie hier auf dem Trockenen sitzen.« Sie verschwand im Haus, um kurz darauf mit einer Blechtasse im Türrahmen zu erscheinen. Tanner war inzwischen aufgestanden und schaute sich im Garten um.
»Ich liebe den Winter mit seinen Schmetterlingen. Wussten Sie eigentlich, dass ›Ulysses‹ das lateinische Wort für ›Odysseus‹ ist?« Helene reichte ihm die Tasse.
»Nein, das wusste ich nicht.« Wer hätte gedacht, dass sich der irische Farmer in der griechischen Mythologie auskannte? Dieser Tanner war doch immer wieder für eine Überraschung gut.
Er schien ihre Verwunderung zu bemerken und zeichnete mit dem Fuß verlegen Kreise in den Kies.
Sie lächelte ihn an, um seine Verlegenheit zu zerstreuen, und schaute dann wie Tanner dem Flug der Schmetterlinge zu. Manche Falter konnte sie mittlerweile von den anderen unterscheiden, sie erkannte sie an ihren Flugmustern. Eine Dreiergruppe schwirrte beispielsweise immer um den kleineren der neuen Schmetterlingsbäume herum und ließ sich regelmäßig auf einem der oberen Äste nieder. Helene blickte Tanner von der Seite an. In all den Jahren hatte er sie nie danach gefragt, was es mit Nellie auf sich hatte, wer ihr Vater war. Das rechnete sie ihm hoch an.
Sie hatten wieder Platz genommen, saßen noch eine Weile stumm nebeneinander, tranken ihren Tee und sahen den Schmetterlingen zu, dann schlug Tanner sich mit den Händen aufs Knie.
»So, ich mach mich mal wieder auf den Weg, genug gefaulenzt. Schätze, ich sollte mich bei den Schnittern blicken lassen. Der neue Gangleader ist mir nicht ganz geheuer, da werfe ich besser mal ein Auge auf seine Arbeit. Danke für den guten Tee.« Er räusperte sich, als hätte er noch etwas auf dem Herzen. Helene wartete eine Weile, und tatsächlich wollte Tanner noch etwas loswerden. »Übrigens … Meine Einladung zum Tanz steht noch. Würde Ihnen vielleicht gefallen, mal rauszukommen und ein paar neue Gesichter zu sehen.« Er drehte sich zu ihr um, und ein Lichtstrahl, der aus ihrer Richtung kam, ließ ihn blinzeln. Es war ihr Anhänger, der das Sonnenlicht zu bündeln und zu reflektieren schien. Helene, die Tanners Irritation bemerkte, schaute an sich hinunter und griff nach dem Amulett, das wie immer um ihren Hals hing, seit sie es von Amarina bekommen hatte.
»Es ist nur das Amulett. Die Sonne verfängt sich manchmal darin.« John nickte und hob seine Hand zum Abschiedsgruß. In Gedanken war Helene jetzt bei dem Amulett, doch dann erinnerte sie sich wieder an Johns letzte Worte und blickte auf.
»Das mit dem Tanz wäre übrigens sehr nett. Wenn Sie mich also beim nächsten Mal mitnehmen wollen – ich würde mich freuen.« Tanner setzte den Hut auf und lächelte.
»Klar doch. Nächsten Samstag also. Ich hol Sie um vier ab.« Täuschte sie sich, oder war da plötzlich ein leichter Sprung in seinen Schritten?
Mit Tanner zum Tanz. Helene dachte einen Augenblick darüber nach, dann zuckte sie mit den Schultern. Warum eigentlich nicht? Er hatte recht, es würde ihr bestimmt guttun, mal unter Leute zu kommen.
Ihre Hand spielte mit dem Amulett, und ein abgelenkter Sonnenstrahl blendete sie. Als sie kurz die Augen schloss, schwirrten helle Punkte hinter ihren Lidern und ließen sie ein wenig schwindlig werden. Es war seltsam, erfüllte sie mit Unruhe. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte, dass Gefahr drohte. Eine plötzliche Angst ließ sie schwer schlucken. Wann hatte sie das schon einmal verspürt? Ein Schauder überlief sie bei der Erinnerung.
Es stimmte, was sie Tanner erzählt hatte. Das Licht spielte gerne mit dem Amulett, doch dieses intensive Blinken hatte sie bisher erst ein einziges Mal erlebt, vor Jahren, als sie dem alten Warrun, Amarinas Stammesältesten, das Amulett gezeigt hatte. Ängstlich hatte er sich die Augen zugehalten und etwas vom Min-Min-Licht und alten Geistern gefaselt. Und von einem Gesang, den sie, wenn sie ihn erst hörte, niemals wieder vergessen dürfe. Sie hatte sich innerlich darüber amüsiert. Und als sie den Gesang später tatsächlich in einem Traum gehört hatte, hatte sie ihn sofort wieder vergessen.
Aber jetzt, viele Jahre später, leuchtete das Amulett wieder.
Damals, nach der Begegnung mit Warrun und dem Ereignis mit dem Amulett, hatte ihr Leben eine dramatische Wende genommen. Nichts war mehr so geblieben wie zuvor, und sie hatte Dinge getan, die sie selbst nie für möglich gehalten hätte.
Helene war beunruhigt. Heute tat sie ein Zeichen wie dieses nicht mehr so rasch ab. Denn dass es ein Zeichen war, stand für sie außer Frage. Eine unbestimmte Angst begann, sich in ihr breitzumachen, und ließ sie für den Rest des Tages nicht mehr los.
Es war schon Nachmittag, als Amarina ins Haus stürmte. Die schwarzen Augen vor Angst geweitet, schnaufte und keuchte sie, als wäre ihr der Leibhaftige begegnet. Katharina reichte ihr freundlich ein Glas Wasser, doch Amarina ließ es fallen, woraufhin die Schwestern einander fragend anblickten. So hatten sie Amarina noch nicht erlebt.
»Was ist passiert?« Helene hielt es nicht länger aus. Sie wusste sofort, dass eingetreten war, wovor sie das Amulett am Morgen gewarnt hatte. Es musste etwas Schreckliches sein, etwas, das die ansonsten so in sich ruhende Amarina völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.
Amarinas Busen hob und senkte sich in schneller Folge, sie rang nach Luft, setzte zu sprechen an, brachte aber kein Wort heraus.
»Sag was! Was ist los?« Amarina schüttelte den Kopf und fing an zu weinen.
»Tut dir etwas weh? Hast du was kaputt gemacht?« Tränen liefen über die schwarzen Wangen, und ein Schluchzen entrang sich Amarinas Brust. Helene war am Ende ihrer Geduld, sie musste endlich wissen, was so schlimm war, dass es Amarina in ein Häufchen Elend verwandeln konnte. Doch erst als Helene sie vor Ungeduld schüttelte, begann die Aborigine zu reden.
»Die Kinder …« Sie atmete noch immer heftig, legte sich die Hand auf die Brust.
Helene wurde hellhörig. »Die Kinder? Was ist mit den Kindern?« Sie schüttelte Amarina mehr als nötig gewesen wäre, um sie zum Reden zu bringen.
»Polizei mit Auto … Polizei hat genommen Kinder. Mit Auto weg.« Amarina raufte sich die Haare und gab einen langgezogenen Klagelaut von sich, der ihren Schmerz erahnen ließ.
»Um Himmels willen, Amarina! Was erzählst du denn da? Die Polizei hat die Kinder mitgenommen? Aber warum denn und wohin und welche Kinder? In Gottes Namen, sprich, Amarina!«
Amarina hatte sich auf die Knie geworfen und die Hände vors Gesicht geschlagen. Sie wimmerte nur noch, doch unter Schluchzen presste sie schließlich ein paar Namen hervor. Amarinas eigene Tochter Cardinia und zwei weitere Orta-Mädchen im gleichen Alter, die Helene ebenfalls kannte – und Nellie.
Helene versuchte jetzt mit Gewalt, Amarinas Finger zu lösen, während diese ihr Gesicht partout bedeckt halten wollte. Heftig schüttelte sie die Aborigine, wieder und wieder.
»Helene, lass sie sofort los!«, schrie Katharina ihre Schwester an, doch diese hörte es nicht. Alles, was sie vernahm, war das Rauschen ihres Blutes und das Stolpern ihres Herzens. Sie hatten ihr Nellie weggenommen!
Erst als ein Nackenwirbel Amarinas laut knackte, ließ sie erschrocken von der Freundin ab. »Entschuldige, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Amarina rieb sich den Nacken und drehte den Kopf wie ein Boxer von rechts nach links, sie schien nicht verletzt zu sein. Helene bestürmte Amarina weiterhin mit Fragen, fasste sie aber nicht mehr an.
»Wie konntest du das zulassen? Wieso haben sie das getan? Wo sind die Kinder?«
Katharinas Mann Matthias und John Tanner hatten nach einigem Hin und Her beschlossen, dass es am besten wäre, einer von ihnen führe mit Amarina und Helene nach Innisfail, um sich dort nach dem Verbleib der Kinder zu erkundigen. Meena Creek selbst war nicht mehr als eine winzige Siedlung. Außer der kleinen Schule und einem halben Dutzend weit verstreuter Farmhäuser gab es weit und breit nichts, nicht mal einen kleinen Laden. Die nächste Polizeistation befand sich in Innisfail, das je nach Wetterlage in drei bis sechs Stunden zu erreichen war. Es wäre doch immerhin möglich, dass die Polizei nur rein zufällig in Meena Creek vorbeigekommen war und die unbeaufsichtigten Kinder in Gewahrsam genommen hatte, bis sich die Eltern auf der Polizeistation meldeten. So richtig glaubte allerdings niemand an diese Version, denn schließlich waren Erwachsene zugegen gewesen, als die Polizisten ein Kind nach dem anderen in ihr Auto gezerrt hatten. Amarina hatte sogar mit ansehen müssen, wie Cardinia noch die Hand nach ihr ausstreckte.
John Tanner saß auf dem Kutschbock, lud Helenes Truhe auf und trieb seine Pferde an. Helene war viel zu aufgelöst gewesen, um selbst daran zu denken, doch Tanner hatte ihr, so schonend er nur konnte, nahegelegt, dass es in Innisfail eine Weile dauern könnte, ehe sie etwas erreichten, und sie daher besser gleich ein paar Sachen für die Reise zusammenpackte. Hinter ihm saßen nun Helene und Amarina, die einander ängstlich bei den Händen hielten, bis die Finger taub wurden. Helene hatte sich bei Amarina für ihr Verhalten entschuldigt, und es tat ihr noch immer leid, wie sie die Freundin behandelt hatte. Auch ihr war schließlich das einzige Kind genommen worden.
Wie lange kannten sie einander schon? Sieben, acht Jahre? Lange genug jedenfalls, um Amarina als ihre beste Freundin bezeichnen zu können. Ihre besorgten Blicke trafen sich für einen Moment. Sie dachte wieder an Nellie und musste schwer schlucken. Es genügte, den Namen der Tochter zu denken, um ihre mühselig niedergehaltene Angst und Verzweiflung hochflattern zu lassen wie einen aufgeschreckten Spatz. Wieso nur hatte sie ihre Tochter allein zum Spielen zu den Orta gehen lassen? Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Nellie – sie war doch erst vier. Wo war sie, wie ging es ihr? Die Kleine würde nach ihr rufen, und zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben wäre die Mutter nicht da, um ihr süßes Mädchen tröstend in die Arme zu schließen.
Helene drückte sich die Handballen gegen die Schläfen. Das strähnige Haar klebte ihr an den Wangen. Düstere Ahnungen breiteten sich in ihrem Schädel aus wie schwarzer Schimmel. War das der Preis, den sie für ihre Liebe zu zahlen hatte? Dass man ihr das einzige Kind wegnahm?
Helene zwang sich, diese Gedanken nicht übermächtig werden zu lassen. Es war wichtig, sich auf die nächsten Schritte zu konzentrieren. Wenn sie ihre Tochter finden wollte, musste sie sich zusammenreißen. Sie musste herausfinden, wer Nellie und die anderen Mädchen entführt hatte und wo sie jetzt waren.
Tanner glaubte, die Polizeistation in Innisfail sei der beste Ort für erste Erkundigungen. Von Amarina erfuhr sie, dass die Polizei den Aborigines schon öfter Kinder weggenommen hatte. Helene mochte das nicht glauben. Das ergab doch alles keinen Sinn. Warum sollte die Polizei Müttern ihre Kinder entreißen? Amarina hatte keine Antwort auf ihre Fragen. Sie war dem Auto, in das man die weinenden Mädchen gezerrt hatte, noch lange nachgelaufen, hatte geschrien und die Arme nach ihnen ausgestreckt. Doch dann war der Wagen hinter einer Kurve verschwunden und hatte nichts außer einer Wolke roten Staubes hinterlassen.
Die meiste Zeit während der Fahrt schwiegen die Frauen, jede hing ihren bedrückenden Gedanken nach, ab und zu brach mal die eine, dann die andere in ein Schluchzen aus, und dann umarmten sie einander. John Tanner vermied es, sich nach ihnen umzudrehen, und schwieg ebenfalls. In Innisfail angekommen, machte er vor der Wache die Pferde fest und half den Frauen aus der Kutsche. Amarina trug Helenes altes Baumwollkleid. Es war ganz fleckig. Die schwüle Hitze hatte ihr Haar in dunkle Zuckerwatte verwandelt. Helene versuchte, es zu bändigen, indem sie es mit dem Taschentuch lose zusammenband, und sie fand, dass ihre Freundin einen recht passablen Eindruck machte. Sie sah an sich herunter, strich den Rock glatt und folgte Tanner, der ihnen die Tür aufhielt. Es war abgemacht, dass er vorsprechen sollte. Helene sprach nach all den Jahren in Australien zwar ein gutes Englisch, doch da es nicht ihre Muttersprache war, fand sie es nur recht und billig, dass Tanner diese Aufgabe übernahm. Dem Wort eines Mannes würde zudem zweifellos größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und deshalb hatte Tanner ihr eingeschärft, sich im Gespräch mit den Beamten zurückzuhalten, auch wenn es noch so schwerfiele.
Das Herz schlug Helene vor Aufregung schmerzhaft gegen die Rippen, als Tanner mit der flachen Hand auf die Klingel schlug, die auf dem Tresen stand. Herrgott, John war doch nur ein irischer Bauer. Was konnte er schon groß mit Worten ausrichten? Ein Blick auf die Freundin verriet ihr, dass es Amarina nicht anders erging. Am liebsten hätte sie lauthals nach Nellie gerufen, doch sie war sich im Klaren, dass dies nicht eben klug gewesen wäre. Angst schnürte ihr die Kehle zu, als Tanner erneut klingelte, dieses Mal so fest, dass der Laut noch eine ganze Weile nachhallte. Hinter einer Glasscheibe konnte sie Polizisten sehen, die sich angeregt miteinander unterhielten und von ihnen keine Notiz zu nehmen schienen.
»Hallo? Jemand da?«, fragte Tanner mit lauter Stimme. Nach einer Weile, die Helene wie die Unendlichkeit vorgekommen war, erschien eine schmächtige Gestalt in Uniform, deren Gesicht von einem schwarzen Schnurrbart beherrscht wurde.
»Constable Hammerton. Womit kann ich dienen?« Der Polizist zückte einen Notizblock und legte ihn vor sich auf den Tresen, bereit, einen weiteren Gesetzesbruch im Landkreis zu protokollieren. Erwartungsvoll schaute er zu Tanner auf, die Frauen hinter ihm schien er gar nicht erst wahrzunehmen. Tanner räusperte sich. Es war ihm anzusehen, wie schwer es ihm fiel, diese Sache in die Hand zu nehmen.
»John Tanner aus Meena Creek.« Er knetete mit beiden Händen seinen Hut, den er beim Betreten des Gebäudes abgenommen hatte. Mit dem Daumen wies er hinter sich. »Oh, und diese Dame hier ist meine Nachbarin Helene Junker mit ihrer Magd.«
Wieder einmal musste Amarina als Dienstbotin ausgewiesen werden, da die Regierung den näheren Umgang mit Schwarzen verboten hatte. Dienstboten waren allerdings als Ausnahme erlaubt. Warum das so war, wusste Helene nicht. In ländlichen Gebieten war es üblich, sich um die große Politik einen Teufel zu scheren, und daher beschäftigten alle Farmer, die sie kannte, einheimische Hilfen – ob das Gesetz es nun erlaubte oder nicht. Solange man die Aborigines nicht direkt auf den Feldern bei der Arbeit erwischte, drückten die Behörden meist ein Auge zu.
»Heute Morgen sind diesen Ladys und zwei weiteren Frauen ohne Erklärung die Töchter weggenommen worden. Von der Polizei, heißt es, und nun fragen wir uns, ob sie uns vielleicht weiterhelfen können?« Er warf einen Blick über die Schulter. Die Frauen hielten sich aneinander fest, sichtlich darum bemüht, die Fassung zu wahren. Constable Hammerton schaute erst wieder auf, als er schwungvoll einen Punkt hinter seine Notizen gesetzt hatte.
»Heute Morgen sagen Sie?« Er kratzte sich am Hals. »Hm, darüber weiß ich nichts. Vielleicht kann Sergeant Miller mehr dazu sagen. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment.« Tanner wechselte einen unruhigen Blick mit Helene und Amarina, als Constable Hammerton sich in die hinteren Räume verzog. Helene spähte durch die Glasscheibe, hinter der Hammerton mit einem Kollegen sprach. Hin und wieder schauten sie dabei auf Tanner, der von einem Fuß auf den anderen trat. Amarina fing an zu wimmern. Helene legte ihr den Finger auf den Mund und drückte sie fester an sich. Schließlich erschien Hammerton wieder.