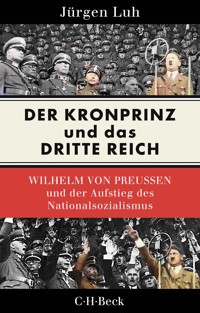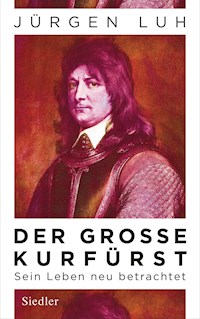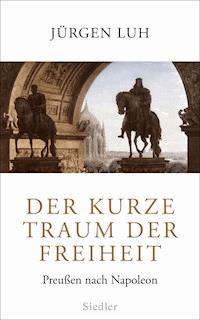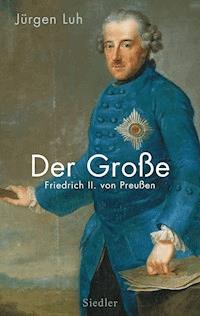
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Inszeniert, glorifiziert, mystifiziert - Wie war Friedrich II. wirklich?
Friedrich der Große faszinierte die Deutschen schon immer. Über seine Kriege, über Werk und Wirkung des kunstsinnigen Preußenkönigs wurde schon viel geschrieben. Jürgen Luh aber zeigt auf eine frische, andere Art, wie Friedrich dachte und wofür er lebte: Der König wollte unbedingt als »der Große« in die Geschichte eingehen. Die Quellen, die der Philosoph auf dem Thron uns hinterlassen hat, offenbaren einen Menschen mit großen Talenten – und ebenso großen Schwächen.
Friedrich II. (1712–1786) erstrebte vor allem eines: Ruhm! Ein Großer wollte er sein unter den Herrschern Europas und vor der Geschichte. Das hat er geschafft – die Nachwelt verklärte ihn, man errichtete dem »Alten Fritz« zahlreiche Denkmäler und glorifizierte ihn in Büchern und Filmen.
Der Friedrich-Kenner Jürgen Luh zeichnet zum 300. Geburtstag ein neues Bild des Preußenkönigs. Manch lieb gewordene Vorstellung wirft er dabei über Bord, doch entschädigt er uns mit einem einfühlsamen Porträt des Menschen Friedrich. So begegnet uns in diesem Buch kein Held, sondern ein faszinierender Herrscher des 18. Jahrhunderts, dessen Leben und Wollen der Autor ebenso kenntnisreich wie amüsant vor uns ausbreitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Franziska und Hans-Joachim
Inhaltsverzeichnis
Bild 1
Tapfrer, deines Ruhmes SchimmerWird unsterblich sein im Lied;Denn das ird’sche Leben flieht,Und die Toten dauern immer.
FRIEDRICH SCHILLER, Das Siegesfest
RUHMSUCHT
Das Kapitel über den Ruhm ist das erste und das längste in diesem Buch, denn Ruhm zu erlangen war Friedrichs wesentliche Antriebskraft. Das ist keine neue Erkenntnis. Fast alle Schriftsteller, die sich mit seiner Person auseinandersetzten, haben dies festgestellt – wenn auch nicht mit der Unbedingtheit und Ausschließlichkeit, mit der es hier geschieht. Oft und gern wurde seine Sucht nach Ruhm als Ausdruck jugendlichen Leichtsinns und ersten Überschwangs gedeutet, dagegen war man nur widerwillig bereit, darin ein Zeichen seiner Rationalität zu sehen. Denn mit seinem Streben nach gloire, wie er selbst, französisch sprechend und schreibend, es nannte, verbindet man allein Friedrichs Reputation als Feldherr, was für ihn ob seiner Erfolge schmeichelhaft ist, aufgrund des dafür in Kauf genommenen Blutzolls aber wenig vorteilhaft. Friedrich schrieb an den Berater und Vertrauten Charles Etienne Jordan am 3. März 1741, also nach dem Einfall in Schlesien und einen Monat vor seiner erster Feldschlacht: »Meine Jugend, die Glut der Leidenschaft, der Ruhmesdurst, ja selbst die Neugier, um Dir nichts zu verhehlen, kurz ein geheimer Instinkt hat mich den Freuden der Ruhe entrissen, die ich genoß. Die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und später in der Geschichte zu sehen, hat mich verführt.«1 Das wird gern zitiert, doch man nimmt die Worte gar nicht ernst. Auch seine Sätze aus den Denkwürdigkeiten, der Geschichte meiner Zeit in der Version von 1742 werden immer wieder angeführt: »Der Ehrgeiz, mein Vorteil, der Wunsch, mir einen Namen zu machen, gaben den Ausschlag, und der Krieg ward beschlossen.«2 Selbst Sebastian Haffner, der »den historischen Blick [und] einen Sinn für die Pfade abseits des akademischen Zunfttrotts«3 besaß, wie Joachim Fest hervorhob, wollte alles »das nicht ganz ernst nehmen. Selbstironie und Selbstverspottung«4, meinte Haffner, »gehörten zu Friedrichs Eigenarten.«
Das ist nur zum Teil richtig. Denn Friedrich karikierte oder verspottete nicht zweckfrei, sich selbst schon gar nicht und erst recht nicht öffentlich. Die gelegentliche Ironisierung seiner selbst sollte die Wahrheit nur verschleiern; sie sollte verdecken, wie bitter ernst er nahm, was er dachte und sagte – gerade über gloire. Weisheiten wie Ruhm sei »eitel« und »nur schöner Schein«5, die er bald verkündete und später immer wieder zum besten gab, dienten dazu, ebenso sein Ausspruch, den uns Kaiser Joseph II. überliefert hat: In seiner Jugend hätte er Ehrgeiz besessen und sogar schlecht gehandelt, aber die Zeiten seien vorüber, und er dächte jetzt viel ernster.6 All dies hat eine Sichtweise bestärkt, die Ruhm als ständiges und bestimmendes Motiv von Friedrichs Handlungen ausblendet – obgleich gerade auch solche Sätze, wie wir sehen werden, ihm Ruhm sichern sollten: den des Philosophen. Man hat dabei übersehen – oder nicht wahrhaben wollen –, daß Friedrich sein Leben lang zielstrebig, verbissen fast, an seinem Ansehen arbeitete – und zwar nicht nur am Ansehen des Feldherrn. »Ich glaube, seine größte Leidenschaft ist Ruhm und guter Ruf«7, hat Ulrich Friedrich von Suhm 1740 geschrieben, ein Mann, der Friedrich von Jugend an kannte. Suhm hat recht gehabt, muß man sagen. Ruhm zu erlangen und diesen dann zu bewahren, war Friedrichs persönlichstes, höchstes Ziel, war der Kitt seines Seins – zeitlebens.
Es ist ja durchaus nicht verwerflich, Ruhm zu erstreben und seinen Namen ins Buch der Geschichte eintragen zu wollen, auch wenn manche das sehr skeptisch sehen. Dieses Streben ist heute wie damals sehr weit verbreitet. Es ist ein wichtiger Antrieb des Menschen für Veränderung und Entwicklung – zum Positiven wie zum Negativen. Ohne dieses Streben des Menschen nach Veränderung gäbe es keine Entwicklung – das eine ist ohne das andere kaum möglich. Friedrich jedenfalls wird man ohne seinen Willen zum Ruhm, gar ohne seinen Willen zur Größe nicht verstehen können. Beides, Ruhm und Größe, zu erreichen und sich zu erhalten, hat seinen Charakter geprägt und sein Leben gestaltet, so wie er es gewollt und gelebt hat.
Der Jugend Traum und Ziel
Bereits Friedrichs Jugendjahre zeugen von seiner Sehnsucht nach Ruhm, spiegeln den Wunsch des Heranwachsenden, »sich einen Namen zu machen«. Wann genau dieses Verlangen den Knaben erfaßte, läßt sich allerdings nur schwer bestimmen. Mit Sicherheit geschah das weit vor dem Fluchtversuch von 1730, mit wohl dreizehn, vierzehn, fünfzehn Jahren schon, zu einer Zeit also, da er — wider den Willen des Vaters und als Ausgleich zu dessen dumpfer Erziehung — die Abenteuerromane und Epen Fénelons, Tassos und Cervantes’ las und durch diese seine Phantasie und Vorstellung anreicherte: den Telemach, den Rinaldo und den Don Quichote. Heimlich mußte er das tun, aus Vorsicht vor dem Vater, wie wir von Friedrichs Gesellschafter Henri de Catt wissen, der die Unterhaltungen, die er mit Friedrich führte, in einem Tagebuch aufzeichnete. Dieses hat de Catt später leider – bis auf das Jahr 1758 – sehr stark bearbeitet, so daß man den daraus entstandenen Gesprächen nicht uneingeschränkt glauben kann. In diesen findet sich die Anekdote des heimlichen Lesens ausführlich ausgemalt. Friedrichs Äußerungen über seine nächtliche Lektüre stehen zwar auch in dem ursprünglichen Tagebuchtext de Catts, allerdings in einem ebenfalls redigierten Teil, wie man von dem Schweizer selbst weiß. So ist auch nicht ersichtlich, wann zwischen dem 14. und 19. November 1759 Friedrich diese Sätze gesagt haben soll: »Ich fing an zu lesen«8, und: »Ich schlief zwischen meinem Gouverneur, dem Grafen Finckenstein, und meinem Kammerdiener. Wenn sie fest eingeschlafen waren, stieg ich über das Bett des Dieners hinweg und stahl mich ins Nebenzimmer, wo mir der Kamin als Lampe diente. Dort kauerte ich mich nieder und las. Aber eines Abends wird der Marquis von einem Husten geweckt; er hört mich nicht atmen, tastet nach mir, und da er mich nicht findet, beginnt er zu rufen. Ich komme schnell zurückgelaufen und sage, daß ich ein Bedürfnis verrichten mußte.«
Wortwörtlich hat Friedrich vielleicht nicht so gesprochen; aber sinngemäß sind solche Sätze wohl denkbar. Die in ihnen bezeichneten Umstände mögen dazu beigetragen haben, daß gerade der Telemachauf den Minderjährigen eine starke Wirkung ausübte. »Das Bild des jugendlichen Helden«9 – Odysseus’ Sohn Telemach – »den Minerva selbst zur Weisheit leitet, versetzte ihn in eine neue, schönere Welt«, bemerkte Ernst Bratuscheck dazu in seiner grundlegenden Studie über Die Erziehung Friedrichs des Großen. Und er vermutete: »Als er die weisen Lehren seiner Ahnfrau las« – diejenigen Sophie Charlottes in ihrer Handreichung zum Telemach für Friedrichs Vater — »schien ihm die preußische Minerva selbst den Weg zum Tempel des Ruhms zu weisen.« Diese Aussage mag in ihrer Deutlichkeit übertrieben sein; sie beruht wohl wesentlich auf Friedrichs späteren Schriftzeugnissen über sein Streben nach Ruhm. Daß die Lektüre des Telemach und anderer, ähnlicher Werke bei dem Knaben durchaus den Wunsch beförderte, gloire gleich den Helden der Romane zu erlangen, und offenbar seine Vorstellung verfestigte, etwas Besonderes zu sein, davon werden wir gleich erfahren. 10
Zunächst muß aber noch vermerkt werden, daß nicht nur die Romanlektüre, sondern auch das Studium der alten Geschichte Friedrich früh mit dem Ruhm und dessen Bedeutung in Berührung brachte; Geschichte, die der Alten vor allem, verstärkt später durch die Lektüre von Rollins Römischer Geschichte, machte einen Gutteil seines Stundenplans aus. Seine Lesefrüchte führten ihn zu der Erkenntnis, daß allein der Ruhm eine Persönlichkeit dauerhaft in der Erinnerung der Menschheit hält. Sie offenbarten Friedrich zudem, welche Taten in den Augen der Nachwelt als ruhmwürdig galten: zuerst diejenigen, die man auf dem »Feld der Ehre« vollbrachte, nämlich Schlachtensiege, Belagerungen, Eroberungen, und darunter vor allem jene Triumphe, die politischen Gewinn abwarfen. Vorbilder als ruhmreiche Feldherren waren ihm Alexander, Cäsar und Scipio africanus. Ihre Namen kann man immer wieder finden in Friedrichs Schriften, von früher Jugend an bis ins hohe Alter.
Das große Ansehen, das diese historischen Heroen allgemein genossen, wirkte stark auf das Selbstverständnis des Jugendlichen. Dies läßt sich zwar aus nachmaligen Äußerungen nur schließen, da Zeugnisse aus jener frühen Zeit fehlen. Aber man kann dies mit gutem Recht tun, denn in den Briefen des jungen Mannes an seine 11 Vertrauten der 1730er und 1740er Jahre ist von den genannten Männern immer wieder die Rede. »Ich schreite von Land zu Land, von Eroberung zu Eroberung und nehme mir wie Alexander stets neue Welten zu erobern vor«12, heißt es in einem Schreiben des Kronprinzen an den Kammerjunker Natzmer 1731, und in einem Brief an den Minister von Grumbkow 1732: »Bisweilen kommen Marius, Sulla, Cinna, Cäsar, Pompejus, Crassus, Augustus, Antonius und Lepidus, um sich mit mir zu unterhalten.«13 Dann: »Man müßte so viel Geist haben wie Du, um aus mir einen Alexander zu machen«14, in einer Antwort auf Wilhelmines Lob seiner Eigenschaften 1734. »Sei mein Cicero, was das Recht meiner Sache anbetrifft, ich werde Dein Cäsar sein, was die Ausführung angeht«15, schrieb er an Jordan 1741 aus Schlesien. »Ein Regiment soll sich nicht durch eitle Prunk- und Prachtentfaltung, nicht durch äußeren Glanz hervortun. Die Truppen, mit denen Alexander Griechenland unterwarf und den größten Teil Asiens eroberte, waren ganz anders beschaffen. Das Eisen bildete ihren einzigen Schmuck. Durch lange, mühselige Gewöhnung waren sie zu Anstrengungen abgehärtet; sie wußten Hunger, Durst und alle Leiden zu ertragen, die der rauhe Zwang eines Krieges nach sich zieht. Eine kernige und enge Manneszucht kettete sie aneinander, ließ sie alle dem gleichen Ziele zustreben und machte sie geeignet, mit Schnelligkeit und Tatkraft die umfassendsten Pläne ihrer Feldherren auszuführen.«16 So schrieb er, schon reif und überlegt, an Voltaire am 7. April 1737. An Themen und Komposition von Friedrichs Briefen offenbart sich: Handeln und Wirken dieser Großen haben ihn berührt und beeindruckt, sind ihm auch Vorbild geworden. Alexander, Scipio, Pompeius und Cäsar nacheifern, das darf man annehmen, wollte auch der Knabe schon. Der junge Mann jedenfalls ließ im Vorsaal zur kronprinzlichen Wohnung in Rheinsberg Reliefmedaillons von Hannibal, Cäsar, Scipio und Pompeius anbringen. Die Helden der Historie wie die des Romans hatten in dem Jugendlichen den – zunächst sicher sehr abstrakten – Wunsch geweckt, gleich ihnen unsterblichen Ruhm zu erlangen.
Den Weg, den seine Helden ihm wiesen, wollte er gehen. Dazu fühlte er sich berufen — und als ein Thronfolger mit Standesbewußtsein auch berechtigt. Wir erkennen das in den von verschiedener Seite überlieferten Aufzeichnungen über den Streit zwischen Kronprinz und König um die Prädestination, die Vorherbestimmung menschlichen Handelns und dessen Ergebnis durch einen zuvor feststehenden Willensentscheid Gottes. Durch Gottes Gnadenwahl, so die Lehre, seien einzelne Menschen zur Seligkeit oder Verdammnis bestimmt. Friedrich, dies läßt sich genau sagen, war mit der Prädestinationslehre am 30. Juni 1724 in Berührung gekommen, als seine Schwester Wilhelmine im Berliner Schloß ein ausführliches Glaubensbekenntnis ablegen mußte. »In demselben sprach die Prinzessin den Glauben an eine ewige, unveränderliche Gnadenwahl aus, doch mit der Erklärung, daß Gott dadurch nicht zum Urheber der Sünde gemacht wird, weil er die Sünde nur zuläßt, aber ihr Maß und Ziel setzt, sie zu einem guten Ende führt, bei der That die Bewegung, aber nicht die Bosheit giebt.«17 Daß der Zwölfjährige sich der theologischen Hintergründe der Prädestinationslehre, wie Wilhelmine sie vorgetragen hatte, bewußt war, darf man mit Fug bezweifeln. Ihm fehlten dafür schlicht Wissen und Verständnis. Doch war, wie Ernst Bratuscheck in seiner Studie vermutet, »Friedrichs Aufmerksamkeit … von nun ab auf dieselbe [Lehre] gerichtet, und er forschte der Sache weiter nach«.
Leider läßt sich darüber mehr kaum sagen; nicht wo er nachforschte, nicht wie lange er es tat. Aus den Quellen wissen wir nur, daß die Prädestination Friedrich wohl während der nächsten zehn Jahre seines Lebens beschäftigte, das scheint immer wieder einmal auf; im Grunde wissen wir sogar nur, daß er gegen die Auffassung des Vaters an der Idee der Vorherbestimmung festhielt. In welchem Zusammenhang er das tat und wie intensiv, das wissen wir nicht. Eduard Zeller, der Friedrich als Philosoph vorstellte, vertrat die Ansicht, die Prädestinationslehre habe »wenigstens ihrer allgemeinen Tendenz nach seinen Beifall gefunden«18; dies erhelle »aus der Mühe, die sein Vater sich gab, den Achtzehn- und Neunzehnjährigen durch Ermahnungen im Befehlston und durch seelsorgerische Einwirkung von ihr zurückzubringen«. Zeller »vermutete« zudem in der Absicht, wie er selbst sagte, schon in dem Jungen und Jugendlichen einen großen Philosophen zu erkennen, »daß Friedrich bei der Selbständigkeit, mit der er schon frühe der positiven Dogmatik gegenüberstand, nur ihre allgemeinen Voraussetzungen über die unbedingte Abhängigkeit aller Dinge von der Gottheit, nicht die Lehre von der ewigen Vorherbestimmung zur Seligkeit und zur Verdammniß sich angeeignet, oder wenigstens nur an jenen festgehalten habe«19. Das wurde von der Geschichtsschreibung gern aufgegriffen. Doch Zellers Mutmaßung ist kaum abgesichert. Für gewiß nehmen darf man wohl nur dies: Den Zwölfjährigen interessierten die Fragen der Gnadenwahl, die mit seiner und Calvins Konfession verbunden waren, mit Sicherheit nicht. Den euphorisch-phantasievollen Knaben, der gerade den Telemach und andere Abenteuergeschichten gelesen und sich in das Leben der antiken Helden vertieft hatte, faszinierte nur die Idee der Vorherbestimmung — jedoch in seiner eigenen Auslegung derselben, nämlich in der Vorstellung, selbst für Großes bestimmt und zum Helden erwählt zu sein, ja einer werden zu wollen. Er stellte sich damit gegen seinen Vater, um gegen diesen »seine Individualität … zu behaupten«20. Aus diesem Grund zuallererst hielt Friedrich wohl an der Prädestination fest, als Friedrich Wilhelm I. ihn unter allen Umständen davon abbringen wollte, und nicht etwa aus frühreifer theologischer Überzeugung. Eine solche fehlte ihm, und es ist fraglich, jedenfalls nicht belegbar, ob er sich zu diesem Thema je eine angeeignet hat. Wie wir wissen, hatte Friedrichs Religionslehrer, der Hofprediger Andreä, »dem Prinzen die verpönte Lehre gar nicht vorgetragen«, ihm stattdessen erklärt, »daß sie für sein Alter noch zu hoch sei«21. Und Andreäs Nachfolger, der allen Gedanken an die Gnadenwahl abholde Hofprediger Noltenius, war von Friedrich Wilhelm I. eigens beauftragt worden, Friedrich von der Prädestinationslehre fernzuhalten. Ob der jugendliche Kronprinz also wirklich »der Sache weiter nachforschte« und »sich tiefgehender mit ihr beschäftigte«, wie Bratuscheck meinte und nach ihm noch viele, muß ungewiß bleiben.
Viel später erst, 1730, nach seinem Fluchtversuch, las Friedrich während der Haftzeit in Küstrin die Werke von Bossuet und Basnage, die Histoire des variations des églises protestantes sowie die Histoire de la religion des églises réformées22; beides scharfe Kampfschriften für — Bossuet – und wider – Basnage — die antiprotestantische Politik Ludwigs XIV. von Frankreich. Beide berührten die Prädestination. Doch hatte diese Lektüre mehr mit der wachsenden Freude Friedrichs an Polemik zu tun und weniger mit irgendeinem Interesse an der Frage der Gnadenwahl.
Der Wille des jungen Mannes
Was der Achtzehnjährige unter Prädestination verstand, hat er weder während der Verhöre nach seinem Fluchtversuch noch in der Küstriner Haft gesagt; wir können es nur erschließen. So aus einem Schreiben Friedrich Wilhelms I. an den Geheimen Rat Gerhard Heinrich von Wolden, Potsdam, 12. Dezember 1730, in dem es heißt: »Er« — der Kronprinz — »wäre von Gott dazu prädestiniret, Mir ungehorsam zu sein, dieses wäre seine verdammliche Lehre.«23 Ferner aus den dazu einzig überlieferten Worten Friedrichs: Er halte »die Frage vom Particularismo vor speculativ und mehr vor philosophisch als theologisch«24. Beide Zeugnisse unterstützen die Vermutung, er habe in der Jugend sich seine eigene »Lehre« von der Vorbestimmtheit aufgestellt, eine, in deren Mittelpunkt er selbst stand.
Aus der Küstriner Zeit erfahren wir auch weiter nur indirekt, durch Exegese, von Friedrichs Überzeugung, etwa durch einen Brief des Kammerdirektors Christoph Werner Hille an den Minister Friedrich Wilhelm von Grumbkow, Küstrin, 18. Dezember 1730, in dem es über Friedrich heißt: »Er stellt sich so, als wolle er vom Heiraten nichts wissen, und er spricht sich darüber in einer Weise aus, die uns samt und sonders zum Lachen gebracht hat. Mein Vater, erklärte er, hat mir selbst geraten, ich solle nicht jung heiraten, und bei meiner Natur wäre ich bald eines Frauenzimmers überdrüssig, das mir alljährlich ein Kind beschert und bald häßlich würde. Dann würde ich blindlings in den Ehebruch hineinrennen, der nach meiner Ansicht etwas Verwerfliches ist. Ich will in vierzig Jahren heiraten, und zwar eine fünfzehnjährige Prinzessin, so schön, als ich sie finden kann.«25 – »Solche eigenartigen Ansichten«, so Hille, »mache ich mir zunutze, um sein System der Prädestination zu bekämpfen, an das er noch heute mit dem Fatalismus eines Türken glaubt.«
Man erkennt aus diesen Zeilen sofort: Friedrichs »System« war irdisch und kein bißchen göttlich, zudem bar jedweder Theologie. Hilles Bericht offenbart, daß Friedrich bei Prädestination an sich selbst dachte, daß es ihm darum ging, was er in der Welt sein wollte und wie er sein wollte; er deutet auch an, daß der Kronprinz gedachte, eigene Interessen zu verfolgen. Hilles Brief zeigt zudem: Um sein Ziel zu erreichen, nahm Friedrich weder Rücksicht auf die Dynastie noch auf das preußische Staatsinteresse. Andernfalls hätte er die Problematik der Thronfolge bedacht, denn nicht heiraten zu wollen bedeutete ja, keinen legitimen leiblichen Erben zu haben. Er wußte dies, und es war seine Absicht: Er wollte seinen eigenen, den ihm bestimmten und vor allem von ihm bestimmten Weg gehen — und seinen Neigungen folgen.
Als es ihm opportun erschien, ließ Friedrich von der Prädestination ab und dem Vater seine Unterwerfung unter »die königliche Willensmeinung«26 melden, ein letzter Hinweis darauf, daß ihm die theologische Bedeutung der Gnadenwahl nicht naheging. Im Grunde war die Unterwerfung eine Verstellung, denn die Gewißheit, zu etwas Großem, Ruhmreichem bestimmt zu sein, gab Friedrich dadurch nicht auf. Unsterblichen Ruhm wollte er unbedingt erringen; dahin ging sein Sehnen. Diesem Ziel, das darf man mit Recht vermuten, denn dafür gibt es einige Anhaltspunkte, diente auch sein Fluchtversuch. Der war eine Reaktion auf den Vater, auf dessen dumpfe Art — ja!, das ist längst allbekannt. Die Aktion war aber auch angelegt, Aufsehen zu erregen – was sie dann weithin tat. Das sollte man ebenfalls bedenken.
Friedrich hatte gut kalkuliert. Er hatte berechnet, daß er durch eine Flucht an Achtung nur gewinnen konnte – durch eine gescheiterte sogar noch mehr als durch eine geglückte, weshalb man schließen darf, daß er gar nicht fliehen wollte. Dies mag überraschen, scheint kaum glaublich – wahr ist es dennoch. Friedrich wollte nicht fliehen, sondern ein Zeichen setzen, nämlich dieses: Ich bin! Ich bin ein eigener Kopf, der Entscheidungen trifft, weittragende und auch folgenschwere. Das wollte er signalisieren. Daß er gar nicht fortwollte, dafür sprechen die dilettantische Vorbereitung und der Hergang des Fluchtversuchs, auch die Aussage eines Eingeweihten, er habe »geglaubt, der Kronprinz würde gewiß wieder hierher«27 — zurück, nach Berlin — »kommen«. Zunächst war nicht einmal aufgefallen, daß der Kronprinz fliehen wollte, dabei hatte er durchaus versucht, durch auffälliges Benehmen Verdacht zu erregen; daß er entweichen wollte, mußte schließlich verkündet werden, und zwar laut und nicht aus Bedrängnis heraus — der Page Keith übernahm dies gegenüber Friedrich Wilhelm I. einen Tag später, nach einem Kirchgang in Mannheim, angeblich seines schlechten Gewissens wegen.
Was sich damals zutrug, ist sehr gut erforscht. Dies die Einzelheiten von Friedrichs Beginnen: Der Kronprinz hatte sich am 4. August 1730 um 3 Uhr morgens von seinem Nachtlager auf einem Steinsfurter Scheunenboden sehr laut erhoben, sich dann angekleidet und sein Geld eingesteckt, schön geräuschvoll, denn es sind Münzen gewesen, die er in seine Rocktasche fallen ließ. Der Kammerdiener neben ihm hatte dies nicht überhören können. Er sah nun den Kronprinzen in einem leuchtend roten Rock (!) stehen, den dieser sich eigens für die Flucht hatte anfertigen lassen. So ausstaffiert verließ Friedrich sein Lager und wartete, an das Rad einer Kutsche gelehnt. Worauf? Allem Anschein nach darauf, daß ihn sein beigegebener Begleitoffizier bemerkte; der Kammerdiener hatte ihn rufen lassen. Von Vorsicht oder Eile, die geboten gewesen wären, beim Kronprinzen jedenfalls keine Spur! Schließlich kam der Offizier, wünschte Friedrich »in aller Ruhe guten Morgen und zog ihn in ein Gespräch, … sie gingen vor der Scheune auf und ab«28.
Soweit Friedrichs Fluchtversuch! Reinhold Koser, der große Biograph des Königs, hat ihn rekonstruiert, die Situation in Steinsfurt auch etwas dramatisiert. Er hat alle Details zusammengetragen und den Kronprinzen auch gebührend bedauert. Indessen: Das Drama für Friedrich war lediglich, daß man sein Ziel nicht erkannte. Erst anderntags verriet sein Page Keith – vielleicht vom Kronprinzen beauftragt? — dem König das Vorhaben. Die Folgen sind aller Welt geläufig: Prozeß und Haft in Küstrin. Daß sein dilettantischer Fluchtversuch seinen Freund Hans Hermann von Katte das Leben kosten würde, konnte Friedrich nicht voraussehen; gewollt hat er es nicht. Sein Ziel hat er trotzdem erreicht. In Europa zuvor kaum bekannt, war sein Name nun – nach versuchter Flucht und Verurteilung — in aller Munde. Erfreut hat er dies registriert. Es hat ihn in seinem Streben bestärkt.
Daß Ruhm in Friedrichs Küstriner Zeit die erste Kategorie seines Denkens war, läßt sich auch aus der Reaktion auf seiner Schwester Hochzeit mit dem Bayreuther Markgrafen herauslesen. Friedrich habe Wilhelmine, so Hille in einem Schreiben an Grumbkow vom 5. Juni 1731, den glänzendsten Thron Europas gewünscht, den englischen.29 Doch da die Briten sich so hochmütig verhielten, hätte der Vater recht getan, die Prinzessin mit einem deutschen Fürsten zu vermählen. Der Ruhm des Königs und des Hauses habe das erfordert. Am Londoner Hof um eine Hochzeit zu betteln, empfand der Kronprinz als unwürdig. Hätte Berlin das getan, hätte dies der Dynastie Schande gemacht — und von solcher wäre auch der Thronfolger nicht unbefleckt geblieben. Daher das Einverständnis des Kronprinzen mit der Anordnung des Königs; vielleicht tat ihm leid, daß Wilhelmine nicht hochrangig heiratete, doch der Dynastie Ansehen — und sein eigenes — ging ihm näher als der Schwester Glück oder Unglück.
Der Kronprinz blieb während der Monate seiner Haft in Küstrin also der Überzeugung treu, zu Besonderem berufen zu sein, und seine Vorstellung von gloire wurde wohl konkreter: kein Schatten dürfe auf einen Ruhmreichen fallen. Weil aber sicheres Zeugnis fehlt, läßt sich darüber nicht mehr sagen. Erst für die Jahre danach, die der Freiheit, sprudeln die Quellen reichlicher.
Gut faßbar wird das Trachten des Kronprinzen in der Ruppiner und Rheinsberger Zeit, als Friedrich fernab von Vater und Hof seine Ambitionen freier verfolgen konnte. In dieser Zeit wird sein Begriff von Ruhm, daß er ihn erstrebt, was er ihm ist und wie man ihn erwirbt, stofflich. Ganz deutlich formuliert er seine Idee 1734 in einer Ode Sur la Gloire, selbstverständlich auf französisch. Ludwig Fulda hat sie 1914 verdeutscht. Die Zeilen entstanden unter den Eindrücken, die der junge Kronprinz als Volontär — als freiwillig Dienender, ohne Kommandogewalt – im Feldlager des Prinzen Eugen an Rhein und Neckar empfing.
Der Odem eines Gottes entfachte Die Seele mir zu hehrem Glühn: O Ruhm, im tiefsten Herzensschachte Fühl’ ich dein himmlisch Feuer sprühn. Berauscht von deinem starken Zwange, Will ich mit holdem Leierklange Besingen deine Segenskraft: Du reichst dem wahren Wert die Krone; Dein Lorbeer wird dem Erdensohne Zum Sporn für alles, was er schafft. 30
Schon bei den Thermopylen schaue Die Kämpfer ich, die kühn ihr Blut Hinopfern, um die Heimatgaue Zu schützen vor der Sieger Wut; Ist deren Macht auch ohnegleichen, Ihr Mut will vor der Zahl nicht weichen, Steht unerschütterlich im Streit; Derweil sie sterbend niedersinken, Sehn sie, vom Ruhm getröstet, winken Als stolzen Preis Unsterblichkeit.
Ihr denen Kunst und Dichtung eigen, Minervas und Apollos Brut, Wer flößt, auf den Parnaß zu steigen, Euch ein die Sehnsucht und die Glut? Homer, Vergil, ja laßt euch fragen, Horaz, Voltaire, ihr sollt mir sagen: Welch einem Gott singt ihr zu Dank? Ihr alle seid dem Ruhm ergeben; Um für die Nachwelt fortzuleben, Feilt Ehrgeiz euch die Verse blank.
O Ruhm, dem ich zum Opfer bringe All meine Kurzweil und Begier; O Ruhm, du meines Glaubens Schwinge, Gönn’ meinen Taten deine Zier! Du kannst, wenn ich ins Grab gesunken, Bewahren einen schwachen Funken Vom Geiste, der in mir geloht: Die Schranken tu mir auf zum Siege, Damit ich deine Bahn durchfliege, Dir treu im Leben und im Tod.
Man hat solcher Dichtung Friedrichs nur wenig Aussagekraft über seine Persönlichkeit beimessen wollen. Hille hatte ja schon seine »allzu starke Lust zum Reimeschmieden«31 bemängelt und empfohlen, »sie etwas lächerlich zu machen«; er hatte Friedrichs Verse als Ausdruck von dessen Innerem nicht ernst nehmen mögen. Im 19. Jahrhundert stellte man den Musiker Friedrich dann weit über den Dichter, denn letzterer beherrsche seine Form nicht. »Er ist der Schüler eines fremden Geistes«32 — derjenige Voltaires war gemeint — »und ihm tributpflichtig, wogegen der Musiker den unmittelbaren Ausdruck der Stimmung findet«, resümierte der französische Historiker Ernest Lavisse. »Seine außerpolitische Literatur, zumal seine metrische, fängt weniger als seine Briefe seine jeweiligen Lebensstimmungen ein, sondern verformelt mehr seine aufklärerischen oder stoischen Gemeinplätze, bestenfalls seine Dauerlehren«33, hat in unserer Zeit der Literaturhistoriker Friedrich Gundolf geurteilt; vor ihm haben aber auch andere Autoren schon so gedacht und geschrieben — und nach ihm wieder. So als bedeutendster Eduard Spranger, der in Der Philosoph von Sanssouci die Frage stellte: »Darf man sie«34 — die dichterischen Zeugnisse — »als einen getreuen Abdruck von Friedrichs Seele betrachten?« Und selbst gleich die Antwort gab: »Niemand wird geneigt sein, mit Ja zu antworten. Dieser ganze geregelte rhetorische Dichtungsstil mit seinem Apparat von mythischen Gestalten und historischen Vergleichsfällen … ist überhaupt nicht geeignet, Persönliches zum Ausdruck zu bringen.« Solcher Auffassung sollte man nicht beipflichten, denn Friedrich hat zeitlebens gern gereimt:»Ich liebe die Verse leidenschaftlich, und obgleich ich selbst schlechte mache, kann ich doch nicht darauf verzichten. «35 Das galt gerade und immer dann, wenn er in einer besonderen Stimmung war.
Die Ode an den Ruhm war jedenfalls nicht einfach dahingedichtet. Dies kann man schon daran erkennen, daß Friedrich sie, korrigiert und überarbeitet, Jahre später, 1750, in die Œuvres du philosophe de Sans-souci aufnahm, in jene drei Bände, die ihn über die Vertrauten, unter denen er sie verteilte, in der europäischen Öffentlichkeit endgültig zum Poeten machen sollten. Aber was sagt sie aus über Friedrich? Etwa dies im allgemeinen: Daß die Begierde nach Ruhm dem jungen Mann um 1734 innere Antriebskraft wurde, zwanghaft geradezu, eben »Sporn für alles, was er schafft«.
Für das, was er noch schaffen wollte, muß man sagen, denn zum Zeitpunkt der Dichtung umfaßten seine »Taten« ja lediglich eine einzige Handlung, nämlich den mißglückten Versuch, vor dem Vater zu fliehen – der ihn allerdings bekannt gemacht hatte.
Gönn’ meinen Taten deine Zier! Du kannst, wenn ich ins Grab gesunken, Bewahren einen schwachen Funken Vom Geiste, der in mir geloht.
Die Ode deutet also Zukünftiges an, Gewünschtes, Erhofftes. Man kann ihr den Grund seiner Ruhmsucht entnehmen, ersehen, daß Friedrich sich einen Namen machen und diesen der Nachwelt überliefert wissen wollte.
Wege zum Ruhm
Die Dichtung offenbart, warum Friedrich nach Ruhm strebte, und offenbart auch, auf welche Weise der Kronprinz glaubte, zu Ruhm gelangen zu können. Zwei Wege, die zum Ziel führen, hat er ausgemacht, und nicht nur einen, wie viele denken. Es ist nicht allein jener, der »mit dem Streben nach militärischer Kompetenz verknüpft war«36., wie man verklausuliert und vorsichtig formuliert hat; der mit dem Sieg auf dem Schlachtfeld verbundene, und sei er noch so teuer erkauft, wie man billigerweise sagen sollte. Diesen auch, natürlich! Es war der erste Weg und der sicherste zugleich. Ihn waren die Helden der Antike gegangen: Alexander, Scipio, Cäsar. Das wußte Friedrich längst. Ihn hatten auch die Großen der Gegenwart eingeschlagen, so der französische Marschall Villars und der Prinz Eugen, in dessen Heerlager Friedrich sich aufhielt. In der Nähe des berühmtesten Feldherrn der Zeit konnte er die Wirkmächtigkeit kriegerischer gloire gleich am eigenen Leib erspüren. Auf die Frage des Savoyers, was ihm denn Freude mache, antwortete Friedrich, nach den Aufzeichnungen in seinem Tagebuch aus dem Feldzug von 1734, 30. Juli: »Was früher Euch, Euer Hoheit, Vergnügen machte: Liebe und Ruhm.«37 Was auch weitere Verse seiner Ode bezeugen:
Wer ist der Held in jedem Kriege Triumphgekrönt? Es ist Eugen; Die Ehren seiner stolzen Siege, Der Ruhm läßt nimmer sie vergehen.
Entnehmen kann man diesen die Überzeugung des Volontärs und Dichters, daß im Feld errungener Ruhm nie verblaßt, daß er ewig währt. Sie spiegeln sein Erleben wider. Der junge Mann hatte genau gesehen, wie wenig des Kaisers berühmter Feldherr noch handeln konnte, wie furchtsam und zaghaft er es tat, wenn er es konnte. Er hatte auch gesehen, wie sehr der Prinz dafür kritisiert wurde. »Prinz Eugen beginnt völlig, den Kopf zu verlieren«38, informierte Friedrich seine Schwester in Bayreuth, »und der Rest der kaiserlichen Generale, Prinz Friedrich von Württemberg ausgenommen, hegt keine großen Erwartungen von ihm.« An seinen väterlichen Vertrauten Paul Heinrich von Camas schrieb er resümierend: Der Feldzug »verlief unrühmlich genug, und Männer, die zeitlebens gewohnt waren, Lorbeer zu pflücken, und zwar in siebzehn großen Schlachten, haben diesmal keinen gefunden«39. Aber dem großen Ruf des Prinzen hatte die vorsichtige Feldzugführung nichts anhaben können. Der blieb ihm erhalten, ungeachtet der Verunglimpfungen einzelner. Man hoffe trotz allem auf ihn, schrieb Wilhelmine, man sehne sich im ganzen Reich nach der Vereinigung aller Truppen unter dem Prinzen: »Dann ist man fest überzeugt, daß nichts mehr zu fürchten sei.«40 Die ruhmreiche Vergangenheit überdeckte die weit weniger rühmliche Gegenwart Eugens.
Friedrich bemerkte das und kam wohl damals schon zu der Erkenntnis, daß man den Ruhm, wenn man ihn einmal erworben hat, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfe; daß man sich dann besser zurückhalten und nicht mehr exponieren sollte. Zwei Jahre später jedenfalls, 1736, schrieb er an Fürst Liechtenstein: »Die großen Menschen haben ihre Zeiten wie das übrige Geschehen. Sie wachsen, sie halten sich eine Zeitlang im Glanze ihres Ruhmes und sie vergehen schließlich, wie sie herangewachsen sind. Welche Erniedrigung für den menschlichen Stolz, denselben Mann, der durch den Siegeslauf seines Glückes unsterblichen Ruhm erworben hatte, scheitern zu sehen.«41 Ruhm zu erringen war das eine – und schon schwer genug; ihn zu bewahren das andere — und offenbar weitaus schwierigere. Dies galt es zu bedenken und dann beizeiten Vorsorge zu treffen.
Vielleicht weist die Ode auch deshalb jenen zweiten Weg zur Unsterblichkeit. Es ist die Spur der Dichter und der Dichtung, die Friedrich verfolgt. Homer, Vergil und Horaz sind ihm die klassischen Zeugen dafür, daß auch dieser Weg zum ersehnten Ziel führt. In der Gegenwart liefert ihm Voltaire das Beispiel. Es ist aber wohl der Weg des Schriftstellers überhaupt, an den Friedrich vielleicht dachte. Doch das ist offen; die Ode selbst gibt noch keinen Hinweis darauf. Sicher ist nur, daß der Kronprinz sich fortan, bis an das Ende seines Lebens, der Verskunst widmete und sich dem Vorbild der Diener Kalliopes verschrieb; an der Decke seines Rheinsberger Arbeitskabinetts kann man dies ablesen, dort sind Voltaires Name und der von Horaz in ein Buch eingetragen, welches Minerva-Athene, Göttin der Weisheit, aufgeschlagen in Händen hält.
Daß er die Kunstfertigkeit dieser Klassiker nicht erreichen würde, war ihm, dies darf man annehmen, wohl bewußt. Warum er dennoch diese Spur verfolgte? Seine Überlegung dürfte diese gewesen sein: Einen Kronprinzen und König als Poet im Reigen der großen Dichter, als Gleicher in ihrer Mitte, hatte die Welt noch nicht gesehen; niemand dachte auch nur entfernt daran, daß er diesen Weg einschlagen könnte, es geschah unvermittelt und ganz unerwartet – und war aus solchen Gründen auffällig. Das Auffallen aber war und ist die erste Sprosse auf der Leiter zum Ruhm. Das Verseschmieden bot ihm also eine schöne und sichere Möglichkeit, sich einen Namen zu machen – sofern solche Reime nur ein wenig Niveau hatten. Daran konnte man arbeiten, und Friedrich tat es.
Ernsthaft begonnen hat er damit, wie wir wissen, wohl mit sechzehn Jahren. »Ich habe der Poesie und dem Studium der Beredsamkeit vielleicht zu viel Zeit gewidmet, aber es entspannt mich, und wenn ich damit beschäftigt bin, langweile ich mich nie und habe an mir selbst genug«42, so seine Stilisierung gegenüber de Catt, später, 1758, während des Siebenjährigen Krieges. Daß es ihm von Anfang an darum ging, sich einen Platz in der literarischen Welt zu erobern, zeigt ein Brief an Voltaire von 1766: »Ich liebe die Poesie immer noch. Mein Talent ist gering; da ich aber zu meinem eigenen Vergnügen Papier bekritzele, so kann dem Publikum ebenso gleichgültig sein, ob ich Whist spiele oder mit den Schwierigkeiten der Metrik kämpfe.«43 Friedrich reimte also keineswegs nur zu seinem »eigenen Vergnügen«, wie er vorgab, sondern dachte durchaus an den Geschmack des »Publikums«.
Es war »ein unbekümmertes, frisch-fröhliches Schaffen«44, in dem er sich gefiel, meinte Gustav Berthold Volz, der Herausgeber von Friedrichs Werken. War es das wirklich? Vielleicht, hin und wieder. Zuallererst aber steckte hinter dieser Darstellung Kalkül: So sollte man ihn wahrnehmen, und so wurde er – zu seiner Freude – auch wahrgenommen, gerade von der Nachwelt, im 19. und 20. Jahrhundert, weniger im 18. Jahrhundert und gar nicht von Voltaire; der wußte um des Königs Anstrengung. »Er wäre ein großer Poet geworden, er könne in zwei Stunden hundert Verse machen«45, hat Friedrich in frühen Jahren Friedrich Heinrich von Seckendorff, dem österreichischen Gesandten, erklärt. Das war jugendlich unbedarft und überschwenglich dahergesagt. Geglaubt hat er es wohl selber nicht. Denn aus den erhaltenen eigenhändigen Notizen und Briefentwürfen des Kronprinzen wie des Königs geht hervor, daß die in seine Briefe eingestreuten Verse »nicht von ihm hingeworfen sind, wie die Laune und der Augenblick sie ihm eingaben, sondern daß sie vielmehr das Produkt angestrengter künstlerischer Arbeit«46 waren. Er hatte sich eigens ein Reimlexikon zugelegt. Friedrich strich, erweiterte, stellte um und feilte am Ausdruck – bis er nach einem 47»mühsamen Läuterungsprozeß«48 Inhalt und Form der Verse gefunden hatte. Das belegen die Blätter eindeutig.
Helfen und raten ließ er sich zunächst von Charles Etienne Jordan, seinem Vertrauten und Sprachlehrer, danach von Voltaire. Dessen erhebliche Kritik »erstreckte sich auf alles, auf die elementaren Regeln der Formlehre, auf unfranzösische Vokabeln wie auf metrische Gesetze, auf Silbenzählung, Reime, Versbildung, auf dichterische Sprache«49. Friedrich nahm das bemerkenswert gelassen hin, selbst später noch, nachdem sie sich zerstritten hatten. 1750 berichtete Voltaire dem Grafen d’Argental aus Berlin: »Ich benutze das Vertrauen, das er zu mir hat, um ihm die Wahrheit zu sagen, kühner, als ich sie Marmontel oder d’Arnaud«50 – zwei Dichter und Dramatiker, die er förderte — »oder meiner Nichte sagen würde. Er schickt mich nicht in die Steinbrüche für meine Kritik seiner Verse; er dankt mir, er korrigiert sie.« Solches offenbart, welch großen Ehrgeiz Friedrich entwickelte. Deshalb seine Geduld: Ein wohlwollendes Urteil Voltaires adelte ja den Poeten. Friedrichs Langmut erweist darüber hinaus, daß die poetische Arbeit ihm bei aller Anstrengung Vergnügen bereitete, daß er sie wollte und brauchte.
Ein begnadeter Dichter wurde dennoch nicht aus ihm. Er selbst bezeichnete sich als »Dilettanten«51, hoffte und wünschte aber dennoch, als Poet geehrt zu werden. Deshalb die Veröffentlichung der Œuvres du philosophe de Sans-souci 1750; drei Bände, von denen zwei Friedrichs Verskunst enthalten. Er schenkte sie stolz den Vertrauten, wohl wissend, daß dadurch die Texte verbreitet würden. Wilhelmine, Bayreuth, 14. November 1755: »Ich verbrachte zwei Tage sehr angenehm in der Unterhaltung mit meinem lieben Philosophen. Ich hatte einen kleinen Kreis um mich; wir lasen seine Werke.«52 Und vierzehn Tage später: »Wir lasen Deine Dichtungen in Gesellschaft von zwei Franzosen, deren einer selbst Dichter ist; sie waren begeistert.« Der König selbst war es auch. »Ein jeder Dichter ist«53, so Friedrich an seinen Sekretär Darget, der mit der Edition betraut war, »wenn er nur glaubt, daß es kein andrer merke, ja selbst, wenn er’s versteckt mit aller List, doch ganz vernarrt in seine eignen Werke.«
Letztlich ist nur eine kleine Auswahl seiner Verse offiziell veröffentlicht worden. In den von Johann David Erdmann Preuß zwischen 1846 und 1857 herausgegebenen Œuvres, der umfänglichsten Edition von Friedrichs Werken, füllen des Königs Poesien fünf der dreißig Bände. Damit sind sie keineswegs vollständig verzeichnet. Die meisten seiner Dichtungen hat er selbst, indem er sie Briefen beigab, quasi ungedruckt publiziert. Diese königlichen Reime wurden natürlich ebenfalls vor Publikum verlesen, auch deklamiert. Sie belegen nicht nur Friedrichs geschickte Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache, sondern auch seine nie nachlassende Beschäftigung mit der Dichtkunst und ihren politisch-publizistischen Möglichkeiten.
Es blieb ihm zu dieser Zeit auch gar nichts übrig, als zu dichten, denn Ruhm auf dem Schlachtfeld zu erwerben, hatte er so bald keine Gelegenheit. »Dieser Feldzug ist die friedlichste Sache von der Welt. Man hört keinen Schuß fallen. Die Franzosen hüten sich wohl, uns anzugreifen, und die Unseren haben ebensowenig Angriffslust. Man führt hier Krieg wie auf der Berliner Generalrevue«54, schrieb er an Wilhelmine am 12. Juli 1734. Und am 10. August: »Die Franzosen haben zehntausend Mann nach Italien geschickt, ein sicheres Zeichen, daß sie in diesem Feldzuge nichts mehr unternehmen … Wir bleiben mindestens noch drei bis vier Wochen im Lager.«55 Nur einmal erhielt er Gelegenheit, seinen Willen, für sich Ruhm zu erlangen, vorzuführen: »Als er mit einem ziemlich starken Gefolge die Philippsburger Linien erkundete und bei seiner Rückkehr durch ein sehr lichtes Gehölz ritt, begleitete das Geschützfeuer der Linien ihn immerfort und zerschoß Bäume dicht neben ihm, ohne daß er sein Pferd antraben ließ und ohne daß die Zügelfaust die geringste ungewöhnliche Bewegung machte, obwohl man scharf darauf aufpaßte. Vielmehr sprach er ununterbrochen sehr ruhig mit ein paar Generalen, die ihn begleiteten; sie bewunderten seine Haltung in einer Gefahr, an die er doch noch nicht gewöhnt sein konnte.«56 So Ulrich Friedrich von Suhm, der sächsische Gesandte in St. Petersburg, in seiner Charakterisierung des Kronprinzen von 1740. Es war ein kleines Ausrufezeichen, das Friedrich hier setzte. Vom Rhein mußte Friedrich dann Anfang Oktober zurückreisen — ohne eine echte Chance zur Bewährung erhalten zu haben.
Friedrich blieb daher nur die Hoffnung auf die Kampagne des nächsten Jahres. Doch der Vater verbot ihm, auch 1735 ins Feld zu ziehen. »Ich habe ihn viermal darum gebeten und ihn an das mir gegebene Versprechen erinnert«57, klagte Friedrich der Schwester am 8. September 1735, »aber keine Sinnesänderung; er sagte mir, er habe sehr tiefe Gründe, die ihn daran hinderten … Um mich zu trösten, will er mich auf eine Reise nach Preußen schicken; das ist ein wenig ehrenvoller als eine Reise nach Sibirien, aber nicht viel.« Ehre und Ruhm im Feld würden ihm, das erkannte Friedrich, versagt bleiben, solange sein Vater lebte. An Wilhelmine, die ein Hilfskorps der Russen für Prinz Eugen wenigstens in Augenschein nehmen konnte, schrieb er resigniert: »Die Frauen werden zu Amazonen und die Männer bleiben daheim. Der König betrügt mich.«58
So nutzte Friedrich die Zeit, so gut er konnte — nutzte sie »friedlich«, wie er sagte. »Ich lese und schreibe wie ein Besessener, und ich mache Musik für vier … Ich betätige mich auch in der Gärtnerei und beginne mir einen Garten anzulegen. Das Gartenhaus ist ein Tempel aus acht dorischen Säulen, die eine Kuppel tragen. Auf ihr steht die Statue Apollos«, meldete er Wilhelmine. Amalthea taufte er diesen Garten nach der Amme des Zeus-Herkules, die eine Ziege gewesen war. Ein Hinweis vielleicht, daß der Ort ihm Kraft geben sollte,
Erste Auflage
Copyright © 2011 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg Lektorat und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin Register: Nadja Geißler, Strausberg
eISBN 9783641061296
www.siedler-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe