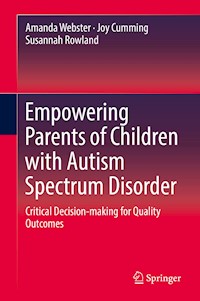7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Amanda Webster begreift, dass ihr elfjähriger Sohn Riche unter Magersucht leidet, ist es fast zu spät. Doch wie konnte es nur dazu kommen, dass sich ihr glücklicher Sohn in diesen zurückgezogenen und beängstigend dürren Jungen verwandelt hat? Und das, obwohl diese Krankheit angeblich nur Mädchen und Frauen trifft? Amanda macht sich große Vorwürfe, doch es bleibt ihr kaum Zeit zum Grübeln, denn ihr Kind schwebt in Lebensgefahr. Einfühlsam erzählt Amanda Webster von dem schweren Weg aus der Anorexie und räumt dabei mit vielen Vorurteilen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Amanda Webster
DER JUNGE, DERÄPFEL LIEBTE
Wie mein Sohn seineMagersucht besiegte
Aus dem australischen Englisch vonAxel Plantiko
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Anmerkung der Autorin:Zum Schutze der Persönlichkeitsrechtewurden bestimmte Details verändert.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Amanda Webster
Titel der Originalausgabe: »The Boy Who Loved Apples«
Originalverlag: The Text Publishing Company
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Lisa Bitzer, Landau
Umschlagmotiv: © Thinkstock/Sergey Matveev
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-5354-6
Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Kevin, Riche, Andy und Louise.Und zum Andenken an Ava Margaret Webster.
1
Riche blickte auf den hohen Reisigzaun, als läge dahinter ein Gulag.
»Da gehe ich nicht rein«, sagte er, und in seinen Gesichtszügen spiegelte sich Angst wider. »Dazu kannst du mich nicht zwingen.«
Ich zögerte. Mir war, als durchlebte ich einen dieser unwirklichen Träume, in denen man sich plötzlich splitternackt auf offener Straße befindet oder in der Öffentlichkeit pinkelt. Tatsächlich stand ich mit meinem elfjährigen Sohn in Brisbane vor einer Klinik für Essstörungen, die sich »Footprints of Angels« nannte. Es war Januar 2003, und meine anderen Kinder, der neunjährige Andy und die sechsjährige Louise, befanden sich zu Hause in Mullumbimby, hundertfünfzig Kilometer weiter südlich. Ich hatte sie bei ihrem Vater, meinem Ehemann, gelassen, mit dem ich damals erhebliche Probleme hatte.
Das Anwesen wirkte nicht wie eine Klinik. Der Zaun, ein unbeschrifteter Briefkasten und der diskrete Seiteneingang erweckten eher den Eindruck eines Vorort-Bordells oder einer anderen Örtlichkeit, der irgendwie ein Stigma anhaftete. Doch jetzt war nicht der Zeitpunkt für zimperliches Zaudern. Seit drei Monaten war Riche gefährlich dünn und zeigte erste Anzeichen von Herzrhythmusstörungen. Seine Pulsfrequenz war zurückgegangen; im Stehen wurde ihm häufig schwindlig. Dank meiner Ausbildung als Medizinerin wusste ich, dass er Gefahr lief, urplötzlich an Herzstillstand zu sterben.
Ich öffnete das Tor. »Also los!« Ich versuchte, entschlossen zu klingen, und bemühte mich, so zu handeln, als fühlte sich meine Haut, dünn und straff um meinen Körper gespannt, nicht wie das Einzige an, was mich noch aufrecht hielt.
Mein Sohn schob sich eine Strähne seines aschblonden Haars aus dem leichenblassen Gesicht und schüttelte den Kopf, der Gesichtsausdruck leer, unerreichbar: ein gespenstisches Irrlicht. Sein T-Shirt schlotterte um die Kleiderbügelschultern, und die kurze hellgraue Hose, auf die er seit seinem achten Lebensjahr schwor, betonte die hervorstehenden Knochen seiner Hüften und herausragenden Höcker der Fußgelenke. Es war vertraute Kleidung, eine seiner Magersuchtuniformen, steril und kalorienfrei. An den Füßen trug er braune Ledersandalen, bequem an- und auszuziehen, ohne eine Schnalle zu berühren.
»Entweder dies oder das Krankenhaus.« Ich versuchte, es nur mahnend klingen zu lassen, doch selbst mir entging der drohende Unterton in meiner Stimme nicht.
Riche ließ sein Haar wieder nach vorn fallen, um sein Gesicht zu bedecken, und schlurfte durch das Tor. Ich folgte ihm in einen gepflegten Garten. Schwerer Duft von Jasmin und Gardenien hing über dem sorgfältig gemähten Rasen. Auf der anderen Seite spendete ein alter Jacarandabaum einem Picknicktisch Schatten. Rechts von uns stand das Haus in klassischer Queensland-Architektur, auf hohen Pfählen über dem Grund ruhend. Der freie Raum darunter war zu einem zusätzlichen Zimmer verwandelt worden. Hinter der Fensterscheibe sah ich einige bequem wirkende Sessel und einen großen Arbeitstisch.
Über einen Weg aus roten Pflastersteinen kamen wir zu einer Treppe, die entlang der Vorderseite des Hauses angebracht war. Das Ächzen des Holzes unter meinen Füßen, als wir zum Empfang gingen, hätte Ausdruck meiner Angst sein können.
Auch wenn das Gebäude von außen wie ein Bordell wirkte, die Inneneinrichtung entsprach eher der eines spießigen Vorort-Schönheitssalons. Beruhigende Pastelltöne wie Rosa, Taubenblau und blasses Zitronengelb zierten die Wände. Engelfiguren tummelten sich auf dem Schreibtisch, saßen im Bücherregal, baumelten an den Türklinken und beäugten mich unbekümmert von einem Tisch aus. Eine himmlische Heerschar, alle weiblich. Weit und breit war kein einziger Erzengel zu sehen.
Riche blickte finster drein, als er die mädchenhafte Ausstattung bemerkte. Eine Empfangsdame bestätigte unsere Anmeldung und bat uns zu warten. Ich setzte mich auf eine Sofaecke unter dem ruhig-heiteren Blick eines Engels. Riche blieb zitternd stehen. Mir war sofort klar, dass ich durch nichts seinen unerschütterlichen Glauben ins Wanken bringen konnte, frühere Besucher – vermutlich Fleischesser – hätten das Sofa leichtfertig mit heimlichen Kalorien übersät. Riche war überzeugt, diese mikroskopisch kleinen Energie-Streubomben würden seine Haut durchdringen und sich in den Zellen einnisten, sobald er sich setzte, und dann würde er wie ein von Fliegenlarven befallener Kadaver aufquellen. Um das nicht zu riskieren, tigerte er im Raum auf und ab und verbrannte Kalorien. Der Triumphmarsch seiner Krankheit, die das Leben aus ihm sog.
Geisterhaft anmutende Mädchen mit beängstigend hervorstehenden Schlüsselbeinen huschten durch den Raum, ihre Schritte verursachten lediglich ein Wispern auf den dunklen Holzdielen. Es waren allesamt Teenager, älter als Riche; Jungs waren nicht darunter. Voller Entsetzen starrte ich auf ihre spindeldürren Körper, ihren angespannten, verkniffenen Gesichtsausdruck. Kontrolliert, aufgesetzt, unecht. Die meisten schulmedizinischen Stereotype, die ich während meiner Ausbildung in den Achtzigerjahren gelernt hatte, hatte ich über Bord geworfen, nachdem ich den Verfall meines eigenen Sohnes verfolgt hatte; jetzt erhoben sie wieder ihre hässlichen und irreführenden Köpfe. Ich wäre fast an die Decke gegangen. In diese Schublade passte Riche nicht.
Doch so, wie er im Raum herumwanderte und nur einmal innehielt, um ein Mädchen vorbeizulassen, sprach sein Körper eine andere Sprache. Er wirkte genauso gebrechlich wie all die anderen, als könnte ihn die leiseste Berührung hinstrecken. Er war einer von ihnen. Er entsprach nicht den Stereotypen, da die Stereotype falsch waren. Ich ließ mich in die Kissen zurückfallen und konzentrierte mich auf meine regelmäßige Atmung.
Das Klackern von Absätzen erklang im Flur, und eine Frau tauchte auf. Sie schien Mitte oder Ende vierzig zu sein, ungefähr mein Alter, gehörte aber zu einer reizvolleren Art Frauen. Sie besaß jenes selbstsichere Auftreten, das ich mit Frauen assoziiere, deren körperliche Attribute – blondes Haar, üppiger Busen – Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ebenfalls eine Mutter, dachte ich zunächst, doch ihr helles buntes Baumwollkleid und das seidige Haar ließen keinen Zweifel, dass ihre Tochter nicht so krank war wie Riche. Betreuung und Sorge um ihn ließen mir weder Zeit noch Kraft für Wimperntusche und Nagellack. Mein zerknautschtes Hemd, die zerschlissenen Jeans und dunklen Haaransätze zeugten von meiner Vernachlässigung mir selbst gegenüber. Die Frau betrachtete mich und warf mir ein Lippenstift-Lächeln zu. »Ich bin Jan«, sagte sie und reichte mir die Hand, »die Direktorin.«
Ich spürte ein inneres Beben, als das fragile Gerüst von Hoffnung in mir zusammenbrach. Jan war nicht die Anzug tragende Fachfrau, mit der ich gerechnet hatte. Sie wirkte eher wie jemand, mit dem ich zum Essen gehen würde. Wie sollte ausgerechnet sie meinem Sohn helfen können? Irgendjemand musste es aber. Ich rappelte mich hoch und erwiderte die Begrüßung.
Jan führte uns in ein grünes Zimmer, wo ein grüner Stoffengel an der grünen Tür hing, zu mickrig, als dass er ein Wunder welcher Art auch immer hätte vollbringen können. Die Farbabstimmung in diesem Gebäude war überwältigend. Das gedämpfte Licht und die ungezügelte Blumenpracht der grünen Polstermöbel-Bezüge verliehen dem Raum eine Atmosphäre unbestimmter Bedrohung. Riche lungerte in der Nähe der Tür herum. Seine übergroßen stumpfen Augen erfassten das Zimmer.
»Keine Angst, du kannst dich setzen, Riche«, sagte Jan. »Die Couch tut dir nichts.«
Jans Verständnis für Riches unausgesprochene Angst flößte mir ein wenig Vertrauen ein. Riche starrte sie unwillig an, bequemte sich aber schließlich, neben mir auf dem Sofa Platz zu nehmen, mit genügend Abstand zu der Rückenlehne. Wer wusste schließlich, wie viele Kalorien in all diesen Rüschen lauerten? Mit einem Magersüchtigen zusammenzuleben, so hatte ich gelernt, war vergleichbar mit einem Aufenthalt in Frankreich: ein paar Monate des Eintauchens in die fremde Kultur, und schon beherrschte man die Sprache fließend.
In einer Ecke des Zimmers saß eine junge Frau in einem Sessel. Ihr Gesicht wirkte frisch und glatt, die beinahe ebenso blonden Haare wie die von Jan waren zu einem Pferdeschwanz hochgebunden.
»Sonia«, stellte sie Jan vor, »eine unserer Therapeutinnen.«
Dann wandte sich Jan an Riche: »Also, weshalb hat dich deine Mutter zu mir gebracht?«
Riche zuckte mit der Schulter und starrte auf seine Füße. Ich setzte mich aufrechter hin, um es nicht so aussehen zu lassen, als sei Riches Schweigen als Verweigerung zu deuten. Als ich vor ein paar Tagen angerufen hatte, hatte mir die Empfangsdame gesagt, die Klinik nehme nur Patienten auf, die sich eingestanden, dass sie krank waren. Das leuchtete mir überhaupt nicht ein – war Ablehnung nicht gerade ein charakteristisches Merkmal dieser Krankheit? Ich unterdrückte den Gedanken, ähnlich einem Kind, das den Springteufel in seinen Kasten presst und die kinetische Energie dadurch erhöht, nur damit dieser dann später herausschnellen kann. Mir stand es nicht zu, die Regeln der Klinik zu bestimmen. Und in diesem Moment sah es ganz danach aus, als sei das Spiel verloren.
Riche schwieg beharrlich. Ich blieb still, da ich nicht eines dieser Elternteile sein wollte, die für ihre Kinder reden. Mindestens drei Sekunden.
Dann blubberte es aus mir heraus. »Er ist abgemagert. Er isst nicht.«
Jan nickte und beugte sich nach vorn. »Du bist ausgezehrt, Riche.« Sie sprach mit normaler, nahezu heiterer Stimme. Warum die Fakten nicht gleich auf den grünen (ja!) Tisch legen? »Vielleicht erzählt mir deine Mutter besser, was passiert ist.«
Ich holte tief Luft und räusperte mich. »Es ist etwas kompliziert«, sagte ich. »Wir haben sehr viele Fehler gemacht.«
Ich hatte mich schnell von der Vorstellung gelöst, Riches Krankheit sei durch ein kontrollierendes, manipulatives Temperament ausgelöst worden, denn er war nie diese Art Kind gewesen – eher das Gegenteil. Doch ein anderer Denkansatz der Schulmedizin, dass gestörte Eltern Magersucht verursachen können, war weniger leicht von der Hand zu weisen. Es ist ein verbreiteter Glaube, das Verhalten eines Kindes spiegele die Erziehungskompetenz wider – jede Mutter mit einem Zweijährigen im Supermarkt kann ein Lied davon singen. Und wie jede Mutter kam ich natürlich zu dem Schluss, mein Mann und ich hätten es vermasselt. Ich gestand es Jan. Jeder Streit, jeder Todesfall, jede Ernährungsmarotte und jeder Wohnungswechsel, an die ich mich erinnern konnte, kam zur Sprache.
Ein Medizinprofessor sagte uns mal, Stethoskop, Mikroskop, Laparoskop und Kolonoskop seien schön und gut als diagnostische Hilfsmittel, aber nichts im Vergleich zum Retrospektoskop: Hinterher ist man immer schlauer. Heute, in der Retrospektive, muten die Details meiner Geständnisse ziemlich banal und nebensächlich an. Sicher würden mir viele Eltern ohne krankes Kind beipflichten, dass es sich nur um kleine Schnitzer handelte, und die sind höchstens ein Teil der Geschichte. Doch damals betrachtete ich meine Schuld als offensichtlich und erdrückend.
Nachdem ich geendet hatte, fragte ich: »Leidet er wirklich an Magersucht?« Trotz des ausgemergelten Beweises, der neben mir saß, keimte noch immer ein unsicheres Gefühl der Hoffnung in mir.
»Ein klassischer Fall«, sagte Jan, ohne einen Moment zu zögern. »Aber Ihnen und Ihrem Mann Kevin ist kein Vorwurf zu machen. Dass Sie ein Kind mit Magersucht haben, macht Sie nicht zu schlechten Eltern.«
Nicht meine Schuld? Auch nicht Kevins? Ich hätte ihr gern geglaubt, aber Riche war schließlich nicht in einem Vakuum aufgewachsen. Bestimmt gab es da noch ein paar alte offene Rechnungen aus seiner Kindheit. Außerdem, wenn wir für Riches Magersucht nicht verantwortlich waren, wer oder was war es dann? Diese Frage würde mich ewig verfolgen. Das jahrelange Schuldgefühl – auf mich selbst und auf Kevin gerichtet – lastete tonnenschwer auf mir.
Vorerst sagte ich nichts.
Jan wandte sich an Riche: »Ich weiß, du hast eine Stimme im Kopf, die dir sagt, dass du dick oder fett bist, aber die lügt. Diese Stimme nennen wir ›negatives Denken‹. Kannst du sie hören?«
Riche schüttelte den Kopf, und ich bereitete mich innerlich auf Jans Ablehnung vor, die unweigerlich folgen würde.
Sie sagte: »Wir können Riche in unser Programm aufnehmen.«
»Aber Sie nehmen doch niemanden, der seine Krankheit verleugnet.«
»Gewöhnlich nicht, doch Riche steht kurz davor, sie zu akzeptieren, und ganz ehrlich, wir müssen schnell handeln. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.«
Völlig überrascht, aber erfüllt von tiefer Dankbarkeit, wurde mir klar, dass ich einen Ort gefunden hatte, an dem Riche behandelt werden konnte – und zwar mitfühlend behandelt –, ohne in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen zu werden. Aus Erfahrung wusste ich allerdings, wie verhängnisvoll es sein konnte, sich auf die Fachkompetenz einer fremden Person zu verlassen. In Bezug auf Magersucht gab es zu viele Unbekannte, zu wenig Fachleute und zu viele nicht validierte Theorien. Ich war nicht gewillt, die Verantwortung für mein Kind einfach abzugeben und zu hoffen, es werde sich schon alles zum Guten wenden.
Im Moment allerdings war Footprints meine beste Option. Und so begannen die Verhandlungen, während Riche schweigend neben mir saß.
Jan sagte mir, Riche benötige wöchentlich vier Therapiestunden mit Sonia und eine Sitzung mit dem Ernährungsberater. Ich schlug vor, mit zwei Therapiesitzungen zu beginnen und fragte, ob er den Ernährungsberater wirklich nötig habe.
Jan sagte: »Ja.«
Ich meinte, mir würde das bei einem elfjährigen Jungen nicht einleuchten, schließlich bereite er das Essen ja nicht selbst zu; das erledigte ich. Außerdem scheine mir Unkenntnis von Kalorien und Ernährung bei Riche wahrlich nicht das Problem zu sein. Ganz im Gegenteil – er studiere Nährwerttabellen und Lebensmittelkennzeichnungen wie ein Profi.
Jan erklärte, der Ernährungsberater sei in der Lage, Riches Einstellung zum Essen zu verbessern. Ich dachte: Quatsch! Doch ich sagte ja, was bereits andeutet, dass ich entweder die Grundprinzipien der Prämisse »Der Kunde ist König« nicht kapiert hatte oder total eingeschüchtert war.
Ohne staatliche Unterstützung hat individuelle Behandlung ihren Preis. Jede Sitzung kostete 100 Dollar. Das Tagesprogramm, an dem Riche derzeit wegen seiner Angst vor frei agierenden Kalorien nicht teilnehmen konnte, würde zusätzliche 50 Dollar pro Tag bedeuten. Proteinpulver für Getränke machten, falls erforderlich, weitere 40 Dollar pro Woche aus. Unsere private Krankenversicherung würde die Kosten für den Ernährungsberater übernehmen, nicht aber die Therapietermine mit Sonia.
Die Gesamtkosten beliefen sich also auf wöchentlich 750 Dollar, die privat zu finanzieren waren – und dies in einem Land mit einem kostenlosen staatlichen Gesundheitssystem, allerdings mit großen schwarzen Löchern in der Versorgung und mit nur einer Handvoll Ambulanz-Einrichtungen, in denen Magersucht-Patienten behandelt und deren Familien unterstützt werden konnten. Nicht gerade ein Pappenstiel, aber wir konnten das Geld aufbringen. Ich hätte sogar meine Seele verpfändet, um meinen Riche zurückzubekommen. Den glücklichen, gesunden Riche.
Jan fuhr fort, wir dürften an Riches Sitzungen nicht teilnehmen und bekämen auch keinerlei Feedback. Erneut gelang es mir nicht, ihre Logik zu begreifen. Wenn man mir nicht die Schuld gab, weshalb wurde ich dann ausgeschlossen? Vor allem, wenn Riche dreiundzwanzig Stunden am Tag von mir versorgt wurde. Ihn zu bitten, ein Käse- und Vegemite-Sandwich zu essen, hatte eine ähnlich hohe Aussicht auf Erfolg, wie meinen Mann dazu zu bringen, ein mit Zyanid gewürztes Steak zu sich zu nehmen. Inzwischen glaubte ich, selbst auch etwas Hilfe zu benötigen. Stattdessen erweckte das Vorgehen den Anschein, als wollte man mich völlig im Ungewissen lassen, ausgegrenzt und in die Rolle einer Köchin, Chauffeurin und Claqueurin gedrängt.
Aber das wird nicht passieren, versprach ich mir selbst. Nicht, solange ich noch irgendetwas anderes tun konnte. Zumindest konnte ich mich weiterbilden. Selbst wenn ich kurz davorstand, mich als absolute Randfigur zu betrachten.
Wir wechselten zu logistischen Fragen. Ob ich nach Brisbane umziehen würde? Nein, das würde ich nicht; ich hatte zwei weitere Kinder. Ob ich nicht der Meinung sei, dass die Fahrten für Riche zu ermüdend seien? Wie sollte er ohne die tägliche Therapie mit Sonia sein negatives Denken kontrollieren lernen? Ich wollte es darauf ankommen lassen.
Wenn eine etwas über Zwanzigjährige dies nach einem zwölfmonatigen Beratungskurs schafft, weshalb sollte ich, eine Ärztin mit sechsjähriger Ausbildung, es nicht auch können? So dachte ich. Und ich würde Riche schließlich auch an den Wochenenden helfen.
»Wie sieht es mit den Hausaufgaben für die Schule aus?«, fragte ich.
»Keine Schule.« Jan schüttelte den Kopf. »Riche braucht seine ganze Kraft, um die Krankheit zu bekämpfen.«
Der Ratschlag war richtig, doch der Grund war falsch, wie ich herausfinden sollte.
»Wie lange wird es dauern?«
»Es können fünf Jahre sein, vielleicht auch länger.«
Ich schloss die Augen und ließ mich in das Dunkel hinter meinen Augenlidern fallen. Mein Körper fühlte sich schwer und stumpf an. Fünf Jahre? Riches Krankheit würde ihn seiner Kindheit berauben. Er würde nie wieder mit ›glitzernden Augen die ganze Welt um sich herum bestaunen‹, wie es Roald Dahl in »Das Konrädchen bei den Klitzekleinen« beschreibt, einem Buch, das Riches Patentante ihm schon sehr früh schenkte. Wie sollte er die ›größten Geheimnisse‹ entdecken? Wie sollte er die Magie finden?
Ich schaute Jan an. »Magersucht verändert unser Leben, stimmt’s?«
»Für immer.« Jan erwiderte meinen Blick, ohne zu lächeln. »Diese Krankheit kann Ehen zerstören.«
2
Als sieben Monate zuvor die Haustür unseres Cottages in Mullumbimby aufgemacht wurde und wieder zuknallte, schloss sich unbeobachtet eine andere Tür – die Tür zu unserem alten Leben. Mir fielen nur der Geruch von brennendem Holz durch das Feuer auf dem Grundstück unseres Nachbarn und das unverkennbare Geräusch von Riches Rückkehr auf – zwei dumpfe Schläge, als seine achtlos weggeschleuderten Sandalen auf den Boden knallten. Er sauste, ein Gebilde aus schlaksigen Armen und Beinen, am Esstisch vorbei und tauchte neben mir am Herd auf.
»Ich bekomme die Pest!«, stammelte er wild dreinblickend und japsend. Er fuhr sich durch das dichte blonde Haar und hinterließ eine dunkelgraue Schmutzspur auf der Stirn. »Das Feuer des Nachbarn hat ein Rattennest zerstört, und Sally hat eine erwischt.«
»Ratten? Das erklärt das Bellen.« Ich drehte das Gas herunter, damit der Reis nicht überkochte.
»Du hast nicht verstanden, worum es geht – Sally hat mir die Ratte vor die Füße gelegt und mich dann geleckt!« Riche rückte dichter an mich heran. »Menschen sterben an der Pest, ist dir das klar?«
Seine Eindringlichkeit überraschte mich. Ich betrachtete ihn. Für einen Elfjährigen war er klein, hager und sehnig, und er machte einen rastlosen Eindruck, permanent in Bewegung, wie eine von einer steifen Brise angetriebene Windmühle. Der winterlichen Kälte zum Trotz trug er halblange Shorts, die seine knochigen Knie freiließen, und eines seiner kurzärmligen T-Shirts mit knallbuntem Aufdruck, die bald zu seiner Uniform werden sollten. Auf seinen Wangen leuchteten rote Flecken, und feuchte Haarsträhnen klebten auf seiner Stirn. Nach lediglich drei Monaten Leben auf dem Lande sah er aus, als habe er hier schon immer gelebt. Nichts hätte ihn von der Versuchung abhalten können, sich dem Feuer zu nähern, mit einem Stock darin herumzustochern und das Spektakel benzinbeflügelter Flammen zu genießen, die von der Koppel hoch in die sternenklare Nacht schossen.
»Dieser Hund ist eine Landplage für die Wildtiere«, sagte ich. »Und was hast du mit deinem Bruder und deiner Schwester gemacht?«
»Andy meinte, er würde Louise nach Hause bringen.« Riche schaute mich ernst an. »Sally kann nichts dafür, dass sie die Wallabys jagt, Mama. Es ist ihr Instinkt. Aber was, wenn ich die Pest bekommen habe?«
Typisch mein Sohn: immer bereit, ein Tier zu verteidigen, aber jederzeit in der Lage, seine jüngeren Geschwister im Stich zu lassen.
»Was für eine Pest? Du weichst mir aus.«
»Sie sah aus wie eine Wildratte. Rattus norvegicus. Die übertragen Bakterien, die die Pest verursachen!«
Der Reis war gar, und das Wasser musste abgegossen werden. Ich stellte das Gas ab und nahm den Kochtopf vom Herd.
»Du hörst mir nicht zu!«
»Entschuldige.« Ich schüttete den Reis in ein Sieb. »Ich kann dir einfach nicht folgen.«
»Sally hat an mir geleckt!« Riche sprach langsam und betonte jede Silbe. »Und sie hat diese Bakterien in ihrem Speichel, weil sie die Ratte im Maul hatte.«
Er steckte den rechten Zeigefinger in den Mund und zog ihn ploppend wieder zwischen den Lippen hervor. Er wiederholte es ein ums andere Mal. Das Ploppen war eine neue und nur geringfügig weniger lästige Angewohnheit als ihr Vorgänger, das Auftitschenlassen eines Tennisballs. Wochenlang hatte unser hundert Jahre altes Holz-Cottage bis zu einer Stunde lang bei jedem Aufprall gezittert, und das gleich mehrmals täglich.
»Dir passiert schon nichts«, sagte ich. »Aber ich kriege gleich einen Föhn, wenn du so weitermachst. Du machst mich ganz nervös!«
Riche begann rastlos auf und ab zu gehen und öffnete und ballte dabei unaufhörlich seine Fäuste. Ich stellte das Sieb mit dem Reis auf dem Kochtopfrand ab und schaute zu meinem Sohn hinüber. Er starrte mich an, ohne mit der Wimper zu zucken, und seine geweiteten Pupillen waren schwarze Seen blanker Angst.
»Riche, wir schreiben das Jahr 2002, nicht 1602. Und das passierte damals in Europa. In Australien ist noch keiner an der Pest gestorben.« Ich bemühte mich, möglichst viel Autorität in meine Worte zu legen; als Ärztin musste ich es schließlich wissen. Doch nach zwölf Jahren Muttersein im Hauptberuf waren meine Kenntnisse in Bezug auf medizinisches Datenmaterial wie Bevölkerungsstatistiken über die Pest natürlich eingerostet.
Riche hingegen schien Experte in Sachen Epidemien der Vergangenheit zu sein. »Das ist nicht wahr.« Er schlug einen sachlichen Ton an. »Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Australien mehrere Pest-Todesfälle gemeldet.«
Seine Sachkompetenz durfte mich kaum überraschen. Als er im Alter von fünf Jahren aufgefordert worden war, seine Lieblingstiere zu nennen, zählte er neben Dinosauriern und Haien einzellige Organismen auf.
Ein vertrautes Kratzen und Schlurfen war zu hören, als meine Mutter mit ihrem Gehgestell in der Küchentür erschien. Sie kam herein, hob die Gehhilfe an und steuerte auf den schweren Holzsessel zu, den wir allein wegen seiner Stabilität gewählt hatten. Sie torkelte die letzten ein oder zwei Schritte, griff nach den breiten flachen Armlehnen und ließ ihren widerspenstigen Körper in die Polster sinken. Ich nahm Teller aus dem Geschirrschrank und eine Handvoll Besteck aus der Schublade neben dem Spülbecken. Als ich zu Riche hinüberschaute, sah ich, dass er meine Mutter mit zusammengekniffenen Augen beobachtete. In seinem Gesichtsausdruck lag Furcht. Oder Abscheu – ich hätte es nicht genau sagen können.
»Mach dir keine Gedanken«, sagte ich. »Wir reden später darüber. Dein Vater kommt jeden Moment nach Hause.«
»Toll.« Ärgerlich zog er die Stirn kraus. »Wieder ein Wochenende mit Krach!« Er drehte sich um und verschwand im Badezimmer.
Toll, dachte auch ich. Mir stand eine Fortsetzung des Kleinkriegs zwischen meinem Mann Kevin und seinem pfiffigeren und sensibleren Sohn bevor. Meine Mutter schaute sich um, als sähe sie die Küche zum ersten Mal. Im vergangenen Jahr war sie aufgrund heftiger Kopfschmerzen und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ärzte hatten im Gehirn eine Blutung infolge einer Arterienerweiterung diagnostiziert und die Aussicht auf eine neue, dann fatale Blutung auf fünfzig Prozent eingeschätzt. Ich hatte die Kinder bei Kevin gelassen und war nach Perth geflogen, wo meine Eltern wohnten. Die Ärzte planten, eine Spirale in die undichte Ader einzusetzen, und legten Wert auf die Einwilligung meines Vaters, der selbst Arzt ist, statt sie nur von meiner Mutter einzuholen, obwohl diese immer noch bei Bewusstsein und klarem Verstand war. Eine Geste des Respekts, wie ich vermute. Mein Vater bat mich um meine Meinung, ich stimmte zu und flog zu ihnen.
Meine Mutter lag auf einem Rollwagen, in einen Operationskittel gekleidet, das Haar unter einer Papiermütze versteckt. Sie lächelte, als sie mich sah, und bat mich, ihr nach dem Eingriff ihre Enthaarungscreme auf die Oberlippe zu schmieren. Die Hormonbehandlung habe den Haarwuchs gefördert, sagte sie. Dies war der letzte vernünftige Satz, den sie mir gegenüber äußerte.
In Medizinerkreisen gilt es als Binsenweisheit, dass bei Arztfamilien Behandlungen häufig schieflaufen, und im Fall meiner Mutter traf das ganz gewiss zu. Später berichtete uns der Arzt, der Eingriff sei äußerst schwierig gewesen. Mehr als sieben Stunden lang hatte er sich immer wieder bemüht, die Platin-Spirale einzuführen, und letztendlich habe er sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als die verletzte Ader mit einer Art Klebstoff zu verstopfen. Meine Mutter hatte dabei über einen längeren Zeitraum unter ernsthafter Bradykardie gelitten, einer dramatischen Reduzierung des Herzschlags auf unter sechzig Schläge pro Minute, wodurch das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde.
Danach lag sie mehrere Wochen im Koma und wachte mit leichten Hirnschäden auf. Ich war stocksauer auf den Arzt, der den Eingriff meiner Meinung nach erheblich länger, als allgemein empfohlen wurde, durchgezogen hatte, wenn man die Kreislaufprobleme und Krankengeschichte meiner Mutter, die schon immer unter Bluthochdruck litt, zugrunde legte.
Als nächste Maßnahme stand Neurochirurgie an, um den erhöhten Druck in ihrem Schädel zu senken. Postoperativ stellten sich dabei Komplikationen durch eine Meningitis ein. Vom Pflegepersonal hörte ich, die Temperatur meiner Mutter sei bis auf 43 Grad Celsius gestiegen, die höchste mit dem Thermometer messbare Temperatur. Sie blieb bewusstlos, und ich ging davon aus, dass sie durch die Infektion und das Fieber weitere Hirnschädigungen erlitten hatte.
Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir ernsthafte Gedanken, wie es weitergehen sollte. Ich dachte an das Alter meiner Mutter und die massive Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Sie war eine sehr aktive Frau gewesen, ständig in diese oder jene Gemeindeaktion eingebunden, und damit war es jetzt eindeutig vorbei. Ich plädierte für eine Beschränkung auf unterstützende Behandlung: Flüssigkeit und Schmerzmittel, die Gabe intravenöser Antibiotika nur im äußersten Notfall. Ich wollte, dass die Ärzte ihr die Möglichkeit gaben, selbst zu kämpfen; auf keinen Fall aber wollte ich, dass sie sich in medizinischen Heldentaten versuchten.
Der Arzt entschied sich jedoch für eine aggressive Behandlung – die Injektion von Antibiotika direkt in die Rückenmarksflüssigkeit. Wieder kam es zu einer lang andauernden Bewusstlosigkeit, gefolgt von einer langwierigen Rehabilitation. Meine Mutter kam mit Windeln nach Hause zurück, unsicheren Schrittes, und ihr Gedächtnis war so zuverlässig wie eine Kerze im Schneesturm. Der Hoffnungsschimmer, den der Neurochirurg zu bieten hatte, bestand darin, dass sie auf lange Sicht in der Lage sein würde, sich mithilfe eines Gehgestells im Haus bewegen zu können.
Zu Weihnachten hat dieser Mensch keine Karte von mir bekommen. Und er war auch nicht da, um meinem Vater bei der Pflege meiner Mutter in ihrem Vorstadthäuschen in Perth zu helfen. Ein Pflegeheim kam nicht infrage – meine Mutter hatte stets behauptet, der Teufel selbst habe sie erfunden –, und ich lebte viertausend Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Kontinents. Die einzige Lösung, die mir einfiel, war der Umzug meiner Eltern von Perth zu mir. Ich wollte für sie sorgen, teilweise auch, um mich für meine besonders zickige »Pubertät« zu revanchieren, die spät einsetzte, als ich bereits über zwanzig war, und die sich zuletzt mit über dreißig geäußert hatte.
Doch das extravagante mehrstöckige Terrassenhaus in Sydney, in dem ich mit meinem Mann und meinen Kindern wohnte, war absolut ungeeignet für jemanden mit Gehgestell. Und da übersteigerte Emotionen jedweder Art (Freude, Wut, Stolz, Trauer: Suchen Sie sich etwas aus!) einem den Blick versperren und zu ungewöhnlichen Entscheidungen treiben können, beschloss ich, einen vollständigen Umzug der gesamten Familie vorzunehmen. Jahre später erzählte mir meine Tochter, ich habe gesagt: »Packt eure Sachen, und dann ab ins Auto!« Und ich denke, so muss es in etwa gewesen sein. Von Gefühlen überwältigt, verstand ich kaum noch etwas, fluchtartig gab ich mein früheres Leben auf, ein Leben mit Firmenessen und protzigen Partys, die urplötzlich keine Bedeutung mehr zu haben schienen. Ich zog mit den Kindern in unser Bungalow-Ferienhaus im Buschland nahe Mullumbimby im Byron Shire.
Byron ist alternatives Territorium: eine Momentaufnahme der Sechzigerjahre, wo die Leute in der Morgendämmerung am Strand ihre Yoga-Übungen machen und in der Abenddämmerung zum Takt der Bongotrommel tantrischen Sex haben. Ein Gebiet, in dem einem vegane Hippies den Börsenschlusskurs der Technologiewerte nennen können und ein Junge mit Downsyndrom an der Kasse des örtlichen Supermarkts die Lebensmittel einpackt. Hier war Platz für jeden, einschließlich einer alten Frau, die auf ein Gehgestell angewiesen und deren IQ um einige Punkte abgesunken war. Hier konnte meine Mutter in den unbeschwerten goldenen Sonnenuntergang ihres Lebens segeln, umgeben von ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren drei Enkeln in einer nach Patschuli duftenden Umgebung eines Landhauses mit drei Schlafzimmern. Kevin musste jede Woche zwischen Sydney und Mullumbimby pendeln, indem er am Wochenende die siebenhundertachtzig Kilometer von seinem Büro zu uns ins Ferienhaus flog und am Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte.
Das war doch nicht zu viel verlangt, oder?
*
Mein Ehemann erschien in seinem Zweireiher und gestärktem Hemd, als ich gerade die Hähnchen-Tajine servierte. Er sah aus, als wäre er geradewegs aus einer Hugo-Boss-Plakatwand herabgestiegen. Er stellte seinen Aktenkoffer an der Tür ab und betrat die Küche. Minnie, unser Cockerspaniel, geriet in einen Rausch aus Kläffen und Sprüngen.
»Würdest du bitte mal deinen Hund wegrufen?«, wandte sich Kevin an mich. »Ich möchte nicht, dass er mir den Anzug versaut.«
Mit einem Arm hob er Louise auf seine Hüfte, mit der anderen hielt er Andy an sich gedrückt, und die drei tauschten schnatternd Neuigkeiten aus. Ich bändigte Minnie und widmete mich wieder der Kasserolle. Riche vermied es, Kevin anzuschauen, und schob ein Stück Hähnchenfleisch auf seinem Teller herum. Am liebsten hätte ich die Erkenntnis in Kevins hübschen Kopf eingehämmert: Weshalb konnte er den Streit mit seinem ältesten Sohn nicht endlich begraben? Schließlich war er nicht Zeuge der Auseinandersetzung zwischen seiner Mutter und Riche gewesen. Was machte ihn so sicher, dass Riche es war, der sich falsch benommen und sich bei ihr zu entschuldigen hatte?
Andy grinste seinen Vater an. Die äußerliche Ähnlichkeit zwischen den beiden fiel mir immer wieder aufs Neue auf. Kleine dunkle Augen, eine dicke Unterlippe und ein kräftiger Knochenbau, doch Andys Haut war olivfarben, wie die meiner Mutter. Riche hingegen ähnelte mir; und Louise war eine Mischung aus Kevin und mir. So ist das halt mit der Genetik: Jeder bekommt das Seine.
Kevin blickte zu seinem Ältesten und sagte so laut, dass Riche merken musste, wer gemeint war: »Na, wie war deine Woche, Kumpel?«
Riche schaute nicht hoch. »Bestens.«
Kevins Gesichtsausdruck wurde hart, und ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Er zuckte mit der Schulter und gab mir einen Kuss, den ich mit einem halbherzigen Wangehinstrecken erwiderte. »Hunger?«
»Total.« Er schnüffelte an dem würzigen Dampf, der in kleinen Spiralen aus der Kasserolle aufstieg. »Aber bitte keinen Reis. Sonst geht mein Surfbrett unter, wenn ich mich draufstelle.«
Ich schnaubte. Kevins neueste Leidenschaft für die kohlenhydratarme Atkins-Diät ging mir gegen den Strich. Weshalb eine ganze Gruppe von Nahrungsmitteln weglassen, wenn er lediglich auf einen Snack und die zweite Portion zu verzichten brauchte?
Ich füllte den Teller für meinen Vater mit etwas Reis und Fleisch aus der Kasserolle. »Hier kommt dein Essen.« Dann wartete ich, bis er sein Kreuzworträtsel zur Seite gelegt hatte, und stellte ihm den Teller hin.
»Ist das für mich?«, fragte mein Vater. »Es sieht fantastisch aus, was auch immer es sein mag. Aber ich brauche noch etwas süße Chilisoße.«
Mein Vater brauchte für alles noch etwas süße Chilisoße. Er kippte dicke orangefarbene Klumpen über das Hähnchen. Zufrieden betrachtete ich seine schlanke Figur. In den acht Monaten, in denen er für meine kranke Mutter in ihrem Haus in Perth gesorgt hatte, hatte er furchtbar zugenommen, und ich war entsetzt gewesen. Für mich war es ein Zeichen der Vernachlässigung seiner selbst gewesen, das darauf hinauslaufen würde, ein gesundheitliches Problem zu werden, daher hatte ich nach seiner Ankunft in Byron die Rolle seiner Diät-Polizistin übernommen. Da ich darauf bestand, nahm er jetzt Süßstoff statt der drei Teelöffel Zucker in den Tee, strich sich Vegemite – jede Menge kalorienarme B-Vitamine – auf den Frühstückstoast, aber keine Butter (»Die solltest du dir nicht wie Frischkäse aufs Brot schmieren, Paps!«), und aß alles light statt mit voller Sahne-Power. Innerhalb von drei Monaten hatte ich meinen Vater auf eine Konfektionsgröße gebracht, die er zuletzt als Dreißigjähriger besessen hatte. Ich dachte ständig an die Botschaft, die dadurch meinen Kindern vermittelt wurde.
Meine Mutter saß am anderen Ende des Tisches. Als ich noch klein war, hatte sie streng auf Hygiene geachtet – »Wasch dir vor dem Essen die Hände, und bring den Hund raus!« –, doch jetzt gab es einen Bissen für sie und einen für Minnie, die das Stück Hähnchen genussvoll von derselben Gabel schleckte.
Riche beobachtete es über den Tisch hinweg. Die Krankheit meiner Mutter beunruhigte ihn mehr als Andy oder Louise, vielleicht weil er älter war. Das unsinnige Gerede, das Gehgestell, die vollgeschissenen Erwachsenenwindeln, die den Abfalleimer im Badezimmer füllten: All das registrierte er. »Ich will nie in ein Krankenhaus kommen«, sagte er zuweilen. »Du siehst doch, was es aus Oma gemacht hat.« Er hatte recht. Mein Vater und ich waren beide Ärzte, doch meine Mutter war alles andere als Werbung für unseren Berufsstand.
Eine volle Stunde verstrich, bevor ich mich mit Kevin allein unterhalten konnte. Wir räumten die Küche auf.
»Ich mache mir Sorgen wegen Riche«, sagte ich.
»Kann ich das hier mit Stahlwolle scheuern?« Kevin begann zu schrubben. »Wieso, was ist denn los?«
»Du kennst ihn doch, wenn er sich mal in eine Idee verrannt hat, gibt er sie nicht mehr auf.«
Kevin machte ein spöttisches Geräusch. »Ph! Er ist starrköpfig – wie seine Mutter.«
»Lass den Quatsch.« Ich schlug mit dem Geschirrtuch nach ihm. »Heute Abend war es verdammt heftig, selbst für Riches Verhältnisse.« Ich lieferte ihm die Rattengeschichte in Form einer gekürzten Nachrichtenmeldung.
»Was gedenkst du zu tun?«
»Keine Ahnung. Aber ich finde, du solltest dich etwas zurückhalten – wenigstens für eine Zeit. Okay?«
Kevin zog die Schultern bis zu den Ohren hoch und senkte den Kopf. »In Ordnung«, sagte er mit einer Miene wie Minnie, wenn sie spielen wollte.
»Sehr witzig!« Mein alles andere als amüsierter Blick prallte an Kevins dickem Fell ab. »Weshalb sollte sich Riche bei deiner Mutter entschuldigen? Sie war es doch, die sich danebenbenommen hat!«
»Sag mir noch mal, was sie gesagt hat.« Kevin zog den Stöpsel an der Spüle heraus und streifte die Gummihandschuhe ab.
»Du weißt ganz genau, was sie gesagt hat, und du weißt auch, dass ihr das ganz ähnlich sieht. Es gibt keinen Grund für die Annahme, dass Riche gelogen hat. Außerdem haben Andy und Louise das Ganze mitbekommen, und die beiden sind sich einig, dass er die Wahrheit gesagt hat.«
Kevin öffnete die Küchentür und ging auf die Veranda. Ich folgte ihm. Wir lehnten uns an das Geländer und schauten zu den Sternen hinauf. Der Geruch brennenden Holzes vom Feuer des Nachbarn war hier intensiver. Flughunde segelten über uns hinweg, gespenstisch leise, abgesehen vom Schlag der Flügel. Ich konnte durch die u-förmige Architektur des Ferienhauses in zwei Schlafzimmer blicken, Szenen im Licht der Lampen: Mein Vater half meiner Mutter ins Bett, Andy und Louise spielten mit Plastikdinosauriern auf dem Boden des Zimmers, das sie sich teilten. Von Riche war nichts zu sehen.
»Kann sich Riche nicht um des lieben Friedens willen einfach bei ihr entschuldigen?«, sagte Kevin. »Seit Monaten hat keiner von euch mehr mit meinen Eltern gesprochen. Das ist doch lächerlich!«
»Du bist lächerlich. Bring sie dazu, sich zu entschuldigen, und lass bitte Riche in Ruhe.«
Kevin holte tief Luft und atmete mit einem zischenden Geräusch ganz langsam aus, als würde die Luft aus einem Reifen gelassen. »Alles klar«, sagte er. »Ich werde ihn nicht mehr darum bitten. Versprochen!«
3
Am Tag nach Riches vermeintlichem Kontakt mit den mittelalterlichen Pestbazillen kam ich vom Einkaufen zurück und entdeckte ihn zusammen mit Kevin neben dem Carport. Riche schimpfte fürchterlich und stieß mit hochgezogenen Schultern die Faust in die Luft. Kevin stand breitbeinig gegen einen Holzpfosten gelehnt, die Hände in die Hüften gestemmt, und blickte auf seinen Sohn hinab. Ich stieg aus dem Auto. Kevin warf mir ein Lächeln zu, das allerdings nicht bis zu den Augen reichte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!