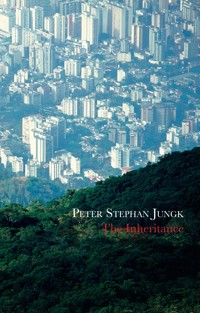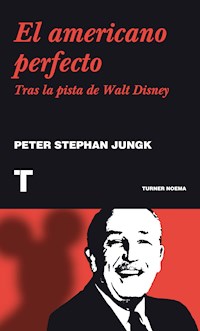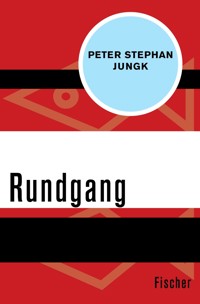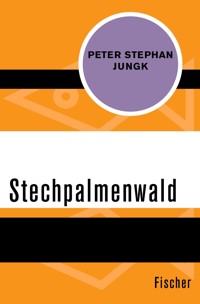11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon mit dreißig war er eine internationale Berühmtheit, Ehrungen fielen ihm zu wie wenigen anderen Zeitgenossen. Sein kleines Zeichenstudio war im Lauf der Jahre zu einer weltumspannenden Industrie geworden. Und als er starb, war er eine Legende, einer der letzten Groß-Moguln Hollywoods: Walt Disney. Dieser biographische Roman offenbart Licht- und Schattenseiten eines der einflußreichsten Männer des 20. Jahrhunderts. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Peter Stephan Jungk
Der König von Amerika
Roman
Über dieses Buch
Schon mit dreißig war er eine internationale Berühmtheit, Ehrungen fielen ihm zu wie wenigen anderen Zeitgenossen. Sein kleines Zeichenstudio war im Lauf der Jahre zu einer weltumspannenden Industrie geworden. Und als er starb, war er eine Legende, einer der letzten Groß-Moguln Hollywoods: Walt Disney.
Dies ist der erste biographische Roman, der die Licht- und Schattenseiten eines der einflußreichsten Männer des 20. Jahrhunderts darstellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561769-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»Der König von Amerika« [...]
»My greatest creation is [...]
Adah gewidmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
»Der König von Amerika« ist ein Roman. Zwar lassen sich zu einigen der Romanfiguren Entsprechungen finden, doch sind die Charaktere und Ereignisse dieses Buchs durchweg Schöpfungen des Autors.
»My greatest creation is Walt Disney«
Walt Disney
»When in doubt, tell the truth«
Mark Twain
Adah gewidmet
1.
Alles ruht.
Er liegt seit einer halben Stunde wach. Reglos wach. Kerzengerade, auf dem Rücken.
Es dauert noch, bis die Sonne aufgehen wird.
Im Zimmer nebenan, zu seiner Linken, sind Roy und Edna untergebracht. Sein Bruder kennt keine Schlafprobleme. Seit der Tuberkuloseerkrankung, 1920, hält Roy strikte Tagesabläufe ein. Er geht vor Mitternacht zu Bett. Um sieben Uhr steht er auf. Bis dahin vergehen noch zwei Stunden.
Walt hat keine Lektüre auf die Reise mitgenommen, von der Illustrierten Life abgesehen. Die aber liegt auf Lillians Nachttisch. Er will nicht hinübergreifen, nicht Licht machen, aus Angst, seine Frau zu wecken. Sowohl der Fernsehapparat als auch das kleine Transistorradio bleiben ausgeschaltet. Er hört die Signalhupe der Eisenbahn, sechs, sieben, acht Mal hintereinander, ein Passagierzug oder ein Güterzug, der in Marceline nicht anhält. Das Hämmern und Trommeln der Räder auf den Schienen wird leiser, langsam leiser, verfliegt.
Seit vier Jahrzehnten glückt mir ein Wagnis nach dem anderen, flüstert er sich zu, wie an jedem Morgen nach dem Erwachen und vor dem Aufstehen. Es hat Rückschläge gegeben, unbestritten. Aber sie waren selten. Äußerst selten. Mitunter sah es aus, als müßten wir unsere Mitarbeiter allesamt entlassen. Das Studio auflösen. Roy aber hat es immer wieder verstanden, Bankiers, Financiers, Aktionäre umzustimmen. Roy, der um siebeneinhalb Jahre ältere Bruder. Der Realist in der Familie, der vor jeder neuen Entwicklung zurückschreckte, mehr noch, sie zunächst zu verhindern suchte. Der niemals glauben mochte, die Ideen seines jüngsten Bruders könnten Gewinne erzielen. Trotzdem: Ohne Roy, denkt Walt, gäbe es unser Unternehmen nicht. Millionen und Abermillionen hat er der Bank of America entlockt, im Verlauf der Zeit. Walt begreift nicht ganz, wie Roy das schaffen konnte. Anderseits ist er sich dessen bewußt, sein Einfallsreichtum allein habe die Endloskette der Kredite ermöglicht. Ich war der Erste, spricht er zu sich selbst, der Zeichentrickfiguren Persönlichkeit verlieh. Ich war der Erste, der im Film mit Farbe arbeitete. Ich war der Erste, der Trickfilme erfolgreich vertonte. Der Erste, der einen abendfüllenden Zeichenfilm produzierte. Der Erste, dem es gelang, einen Spielpark in die Welt zu setzen, der weder traurig noch jemals schmutzig oder gar häßlich ist. Ein kleines Paradies auf Erden, mein Reich in Anaheim. Walt genießt es ungemein, die Triumphe der Vergangenheit und die Meisterstreiche der Gegenwart an sich vorbeiparadieren zu lassen: Einunddreißig, oder sind es zweiunddreißig, vergoldete Oscarfiguren durfte ich bisher entgegennehmen, mehr als jeder vor mir, mehr, als je einer nach mir entgegennehmen wird. Und sechshundertunddreizehn Auszeichnungen, Ehrendoktorate, Preise, Medaillen aus aller Welt.
Ich kann meinem Schicksal nur dankbar sein, sagt er sich allmorgendlich vor: Ich lande, wie ein Stehaufmännchen, immer wieder auf den Füßen.
Erst seit wenigen Jahren, denkt Walt in der Stille, ist das Hochgebirge unserer Millionen-Schuld endgültig abgetragen. Erst jetzt gehört jeder Cent, den wir einnehmen, auch wirklich uns. Unserem Unternehmen, unseren Aktionären. Und nicht der Bank. Erst seit es mein Reich in Anaheim gibt. Erst seit es meine ›20000 Meilen unter dem Meer‹ und die fünf Folgen ›Davy Crockett‹ und die ›101 Dalmatiner‹ und meine ›Mary Poppins‹ gibt. Nach ›Schneewittchen‹ ging es uns gut, vor dreißig Jahren. Wir waren reich, drei, vier Jahre lang, Roy und ich, und unsere Frauen kauften sich, was ihr Herz begehrte. Ich fing mit dem Polospiel an – besaß nach und nach zwölf Pferde! Die fetten Jahre, von ’37 bis ’40! Aber dann kamen ›Pinocchio‹ und ›Fantasia‹ und ›Bambi‹ – und unser Finanzglück schien am Ende.
Lillian und Walt, seit einundvierzig Jahren verheiratet, schlafen seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr im selben Bett. Nur auf Reisen ergibt sich mitunter die Ausnahmesituation des Beisammenliegens, Wärme an Wärme, Körper an Körper. Getrennte Schlafzimmer – eine der Bedingungen, die seine Frau ihm stellte, nach dem großen Streik der Studio-Belegschaft, Mitte der vierziger Jahre. Wolle er mit ihr verheiratet bleiben, müsse er die Nacht im eigenen Bett verbringen. Zu unruhig sei sein Schlaf. Zu oft wecke er sie mitten in der Nacht, belagere sie mit seinen Sorgen, seinen Ängsten, seinem Zweifel an sich selbst und an der Welt. Eine weitere Bedingung, die Ehe fortzuführen, Jahre vor dem Studiostreik geäußert, lautete: Er müsse sich damit einverstanden erklären, ein Kind zu adoptieren. Die erstgeborene Tochter, Diane, war damals drei Jahre alt. Sie sehnte sich nach einer Spielgefährtin. Unwillig unterschrieb er die notwendigen Papiere. Und so kam Sharon in sein Leben. In den ersten Jahren sah er sie so selten, daß er seine Frau einmal fragte, wer das kleine Mädchen denn eigentlich sei, das da mit Diane im Garten herumtollte?
Erste Tageslichtstreifen berühren den Himmel über Marceline. Nach und nach nehmen die Umrisse der Zimmereinrichtung Gestalt an. Der große Kleiderschrank. Die Nachtkästchen. Die Vorhänge mit dem Tulpenmuster. Die große Deckenlampe mit den sieben Spinnenarmen und einer länglichen Glühbirne am Ende jeden Armes. Wieder das Heulen einer Lokomotive, schrill und dumpf zugleich, sonderbare Mischung, lautleise, und das Pochen der Hundert Räder auf den Schienensträngen, die an Marceline vorbeiführen, nein, nicht vorbei-, sondern mitten hindurchführen auf ihrem Weg von Chicago nach Kansas City, oder von Kansas City nach Chicago, das prägende Geräusch an diesem Ort. Alle zwanzig, dreißig Minuten durchbricht es die ländliche Stille.
Ich bin tonangebend, ich bin einer der Glorreichen der Welt, wie Echo hallen diese Worte in Walts Innerstem wider. Seit ›Schneewittchen‹, seit 1937, spricht er sich dies Selbstverherrlichungsgebet vor, jeden Morgen, beim Wachliegen, bevor die Sonne aufgeht. Mehr Menschen auf Erden haben meinen Namen im Ohr als den Namen Jesus Christus. Milliarden kennen wenigstens einen meiner Filme. Ich bin Mythos. Die Maus ist beliebter als das Christkind und der Weihnachtsmann zusammengenommen. Das hat es vor mir nicht gegeben: eine Kunstgattung, eine Idee, ein Konzept, welches die gesamte Menschheit anspricht, erreicht und beglückt. Ich habe ein Universum geschaffen. Mein Ruhm wird Jahrhunderte überdauern.
Für die Leute von Marceline aber, fügt er an diesem Samstag, dem 10. September 1966, hinzu, bin ich, das versteht sich von selbst, so etwas wie Gott. Vier Jahre, murmelt Walt in die Zimmerdämmerung hinein, lebten wir hier. Ich war viereinhalb, als wir ankamen, neun, als wir fortzogen. Ich kehre viel zu selten zurück, war seit zehn Jahren nicht mehr zu Besuch.
Am Nachmittag soll er das neue Freibad und den umliegenden Stadtpark einweihen und auf seinen Namen taufen. Walt ist selten so stolz gewesen, nicht einmal im vorletzten Jahr, als sich eine Schule für tausendundvierhundert Kinder in Pittsburg mit seinem Namen schmückte. Auch damals war er angereist, durchschnitt im Beisein der Stadtväter das Band, fuhr nach der Feierstunde jedoch sogleich wieder ab.
Er schält sich aus den Bettlaken, bedacht, Lillian nicht zu wecken, tastet sich durch einen finsteren Korridor ins Badezimmer vor. Es dauert, bis er dort eingetroffen ist. Seit Monaten sollte er einen Arzt aufsuchen, zögert das Rendezvous immer von neuem heraus. Der Nacken schmerzt ihn. Das rechte Bein verursacht ein kaum erträgliches Ziehen und Stechen. Der ganze Rücken tut ihm weh. Er schaltet das Licht ein, läßt heißes Wasser in die Badewanne laufen.
Die Verletzung, die er sich beim Polospiel zugezogen hat, vor fast dreißig Jahren, quält ihn zur Zeit mehr denn je. Er stürzte vom Pferd, in einem aussichtslosen Wettstreit, in dem sein Team weit abgeschlagen war. Ganz sinnlos, noch weiterzukämpfen. Walt und seine Mannschaft aber, der auch Spencer Tracy angehörte, spielten unbeirrt weiter, bis zum Moment des Unfalls. »Niemals aufgeben!«, so lautet eine von Walts Lebensregeln. Drei Halswirbel wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind nie wieder ganz verheilt. Ein in Hollywood angesehener, von Stars, Filmregisseuren und -produzenten gleichermaßen frequentierter Chiropraktiker hatte Walt eingeredet, er könne die Verletzung ohne Komplettverband ausheilen. Ohne Rückenkorsett und Torsogips. Eine folgenschwere Fehlentscheidung, unter der er seither zu leiden hat.
Er streckt sich in der heißen Badewanne aus. Läßt immer wieder Wasser nachlaufen, dreht den Heißwasserhahn mit den Zehen des linken Fußes auf und zu. Seine Massage konnte seit zwei Tagen nicht stattfinden. Schon quälen ihn die Halswirbelschmerzen ganz besonders. In seinem Studio in Burbank streckt er sich allabendlich um sieben, halb acht Uhr bäuchlings auf einem schmalen Bett aus, in einer Kammer neben seinem Büro. Er nennt diese mit Photographien und Zeichnungen, mit Illustrationen seiner Lebensgeschichte austapezierten Raum die Lachkammer. Dort schenkt er sich zunächst ein Glas Scotch ein, trinkt es aus und bekommt anschließend Hitzeapplikationen verabreicht. Läßt sich den Rücken, den Nacken, die Hüften, die Beine massieren. Während Hazel George, die Studiokrankenschwester, seine Gliedmaßen knetet, erlaubt er ihr, die seit fünfundzwanzig Jahren seine Masseuse ist, Einblicke in sein Leben. Die Zahl seiner Geheimnisse ist nicht groß. Die wenigen jedoch, die er hütet, teilt er mit niemandem außer mit Hazel George.
Ihre Behandlungen schafften in der Regel immer Abhilfe, wenn auch lediglich für kurze Zeit. Neuerdings bleibt der nagende Schmerz mitunter auch nach mehrfachen Kompressionen und ausführlicher Heilbehandlung spürbar.
Das Gastgeberpaar, Mr. und Mrs. Othic, sitzen in freudiger Erregung in ihrer sonnenhellen Küche, als Walt und Roy kurz nach sieben Uhr zum Frühstück erscheinen. Sie sind stolz, sehr stolz sogar, die Brüder bei sich empfangen zu dürfen. Ihre Bekanntschaft, man könnte beinahe von Freundschaft sprechen, geht auf das Jahr 1956 zurück, als Walt die Grundschule von Marceline auf seinen Namen taufte. Vor fünfzig Jahren existierte in Marceline ein kleines Hotel, das Allen, im ersten Stock über Murray’s, dem Kleidergeschäft an der Hauptstraße, der Kansas Avenue, wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Es schloß Mitte der vierziger Jahre, nachdem Marceline seine Bedeutung als Kohlenmine und kleiner Eisenbahnknotenpunkt eingebüßt hatte. Mitte der sechziger Jahre gibt es nur einen kleinen Motelneubau am Ortsrand, das Lamplighter, ein schlecht gebautes, häßliches Haus mit schäbigen kleinen Räumen. Und da es zehn Jahre zuvor weder das Allen noch das indiskutable Lamplighter gab, rief Walt den Bürgermeister an, bat ihn, er wolle lieber Hausgast sein während seines zweitägigen Marceline-Aufenthalts, als in Macon oder Moberly untergebracht zu werden, den einzigen größeren Orten der Umgebung. Das Haus müsse allerdings Aircondition haben, forderte er. Da fiel Eddie Strayhall die Wahl nicht schwer: Von den zweitausendvierhundertachtundachtzig Einwohnern Marcelines besaß im Jahre 1956 nur eine einzige Familie Aircondition, der wohlhabende Farmer und Zobelzüchter Othic, der sich an der Kansas Avenue, Ecke Bisbee Street, eine Prachtvilla hatte erbauen lassen, mit vier Schlafzimmern und zwei Badezimmern. Ein langgestreckter Bau aus karmesinroten Ziegeln, unähnlich allen anderen Häusern von Marceline, wie man ihn in den vornehmeren Vororten einer Großstadt vermutet hätte, nicht mitten in der Prärie.
Seit damals hielt man regen Kontakt – zwei der Othic-Kinder waren Walts Einladungen nach Los Angeles bereits mehrmals gefolgt und durften Disneyland jeweils als seine persönlichen Gäste besuchen. Er begleitete sie höchstpersönlich von Attraktion zu Attraktion. Zu Weihnachten erhielten die beiden Söhne und die jüngste Othic-Tochter großzügige Geschenke von Mr. Disney, den alle drei Kinder Onkel Walt nennen durften, nein, nennen mußten, er bestand auf dieser Anrede.
Außer ein paar Auserwählten weiß niemand, wann Walt in Marceline eingetroffen ist und wo er übernachtete. Eine Menschentraube hat sich vor dem Lamplighter eingefunden, schon ab sieben Uhr früh. Doch dann verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, Walt sei – wie schon vor zehn Jahren – auch diesmal wieder bei den Othics abgestiegen.
Er raucht nach dem Frühstück seine erste Lucky Strike des Tages, bis zum filterlosen Ende, so weit, bis die braungelben Fingerspitzen den Zigarettenstummel kaum noch greifen können. Und zündet sogleich die nächste an, mit dem glühenden Rest der alten, raucht auch diese bis zum bitteren Ende. Walt und Roy tragen dünne, anthrazitgraue, maßgeschneiderte Anzüge aus dem Modehaus Klein & Hutchinson, am Cañon Drive in Beverly Hills, weiße Hemden, und Krawatten, Walt eine hellblaue, Roy eine ockergelbe. Walt hat wie jeden Tag ein weißes Stecktuch in die Jackett-Tasche geschoben – und die immergleiche, die seit Jahren gleiche goldene Krawattenspange in Brusthöhe festgemacht. Selbst hier, auf dem Land, durchbrechen die Brüder ihren selbstauferlegten Kleidungskodex nicht. Einzige Ausnahme: Sie haben an diesem Morgen Stiefel angezogen, schwarze schweinslederne Cowboystiefel.
Lillian und Edna schlafen noch, als ihre Männer das Haus verlassen. Sie nahmen am Vorabend starke Medikamente ein, die Lillian immer bei sich trägt. Auch Edna leidet unter schweren Schlafstörungen, seit einigen Jahren. Die Brüder denken, es werde ihnen glücken, unbemerkt zum Farmhaus in der Missouri Street, Ecke Broadway zu spazieren, wo die Familie einst, vor mehr als einem halben Jahrhundert, zuhause war: Elias, der so oft übelgelaunte, hagere, großgewachsene Vater, die Mutter, Flora, der Mund schmerzverzerrt und die Augen fast immer traurig, die zweijährige Schwester, Ruth, und die viel älteren Brüder Herbert und Raymond, die damals von zuhause fortliefen, weil sie Elias’ Unleidlichkeit und Ungerechtigkeit und die wiederholten Züchtigungen, die ihr Vater ihnen angedeihen ließ, nicht länger ertrugen. Walt und Roy hoffen, es werde ihnen gelingen, das Flüßchen, an dem sie mit den benachbarten Taylor-Buben und mit Clem Flickinger fischen gingen, aufzusuchen, ohne, daß es jemand im Ort bemerkt und ihnen dorthin nachfolgt. Sie wollen allein sein, ihren Erinnerungen ungestört nachsinnen. Sie freuen sich auf den Aufbruch in die Vergangenheit.
Die Morgenluft riecht nach frischer Erde, kühlem Gras, von weitem weht der Dunst von Kuhdung herüber. Der 10. September 1966 ist ein Samstag. Alle Kinder haben schulfrei. Kaum bringen die Brüder den ersten Häuserblock hinter sich, in Richtung Norden, weg vom Ortskern, um viertel vor acht Uhr morgens, da kommt ihnen die Gruppe, die vor dem Lamplighter gewartet hatte, entgegengelaufen, und immer mehr Leute aus Marceline, die sich dem ursprünglichen Trupp angeschlossen haben, mit Notizheften, Tagebüchern, Briefpapierblocks bewaffnet, mit Bleistiften, Buntstiften, Kugelschreibern, Füllfedern ausgerüstet. Sie bestürmen Walt. »Hey!«, »Hi«, »Yeah!«, »Uhh!«, »Me«, »Sir«, und sonst ist nur das Kratz- und Kritzelgeräusch zu hören, das Walts Schreibbewegungen verursacht. Keiner erbittet Roys Namenszug. Alle gruppieren sich um Walt, nur um ihn, mit dem Ungestüm eines Bienenstocks, der sich um die Königin schart.
Er gibt sein Autogramm, dreißig, vierzig Mal, nicht widerwillig, aber ohne das leiseste Lächeln. Und jeder staunt: Wie unähnlich seine Signatur den rundgeschwungenen Buchstaben zu sein scheint, die man von ihm so gut zu kennen glaubt. Wie unähnlich jener Signatur, die die Filmplakate, die Eröffnungsbilder der Fernsehsendungen, die Millionen Comichefte und Kinderbücher ziert.
Ein sonniger Spätsommertag, mit wattefetzenkleinen Wölkchen. Es wird warm werden in Marceline, Missouri. Der Himmel ist durchkreuzt von den Kondensstreifen der Passagierflugzeuge, die den Kontinent überqueren. Jetzt duftet es nach frischgemähtem Heu, nach reifen Äpfeln und reifen Aprikosen. Walt und Roy beginnen ihren Rundgang – trotz der Menschentraube, die sie umringt.
»Zum Haus!«, flüstert Walt seinem Bruder zu.
»Lieber zuerst zum Fluß!«, bittet Roy, ebenso leise.
»Zuerst zum Haus!«, wiederholt Walt.
Und Roy folgt seinem jüngeren Bruder nach. Augenblicklich. Ohne Widerrede.
Sie marschieren zum Rand des Städtchens hin. Walt hustet. Der Raucherhusten, der ihn seit zwanzig Jahren quält, ist akut geworden. Er hält mitunter eine Minute lang an. Wie abscheulich das Rasseln seiner Anfälle klingt! Er ringt nach Luft.
Die Schar der Begleiter wächst stetig an. Immer mehr Bewohner Marcelines treten aus ihren Häusern und folgen der Prozession der Disneybrüder an die Quellen ihrer Kindheit.
Einer von denen, die da mitgehen, mitpilgern, bin ich, Wilhelm Dantine. Ich habe am Vortag ein Zimmer im Lamplighter gemietet, in der Annahme, auch Walt werde hier absteigen, da es ja in Marceline kein anderes Hotel oder Motel gibt. Ich wunderte mich, daß niemand außer mir und einem älteren Herrn aus St. Louis hier wohnte, erfuhr, als ich um sechs Uhr dreißig an der Tankstelle meinen Frühstückskaffee trank und dazu ein Zuckerguß-Donut verschlang, die Brüder Disney seien offenbar bei Privatleuten abgestiegen. Ich war davon ausgegangen, es müsse in Marceline eine ganze Reihe von Unterkunftsmöglichkeiten geben, immerhin ist dies der Ort, an dem Walt die entscheidenden Kindheitsjahre verbracht hat. Aus aller Welt, meinte ich, reisten die Menschen an, um dies besondere Städtchen mit eigenen Augen zu sehen. Und als ich in den späten Abendstunden ankam, bei orangenem Dämmerlicht, begriff ich, daß ich der erste Besucher seit langer Zeit war, der den Weg hierher gefunden hatte, auf der Suche nach Walts Vergangenheit. Das Lamplighter war in erster Linie für Lastwagenfahrer und Firmenvertreter eingerichtet worden. Denn außerhalb Marcelines wußte kaum jemand von Walts tiefer Verbindung mit seinem Kindheitsort. Ich hatte am Vortag zwanzig Meilen westlich, in der Kleinstadt Meadville in einem Coffee Shop Station gemacht. Einige Fenster des Lokals, auch die Innenwände waren mit bunten Abbildungen der Maus und der Ente verziert. Als ich bezahlte, fragte man mich, wohin die Fahrt gehe. Ich zeigte auf Mickey, Minnie, Donald und Genossen. Die Besitzerin des Coffee Shops, fünfzigjährig, mit Lockenwicklern im Haar, und ihre beiden jungen Kellnerinnen sahen mich ausdruckslos an. »Nach Marceline!«, fügte ich hinzu. Keine Reaktion. Da verstand ich, daß die Damen Walts vermeintliche Kreationen zwar zärtlich liebten, von den Lebensumständen oder gar der Lebensgeschichte ihres Schöpfers jedoch kaum das Mindeste wußten.
Ich war mit meinem Rambler, Baujahr 1961, unterwegs, benötigte von Los Angeles mühsame fünf Tage hierher. Es ist nicht das erste Mal, daß ich dabei bin, wenn Walt auf Reisen geht. Ich tauche hier und da an Orten auf, an denen er sich zeigt, seien es Filmpremieren, Einkaufszentrumseröffnungen, Auszeichnungsverleihungen im ganzen Land. Sechs Mal nahm ich an solchen Gelegenheiten teil, seit dem 18. Dezember 1959, dem Tag meiner Entlassung, immer dann, wenn ich rechtzeitig von einer solchen Veranstaltung erfahren habe. Er hat mich kein einziges Mal wiedererkannt. In zwei oder drei Fällen fing ich, so will mir scheinen, einen Blickmoment von ihm auf, der mir das Gefühl vermittelte: Er ahnt etwas. Er glaubt, sich zu erinnern. Aber dann streiften seine kleinen grauen Augen jeweils weiter. Oder schauten gleichsam durch mich hindurch. Und es kam zu keinem weiteren Kontakt. Nach Marceline zu reisen plante ich längst, seit mehr als zehn Jahren. Ich wollte den Ort mit eigenen Augen sehen, doch es kam nicht dazu, bis zu diesem Tag im Spätsommer 1966. Meine Verfolgungsreisen haben meiner Ehe und meinem Familienleben nicht gutgetan, wie man sich vorstellen kann. Meine Frau warf mir vor, ich lebte mit der Faszination, die Walt auf mich ausübte, nicht aber mit ihr und unseren beiden Söhnen zusammen.
Zuletzt sah ich ihn vor zwei Jahren aus nächster Nähe, im Zoo von San Diego. Er stiftete da, im Sommer 1964, ein Löwenbaby, welches ihm ein auf Staatsbesuch weilender südafrikanischer Politiker, der damalige Ministerpräsident Hendrik Verwoerd, als Gastgeschenk mitgebacht hatte. Walt wirkte zu jenem Zeitpunkt, so will mir scheinen, um Jahre jünger als dieses Mal, in Marceline. Hier sah er erstaunlich gealtert aus, trat auch weniger staatsmännisch auf, als dies bei früheren von mir miterlebten Anlässen der Fall war. Es mochte sein, daß er fühlte, sich hier weniger verstellen zu müssen, denn er bewegte sich im Herzen Missouris gelöster als an jedem anderen Ort, an dem ich ihn beobachtet hatte. Roy hingegen, den ich viel seltener zu sehen bekam, erschien mir immer gleich, immer ganz unverändert. Er sah, befand ich, genauso aus, wie man sich einen alternden Buchhalter aus dem mittleren Westen vorstellt.
Die Brüder folgten der Missouri Avenue in Richtung Norden. In ihrem Rücken die Heerschar von Begleitern, die mittlerweile auf rund sechzig Personen angewachsen war. Wir hielten, ich kann es bezeugen, da ich mich in ihrer Mitte befand, einen gewissen Abstand ein. Unsere Nähe scheint Walt und Roy nicht allzu sehr gestört zu haben. Zwar drehten sie sich alle paar Schritte nach uns um, aber ich habe weder bei dem einen noch bei dem anderen Anzeichen von Feindseligkeit oder Widerwillen festzustellen vermocht. Sie hatten sich damit abgefunden, den Pfad in die Vergangenheit in großer Begleitung zurücklegen zu müssen.
»Hey, ihr zwei, meine Oma war eure Nachbarin, die Miss Passig, erinnert ihr euch?«, rief ein junger Mann. »Sie sagt, Roy war extrem verliebt in sie. Stimmt das?«
»Hallo, Brüder, wißt ihr noch? Ich bin die Eileen«, frohlockte eine ältere, rüstige Frau. Sie trug ihr Sonntagsgewand, ein langes, schwarzes Kleid und ein kleines, schiefes, rosa Hütchen. »Bei uns hat eure Mutter die Nähseide gekauft. Und auch praktisch alle eure Anziehsachen. Ich kann mich gut an euch erinnern, ihr Rotznasen.«
Alle lachten. An der Ecke Missouri Avenue und Bigger Street stießen wieder Leute zu unserem Pulk hinzu. Eilten an die Spitze, um die Brüder aus der Nähe zu sehen, wagten es jedoch nicht, um Autogramme zu bitten. Einer der neu Hinzugekommenen trug einen breiten, beigen Cowboyhut und auf dem ausgewaschenen Bluejeans-Hemd den Sheriffstern. Er war unbewaffnet.
»Sie sind aber nicht von hier?« Ein zwölf-, dreizehnjähriger Junge, der neben mir einherschritt. Er trug eine Angel in der rechten Hand.
»… ich bin vor einem Monat hierher übersiedelt.«
»Ich hab Sie aber noch nie gesehen.«
Ich achtete seit dem frühen Morgen darauf, nicht aufzufallen, nicht als Fremder identifiziert zu werden. Hielt mein langes Haar unter einer Baseballkappe der New York Yankees versteckt. Trug meine gewöhnlichsten Kleidungsstücke, schwarze Jeans und ein graues, kurzärmeliges Hemd. Auch die Schuhe hätten abgetragener kaum sein können, ein Paar braune, ungeputzte Mokassins.
Einige Schritte weiter sprach mich die ältere Dame an, die zuvor für Gelächter gesorgt hatte: »Hey there, hi there, Sie sind aber nicht von hier, stimmt’s? Ich bin Eileen Murray. Und wer sind Sie?« Sie wirkte wie eine Schuldirektorin im Ruhestand.
Ich nannte ihr den ersten Namen, der mir in den Sinn kam: »Charles.«
»Charlie! Wie Chaplin! Und wie noch?«
»Webster. Charles Webster.« Es war der Name eines Mitschülers aus der High School, den ich nie besonders mochte und den ich immer dann nannte, wenn ich den eigenen Namen verschweigen wollte.
»Freut mich. Hört her, Leute, das hier ist Charlie Webster! Und von wo, wenn man fragen darf?«
»Ursprünglich … aus New York.«
»Tatsächlich! Von so weit her kommt selten jemand zu uns. Und Sie sind wegen Walt hier?«
»Nur zufällig … auf Durchreise …«
»Das ist aber ungewöhnlich. Hier kommt man doch nicht zufällig vorbei? Wir liegen doch fernab aller Durchgangsstraßen?«
Mir war die Aufmerksamkeit, die mir plötzlich zuteil wurde, denkbar unangenehm.
»Da haben Sie ja einen besonderen Tag erwischt, nicht wahr?«, fuhr Mrs. Murray fort. »Ausgerechnet am Schwimmbad-Einweihungstag sind Sie bei uns. Gratuliere!«
Ich nickte höflich.
Sie selbst, fuhr sie fort, sei achtzehn Jahre alt gewesen, als Walts Eltern aus Chicago nach Marceline übersiedelten. »Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, Mister Webster, wie manche Leute gehaust, in welchen Verhältnissen insbesondere Familie Disney einst gelebt hat. Diese Armut! Diese Einfachheit. Ohne Strom, versteht sich, und das Wasser mußte man aus dem Brunnen holen. Von einer Toilette im Haus keine Spur. Man hat alles im Freien erledigt, natürlich, auch im tiefsten Winter. Im hohen Schnee. Im Idealfall gab’s da eine kleine Holzhütte, wie sie in Walts frühen Filmen oft vorkommt. Amerika, das war damals so wie heute Afrika. Das vergessen die Nachkommen, kein Mensch denkt mehr an früher, wie es wirklich ausgesehn hat hier bei uns. In den großen Städten war’s natürlich anders, modern, etcetera. Aber dann kamen die Jahre der Depression, in den zwanziger und in den dreißiger Jahren. Unvorstellbar, Mister, ich weiß nicht, wie alt sind Sie denn?«
»Bald dreißig.«
»Dann haben Sie natürlich keine Ahnung, wie das früher war, als Stadtkind noch dazu. Mein Gott, New York! Sie müssen sich vorstellen, hier war in den Häusern früher alles voller Flöhe und anderem Ungeziefer. Wanzen, Mäuse, Ratten. Bevor Walts älteste Brüder weggelaufen sind von Marceline, Herbert, der unehrliche, und Raymond, der häßliche, lebten da sieben Menschen auf engstem Raum zusammen. Die fünf Kinder schliefen alle in einem Zimmerchen, wobei die ältesten da ja schon ausgewachsene Kerle waren. Unglaublich unangenehme Jungs übrigens, die beiden …«
»In welcher Hinsicht?«
»Frech, immer unzufrieden, streitsüchtig, halbe Ganoven.«
»Und Walt?«
»Reizend. Hilfsbereit. Lustig. Wissen Sie, was seine Lieblingsspeise war?«
»Keine Ahnung«, behauptete ich, obwohl ich die Antwort kannte.
»Seine Lieblingsspeise war der Apfelkuchen, den seine Mama gebacken hat. Der ganze Ort wollte Floras Apfelkuchen. Sie machte ihn aus den Äpfeln, die in ihrem Garten wuchsen …«
Ich mußte Mrs. Murray nicht erst bitten, mir die Schatztruhe ihrer Erinnerungen zu öffnen. Es bereitete ihr Freude, ihr Wissen um Walts Kindheit auszuplaudern: »Er war enorm begabt, hat als Sieben- und Achtjähriger schon so gut zeichnen können! Wenn er aus der Schule kam und seinen Eltern nicht gerade helfen mußte, bei den Haus- und Feldarbeiten, dann lag er unter der Ulme, Sie werden sie gleich sehen, da lag er stundenlang und hat die Tiere gezeichnet, die vorbeikamen, vorbeiflogen, vorbeihüpften, die Hühner und die Enten, die Heuschrecken, die Ameisen und die Eichkätzchen, die Raben, Hasen, Rehe, Opossums, Mäuse. Natürlich, Mäuse … Mein Gott, Mäuse!«
Vorn schritten Walt und Roy immer rascher, als versuchten sie nun doch, uns, die wir zugleich ihre Begleiter und ihre Verfolger waren, abzuschütteln. Es gelang ihnen nicht. Und als der Troß an der Ecke Missouri Street und Broadway ankam, war er auf ungefähr hundert Männer, Frauen und Kinder angewachsen.
»Das war die Farm!« Eileen Murray zeigte auf ein zweistöckiges, dunkelrot angestrichenes Holzhaus, auf das die Brüder Disney jetzt zugingen. Wie oft hatte Walt uns von der Farm in Marceline erzählt! Wie oft erwähnte er die Übersiedlung von Chicago nach Marceline. Sein Vater, ein arbeitsloser Zimmermann, hielt es in der Großstadt nicht länger aus. Vor allem aber verwandelte sich der zunächst kleinbürgerliche Bezirk, in dem die Familie lebte, im Nordwesten der Metropole, mehr und mehr zu einer von Zuhältern und Prostituierten frequentierten Gegend. Elias Disney befürchtete, seine ältesten Söhne, zu jener Zeit fünfzehn und siebzehn, könnten auf die schiefe Lebensbahn geraten, falls er sie nicht aus Chicago fortbrachte und mit der Familie aufs Land übersiedelte. Ein Onkel von Elias, Robert, und dessen Frau Margaret, hatten wenige Jahre zuvor in Marceline eine Farm erstanden, der Neffe zog ihnen nun nach, mitsamt Frau und Kindern, und wurde Erwerbsbauer.
Walt überquerte die Veranda seiner einstigen Wohnstätte. Er klopfte an der Eingangstür an. Die Besitzerfamilie öffnete ihm: Vater, Mutter und zwei halbwüchsige, übergewichtige Töchter. Eileen wies darauf hin, daß die Westfalls aus dem Nachbarort New Cambria stammten und den ehemaligen Disneybesitz, der ganz und gar verfallen war, vor wenigen Jahren samt kleinem, dazugehörigem Grundstück käuflich erworben, die Ruine wiederhergestellt und das umliegende Land wieder zu bestellen begonnen hätten. Ich sah, wie Walt den Westfalls die Stelle an der Südwand des Gebäudes zeigte, auf die er als Achtjähriger mit Teer ein Schwein gemalt hatte, zwölf Fuß breit, acht Fuß hoch. Das Bild entstand an einem Markttag, als seine Eltern nach Macon gefahren waren, um dort eine Muttersau zu kaufen.
»… als Vater und Mutter abends heimkamen«, es war das erste Mal seit zwei Jahren, daß ich seine weiche, melodiöse und zugleich tiefe Stimme wieder zu hören bekam, und sie ging mir, wie immer, durch Mark und Bein, »und mein Kunstwerk erblickten, das da die verdammte halbe Wand mit Teer bedeckte, gab’s natürlich unglaubliche Schläge. Auf den Hintern vom Vater. Und zwei Ohrfeigen von meiner Mutter.«
Die Brüder wurden aufgefordert, sich im Haus umzusehen, die Räume zu besichtigen, in denen sie einst gelebt hatten. Sie nahmen einen kleinwüchsigen, etwa sechzigjährigen Mann in ihre Mitte, der gleichsam aus dem Nichts aufgetaucht und Walt kraftvoll um den Hals gefallen war. Clem Flickinger, wie ich von Mrs. Murray erfuhr, der Nachbar aus jener Zeit, Walts Kindheitsfreund, mit dem er täglich spielte. Die Taylor-Buben, John und Fred, seine anderen Spielkumpane, waren längst fortgezogen. Ruth, Walts jüngste Schwester, die sich als Dreijährige in den achtjährigen John Taylor verliebt hatte, war 1950 nach Marceline zurückgekehrt, auf der Suche nach ihrem Kindheitsschwarm. Doch er lebte nicht mehr hier, es hieß, er sei am 6. Juni 1944 in Frankreich gefallen, als einer der ersten Invasionssoldaten, die an der Küste der Normandie gelandet waren.
»Clem hat Walt das Fischen beigebracht, mit bloßen Händen«, raunte mir Eileen zu. »Die beiden sind nur ein paar Monate auseinander, Jahrgang 1901. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Baum, mögen Sie? Während die Buben im Haus sind … Sie wundern sich, Mister Webster? Sind für mich immer noch Buben, daran hat sich doch nichts geändert.« Sie führte mich dreißig Schritte weiter, den Broadway entlang, der nicht breiter war als ein Feldweg. Da stand, inmitten der Wiese hinter der Farm, eine uralte, mächtige Ulme. Ich ging auf sie zu, betastete ihre rissige graue Rinde, berührte den Stamm und griff nach den im Wind zitternden Blättern.
»Da lag er, hier, ich sehe es noch ganz genau vor mir, auf dem Bauch lag er, mit Stiften und Papier, irgendwelches rauhes Packpapier war das, weil so schönes weißes Papier hat ja kein Mensch hier besessen, und da lag er ausgestreckt und hat gezeichnet, gezeichnet, gezeichnet, mein Gott, stundenlang, stundenlang, mein Herr.«
Ich trug eine kleine Kodak Instamatic bei mir, holte sie hervor, streckte den Arm aus, photographierte mich selbst vor dem Hintergrund einer Stelle des Stammes, die wie das Getriebe einer mächtigen Zahnrad-Apparatur aussah, die Baumrinde bildete zehn längliche Zacken in Kreisform, seltsam gleichmäßig aneinander- und übereinandergereiht.
»Mir scheint, Sie interessieren sich ein bißchen für Walt?«, rief meine Begleiterin aus. »Das hätten Sie mir doch sagen können, daß Sie ein Photo von sich haben möchten unter Walts Nachdenkbaum, unter seinem Bauchnabelbaum, wie ich ihn immer nenne, weil er hier auf dem Bauchnabel lag und malte und zeichnete. Mein Gott, das hätte ich doch für Sie geknipst!«
Ich machte von ihr ein Bild, sie lachte, den Blick auf die Erde gesenkt, rief: »Nicht doch, nein, bitte nicht!«, und freute sich.
Von diesem Baum hatte Walt uns nie erzählt.
Ich zerrieb ein Blatt zwischen meinen Fingern, sog seinen bitteren Duft tief ein. Riß einen kleinen Ast mitsamt den Blättern ab, verstaute ihn in meiner Jackentasche. Ich sah einen Quell entspringen, direkt neben den Baumwurzeln, ein schmaler Bach floß in Richtung der offenen Felder.
Mrs. Murray konnte nicht ahnen, in welchem Ausmaß ihre Worte mich elektrisierten, meine Neugierde immer weiter anstachelten. Und sie genoß es offensichtlich, mich, den einzigen Besucher von Auswärts, in ihre Obhut genommen zu haben.
»Auch die Sache mit der Eule weiß außer mir fast niemand, Mister Webster«, fuhr sie fort. »Clem kennt die Geschichte, ja, vielleicht. Aber keiner sonst. Wollen Sie sie hören? Walt lag hier, eines Sonntags, wie immer, dachte nach, was das Leben sei, und zeichnete, da hörte er plötzlich den Ruf einer Eule, unmittelbar über sich, hier, in diesen Ästen. Ein Bruder seines Vaters, den er sehr liebte, kam oft zu Besuch, der hatte keinen festen Wohnsitz, lebte hier und da, verschwand, kam wieder. Walt nannte seinen Onkel Elf, weil er wirklich wie ein guter Kobold war, und Elf hatte Walt immer gewarnt, Eulen seien Todesboten. Wer eine Eule vor seinem Fenster rufen höre, müsse am nächsten Tag sterben. Er sprang auf, so rasch, daß die Eule nicht mehr fortkonnte, er erwischte sie an den Füßchen. Wie es geschrien haben muß, das arme kleine Wesen, als er es würgte und zu Tode trampelte. Dieses Heulen, mein Gott, dieses Fauchen! Walt bekam schreckliche Gänsehaut, auf dem Rücken, auf dem Nacken und auf der Schädeldecke. Und dann begrub er es, das arme Käuzchen, hier, tief unter diesem Baum. Ich kann Ihnen die Stelle zeigen, da, genau da, direkt neben der Quelle … Merkwürdig, die Geschichte, finden Sie nicht? Denn Eulen zählen ja wirklich zu den mörderischsten Feinden der Mäuse, die es – neben den Katzen vielleicht – überhaupt gibt, nicht wahr?«
Walt und Roy traten aus dem Haus, Clem Flickinger und Familie Westfall begleiteten sie. Die Gruppe bewegte sich unmittelbar auf die Ulme zu.
»Sehen Sie, Mister Webster, diese freie Stelle, wo die Buben jetzt stehen bleiben, da befand sich die Scheune, die war so hübsch, dort hat Walt sein erstes Geld gemacht. Er hat die Enten und die Hasen und die kleinen Schweinchen in Kleidchen gesteckt, in so komische wollene Höschen und Hemdchen, das sah unglaublich blöde und lustig aus. Dann ließ er die Leute hereinkommen und hat jedem ein paar Cents abverlangt, auch mir natürlich. Ich war wohl die Älteste in seinem Publikum. Er hat dann, lese ich in den Zeitungen, vor ein paar Jahren die ehemalige Scheune in seinem Garten in Los Angeles nachbauen lassen, ganz exakt, nach alten Photos. Ein Stück Marceline, das er immer um sich hat …«
Ich ging rückwärts, bis ich wieder mit der Schar der Mitläufer verschmolz, die inzwischen auf der Wiese eingetroffen war.
»Ah, der Fremde – immer noch unter uns?«, rief der Junge mit der Angel, dem ich zuvor aus dem Weg gegangen war. Er winkte mir zu, froh, mich wiederzusehen.
»Michael, mein Enkel«, klärte Mrs. Murray mich auf, »ein süßer, kluger Kerl, so stelle ich mir Walt im selben Alter vor …«
»Großmutter, der Herr sagt, er wohnt seit einem Monat in Marceline. Das stimmt doch gar nicht, oder? Wir würden ihn doch kennen?«
Mrs. Murray schmunzelte. »Wir sind ein homogenes Völkchen, hier in Marceline. Kein Neger unter uns, kein Mensch aus Asien, kein Indianerabkömmling, Gott sei Dank. Wir wissen doch sofort, wer hier dazugehört und wer nicht. Trägt hier irgendeiner eine Baseballkappe der Yankees? Na eben!«
Der Junge freute sich: »Wie Pastor Brown immer sagt: Lügen haben kurze Beine.«
»… ein Mißverständnis …«, murmelte ich.
Walt umfaßte jetzt den breiten Stamm der Ulme, umarmte ihn, er preßte die Schläfe fest an die Rinde, so fest, daß seine Wange nach oben verrutschte, ihm das Auge halb zudrückte. Ich hatte ihn in all den Jahren, die ich ihn kannte, nie ähnlich zärtlich erlebt wie in dieser halben Minute. Dann ließ er los, wischte sich zunächst die Backe ab, richtete sich die Krawatte, strich sich über das Jackett, auf dem Partikel der Baumrinde hängen geblieben waren. Und dann versanken seine Hände in den Hosentaschen.
»Er sucht nach einer Münze«, flüsterte Mrs. Murray mir zu, »bei uns ist es Brauch, ein Geldstück in eine Quelle zu werfen. Das bringt Glück … Riesenglück.«
Er betrachtete eine ganze Weile lang seinen Handteller. Und rief dann, so laut, daß alle ihn hören konnten: »Kein Penny darunter. Bloß Nickels, Dimes und Quarters …!« Und ließ das Geld in die Hosentasche zurückklimpern.
Walt streckte die Arme aus, zeigte auf die Felder jenseits des Grundstücks: »Dort unten, beim Teich«, sagte er, »das war die Stelle, an der ich immer auf Porker, der Muttersau geritten bin. Sie ließ mich aufsteigen, kein Problem, ich ritt auf ihr, gute zwanzig, dreißig Yards. Bis der Punkt kam, immer genau derselbe Punkt vor dem Schlammtümpel, wo sie mich abwarf! Ich habe dieses Schwein zu meinem Lieblingstier erkoren, und ich weiß ganz sicher, daß sie jedes Wort verstanden hat. Sie war unglaublich klug. Ich konnte meinen Vater dazu überreden, sie nicht zu schlachten. Unser Spiel ging so lange weiter, wie ich hier lebte: Aufsitzen, Reiten, Abgeworfenwerden … das schönste Spiel meines Lebens.«