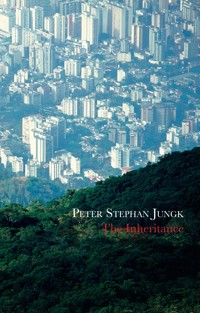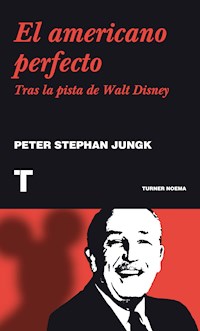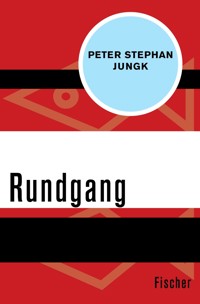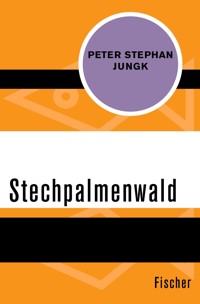11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daniel Löw, ein in London lebender, deutschsprachiger Dichter, hat von seinem Onkel ein beträchtliches Erbe zugesprochen bekommen, das man ihm abspenstig machen will. In einer Verfolgungsjagd, die ihn über Caracas und Miami bis nach Panama führt, kämpft Löw verzweifelt um seine Erbschaft ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Peter Stephan Jungk
Die Erbschaft
Roman
Über dieses Buch
Daniel Löw, ein in London lebender, deutschsprachiger Dichter, hat von seinem Onkel ein beträchtliches Erbe zugesprochen bekommen, das man ihm abspenstig machen will. In einer Verfolgungsjagd, die ihn über Caracas und Miami bis nach Panama führt, kämpft Löw verzweifelt um seine Erbschaft ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561768-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dies ist ein Roman. [...]
Für Luc Bondy
Wir leben zwar in [...]
Quitt rennt mit dem [...]
1 Lärm
2 Ankunft
3 Esther Moreno
4 Albacea
5 Zimmer 1813
6 Simone von Oelffen
7 Erste Hilfe
8 Rotes Fleisch
9 Die Bauchtasche
10 Meran
11 Der Friedensrichter
12 Nachmittagsspaziergang
13 Daniel in der Löwengrube
14 Vor Gericht
15 Pension Wagner
16 Vierzig Grad im Schatten
17 Panama City
18 Eldorado
19 Wir haben Geschichte gemacht
20 Das Verhör
21 Madurodam
22 Gebetsriemen
23 Miami
24 Samsons Kreditkarte
25 Der Wunderrabbi
Die Gedichte ›Spaziergang‹ und [...]
Dies ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit natürlichen oder juristischen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Luc Bondy
Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, fast mehr als mich selbst. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gefühlsweichheit und unberechenbare Verrücktheit – nur daß Fortuna meinen Onkel zum Millionär und mich zum Gegenteil, das heißt, zum Dichter gemacht hat.
Heinrich Heine
Quitt rennt mit dem Kopf gegen den Felsquader. Er steht wieder auf und rennt noch einmal gegen den Felsen. Noch einmal steht er auf und rennt gegen den Felsen.
Peter Handke,
Die Unvernünftigen sterben aus
1 Lärm
Helikoptergeknatter wirbelt ihn aus tiefen Träumen.
Auf dem Nachttisch die roten Ziffern eines elektrischen Weckers – es ist 05:33.
Er steht auf, schiebt den schweren Kunststoffvorhang zur Seite. Sieht aus dem zwölften Stockwerk auf die Stadt und in den bedeckten, noch dunklen Novemberhimmel.
Eine Düsenjägerstaffel donnert über das Hotel hinweg. Der Überschallknall der Maschinen läßt das Fensterglas nachzittern. In diesem Land sind Übungen der Luftwaffe nichts Ungewöhnliches. Er schließt den Vorhang. Achtet darauf, keinen Spalt zu belassen, sonst strömte da nach Sonnenaufgang Tageslicht herein. Im Badezimmer entnimmt er dem Necessaire die Schachtel Quies, befreit zwei Wachsbällchen vom Watteflaum, der sie umgibt, schiebt sie tief in die Ohrmuscheln.
Er schläft ungestört, bis acht Uhr. Zieht die rosa Wachskugeln aus den Ohren. Schaltet mit der Fernbedienung das Televisionsgerät ein, nicht aus einem bestimmten Grund. Zur vollen Stunde verkündet die Sprecherin eines planetweit ausgestrahlten Senders, in Caracas, Venezuela, sei vor wenigen Stunden ein Militärputsch gescheitert. Die Regierung habe die Lage wieder in der Hand.
Er springt aus dem Bett, durchquert das verdunkelte Zimmer. Reißt den Vorhang auf, sieht auf die sonnenüberflutete Stadt.
Drei der vier staatlichen Fernsehkanäle sind außer Funktion. Das intakte Programm überträgt eine Wetterkarte mit den zu erwartenden Mindest- und Höchsttemperaturen des Tages.
Der Reisende rüttelt an dem Fenstergriff, obwohl er seit seiner Ankunft vor vierzig Stunden wiederholt einsehen mußte, daß sich das Fenster nicht öffnen läßt.
Er kleidet sich an. Entdeckte am Vortag in der Nachbarschaft des Hotels eine Espressobar. In der Gesellschaft einer Schar erdkrustenbedeckter Bauarbeiter, die einen Tunnel für eine neue Untergrundbahnlinie gruben, trank er einen der wohlschmeckendsten Kaffees seines Lebens.
Er wendet sich, als er den Schlüssel abgibt, an den Concierge: »Alles vorbei, nicht wahr?«
»Nein, Señor, keineswegs …«
Er denkt: Der Concierge irrt. Und tritt durch die Drehtür auf die palmengesäumte Straße. Schwüle Nässe legt sich an den Körper an. Er geht auf das Arbeitercafé zu. Die Rollbalken sind heruntergelassen. Die Baustelle ruht. Detonationsgeräusche sind zu hören, die nicht von fernher kommen. Die Türen eines Kleinwagens stehen weit offen. Eine Gruppe Passanten umringt das geparkte Fahrzeug. Aus dem Autoradio peitschen die rabiaten Stimmen zweier Nachrichtensprecher.
Im neonhellen Gang einer Gaststube werfen aufbrausende Männer in kurzärmeligen Hemden einander Wortbrocken zu. Es riecht nach altem Speiseöl und gebratenem Fisch. Der Wirt preßt ein Transistorradio an die Schläfe. Der Fremde, das Hemd durchgeschwitzt, bestellt einen pequino. Der Wirt hebt den Kopf nicht vom Radiogerät.
Nachdem er den schmerzhaft bitteren Kaffee mit einem Schluck ausgetrunken und ein ranziges Stück Sandkuchen verschlungen hat, kehrt er auf die Straße zurück.
Er will die Untergrundbahn nehmen. Die Station an der Plaza Venezuela ist mit Gittern verbarrikadiert. Er fragt einen, der zwei Gepäckstücke schleppt, wo sich die nächste Busstation befinde, er müsse zur Avenida Urdaneta. Alle zehn Schritte legt der kräftige Träger eine Erholungspause ein. »… hoy?! No bus!«
In der Mitte der Plaza wartet der Fremde auf das Ungewisse. Zwei Helikopter kreisen über seinem Kopf. Ein Taxi bleibt stehen, der zigarillorauchende Chauffeur lehnt aus dem Fenster, fragt, wohin er denn möchte. Er gibt sein Fahrtziel an, mit der Untergrundbahn fünf Stationen entfernt. Der Fahrer nennt den Preis: »Hundredandtwentydollars.« Er sieht nicht ein, warum er für die kurze Strecke mehr als zehn Dollar ausgeben soll, trotz der besonderen Bedingungen des Tages.
Am Vorabend hatte er für diesen Morgen ein Treffen mit dem Testamentsvollstrecker seines im einundneunzigsten Lebensjahr verstorbenen Onkels vereinbart. Er überlegt, zu Fuß zum Treffpunkt, der Import-Exportfirma Kiba-Nova vorzudringen, wo Julio Kirshman auf ihn wartet. Detonationen erfüllen die Luft. Er beschließt, zunächst vom Hotelzimmer aus anzurufen, den Testamentsvollstrecker zu bitten, ihr für neun Uhr dreißig angesetztes Gespräch zu verschieben bis die Lage sich geklärt habe.
Es war unvernünftig gewesen, den Reisepaß im Tresor der Firma Kiba-Nova zu hinterlegen, doch Kirshman, Juniorchef und Miteigentümer des Import-Exporthauses, hatte ihn gewarnt: Amerikanische und Europäische Pässe seien die Lieblingsobjekte der Ganoven dieser Stadt, sein Ausweis ein Vermögen wert. Er könne durchaus auch aus dem Tresor einer Hotelrezeption geraubt werden. Nur im Safe der Firma befinde sich das Dokument in Sicherheit.
Als er in sein Zimmer zurückkehrt, läutet das Telephon. »Herr Löw? Dr. Johannes am Apparat.« Der Anwalt, der ihm vom österreichischen Konsulat empfohlen worden war und an den er sich vierundzwanzig Stunden zuvor erstmals gewandt hat. »Verlassen Sie auf keinen Fall das Hotel«, warnt Friedrich Johannes. »Hat Kirshman Sie denn nicht angerufen? Im Augenblick bombardiert eine Einheit der Putschisten den Präsidentenpalast. Es gibt schon fast hundert Tote. Sie tragen Ihren Paß hoffentlich immer bei sich? Selbst im Hotel! Ich rufe Sie später nochmals an.«
Ein Blick aus dem Fenster. Alles scheint ruhig. Es ist zehn Uhr morgens. Er wartet ab, ob Kirshman sich bei ihm melde. Wie würde der Testamentsvollstrecker, der gute Freund seines Onkels, sich verhalten?
Daniel Löw hockt im Türkensitz auf dem breiten, weichen Bett, hält das Notizbuch aufgeschlagen. Er nimmt sich vor, Luft und Farben dieses Tages, die Lage auf den Straßen und die in der Stadt gleichsam antastbare Furcht in Worte zu kleiden. Es gelingt ihm nicht.
Kirshman ruft nicht an.
Dr. Johannes ermahnt ihn zwei Stunden später erneut, das Hotel keinesfalls zu verlassen. Daniel erwähnt, vom Testamentsvollstrecker weiterhin keine Nachricht erhalten zu haben.
»Das überrascht mich nicht. Was habe ich Ihnen gestern abend gepredigt?« entgegnet der Anwalt. »Haben Sie sich überlegt, ob Sie mich mit dem Fall Löw gegen Kirshman beauftragen wollen?«
»Ich bitte Sie … um etwas Geduld.«
Um ein Uhr ruft Löw im Büro der Firma Kiba-Nova an. Eine weibliche Tonbandstimme verkündet die Öffnungszeiten des Unternehmens: Montag bis Freitag, acht Uhr dreißig bis achtzehn Uhr dreißig, ohne Mittagspause. Er sucht in seinen Unterlagen nach Kirshmans Privatnummer. Julio hebt ab: »Na, was sagste?! Wie’s da drunter und drüber geht, bei uns im Land, haste schon gehört?«
»Ja, habe ich gehört.«
Sie sprechen Deutsch: Kirshmans und Löws Muttersprache. Julio kam 1948 in Caracas, Daniel 1954 in Wien zur Welt.
»Biste noch da?« fragt Kirshman.
Daniel antwortet nicht.
»Ja, dann müss’n wir zwei beiden das dann halt alles morg’n erledig’n«, sagt Julio. »Morg’n wird’s ja hoff’ntlich vorbeisein mit’n Schießerei’n …?«
2 Ankunft
Alexander Stecher Bravos einziger Verwandter, von Jacob Löw, Daniels Vater abgesehen, war nach Caracas gekommen, um mit Julio Kirshman noch offene Fragen der Erbschaft zu klären. Er hatte Flugnummer und Landezeit der aus New York eintreffenden American-Airlines-Maschine schriftlich vorangekündigt.
Niemand nahm ihn am Flughafen Maiquetía in Empfang. In der Ankunftshalle umringten ihn selbsternannte Wohltäter, rissen ihm den Koffer aus der Hand, boten ihm unüberbietbare Wechselkurse an, versprachen Hotel-, Stadtrundfahrts-, Bordellbesuchsvergünstigungen. Es gelang ihm nur mit Mühe, Helfer und Bittsteller zu vertrösten, andere zu verjagen, bevor er im Rücksitz eines raumschiffgroßen Dodge Polara, Baujahr 1966 versank. Die Fahrt zum Hotel dauerte eine Stunde. Sie führte an Urwaldhügeln entlang und durch halbkilometerlange, unbeleuchtete Tunnels. Er kam an Vorstadthütten vorbei, aus Wellblech und einem Sammelsurium an Materialien, Farben, Formen errichtet, Kleinbauten, die sich zur Stadtmitte hin schiefwinkelig verdichteten. Es wunderte ihn, wie robust sie zu sein schienen angesichts ihrer Zerbrechlichkeit. Tankstellen, Automobilreparaturwerkstätten, Busdepots, Erdölpumpen im Umfeld der Metropole.
Die Wolken ähnelten glänzender Steinkohle.
Er meldete sich, nachdem er Zimmer 1244 bezogen hatte, bei Kirshman zu Hause. Es war Sonntag nachmittag, sechzehn Uhr. Eine Angestellte ließ ihn wissen, Señor Julio sei in der Firma zu erreichen.
»Ah!« Der Testamentsvollstrecker klang überrascht, »biste schon da? Biste erschöpft? Willste morgen herkommen?«
Der Flug von New York nach Caracas hatte ihn keineswegs ermüdet. Er sah keinen Grund, warum er nicht umgehend aufbrechen sollte.
»Also: Dann kommste gleich. Nimmst die Untergrundbahn. Linie B. Sieh dich vor Tasch’ndieb’n vor, die lauern dir hinter jeder Ecke auf!«
Er fand mühelos zur Cuji a Romualda, unweit der Metrostation Avenida Urdaneta, sie lag inmitten eines Fußgängergassengeflechts voller Stoffläden, Billigkleidungs-, Teppichgeschäften. Alles hatte geschlossen. Hohe, weiße Metalltüren grenzten das Kiba-Nova-Firmengebäude von der Straße ab. Löw beobachtete drei Arbeiter, deren laute Stimmen die Sonntagsruhe durchbrachen, sie luden Waren auf und ab, riefen einander Schimpf- und Scherzworte zu.
Dann trat er ein.
Hinter einem festtafelbreiten Tisch thronte ein schwergewichtiger, kleinwüchsiger alter Mann, die Hände in den Hosentaschen vergraben, eine erloschene Zigarrenhälfte zwischen den Lippen. Er erhob sich nicht. Er signalisierte ihm mit der Kinnspitze, sich zu setzen. Sie reichten sich nicht die Hände.
»Da bist du also!« Rauch, Husten, Atemnot schwangen mit. Er stieß die kalte Zigarre von Mundwinkel zu Mundwinkel. »Hast uns ja einen schönen Dreck hingeschissen!«
Daniel stand auf: »So kommen wir nicht weit.«
»Setz dich, Herr Oberlehrer, nur mit der Ruhe, ’s war nicht so gemeint!«
Sie schwiegen.
In den Hosentaschen rammte Konrad Kirshman seine langen Fingernägel in die Handteller.
Der Fremde sah sich um. Auf Regalen stapelten sich halbgeöffnete Kartons und Dutzende aufgerissener Schachteln, noch vollgepackt mit Ware aus Asien, Europa, aus Nord- und Lateinamerika.
Im Hintergrund knarrte eine Tür. Ein drahtiger Mensch, militärisches Kurzhaar, glatt rasiert, Mitte vierzig, schritt in den Erdgeschoßraum, als trete er, tuschbegleitet, auf einer Varietébühne auf. Er ging federnd auf den Besucher zu, jovial, gut gelaunt: »Endlich lern’n wir dich kenn’n!« Sie gaben sich die Hand. »Ich bin der Julio. Mit meinem Herrn Papa hast du schon Bekanntschaft gemacht?«
Daniel hatte seinen zuletzt veröffentlichten Gedichtband mitgebracht, überreichte Julio das schmale Büchlein mit dem schwarzen Einband. Der Beschenkte warf einen Blick darauf und verstaute es in einer Schublade des riesigen Schreibtisches, die er doppelt verschloß. In dem Moment, in dem die tiefe Lade offenstand, erkannte Löw, daß sie bis zum Rand mit Banknoten angefüllt war.
Julio wandte sich an seinen Vater. »Läßte uns bitte allein?«
»… Geheimnisse?! Vor mir, Kerlchen?«
»Läßte uns bitte allein?«
Der Achtzigjährige stand langsam auf, torkelte zum Ausgang, die Hände in den Hosentaschen, bellte den dort herumlungernden Arbeitern im Hinausgehen Befehle zu.
»’tschuldige ’s Benimm meines Vaters, ich hab’s gehört, was er vorhin zu dir … ’s war sicher nicht so gemeint.«
Löw studierte Julio Kirshmans Angesicht. Es erschien ihm entspannt, gleichsam milde im Vergleich zu der dem Vater ins Auge gezeichneten Niedertracht.
Julio, seinerseits, betrachtete Daniel. Der hochgewachsene Besucher mit dem schwarzen, schulterlangen Haar und den feinen, blassen Gesichtszügen wirkte durchaus anders, als er ihn sich vorgestellt hatte. Zu Besuch bei Stecher ließ er sich nicht selten Photos des Neffen zeigen. In der Realität wirkte Löw selbstsicherer, erwachsener, um vieles seriöser, als in Kirshmans Imagination. Des Fremden Auftreten hatte etwas sonderbar Feierliches an sich, eine Ausstrahlung, die es nicht ohne weiteres zuließ, mit Stecher Bravos Verwandten umzuspringen, wie es einem beliebte. Er hatte Daniel mit »Du« angesprochen, überlegte jetzt, sekundenlang, ob es sich nicht eher ziemte, fortan per »Sie« mit ihm zu konversieren.
»Also: Willste das Lager seh’n?« fragte der Testamentsvollstrecker und rang sich zur Du-Form durch.
Er führte Löw von Stockwerk zu Stockwerk, zeigte ihm sportfeldgroße Flächen, vollgeräumt mit Import-Export-Ware. Die erste Etage beherbergte Gitarrensaiten und Baseballschläger aus Taiwan, die zweite Scheren, Nagelfeilen und Messer aus Solingen, die dritte Kindergeigen, Hammondorgeln, Pingpongbälle aus Südkorea, die vierte Tischtennistische, Porzellanengel, Angelhaken und Taschenrechner aus Rotchina, die fünfte, sechste, siebente immer neue, bunte, vielförmige Artikel aus fünf Kontinenten. In der achten Etage roch es, kaum merklich, nach Zigarrenrauch. »Na warte! Wenn ich den erwische, der es wagt, hier zu paff’n«, fluchte Kirshman, »zwisch’n den Fischer- und Schmetterlingsnetzen! Den knüpf’ ich am nächst’n Latern’pfahl auf!«
Ein behäbiger Transportfahrstuhl brachte sie ins Parterre zurück. »Und da glaubste im Ernst, wennste das geseh’n hast, daß wir hab’n dir was wegnehm’n woll’n? Wir ha’m genug, wir brauch’n nicht das Geld vom Alexander selig.«
»Um so mehr überrascht es mich, daß Sie mir bisher nicht geben wollten, was mir zusteht«, der Erbe sprach friedfertig wie einer, der die milde Güte einer Havannazigarre preist.
»Mach’ dir bloß keine Sorg’n! Alles wird in bester Ordnung abgewickelt werden. Auf Heller und Pfennig! Mußt auch nicht so piekformell mit uns sein, sagst einfach ›Du‹ zu uns, wir sind ja fast Familie: Papa und dein Onkel sind doch die dickst’n Freunde geblieb’n, fünfzig Jahre lang! Willste jetzt die Wohnung seh’n?«
Sie fuhren in einem schwarzen Jeep mit Vierradantrieb zur Avenida Altamira, im Stadtteil San Bernardino, parkten vor dem Hochhaus, in welches Stecher Bravo zwanzig Jahre zuvor übersiedelt war. Ein Grundstück am Stadtrand, auf dem einst sein hübsches, einstöckiges Häuschen stand, inmitten eines Mangohains, hatte Stecher der Stadtverwaltung für hohe Dollarsummen abgetreten, kaufte sich von einem Bruchteil der Einnahmen die Neubauwohnung.
Im zwölften Stockwerk läuteten sie an der Tür links vom Fahrstuhl. Sie hatten nicht angerufen, sich nicht angemeldet. Eine hohe Stimme fragte: »Quién es?« und Kirshman entgegnete: »Yo, Julio!« Erst, nachdem der Testamentsvollstrecker hinzugefügt hatte, in Begleitung des Neffen von Señor Stecher Bravo zu sein, ging die Tür einen Spalt weit auf. Und dann ließ die Bewohnerin die beiden Männer ein, hielt sich zunächst am Türrahmen fest. Stecher habe ihr oft von ihm erzählt, versuchte die altersgebeugte Frau Daniel begreiflich zu machen. Der Onkel hatte ihm nicht selten von Perpetua, seiner treuen Angestellten der vergangenen fünfunddreißig Jahre gesprochen und sie in seinen Briefen wiederholt beschrieben. Er erriet den Inhalt ihrer Wortkaskaden.
Neben dem Kühlschrank lagen Alexanders schwarze Lederhandschuhe auf einem brüchigen Holzstuhl, und ein farbiger Reklameprospekt der Kurstadt Meran.
Julio führte ihn weiter, in den Salon. Es war später Nachmittag. Kirshman eilte auf die Terrasse, beugte sich über das Geländer, um nachzusehen, ob sein Wagen noch nicht aufgebrochen oder gar gestohlen worden sei. Daniel folgte ihm hinaus, in die Abenddämmerung. Es roch nach den süßen Blüten der Tropenbäume. In den umliegenden Hochhäusern, auf den Straßen und Boulevards gingen die Lichter an. Ein Vogelschwarm zog in großer Höhe vorbei. Hundert Flügelpaare tanzten im Gleichflug.
»Lang könn’ wir da nicht bleib’n«, sagte Kirshman, »sonst is’ mein Jeep weg.«
Sie kehrten in den Salon zurück. Die Möbelstücke, in deren Mitte Stecher mehr als fünf Jahrzehnte gelebt hatte, seit seiner Emigration aus Hamburg, ohne sie je zu erneuern: schiefe Tische, abblätternde Tapeten, von der Sonne gebleichte Bibliotheksstellagen. Die Chaiselongue, im Sommer 1940 erstanden, von den letzten Ersparnissen. Ein dunkelbraunes Radiogerät aus den fünfziger Jahren, R.C.A., made in U.S.A. Kein Televisionsapparat. Die Sofas und Fauteuils, mit grobem Stoff überzogen, an mehreren Stellen abgestoßen, zerschlissen. Perpetua wies auf den grauen Armstuhl hin, in dem Alexander in den Jahren vor seinem Tod jeden Tag zugebracht habe. Auch als Neunzigjähriger ließ er, erzählte sie, niemals von seinen Büchern, die Beine beim Lesen auf dem roten Lederhocker ausgestreckt. Löw setzte sich in den Fauteuil, streckte die Beine auf dem Hocker aus. Wie sonderbar, dachte er da, in den Möbeln meines Onkels zu sitzen, in der Wohnung zu stehen, die sein Zuhause war, jahrzehntelang. Erstmals zu Besuch in jenen Räumen, in denen mich Alexander sehnsüchtig erwartet hat, nie bin ich zu ihm gereist, sooft er mich auch eingeladen hat. Perpetua wischte mit der rauhen Außenfläche ihres Daumens eine Träne fort.
Julio nahm zu seiner Rechten Platz. »Hier«, er räusperte sich, »hier bin ich immer gesess’n, neb’m Alexander selig, bei mei’n Besuch’n, ich war der einzige, den er seh’n wollte, den er zu sich ließ, in’n letzt’n Jahr’n, dein Onkel – mich hat er um Hilfe gebet’n, mich hat er angeruf’n, mitt’n in der Nacht, weg’n jeder Kleinigkeit, ich soll zu ihm komm’n, weil er Angst hat. Angst vorm Tod, Angst vor der Nacht. Er wollte nur mich. Stocktaub war er. Hat sich aber geweigert, den Hörapparat reinzutun. Man mußte ihn anbrüll’n, Wort für Wort. Und wo warst du in dieser Zeit? Biste je zu Besuch gekomm’n? Von weg’n! Daß aber du jetzt die Wohnung erb’n wirst, das haste nur mir zu verdank’n, Daniel Löw, er wollte die Wohnung nämlich der Perpetua vermach’n, nich’ dir!«
Kirshman lief auf die Terrasse, schleuderte den Oberkörper über die Brüstung. Kam in den dunklen Raum zurück, den Kopf vorgestreckt wie ein Kampfstier. Schaltete eine Stehlampe ein. Und setzte sich an dieselbe Stelle wie zuvor: »Jetz’ gibt’s noch das Problem mit Perpetuas Enkelin, in die war unser Sascha, ich hab’ ihn immer Sascha genannt, den Alexander, in die war er verliebt, seit sie neun, zehn Jahre alt war, sie sagt, die Wohnung steht ihr zu, er hat sie ihr versproch’n, lügt das Luder, und sie hat nach sein’m Tod gleich das Zimmer hinter der Küche bezog’n. Die Manuela hat ja von dei’m Onkel auch den klein’n gelb’n Chevrolet, Baujahr ’62, geerbt, wie’s im Testament bekanntlich vermerkt ist, jedenfalls hat sie nach sein’m Tod alle Schlösser ausgewechselt und die Telephonleitung’n durchgeschnitt’n und Voodoo getrieb’n, hier in der Wohnung. Da war alles voll von ausgetret’nen Zigarr’nstumm’ln auf ’m Parkett. Die kleine Manuela aus der Wohnung rauszubekomm’n, ha!, daran wirste dir noch die Zähne ausbeiß’n.«
Perpetua schloß das Zimmer ihrer neunzehnjährigen Enkelin auf. Sie war an den Küstenort Maracaibo gefahren, kam erst in einer Woche wieder. Der Raum roch kräftig nach Weihrauch. Jesus-, Maria- und Engelsbilder schmückten die schmutzigen Wände, der Boden sah ruß- und blutverschmiert aus. In einer Ecke stak ein Dutzend beigeweißer Hühnerknochen in zwei verbeulten Kochtöpfen.
»Siehste? Voodoo!« Julio eilte quer durch die Wohnung, hinaus auf die Terrasse.
Sie nahmen Abschied von Perpetua. Die Haushälterin reichte Daniel beide Hände. Er küßte ihre eingefallenen Wangen. Holzähnlich fühlten ihre entzündeten Handteller sich an, eine Spätfolge der Pflege, die sie Stecher hatte angedeihen lassen. An Füßen und Beinen hatte er Pilze entwickelt in den Monaten vor seinem Tod. Perpetua bekam davon Ekzeme, wurde sie nun nicht mehr los.
Julio setzte Daniel vor dem Hotel Presidente ab. Er bat ihn nicht zu sich nach Hause. Er stellte ihn seiner Frau und seinen drei Kindern nicht vor. Riet ihm nicht, wohin er an diesem Abend Essen gehen sollte. Zum Abschied sagte er: »Jetzt biste aber müde!« Rollte das Fenster auf, nachdem Löw ausgestiegen war: »Wohnste ja gar nicht so schlecht hier? Kostet doch ’ne Stange Geld hier? Morg’n um elf biste bei mir im Büro, da bring’n wir dann alles unter Dach und Fach.«
3 Esther Moreno
Niemand darf das Hotel mehr verlassen. In der Halle des Presidente, nahe dem Eingang zum Restaurant, hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Daniel schließt sich den Gestrandeten, den bleiern Vorwärtstapsenden an. Er hört ihren Gesprächen zu: Versäumte Abflüge, verschobene Weiterreisen, stornierte Geschäftstermine. Ein Kapitän, dessen Kreuzfahrtschiff im Hafen La Guaira vor Anker liegt, kann nicht zu seiner Mannschaft zurück. Eine Augenspezialistin, am nächsten Morgen dringend in ihrer Klinik in Los Angeles erwartet, hat alle Operationen der kommenden Tage absagen müssen.
Daniel erscheint es unerträglich, weiterhin wie Vieh auf Fütterung zu warten. Er kehrt in sein Zimmer zurück, hängt sich zwei Frotteetücher um. Durchquert dann im Keller einen langen Gang, erreicht das Terrain des Schwimmbassins. Die Wasseroberfläche regt sich nicht. Das Becken ist menschenleer. Liegestühle, Sonnenschirme glänzen matt im Licht. Es riecht nach Chlor und Hitze.
Er gleitet in das Wasser. Er fühlt sich geborgen in einem Schwimmbecken. Er schwimmt auf dem Bauch, wiederholt immer nur die einfachen, perpetuellen Arm- und Beinbewegungen, wie er sie mit acht, mit neun Jahren erlernt hat, unter der Jahrhundertwende-Kuppel des Wiener Diana-Bades, das es längst nicht mehr gibt. Er schwimmt mit Ausdauer von Beckenrand zu Beckenrand, und immer so fort. Über seinem Kopf ragen zwanzig Stockwerke in den Himmel. Im Hotelpark knarren die Palmenstämme. Zwei Papageien flattern in einem geräumigen Käfig auf und nieder, stoßen Schreie aus, als drohe Todesgefahr.
Vor Daniel zeichnet sich das Bild seines Onkels ab: Lächelnd. Immer lächelnd. Nicht nur wenn er photographiert wurde, lächelte Alexander Stecher Bravo, er schmunzelte in jeder erdenklichen Lebenslage. Ein schmaler Mann, immer glatt rasiert. Brillenträger, seit seiner Jugend. Täglich zog er ein frisches weißes Hemd, legte auch bei größter Hitze eine Krawatte an. Sein Haar war weiß und militärisch kurz geschnitten.
»Muy bién! Muy bién!« kreischt einer der Papageien.
Er war vier Jahre alt, Alexander zweiundfünfzig Jahre älter; der Onkel saß an seinem Bettende, im achtzehnten Stockwerk des New Yorker Hotels St. Moritz, Central Park South. Die Eltern gingen aus an jenem Abend, sahen am Broadway die Generalprobe zur Welturaufführung der West Side Story, hatten dem Verwandten, der ihn seit zwei Stunden erst kannte, ihn nie zuvor gesehen, die Aufgabe des Kindbewachers anvertraut. Du schütteltest, erzählte Stecher dem Neffen noch Jahrzehnte später, ununterbrochen den Kopf, mehr als eine halbe Stunde lang. Wie ein Schwachsinniger bist du mir damals vorgekommen. Dann aber hieltest du mit dem Kopfschütteln plötzlich inne, blinzeltest, sahst, daß ich es war, der bei dir saß, wie immer vertieft in die Börsenberichte des »Wall Street Journals«, der »Washington Post«, der »New York Times«. Da hast du dich aufgesetzt, mich angeschaut und gesagt: Ach!, wenn du da bist, brauche ich ja nicht weiter mit dem Kopf zu schuckeln! Minuten später bist du selig eingeschlafen.
Ruhige Schwimmzüge, von Bassinrand zu Bassinrand. Das Knacken eines verrosteten Liegestuhls.
Daniel Löw ist im juristischen Sinne nicht Alexander Stecher Bravos Neffe, obwohl er sich immer als sein Neffe empfunden und bezeichnet hat. Jacob, Daniels Vater, hatte zwei Cousins mütterlicherseits, Söhne der einzigen Schwester seiner Mutter: Arnold und Alexander. Arnold, Mittelschullehrer, in seiner Freizeit passionierter Ornithologe, verstarb, ohne geheiratet oder Nachwuchs hinterlassen zu haben. Alexander, auch er ein unbeugsamer Junggeselle, blieb ebenfalls kinderlos. Stecher verwöhnte seinen Cousin zweiten Grades seit dessen Geburt. Nahezu jedes Jahr unternahm er die Reise von Caracas, flog nach Europa oder schiffte sich nach Le Havre ein. Für Jacob, den Cousin ersten Grades, brachte Alexander wenig Interesse auf. Trafen die beiden einander, wußte keiner, wie mit dem anderen umzugehen war.
Die Haare sind feucht vom Schwimmbad, als er den fensterlosen Speisesaal betritt. Auf den langgestreckten Buffettischen findet er kaum noch Eßbares vor. Zwanzig Neonlampen verströmen Kaltlicht. In der Mitte des Plafonds eine Spiegelkugel, Glitzerkarussell. An Tanzabenden wird sie in Drehung versetzt, kleidet den Raum in schaukelnde Blitze.
Er schnappt sich von den leeren Metallplatten verwelkte Salatblätter und ein Reststück Käse, grauschimmernde Wurstscheiben und ausgetrocknete Weißbrotschnitten. In einer Kupferwanne liegen drei kahle Ochsenknochen in schwarzer Bratensauce. Er sitzt allein im hangarbreiten Saal. Verschlingt das wenige, das auf seinem Teller liegt. Steht nochmals auf, sucht nach einem Stück Obst.
Eine Frau betritt den Raum. Ihre Augen ähneln denen von in schweren Netzen gefangenem Wild. Ihr langer, kreideweißer Hals reckt sich in jede Richtung. »I’m hungry!« ruft sie. Und nochmals: »I’m hungry!«
Er reicht ihr zwei Orangen, die letzten, die zu finden waren.
»Let’s share«, sagt sie, »teilen wir.«
Er kehrt an seinen Platz zurück, der runde Tisch ist übersät mit Essensresten, zerknüllten Papierservietten, schmutzigem Besteck, leeren Flaschen und Gläsern. Die Unbekannte setzt sich zu ihm, an denselben Tisch. Reißt die Schalen von den Orangen. Daniel nimmt milde Hitze wahr, die vom Sonnengeflecht in sein Geschlecht und in die Oberschenkel ausstrahlt. Das rote, drahtig-trockene Haar der Frau wird von einem schwarzen Stirnband streng zurückgehalten. Über der Oberlippe steht beiger Flaum. Ihr Kostüm, aus teurem Stoff gewoben, sitzt ein wenig schief, es ist ihr zu groß, wie von einer schwereren, breiteren Verwandten geerbt. Ihre Stöckelschuhe sind ihr zu eng. Er schätzt die Fremde auf Ende dreißig, sie sei, meint er, ungefähr im gleichen Alter, wie er selbst. Ihr Teint wirkt trocken, die Lippen sind aufgesprungen, als herrschten Eis und Schnee. Weiche, blonde Härchen wachsen auf ihren Wangen, in der Höhe der hervortretenden Backenknochen. Sie verschlingt die Orange, die er ihr gab.
Vor Jahren habe sie schon einmal einen Coup d’État in Caracas miterlebt, sagt die Frau. »Die Aufständischen haben sich im fünften Stock meines damaligen Wohnhauses verschanzt, lieferten den Regierungstruppen Feuergefechte, bis sie nach zwei Tagen überwältigt und an Ort und Stelle durch Kopfschüsse hingerichtet wurden.« Verirrte Kugeln und Schrapnellsplitter schlugen in ihre Wohnung im vierten Stock ein und beschädigten das ihr von den Großeltern väterlicherseits vererbte Chagall-Gemälde Leóncin im Winter, zerschmetterten Kleiderschrank, Anrichte sowie eine zweihundertjährige Standuhr.
Sie pflückt letzte Salatreste von den Metallplatten, kehrt an den Tisch zurück. Sie sei nach dem Ende der Regierungskrise nach Miami übersiedelt, vor einer Woche kehrte sie zum ersten Mal nach Caracas zurück, um ihre Wohnung zu verkaufen. »Seit meiner Auswanderung habe ich immer neue Versuche unternommen, sie zu verkaufen, das ist mir jedoch bisher nicht gelungen«, nicht zuletzt, da sich entfernte Verwandte darin eingenistet hätten, die sich strikt weigerten, sie zu verlassen. Nun überlege sie, einen Prozeß gegen ihre Familienangehörigen anzustrengen, habe bereits Verbindung zu einem Rechtsanwalt aufgenommen. Der Militärputsch aber bringe nun alle Bemühungen für ungewisse Zeit zum Stillstand. Sie ringt nach Luft. »Und Sie? Was machen Sie hier, wer sind Sie, wie heißen Sie?« Ihre nasale Stimme hat etwas weinerlich Klagendes, die Sturzflut ihrer langen Sätze etwas sonderbar Müdes, Gelangweiltes an sich.
Die weißen Teller reflektieren das Licht der Neonröhren. Im Hintergrund Lärm: Eine Schar Hotelgäste beschwert sich, ihre Telephonleitungen seien unterbrochen. Sie wünschen, zum Flughafen chauffiert zu werden. Die Rezeptionsbelegschaft teilt mit, der Flugplatz bleibe bis auf weiteres für den nationalen und internationalen Zivilverkehr geschlossen. Taxis könne man nicht rufen, da naturgemäß auch die Taxichauffeure der Ausgangssperre unterlägen.
»Sie müssen mir gar nichts erzählen«, sagt die Frau. »Ich dachte nur, in der Art, wie Sie die Orangen mit mir teilten, daß ich Sie seit langer Zeit kenne, selbst wenn ich annehmen muß, wir seien einander nie zuvor begegnet und würden einander nie wieder begegnen. Zeit ist nicht Chronologie, wie man gemeinhin denkt. Zeit ist das große Alleszugleich, Gestern-Heute-Morgen-Immer, wenn Sie verstehen, wie ich das meine.«
In der Hotelhalle ebbt der Tumult ab. Die Menschen begeben sich in ihre Zimmer zurück.
»Ich bin zum ersten Mal hier … kam vorgestern an.« Er spricht sehr leise.
»Eine Geschäftsreise?«
»Mein Onkel lebte hier, über fünfzig Jahre lang …«
»Ach so! Sie besuchen Ihren Onkel …!«
»Er ist vor einigen Monaten verstorben …«
»Und vorher … ich meine: bevor er starb … haben Sie ihn nie besucht? Oder waren Sie zerstritten?«
»Er kam zu mir. Beinahe jedes Jahr.«
»Verzeihung, aber … Sie müssen doch neugierig gewesen sein, wo er lebte, wie er lebte …?«
Daniel antwortet nicht.
»Und jetzt? Wieso sind Sie jetzt hier«, fährt sie fort, »jetzt, da er tot ist?«
Er schweigt.
»Ich habe Zeit, viel Zeit, dank den Umständen dieses außergewöhnlichen Tages. Was soll ich tun? Im Zimmer sitzen und grübeln? An meinen Mann denken? Er starb an Herzinfarkt mit einundfünfzig Jahren. Wir waren glücklich miteinander, sehr glücklich sogar, das dürfen Sie mir glauben.«
Sie streckt ein Bein aus, das spitze Knie berührt sein Knie, sie tut so, als sei sie versehentlich dagegen gestoßen. Jetzt sieht sie frech, hübsch und traurig zugleich aus.
»Erinnere ich Sie … an jemanden?«
Er verneint.
»Und Ihr Sternzeichen?« fragt sie.
»Schütze.«
»Wie meines: 8. Dezember.«
»Freut mich: 9. Dezember.«
Sie lächelt zufrieden. »Sie sagten, Ihr Onkel sei vor fünf Monaten …?«
»Er wurde über neunzig Jahre alt …« Löw häuft die Brotkrümel rund um seinen Teller zu einem fingernagelhohen Hügel. »Was tun Sie … in Miami?«
»Als mein Mann starb, hinterließ er mir so viel, daß ich für hundertundfünfzig Jahre gut versorgt bin.« Ihr verlegenes Grinsen verleiht ihr einen Hauch von Schlampigkeit, der Daniel zuvor nicht aufgefallen war. Ihre unregelmäßigen Zähne blecken marderähnlich. »Und Sie? Was machen Sie?«
»Ich bin Lyriker.«
»Davon können Sie leben?«
»Ich lebe bescheiden«, entgegnet er. Hier und da heimse er literarische Auszeichnungen ein, zuletzt den Hildesheimer Rosenstock, einen traditionsreichen Preis, den die deutsche Industrie nur alle zehn Jahre vergebe. »Meine Werke sind in mehreren Sprachen erschienen. Und ich übersetze Theaterstücke aus dem Englischen ins Deutsche. Unterrichte seit kurzem an einer amerikanischen Universität in Bristol ein Semester Creative Writing, eine Anstellung, die, wie ich finde, überraschend gut dotiert ist.«
»Und Sie leben … wo?«
»In London.«
»… allein?«
Er steht auf. »Meine Frau erwartet im nächsten Jahr unser erstes Kind.«
Sie blickt zu Boden. »Ich frage Sie nichts mehr.«
Er hält sich mit beiden Händen an der Stuhllehne fest.
»Ihren Namen hatten Sie mir noch nicht –«
Er nennt ihr seinen Namen.
Sie nickt anerkennend, als zeichne ihn der Klang seines Namens vor anderen Menschen aus. »Und ich bin …«, sie unterbricht sich, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde: »… ich bin Esther Moreno. Der Onkel, von dem Sie mir zuvor …« Sie zögert erneut: »Lassen wir das … Es geht mich nichts an.«
Ein Kellner bewegt sich an der Rückwand des Speisesaals auf und ab, gleich einer Wildkatze im Käfig, schaltet die Beleuchtung aus. Und nochmals ein, wieder aus.
4 Albacea
Am neunzigsten Geburtstag seines Onkels hatte der Neffe sich über Alexanders Wunsch, keine Telephongespräche mehr führen zu wollen, hinweggesetzt. Der Jubilar freute sich nicht: »Schreiben Sie mir lieber. Was? Verstehe kein Wort. Ich weiß, daß ich Geburtstag habe, vielen Dank! Bin taub! Wer? Ach, du bist’s! Schreibe mir lieber. Spare dir das viele Geld, um herauszufinden, ob ich wohl noch lebe. Mach dir keine Sorgen, ich bin zäh. Wenn mein Atem morgens unbemerkbar ist, dann fühlt Perpetua, ob meine Hände noch warm sind, denn auch in diesem Affenland wird man nicht mit warmen Händen eingepflanzt. Und sollte ich abkratzen, wird dich die Nachricht noch früh genug erreichen …«
Seit ihrem letzten Wiedersehen, es lag bereits einige Jahre zurück, korrespondierten sie einmal im Monat. Acht Wochen nach dem runden Geburtstag riß das Regelmaß der Postsendungen plötzlich ab. Daniel wartete noch drei Wochen, ehe er entschied, Stechers Bitte erneut zu ignorieren. Das Hausmädchen hob nach langem Läuten ab. »Muerte!, muerte!« schrie sie, wiederholte mehrmals »Kershenbohm! Kershenbohm!« ungeduldig, daß er den Namen nicht kannte, gab ihm eine Telephonnummer, unter der Genaueres zu erfahren sei.
»Hallo?!« Die Stimme eines alten Mannes.
»I’d like to speak to Mr. Kershenbohm, please.«
»Kirshman. Konrad Kirshman.«
»Daniel Löw, I’m calling from Europe.«
»Bist der Neffe vom Alexander selig. Wir können Deutsch sprechen. Ich war sein bester Freund, über fünfzig Jahre lang. Wir sind durch die Hurenhäuser gezogen, Dein Onkel und ich, wie er da angekommen is’, in Caracas, im Dezember ’39. Das verbindet ein Leben lang! Was kann ich für Dich tun?«
»Ich wollte wissen –«
»Obste was erbst?!«
»Wann und woran er gestorben ist.«
»Schlaganfall. Vor ’ner Woche. Kam aus’m Spital zurück, Routineuntersuchung. Danach isses passiert. Er hat nicht gelitten. Mein Sohn Julio wird dir mehr erzählen. Der ist jetzt nicht da. Der ist von deinem Onkel zum ›albacea‹ ernannt worden. Weißte, was das ist?«
Daniel verneinte.
»Testamentsvollstrecker. Ruf nächste Woche an, dann kannste mehr erfahren. Bist ja Erbe. Aber der Alexander hat kurz vor seinem Tod sein Testament noch abgeändert. Seine Haushälterin soll seine Wohnung erben, haste das gewußt?«
»Ich finde das durchaus in Ordnung«, bekundete Löw. »Er hat sehr oft von ihr geschwärmt und mir vorgejammert, wie sehr er sich davor fürchtet, sie könnte ihn eines Tages verlassen …«
»Bist wohl nicht ganz bei Sinnen? Also dann, Neffe vom Alexander selig …«
Als das Gespräch beendet war, wunderte er sich, von Kirshman und Sohn nie gehört zu haben. Sein Onkel hatte das Import-Export-Haus Kiba-Nova ihm gegenüber nie erwähnt.
»Für den Fall, daß ich verschwinde: werde Dir meine Girokonten plus Wertpapierdepots an der Südamerika-Deutschland-Bank in Hamburg und in deren Filiale in Panama City vermachen«, hieß es in einem der Briefe des Onkels, zwei Jahre vor seinem Tod, ein Brief, der im nächsten Satz von seiner Freude an dem betörenden Duft eines lateinamerikanischen Berggrases sprach, welches nur an vier Tagen des Jahres blühe. »Werde Dir meine Girokonten plus Wertpapierdepots an der Südamerika-Deutschland-Bank in Hamburg und in deren Filiale in Panama City vererben.« Mehr nicht. Und der Erbe hatte es bei dieser Mitteilung belassen. Sie genügte ihm. Er fragte nicht genauer nach.
Eine Woche nach dem Telephongespräch mit Konrad Kirshman rief er erneut in Caracas an.
»Ah, schön von dir zu hör’n, Papa hat mir schon erzählt von eur’m Gespräch … Dein Onkel hat sein Testament kurz vorm Tod abgeändert: Die Wohnung soll nun nicht die Perpetua bekomm’n, die sollst du bekomm’n!«
»Ihr Vater sagte mir vorige Woche das Gegenteil.«
»Er wird alt. Die Wohnung ist sicher viel wert. Und auf’m Konto vom Alexander selig, hier, in Caracas, war’n am Todestag vierhunderttausend Bolivares, so circa sechstausend Dollar. Die kriegste natürlich auch. Noch Frag’n?« Julios Stimme hallte echoreich wider.
Es mochte ja sein, daß der Verwandte seine Ersparnisse längst aufgebraucht hatte, infolge seiner ausgedehnten Reisen, und der zahlreichen Spitals- und Arztbesuche, die notwendig geworden waren, eine hartnäckige Darmerkrankung in den Griff zu bekommen. »Ich habe in letzter Zeit vier Operationen und sechs Krankenhausaufenthalte hinter mich gebracht«, hieß es in einem der letzten Briefe Stecher Bravos, »was hier nicht zum billigen Luxus gehört. Die idiotische Inflation konnte ich wirklich nicht voraussehen. Stell Dir vor: Meine Autohaftversicherung kostet dieses Jahr siebenmal soviel wie im vergangenen Kalenderjahr. »Time Magazine« kostete vor kurzem noch einen Bolivar, jetzt muß ich sechzig Bolivares dafür bezahlen. Das ist so drastisch, daß man sich nicht dagegen schützen kann. Nun, ich habe den Trost, daß ich nicht unsterblich bin.«
»He?! Biste noch da?« rief Julio in den Hörer.
Daniels Herz pochte. »Haben Sie irgendeine Information bezüglich seiner Konten …?«
»Welcher Kont’n?«
Er holte tief Luft. Dann fuhr er fort: »Zunächst Hamburg … wissen Sie da schon etwas Genaueres?«
»Hamburg?!«
»Das war das einzige, was Alexander mir eingetrichtert hat seit ich dreizehn Jahre alt bin, seit meiner Bar-Mitzwah, darauf sollte ich achten, unbedingt achten, wenn ihm, Gott behüte, eines Tages etwas zustoßen –«
»Mach dir keine Sorg’n. Wir besitz’n ein achtstöckiges Haus voller Ware, wir sind auf sein Geld nicht angewies’n. Hättste ein’n arm’n Vollstrecker gekriegt, bekämste gar nix! Der hätte alles einkassiert, da kannste sicher sein! Ich muß bloß das Begräbnis bezahl’n, und seine Angestellte und ein paar ausstehende Rechnung’n. Der Rest bleibt für dich!«
»Perpetua sollte meines Erachtens eine größere Entschädigung bekommen«, gab Daniel zu bedenken, »da ihr ja die Wohnung –«
Doch Julio hatte bereits aufgelegt.