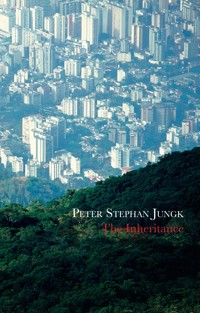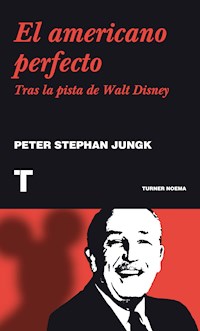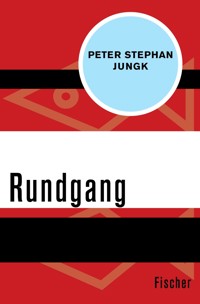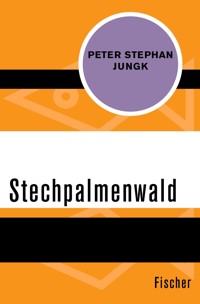9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von der Kritik als unbedingt lesenswerte Biographie gewürdigt, zeichnet sie sich durch eine Fülle von Material aus und bietet ein anschauliches Bild von der Beziehung zu Alma Mahler-Werfel. Sie ist darüber hinaus auch glänzend erzählt. Peter Stephan Jungk, der Gespräche mit Zeitgenossen und Freunden in Amerika und Europa geführt hat, ist dem Lebensweg Werfels nachgegangen, einem Weg der von Prag über Wien und Venedig nach Sanary-sur-mer ins französische Exil führt und schließlich nach einer waghalsigen Flucht in Kalifornien endet. Dabei wird deutlich, wie stark die äußeren persönlichen und politischen Ereignisse sein schriftstellerisches Werk bestimmt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Stephan Jungk
Franz Werfel
Eine Lebengeschichte
Über dieses Buch
Diese erstmals 1987 erschienene Biographie kann nach wie vor als der überzeugende Versuch gewertet werden, sich dem Lebensweg Franz Werfels auf eine sehr persönliche Weise anzunähern. Von der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« als »erste wirklich umfassende und nicht nur deshalb lesenswerte« Biographie gewürdigt, zeichnet sie sich durch eine Fülle von Material aus und bietet ein anschauliches Bild von der Beziehung zu Alma Mahler-Werfel. Sie ist darüber hinaus auch glänzend erzählt.
Peter Stephan Jungk, der Gespräche mit Zeitgenossen und Freunden in Amerika und Europa geführt hat, ist dem Lebensweg Werfels nachgegangen, einem Weg, der von Prag über Wien und Venedig nach Sanary-sur-mer ins französische Exil führt und schließlich nach einer waghalsigen Flucht in Kaliforniern endet. Dabei wird deutlich, wie stark die äußeren persönlichen und politischen Ereignisse sein schriftstellerisches Werk bestimmt haben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490748-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Stadtpark
Caruso
Café Arco
Der Jüngste Tag
Der brave Soldat
Alma Maria Mahler-Gropius
Breitenstein am Semmering
»Ich bin Bocksgesang …«
Roman der Oper
Erfolg und Krise
Barbara oder die Wirklichkeit
Hohe Warte
Die vierzig Tage des Musa Dagh
Hiobsbotschaften
Jeremiade
1938. Kapitel
Himmel und Hölle
»I’m an American«
Totentanz
»Das Buch muß fertig werden …«
Tafelteil
Anhang
Zeittafel
Bibliografische Anmerkungen
Anmerkungen
Stadtpark
Caruso
Café Arco
Der Jüngste Tag
Der brave Soldat
Alma Maria Mahler-Gropius
Breitenstein am Semmering
»Ich bin Bocksgesang …«
Roman der Oper
Erfolg und Krise
Barbara oder die Wirklichkeit
Hohe Warte
Die vierzig Tage des Musa Dagh
Hiobsbotschaften
Jeremiade
1938. Kapitel
Himmel und Hölle
»I’m an American«
Totentanz
»Das Buch muß fertig werden …«
Danksagung
Register
Erwähnte Werke von Franz Werfel
Personen und fremde Werke, Zeitungen und Zeitschriften etc.
Anna Mahler gewidmet
»Weißt Du, Felice, Werfel ist tatsächlich ein Wunder, als ich sein Buch ›Der Weltfreund‹ zum ersten Mal las, dachte ich, die Begeisterung werde mich bis zum Unsinn fortreißen.«
Franz Kafka
1913
»Meine Schwierigkeit: Was habe gerade ich in einer Welt zu bestellen, in der ein Werfel Ausleger findet!«
Robert Musil
1930
Stadtpark
In der ersten Septemberwoche 1890 gingen über Böhmen und weiten Teilen Nordösterreichs heftige Regenstürme nieder, ließen die Flüsse aus den Ufern treten, verursachten in Prag die verheerendsten Überschwemmungen seit mehr als vierhundert Jahren. Man beklagte zahlreiche Todesopfer. Schon stand die Josefstadt, das Ghetto der Juden, zur Gänze unter Wasser, da stürzte in den frühen Morgenstunden des 4. September die uralte, steinerne Karlsbrücke ein. Erst am Mittwoch, dem 10. September, hörte der Niederschlag auf, sank der Pegel des Hochwassers langsam – tagsüber herrschte trübes Wetter, erst gegen Abend hellte es ein wenig auf.
In einer schön gelegenen Wohnung der Prager Neustadt, in der Havlíčekgasse 11, kam kurz vor Mitternacht Franz Viktor Werfel zur Welt, das erste Kind seiner Eltern Rudolf und Albine Werfel. Die Vorfahren väterlicherseits, teils Wörfel, teils Würfel genannt, waren seit über drei Jahrhunderten in Nordböhmen ansässig. Franz Viktors Ururgroßvater Gottlieb Würfel, dem Status nach ein Schutzjude, lebte in Böhmisch Leipa. Dessen Sohn Juda nahm 1812 als Unteroffizier an Napoleons russischem Feldzug teil. Juda Werfels Sohn Nathan, Franz Viktors Großvater, wurde als fünftes von sieben Kindern geboren – zunächst Weber in Leipa, später Mehlhändler in Jungbunzlau, übersiedelte er schließlich nach Prag, wo er mit einer Bettfedernreinigung ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftete, dieses aber auch rasch wieder verlor. Sein Sohn Rudolf Werfel, 1857 in Jungbunzlau als eines von neun Geschwistern geboren, wuchs als Kind sowohl in Prag als auch in einer renommierten bayerischen Internatsschule auf. Von den Schulden des Vaters zunächst schwer belastet, konnte er sich im Laufe weniger Jahre einigen Wohlstand erkämpfen und meldete 1882, als Fünfundzwanzigjähriger, die Eröffnung einer Handschuhmanufaktur an. Sieben Jahre später heiratete er die erst neunzehnjährige Albine Kussi, Tochter eines vermögenden Mühlenbesitzers aus Pilsen.
Im Haushalt der Jungvermählten arbeitete und wohnte die tschechische Köchin Barbara Šimůnková, eine resolute Person Mitte Dreißig, aus Radič nahe Tábor – sie wurde zur Kindermagd des Neugeborenen, seine frühesten Eindrücke waren mit Barbara engstens verbunden, mit ihr verbrachte er die meisten Stunden des Tages. Halb Ammendeutsch, halb Kuchlböhmisch sprach sie mit dem Buben; eines der ersten Worte, das er aussprechen konnte, hieß Bábi. Bábi fuhr ihn, als er noch im großen, weißen Kinderwagen lag, nahezu täglich in den unweit gelegenen Stadtpark – die hohen Baumkronen bildeten seinen ersten Himmel. Sobald er gehen gelernt hatte, führte sie ihn in diesen Park, um den Teich mit seinen Grotten, seinen Buchten und Trauerweideninseln. Er spielte in der Sandkiste, nahe dem Affenkäfig, sammelte Edelkastanien, erlebte Regentau, Blumenbeet, Baumschatten, begriff die Aufeinanderfolge der Jahreszeiten.
Schräg gegenüber der Wohnung seiner Eltern lag der große Staatsbahnhof Prag-Mitte, ein Gebäude, das Franz Viktor neugierig machte wie kein anderes. Vom Fenster aus konnte er auf Dampf und Schmutz und Güterwaggons hinabsehen, er hörte die Pfiffe, das Kreischen der Bremsen; immer nochmals wollte er das Innere dieser faszinierenden Station erforschen, die Lokomotiven berühren: »Maschina! Maschina!« nannte er die schwarzen, zischenden Monstren, die hier an den Endpunkten zahlreicher Schienenstränge standen.
An Sonntagen nahm Barbara den Vier-, Fünfjährigen sehr früh morgens in die Messe mit. In der kühlen, weihrauchduftenden Steinhalle der St. Heinrichskirche kniete er nieder, wenn Bábi niederkniete, stand auf und faltete die Hände, wenn Barbara aufstand und die Hände faltete. Nach Hause zurückgekehrt, baute er dann aus zufällig zusammengesuchten Gegenständen, aus Besen, Hutschachteln, Zeitungspapier, einen Altar auf, zelebrierte davor so etwas Ähnliches wie römisch-katholischen Gottesdienst. Öfters kam Pfarrer Janko von der Heinrichskirche – ein guter Freund Rudolf Werfels – zum Mittagessen zu Besuch; dann gab sich Barbara besondere Mühe, ihre phantasievollsten Gerichte aufzutischen. Franz Viktor wuchs aber durchaus auch in der jüdischen Tradition auf: zwar waren seine Eltern gänzlich unorthodox, doch am achten Tag nach seiner Geburt war die rituelle Beschneidung erfolgt, und an den hohen Feiertagen begleitete der Sohn seinen Vater in die Maiselsynagoge. Das Licht der vielen brennenden Kerzen, das Flimmern der Synagogenluft, erschien dem Jungen jeweils als lebendige Gegenwart Gottes, die ihn gleichermaßen erregte und beängstigte.
Auf den Spielplätzen des Stadtparks begegnete Franz seinem ersten Freund, dem um ein Jahr jüngeren Willy Haas. Barbara erzählte den beiden, schon ihre Kinderwagen seien nebeneinander durch die kiesbedeckten Alleen geschoben worden. Gemeinsam erlebten die Buben den gefürchteten, stelzbeinigen Wächter Kakitz, der einen mächtigen Säbel an der Seite trug; sie hänselten die Sesselbabbe, die jedem, der sich auf den Stühlen der Rondeaus oder entlang der Promenaden niederlassen wollte, sofort den Sesselkreuzer abverlangte. Mit altem Brot fütterten sie die Schwäne, und Barbara kaufte dem Brezelmann Naschereien ab, und manchmal durften die Kinder auch große, bunte Luftballons mit nach Hause nehmen. Glück der frühen Kindheit, das mit Franz Werfels Eintritt in die Privatvolksschule des Piaristenordens von einem Tag zum anderen unterbrochen wurde.
In jüdischen Familien war es üblich, die Söhne zu den Piaristen zu schicken, in Franz’ erster Klasse stammte gar die Mehrzahl der Schüler aus jüdischem Haus. Im hinteren Trakt des Klostergebäudes, in hohen, gewölbten Räumen, unterrichteten Mönche in schwarzer Kutte etwa sechzig Knaben zugleich. Nur die Religionsstunden erfolgten in getrennten Klassenzimmern: für die Kinder mosaischen Glaubens kam Rabbiner Salomon Knöpfelmacher in das Kloster der Piaristen.
Franz saß in einem weißgetünchten Raum, in eine enge, grünlackierte Bank gezwängt; hinter dem erhöhten Katheder hing eine große Landkarte der Großmacht Österreich-Ungarn, mit ihren zehn Kronländern, daneben ein Bildnis des Kaisers Franz Joseph I., in weißer Uniform. Nahe der Tür stand ein Schrank mit Weltkugeln und Planetengloben. Umringt von einer Schar Dutzender fremder, lauter Buben, konnte der Sechsjährige schon die ersten Schultage kaum ertragen – er fühlte sich ausgesetzt, vom Elternhaus durch unbegreiflichen Ratschluß gewaltsam getrennt. Er flüchtete sich in die Krankheit: die ersten Monate dieses Schuljahres verbrachte er zu Hause, von Mutter, Vater und Barbara umsorgt und verwöhnt. So ging das ereignisreiche Jahr 1896 zu Ende, neben dem erschreckenden Erlebnis der Einschulung im Herbst von zwei weiteren Geschehnissen geprägt: dem Tod des Großvaters Nathan Werfel und der Geburt der Schwester Hanna.
Während seiner gesamten Piaristenzeit blieb Franz Werfel ein kränkelndes Kind und ein ziemlich schlechter Schüler. Sehr still hockte er in der Bank; in den Taschen seines blauweißen Matrosenanzugs bewahrte er neben bunten Murmeln ein Notizbüchlein auf, mit einer Namensliste aller seiner Mitschüler und der Patres, die sie unterrichteten. Bis vier Uhr nachmittags dauerte der Schultag zumeist; dann und wann zog Franz noch mit den anderen in den Stadtpark, wo sie Räuber und Gendarm oder mit ihren Glaskugeln Tschukes spielten. An anderen Tagen aber beeilte er sich, rasch nach Hause zu kommen, um noch mit Barbara spazierengehen zu können. Da fuhren sie zum Belvedere-Plateau, sahen hinab auf die hunderttürmige Stadt mit ihren Barockbrücken, auf die neuen Großbaustellen im ehemaligen Ghetto, wanderten über den mit Obstbäumen bepflanzten Laurenziberg wieder abwärts und eilten, sobald es Abend wurde, in die Havlíčekgasse zurück, damit Bábi der Familie rechtzeitig das Essen bereiten konnte. Sie überquerten die stillen Plätze der Kleinseite, wo zwischen dem holprigen Pflaster das Gras wuchs, passierten die großen Gärten der Adelspaläste und die bewachten Torbögen der Palais, liefen weiter, über die wiedererrichtete Karlsbrücke mit ihren Heiligenfiguren und dem großen Kruzifix, umrahmt von goldenen hebräischen Lettern; die Umschrift mußte einst ein Jude finanzieren, erzählte Barbara, weil er das Kreuz verspottet habe. Weiter führte ihr Weg, vorbei am rauchgeschwärzten Gemäuer der Altneusynagoge, durch enge, dunkle Gassen und finstere Pawlatschenhöfe, in denen es nach altem Bier und geselchtem Fleisch roch, weiter über den Graben, wo die Pferdestraßenbahnen verkehrten und die Kutscher die Rösser ihrer Fuhrwerke rücksichtslos durch den dichten Abendverkehr peitschten.
Franz nahm diese Farben, Klänge, Gerüche tief in sich auf, er prägte sich offenbar Nebensächliches mit größter Aufmerksamkeit ein: Ladenschilder, Straßenlaternen, Milchwagen, Kohlentransporte … Sah mit gleicher Konzentration in das eigene Kinderzimmer, wo bunte Stoff- und Seidenreste, Bänder und Volants neben seinem Spielzeug lagen, wenn Barbara beim Schein des alten Auer-Gaslichts an der leise ratternden Nähmaschine saß. Lauschte mit großer Intensität den Gesprächen der Erwachsenen, beobachtete ihre übertriebenen Gesten, ihre Verschrobenheiten, sammelte Eindrücke, wie andere Kinder Briefmarken sammeln oder Muscheln …
Im Jahre 1899, Franz besuchte die vierte Volksschulklasse, kam Marianne Amalia, seine zweite Schwester zur Welt; Familie Werfel übersiedelte in eine größere, repräsentativere Wohnung in der Hybernergasse, in der Nähe des Pulverturms. Auch dies neue Zuhause lag unweit dem Staatsbahnhof, von dem aus Rudolf Werfel seine häufigen Reisen nach Tuschkau bei Pilsen unternahm – dort befand sich eines seiner Fabriksgebäude, zugleich die wichtigste Zweigstelle seines Unternehmens.
Der tarockspielende Kommerzialrat mit dem buschigen Schnauzbart und dem vergoldeten Pincenez im runden Gesicht war in Prag mittlerweile zur stadtbekannten Figur avanciert. Man wußte von seiner Leidenschaft für die Musik – oft sah man ihn im Neuen Deutschen Theater, in Begleitung seiner jungen, attraktiven Frau, welche die gedrungene Gestalt ihres Gatten um Kopfgröße überragte; unverwechselbar ausdrucksstark waren Albine Werfels Gesichtszüge.
Weit über die Landesgrenzen der Donaumonarchie hinaus hatten sich die Lederhandschuhfabriken Werfel & Böhm einen Namen gemacht: sie expandierten ständig, unterhielten Zweigniederlassungen in London, Paris, Brüssel und Berlin. Der Hauptumsatz des Unternehmens, an dem Rudolf Werfel seinen Schwager Benedikt Böhm beteiligt hatte, ergab sich durch den Export in die Schweiz und nach Amerika.
Der Sohn erlebte seinen Vater in diesen Jahren als äußerst nervösen, oft aufbrausenden Mann. Eine der Ursachen solch gespannter häuslicher Atmosphäre erahnte Franz zwar, verstehen konnte er sie allerdings noch nicht. In Prag war es in der letzten Zeit immer häufiger sowohl zu antideutschen als auch zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen; etwa vierhunderttausend Einwohner zählte die Stadt Ende des neunzehnten Jahrhunderts, rund fünfunddreißigtausend von ihnen bekannten sich zur deutschen Umgangssprache. Eine Minderheit innerhalb dieser Minorität wiederum bildeten zwölftausend deutschsprachige Juden. Doch auch jene jüdischen Prager, die zu Hause lediglich tschechisch sprachen, entgingen dem krassen Antisemitismus nationaltschechischer Prägung keineswegs: Juden und Deutsche galten gleichermaßen als Ausbeuter des tschechischen Volkes, da man meinte, sie hätten, gemeinsam mit der verhaßten Aristokratie, die besten Positionen im Staat unter sich aufgeteilt. Die große Mehrheit der Prager Bevölkerung fühlte sich fremd im eigenen Land, allseits herrschten Mißtrauen, Haß und Rachsucht.
Im Frühjahr 1897 war es zu antisemitischen Kundgebungen Hunderter tschechischer Arbeiter gekommen; den Kern dieser neuen Bewegung bildete die Gewerkschaft der Handschuhmacher, zum Großteil also Angestellte der Werfelschen Betriebe in Prag und Tuschkau. Ende desselben Jahres raste der Dezembersturm durch die Stadt: deutsche Einrichtungen wurden zerstört, vor allem aber jüdische Geschäfte und Wohnungen gebrandschatzt und geplündert – erst nach Tagen hatte die Regierung in Wien das Standrecht über die Stadt Prag angeordnet. Zwei Jahre später sorgte der Prozeß um einen angeblichen jüdischen Ritualmord in ganz Böhmen für neue antisemitische Hysterie, vergiftete nun auch zusehends das Klima zwischen Juden und Deutschen. Diese Entwicklungen bereiteten Rudolf Werfel naturgemäß größtes Unbehagen – an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert herrschte ähnliche Angststimmung in Prag wie einst zu Rabbi Bezalel Löws Zeiten, da der Kabbalist und Schriftgelehrte (zum Schutze der Juden im Ghetto) aus Moldauschlamm den Golem erschaffen hatte.
Ab Herbst 1900 besuchte Franz Werfel – ohne Kraft, ohne Lust und Geschicklichkeit – das K. K. Deutsche Gymnasium am Graben; das Schulgebäude lag unmittelbar neben jenem des Piaristenordens, an der Ecke Herrengasse. Auch hier stammte mehr als die Hälfte der Buben aus jüdischem Elternhaus, auch hier unterrichtete Salomon Knöpfelmacher, war der inzwischen zehnjährige Franz einer seiner schlechtesten Schüler. Der Rabbiner brachte ihm die hebräische Schrift und Sprache bei, lehrte ihn Israels biblische Geschichte, von der Genesis bis zu den Propheten. Er schätze, bemerkte Knöpfelmacher eines Tages, die Musikalität König Davids weit höher ein als etwa die eines Wolfgang Amadeus Mozart; Werfel faßte daraufhin den Entschluß, den Religionsunterricht fortan bloß noch als Farce zu betrachten.
Sein ganzes Interesse galt den orientalischen Romanen von Karl May sowie der wöchentlich erscheinenden illustrierten Knabenzeitung ›Der Gute Kamerad‹: er las Indianergeschichten in Fortsetzungen, erfuhr Interessantes, Spannendes über China und Siam, Indien und Afghanistan, erhielt Anleitungen zum Bau einer Photokamera. Die Geschichte vom tapferen Schiffsjungen Erich hatte es ihm besonders angetan: der braungebrannte norddeutsche Bub, Held einer Erzählung aus dem ›Guten Kameraden‹, wurde ihm zum Freund und Vorbild – von Erich lernte er Schiffstakelung, Matrosenlieder und Seemannsfabeln. Als Franz eines Sonntags mit seiner Mutter einen Ausflug auf einem Moldaudampfer unternahm, verwandelte sich diese Bootsfahrt für ihn in eine phantastische Ozeanreise: Insulaner umzingelten das Schiff, die Spitzen ihrer Pfeile hatten sie in Gift getaucht, Zyklone brachten Erich und seinen Freund in Seenot, majestätisch zogen am Horizont rauchende Vulkane vorüber …
Während er las, naschte Franz unentwegt, er war ein dickliches Kind geworden; verbot Barbara ihm aber das Essen zwischen den Mahlzeiten, antwortete er ihr jedes Mal mit schuldigem Bubenblick – und aß weiter.
Seine Eltern hatte er schon mehrmals zu Schauspiel- und Opernaufführungen ins Neue Deutsche Theater – am Rande des Stadtparks – begleiten dürfen. Höhepunkt der Saison waren jeweils die Maifestspiele, ins Leben gerufen von Angelo Neumann, einem der bedeutendsten Opernimpresarios und Theaterintendanten Europas. Alljährlich verpflichtete Neumann die besten Sänger und berühmtesten Schauspieler aus den Großstädten der Nachbarländer für einige Wochen an sein Theater nach Prag. Im Mai 1900 gab hier zum Beispiel Josef Kainz den Hamlet, ein Jahr später, im Todesjahr Giuseppe Verdis, stand eine Verdi-Stagione auf dem Programm, 1902 ein großes Wagner-Festspiel. Die Maifestspiele, fünf Wochen, in denen man ganz und gar dem Sprechtheater und der großen Oper verfallen konnte, galten den kulturell interessierten Pragerdeutschen durchaus als der Höhepunkt des Jahres. Die Tschechen nahmen an diesem Festival des Neuen Deutschen Theaters allerdings niemals teil, umgekehrt hätte sich aber auch kein deutschsprachiger Prager je ins Tschechische Nationaltheater verirrt, selbst dann nicht, wenn Diaghilev oder Nijinski dort ein Gastspiel gaben.
Immer wieder bettelte Franz Werfel, zu den Stagione-Ereignissen mitgenommen zu werden; schon im ersten Akt befiel ihn dann jedesmal große Traurigkeit darüber, daß der Ablauf der Stücke, der Opern, nicht unterbrochen werden konnte, das ganze Schauspiel im Nu wieder zu Ende sein würde. Am glücklichsten machte ihn die Vorfreude auf einen Theaterabend, er sehnte sich unentwegt nach diesem Gefühl erregter Antizipation.
Er baute sich ein Puppentheater und begann, Stücke der Weltliteratur selbst in Szene zu setzen. Georg Weber, Werfels liebster Freund am Deutschen Gymnasium, teilte dessen Theaterbegeisterung: in den Küchen der elterlichen Wohnungen bastelten sie Pappfiguren, Speere, Schilder und Rüstungen, auch die Effekte für ihre Vorstellungen stellten sie selbst her, ließen Kolophoniumblitze zucken und Dämpfe stinkender Kochbutter aufsteigen, folgten bei alledem gewissenhaft den Anleitungen des ›Guten Kameraden‹. Vor Schulfreunden und Verwandten brachten sie dann ganze Dramen und Opernlibretti zur Aufführung – ›Faust‹ und ›Freischütz‹, ›Zauberflöte‹ und ›Wilhelm Tell‹. Das Hauptaugenmerk des Publikums allerdings lenkten sie auf das Gelingen ihrer Kulissentricks.
In Franz’ ersten Gymnasialjahren nahm auch sein Mitschüler Franz Jarosy einen wichtigen Platz ein: ganz Gegenpol zu dem Christen Weber, imponierte er Werfel durch sein überlegenes Auftreten, durch Lebensfreude und Zynismus. Obwohl Jude, hielten ihn die meisten seiner Klassenkameraden für konfessionslos oder getauft, vor dem Religionsunterricht drückte er sich jedenfalls erfolgreich. Schon als Zwölfjähriger war der Sohn des Direktors eines Triestiner Versicherungsunternehmens ein brillanter Schauspieler, der die Gleichaltrigen mit betonter Überheblichkeit behandelte; so verkaufte er Werfel zum Beispiel einen gewöhnlichen Hosenknopf als Hosenknopf Napoleons …
Nur unter einer Bedingung erklärte sich Jarosy bereit, an den Theateraufführungen seiner Freunde teilzunehmen: die Figuren sollten nicht mehr von Puppen, sondern von den Buben höchstpersönlich dargestellt werden – Jarosy selbst wollte dabei ausschließlich Prinzen und Edelmänner spielen. Das konnte Franz Werfel nur recht sein, ihm lag nämlich daran, immer nur die Bösewichte, die Intriganten und Dämonen zu verkörpern.
Ein theatralischer Akt ganz anderer Art fand Mitte des Jahres 1901 in Prag statt: die Kinder hatten schulfrei bekommen, und an allen Hauptstraßen der Stadt bildete die Bevölkerung Spalier; zum ersten Mal seit zehn Jahren stattete Seine Apostolische Majestät, Kaiser Franz Joseph der Erste von Österreich, König von Ungarn, König von Böhmen und Mähren, Prag seinen Besuch ab. Auch Werfel, Jarosy, Weber und Haas sahen ihn sekundenlang in der Hofequipage den Wenzelsplatz hinabrumpeln. Die öffentlichen Gebäude sowie zahlreiche Privathäuser der Stadt waren festlich geschmückt, wobei das Stammhaus der Firma Werfel & Böhm in der Mariengasse ein besonders festliches Gepränge aufwies.
Das Gymnasium und sein streng bürokratisches Unterdrückungsprinzip bedrängte und ängstigte Franz mehr und mehr. Er empfand den Schulzwang als Marter, die das freie Atmen zu ersticken drohte. Die erlösenden Wochen der Sommerfrische erlebte er dafür um so intensiver, Familie Werfel verbrachte sie zumeist im österreichischen Salzkammergut. Franz liebte das Schwimmen im See, das Bergsteigen und Wandern, den Nachmittagsschlaf in hohen Wiesen oder schattigen Wäldern, wenn auch während all dieser Tage das Damoklesschwert des erneuten Schulbeginns über ihm schwebte: wie eine Naturkatastrophe kam das Ende der Ferienzeit über ihn. Krank zu werden, erschien ihm – ähnlich wie in den ersten Piaristenjahren – der beste Ausweg, dem Gymnasiastendasein gelegentlich zu entkommen; es gab kaum eine Kinderkrankheit, die ihm erspart geblieben wäre.
Nachdem er im ersten Semester der Tertia sehr viele Unterrichtsstunden versäumt hatte, trat der Entkräftete im zweiten Halbjahr der dritten Klasse einen aussichtslosen Kampf gegen seine Widersacher, die k. k. Professoren Konthe, Krespin, Löffler und Rotter an. Mutter Albine suchte die Herren oftmals während der Sprechstunden auf, versuchte, dank geschickter Intervention, noch zu retten, was zu retten sein mochte; dennoch erhielt Franz am Ende des Schuljahres sowohl in Latein als auch in Mathematik die Note Ungenügend und erreichte somit das Klassenziel nicht – er mußte die dritte Unterrichtsstufe des Gymnasiums wiederholen.
Zu seinem dreizehnten Geburtstag fand Mitte September 1903 Franz Werfels Bar-Mitzwah statt. Die Konfirmation, wie assimilierte Prager Juden dies Ereignis nannten, tröstete ihn ein wenig über das Niederlagegefühl hinweg, in der Tertia durchgefallen zu sein. Alexander Kisch, der Rabbiner der Maiselsynagoge, hatte Franz auf dies Ereignis monatelang vorbereitet, erhob ihn nun zum Sohn der jüdischen Gebote und Verbote: gleiche Rechte und gleiche Pflichten wie die eines Erwachsenen waren ihm auferlegt – die Bar-Mitzwah ist neben Beschneidung und Hochzeit wichtigster Ritus im Leben eines jüdischen Mannes.
Die berstende Fülle in den Bethäusern, das unentwegte Gemurmel der Gemeinde hatte ihm schon immer mißfallen; begegnete er auf den Straßen Prags polnischen oder russischen Chassidim, den Flüchtlingen der Pogrome, mit ihren langen Schläfenlocken und schwarzen Kaftans, mit den Schaufäden, die ihnen aus dem Hosenbund baumelten, so mußte er sich jedes Mal erneut eingestehen, ihnen gegenüber keinerlei Verwandtschaftsgefühl zu empfinden.
Mit den Fingerspitzen die in Samt gehüllten Thorarollen zu berühren, dem Gesang des Kantors, oder, am Neujahrstag, dem Blasen des Widderhorns zuzuhören, die Mutter zu beobachten, wie sie, am Versöhnungstag, erschöpft vom Fasten, die Tempeltreppen hinabstieg, diese Augenblicke jüdischen Lebens liebte er hingegen; von dieser Tradition wollte er durchaus ein Teil sein.
Nun stand er selbst an der Bimah, der breiten Erhöhung in der Mitte des Tempelraums, wo die Bücher Mosis vor ihm ausgerollt lagen. Und er sang mit aufgeregter, zugleich klagender Stimme hebräische Worte; ein Betschal bedeckte seine Schultern. Laut sprach er sodann den Segen vor der Lesung des Wochenabschnitts aus den Propheten: »Gelobt seist Du, Gott unser Herr, Herr der Welt, der erwählt hat die Propheten, die reich begabten, und sein Gefallen hat an ihren Worten, die sie gesprochen in Wahrhaftigkeit.« Und nach der Haftorah (so nennt man die Lesung aus den Propheten) sagte er ›Sch’ma Israel‹, das Herzgebet Israels seit den Tagen des Vorvaters Moses.
Familie Werfel übersiedelte neuerlich, diesmal aus der Hybernergasse in die Mariengasse, in ein Gebäude, welches in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes der Firma Werfel & Böhm lag. Nun wohnten sie im exklusivsten Bezirk der Stadt, direkt am Rande des Stadtparks, sahen auf die Kronen der hohen Kastanienbäume, konnten auf der gegenüberliegenden Seite des Parks das Neue Deutsche Theater erkennen. Die großen Räume der Wohnung rochen nach Sauberkeit, alles war strahlend weiß ausgemalt, auch die Korridore und Türen, selbst die Bodenleisten waren weiß lackiert. Kostbare Teppiche lagen ausgebreitet, an den Wänden hingen wertvolle Gemälde. Franz’ eigenes Zimmer war allerdings sehr klein – es lag zwischen der Küche und Barbaras Stube.
Zu Bábis Entlastung wurden Gouvernanten engagiert, die sich um die Mädchen Hanna und Marianne zu kümmern hatten, aber auch darüber wachten, daß der schlechte Schüler und Sohn des Hauses seine Hausaufgaben pünktlich erledigte und abends rechtzeitig das Licht löschte. Eine dieser Angestellten hieß Anna Wrtal; Franz aber mochte Erna Tschepper besonders gern: sie war etwa dreißig Jahre alt, als sie bei Kommerzialrat Werfel zu arbeiten begann. Das schöne, blonde Haar trug sie zu einem Knoten zusammengesteckt. Nahezu täglich besuchte Fräulein Erna mit ihrem Zögling die Parks, oft schloß sich ihnen ein junger Kavalier an, mit dem sie dann auf den Kieswegen promenierten; die Nacht verbrachte Fräulein Tschepper nicht selten bei ihrem Verehrer, ein Geheimnis, das zwischen ihr und Franz streng gehütet wurde.
Er mochte es sehr, von Erna gebadet und abgetrocknet zu werden, er war glücklich, so lange er wollte, lesen zu dürfen. Dies ununterbrochene Lesen hatte er sich während der oft wochenlangen Kinderkrankheiten angewöhnt – es war zu seiner Lieblingsbeschäftigung geworden. Schwabs ›Sagen des Klassischen Altertums‹ studierte er zur Zeit, vertiefte sich in Bulwers ›Die letzten Tage von Pompeji‹ und Gustav Freytags ›Soll und Haben‹; er las allabendlich, nicht selten bis tief in die Nacht. Sein Glück sollte jedoch nicht lange währen: als Erna schwanger wurde, entließ Mutter Albine sie fristlos. Zwei Nächte hindurch weinte Franz, nachdem Fräulein Tschepper ihm mitgeteilt hatte, sie werde von der Familie fortgehen müssen.
In Los Angeles, Kalifornien, an jenem Ort, an dem Franz Werfel fünfundfünfzigjährig starb, nahm meine Suche nach seiner Lebensgeschichte ihren Ausgang. An seinem Geburts- und Kindheitsort wollte ich meine Spurensicherung abschließen. Die Einreise in die damalige »Sozialistische Tschechoslowakische Republik« blieb mir jedoch – trotz mehrmaliger Beantragung – verwehrt. Eine Tatsache, die uns schon wenige Jahre später durchaus absurd anmutet.
Ich wollte in Werfels Wohnungen stehen, seine Schulgebäude sehen, durch seine Gassen, Parks und Theaterkorridore gehen, doch jeder neue Versuch, nach Prag zu gelangen, blieb erfolglos. Ich wandte mich schließlich an einen Prager Bekannten, dem ich Jahre zuvor begegnet war, und bat ihn, mir Rat zu geben.
Der alte, störrisch-freundliche Herr antwortete postwendend: unter dem Briefkopf »Dr. František Kafka, Schriftsteller, Prag« teilte der Absender mir mit, sich in den Archiven der Goldenen Stadt zwar gut auszukennen, mich jedoch vorwarnen zu müssen – »… die Feststellungen in den Matriken dauern sehr lange, denn man kann nicht selbst forschen, sondern nur um die Abschriften, selbstverständlich mit Stempelgebühr, ersuchen.« In der Folge erhielt ich von Dr. Kafka – er selbst bezeichnete sich übrigens als den letzten Überlebenden des Prager Kreises – Brief um Brief.
Das Geburtshaus Franz Werfels, gegenüber dem Bahnhof Mitte, in der Havlíčkova ulice werde, so ließ Dr. Kafka mich wissen, seit Jahren schon als Bürogebäude benutzt. Zur Zeit entstehe hier die neue Untergrundbahnstation der Linie B, »Revolutionsplatz«. Im Hausflur der Havlíčkova 11 entdeckte Herr Kafka orientalische Landschaftsbilder, »am Fersen der Stiege« stehe überdies »in der Nische eine schwarze, aber gipserne Rittergestalt«. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, den Portier zu überlisten, sei es ihm schließlich doch noch gelungen, ins Innere des Gebäudes vorzudringen: »Die heutige Raumlösung ist weit entfernt dem Bauplan aus 1889, denn es wurden kleine Räume in den ursprünglichen Wohnzimmern zu Amtszwecken errichtet.«
Franz Werfels ehemalige Schule, das Kloster des Piaristenordens an der Ecke Graben und Herrengasse, beherberge heute etwa dreißig Mietwohnungen, ein »altberühmtes Industrieunternehmen für Maschinenerzeugung« sowie die Weinstube ›U Piaristů‹. In den Stockwerken des einstigen Deutschen Gymnasiums sei nunmehr die »Elektrotechnische Fachmittelschule« untergebracht – ein Durchgang verbinde auch heute noch »das Piaristengebäude im Hof mit dem Hof des ehemaligen Gymnasiums«.
Der Stadtpark aber, vor den Toren des modernen Hauptbahnhofs gelegen, bestehe heute bloß noch aus einem schmalen Rasenstreifen, der bis zum prunkvoll renovierten Smetana-Theater, dem einstigen Neuen Deutschen Theater, führe. Die ehedem größte innerstädtische Grünfläche – mit ihrem Teich, den Grotten, Wasserfällen und Spielplätzen – sei dem Bau der Metro-Linie A zum Opfer gefallen.
Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die zahlreichen, engbetippten Briefseiten, die Dr. Kafka mir im Laufe der Jahre zugesandt hat … Ich blättere durch das Konvolut, stoße auf seine Beantwortung meiner Nachfrage, ob in Prag vielleicht Näheres über Barbara Šimůnková in Erfahrung zu bringen sei, von der ich lediglich wußte, daß sie im Jahre 1935 im Spital der Elisabetherinnen gestorben war. »Sie starb im Alter von achtzig Jahren, sechs Monaten, acht Tagen«, schrieb mir Herr Kafka, »begraben wurde sie am 26.3.1935 auf dem Olschaner Friedhof. Dort habe ich folgendes festgestellt: sie liegt noch immer am 3. Friedhof, 2. Abteilung, Grab Nr. 782. Eingetragen wurde sie in das Verzeichnis als ›Köchin‹. Das Grab, während zwanzig Jahren nicht bezahlt, ist bereits an den Staat samt Grabstein und Zubehör verfallen.«
Caruso
Im Mai 1904 stand Verdis ›Rigoletto‹ auf dem Festspielprogramm von Angelo Neumanns Neuem Deutschen Theater. Seit Wochen war für dies erste Gastspiel des weltberühmten Tenors Enrico Caruso Reklame gemacht worden. Franz Werfel begleitete seine Eltern an diesem Abend, erlebte eine Aufführung mit, welche in ihrer Einzigartigkeit die Stagione-Aufführungen der vergangenen Jahre bei weitem übertraf. Die Eleganz von Carusos Timbre, sein müheloses Legato, die Gewalt seiner Crescendi begeisterten das Publikum. Dreimal mußte der Tenor die Arie des Herzogs wiederholen, und jedesmal betonte er dabei neue Nuancen. Noch Stunden nach der Vorstellung zogen Gruppen Caruso-Berauschter durch die Nacht, erschallte »La Donna è mobile« in den Straßen und Pawlatschenhöfen der Stadt.
Kein Theatererlebnis hatte Franz je so stark berührt. Die Beschäftigung mit den Künsten, vor allem aber die Leidenschaft für das Theater, begann Werfels Leben nun vollends auszufüllen, drängte – zumindest vorübergehend – sogar die Schulsorgen in den Hintergrund. Bei Rosenthal, dem k. u. k. Hofoptiker auf dem Graben, kaufte er sich von seinem Taschengeld Grammophonplatten der Marke Schreibender Engel, kaufte Aufnahmen von Enrico Caruso: Verdis ›Rigoletto‹, ›Il Trovatore‹, ›La Traviata‹ oder Bellinis ›Norma‹, Donizettis ›Lucia di Lammermoor‹. Immer wieder gehört, prägten sich die Melodien und Libretti langsam ein, bald konnte der Vierzehnjährige bereits ganze Arien auswendig nachsingen.
Er trug Reclam-Ausgaben von Goethes ›Faust‹ und Lord Byrons Drama ›Manfred‹ in den Jackentaschen, an den Wänden seines engen Zimmers hingen Abbildungen Giuseppe Verdis und Dante Alighieris. Franz las Gedichte, am liebsten Novalis, Hölderlin, Lenau, Rilke, in Übersetzungen auch Walt Whitman und Jules Laforgue. Er liebte es, wenn ihm seine Mutter vor dem Einschlafen immer wieder dieselben Oden, Sonette und Balladen vorlas, schon nach kurzer Zeit behielt er sie im Gedächtnis, Wort für Wort. Mit Georg Weber improvisierte er weiterhin Puppentheatervorstellungen auf seiner großangelegten Kasperlbühne; inzwischen machte auch Hanna, die ältere der Schwestern, bei diesen Spielen mit.
Werfels Talent, Erwachsene nachzuahmen, war verblüffend; er imitierte ihre Körperbewegungen, ihren Sprachschatz und Tonfall nahezu perfekt – besonders beliebt war seine Nachahmung des Kantors der Maiselsynagoge: ein Badetuch über die Schultern gelegt, kopierte er den unfreiwillig komischen, klagelauten Gesang des Vorbeters. Hanna tat, als sei sie ein frommes Mädchen der Gemeinde, und auch Marianne, die kleinere Schwester, durfte schon dabeisitzen und mitspielen.
Nach Wiederholung der dritten Klasse am Deutschen Gymnasium wechselte Franz Werfel im September 1904 in das K. K. Stefansgymnasium in der Stefansgasse – Willy Haas, der sanfte, dunkeläugige Freund aus frühester Stadtparkzeit war hier nun sein Klassenkamerad. Oft lasen die beiden unter der Bank während der Unterrichtsstunden. Sie brachten einander Bücher aus den Bibliotheken ihrer Eltern mit: bald tauchte in der Klasse ein abgegriffenes Exemplar von Arthur Schnitzlers ›Reigen‹ auf, bald kursierten die neuesten Werke von George, Hofmannsthal, Strindberg, Hauptmann …
Klassenvorstand Karl Kyovsky entwickelte eine gewisse Vorliebe für den neuen Zögling Werfel: Eines Mittags störte ein Leierkastenmann, der im Hof des Gymnasiums spielte, den Lateinunterricht. Kyovsky fragte, ob jemand erkenne, welche Melodie da erklang – Franz sprang sofort auf und antwortete: »Das Sextett, Herr Professor, aus ›Lucia di Lammermoor‹ von Gaetano Donizetti!« Der k. k. Lehrmeister lächelte – und seinem schwachen Schüler blieb von jenem Tag an wenigstens ein Genügend sicher.
Die Theateraufführungen und Opernabende der letzten Jahre, insbesondere das Gesamtwerk Giuseppe Verdis, nahezu unentwegtes Lesen von Lyrik, von Prosa- und Dramentexten, erste, noch halbbewußte Erregungen, die das Fremdwesen Frau auslöste, sie alle verschmolzen in Franz Werfels Bewußtsein zu einem Element. Er wollte danach fassen, es in Worte kleiden, er tastete nach Sprache. Begann Sätze zu formen, er begann, ohne Absicht, Verse zu schreiben. Aus dem Stegreif, ohne nachzudenken. Es geschah, und der Ausführende war zugleich der Überraschte. Er packte die Kraft, die ihm aus Arien, Duetten, Quartetten italienischer Opern, nicht zuletzt aus Carusos Belcanto zufloß, in Sprache. Erfand sich die Welt neu, bildete Kosmos nach. Schrieb Strophe um Strophe. Setzte Rufzeichen an ihr Ende. Schrieb ein ganzes Poem! Dichtete Angst, Freude, Erinnerung. Er sang Sprache. Täglich entstand ein neues Gedicht.
Willy Haas kam jeden Tag zu Besuch. Zuerst mußte er Barbara begrüßen, einige Worte mit ihr wechseln, das verlangte Franz von ihm, danach erst betrat er die Kammer seines Freundes. Große Unordnung herrschte hier, Zettel lagen offen herum, Versskizzen, im Kleiderschrank, auf dem Waschtisch, dem Nachtkasten, sie staken zwischen Buchseiten oder zerknüllt in den Hosen- und Jackentaschen. Franz trug dem Freund seine Gedichte auswendig vor – und dieser war hingerissen von Werfels allerersten Versen, ermutigte ihn, weiterzuschreiben, unbedingt weiterzuschreiben.
Frau Kommerzialrat Werfel glaubte in Willy Haas einen möglichen Anstifter des plötzlichen, unentwegten Dichtens ihres Sohnes zu erkennen – sie verhängte strengstes Hausverbot über den Klassenkameraden. Franz schrieb unbeirrt weiter. Gerade in dieser Zeit seiner ersten Versuche ermutigte ihn der Arzt und berühmte Prager Lyriker Hugo Salus, ein Bekannter der Familie: während einer gemeinsamen Eisenbahnfahrt wandte er sich, nachdem er eine ganze Weile aus dem Abteilfenster gesehen hatte, mit einem Mal dem Gymnasiasten zu und forderte ihn auf, ein Gedicht mit dem Titel ›Kirchhof im Feld‹ zu verfassen.
Sommerfrische, Salzkammergut; Franz schrieb Dialogszenen, die er zusammen mit Hanna und anderen Kindern in einem Gartenpavillon zur Aufführung brachte – die Hauptrollen schanzte er immer sich selbst zu: ›Aphrodite‹ hieß eines dieser Kurzdramen. ›Barseba‹ ein anderes, ›Klassische Philister‹ machte sich über die Professoren des Stephansgymnasiums lustig; Gedichte entstanden weiterhin in großer Zahl.
Im Garten der gemieteten Ferienvilla gab es einen Springbrunnen, in dessen Becken die Kinder Schiffe kreuzen ließen. Beim Räuber- und Gendarmspiel wollte der fünfzehnjährige Werfel besonders gerne an den Marterpfahl gebunden, wollte gefesselt, ausgelacht, gedemütigt werden. Eines Abends, ein Gewitter drohte, floh er mit Hanna in ein Blockhäuschen – auch das kleine, verwöhnte Kätzchen, mit dem sie oft spielten, hatte hier Unterschlupf gefunden. Während in der Dämmerung die Blitze zuckten, quälte Franz die leise miauende Katze, quälte sie so lange, bis ihm ein lebloses Knäuel in Händen lag. Ein grausames, gräßliches Elementarereignis, das der Pubertierende wenig später in seinem ersten Prosatext literarisch zu bewältigen suchte. ›Die Katze‹ überhöht die verabscheuungswürdige Tierquälerei zur mythischen Tat: »… meine Muskeln krampften sich im Wonnevorgefühl eines Wühlens in weicher Lebendigkeit zusammen und mein Ohr lechzte nach dem spitzen Schrei eines Opfers. […] Mit verräterischer Zärtlichkeit hob ich endlich Katzerls leichten Leib auf und verdunkelte durch die vorgehaltenen Daumen seine Augen. […] Und immer tiefer drückte ich, bis es mir warm die Finger hinabrann und ich mit zusammengebissenen Zähnen in unerhörter Lust kleine Schreie ausstieß. […] Dann hörte ich mich noch unter von Blitz und Donner aufgepeitschtem Rasen fürchterlich schreien: ›Herr Gott, hilf mir vor dem Teufel, Gott sei bei uns.‹«
In den Häusern der gutsituierten pragerdeutschen Familien fanden im Winter alljährlich Abendgesellschaften statt. Franz Werfel und Willy Haas waren nun in dem Alter, da man sie zu solchen Anlässen einzuladen begann. Ein steifes Zeremoniell umgab diese Soireen, zunächst erfolgte schriftliche Zu- oder Absage seitens der Geladenen, danach war ein Anstandsbesuch bei der Gastgeberfamilie fällig, letztendlich mußte man auch eine Woche nach dem Fest noch einmal zu einem Höflichkeitsbesuch antreten; bei jeder dieser Gelegenheiten trug man Cut und Zylinder. Dies alles nahm Franz in Kauf, da er hoffte, ein Mädchen wiederzusehen, das wenige Jahre zuvor in ihm erste heftige Verliebtheit ausgelöst hatte. Damals sah er sie täglich im Speisesaal eines großen Alpenhotels, beide saßen in Begleitung ihrer Eltern an der selben Gästetafel. Maria Glaser, Tochter des Kommerzialrats und Schokoladefabrikanten Adolf Glaser, war ein ungewöhnlich schönes, schwarzhaariges Mädchen mit dunkelblauen Augen. In sein zerknittertes Frackhemd und den verdrückten Smoking gekleidet, begegnete er der Gleichaltrigen nun auf den Hausbällen wieder; er wußte nicht, wie sich bewegen, gab kaum ein Wort von sich. Er glaubte, verlogen und unrein zu sein, empfand sein dickliches Äußeres als abstoßend häßlich, hingegen erschien ihm Maria als edel, ehrlich und gut. Derselbe Junge, der seinen Freunden jubelnd Verdi-Arien, manchesmal ganze Opernszenen vorsang und Dramenakte auswendig deklamierte – in Fräulein Mitzis Gegenwart verstummte er.
Bei Schönwetter, im Frühjahr, veranstaltete Familie Glaser im Garten ihrer Villa sogenannte ästhetische Sonntagnachmittage. Jeder Eingeladene wurde aufgefordert, entweder ein eigenes Gedicht oder sonst etwas Selbstgeschriebenes vorzutragen, für Franz die erste Gelegenheit, ein größeres Publikum mit seinen Versen bekannt zu machen – Fräulein Mitzi dabei zu imponieren, das hoffte er vor allem. Doch dann stand er ihr wieder allein gegenüber und brachte kein vernünftiges Wort hervor. Ähnlich erging es ihm auf dem Tennisplatz, wo er sie von der Zuschauerbank aus beobachtete, ihre grazilen, zugleich energischen Bewegungen bewunderte. Er lauschte ihrer Stimme, wenn sie zu ihren zahlreichen Verehrern sprach – ihn würdigte sie meist kaum eines Blicks. Doch mit jeder Wunde, die sie ihm schlug, fühlte er sich enger an Mitzi gebunden.
Zu Hause, zurück in seiner Kammer, schrieb er: »Du gabst mir ein böses, böses Wort./Nicht bösen Herzens, doch mich traf das böse Wort./Ich war ganz verlegen, rot und stumm/Und die andern stießen sich und lachten um uns herum …« Und er klagte: »… Du spielst mit all den Vielen,/Mich aber merkst Du nicht./Ich bin im Hintergrunde/Dir nahe jede Stunde/Mit zugefrornem Munde/Und eisernem Gesicht.«
Franz Werfels schulische Leistungen blieben besorgniserregend schwach, insbesondere in den Gegenständen Latein und Mathematik. Ein Nachhilfelehrer wurde von den Eltern engagiert, doch anstatt sich von Dr. Holzner auf die Mathematik-Klassenarbeit vorbereiten zu lassen, verwickelte der Schüler seinen Lehrer in wortklauberische philosophische Streitgespräche.
Mutter Albine versuchte, wie eh und je, bei den Professoren zu intervenieren, der jähzornige Kommerzialrat forderte seinen Sohn hingegen auf, endlich Schluß zu machen mit dem lächerlichen Dichten. Er stellte ihm zuweilen mathematische Prüfungsfragen: wußte Franz die Antwort nicht, starrte Rudolf Werfel nur verächtlich vor sich hin, schickte den Erben in sein Zimmer zurück. Verlangte nun immer häufiger, Franz möge ihn in die Fabriksgebäude begleiten, in die Fertigungshallen, wo er inmitten der Gerber und Lederzuschneider, der Näherinnen und Packer stand, wo er zusah, wie sämischgares Reh-, Ziegen-, Schweine-, Kalbsleder mit Dolliermessern bearbeitet wurde; Dutzende Nähmaschinen surrten, abertausend Lederstreifen wurden zusammengefügt und anschließend in den sogenannten Dressierstuben gezogen, gepreßt, geglättet, erhielten hier ihre endgültige Form, bevor man sie in große Exportkisten verpackte. Werfel junior mochte den angenehmen Geruch der hochaufgestapelten, verschiedenfarbigen Damen- und Herrenhandschuhe, genoß sogar für Augenblicke das Pulsieren des Großunternehmens, radikalster Gegensatz zu seiner Sprachmusik. Das Erbe der Firma Werfel & Böhm eines Tages anzutreten, wie es selbstverständlich von ihm erwartet wurde, das allerdings konnte er sich, auch bei gutem Willen, nicht vorstellen.
Ein enger Freundeskreis umgab Franz Werfel, dem neben Willy Haas auch Paul Kornfeld, Ernst Deutsch, Franz Janowitz, Fritz Pollak und Ernst Popper angehörten. Kornfeld, Janowitz und Popper schrieben, wie er, Lyrik, Prosa und Dramen – sie lasen einander ihre Werke vor und kritisierten einander schonungslos. Ernst Deutsch war schauspielerisch hochbegabt; er war bereits im Kloster der Piaristen vier Jahre lang Werfels Mitschüler gewesen, zwischen den beiden bestand ein immerwährender Wettstreit, wer Rabbiner Salomon Knöpfelmacher besser nachahmen könne. Außerdem konnte der Sechzehnjährige, ein stadtbekanntes Tennis-As, mit großen Erfolgen bei den Mädchen prahlen.
Schwerblütig, introvertiert wirkte Werfels Klassenkamerad Paul Kornfeld, der wie Franz unter dem Schulzwang, insbesondere aber unter der Borniertheit ihres Deutschprofessors litt, der sich zum Beispiel weigerte, Arbeiten zu korrigieren, die über den roten Rand hinausragten, der kein Werk durchnahm, welches die Klasse wirklich interessierte: ›Götz‹ wurde statt ›Faust‹ gelesen, Hoffmann von Fallersleben statt Heine, Klopstock statt Hebbel …
In der siebenten Klasse führte Werfel das gelegentliche Schulschwänzen ein – tollkühn durchstreiften da die Freunde an manchen Vormittagen die Parks, saßen in den Konditoreien und Kaffeehäusern, kehrten in düsteren Bierschenken der Vorstädte ein oder kokettierten in Gartenlokalen, im Schatten alter Kastanienbäume, mit Serviermädchen und Radieschenweibern; gaben für die versäumten Unterrichtsstunden gefälschte Entschuldigungsformulare ab.
Abends besuchten sie des öfteren das Neue Deutsche Theater, erlebten Aufführungen mit der Triesch, mit Moissi, Schildkraut, Sonnenthal, sahen Gastspiele des Deutschen Theaters Berlin, in der Regie Max Reinhardts, den ›Sommernachtstraum‹ etwa, oder den ›Kaufmann von Venedig‹ … Maria Immisch war der Star einer mehrwöchigen Schiller-Feier – in ihr glaubte Werfel die Inkarnation des Weibes erkannt zu haben; mit einem großen Blumenstrauß in den Armen wollte er sie eines Nachts an der Bühnenpforte überraschen. Der Plan mißlang. Überglücklich, daß das Unerreichbare unerreichbar geblieben war, warf er den Strauß in hohem Bogen in den Stadtparkteich.
Willy Haas hörte von seinem Freund immer neue Gedichte: Liebeslieder und Klagegesänge, Maria Glaser gewidmet, und Erinnerungen an das Spielen im Stadtpark, an das Gefühl der Geborgenheit in Barbaras Nähe. Kinderzimmer-Momente, Flußdampferfahrten kehrten wieder, Matrosenanzug, Ladenschilder, Fußballspiele, und Kakitz, der Parkwächter. Diese Verse, immer noch ganz ungeordnet, manche bloß bruchstückhaft skizziert, müsse Franz nun endlich zu sammeln beginnen und neu abschreiben, drängte Haas. Vielleicht könne dann das eine oder andere Gedicht sogar einer Zeitschriftenredaktion zum Abdruck angeboten werden.
Werfel war dazu nur unter einer Bedingung bereit: Haas müsse die eigene Adresse als Absender angeben, sein Vater dürfe nicht erneut zu Zornausbrüchen gereizt werden, sollte eines der Manuskripte in die Mariengasse zurückgesandt werden. Alle angeschriebenen Zeitschriften sandten die in schönster Handschrift vorgelegten Gedichte postwendend zurück. An Willy Haas’ Adresse. Und Franz schrieb weiter, sein Freund verschickte die Blätter von neuem.
An einem sonnigen Winternachmittag saßen die beiden in ihrem neuen Stammcafé Arco, gegenüber von Willy Haas’ Wohnhaus, in der Hybernergasse. Sie wollten noch zum Baumgarten, dem Park in Bubeneč fahren, Haas mußte sich zuvor nur rasch ein Taschentuch aus seiner Wohnung holen. Werfel wartete unten im Hausflur auf ihn. Wortlos, atemlos überreichte ihm der Freund Augenblicke später die Sonntagsausgabe des Wiener Tagblatts ›Die Zeit‹: da stand in der rosafarbenen Literaturbeilage an erster Stelle das Gedicht ›Die Gärten der Stadt‹, von Franz Werfel. Dieser empfand plötzliche Übelkeit und heftiges Herzklopfen, als er da seinen Namen zum ersten Mal gedruckt sah, in einer vielbeachteten Zeitung zudem, bei großer Auflage in ganz Europa erhältlich. Dabei war ihm das publizierte Gedicht keineswegs eines seiner liebsten, eine eher schwerfällige Arbeit, die mit den Zeilen einsetzte: »Erschlaffter Efeu schlingt sich um Fontänen,/Die lange schon des Wasserspiels entbehrten,/Es rollen noch des kurzen Regens Tränen/An Marmorhermen in versteckten Gärten.«
Im Baumgarten bewegte sich Werfel dann wie in Trance, starrte immer wieder auf das Zeitungsblatt, fühlte sich stolz wie noch nie. Er glaubte, das sei der Ruhm, das sei es, was ihn so sehr anzog, seit er Enrico Carusos Stimme zum ersten Mal gehört, seit er an jenem ›Rigoletto‹-Abend den tosenden Beifall miterlebt hatte. Selbst auch nur eine Spur Berühmtheit zu haben, eines künftigen Tages, das war zur Vision seiner Schultage geworden. Von nun an, Ende Februar 1908, würde man in ihm den zum Dichter Geborenen erkennen müssen …
Sporadisch zunächst, später immer mutiger, zogen Werfel, Haas, Deutsch und die anderen Freunde durch die Nachtlokale der Stadt, besuchten die Etablissements Hamlet, Montmartre, Napoleon, Eldorado. Das Gogo, in der Gemsengasse, nahe der Markthalle, war Prags ältestes und teuerstes Freudenhaus. Der Salon mit seinen roten Tapeten, den Samtvorhängen und goldumrahmten Spiegeln wurde von wohlhabenden Geschäftsleuten und höheren Beamten besucht, von Künstlern, Akademikern und Militärs. Die Gymnasiasten sahen im Bordell vor allem eine inspirierende Diskussionsstätte, und die prickelnde Stimmung im Empfangssaal des Gogo steigerte das Gefühl des Erwachsenwerdens – kräftig unterstützt von Wein-, Likör- und Zigarettenkonsum.
Für die musikalische Untermalung im Salon sorgte ein alter Pianist, und sobald Schüler Werfel auftauchte, klimperte der Klavierspieler bereits die ersten Takte einer italienischen Oper: Franz war in den Nachtlokalen dafür bekannt, nahezu jedes Gesangstück aus dem reichen Opernrepertoire mit schöner Tenorstimme auswendig vortragen zu können. Man hatte ihm den Spitznamen Caruso gegeben, und die Gebildeteren unter den Damen riefen ihm begeistert Carousseau! zu, in der Annahme, der Name ihres Idols werde französisch ausgesprochen.
Die Mädchen fanden Gefallen an ihren jüngsten Gästen, scherzten mit ihnen, erlaubten ihnen manchmal dabeizusein, wenn sie im Morgengrauen gemeinsam frühstückten, ließen wohl auch Zärtlichkeiten zu, die nicht allzu genau verrechnet wurden. Und dann wankten die Freunde nach Hause, schliefen bis spät am Vormittag – da hockten ihre Klassenkameraden schon seit Stunden in der Schule. Kaum begreiflich, wie Franz’ Eltern, wie seine Lehrer ihm dies auf Dauer durchgehen lassen konnten.
Spiritistische Séancen sorgten für neue Aufregung, eng aneinandergerückt, ein Tischchen umsitzend, riefen die Jünglinge nach den Seelen der Toten. Paul Kornfeld galt als stark medial veranlagt, in seiner Wohnung fanden die Sitzungen daher auch meistens statt. Oft wartete man stundenlang, bevor der Tisch jäh in die Höhe sprang und zuckend über den Boden tanzte. Die Verstorbenen teilten sich durch Klopfzeichen oder Neigungen der Tischplatte mit, gaben Auskunft, wie es ihnen im Jenseits erging, orakelten über die Zukunft; eine Erfrierende flehte gar um Hilfe, ihre Niederkunft stehe unmittelbar bevor, man müsse sie retten, in Semlin, am Ufer der Donau! Panisch eilten die Freunde um drei Uhr nachts durch leere Gassen zum Hauptpostamt, gaben ein Telegramm an das Gendarmeriekommando in Semlin auf, man müsse der Sterbenden unverzüglich Beistand leisten …
Max Brod hatte im Jahre 1908, als Vierundzwanzigjähriger, bereits ersten literarischen Ruhm erlangt und galt als Doyen der jungen Prager Schriftsteller. Nach der Erstveröffentlichung jenes Werfel-Gedichts in der Wiener ›Zeit‹ wandte sich Willy Haas an Brod, legte ihm eine größere Sammlung der Verse seines Freundes vor: sie gefielen dem ehemaligen Piaristen- und Stephansschüler, der selbst als Gymnasiast zu schreiben begonnen hatte, außerordentlich. Er wünschte, den Achtzehnjährigen unverzüglich kennenzulernen – um so erstaunlicher, da ein Altersunterschied von sechs Jahren gemeinhin als unüberbrückbares Hindernis galt.
Franz war sehr aufgeregt, als er Brod zum ersten Mal gegenüberstand. Als er aber seine Lieblingsgedichte auswendig vorzutragen begann, zaghaft zunächst, doch dann immer lauter und sicherer, da hatte er den so Gefürchteten bereits rückhaltlos für sich gewonnen. Enthusiastisch sagte Brod Werfel zu, sich für weitere Publikationen unbedingt einsetzen zu wollen. Nur einmal hatte er schon ähnlich großes Lob ausgesprochen: gegenüber dem fünfundzwanzigjährigen Versicherungsangestellten Dr. Franz Kafka, dessen erste Veröffentlichung, acht Prosatexte, kurz zuvor in der Münchener Literaturzeitschrift ›Hyperion‹ erschienen war.
Brod nahm nun auch an den spiritistischen Séancen der Abiturienten teil, brachte manchmal seine Freunde Franz Kafka und Felix Weltsch mit. »… ich bin seit drei Tagen so verwirrt«, hieß es in einem der Einladungsbriefe Werfels an Max Brod, »daß ich mich wundere, überhaupt schreiben zu können …« Er habe bei neuen Versuchen »so frappante Erscheinungen erlebt«, daß er nun, speziell dank Brods Anwesenheit, »auf ganz besondere Sachen rechne«. Gelegentlich fanden die Sitzungen in Werfels Stammcafé in der Hybernergasse statt: »(wir haben) für heute Abend den Keller im Kaffee Arko [sic] besorgt und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie kämen und auch die andern Herren benachrichtigten …«
Die Troika Brod, Kafka, Weltsch war sich einig in ihrer Wertschätzung des dicken Gymnasiasten Werfel. Sie mochten seine Gedichte, und besonders gefiel ihnen dies Singende seiner Persönlichkeit. Sie luden ihn ein, sich ihren wöchentlichen Ausflügen in die Umgebung Prags anzuschließen. Da wanderten sie, sonntags zumeist, durch die böhmischen Wälder, badeten nackt in den Flüssen, wobei sich Franz Kafka, schlank und groß, mit olivfarbener Haut, immer als der kräftigste und mutigste Schwimmer erwies. Werfel jedoch war der anstrengenden Fußtour und dem stundenlangen Nacktbaden nicht gewachsen – nachdem er die drei Freunde ein Wochenende lang begleitet hatte, im Frühsommer 1909, kehrte er übermüdet und mit schwerem Sonnenbrand nach Hause zurück, lag noch Tage später mit hohem Fieber im Bett. Mutter Albine stellte Max Brod wütend zur Rede: verantwortungslos sei es von ihm gewesen, schimpfte sie, auf den jüngeren Freund nicht besser aufgepaßt zu haben, zu diesem besonders kritischen Zeitpunkt noch dazu, da der ohnehin so gefährdete Schüler unmittelbar vor seiner Reifeprüfung stehe.
Fünfundsiebzig Jahre später. Berlin-West. Knesebeckstraße, Ecke Kurfürstendamm. Im ersten Stock eines Patrizierhauses wohnt Anuschka Deutsch aus Prag. Sehr langsam bewegt sich die zarte, zerbrechliche Dame durch den hellen Salon. »Wahrscheinlich hätte ich in normalem Zustand noch einiges für Sie Wichtiges beitragen können«, sagt die Siebenundachtzigjährige, mit tiefer, sehr rauher Stimme, »momentan bin ich dazu leider zu schwach.«
1922 hatte Fräulein Fuchs den damals im ganzen deutschen Sprachraum bekannten Schauspieler Ernst Deutsch geheiratet. »Sie sind leider etwas zu spät gekommen«, sagte sie, »denn nun bin ich krank.« Und versinkt in einen Fauteuil. Ihre Augen sind sehr wach. »Schauen Sie, diese Photographie hier, die kann ich Ihnen ja zeigen, da waren die beiden, mein Mann und der Werfel, auf Maturareise. Mein Mann hat zur selben Zeit das Deutsche Gymnasium am Graben absolviert wie der Werfel seines in der Stephansgasse. Sie haben immer gestritten, wer von ihnen das bessere Gymnasium besucht hat, außerdem hatten sie denselben Religionslehrer gehabt, und den haben beide sehr gut nachmachen können. Und jeder hat immer behauptet, es seien seine Geschichten, und sie haben deswegen riesig gestritten, auch noch nach vielen, vielen Jahren. Und weil sie beide ja wirklich so brave Kinder waren, hat man einen armen Mitschüler mitgeschickt, auf die Maturareise, der hat auf sie aufpassen sollen. Da haben sie furchtbare Sachen angestellt. Sie wollten zum Beispiel ins ›Tivoli‹ hinein, in Kopenhagen, und haben aber überhaupt kein Geld mehr gehabt, wollten da umsonst hinein! Meiner Meinung nach sehen die zwei auf dem Photo da völlig verkommen aus.«
»Ich hab’ die Schwestern vom Werfel gut gekannt«, fährt Frau Deutsch fort, nachdem sie selbst jene Photographie noch einmal kopfschüttelnd betrachtet hat, »beides hübsche Mädchen, im Grunde, die Marianne und die Hanna. Aber ihre Mutter, Werfels Mutter, mit Verlaub gesagt, die war leider das Gegenteil von einer Persönlichkeit … Die jüngere Schwester, die Marianne, die war vier Jahre jünger als ich, wir gingen zur selben Schule, aber sie war ein modernes Mädchen, die so mit Männern herumgezogen ist. Wir haben das nicht gemacht. Nicht, weil wir nicht wollten. Sondern: es ist nicht geschehen. Mit einem Musiker ist die Marianne herumgezogen, glaube ich. Keine Ahnung, wie der hieß. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist sie nach der vierten Klasse vom Gymnasium abgegangen … Die andere, die Hanna, die war eine Schulkollegin von meiner älteren Schwester, die hat dem Werfel enorm ähnlich gesehen. Später hat sie einen Cousin von mir geheiratet, den Fuchs-Robetin, aber meine ganze Familie war auseinander mit ihm … Ich hab’ ja die Werfel-Schwestern vor allem von den Gesellschaften her gekannt, ich war sehr oft bei Hausbällen und Gartenfesten, schon als Zehnjährige hat man mich zu so etwas eingeladen … Ich hab’ auch eine große Liebe vom Werfel sehr gut gekannt, bildschön war die, die Mitzi Glaser! Zu mir war sie immer nur sehr arrogant. Ich hab’ auch ihre Familie gekannt, ihre Schwester, die Frida, auch ihre vier Brüder … Mein Mann war ja – das hat er mir viel später erst gestanden – sehr heftig in die Frida verliebt. Daß der Werfel sehr verliebt war in die Mitzi, das haben wir alle gewußt. Aber natürlich platonisch verliebt! Das war sonst unmöglich, Sie müssen bedenken, das war vor dem Ersten Weltkrieg: auf herausfordernde Mädchen – die hat’s natürlich auch gegeben – hat man doch gar nicht hingeschaut. Und sich mit einem Mädchen in einem Kaffeehaus ein Rendezvous zugeben, das war doch so unmöglich wie – daß Sie jetzt hier die Wände heraufkriechen. In unseren Kreisen haben die Begegnungen in den Wohnungen stattgefunden, bei den Einladungen. Natürlich ist der Werfel in dieser bürgerlichen Gesellschaft aufgewachsen – und ist dann, so zum Ausgleich, zum Beispiel ins ›Arco‹ gegangen. Und hat angefangen, zu dichten. Es haben sich ja alle sehr lustig gemacht, weil der Werfel dichtet, schon die Idee, zu dichten, war so fernliegend für alle aus dieser Gesellschaft. Ich erinnere mich, wie sein erster Lyrikband erschienen ist, da ist unser Arzt, der zugleich der Arzt von der Familie Werfel war, übrigens ein sehr vertratschter Mensch, zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt: ›Ist doch wirklich eine Frechheit, dieser Franz veröffentlicht da ein Buch, ‹Der Weltfreund›‹, und hat es uns vorgelesen, um zu zeigen, wie schrecklich es sei. Nach kurzer Zeit hab’ ich das Buch dann bekommen, und es hat mir sehr gefallen, sehr. Ich war ja noch wahnsinnig jung … Aber für mein Gefühl war der ›Franzl‹ einer der reizendsten Menschen, die ich je gekannt hab’. Bis auf sein Aussehen, das wirklich nicht schön war … Im Kaffeehaus sind sie alle gesessen, wie gesagt, mein Mann und der Werfel, damals, und Kafka, Brod, Kisch. Den Kisch hab’ ich sehr gut gekannt … Verheiratet hat die Mitzi Glaser dann von Bondy geheißen. Arme Mitzi: ihr Mann, aus der Familie der Kupferkönige Böhmens, hat sich nur an jedem zweiten Tag rasiert. Und an unrasierten Tagen ist er nicht vor die Tür gegangen, der Herbert, also durfte die Mitzi nur an jedem zweiten Tag ausgehen … Sie ist früh gestorben, glaub’ ich. An einer Brustkrebsgeschichte? Bin unsicher … bin schon nach zehn Minuten Gespräch so lächerlich müde … muß mich gleich wieder hinlegen … Sie hätten früher kommen sollen, wie mein Mann noch gelebt hat. Was der Ihnen über den Werfel noch alles hätte erzählen können …!«