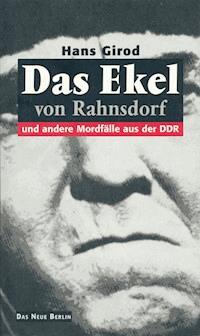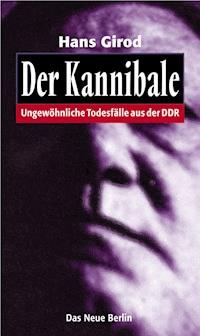Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erstmals sind die beiden Einzelbände "Das Ekel von Rahnsdorf" und "Leichensache Kollbeck" in einem Sammelband vereint. Als erfahrener Praktiker - Girod war Kriminalist und Hochschuldozent - schildert er minutiös die Arbeit der Kriminalisten vor Ort. Mord in der DDR geschah aus Habgier, Triebhaftigkeit oder Eifersucht - uralten Motiven also. Den Selbstmord wählten jährlich mehrere zehntausend DDR-Bürger als letzten Ausweg, als ihre jeweils individuelle Lösung eines Konfliktes. Der Autor schildert mehr als 20 Fälle - grauenhaft, erschütternd, sachlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-360-50012-0 ISBN Print 978-3-360-01240-2
Umschlagentwurf: Jens Prockat
Die Print-Ausgabe erschien unter dem Titel: »Der Kreuzworträtselmord«
© 2004 (1997, 1998) Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.das-neue-berlin.de
Hans Girod
Das Ekel von Rahnsdorf
und andere Mordfälle aus der DDR
Im Interesse des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Täter, Opfer und Zeugen wurden die Namen der Beteiligten sowie einiger Handlungsorte verändert.
Der gewöhnliche Mord in der DDR
Die Kriminalstatistik der DDR registrierte über Jahrzehnte gleichbleibend ein Tötungsverbrechen auf 100.000 Einwohner pro Jahr. In der gleichen Zeitspanne stieg die Häufigkeit dieser Deliktgruppe in der Bundesrepublik auf das Fünffache. Nach dem Untergang der DDR ist in den neuen Bundesländern auch diese Größe inzwischen überschritten. Im internationalen Vergleich schnitt die DDR mit ihrem geringen Anteil an Tötungsdelikten sehr günstig ab. Man vermutet richtig, daß sich das Gesamtbild der Kriminalität in der DDR sowohl quantitativ als auch qualitativ von dem in der Bundesrepublik erheblich unterschied. So entfielen in den sechziger und siebziger Jahren in der DDR durchschnittlich 750 Straftaten auf 100.000 Einwohner, während in der Bundesrepublik der Anteil bereits 6.200 und in Westberlin sogar 12.000 betrug.
Dafür gab es verschiedene Gründe: Der Ehrgeiz der SED und der DDR-Regierung lag darin, nachzuweisen, daß die Kriminalitätsbelastung ständig abnahm. Zentralistische Verwaltungsstrukturen, harte Strafen, nahezu perfekte Personenkontrollen, ein ausgefeiltes polizeiliches Meldesystem und geschlossene Grenzen führten über die Jahre in der Tat zu einem Rückgang der Kriminalität, selbst wenn statistische Angaben – wie allenthalben üblich – gelegentlich durch ausgeklügelte Zuordnungen verfälscht wurden.
Für das internationale Verbrechen blieb die DDR wenig attraktiv. Ganze Deliktgruppen der organisierten Kriminalität wie Drogenhandel oder Entführungen, deren beängstigendes Ausmaß heute bereits eine ernste Gefahr für die Gesellschaft bedeutet, fehlten deshalb im Kriminalitätsbild der DDR.
Bestimmte Formen häufig auftretender Delikte mit geringem Schaden wurden Verfehlungen genannt. Sie waren keine Straftaten und blieben daher außerhalb der Kriminalstatistik. Verfehlungen wurden, wie im Falle kleiner Ladendiebstähle, durch die, wie es in der entsprechenden Verordnung hieß, „leitenden Mitarbeiter der Verkaufseinrichtungen“ selbst geahndet oder es entschieden über sie die sogenannten gesellschaftlichen Gerichte.
Die geringe Kriminalitätsbelastung erklärt sich aber auch aus dem humanistischen Anspruch der DDR, die Kriminalität schrittweise aus dem Leben der Gesellschaft zu verdrängen, der – wenn er auch letztlich eine Vision bleiben mußte – immerhin vielfältige, ehrliche Bemühungen hervorbrachte.
Schließlich wurden mit der Ablösung des seit 1871 in Deutschland gültigen Strafgesetzbuches durch das 1968 in Kraft getretene sozialistische Strafgesetzbuch der DDR andere, gemeinhin traditionell eigenständige Tatbestände, wie z. B. die Prostitution oder die Kindestötung, die nicht in das Bild der sozialistischen Menschengemeinschaft paßten, aus ideologischen Gründen kurzerhand dadurch kaschiert, daß man sie in anderen, unverfänglichen Tatbeständen wie asoziale Lebensweise oder Totschlag untergehen ließ. Systemtypische Delikte, die vorrangig den Schutz der Staatsordnung und der Wirtschaft betrafen, auf die die sozialistische Rechtsordnung besonders empfindlich reagierte, bereicherten hingegen das Strafgesetzbuch. Der inoffizielle Grundsatz der SED-Führung „Erst politisch entscheiden, dann rechtlich würdigen“ führte in den Rechtswissenschaften, aber auch in der Rechtspraxis, dazu, daß ihnen mitunter konstruierte Theorieinstrumentarien aufgezwungen wurden, um jeweils aktuelle Rechtspolitik der SED zu rechtfertigen und wissenschaftlich zu bestätigen.
Solange sich die Kriminalitätsanalyse auf die Beschreibung und Erklärung von Verbrechen im kapitalistischen Gesellschaftssystem beschränkte, wurden umfangreichen Veröffentlichungen keine Hindernisse in den Weg gelegt. Mehr oder weniger leidenschaftlich, meist aber selbstgefällig, wurde aus dem von Marx und Engels postulierten unauflöslichen Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Arbeit und privater Aneignung abgeleitet, daß die Kriminalität dem Kapitalismus eigen ist und schließlich zu seinem Untergang beiträgt. Dem Sozialismus hingegen ist sie wesensfremd, besitzt keine Basis mehr und wird bald aus dem Leben der Gesellschaft verbannt sein.
Wenn der erste Teil dieser These auch zutreffen mag, so blieb der zweite Teil ein irreales Wunschdenken und verbaute schon deshalb ernsthafte theoretische Auseinandersetzungen, weil die Frage nach den eigenen Widersprüchen im Sozialismus, z. B. wenn der Mensch als Miteigentümer des gesellschaftlichen Vermögens sich dennoch daran vergeht, letztlich unbeantwortet bleiben mußte.
Obwohl das phänomenologische Bild und die strafrechtlichen Tatbestände der sogenannten allgemeinen Kriminalität in der DDR und die meisten kriminologischen Ergebnisse mit denen der alten Bundesrepublik in vieler Hinsicht vergleichbar waren, blieben die Deutungsversuche über die Ursachen der Kriminalität im Sozialismus wegen der fehlerhaften Prämisse, daß der Mensch bald frei von Egoismus und Habgier sei und sich ausschließlich in der Arbeit und zum Wohle des Gemeinwesens verwirklicht, nur Worthülsen einer hilflosen politischen und ideologischen Argumentation.
So gab es keinen öffentlichen Platz für die wissenschaftliche Erörterung besonderer Wirkungsmechanismen krimineller Erscheinungsformen in der DDR, wenn man von den vollmundigen Schuldzuweisungen absieht, die alle Ursachen dem unerwünschten Kriminalitätsimport aus dem Kapitalismus anlasteten.
Die Kriminalistik indes, die sich mit der Untersuchungsmethodik konkreter Straftaten befaßt, und die um ihren eigenen wissenschaftlichen Gegenstand, insbesondere als Universitätsdisziplin bemüht war, behielt daher immer eine freundlich-kühle Distanz zur Kriminologie in der DDR. Und in der täglichen Wirklichkeit der Kriminalpolizei ließ sich aus den gespreizten kriminologischen Theorien ohnehin kaum ein praktischer Nutzen ziehen.
Der kriminalistische Untersuchungsalltag in der DDR unterschied sich in der Taktik, Methodik und Spurenkunde kaum von dem in der Bundesrepublik. Allerdings vollzog er sich unter anderen Rahmenbedingungen:
So war die Volkspolizei militärisch strukturiert. Zwar bestanden Kommissariate und Dezernate, doch in ihnen arbeiteten „Kommissare“ mit militärischen Dienstgraden. Die Volkspolizei zählte als wichtiger Bestandteil der Landesverteidigung zum System der sogenannten bewaffneten Organe.
Die Kriminalpolizei besaß als „Untersuchungsorgan“ strafprozeßrechtliche Kompetenzen, die sie von denen der übrigen Polizei schärfer abgrenzten als in den alten Bundesländern. Auch ihre relativ gute personelle Situation wirkte sich positiv auf die Ermittlungsqualität aus. War ein Untersuchungsführer in der DDR mit der gleichzeitigen Bearbeitung von maximal dreißig Verfahren ausgelastet, so hatte sein westdeutscher Kollege bereits mehr als einhundert zu bewältigen.
Schließlich wurden bestimmte höhere Leitungspositionen in der Volkspolizei inoffiziell durch MfS-Offiziere (sogenannte OiBE, „Offiziere im besonderen Einsatz“) besetzt.
Unter diesen Bedingungen, die sich, wie in anderen Bereichen auch, schließlich durch einen mächtigen politisch-ideologischen Indoktrinationsapparat in Form der Politabteilungen ergänzen ließen, wurde die eigentliche kriminalistische Arbeit geleistet.
Was die schnelle und umfassende Aufklärung von Tötungsstraftaten in der DDR betraf, mangelte es gewiß nicht an der erforderlichen Sachkunde und Ernsthaftigkeit. Gut ausgebildete Morduntersuchungskommissionen (MUK) in jedem Bezirk, deren Leiter in der Regel über ein kriminalistisches Universitätsdiplom verfügten, ein vorbildliches Netz gerichtsärztlicher Versorgung, günstige gesetzliche Voraussetzungen für die ärztliche Leichenschau, aber auch für die Leichenöffnung, insbesondere die sogenannte Verwaltungssektion, und die Nutzung der naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnismöglichkeiten der Kriminalistik für die Untersuchung von Gewaltdelikten, sicherten der Justiz Aufklärungsquoten, die im internationalen Vergleich der DDR durchaus vorderste Plätze sicherten.
Der Mord zählte auch in der DDR zu den Delikten mit der höchsten Gesellschaftsgefährlichkeit und wurde in der Regel mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe, bis in die siebziger Jahre nicht selten sogar mit dem Tode bestraft.
Seit der Herausbildung der forensischen Wissenschaften haben sich die Fachleute, auch in der DDR, ernsthaft darum bemüht, das Phänomen der Gewalt gegen die körperliche und sexuelle Integrität des Menschen zu untersuchen und vom scheinbar entwicklungsbedingt Tierischen in uns abzugrenzen.
Immer mehr sind wir heute genötigt, uns mit der Gewalt auseinanderzusetzen. Infolge seiner ethischen, moralischen und sozialen Entwicklung hat der Mensch gelernt, sein Gewaltpotential zu zügeln. Doch gibt es vielfältige Umstände, es freizusetzen. Dann brechen sich spezielle Mechanismen ihre Bahn, die den ursprünglichen Gedanken an Gewalt in die Realität der Tötung überführen. Es sind komplizierte psychische, soziale, medizinisch erklärbare, gefühlsmäßig faßbare, gerechtfertigte und ungerechtfertigte, aber auch für immer verborgene Faktoren. Sie vereinen sich mit der seit der jüngeren Steinzeit vorhandenen, unveränderten Triebausstattung des Menschen, bei dem sich im Unterschied zur Tierwelt zum Erhaltungstrieb Mordlust, Habgier und andere, den Tieren fremde, niedere Beweggründe zu gesellen scheinen.
Zwischen Täter und Opfer baut sich vielfach eine bizarre Realität auf, die selbst ein Fachmann meist nur unvollkommen zu erkennen und zu beurteilen vermag. Zu welchen Mitteln im Einzelfall auch gegriffen wird, welche Beweggründe und Anlässe ihm zugrunde liegen, immer stehen die Schicksale von Täter und Opfer gleichermaßen für die extremsten Varianten zwischenmenschlicher Konfliktlösung.
Oft tut sich ein scheinbar unentwirrbares Ursachengeflecht auf, dessen Hintergründe zerstörerische Umwelteinflüsse, zerrüttete Sozialbindungen, unbefriedigtes und ungesteuertes Trieberleben, aber auch zunehmende Verzweiflung und Angst sind und die der unheilvollen Aggression oft schon bei geringsten Anlässen zum Durchbruch verhelfen.
So handelt der Durchschnittstäter aus oftmals banaler Situation heraus plötzlich, im Affekt und enthemmt durch Alkohol oder andere Sucht- und Betäubungsmittel. Gekränkte Eitelkeit, Haß, Wut, Habgier, Egoismus und ungezügelter Sexualtrieb sind dabei die mobilisierenden Elemente. Das Opfer stammt dann meist aus dem näheren sozialen Umfeld. Dreiviertel aller Tötungsdelikte in der DDR – wie auch weltweit – lassen sich in dieses Schubfach legen.
Nur ein knappes Drittel der Täter hat die Tat mehr oder weniger langfristig vorbedacht, nicht wenige unter ihnen mit teuflischer Abgebrühtheit. Ihr ganzes Denken verläuft in einer einzigen Richtung: Die Tötung wird als ausschließliche Lösung erwogen.
Andere Täter kalkulieren den Tod des Opfers als mögliche Folge ein, etwa, wenn der Räuber das niedergeschlagene, bewußtlose Opfer ins Wasser stößt und es kaltblütig seinem Schicksal überläßt.
Nach dem Verbrechen fühlt sich jeder Täter alsbald in einer fatalen Schlinge, aus der er sich nicht mehr befreien kann. Die Tat läßt sich nicht ungeschehen machen, woraus neue, vorher nicht kalkulierbare Reaktionen erwachsen. Oft unternimmt er Rettungs- und Wiederbelebungsversuche, die Ausdruck eines nicht selten unbeschreiblichen Entsetzens über sich selbst sind. Manch einer unternimmt den Versuch, seinem eigenen Leben ebenfalls ein Ende zu setzen, oder aber er ist wie gelähmt, verbleibt am Tatort, bis die Polizei ihn festnimmt. Schuldgefühle und Bestürzung, häufiger aber die Angst vor gesellschaftlicher Sühne, veranlassen manche Täter auch, sich der Polizei zu stellen.
Mitunter setzen sich jedoch die destruktiven Kräfte im Täter fort. Die Furcht vor Entdeckung paart sich mit eiskalter Berechnung der Folgen. Daraus erwachsen neue Triebkräfte: Spuren werden beseitigt, falsche Fährten gelegt. Die Tat wird mehr oder minder geschickt verschleiert. Der Täter verschwindet im Hintergrund. Der Drang, die eigene Person zu schützen und nichts preiszugeben, kann die Untersuchungshaft überdauern. Eine Verurteilung erfolgt dann mitunter ohne Geständnis. Nicht selten wird bei der Bewertung der Beweismittel, die der Polizei zur Verfügung stehen, das erlahmte Verteidigungsverhalten erneuert und ein bereits abgelegtes Geständnis vor Gericht widerrufen.
Die drohende Todesstrafe, die in vielen Ländern immer noch als Höchststrafe ausgesprochen wird, zumindest die Erwartung einer langen Haftstrafe, erzeugen zuweilen erstaunliche Widerstandskräfte, die Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht mit den im Strafprozeßrecht zugelassenen Mitteln oft nicht brechen können.
Im Grunde sind die meisten Täter lediglich bestrebt, nicht als Verdächtige in das Netz polizeilicher Ermittlungen zu geraten. Deshalb bemühen sie sich, die Tat gänzlich oder teilweise zu verschleiern. Je nach dem Grad ihrer Intelligenz, den zeitlichen und örtlichen Bedingungen, unter denen solche Verschleierungen stattfinden müssen, aber auch ihrer aktuellen psychischen Belastbarkeit erlangen solche Kaschierungen unterschiedliche Qualität. Sie reichen von einfachen ablenkenden Spurenveränderungen über die Vortäuschung eines tödlichen Unfalls, einer Selbsttötung oder gar eines natürlichen Todes bis zur restlosen Beseitigung des Opfers. Ihrem Ergebnis steht die moderne Kriminalistik mit dem entsprechenden taktischen und naturwissenschaftlich-technischen Potential gegenüber, die, wenn sie zum Einsatz kommt, mit bestechender Sicherheit in den spurenkundlichen Mikrokosmos der Tat vorzudringen vermag, der weit außerhalb dessen liegt, was ein Täter sich vorstellen kann. Gerade die letztgenannte Kategorie von Fällen stellte auch in der DDR die eigentliche Herausforderung für Kriminalisten und Gerichtsmediziner dar. Zusammen mit Partnern anderer forensischer Disziplinen waren sie, sehr oft erfolgreich, zuweilen auch mit in die Irre führender politischer und ideologischer Orientierung bemüht, die Opfer zu identifizieren, die Täter zu ermitteln und zu überführen sowie die facettenreichen Tatabläufe, Verhaltensweisen und Beweggründe auszuleuchten.
Das vorliegende Buch widmet sich authentischen Mordfällen, die sich in der DDR zugetragen haben.
Wenngleich die meisten von ihnen wegen ihrer phänomenologischen Grundstruktur überall in der Welt hätten begangen werden können, besitzen sie etwas Unverwechselbares: Sie widerspiegeln auf ihre eigene makabre Weise die DDR-Realität. Das betrifft die Tatentwicklung ebenso wie die mitunter hindernisreichen kriminalistischen Erkenntniswege von der ersten vagen Spur bis zum schlüssigen Beweis.
Natürlich ist hier nur eine kleine Auswahl von Fällen beschrieben. Und es stehen nicht die kausal geradlinig verlaufenden Affektstraftaten, die auch in der DDR den größten Anteil an den begangenen Gewaltverbrechen hatten, im Zentrum. Vielmehr sollen die besonderen Ausnahmezustände menschlichen Verhaltens bei der Tat, ihre Entstehungsbedingungen und die mitunter bizarren Praktiken ihrer Verschleierung unter Berücksichtigung der zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen vorgestellt werden.
Vor allzu großen Erwartungen an Raffinesse und Perfektion in der Tatdurchführung und ihrer Verdunklung kann der Autor nur warnen. Diese finden eher in den wirklichkeitsfremden Konstruktionen der Kriminalliteratur oder im Fernsehkrimi ihre Befriedigung. Die tatsächliche Praxis ist meist durch eine überraschende Primitivität gekennzeichnet. Dennoch kann auch der kriminalistische Erkenntnisprozeß voller Spannung sein, was im vorliegenden Buch hoffentlich bewiesen ist.
Den Schauder beim Blick in die Abgründe menschlichen Verhaltens – das sei noch kurz bemerkt – sollte man zurückhalten. Ein Laie wird kaum die wahre Schuld bzw. Schuldfähigkeit eines Täters, die psychopathologischen Vorgänge, die sein Handeln bestimmen, seine Schuld mindern oder gar ausschließen, ermessen können. Er kennt oft auch nicht die Spitzfindigkeiten rechtlicher Bewertung oder die Zusammenhänge zu den sogenannten straflosen Nachtaten, wie die Beseitigung eines zuvor getöteten Opfers, die grausame Ausmaße annehmen können und die trotzdem auf die juristische Beurteilung nur geringen Einfluß haben.
Nicht alle Fragen können hier beantwortet werden. Auch war es nicht das Anliegen des Autors, eine kritische Analyse der Strafakten vorzunehmen oder eine Beurteilung der mitunter drakonischen Urteile zu treffen, über deren Angemessenheit man geteilter Meinung sein mag. Ebensowenig sind das schizoide System der Verteidigung in der Rechtspraxis der DDR und die sogenannten Justizirrtümer, von denen auch die sozialistische Rechtsprechung nicht freiblieb, Gegenstand des Buches.
Dem Autor liegt mit seinem Bemühen um Authentizität und Objektivität daran, einen Beitrag im Disput um einen Teilbereich der DDR-Wirklichkeit zu leisten und einen kleinen Einblick in die Tötungskriminalität Ostdeutschlands und ihre kriminalistische Aufklärungspraxis zu vermitteln. Jede verklärende Nostalgie liegt ihm fern.
Es werden Fälle aufgegriffen, über die bisher überhaupt nicht, sehr wenig oder aber aus vordergründig ideologisch-politischen Gründen berichtet wurde.
Die Notwendigkeit, persönliche Daten und die Intimsphäre der Täter, Opfer und Zeugen zu schützen, begründet, daß vor allem die Namen der Beteiligten und, wo es geraten erschien, auch die Handlungsorte verändert, bestimmte Handlungsabläufe gestrafft oder auf das kriminologisch Typische konzentriert wurden.
Die agierenden Kriminalisten, Gutachter und höheren Polizeioffiziere sind keine erfundenen Figuren, vereinen in sich mitunter jedoch mehrere Persönlichkeiten, die mit dem jeweiligen Fall zu tun hatten. Die für eine plastische Darstellung der Berichte notwendigen Dialoge sind zumeist rekonstruiert oder nachempfunden, bleiben aber stets sach- und persönlichkeitsbezogen und dienen der Charakterisierung der jeweilig beschriebenen Situation. Die Authentizität der Geschehnisse ist dadurch keineswegs beeinträchtigt und teilweise durch die beigefügten Dokumente belegt.
Im Anhang finden sich Erläuterungen zu den wichtigen Fachbegriffen und Abkürzungen. Die Angaben der Aktenzeichen soll dem beruflich Interessierten den Zugang zum Originalmaterial erleichtern.
Angst geht irre Wege
(Aktenzeichen I B 22/64 Bezirksstaatsanwalt Magdeburg)
Die heutige Bundesstraße 1 schlängelte sich einst als Reichsstraße 1 von Deutschlands Westgrenze nordwärts bis zum ostpreußischen Königsberg.
Der „Eiserne Gustav“, ein Berliner Kutscher mit bürgerlichem Namen Gustav Hartmann, benutzte sie im Jahre 1928, damals achtundsechzigjährig, für seine legendäre Kutschfahrt nach Paris – ein, wenn auch erfolgloses, so doch originelles Aufbegehren gegen den unvermeidlichen Sieg des Automobils über die gute alte Pferdedroschke.
Für die DDR begann die Straße bei Marienborn an einem gewaltigen Schild aus Eisen und Beton mit mannshohem Staatswappen und der Aufschrift „Wir begrüßen Sie in der Deutschen Demokratischen Republik“, was den meisten von Helmstedt aus einreisenden „BRD-Bürgern“, wie die heutigen Wessis im Offizialjargon hießen, für den Rest ihrer Fahrt durch das Land der machthabenden Arbeiterklasse die Disziplin gezähmter Klosterschüler aufzwang. Von hier an war sie eine Fernverkehrsstraße, kurz die F 1. Als solche endete sie bei Kietz, einem stillen Dörfchen im Oderbruch, nahe der Grenze zu Polen.
Im nördlichen Sachsen-Anhalt führte die Straße durch Burg. Diese Kreisstadt verdient als Geburtsort des preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz durchaus Erwähnung, auch wenn sie als zentrale Produktionsstätte des begehrten Burger-Knäckebrots für die DDR-Realisten weitaus handfestere Bedeutung besaß.
Einige Kilometer hinter Burg zweigen von der B1 mehrere Landstraßen ab, die die Ortschaften Ziegelsdorf, Stresow, Grabow und Theeßen verbinden. Dort begann die Abgeschiedenheit ländlicher Idylle.
Anfang Juni 1964 jedoch schreckte die Bewohner dieser Gegend ein ungewöhnliches Ereignis aus ihrem täglichen Einerlei auf. Die LPG-Scheune in Grabow brannte lichterloh.
Das Aufgebot an Einsatzkräften aus dem VPKA Burg und der Kreisdienststelle des MfS war beeindruckend. Das hatte seinen Grund. Der Brandursachenermittler der Feuerwehr hegte den Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. So etwas rüttelte an den Grundfesten der Arbeiter- und Bauernmacht. Hier war zweifellos ein Feind tätig geworden, ein Saboteur des friedlichen Aufbaus der sozialistischen Landwirtschaft.
Vor wenigen Jahren hatte die Kollektivierung ihren Abschluß gefunden. Die meisten Bauern hatten sich teils aus Einsicht, teils aus Gehorsam, vielfach aber auch nach massiver, ja sogar handgreiflicher Überzeugungsarbeit in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gefügt. Doch viele hatten ihren Hof bereits vor dem Bau der Mauer bei Nacht und Nebel verlassen, um weiter westlich ihr Glück zu versuchen. Das galt als Republikflucht – und als Verbrechen –, insbesondere dann, wenn sich der dem gesellschaftlichen Fortschritt Entziehende aus Zorn und Trotz den Flammen überließ, was mitzunehmen ihm verwehrt blieb. Die Sicherheitsorgane besaßen mit solchem Tun reiche Erfahrungen. In Grabow schienen die Wahrung der Klasseninteressen und die Grundsätze der revolutionären Wachsamkeit ein solches Aufgebot zu rechtfertigen.
Man ging davon aus, daß der Täter mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut war und deshalb den Dorfbewohnern kein Unbekannter sein konnte.
Und so brodelte es denn in der Gerüchteküche. Ausgesprochene und unausgesprochene Verdächtigungen machten die Runde, und die phantastischsten Versionen wurden in der Ortsparteileitung, im Gemeinderat und natürlich im „Dorfkrug“ ersonnen.
Allein, kein Verdacht vermochte sich verdichten, und sowohl die bevorstehenden großen Schulferien als auch die Vorbereitungen auf die täglichen Mühen der Erntezeit wären Anlaß genug gewesen, daß sich die aufgebrachten Gemüter allmählich wieder anderen Dingen zuwendeten, wenn nicht ein viel größeres Unheil seinen Lauf genommen hätte.
Es begann am 25. Juni 1964 in der Polytechnischen Oberschule in Theeßen. Lehrer Winfried Fanselow, 49, nutzte die letzte Stunde in seiner 10 b, um einigen seiner Schüler Besuche bei deren Eltern anzukündigen.
„Es geht um die Berufsausbildung und um ein paar Dinge, die mit dem Schulabschluß zusammenhängen. Also: Stötzel, Wasdow und Pandelitz, ihr informiert bitte eure Eltern, daß ich heute im Laufe des Nachmittags mal auftauche.“
Wasdow vermutete, daß es um Werbung als Soldat auf Zeit ging, die ihm eine Lehrstelle als Feinmechaniker sicherte. Beim Verlassen des Schulgebäudes wandte er sich fragend an Pandelitz, dem der Anlaß des Elternbesuches ebenfalls sonnenklar schien: „Der Fanselow will meinen Alten überzeugen, daß ich auf der LPG als Melker anfange. Da können die aber machen, was sie wollen. Nach der Fahne hau ich sowieso ab aus meinem Kaff.“
Stötzel indes zuckte auf die Frage, warum der Lehrer auch zu seinen Eltern nach Grabow kommen wollte, gespielt gleichgültig mit den Schultern: „Keine Ahnung. Soll er doch, wenn’s ihm Spaß macht.“
Die Sechzehnjährigen schwangen sich auf ihre Fahrräder, verabschiedeten sich und radelten in verschiedene Richtungen heimwärts in ihre Dörfer.
In Manfred Stötzel wuchs die Beklemmung. Sein Kopf dröhnte, während er in die Pedale trat. Ein schlechtes Gewissen plagte ihn seit geraumer Zeit. Und das mit Recht. Jetzt schien das Verhängnis unabwendbar. Denn er war es, der Anfang des Monats die Scheune in Brand gesteckt hatte. Doch noch verdächtigte ihn niemand, und beim Löschen hatte er besonderen Eifer an den Tag gelegt. In diesem Punkt fühlte er sich einigermaßen sicher. Als schlimmer hatte er Lehrer Fanselows Standpauke vor einer Woche empfunden. Er war in letzter Zeit mehrmals der Schule unentschuldigt ferngeblieben, hatte also geschwänzt. Die Schule machte ihn fertig. Vor allem dienstags und mittwochs, wenn der Unterricht bis in die frühen Nachmittagsstunden andauerte, fühlte er sich hundeelend, hatte Kopfschmerzen und war für den Rest des Tages über alle Maßen gereizt. Wenn es ganz schlimm war, zitterten seine Hände, und ihm wurde so schlecht, daß er sich übergeben mußte. Anstatt dem Unterricht zu folgen, streifte er deshalb viel lieber durch die Wälder und dachte sich Geschichten aus. Gern würde er Elektriker werden. Nun rechnete er damit, keine Lehrstelle zu erhalten, zumal seine schulischen Leistungen über das Mittelmaß nicht hinausreichten. Er befürchtete, seine Eltern würden stinksauer reagieren und ihn – nicht zum ersten Mal – verdreschen.
Er hatte schon als kleiner Junge öfter Schläge bezogen, vor allem, weil er sich mit anderen Kindern schwer vertrug, immer bestimmen wollte und sofort aggressiv wurde, wenn ihm etwas nicht paßte. Später hatte er deshalb lieber allein gespielt. So blieben auch seine Beziehungen zu seinem jüngeren Bruder eher blaß. Jetzt war er ein ausgesprochener Einzelgänger, ohne echte Freundschaften.
Seine Eltern, unermüdliche Landwirte und fest verhaftet mit ihrem Grund und Boden, gehörten noch zu den wenigen nicht kollektivierten Einzelbauern der Gegend. Tag und Nacht waren sie für ein einigermaßen gutes Auskommen auf den Beinen. Der Vater war ein stiller, fleißiger, im Grunde anspruchsloser Mann, der abends sein Bier trank und, sobald er den Fernseher eingeschaltet hatte, im Sessel einschlief. Daß die Mutter im Hause das Sagen hatte, nahm er widerspruchslos hin. Er empfand es eher als entlastend.
Stötzel fürchtete sich nur vor einem: Wenn es herauskäme, das Schuleschwänzen, oder gar das Feuerlegen an der Scheune, dann würde er von der Mutter eine tüchtige Tracht Prügel beziehen. Mindestens. Dabei war er fast einen Kopf größer als seine Mutter. Was konnte er tun? Nur eins beschäftigte ihn: Wie konnte er es anstellen, daß Lehrer Fanselow nicht in Grabow bei seinen Eltern erschien? Vielleicht konnte man ihn davon abhalten, ihn überreden. Bloß wie? Alles Grübeln half ihm nicht weiter. Als er das elterliche Gehöft erreichte, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Wie einen Abgrund empfand er, was vor ihm lag. Er mußte den Sturz abwenden, durfte nicht länger zögern. Stötzel stellte sich den möglichen Zeitplan seines Lehrers vor. Der mußte so gegen sechs Uhr abends im benachbarten Stresow bei den Eltern von Pandelitz sein.
Beim Mittagessen erinnerte der Vater daran, daß er den ganzen Nachmittag auf dem Rübenacker beschäftigt sein würde. Die Mutter indes plante, nach Burg zu fahren. Im Dorf hatte man erzählt, daß es dort Kinderbadewannen aus Plaste geben würde – eine Rarität des sozialistischen Einzelhandels.
„Das wäre das richtige Geschenk für Lisbeths Tochter zur Entbindung.“ Sie freute sich über die Idee, als der Junge, dessen Schweigsamkeit auffällig war, herauspreßte: „Fanselow kommt heute Abend. Elternbesuch.“
„Heute?“ fragte die Mutter unwillig. „Kann er nicht früher Bescheid sagen? Oder weißt du das schon länger?“
„Nein, er hat’s heute gesagt, es geht um den Schulabschluß oder so was.“
„Das paßt mir aber gar nicht. Kommt selten genug, und dann grade, wenn ich was vorhabe.“
Doch schon ist die Mutter beschwichtigt. „Ist nicht so schlimm, dann fahre ich ein anderes Mal nach Burg“, reagierte sie überraschend. „Du bist mir schon wichtiger als die Wanne. Die kriege ich auch noch ein andermal.“
Der Vater war vom Tisch aufgestanden: „Manne, kommst du mit raus in die Rüben?“
„Nee, geht nicht, wir haben noch von der FDJ was – in Theeßen“, log Stötzel.
Hinter seinen Schläfen hämmerte es schmerzhaft, so sehr beschäftigte ihn die nahende Bedrohung. Während sein Bruder der Mutter beim Abwasch half, zog er sich nachdenklich zurück. Der Schuppen war der einzige Ort, an dem er sich allein und sicher fühlte. Dort stand sein Fahrrad, an dem er gern herumbastelte, dort befand sich allerlei Werkzeug, dorthin hatte er Omas alten Volksempfänger gerettet, der immer noch funktionierte. Über eine Stunde verging, bis er den Schuppen verließ. Zwar hatte er noch keinen Plan, aber eins stand fest: Fanselow darf nicht nach Grabow kommen!
Ich werde ihm sagen, meine Mutter ist nach Burg gefahren, und Vater ist auf dem Rübenacker, keiner hat Zeit! Fanselow müßte dann sagen: Gut, verschieben wir den Besuch! Und wenn er das nicht tut? – Die Gedanken schossen durch seinen Kopf, während er seinen Pflichten nachging. Er fütterte die Hühner, stampfte in der Futterküche Kartoffeln für die Schweine, wie es seine Aufgabe war.
Dann kehrte Manfred Stötzel in den Schuppen zurück. Beim Anblick der Werkzeuge nahm die Lösung Gestalt an: Ich werde ihn irgendwie verwunden, dann muß er zum Arzt und kann nicht zu uns kommen. Nur ein bißchen stechen, irgendwie ritzen oder stechen. Nur verletzen. Es darf nicht schlimm sein, aber er muß gleich zum Arzt! Nein, sterben darf er nicht. Das war’s. Endlich wurde er ruhig, merkwürdig ruhig. Seine Blicke tasteten über die Werkzeuge. Damit geht’s! Er griff nach einem spitzen, kantigen Gegenstand, einer Reibahle mit etwa handlanger Klinge, betrachtete sie wie abwesend.
Dann setzte er sich an das verstaubte Radio und suchte … den Freiheitssender 904.
Es war einer der Tarnsender der DDR-Ideologen, der als Waffe im kalten Krieg eingesetzt wurde. Mit seinen Schlagern sollte er vor allem die westdeutsche Jugend auf sich aufmerksam machen. Die DDR-Jugend indes weigerte sich zu akzeptieren, daß ihnen verboten sein sollte, diesen Sender zu hören. Seine Sendeantennen verbargen sich in einem polizeilich geschützten Wald bei Reesen, in der Nähe von Burg. Von dort aus begann er am 18. August 1956, einen Tag nach dem KPD-Verbot in der Bundesrepublik, zu senden.
Doch das alles wußte Stötzel nicht. Es interessierte ihn einfach nicht. Viel wichtiger war etwas anderes: Hier kam Musik nach seinem Geschmack – die besten Hits aus dem Westen, die man auf heimischen Radiofrequenzen vergeblich suchte. Nur hin und wieder wurden die heißen Rhythmen für kurze Augenblicke unterbrochen. Dann hauchte eine zarte Frauenstimme geheimnisvolle Sätze in den Äther, wie „Achtung, Bäckermeister! Der Teig wird sauer.“ Kein Mensch verstand das. Doch es erweckte den Eindruck, daß die kommunistischen Untergrundkämpfer Westdeutschlands auf diesem Wege wichtige Nachrichten erhielten. Solche Unterbrechungen waren lästig, doch wurden sie in Kauf genommen, um Drafi Deutscher, Siw Malmquist, die Rolling Stones oder die Tornados in die ostdeutschen Stuben zu holen.
Bis zum späten Nachmittag saß er so da, die Reibahle in den Händen.
Dann verstaute er sie in seiner Gesäßtasche, nahm sein Fahrrad und verließ endgültig den Schuppen. Er war ohne Hast und Anspannung, sah noch nach der Mutter im Gemüsegarten hinter dem Haus, ohne sie anzusprechen, und radelte gemächlich nach Stresow.
Sein Ziel war das Gehöft der Familie Pandelitz. Wie erwartet, entdeckte er das sorgfältig abgestellte Motorrad seines Lehrers auf dem Hof. Sein Schulkamerad war nicht zu sehen, aber dessen jüngere Geschwister, die dort spielten, kamen Stötzel eilig entgegen, um ihm das Geheimnis anzuvertrauen: „Euer Klassenlehrer ist da!“
„Ich weiß“, antwortete Stötzel sicher. Eins der Kinder lief ins Haus, und bald darauf kam Frau Pandelitz heraus und fragte Stötzel, was er wolle.
„Herr Fanselow wollte auch zu uns kommen, aber meine Mutter fährt heute noch nach Burg, und mein Vater ist in den Rüben, bis spät. Ich will nur fragen, ob er gleich kommen könnte, weil meine Mutter noch da ist.“ Stötzel sprach es ohne Hemmungen. „Wir sind sowieso fertig, ich sage ihm Bescheid. Fahr zu deiner Mutter und sag ihr, er kommt gleich“, entgegnete Frau Pandelitz und kehrte ins Haus zurück.
Stötzel schwang sich auf sein Fahrrad und radelte betont langsam zurück zur Grabower Landstraße.
Es war ein milder, sonniger Frühsommertag. Der Wald, durch den der Weg nach Grabow führte, war schattig und kühl. Um Zeit zu schinden, beschrieb Stötzel riesige Achten um scheinbare Hindernisse. Seine Hände waren kalt wie immer, wenn er erregt war. Er mochte eine Weile so gefahren sein, da endlich vernahm er hinter sich das ferne Knattern eines nahenden Motorrads.
Fanselow! – Das muß er sein. Schlagartig wich das Blut aus dem Gesicht des Jungen. Mit gewaltiger innerer Anspannung versuchte er der jähen Kraftlosigkeit Herr zu werden. Er zitterte wie Espenlaub. Doch schließlich gewann er seine Konzentration wieder, und bemühte sich, unauffällig weiterzufahren, jetzt geradeaus. Nur wenige Augenblicke später war das Motorrad heran und verlangsamte das Tempo. Die abgewetzte Aktentasche hing dem Lehrer an einem Riemen über der Schulter. Fanselow paßte sich der Geschwindigkeit an und begann gleich das Gespräch: „Du kannst dir ja denken, was ich mit deinen Eltern besprechen muß.“
„Meine Mutter schlägt mich zusammen“, preßte der Junge hervor.
„Wird wohl nicht so schlimm werden, Stötzel. Schuleschwänzen ist doch kein Verbrechen.“ Und nach einer kurzen Pause: „Oder hast du noch mehr auf dem Kerbholz?“
Die Frage verwirrte Manfred Stötzel. Ahnte der Fanselow etwas wegen der Scheune? Der blieb die Antwort schuldig. Eine unheimliche Macht schnürte Stötzel das Herz zusammen, so daß er nur an das eine dachte: Jetzt muß es passieren!
In stiller, irgendwie makabrer Eintracht fuhren der Rad- und der Motorradfahrer nebeneinander her. Der Junge aber nahm die Geräusche der Umgebung nicht mehr wahr, das Motorrad des Lehrers glitt lautlos wie ein Phantom neben ihm her. Er verlangsamte sein Tempo. Der ahnungslose Fanselow fuhr nun eine Nasenlänge vor ihm. Stötzel fixierte den Rücken seines Lehrers und dachte: „In die linke Seite muß ich stechen!“ Kein Gedanke mehr an ein bloßes Ritzen.
Fanselow spürte die peinliche Situation und versuchte sie mit Worten zu überspielen: „… wenn du eine Abreibung kriegst, die kannst du doch wohl verkraften.“
Das war der Moment. Stötzel zog die Reibahle aus der Hosentasche, fuhr dichter an den Mann heran und rammte sie mit voller Wucht in dessen Rücken. Der Stoß ließ ihn schwanken, und beinahe wäre er vom Rad gestürzt. Der Lehrer fuhr noch einige Meter, ehe ein Schlagloch das Motorrad zum Kippen brachte.
Fanselow lag bäuchlings im Sand. Er versuchte sich aufzustützen und stöhnte: „Stötzel, warum?“
Aus dem Tank des Motorrads lief inzwischen Benzin. Die Räder trudelten allmählich aus. Immer wieder wollte sich Fanselow aufrichten, aber Stötzel war bereits bei ihm und stach abermals in den Rücken seines Lehrers, den die Kräfte verließen. Er stöhnte. Mit weit aufgerissenen Augen drehte er den Kopf zur Seite und starrte auf den Angreifer. Immer wieder stieß er hervor: „Stötzel, warum, Stötzel!“
Der Junge war über die Wirkung seiner Attacke erschrocken, Angst schüttelte ihn. Gleichzeitig überkam ihn eine unbeschreibliche Wut über die Fassungslosigkeit des Lehrers, der doch hätte wissen müssen, wie sehr er gelitten hatte. Die Wut machte ihn so benommen, daß er sich später nur noch bruchstückhaft daran erinnern kann, wie er das Tatwerkzeug wieder einsteckte und einen großen Feldstein nahm, um seinem Lehrer den Kopf zu zertrümmern. Erst als er kein Lebenszeichen mehr wahrnahm, ließ er von seinem Opfer ab.
Es war still geworden auf der Landstraße nach Grabow. Stötzel betrachtete seine Hände und die Kleidung. Sie waren fast sauber. Das Hemd des Lehrers dagegen sog sich mit Blut voll. Aus den Wunden sickerte es rot in den Sand.
Urplötzlich ließ seine innere Starre nach. Ein neuer Gedanke ergriff von dem Jungen Besitz: Fanselow muß verschwinden! Also packte er seinen Lehrer an den Füßen und schleifte ihn weit ins dichte Unterholz des Waldes. Abseits jedes zufälligen Blicks ließ er den Körper im Dickicht liegen.
Wieder auf der Landstraße, fand er die Aktentasche, die er weit in den Wald schleuderte, ehe er das Motorrad aufrichtete, um es sorgfältig hinter einer dichten Gebüschgruppe zu verstecken. Mit einem Zweig fegte er den Sand über die kleinen Blutlachen und verwischte sie bis zur Unkenntlichkeit.
Jetzt hatte sich der Schüler beruhigt. Ohne Emotionen bestieg er sein Fahrrad und radelte zum Rübenacker seines Vaters, der hinter dem Wald, kurz vor Grabow lag.
Er wußte, wo der Vater gewöhnlich sein Fahrrad und die Geräte am Rande des Feldes ablegte. Dorthin fuhr er. Der Vater arbeitete weit draußen auf dem Acker und bemerkte seinen Sohn nicht. Stötzel griff sich einen Spaten, schwang sich erneut auf sein Rad und kehrte zu dem Dickicht zurück, in das er den Körper seines Lehrers geschafft hatte. Alles dort war ruhig und schien unverändert. Den Spaten bei seinem Opfer zurücklassend, kehrte er unverzüglich zum Rübenacker zurück. Das alles nahm nur wenige Minuten in Anspruch. Jetzt benahm er sich so auffällig, daß der Vater ihn bemerkte und ihm aus der Mitte des Ackers zuwinkte. Warum Stötzel den Spaten zu Fanselow brachte, um dann gleich wieder umzukehren, konnte er sich selbst nicht beantworten.
Jäh hatte ihn die Angst wieder eingeholt, nicht die Angst vor seinem Tun, vor sich selbst, sondern die Angst vor dem Entdecktwerden, wie beim Scheunenbrand. Nein, so eingehend hatte er das alles nicht geplant.
Bloß nichts anmerken lassen, so tun, als sei nichts geschehen! Stötzel griff sich eine Hacke und stapfte über die Furchen hinweg auf seinen Vater zu, sorgsam darauf achtend, daß er die jungen Rübenpflanzen nicht niedertrat.
„Ich habe nicht viel Zeit, muß noch nach Stresow“, sagte er anstelle einer Begrüßung.
„Mach, solange du kannst“, kam es kurz zurück.
Mit schnellen, geübten Bewegungen lockerten die beiden Männer den verkrusteten Ackerboden rings um die Pflänzchen. Bei dieser Arbeit sprach man nicht, sondern hing seinen Gedanken nach. Das Knirschen der Hacken auf der ausgetrockneten, aufstaubenden Erde war das einzige Geräusch. Nach gut einer halben Stunde meinte Stötzel, seiner Pflicht nachgekommen zu sein, und überließ, still und wortkarg wie sonst auch, die endlosen Rübenreihen der Ausdauer des Vaters.
Je weiter er sich vom Vater entfernte, um so stärker plagte ihn der Gedanke an den leblosen Fanselow im Wald. Da war auch wieder die Angst, die kalte Angst, und eine Frage bohrte sich in sein Hirn: Hat ihn schon jemand gefunden?
Aber die Landstraße lag ruhig. Das Knacken der Pedale seines Fahrrads und das Schlagen der Kette an den blechernen Schutz blieben das einzige Geräusch, das der Wald schnell schluckte. Doch ihm kam es laut vor, er meinte sogar, ein Echo zu hören. Bei dem Versteck angekommen, hatte er das Gefühl, als liege Fanselows Körper nicht mehr so, wie er ihn verlassen hatte. Das Herz schlug ihm bis zum Halse. Er beugte sich über ihn, und panischer Schrecken packte den Schüler, als er das leise, kaum hörbare gurgelnde Atemgeräusch vernahm, das Fanselows zertrümmerter Körper noch von sich gab. Hastig zog er die Reibahle hervor und stach blindlings auf den Sterbenden ein. Neunzehn Stiche zählte man später. Der Lehrer war tot.
Jetzt mußte die Leiche verschwinden. Da lag auch noch der Spaten, mit dem er neben dem Toten eine Grube aushob, tief und breit genug, um den leblosen Körper ohne Anstrengungen hineinzurollen. Sodann schüttete er das Grab zu, trat die Oberfläche fest und glich die Stelle mit Laub und Zweigen der Umgebung an.
Er hatte sich wieder in der Gewalt, hatte seine eiskalte Teilnahmslosigkeit wiedererlangt, ja, er fühlte sogar eine gewisse Zufriedenheit über das Werk seiner Spurenbeseitigung. Schließlich fiel ihm noch die weggeworfene Aktentasche seines Lehrers ein. Er fand sie bald und vergrub sie zwei Spatenstiche tief, ohne einen Gedanken an ihren Inhalt zu verschwenden.
Wieder auf dem Weg nach Grabow, kam ihm das Motorrad in den Sinn, das er eigentlich auch hätte eingraben sollen. Doch seine Energie war aufgebraucht. Jetzt konnte er nicht mehr. Nur die Ahle, von ihr mußte er sich noch trennen, und beim Fahren schleuderte er das unheimliche Werkzeug in weitem Bogen in ein Roggenfeld. Daheim säuberte er sofort den Spaten und stellte ihn zu dem anderen Gerät.
Wenig später saß die Familie am Abendbrottisch. Er hatte sich wieder so weit gefaßt, daß er eine Riesenportion Bratkartoffeln und Spiegeleier mit großem Appetit verdrücken konnte. Gleichgültigkeit stieg in ihm auf.
Am nächsten Morgen war die Hölle los. Die Frau des Lehrers hatte nach schlaflosen Stunden und dunklen Ahnungen, daß ihrem Mann etwas zugestoßen sein könnte, in aller Frühe beim ABV eine Vermißtenanzeige aufgegeben. Sie wußte, daß er am Vorabend gegen 18 Uhr das Gehöft der Familie Pandelitz in Stresow verlassen hatte, um in Grabow einen weiteren Elternbesuch abzustatten. Doch Frau Stötzel beteuerte, vergeblich auf den Klassenlehrer ihres Ältesten gewartet zu haben. Der ABV tat sofort das Naheliegende. Auf seine Bitte hin erklärte sich der Revierförster bereit, mit einer Gruppe von Schülern den Weg von Stresow nach Grabow abzusuchen. Unter den Freiwilligen der Suchaktion befand sich auch Stötzel. Noch am Morgen wurde der Wald zwischen den beiden Dörfern in einer Breite von etwa hundert Metern links und rechts der Landstraße durchgekämmt. Nur eine knappe Stunde dauerte es, bis der Revierförster das Motorrad des Lehrers fand. Wenn bis dahin die meisten Beteiligten nicht im geringsten an ein Verbrechen gedacht hatten, zweifelte mit der Entdeckung des Motorrads niemand mehr daran, daß dem Lehrer etwas Ungeheuerliches zugestoßen sein mußte.
Nun brauchte es nur noch wenige Minuten, bis der Förster hinter einem Gebüsch auf frisches Erdreich stieß. Hier mußte gegraben worden sein. Die Erregung der Schüler war auf dem Höhepunkt, doch der ABV ließ die Suche abbrechen. Seine Kompetenz endete hier. Für ihn war ein untrüglicher Verbrechensverdacht entstanden. Seine Meldung an den Kriminaldauerdienst des VPKA Burg führte dazu, daß die Morduntersuchungskommission aus Magdeburg, der Bezirkshauptstadt, angefordert wurde. Wenig später trafen die Spezialisten ein: Drei Mitarbeiter der MUK gemeinsam mit ihrem Chef, zwei Kriminaltechniker, eine Gerichtsärztin und ein Fährtenhundeführer mit „Rex“, einem stattlichen Schäferhundrüden.
Mit großer Vorsicht wurde die vermeintliche Grabstelle freigelegt und der Leichnam des Lehrers Fanselow geborgen. Da die Tatzeit noch nicht weit zurücklag, ließ sich die Leiche sicher identifizieren, und auch die junge Magdeburger Gerichtsärztin konnte noch am Tatort ihre erste Diagnose treffen: Tod durch innere Verblutung infolge scharfer Gewalteinwirkung.
Die Frage nach der vorsätzlichen Herbeiführung der Verletzungen ließ sich anhand der überzeugenden Befunde an der Leiche rasch bejahen: Die Stiche wurden wahllos ausgeführt, teilweise durch das Hemd des Lehrers hindurch, sie trafen im wesentlichen die Rückenpartie, die Blutablaufspuren belegten eindeutig, daß die meisten Stiche gegen das bäuchlings liegende Opfer geführt worden waren.
Diensthund „Rex“ leistete indes eine zuverlässige Sucharbeit. Angesetzt am Fundort der Leiche, verfolgte er die Spur nicht allein bis zur Stelle, an der die Aktentasche vergraben war, sondern verwies sogar in dem an den Wald grenzenden Roggenfeld auf das blutbehaftete Tatwerkzeug.
Die weiteren Ermittlungen bedeuteten für die MUK reine Routine. In der Aktentasche des Lehrers fand man drei Schülerakten, eine trug den Namen „Manfred Stötzel“. Stötzels Angaben zu seinem Alibi für die fragliche Zeit waren voller Ungereimtheiten. Ausreichende Fingerabdruckspuren am Motorrad, an der Tasche und am Tatwerkzeug sorgten ebenso für eine schnelle Begründung seiner Täterschaft wie die an seiner Hosentasche nachgewiesenen Blutspuren mit Fanselows Blutgruppe.
Noch am selben Tag wurde das Ermittlungsverfahren gegen Manfred Stötzel eingeleitet, und er wurde verhaftet.
In den ersten Stunden seiner Vernehmung stellte Stötzel ein naives, leicht durchschaubares Verteidigungsverhalten zur Schau. Darauf folgte eine kurze Pause der Verstocktheit, in der er sich zu einem Gespräch überhaupt nicht bereit zeigte. In den späten Abendstunden schließlich brach er sein Schweigen und begann zunächst zu schildern, wie er den Brand an der Grabower Scheune gelegt hatte. Keineswegs hätten ihn staatsfeindliche Motive bewogen. Er habe erst ein kleines Feuer machen wollen, doch konnte er die Flammen nicht mehr bändigen. Als ihm das bewußt wurde, habe er das Weite gesucht. Bei den Löscharbeiten sei er dann besonders aktiv gewesen, wofür er von den Feuerwehrleuten lobende Worte erntete.
Dann gestand er, den Lehrer getötet zu haben. Eigentlich habe er Fanselow ganz gut leiden können, aber sein bevorstehender Elternbesuch habe ihn so verrückt gemacht, daß er keinen anderen Ausweg gesehen habe. Erst wollte er ihn nur stechen, damit der Lehrer zum Arzt hätte gehen müssen, doch dann sei der Jähzorn über ihn gekommen, und er habe ihn getötet.
Im Ermittlungsverfahren wurde Manfred Stötzel psychiatrisch begutachtet. Mehrere Wochen stand er unter fachärztlicher Beobachtung. Die zahlreichen klinischen Untersuchungen und Explorationen nahm er widerstandslos hin. Er blieb wortkarg und in sich gekehrt, wenngleich er sich an manchen Tagen freundlich und aufgeschlossen, ja zuweilen sogar läppisch albern zeigte.
Das Ergebnis der psychiatrischen Untersuchung beeinflußte den weiteren Verlauf des Verfahrens: Der Gutachter wies nach, daß Manfred Stötzel an einer organischen Schädigung des Stammhirns litt – Folge einer frühen Enzephalitis (Gehirnentzündung).
Diese Schädigung und eine die Persönlichkeit beeinträchtigende auffällige hormonelle Störung, die in der Fachsprache als endokrines Psychosyndrom bezeichnet wird, veranlaßten das Gericht nach § 42 des DDR-Strafgesetzbuches, wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit die Unterbringung Stötzels in einer Heil- und Pflegeanstalt anzuordnen.
Die Antennen-Connection
(Aktenzeichen I BS 46/64 Bezirksstaatsanwalt Erfurt)
Anfang der sechziger Jahre mußte der brave DDR-Bürger für einen Fernsehapparat der einheimischen Marken „Staßfurt“ oder „Rafena“, deren Qualität gegenüber den aus dem sowjetischen Bruderland importierten Geräten unbestritten besser war, um die zweitausend Mark auf den Ladentisch legen, ganz zu schweigen von der Summe, die unterm Ladentisch dem Verkäufer zugeschoben wurde. Das war immerhin ein Betrag, der nahezu zwei Monatsverdiensten eines Arztes in einem großstädtischen Krankenhaus entsprach.
Rentner besaßen allerdings das Privileg, für den Erwerb eines solchen Objekts der Begierde einen großzügigen zinslosen Kredit in Anspruch nehmen zu können. Und nicht einmal eine Anzahlung war notwendig. So wurde manche Oma von ihrer Verwandtschaft gehätschelt und sanft gedrängt, der Familie das ersehnte Utensil zu ermöglichen.
Unmittelbar nachdem am 1. April 1963 das Zweite Deutsche Fernsehen seine erste Sendung ausstrahlte, boomte der illegale Bau von Tunern, kleinen Vorsatzgeräten zur Einstellung auf die UHF-Frequenzen, mit denen das ZDF problemlos empfangen werden konnte. Erst sechs Jahre später, als sich der Arbeiter- und Bauernstaat ein zweites Fernsehprogramm auf dem UHF-Kanal leisten konnte, gelangten auch die Tuner in den sozialistischen Einzelhandel. Nun konnte man ein zweites eigenes Programm empfangen, sehr zum Gefallen der Partei- und Staatsführung, die aber auch in Kauf nehmen mußte, daß ein weiterer Sender des Klassengegners ebenfalls in die Wohnstuben gelangte. Bis dahin aber sicherte der Tunermarkt findigen Bastlern einen einträglichen Nebenverdienst.
Ewald Triglitz, 26, und seine Freunde Rudi Asbach, 25, und Waldemar Pfeffenrat, 28, besaßen zwar nicht das technische Talent, um auf diese Weise ihre Einkünfte aufzumöbeln. Doch sie diskutierten immer wieder die Frage, wie man aus dem allgemeinen Fernsehfieber Kapital schlagen könnte, ohne über die technischen Voraussetzungen für den Tunerbau zu verfügen. Da Ewald Triglitz aushilfsweise in der Erfurter Reparaturwerkstatt der PGH „Radio und Fernsehen“ arbeitete, wußte er immerhin, mit welcher Ungeduld die Kunden auf die Instandsetzung ihrer Geräte warteten. Aber die Werkstatt war völlig überfordert. Ersatzteile standen nur knapp, Ausleihgeräte gar nicht zur Verfügung. Stets war langes Warten angesagt. Er hatte das Werkstattchaos bereits ausgenutzt, um gelegentlich eines der Reparaturgeräte für sich abzuzweigen und unter der Hand umzurubeln. Die Genossenschaft hatte dann dem drängenden Kunden Ersatz schaffen müssen. Für Triglitz konnte das allerdings keine Dauerlösung sein. Das Risiko, erwischt zu werden, erschien ihm doch zu groß.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!