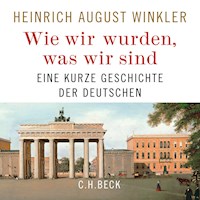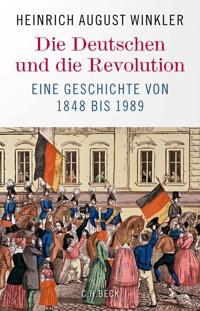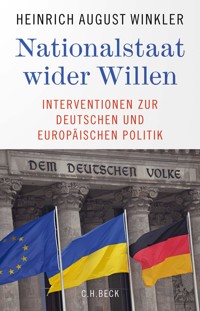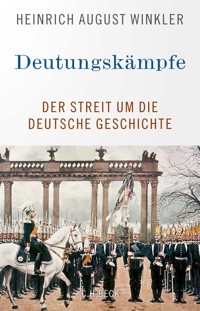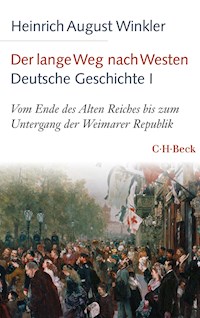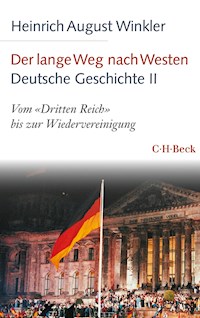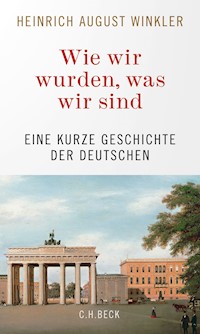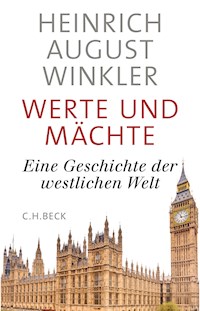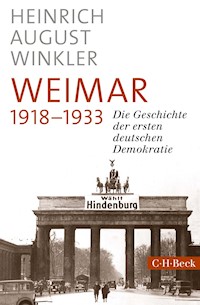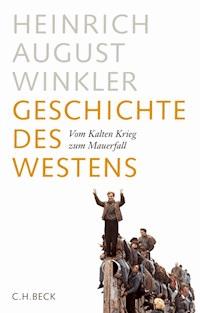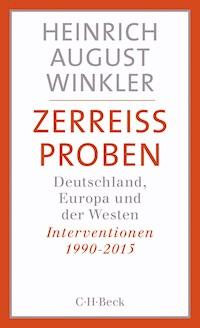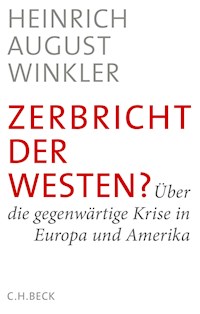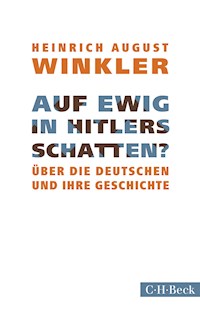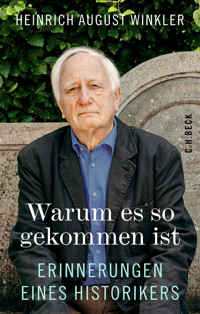
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich August Winkler ist einer der bedeutendsten deutschen Zeithistoriker. Er ist aber auch einer der einflussreichsten deutschen Intellektuellen, der die politischen Debatten unseres Landes bis heute prägt. In diesem Buch erinnert er sich an seinen Lebensweg von Königsberg über Süddeutschland nach Berlin, an Begegnungen und Erlebnisse, an Gespräche und Kontroversen, an Irrtümer und Erkenntnisse. Doch es sind keine Memoiren im klassischen Sinne. Es ist ein Rechenschaftsbericht über ein Leben, das der historisch-politischen Selbstaufklärung der Deutschen gewidmet ist. Daher bieten diese Erinnerungen auch etwas, das heute so nötig ist wie lange nicht mehr: einen politisch-moralischen Kompass in den Zeitenwenden unserer Epoche.
In diesem Buch blickt Heinrich August Winkler zurück auf seine Kindheit in Königsberg und die letzten Wochen des "Dritten Reiches", die er in Württemberg erlebte. Er berichtet von seinen Prägungen in der Nachkriegszeit, von seinen wissenschaftlichen und politischen Vorbildern, von frühen Begegnungen mit Konrad Adenauer und Willy Brandt, vom Kampf um die Verwestlichung der Bundesrepublik. Er erinnert an die deutsche Teilung und ihre Überwindung, an die Gründung der Berliner Republik und seine Interventionen zu politischen Streitfragen der Zeit, bis hin zu seiner Kritik an der Ostpolitik der SPD und seinen frühen Warnungen vor Putin. Er beschreibt seine Rückkehr nach Königsberg, seine frühen Reisen in die USA und die DDR sowie seine Gespräche mit Gerhard Schröder, Wolfgang Schäuble, Jürgen Habermaas, Ralf Dahrendorf, Reinhart Koselleck und vielen anderen. Vor allem aber zeigen diese Erinnerungen eines der großen Intellektuellen der Bonner und Berliner Republik, welch weiten Weg Deutschland seit dem Zivilisationsbruch des "Dritten Reiches" in Richtung Westen zurückgelegt hat und welche Errungenschaften, aber auch Verpflichtungen damit verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
HEINRICH AUGUST WINKLER
Warum es so gekommen ist
ERINNERUNGEN EINES HISTORIKERS
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Bildteil
Vorwort
1. Warum ich Historiker wurde Geschichte in praktischer Forschungsabsicht
Prägungen
Von Berlin nach Freiburg: Lehrerfahrungen und Forschungsschwerpunkte
Professor an der Humboldt-Universität: Der Westen wird zu meinem Leitthema
2. Politische Interventionen und Kontroversen
Von Königsberg nach Ulm: Erinnerungen an Krieg und Nachkriegszeit
Von der
CDU
zur SPD: Erfahrungen aus drei Jahrzehnten
Folgen einer friedlichen Revolution: Berlin in den 1990er Jahren
Was alles strittig war: Innenpolitische Kontroversen
Rot-Grün an der Macht: Die Anfänge der Berliner Republik und das Echo des «Langen Wegs nach Westen»
Beitritt oder Partnerschaft? Die Türkeifrage
Am Anfang war ein Glaube: Die Entstehung meiner «Geschichte des Westens»
Beginn einer Zeitenwende: Putin beendet die Nach-Kalte-Kriegszeit
Gegen ein deutsches Moralmonopol: Die Flüchtlingskrise 2015/16
Es bleibt beim Staatenverbund: Meine Selbstrevision in Sachen Europa
Abschied von deutschen Illusionen: Der Ukraine- und der Nahostkrieg
3. Begegnungen und Erlebnisse
Zeugen ihrer Zeit: Wie kam es zu 1933?
Zaungast der Primaries: Die
USA
im Sommer 1968
Das andere Deutschland: Neun Wochen in der
DDR
Polen: Ein Land im Umbruch
Spurensuche in Kaliningrad: Ein Besuch im einstigen Königsberg
Eindrücke von drei Jahrhundertgestalten: Churchill, de Gaulle, Adenauer
Gespräche mit deutschen Politikern. 1. Helmut Schmidt und Wolfgang Schäuble
Gespräche mit deutschen Politikern. 2. Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher
Streitgespräche mit einem Freund: Bronisław Geremek, die Türkeifrage und der Irakkrieg
Drei große Intellektuelle: Reinhart Koselleck, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas
Fortschritt oder Verlust? Folgen der digitalen Revolution
Epilog
Dank
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Dörte
Bildteil
Meine Eltern, Dr. Theodor Winkler und Brigitte Winkler, geb. Seraphim, 1937
Doris Seraphim (stehend) und Sophie Seraphim um 1953 in Ulm
Ansicht von Urspring, um 1945/46
Klassenfoto des Humboldt-Gymnasiums von 1952/53: Der Autor steht in der zweiten Reihe ganz rechts
Oberstudienrat Dr. Walter Reichle im Februar 1954
Besuch des Politischen Seminars der Ulmer Jugend im Bundeshaus in Bonn am 4. Februar 1954: Bundestagspräsident Hermann Ehlers (links) und der Autor
Der Autor mit Robert Schuman im Oktober 1955 in Paris
Empfang des Politischen Seminars der Ulmer Jugend im Schöneberger Rathaus: der Regierende Bürgermeister von Berlin Otto Suhr (links) und der Autor März 1956
Bundeskanzler Konrad Adenauer in Bad Boll am 22. Juni 1954, aufgenommen vom Autor bei einer Tagung der Evangelischen Akademie
Beauftragung des Autors zur Berichterstattung über den Deutschen Historikertag 1956 für die Ulmer Nachrichten
Der Autor um 1963 in Ulm
Hans Rothfels
Hans Rosenberg
Ernst Fraenkel
Richard Löwenthal
Dörte Winkler, Bronisław Geremek und der Autor im September 1983 am Narew
Gesprächsrunde in Masuren 1985 (von links nach rechts: der Autor, Hanna Geremek, Maria Walicka, Bronisław Geremek, Jerzy Holzer)
Der Autor im Gespräch mit Markus Meckel (Mitte) und Jürgen Habermas anlässlich einer Tagung in Werder bei Potsdam 1994
Der Autor im Juli 1994 an der Grabstätte Immanuel Kants bei einer Reise nach Kaliningrad (ehem. Königsberg)
Symposium anlässlich des 85. Geburtstags von Helmut Schmidt am 26. März 2004 in Hamburg (von links nach rechts: Johannes Paulmann, Fritz Stern, Henry A. Kissinger, Theo Sommer, Ralf Dahrendorf, Hans-Peter Schwarz, Heinrich August Winkler)
Der Autor im Gespräch mit Altbundespräsident Richard von Weizsäcker am 30. Januar 2009
Der Autor im Gespräch mit Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich der Gedenkstunde von Bundestag und Bundesrat am 8. Mai 2015
Der Autor im Gespräch mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Christoph von Marschall anlässlich der Präsentation des vierten Bandes seiner «Geschichte des Westens» in der Nikolaikirche in Berlin im Januar 2015
Der Autor bei seiner Rede im Bundestag anlässlich der Gedenkstunde zum 70. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2015
Der Autor mit den Staatsspitzen am 8. Mai 2015 (in der ersten Reihe von links nach rechts: Bundesratspräsident Volker Bouffier, der Autor, Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle)
Der Autor im Gespräch mit Friedrich Merz anlässlich der Präsentation seines Buches «Zerbricht der Westen?» im Januar 2018 bei der Atlantik-Brücke
Vorwort
Was ich in diesem Band vorlege, sind keine klassischen «Memoiren». Es sind drei Kapitel mit Rückblicken auf mein Leben, von denen jedes einen eigenen Schwerpunkt hat. Am Anfang des Buches stand eine Anfrage. Im April 2022 erhielt ich einen Brief meiner Historikerkollegen Christof Dipper und Heinz Duchhardt. Sie informierten mich über ihr Vorhaben, einen Band unter dem Arbeitstitel «Historiker im Selbstportrait: Autobiographische Zeugnisse der Geschichtswissenschaft in Deutschland» zusammenzustellen. Dazu sollten Historiker beitragen, die zwischen den ausgehenden 1920er Jahren und dem Jahr 1942 geboren wurden. Ich ging gern auf die Bitte ein, mich an dem Projekt zu beteiligen, und legte den Herausgebern im September 2022 das Ergebnis vor. Der von Dipper und Duchhardt herausgegebene Band ist im Frühjahr 2024 unter dem Titel «Generation im Aufbruch. Die Geschichtswissenschaft im Spiegel autobiographischer Porträts» erschienen.
Eine erweiterte Fassung dieses Beitrags bildet das erste Kapitel meines Buches. Es ist gewissermaßen ein erster Durchgang durch mein Leben: eine Skizze, in der, dem Zweck des Sammelbandes entsprechend, mein wissenschaftlicher Werdegang und meine Tätigkeit als akademischer Lehrer und Forscher im Vordergrund stehen. Anderes trat notwendigerweise in den Hintergrund: etwa meine persönlichen Erinnerungen an meine ostpreußische Heimat, an die Endphase des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegszeit, meine ersten Gehversuche in der politischen Bildungsarbeit und meine frühen Begegnungen mit Politikern, meine Ablösung von den konservativen Prägungen durch die Familie, der Austritt aus der CDU 1961 und der Eintritt in die SPD im Jahr darauf, meine publizistischen Interventionen und meine Rolle in einer Reihe von politischen Kontroversen, vor allem in der Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands und meinem Wechsel von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an die Humboldt-Universität zu Berlin im Jahr 1991, meine Gespräche mit Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, meine Eindrücke von Politikern und Intellektuellen, denen ich im Laufe meines Lebens begegnet bin.
Ich entschloss mich deshalb, es nicht bei dem Überblick über mein Historikerleben zu belassen, sondern ihn unter dem Titel «Geschichte in praktischer Forschungsabsicht» zum ersten Kapitel eines Erinnerungsbandes zu machen, der zwei weitere Kapitel enthält: «Politische Interventionen und Kontroversen» und «Begegnungen und Erlebnisse». Für die Zeit seit 1989 kann ich mich dabei auf fortlaufende Tagebuchaufzeichnungen stützen.
Dass das zweite und das dritte Kapitel sehr viel umfangreicher sind als das erste, bedeutet nicht, dass mir meine außerwissenschaftlichen Aktivitäten wichtiger gewesen wären als meine Arbeit in Lehre und Forschung. Vielmehr wird erst in diesen beiden Kapiteln deutlich, vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund sich meine Themenwahl, meine Fragestellungen und historischen Urteilsmaßstäbe entwickelten, was ich als Echo auf meine Arbeiten erlebte, und, was den letzten Punkt angeht, vor allem die Bücher, mit denen ich über die Fachwelt hinaus ein breiteres, an Geschichte und Politik interessiertes Publikum erreichen wollte. Ich denke dabei besonders an die 1993 erschienene Geschichte der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, an die beiden Bände des «Langen Weges nach Westen», einer deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, aus dem Jahr 2000 und die vier Bände der «Geschichte des Westens», die ich zwischen 2009 und 2015 vorgelegt habe.
Das Stichwort politische Bildungsarbeit ist bereits gefallen. Letztlich waren alle meine Veröffentlichungen, und nicht nur die zur besonders gegenwartsnahen Geschichte, Versuche, zur politischen Aufklärung beizutragen. Die Frage, welchen Einfluss Geschichtsbilder auf die Politik der jeweiligen Zeit hatten, hat mich seit meinen Studententagen beschäftigt. Sie stellt sich auch heute, und das in allen Ländern und allen politischen Kulturen.
Im wiedervereinigten Deutschland werden wir tagtäglich mit der Tatsache konfrontiert, dass die Spaltung des Landes in zwei Staaten und zwei politische Kulturen Langzeitfolgen hat, die sich unter anderem im unterschiedlichen Wahlverhalten in Ost- und Westdeutschland zeigen. Von einer gesamtdeutschen politischen und Geschichtskultur sind wir noch weit entfernt. Vor allem im zweiten Kapitel dieses Buches gehe ich ausführlich auf diese Herausforderung an Politik und Wissenschaft ein.
Mein Buch erscheint zu einer Zeit, in der vieles von dem, was wir in den westlichen Demokratien nach den Umbrüchen und Aufbrüchen des 20. Jahrhunderts für unumstrittene Erkenntnisse und Errungenschaften hielten, nicht nur von außen, von autoritären oder neototalitären Mächten, sondern auch von innen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, in Frage gestellt wird.