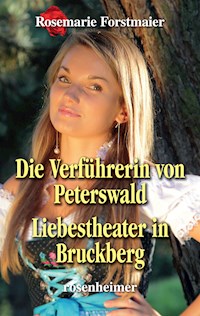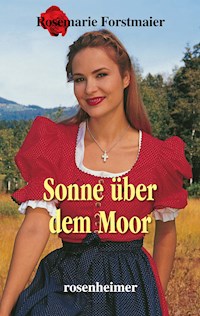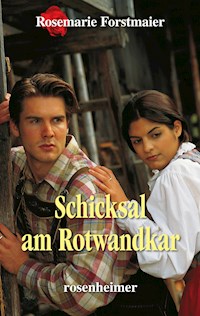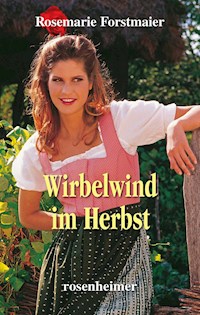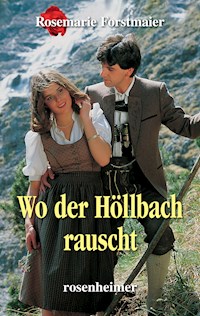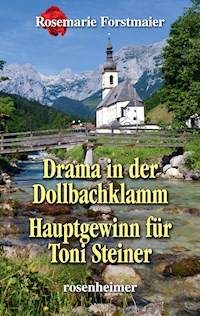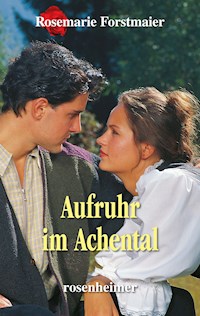16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Moosham gerät die Dorfidylle durcheinander, als eine Bergbahn auf den Spitzkogel gebaut wird. Nicht nur, dass zwischen dem Bürgermeister und dem Postwirt eine erbitterte Feindschaft entbrennt, beide Männer müssen auch noch miterleben, wie die für den Bau angereisten Fremden die Gefühle ihrer Töchter in Aufruhr bringen. Erst als es am Berg zur Katastrophe kommt, beginnen sich die ersten Mooshamer zu fragen, ob sie wirklich den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Studio von Sarosdy, Düsseldorf
Satz: Tau Type, Bad Sauerbrunn
eISBN 978-3-475-54644-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
Rosemarie Forstmaier
Der leise Ruf
In Moosham gerät die Dorfidylle durcheinander, als eine Bergbahn auf den Spitzkogl gebaut wird. Nicht nur, dass zwischen dem Bürgermeister und dem Postwirt eine erbitterte Feindschaft entbrennt, beide Männer müssen auch noch miterleben, wie die für den Bau angereisten Fremden die Gefühle ihrer Töchter in Aufruhr bringen. Erst als es am Berg zur Katastrophe kommt, beginnen sich die ersten Mooshamer zu fragen, ob sie wirklich den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Die Herbstsonne schien noch recht kräftig, brachte die buntgefärbten Wälder zum Glühen und Leuchten, derweil auf den Wiesen das satte Sommergrün schon verblaßte. Ein tiefblauer Föhnhimmel spannte sich über Berge und Täler, und in dieser glasklaren Luft rückten Gipfel und Grate schier zum Greifen nahe.
Es lag aber weniger am Föhn, was viele Leute in Moosham so aufgeregt und bremsig machte, als vielmehr daran, daß dieses Dorf, dicht am Fuß des steilaufragenden Spitzkogls gelegen, heute einen denkwürdigen Tag beging. Freilich, des einen Freud, des andern Leid. Denn so recht einig war man sich nicht, ob man sie brauchte oder nicht, ob sie ein Fluch oder ein Segen sein würde, die Bergbahn auf den Spitzkogl. Trotzdem, ab heute war es amtlich und genehmigt: die Bahn wird gebaut!
Unter der breitästigen, schon ganz mit herbstlichem Gold überschütteten Linde, die mitten im Dorf wuchs, stand ein hölzernes Kioskhäuschen; gleich in der Nähe, beim Kronprinzen-Denkmal, waren die Bus-Haltestelle und etliche Bänke zum Ausruhen und Schauen. Und so war es nicht verwunderlich, daß der Kiosk-Pauli in seinem holzgezimmerten Miniatur-Laden längst zu einer allseits beliebten Institution geworden war; gewissermaßen eine Art Kommunikationszentrale, da man hier um einiges mehr erfuhr, als in seinen Zeitungen und Zeitschriften stand. Hier wurde über Gott und die Welt geredet, auch große Politik gemacht, und es waren gerade die sogenannten kleinen Leute, deren Meinung nirgends Gewicht hatte, die nie gefragt wurden, die sich hier am liebsten trafen und so manch hitzige Debatte miteinander ausfochten. Schon gleich gar an einem Tag wie dem heutigen. Der Pauli lehnte im offenen Schubfenster, auf die ausgelegten Zeitungen gestützt, und folgte dem Disput seiner fünfköpfigen Kundschaft mit gespannter Aufmerksamkeit.
»... schuld ist der Bürgermoaster, sag ich! Der hat uns das ein’brockt. Und ich kann’s enk auch verraten warum«, brummte der alte Schleifer Lois nuschelnd, zündete sich mit zittrigen Säuferhänden seinen erkalteten Zigarrenstumpen an. »Zum einen möcht er sich ein Denkmal setzen, das später einmal einen jeden an den großartigen Schmetterer Hias erinnert. Und zweitens kann er seine sumpfigen Mooswiesen als teuren Baugrund verkaufen. Habt’s mich?!«
»Naa, naa, das därfst net sagen«, mischte sich der Bäcker ein, der gerade einen Korb mit frischen Brezen für den Pauli brachte. »Die Bahn ist ein Aufschwung fürs ganze Dorf, und da profitiert ein jeder davon.«
»Ja, am meisten ihr G’schäftsleut«, pflichtete ihm der Maurer Anderl bei, der seinen rechten Arm in der Schlinge trug, krank feierte, wie man hier sagte. Mit der Linken griff er in den Korb, holte sich eine knusprige, warme Breze, und sofort taten es ihm die übrigen nach.
»Fünfe weniger, Pauli«, sagte der weißbemehlte Meister großzügig, der allzu froh war, seiner heißen Backstube entronnen zu sein und sich immer gern an einem kurzen Diskurs beteiligte.
Der Schleifer Lois, er tat sich ein wengl hart mit dem Beißen, mummelte mit vollem Mund: »Die Gemeinde macht Schulden, und uns haun sie’s auf die Steuern drauf. Irgendwo muß das viele Geld doch herkommen!«
Der Schleifer Lois, er tat sich ein wengl hart mit dem Beißen, mummelte mit vollem Mund: »Die Gemeinde macht Schulden, und uns haun sie’s auf die Steuern drauf. Irgendwo muß das viele Geld doch herkommen!«
»No, halt von der Aktieng’sellschaft. Und daß sich die Gemeinde da auch beteiligt, ist doch selbstverständlich. Kannst dir ja auch ein paar Aktien kaufen, nachher g’hört dir auch ein Stückl davon«, beschwichtigte der Bäcker schmunzelnd.
»Fallert mir grad ein. Von was denn, ha? Vielleicht von meine paar Markln Renten.«
»Wo jetzt die Genehmigung durch ist, wird’s doch auch bald mit der Arbeit aufgehen«, wandte der Kreuzer Sepp ein, dem man es ansah, daß es ihm nicht sonderlich gutging. »Alles, was ich mir von der Bahn derhoff, ist eine Arbeit.«
»Arbeit wird’s genug geben«, meinte dazu der Maurer Anderl. »Fragt sich bloß, für wen? Ob da unsere Handwerker mithalten können, ob sie überhaupt gefragt sind?«
»Du wärst schon gut«, fiel ihm der Bäcker ins Wort.
»Warum denn nachher net, ha?«
»Mein Chef sagt, und der muß es schließlich wissen, daß der Wohler seine eigenen Arbeiter aus der Schweiz herbringt, Italiener und ...«
»Gastarbeiter? Ausländer?« entfuhr es dem Kreuzer betroffen.
»Naa, Spezialisten, die für den Wohler auf der ganzen Welt Bergbahnen bauen. Fachleut ...« er brach ab, denn am Straßenrand hielt ein Traktor an.
Es war der Zwerger Simon, der von seinem Gefährt stieg, zum Kiosk ging. »Aha, schon bei der Brotzeit!« meinte er zu den auf einmal recht müßig Herumstehenden. »Pauli, die Fernseh-Zeitung!«
Der Pauli wußte, was diesen ansonsten so freundlichen, beliebten Menschen heute drückte. Doch er brachte nur ein recht hilfloses: »Geht sonst noch was ab?« zustande.
»Naa, du, ich bin schon vollauf bedient. Vergelt’s Gott!«
»No, no, Zwerger, du tust ja grad, wie wenn gleich die Welt untergehen tat«, hielt ihm der Bäcker aufmunternd entgegen. »Das ist halt der Fortschritt; den kann keiner aufhalten, und keiner kann z’rückstehen.«
Die von harter Arbeit schon etwas gebeugte Gestalt des Bauern straffte sich, ehe er gereizt hervorstieß: »Fortschritt? Fortschritt ist das für mich keiner, das ist bloß Geldgier. – Kann schon sein, daß du etliches an Brot und Semmeln mehra verkaufst – das heißt: wenn sich net mit enkerem großen Aufschwung über kurz oder lang so ein billiger Großmarkt breitmacht.«
Das tat weh, und schon fiel ihm der Getroffene aufgebracht ins Wort: »Sowas tat der Schmetterer nie für gut heißen; net als Bürgermeister und net als Bauer, daß er seine eigenen G’schäftsleut so eine Laus in den Pelz setzt.«
»Es gibt aber noch andere Bauern, die kleinen, die zu kämpfen haben, die sich net lang b’sinnen, wenn so ein Angebot kommt ... Naa, naa, mich kannst gleich streichen«, fügte er mit einem spröden Schmunzeln hinzu. »Mir wird eh von meinem wenigen Boden genug unter den Füß’n weggerissen, mein Almgrund zerschunden, verdorben und versaut. Ich brauch jedes Fleckl selber, wenn’s weitergehen soll.«
»Wirst es sehen, Zwerger, es wird alles halb so schlimm werden, wie du dir das jetzt ausmalst«, beruhigte ihn nun auch der Pauli. »So ein wengl Aufschwung tut schon not. Woanders geht’s ja auch vorwärts, da braucht man sich ja bloß umschaun.«
Der Bauer nahm seine Zeitung, bezahlte und wandte sich zum Gehen. Mißmutig stieß er noch hervor: »Ihr werdet’s schon noch sehen, wohin das führt, wenn einmal das große Abräumen kommt! Wenn dieser Raubbau an der Natur so weitergeht. Allweil bloß von der Natur kann man net leben. Wir alle müssen aber mit ihr leben!« Er ging mit einem grüßenden Nicken davon.
»Geh, Pauli, gib mir auf den Schreck auffi ein Flaschl Bier«, sagte der Maurer mit einem erleichterten Aufschnaufen.
»Für dich auch eins, Brezenschmied?«
»Naa, ich muß wieder in meine Backstubn. Servus, mitnander!«
Alle, außer dem Kreuzer Sepp, ließen die Bierflaschlverschlüsse aufschnappen, prosteten sich im Stehen zu. Der eine und der andere genehmigte sich noch eine Breze dazu, und einer meinte: »Schau, Pauli, wennst halt jetzt noch einen Leberkäs oder heiße Würstel hättst, nachher könnt man bei dir anständig Brotzeit machen.«
Damit hatte er einen wunden Punkt angesprochen. Der Pauli und seine Wally wünschten sich nichts sehnlicher als so ein Brotzeit-Standl hier mitten auf dem Dorfplatz.
»Ja, das wär schon was«, gab er mit einem etwas bitteren Aufseufzen zu. »Aber der Kiosk steht auf Gemeindegrund, und sie geben mir keine Konzession für einen Ausschank.«
»Du verkaufst doch eh Bier und Schnaps und ...«
»Bloß in der Flaschen, und eigentlich därf’s da keiner trinken, und Glasl därf ich schon gleich gar keins dazugeben.« Er deutete zum Gasthof Zur Post hinüber, der schräg gegenüber lag, und fügte etwas spöttisch hinzu: »Da könnt ja sonst der Brenner Luck etliche Halbe weniger verkaufen. Er ist am ärgsten dagegen, daß ich einen Imbiß mit Ausschank krieg. Und als der beste Spezi vom Bürgermeister hat er’s leicht ... Ah, guten Morgen, Frau Postrat! Was därfs denn sein? Das neue Rätselheft ist da.«
Die schon etwas zerrupfte Fasanenfeder auf dem Hut der korpulenten Endfünfzigerin zitterte merklich, als diese ihren vorwurfsvollen Blick von einer Bierflasche zur anderen wandern ließ und im Vorbeigehen knarzend bemerkte: »Und das schon am Vormittag!« Dabei waren die Mannsleut ohnehin bereits, wie von einer eiskalten Zugluft erfaßt, vor ihr zurückgewichen.
»Das sollten S’ net tun, Herr Ringsgwandl, so früh schon Alkohol ausschenken«, wurde der Pauli noch abgemahnt, als sie bezahlte und wieder davonrauschte.
Sie war kaum außer Hörweite, als der Schleifer Lois mit einem verächtlichen Schnauben sagte: »Was sich die alte Schatulln einbildet! Geht sie das was an?«
»Ihr stinkt’s halt noch allweil, daß sich unser Postrat von ihr nie nix hat dreinreden lassen. Dem kreuzfidelen Zirngibl selig ist eine Maß Bier und eine zünftige G’sellschaft allweil wichtiger g’wesen wie seine damische Alte.«
Aber schon war die überkandidelte Witwe vergessen, denn nun kam einer, den man seit jeher schätzte und mochte.
»Grüß dich, Kramer!« rief ihm der Maurer Anderl entgegen.
»Guten Morgen, Herr Grünbeck! Was soil’s denn sein? Auch eine Halbe? Frische Brezn sind auch da.« Der frühere Dorfkramer Anton Grünbeck lehnte mit einem verschmitzten Schmunzeln, aber entschieden ab: »Fürs Bier ist’s mir noch ein bißl früh, aber eine Brezn und eine Schachtel Virginia hätt ich gern.« Auf den verbundenen Arm des Maurers weisend, erkundigte er sich: »Wie geht’s denn?«
»Nimmer der Red wert. – Grad vorhin hast was versäumt. Der Zwerger hat sich mit dem Breznschmied bös über unsere Bahn auslassen.«
»Was? Der Bäcker auch?«
»Naa, natürlich net. Aber der Zwerger.«
»Kein Wunder, wo sie doch die Mittelstation auf seinen Almgrund bauen, und ein Lift und eine Abfahrt gehn auch über seinen Grund. Verstehen kann man das schon, denn er tut sich ja eh net so leicht mit seine bucklerten Wiesen. Ihn wird’s schon hart derwischen.«
»Sag bloß, du bist auch dagegen?« fiel ihm der Maurer ins Wort, stellte das leere Flaschl auf die schmale Holztheke.
Es gab wohl kaum einen, der die häuslichen Verhältnisse eines jeden gebürtigen Mooshamers besser gekannt hätte als Anton Grünbeck; nicht umsonst war er über vierzig Jahre lang in seinem Gemischtwarenladen gestanden, wie sich seine Krämerei früher genannt hatte. Da weiß einer schon, wo’s schwelt oder brennt, und woher der Wind weht. Und er hatte nichts vergessen, erinnerte sich – ganz im Gegensatz zu so manch anderem – noch genau, wie es früherszeiten gewesen war, wie sich alles verändert hatte. Und er war vor allem einer, dessen Blick sich nicht getrübt, der sich den Sinn für die Realität bewahrt hatte.
»Es steht halt einmal fest, daß die Zeit net stehenbleibt und keiner so kann, wie er grad möcht. Die einen wollen noch mehr Fortschritt, denen kann’s net schnell genug gehen, und die andern möchten wieder alles rückgängig machen. Doch ehrlicherweis muß man schon zugeben, daß früher, in unserer guten alten Zeit, auch net alles so rosig gewesen ist.«
»Da hast recht, Kramer«, pflichtete ihm der alte Schleifer vorschnell bei. »O mei, wenn ich dran denk, ... bitter arm sind wir gewesen, und die meisten waren net viel besser dran. – Naa, naa, das muß man schon zugeben, so gut wie jetzt ist es uns noch nie ’gangen.« »Wir sind ja eh lang, bis weit in die sechzger Jahr, hint dran gewesen«, wandte einer ein. »Das Tal der Büffl hat man’s g’heißen, zwegen unserer Rückständigkeit. Und für viele sind wir allweil noch die Moosbüffl. Aber das wird ihnen jetzt schon vergehen, wenn wir mit einer Bergbahn aufwarten.«
»Der erste Aufschwung hat eh erst mit dem Fremdenverkehr angefangen, auch das muß man zugeben«, sagte der Grünbeck. »Da ist’s mit dem Investieren und Bauen losgegangen. Und da hat halt so mancher einen Buckel voller Schulden gehabt, die er mit der Vermieterei in die paar kurzen Sommermonat gar net z’rückzahlen kann. – Außerdem werden die Gast’ allweil anspruchsvoller. Jetzt muß schon jedes Zimmer ein Bad oder doch eine Dusche haben, wennst es vermieten willst. No, und das heißt halt wieder investieren. Was liegt denn da näher, als daß man auch Wintergäst, Schifahrer braucht. – Und so geht halt eins ins andere; jeder möcht leben, möcht net z’rückstehen. Verstehen muß man das schon.«
»Nachher bist also doch auch für die Bahn, Kramer?« Merkwürdigerweise gab dieser darauf keine genaue Antwort, meinte statt dessen: »Man muß allweil zwei Seiten sehen und auch ein wengl dazuhelfen, das Beste für jeden draus z’ machen.«
»Und? Steigst ein und kaufst dir jetzt Aktien?« wollte der Maurer wissen. »Siehst dir da einen G’winn?«
»O mei, G’winn«, kam es zweifelnd, jedoch mit einem Schmunzeln gemildert, zurück. »Was brauch ich auf meine alten Tag noch einen G’winn! Ich hab mein Auskommen. – Sagen wir es einmal so: Wenn keiner ein Risiko übernimmt, bloß an sich selber denkt, nachher wird’s nie was. Sehen wir es doch einmal so: Man kann nix mehr zurückdrehen, jetzt ist es schon einmal wie’s ist. – Jessas, jetzt muß ich aber weiter. Ich muß noch in die Gärtnerei und etliche Blumen für mein Reserl holen.«
»Keinen G’winn! Keinen G’winn will er haben«, stieß der Maurer-Anderl sarkastisch hervor, kaum daß der Grünbeck gegangen war. »Der tut sich leicht mit seinem vielen Geld. Ich möcht net wissen, wieviel ihm der Supermarkt für seinen Laden und dem schönen Grundstückl mitten im Dorf zahlt hat als Ablöse.«
»Schön dumm war er gewesen, wenn er net verkauft hätt, wo er und seine Frau sich ihr Lebtag lang geplagt haben«, hielt ihm der Kreuzer Sepp entgegen. Aber gleich drauf setzte er mit einem Gedankensprung hinzu: »Wenn’s bloß mit der Bahn bald aufging, daß man wieder eine Arbeit kriegt.«
»Geh zu, Bahn«, winkte der Schleifer, der allmählich das Interesse daran verlor, geringschätzig ab, »davon hab ich eh nix. Mir wär’s lieber, wenn bei uns der Zug wieder halten tät, daß man net andauernd auf den Bus angewiesen ist.«
»Wer weiß, am End wird unser Bahnhof wieder aufgemacht, wenn bei uns wieder mehra los ist, wenn’s mehra Fahrgäste gibt. Das, mit dera Streckenstillegung war auch so ein Blödsinn, den keiner versteht.«
Indes hatte der Pauli etliche Kundschaft bedient, die sich um die Bierflaschl-Politiker nicht weiter gekümmert hatten, genau so wenig wie der gußeiserne Kronprinz auf seinem Sockel, der über Moosham mit all seinen Veränderungen schon seit langem majestätisch wohlwollend hinwegsah.
Herr Grünbeck hatte ein paar Worte mit Antonio gewechselt, der ein paar spinndünne Stühle und winzige Tische an der Wand seiner Pizzeria aufstellte, die bei der hiesigen Jugend sehr beliebt geworden war. Wortreich hatte ihm der temperamentvolle Sizilianer versichert, daß er – naturalmente – sich an der Bergbahn beteiligen, auch Aktien kaufen wollte. Ja, ja, dachte sich der Grünbeck, g’wiß auch einer, dem es kaum um den Gewinn geht. Was der Antonio und seine Maria wollen, warum sie ihr mühsam verdientes Geld dafür opfern, hat einen anderen Grund: Dazugehören möchten sie halt endlich, nicht länger als Fremde, als Ausländer angesehen werden. Ob man sich eine Heimat erkaufen kann, möcht ich bezweifeln.
Nun ging er über die Straße auf den Supermarkt zu, der vor etlichen Jahren das alte Kramerhäusl verdrängt hatte.
Die Verkäuferin in der Obst- und Gemüseabteilung begrüßte ihn besonders herzlich. Denn die Allinger Margret hatte fast an die zwanzig Jahre bei ihm, zuerst als Lehrmadl und dann als Ladnerin, gearbeitet.
»Gibst mir ein paar Bananen und einen schönen, frischen Salatkopf! Weißt eh, für meinen Hansi.«
Sie schmunzelte verstehend, suchte gewissenhaft aus, denn sie wußte warum, auch daß es dabei weniger um den Kanarienvogel als vielmehr um ihn selber ging. Er hatte sich nämlich geschworen, nie mehr in seinem Leben ein welkes Salatblatt, einen angedörrten Wurstabschnitt oder eine braunfleckige Banane zu essen; diesen Luxus leistete er sich. Zu lange hatten er und seine Frau von der Ware gelebt, die man der Kundschaft nicht mehr zumuten konnte. Jetzt sollten andere Zusehen, wie sie ihren übriggebliebenen Ausschuß loswurden!
»Ist’s so recht, Herr Grünbeck?«
»Freilich, Margret, dank dir schön! Wie geht’s dem Franzi? G’fallt’s ihm bei die Gebirgsjäger drin?«
Ihr Gesicht wurde etwas besorgt, ehe sie ausweichend antwortete: »No ja, jetzt am Anfang geht’s schon ein wengl streng zu. Aber da muß er halt durch. Am ärgsten ist es mir halt, weil er so selten heimkommt. Die Fahrerei ist so umständlich und dauert mit dem Bus so lang. Jetzt redet er von nix anderem mehr als von einem Motorradi. Mir ist das gar net recht.«
»Margret, dein Franzi ist ein ruhiger, b’sonnener Bub, keiner von die Wilden«, unterbrach er sie aufmunternd. »Einen anständigeren und verantwortungsvolleren Buben – und ich kenn ihn doch auch, seit er auf der Welt ist – könntest dir gar net wünschen. Und drum brauchst bei ihm keine Angst haben; er weiß schon, was er tut. Laß ihm die Freud; und er fahrt doch auch gern zu dir heim. – Wie ist es denn damit?« Dabei zwinkerte er ihr zu, rieb Daumen und Zeigefinger vielsagend gegeneinander. »Ich bin auch allweil noch sein Göd! Und dafür hat man schließlich auch seinen Paten.«
»Naa, naa, Herr Grünbeck«, wehrte sie fast beleidigt ab, »er hat sich selber alles z’sammgespart. Schon seit seiner Lehrzeit.«
»Ja, so einen Buben wie deinen Franzi hätten wir uns auch allweil g’wünscht, mein Reserl und ich. Aber no, der Herrgott wird’s g’wußt haben, warum er uns diesen Wunsch net erfüllt hat. – Du, jetzt muß ich weiter, in die Gärtnerei. Der frühe Reif hat den Tagetes den Garaus g’macht, und drum muß ich schauen, daß ich noch was anders krieg.«
»Gehen S’ zu, Herr Grünbeck, jetzt werden S’ Ihnen aber schwer tun; und in ein paar Wochen ist eh Allerheiligen.«
»Nix da! Ein wengl was werd ich schon finden. Mein Reserl hat Blumen allweil so gern g’habt«, entgegnete er, und dabei erschien ein feuchtes Glänzen in seinen Augen.
Als er ging, sah ihm die Allinger Margret nach, bis er aus der Tür war. Einen besseren Menschen als ihn konnte man sich kaum denken.
*
Bienengesumm lag über dem stillen Fleck geweihter Erde mit den vielen blumengeschmückten Hügeln zwischen weißen Kieswegen. Nur von der angrenzenden Steinmetzwerkstatt, die hinter der umfriedenden Mauer lag, hörte man gedämpftes Arbeitsgeräusch: Hämmern und Meißeln. Doch dies störte die Ruhe der stillen Schläfer wohl kaum; gewiß ebensowenig das Rechen und das in regelmäßigen Abständen vernehmbare Auf- und Zuschnappen eines Bierflaschlverschlusses. Letzteres rührte vom Angerer Aloise, dem Friedhofswärtl, der zudem auch als Totengräber fungierte, her; ein Amt, das halt auch versehen werden mußte.
Ob nun der Aloise, ein zaundürres, stets kreuzfideles Manndl, sein Flaschl ständig brauchte, um diese doch ein wenig makabre Tätigkeit verrichten zu können, oder ob er diese Arbeit nur tat, weil er halt das Bier allzu gern mochte, mag dahingestellt bleiben. Er war allseits beliebt, und er hatte sich im Laufe der Jahre fast zu einem Philosophen entwickelt, der mit seinen entschlafenen Schutzbefohlenen so manche stumme Zwiesprache hielt.
Auch jetzt blieb er vor einem prächtigen schwarzmarmornen Grabstein stehen. Therese Grünbeck stand in noch frischen Goldlettern zu lesen, was ihn wieder zu einem lautlosen und einseitigen Diskurs veranlaßte. Freilich, nicht ehe er sich mit einem Schluck aus seinem Bierflaschl gestärkt hatte, das er in einer gestutzten Buchsbaumeinfassung versteckt und gut gekühlt hielt.
Sich mit dem Handrücken über die Lippen und das stoppelige Kinn wischend, dachte er: Eine patente Person ist sie gewesen, unsere Kramerin; allweil freundlich und freigebig, hat mir oft ein Flaschl extrig zugeschoben. – Nix als wie Arbeit und G’schäft ihr Lebtag lang, allweil hinterm Ladentisch. Sie hätt sich schon noch etliche schöne Jährlein verdient, jetzt, wo’s ihnen soviel besser gegangen war. Viel hat sie nimmer davon gehabt, vom ruhigen Ausrasten im neuen Haus; grad noch zwei Jahr. – Ein wengl ehnder hätten sie halt das Massel haben sollen, mit dem neuen Supermarkt, der so scharf auf ihre gute G’schäftslag g’wesen ist und ihnen für die alten Hürben viel Geld zahlt hat.
Er genehmigte sich noch einen Schluck, verstaute das Flaschl wieder in der Buchsbaumhecke, ehe er seine Betrachtungen über die Grünbeckischen fortsetzte: Kinder wenn dagewesen wären, wär’s was anders. Was soll denn jetzt er allein mit seinem Geld anfangen? Noch dazu wo er gar keiner ist, der sich viel vergönnt! Und ohne sein Reserl schon gleich gar nimmer.
Er kramte noch seinen Schmalzler aus der Brusttasche seiner schon arg abgerissenen Joppe, nahm eine gehörige Pris und rechte weiter, seine Gedanken einer anderen, in die Ewigkeit übersiedelten Person zuwendend.
Eigentlich hätte er sich mit dem Instandsetzen der Wege jetzt etwas tummeln müssen. Allerheiligen war nicht mehr weit, und von den Bäumen und Sträuchern fiel bei jedem Windstoß das Laub, legte sich als raschelnder Teppich zwischen die Gräber. Und es gab immer etliche Bißgurn – ja, dabei handelte es sich ausschließlich um die Weiberleut –, die sich über die geringsten Nachlässigkeiten seinerseits sofort beschwerten.
Vom dickbäuchigen Zwiebelturm der Kirche schlug es soeben zwei Uhr, für den Aloise Zeit, sich bei seiner gemächlichen Arbeit wieder ein bißl auszurasten.
»Was, schon zwei, und ich bin noch net fertig«, entfuhr es Frau Hermine Häubl erschreckt, und schon zerrte sie sich die Kleiderschürze vom mageren Leib, griff sich fahrig ins wohlondulierte ergrauende Haar und schoß aus der altmodisch möblierten Küche in den hohen, düsteren Flur hinaus. »Sie wird sicher schon da sein, die Frau Postrat.« Seit sie allein lebte, hatte sie es sich angewöhnt, mit sich selber zu reden. Dabei hatte auch ihr Ehemann selig, der Herr Stationsvorsteher Josef Häubl, nie sonderlich viel mit ihr gesprochen. Er war ein wortkarger, mürrischer Mensch gewesen, dessen einziges Interesse ausschließlich seinem Beruf, der Eisenbahn gegolten hatte.
Dieser überaus diensteifrige, farblose Mann war dann auch, als man die Nebenstrecke nach Moosham aus Rationalisierungsgründen stillegte, einfach gestorben; vielleicht aus Protest oder auch aus Bosheit, weil man ihn seines Lebensinhaltes beraubt hatte. Zwei Jahre lag dies nun zurück, seit dieser Zeit bewohnte seine Witwe ganz allein das obere Stockwerk des verlassenen Bahnhofsgebäudes, etwas außerhalb des Dorfes. Man hatte ihr dies auf Lebenszeit – sozusagen als Alterssitz – gestattet.
Während Frau Hermine Häubl nervös hin und her wieselte, sich den schmalkrempigen, leicht verschossenen Filzhut aufs Haupt drückte, verließ die ebenfalls verwitwete Frau Berta Zirngibl mit herrischen, Überheblichkeit verratenden Schritten ihr Haus. Auf dem leicht blond getönten Haar trug sie den unvermeidlichen Filzhut mit der Fasanenfeder; so wie sich das für eine Frau ihres Standes gehörte.
Mit einem kleinen Gießkännchen machte sie sich auf den Weg zu ihrer »sogenannten« Freundin; eilte zielstrebig durchs Dorf, hierhin und dorthin herablassend grüßend, zur Kirche. Eigentlich, um genauer zu sein: zum Friedhof.
Auch sie hatte sich verspätet; es war bereits zehn Minuten nach zwei, als sie am Friedhofstürchen ankam. Doch schon kam Hermine Häubl, hektisch wie immer, aus der entgegengesetzten Richtung herangehastet.
Und nun begann ein Ritual, das sich stets in der gleichen Form abspielte. Zwei einsame Frauen, die kaum noch einer beachtenswert fand, nahmen sich gegenseitig wichtig. Dabei spielte es kaum eine Rolle, daß man sich gar nicht so sonderlich gern mochte. Was sie zusammenhielt, war dies: Wir höhere Beamtengattinnen gegen den Rest der Welt! Es war ihnen, außer ihrem Dünkel, kaum noch etwas geblieben. – Und etwas braucht der Mensch eben, um sich dran festzuhalten.
»Jetzt sind S’ aber schon wieder zu spät, Frau Stationsvorsteher«, rügte die Altere mit deutlich gereiztem Unterton.
»Müssen S’ schon entschuldigen, Frau Postrat, aber ich hab mich eh so tummelt«, kam es atemlos, in demselben gequälten Bayrisch und mit schuldbewußter Miene, zurück.
Akkurat das war es, was erwartet und beabsichtigt wurde, und schon war die Rangordnung wieder hergestellt.
»Ich weiß net recht, Frau Postrat, ob man jetzt nach dem Reif, der etliches verdorben hat, noch was pflanzen ...«
»Unsinn!« fiel ihr Frau Zirngibl zurechtweisend ins Wort. »Wo’s eh bald Allerheiligen ist und man alles neu herrichtet.« Selbstgerecht und mit unterschwelliger Bosheit fügte sie hinzu: »Ich hab eine schöne dicke Kerzn kauft für’s Ewige Licht. Das hat er sich schon verdient, mein Alfons selig!«
Für was denn? fragte sich die Häublin insgeheim ergrimmt. Dafür vielleicht, daß er sein Lebtag lang das Gehalt ins Wirtshaus tragen, versoffen und Karten gespielt hat! Da ist der meinig schon viel sparsamer gewesen!
Diese beiden hatten es sich zur Aufgabe gemacht, ihre teuren Verblichenen zu Heiligen zu erheben, jetzt, wo sie sich gegen diese Heiligsprechung nicht mehr wehren konnten.
Dies hatte der Angerer Aloise längst durchschaut. Aber auch sonst hatte er diese beiden so dick wie der Teufel das Weihwasser, wich ihnen lieber aus. Nur war dies im begrenzten Raum des Friedhofes nicht ganz einfach.
Auch jetzt lugte er hinter einem Grabstein hervor, sah die beiden über den Gräbern ihrer verstorbenen Ehemänner knien, die nicht weit voneinander entfernt lagen, eifrig herumhackend und zupfend. – Wie die Krähen nach einem warmen Regen! war dazu seine Interpretation. Er für sein Teil hätte auf diese zwei eifrigen Friedhofsgängerinnen gern verzichtet.
Doch nun erregten knirschende Schritte auf dem Kiesweg seine Aufmerksamkeit. Als er sah, wer da kam, verzog sich sein faltiges Nußknackergesicht zu einem erwartungsvollen Grinsen, und er machte es sich in seinem Versteck etwas bequemer, wissend, daß ihm nun einige unterhaltsame Abwechslung geboten wurde.
Auch die beiden eifrigen Scharrerinnen hoben ruckartig die behüteten Köpfe, schnellten wie auf Kommando auf, jede mit einem sichtlich erwartungsvoll hungrigen Lächeln.
Herr Grünbeck kam ebenfalls mit Gießkanne, Werkzeug und einem Spankorb, wollte zum Grab seiner Frau. Als er die beiden gewahrte, blieb er mit einem freundlichen Gruß stehen. »Grüß Gott, die Damen!« Das war er noch von seinem Geschäftsleben her so gewohnt, war ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen. »Auch fleißig beim Saubermachen? Gell, das schöne Wetter muß man noch ausnützen.«
Sofort machte sich Berta Zirngibl zur Wortführerin, sagte vorschnell und überschwenglich herzlich: »Jessas, unser Herr Grünbeck! Grüß Ihnen Gott! – Grad vorhin hab ich zur Frau Stationsvorsteher gesagt, wie’s wohl dem Herrn Grünbeck gehen mag?«
Jene allerdings konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, staunte über die unverfrorene Dreistigkeit ihrer Freundin. »Ob er z’rechtkommt, und den schweren Verlust schon überwunden hat?«
Vorschnell, doch deutlich reserviert, kam es zurück: »No ja, Frau Postrat«, auch er wußte, wie sehr diese ehemalige und zumeist recht schwierige Kundin auf diesen Titel pochte, und weil er ein liebenswürdiger Mensch war, tat er ihr halt den Gefallen, »das Leben muß weitergehen. Sie wissen’s ja selber. Das ganze Jammern und Klagen macht keinen nimmer lebendig. Aber arg ist es schon, so allein.«
»Wem sagen S’ denn das, Herr Grünbeck«, tat sie salbungsvoll, von einem brunnentiefen Aufseufzen begleitet. »Ich sag’s oft zur Frau Stationsvorsteher: Mit meine Händ tät ich ihn ausgraben, meinen Alfons, wenn ich ihn z’rückholen könnt.«
Auch eine glatte Lüge! mußte die Häublin bei sich feststellen. Sie selber kam überhaupt nicht zu Wort. Obwohl der stramme, gutaussehende Wittiber nach einer Fluchtmöglichkeit suchte, wurde er von ihrer Freundin nicht so ohne weiteres entlassen. Ganz schön aufdringlich! dachte sie. Und dabei, nicht zuletzt auch beim Anblick dieses noch rüstigen Mannsbildes, kam ihr zwangsläufig ein Verdacht, der gar nicht einmal so unverständlich war. Schließlich befand man sich immer noch im besten Alter! Hin und wieder, man verbrachte ja viel Zeit ganz allein, kamen schon so Gedanken, wie es denn wäre, wenn ... Und ein bißl was möchte man halt vom Leben auch noch haben. Das war doch nichts Unrechtes?! Gar zuviel, das gestand sie sich beim Anblick dieses liebenswürdigen Mannes verschämt ein, hatte sie von dem Ihrigen, Gott hab ihn selig, auch nicht gehabt. – Aber sich gleich so ins Zeug legen, wie das die Zirngiblin tat, war direkt peinlich.
»Ja, dann, meine Damen«, machte nun der Herr Grünbeck kurzen Prozeß, »wünsch ich noch einen schönen Tag. Ich muß dazutun, daß ich meine Pflanzl einsetz«, und damit schritt er davon.
Kaum war er außer Hörweite, beide starrten mit unverhohlen sehnsüchtig bewundernden Blicken hinter ihm her, zischelte die ältere abfällig: »Haben S’ es g’sehen, Frau Postrat, sündteure Chrysanthemen hat er drin g’habt, in seinem Korb. Was anders ist wohl net gut genug«, letzteres hatte neidvoll geklungen. »Wo’s der nächste Reif eh wieder alles hin macht.«
»Mei, er kann sich’s halt leisten.«
Obgleich in ihren Augen immer noch dieser begehrliche Glanz lag, schnarrte sie geringschätzig: »Freilich, jetzt hat er’s! Aber früher sind die Grünbeckischen für jedes Zehnerl dankbar gewesen, das man in ihren Laden getragen hat.« Geradezu schadenfroh fügte sie hinzu: »Und was hat er jetzt von seinem Geld, dem neuen Haus, frag ich Sie, Frau Stationsvorsteher? – Net einmal Kinder sind da!«
Aha, das war wieder ein Seitenhieb auf sie gewesen, die Häublin. Auch ihre Ehe war kinderlos geblieben. Ihre Freundin tat sich nicht wenig wichtig mit ihren zwei Kindern, obwohl Sohn und Tochter, beide längst verheiratet, sich so gut wie nie bei ihr blicken ließen. Daraufhin erfrechte sie sich zu einem etwas schnippischen: »Er wird schon wissen, wie er es sich einrichtet. Wer weiß, am End hat er gar ’s Heiraten noch einmal im Sinn.«
Die Fasanenfeder geriet ins Zittern. Anstatt wie gewöhnlich zurückzuschnappen, sie ließ sich ansonsten nicht ungestraft über den Mund fahren, erwiderte sie nur anzüglich: »Wenn unser Herrgott einen Esel braucht, nachher laßt er einem älteren Mann das Weib sterben!« Zu spät merkte sie, daß sie, was sie sonst tunlichst zu vermeiden versuchte, etwas ins Gewöhnliche abgerutscht war.
Stillvergnügt vor sich hingrinsend, setzte der Angerer Aloise noch eine Pris drauf, nachdem er sein Flaschl geleert hatte, und machte sich schön langsam wieder an seine Arbeit. Aber so lange diese beiden hier in seinem Reich noch beschäftigt waren, verlegte er seine Tätigkeit doch lieber hinter die Kirche.
Indessen kniete sich Anton Grünbeck auf die steinerne Einfassung des Gevierts, das seinem geliebten Reserl zur letzten Wohnstätte geworden war, und begann die vom Frost verbrannten und nun schwärzlich verfärbten Tagetes auszugraben. Dabei unterhielt er sich stumm mit ihr, geradeso, als hielte er sie über alles auf dem laufenden. Aber immer kam ihm halt das große, tiefe Bedauern, sein Kummer dazwischen, daß sie nicht mehr bei ihm, daß er nun allein war.
...du weißt es eh, Reserl, wie ich mich jeds Jahr auf einen schönen Herbst g’freut hab. Aber so richtig schön war’s halt bloß mit dir, wenn wir mitnander spazierengegangen sind. Allweil am Sonntag, gleich nach dem Essen ..., auch das schmeckt mir nimmer so recht. Ich bin halt kein guter Koch, weißt eh. – Das Wohnzimmer hab ich gestöbert, ja, wirklich, blitzsauber ist es geworden. Aber freilich ..., allein daheim ... Auf d’Nacht halt das Fernsehn, auch wenn’s meistens ein Schmarrn ist. Doch müd wird man zum Glück davon. – Heiland, daß ich’s net vergeß: Eine ganze Maschin voll Wäsch hab ich verfärbt, weil ich einen Socken mit einibracht hab. Ich hab mich net schlecht g’ärgert. Aber das ist dir ja auch ab und zu passiert, weilst allweil die Händ voller Arbeit g’habt hast, mit dem Laden. – O mei, Reserl, wie schön könnten mir’s jetzt mitnander haben ... Hier seufzte er schmerzlich auf und schluckte, ehe er versuchte, sich mit einem: Doch der Herrgott wird’s schon wissen, warum’s so sein hat müssen! zu trösten. Aber so recht gelang es ihm halt doch nicht.
Während Herr Grünbeck so mit sich und seinem Reserl und seinen Pflanzen beschäftigt war, ließen die beiden Beamtenwitwen den Brunnen an der Friedhofsmauer nicht aus den Augen. Jede lugte und äugte, versuchte dies jedoch tunlichst vor der anderen zu verbergen.
Und wie’s der Zufall wollte, war man haargenau mit der Arbeit fertig, als sich aus der erwarteten Richtung Schritte näherten. Und flugs hielt jede ihr Gießkanndl in der Hand, dann ging’s zum Brunnen.
Man hatte sich jedoch leider getäuscht. Es war nur der Friedhofswärtl gewesen, der nun einen Diskurs mit dem ehemaligen Kramer hielt. Es sollte nicht sein; für heute mußte man auf eine weitere Begegnung mit ihm verzichten.
Mit widerwilligen und enttäuschten Gesichtern verließen beide Damen den von herbstlicher Sonne überflirrten Gottesacker.
Plötzlich, ganz unvermittelt brach es aus der verwitweten Frau Postrat heraus: »Unsereins ist ja jetzt der Garniemand mehr! Heut auf d’Nacht ist ja beim Postwirt die Feier mit einem Essen wegen der Bergbahn, weil’s doch jetzt alles amtlich ist. – Frühers, wie mein Alfons noch gelebt hat, wär man dabei net übergangen worden, da hat man dazugehört. Aber jetzt ... Ich hab nix g’hört und g’sehen von einer Einladung. Und ich möcht wetten, daß die Pemmlerin dabeihockt.«
»Das ist schließlich auch die Frau vom Nachfolger des Herrn Postrat selig, und er wird ja auch dabei sein«, entfuhr es Frau Häubl ziemlich unüberlegt. Etwas mildernd und tröstend setzte sie hinzu: »Ich bin ja auch net eingeladen.«
Nach einem doch recht verächtlich verletzenden Blick auf ihre Begleiterin ereiferte sich Frau Zirngibl, wiederum etwas ins Gewöhnliche verfallend: »Aber mich können sie auch kreuzweis ..., wenn sie meinen, daß ich ihnen auch bloß eine einzige Aktie abkauf. – Freilich, der Meinige selig hätt sich g’wiß breitschlagen lassen und hätt bei dera großartigen Spinnerei vom Bürgermeister mitgehalten. Er war ja mit dem Schmetterer allweil gut Freund, auch im Wirtshaus, beim Brenner ...«
Hastig, ehe sie noch mehr heraussprudelte und verriet, was ihr und ihnen beiden hernach leid täte, unterbrach Hermine sie: »So regen S’ Ihnen doch net auf, Frau Postrat. – Haben S’ net g’hört, man soll billige Fahrschein kriegen, wenn man Aktien kauft.«
Mit einer an ihr recht ungewohnten Hellsichtigkeit wandte die Zirngiblin immer noch erregt ein: »Das könnten teure Karten werden. Nein, ich dank schön dafür! Von mir aus können sie bauen, was sie meinen, aber net von meinem Geld.«
»Hinauffahren möcht ich schon einmal gern, auf den Spitzkogl. Ich bin ja noch gar nie droben gewesen. Mein Josef hat für sowas nie was übriggehabt.«
»Der Meinig auch net. Trotzdem brauch ich keine Bahn!« Das Thema war damit für sie erledigt.
Hinter dem Friedhofstürchen trennte man sich; jede schritt wieder ihrer häuslichen Einsamkeit entgegen.
*
Draußen dämmerte ein nebelverhangener Morgen herauf. Um diese Zeit war es im »Gasthof zur Post« noch ungewohnt still.
Um so lauter war es am gestrigen Abend bis in die späte Nacht hinein hergegangen, als der Bürgermeister mit den Honoratioren, den Haupt- und Kleinaktionären, den Sieg für ihr Bergbahn-Projekt gefeiert hatte. Und dabei war gewiß auch schon das eine oder andere Geschäft angebahnt und besprochen worden.
Vom Personal war um diese frühe Zeit noch niemand auf den Beinen, so daß es an der Christi, der einzigen Tochter des Postwirts lag, den abreisenden Gästen das Frühstück zu servieren. Ihr sah man die lange Nacht nicht an, was bei ihren einundzwanzig Jahren und ihrem blühenden, reizvollen Aussehen nicht verwunderlich war.
Auch die unausgeschlafenen, mürrischen Mienen ihrer beiden Gäste erhellten sich, als sie die Gaststube betrat, die Bestellung aufnahm und mit einem freundlichen Lächeln versprach: »Es ist gleich so weit.«
»Danke vielmals! Aber es eilt nicht so sehr«, kam es in kehligem Bernerisch von Herrn Wilhelm Wohler zurück, obgleich er seinen Neffen gerade vorhin noch zur Eile angetrieben hatte.
Auch Bernhard Wohler, mit seinen knapp dreißig Jahren ein korpulenter, zur Schwammigkeit neigender Mann, blickte das bildhübsche Mädchen mit bewundernden Augen an, starrte ihr nach, bis sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte.
Wilhelm Wohler, Inhaber einer für den Bergbahnbau weltweit bekannten Firma, warnte, wieder sein bärbeißiges Gehabe aufsetzend: »Daß du mir die Finger da von dem Maidli läßt! Ich will keinen Arger mit dem Herrn Brenner.«
Mit einem etwas schiefen Schmunzeln versuchte sein Neffe dies mit einem: »Ich bin ein freier Mann, Onkel«, ins Lächerliche zu ziehen.
»Du bist ein Wohler!« kam es zurechtweisend zurück. »Ingenieure hat’s genug; ich kann auch einen anderen hier als Projektleiter einsetzen«, drohte er.
»Hab schon verstanden, Onkel«, gab der Jüngere mit einem gezwungenen Lachen nach.
Indes war der Brenner Ludwig bei seiner Tochter in der großen Wirtskuchl erschienen; auch er machte einen verkaterten Eindruck. Mit einem vielsagenden, breiten Schmunzeln wies er sie drauf hin: »Daß du mir ja für ein anständigs Frühstück sorgst; tu nur was drauf! In der Schweiz ist man sowas g’wohnt.«
»In der Schweiz kostet’s dafür aber auch rnehra«, wandte die Christi spöttisch ein.
Dazu meinte er rundheraus: »Wart nur, bis wir unsere Bahn haben, nachher wird bei uns auch kräftig draufgeschlagen.«
Da auch sie aus seinem Holz geschnitzt, in seinem ausgeprägten Geschäftssinn erzogen worden war, stimmte sie darin mit ihm voll überein.
Mit seinem Doppelkinn in Richtung Gaststube weisend, fragte er mit gedämpfter Stimme: »Was sagst denn nachher zum jungen Wohler? «
»Er ist net grad das, was sich ein jungs Madl erträumt.« Plötzlich hielt er ihren Arm umklammert, redete beschwörend auf sie ein: »Sei net dumm, Christi! Diese Leut haben Geld wie Heu, g’hören zu die wirklich Reichen! Und er hat eh bloß noch Augen für dich! Du, so eine Partie war net zu verachten.«
Geschmeichelt, doch auch ein wenig schnippisch wandte sie ein: »Und das G’schäft? Unser neu’s Hotel, das du bei der Talstation hinbauen willst? Das heißt ...« hier wurde ihr Ton gedehnt, etwas zweifelnd, »wenn dir der Schmetterer den Grund wirklich verkauft.«
»Alles schon abgemacht, nur keine Sorg.« Er schien auch darüber bereits nachgedacht zu haben. »Warum soll er denn net in die Gastronomie einsteigen! Sein Geld dazu ...« er brach ab, schlurpende Schritte näherten sich.
Es war die alte Burgl, ein Dienstbot wie ein Relikt aus alter, längst vergangener Zeit, die nun schon fast zum Inventar gehörte. Treue Seelen wie sie, die sich ihr ganzes Leben lang nur für einen Herrn abgeplagt hatten, gab es heute kaum noch. Doch große Hilfe war dieses gebeugte, schiefgearbeitete Weiblein keine mehr, dafür bedeutete sie für die Christi um vieles mehr, war fast wie eine leibliche Großmutter.
»Jetzt kannst dich ja noch ein wengl zum jungen Wohler aussi sitzen«, raunte der Postwirt seiner Tochter zu.
»Die Burgl kann ...«
»Naa, naa, Vater. Ich rieht das Frühstück für die verwöhnten Herrn schon lieber selber her«, kam es mit versteckter Ironie zurück. Es war schon merkwürdig: Einerseits schmeichelte ihr die Aufmerksamkeit des jungen Mannes, der aus der großen Welt kam, viel gereist, sehr vermögend war. Andererseits jedoch hatte sie ihre Zweifel und vor allem ihren Stolz; sie wollte sich nicht lächerlich machen.
»Er kommt ja bald wieder«, schmunzelte der Brenner süffisant. »Und dann ist noch mehr als genug Gelegenheit, daß man sich näher kennenlernt. Er wird sich für den Bahnbau eh bei uns einquartieren.«
Nun ja, man würde sehen.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com