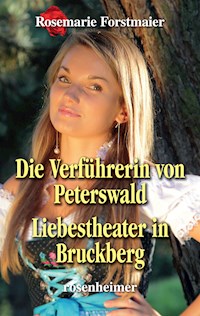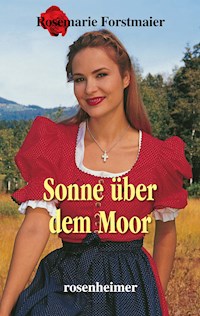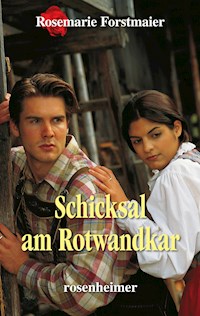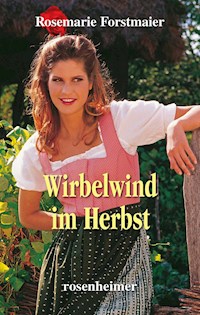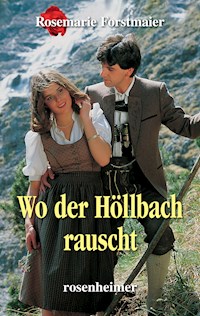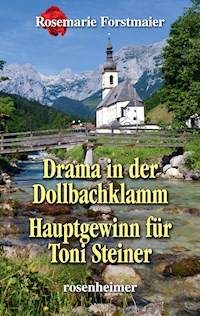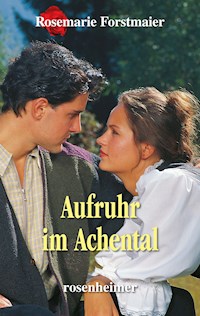16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der sonst so besonnene Oberecker Markus begegnet der geheimnisvollen, verführerisch schönen Maria. Brennende Leidenschaft erfasst ihn. Hals über Kopf verliebt er sich in das Mädchen aus dem fahrendem Volk und vergisst darüber die Veronika vom Nachbarhof. Aber ist es möglich, dass die Liebe dieses ungleichen Paares Bestand hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2009
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Michael Wolf, München
Lektorat, Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger & Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
eISBN 978-3-475-54645-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Rosemarie Forstmaier
Ein Mädchen wie der Wind
Der sonst so besonnene Oberecker Markus begegnet der geheimnisvollen, verführerisch schönen Maria. Brennende Leidenschaft erfasst ihn. Hals über Kopf verliebt er sich in das Mädchen aus dem fahrendem Volk und vergisst darüber die Veronika vom Nachbarhof. Aber ist es möglich, dass die Liebe dieses ungleichen Paares Bestand hat?
Alle sieben Jahre, so sagt man, macht der Wald Hochzeit. Dann stecken Tannen und Fichten unzählige ihrer scharlachroten Blütenkerzen auf.
Ab und zu jedoch geschieht es, dass die Natur allzu verschwenderisch mit ihren Kräften umgeht, aus irgendeinem, dem Menschen unerfindlichen Grund ein so üppiges Blühen anhebt, als würden die Bäume in ihrem tiefroten Schmuck verglühen. Der Wald ist rauschig, heißt es dann mit einem fast ehrfürchtigen, aber auch etwas angstvoll besorgten Staunen. Denn es bleibt auch auf die Menschen nicht ganz ohne Wirkung, wenn sich beim geringsten Windhauch schwefelfarbene Wolken erheben und der Blütenstaub sich wie ein stumpfer, gelber Schleier über die bunten Wiesen des jungen Mai legt und auch in die Häuser eindringt.
So schrieb man schon von alters her jenen Wolken aus befruchtendem Pollen Kräfte zu, die mehr verdarben als nutzten. Sogar manche Menschen sollten davon rauschig werden und Dinge tun, die ihnen ansonsten nie in den Sinn gekommen wären – geradeso als würde dieser gelbe Staub ihren Verstand benebeln.
Auch in diesem Jahr schickte sich der Wald zu einer solch verschwenderischen Blüte an, waren die zottigen Äste der Nadelbäume mit Knospen dick überkrustet.
Feierabendliche Stille lag über den beiden Gehöften im hinteren Winkel des geweiteten, sanft ansteigenden Tales. Der höher gelegene Obereckerhof war bereits in den dunklen Schlagschatten des Bergwalds getaucht, während auf dem östlich des Tales gelegenen Untereckerhof noch goldenes Sonnenlicht lag.
Trotzdem deckte die Unterecker Kathi das Mistbeet sorgfältig mit den alten, teils gesprungenen Fensterhälften ab – vor späten Nachtfrösten war man noch nicht gefeit. Sie schnitt noch ein paar Halme des kräftig sprießenden Schnittlauchs ab, nahm die Schüssel mit den zwei dicken Salatköpfen und ging über den Hof ins Haus.
In der niedrigen Küche hantierte die Barbara am Herd und fragte beim Eintreten ihrer Schwiegermutter: »Kommt der Simon noch nicht? Das Essen wär gleich fertig.«
»Warten wir halt noch ein bissl; er muss ja bald da sein. Geh weiter, Vroni, putz mir noch geschwind den Salat!«
»Ja, Mutter«, antwortete die Tochter, die bereits den Tisch deckte. Es war nichts Auffälliges an dieser Fünfundzwanzigjährigen. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckte man die Ebenmäßigkeit ihres schmalen Gesichtes, die Wärme ihrer braunen Augen.
»Jessas, da ist er!«, entfuhr es der Barbara fast ein wenig erschrocken, als schwere Schritte laut wurden. Und plötzlich entstand unter den drei Weiberleuten eine merkwürdige Hektik.
Kaum war der Unterecker Simon durch die Küchentür getreten, da hastete seine Frau auch schon mit einem »Aber lang bist aus gewesen« auf ihn zu, um ihm Rucksack und Joppe abzunehmen.
»Wie schaut’s aus auf dem Holzschlag?«, erkundigte sich die Altbäuerin. »Bleibt noch was zum Verkaufen?«
Der Simon setzte sich an den Tisch, nahm einen Zug aus der Bierflasche, wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und antwortete mit unverhohlenem Missmut: »Nimmer viel. Das meiste ist Brennholz.«
»Naa, naa, naa, so ein Schaden!«
Die beiden jungen Frauen machten betretene Gesichter, tummelten sich aber umso mehr, das Essen auf den Tisch zu bringen. Beide dachten an das schlimme Unwetter und an die Verwüstungen, die der Sturm kürzlich in der ganzen Gegend angerichtet hatte.
»Jetzt brauchst auch nimmer jammern, Mutter. Jetzt ist das Unheil schon einmal geschehn. Andere hat’s schließlich auch ganz schön erwischt.«
Der Simon begann seine Suppe hungrig und geräuschvoll zu schlürfen. Zwischen Schlucken und Kauen fuhr er fort: »Dem Gerstreiter Jakl hat’s unter der Großen Schneid fast den halben Stangenwald umgelegt und zerdroschen …«
Inzwischen hatte sich auch die Veronika an den Tisch gesetzt. Nun senkte sie plötzlich den Kopf tief über ihren Teller.
»Jessas, da fällt mir ein – ich hab ihm von uns zwei Ferkel zugesagt, weil seine Sau den ganzen Wurf zusammengefressen hat.«
»Gspaßig, dass so was der Gerstreiter Mena passiert«, meinte dazu die Altbäuerin etwas verwundert.
»Der Jakl sagt, seine Mutter wär nimmer so recht auf die Füß und kann’s kaum noch packen.«
»Ja, das hab ich auch gehört«, kam es von der Barbara. »Heiraten sollt er halt, der …« Sie brach unvermittelt ab und warf ihrer jungen Schwägerin einen verstörten und zugleich bedauernden Blick zu.
Auch die Untereckerin hatte gemerkt, woher der Wind wehte, stiftete jedoch noch mehr Unruhe, als sie überstürzt fragte: »Wie schaut’s denn im Holz beim Nachbarn aus?« Und dabei hatte sie doch nur rasch das Thema wechseln wollen!
Veronikas Kinn sank nun vollends auf die Brust, während sie fahrig in ihrer Suppe rührte.
Schon fuhr der Simon heftig auf. »Dieser Oberschlaue ist halt wieder einmal mit einem blauen Aug davongekommen. Im Mischwald hat der Sturm weniger angerichtet.« Diesen letzten Satz hatte er verächtlich hervorgestoßen, ehe er erneut aufbrauste. »Das hat natürlich dem Herrn Forstmeier, dem ich droben begegnet bin, haargenau ins Konzept passt. Auf einmal hört man nichts anders mehr als Mischwald! Mischwald! Wer hat denn uns Bauern das eingebrockt, ha? Doch bloß die Forstbeamten, die Schreibtischtäter in ihren Büros, die uns ständig gepredigt haben …«
»Geh zu, das war doch lang vor deiner Zeit, wie der Vater und dein Großvater den Wald …«
Er ließ seine Mutter nicht ausreden, fiel ihr giftig ins Wort: »Und jetzt haben wir das Schlamassel! Jetzt kann ich mir dem Forstmeier sein saudummes Gered anhören! Aber Gott sei Dank schaut’s im Staatsforst auch nicht anders aus!«
»Ja, da hast was davon!«, wies sie ihn mit leiser Schärfe zurecht.
Es entstand ein kurzes Schweigen, bis er hervorstieß: »Was ist? Gibt’s heut sonst nichts mehr?« Er starrte auf seinen leeren Teller.
Obgleich sie ihre Suppe noch nicht ausgelöffelt hatten, sprangen die Barbara und ihre Schwägerin auf, hantierten geschäftig am Herd. Der Simon war der Bauer, er hatte das Sagen und dies wurde respektiert. So war das von Anfang an gewesen, als er acht Jahre zuvor, kaum fünfundzwanzigjährig, nach dem Tod seines Vaters den Hof bernommen hatte.
Ein warmer Schwall vom Sauerkraut, gemischt mit dem Wacholderduft des gesottenen Geselchten, zog durch die Küche, was den Simon voreilig zu Messer und Gabel greifen ließ. Da fiel ihm plötzlich ein: »Ich mein, ich hätt vorhin beim Vorbeigehn den Toni gesehen.«
Alle drei Frauen horchten überrascht auf, ehe die Barbara einwandte: »Ah geh, da musst dich getäuscht haben. Wo tät denn der auf einmal wieder herkommen?«
»Was weiß denn ich! Aber er muss es gewesen sein. Ich hab doch Augen im Kopf. Die zaundürre Gestalt …«
»Dass ihn der Markus wieder nimmt, kann ich kaum glauben nach all den Scherereien, die er ihm schon gemacht hat, fiel ihm seine Mutter zweifelnd ins Wort. Wer will schon einen Melker, der sich vor der Arbeit drückt, krumme Weg geht und einem die Gendarmen ins Haus zerrt!«
»Vielleicht hat’s dem Markus gar nicht so viel ausgemacht«, kam es mit kaum verhohlenem Sarkasmus vom Simon.
Dies ging der Untereckerin nun doch zu weit und sie hielt ihm aufgebracht entgegen: »Der Markus ist ein grundehrliches Mannsbild und ich versteh nicht, dass du kein gutes Haar an ihm lassen kannst. Ihr seid miteinander aufgewachsen, fast gleichaltrig und er hat keinem was in den Weg gelegt. Schau dir seinen Hof, sein Sach an, dann …«
»Wird er mir auch noch als gutes Beispiel hingestellt, ha?«, schnaubte der Simon erbost. »Hab ich unser Sach nicht grad so gut in Schuss? Bin ich am End ...«
»So was sagt keiner«, erklärte die Mutter streng. »Aber er hat’s um etliches schwerer gehabt als du, hat als Halbwüchsiger schon seinen Vater, der bei der Bergwacht abgestürzt ist, ersetzen müssen. Seit über zehn Jahren ist seine Mutter tot …«
»Ja, ja, ich weiß schon«, unterbrach er sie. »Aber er hat ja die Johanna.«
»Eine Hauserin ist keine Bäuerin«, musste er sich noch belehren lassen.
Nun kamen die Knödel und das Selchfleisch auf den Tisch, was ihn besänftigte, weil er einen Mordshunger hatte und ihm das Essen allemal lieber war als das ständige Gesäusel um den Oberecker Markus. Er mochte den Markus nicht, hatte sich schon als Bub mit ihm abgerauft und sah in ihm eher einen Widersacher – sehr zum Leidwesen der Weibsleute, die auf gute Nachbarschaft hielten.
Barbara und Veronika mischten sich allerdings wohlweislich in derlei Dispute nie ein. Sie hätten nur den Kürzeren gezogen. Widerspruch vertrug der Unterecker nur von seiner Mutter.
Er war beim dritten Knödel, als er innehielt und sinnend vor sich hin blickte. Schließlich sagte er kopfschüttelnd wie zu sich selber: »Ob der Toni bleibt? Wer kann sich denn heutigentags noch einen Melker leisten?«
Die Altbäuerin fischte das letzte Salatblatt aus der Schüssel – sie vertrug die schwere Kost nicht mehr so recht – und erwiderte wie nebenbei: »Der Oberecker Markus schon – wenn er mag!« Es gab noch einen anderen Grund, außer seiner Tüchtigkeit, weshalb sie nichts auf den Nachbarn kommen ließ. Ehe der Simon etwas einwenden konnte, fuhr sie entschieden fort: »Aber das werden wir ja bald wissen, weil ich eh schon hinübergehen und den alten Hiasl wieder einmal besuchen wollt.«
Dies verschlug ihm endgültig seinen gesegneten Appetit. Einen unzerkauten Brocken gewaltsam hinunterwürgend, brachte der Simon undeutlich hervor: »Was rennt’s dem Markus denn andauernd nach? Zu uns herüber hat er auch nicht weiter. Aber es ist ihm wohl nicht danach.«
»Ist doch kein Wunder bei deinem Humor!« Die Barbara schaute angelegentlich auf ihren Teller, Veronikas Wangen liefen rot an.
»Er tät schon kommen, wenn ihm wirklich was dran gelegen wär«, brummte der Simon und warf seiner Schwester einen kurzen Blick zu, »wenn er wirklich ernsthaftere Absichten hätt! Mich braucht er ja nicht zu heiraten. Ich bin auch auf eine solche Verwandt …«
Da sprang die Veronika plötzlich auf und rannte aufschluchzend aus der Tür.
»So, jetzt hast es!«, fuhr die Untereckerin ihren Sohn erbost an. »Dass du auch nie Ruh geben kannst! Was musst denn andauernd sticheln und stänkern?«
»Weil mir das ständige Herumgemauschel um den da« – er wies mit dem Kinn zum Fenster in Richtung Nachbarhof – lang schon auf die Nerven geht. Es gibt auch noch andere auf der Welt.«
»Simon, ich bitt dich«, murmelte nun die Barbara besänftigend, wurde aber sofort mit einem groben: »Du hältst dich da ganz heraus!« zum Schweigen gebracht.
Auch er stand nun auf und verließ die Küche.
Nervös wischte die Altbäuerin über die ohnehin blitzblanke Tischplatte, erhob sich, strich sich die Schürze über dem mageren Leib glatt und sagte verstört: »So, jetzt ist halt das Malheur wieder einmal fertig! – Mannsbilder!«, stieß sie noch etwas geringschätzig und zugleich schicksalsergeben hervor. »Da ist halt jeder von den Zweien so ein sonderbarer Heiliger!«
»›Eisheiliger‹ passt eher«, rutschte es der Barbara heraus.
Nach einem deutlich irritierten Blick gab ihre Schwiegermutter aufseufzend zu: »Na ja, vielleicht hast Recht. Man weiß bei keinem so recht, ist er gereift oder gefroren. – Aber die Veronika sollt sich halt auch langsam besinnen und dem Markus zu verstehen geben, dass sie nicht ewig herwartet.«
»Das glaubst doch selber nicht, dass sie das tut. Sie hat ihn viel zu gern, um was zu riskieren.«
»Es wär gewiss alles anders, wenn sich die zwei Holzköpf ein bissl besser miteinander verstehen würden.«
Auch droben beim Oberecker hatte man die Abendmahlzeit beendet. In der großen, behaglich eingerichteten Bauernstube räumte die Hauserin die letzten Teller vom Tisch, während man aus der angrenzenden Küche das lautstarke Hantieren der Annamirl hörte, die bereits beim Abwasch war.
Der Oberecker Markus stand an einem Fenster, schaute über den Hofplatz zum Obstanger und zum Austragshäusl hinüber, das zwischen verblühenden Bäumen fast versteckt lag.
»Ob er nicht doch das Dableiben im Sinn hat, der Toni?«, kam es unvermittelt von der Johanna.
Beiläufig und ohne sich umzudrehen, erwiderte der Oberecker: »Ach, woher denn. Bis er was findet, darf er bleiben!«
»Das kann lang dauern. Ich hätt mich an deiner Stell erst gar nicht drauf eingelassen.«
»Ich kann ihn doch schließlich nicht weiter schicken, wenn er bloß…«
»Nach allem, was er schon angestellt hat?«
Sich umwendend, stieß er entschieden hervor: »Herrgott, ein Mensch kann sich auch ändern. Und wo soll er denn hin?«
Die Johanna stellte ihren Tellerstapel wieder auf den Tisch, stemmte die Arme in die breiten Hüften und entgegnete scharf: »Dorthin, wo er hergekommen ist. Du glaubst doch nicht, dass er hier in der Nähe eine anständige Arbeit findet? Wer nimmt denn einen, den man beim Wildern, noch dazu beim Schlingenlegen, erwischt und eingesperrt hat?«
»Das ist lang her …«
»Aber gewiss nicht vergessen. Ich fürcht, Markus, da hast dir was aufgehalst – und bloß, weil du nicht nein sagen kannst.«
»Er wird schon was finden.«
Die Johanna schnaufte, was ihre Zweifel zum Ausdruck bringen sollte, nahm ihr Geschirr und trug es hinaus.
Gleich darauf hörte der Markus sie mit der Annamirl schelten, die ihr wieder nichts recht machen konnte.
Aber auch er musste zugeben, dass es schon ein rechtes Kreuz war mit dieser Magd. So fleißig und tüchtig sie bei der Stallarbeit und der schweren Feldarbeit war, so ungeschickt und dumm stellte die Annamirl sich bei der Hauswirtschaft an.
»Jessas, wie ein ausgewachsenes Weibsbild noch so dappig sein kann!«, schnaubte die Hauserin. »Wie oft soll ich es denn noch sagen, dass man die Tiegel und Haferl nicht in die Spülmaschin stellt, sondern mit der Hand abspült? Passt doch sonst nichts mehr hinein!«
Die Annamirl zog einen beleidigten Flunsch, ihr grobes, rundes Gesicht wurde dadurch nicht schöner, und maulte: Wenn noch Platz war da drin, und da hab ich mir denkt …«
»Um Gottes willen, lass das Denken, tu lieber, was man dir anschafft! Stell die Teller in die Maschin und richt dir für die Töpf ein Abspülwasser her!«
»Dass man ihr aber auch nichts recht machen kann«, maulte die stämmige Dirn vor sich hin, kaum dass die Hauserin die Küche wieder verlassen hatte.
Indes hatte der Markus sich erneut dem Fenster zugewandt. Nun sah er die Untereckerin über den Hof kommen. »Wir kriegen Besuch! Die Nachbarin«, sagte er zur Johanna, die den Tisch abwischte.
»Die Barbara oder gar die Veronika?«
»Naa, die Kathi.«
»Ah, was! Wird doch nichts passiert sein?«
Allzu häufig besuchte man sich nicht.
Als die Untereckerin gleich darauf die Bauernstube betrat, begrüßte man sich mit unverhohlener Freude und Herzlichkeit.
Die Kathi stellte ein Glas Honig auf den Tisch und erklärte: »Der ist für den Hiasl. Wie geht’s ihm denn? Ist er jetzt ganz bettlägerig, weil ich ihn gar nimmer seh?«
Da sich die Unterhaltung wohl nur um allerhand Krankheiten drehen würde, verdrückte der Markus sich lieber.
Erst nachdem die Johanna die Besucherin zum Niedersitzen gedrängt hatte, antwortete sie: »Er kommt schon ein Weilchen nimmer so recht auf die Füß.« Ihre Stimme wurde anklagend. »Obwohl er’s bis zu uns herüber nimmer schafft, weigert er sich starrköpfig, in eine Kammer im Hof zu ziehen. Kannst dir vorstellen, Kathi, was für eine Heidenarbeit das ist, wennst ihm jede Mahlzeit hinüber bringen musst!«
»Warum mag er denn nicht her?«
»Frag mich was Leichteres! Recht seltsam und eigenbrötlerisch ist er ja schon alleweil gewesen. Hätt er sonst jahrelang allein im Zuhäusl gehaust? Aber jetzt wird’s mir langsam zu viel …«
»Und der Markus? Was sagt der dazu?«
»O mei, der! Du kennst ihn doch! Man sollt so einem alten Menschen halt diese letzte Freud gönnen, seinen Willen lassen, ist seine Ausred«, beschwerte sich die Hauserin mit einem gereizten Unterton. »An die viele zusätzliche Arbeit denkt er natürlich nicht und an wem das alles hängen bleibt.« Plötzlich fuhr sie heftig auf. »Aber ich weiß schon, warum er sich so sträubt, dieser alte Loder! Weil er Angst hat – und das nicht zu Unrecht –, dass er sein abscheuliches, stinkendes Hundsviech nimmer bei sich in der Kammer haben kann.«
Die Untereckerin wusste nicht so recht, was sie darauf sagen sollte, murmelte begütigend: »No ja, er hängt halt an seinem Nero.«
»Das sagt der Markus auch. Aber mir kommt er nicht ins Haus, schon gar nicht in den Oberstock hinauf.«
»Was sagt denn der Doktor?«
Einen Moment schaute die Johanna verblüfft, dann begriff sie. »Ach so, ja, wegen dem Hiasl. Dass man halt in seinem Alter mit allem rechnen muss.«
»Zusammengeschunden und abgerackert ist er halt auch. Er hat ja alleweil noch fest mitgearbeitet …«
»Siehst, Kathi, das ist meine Red«, fiel ihr nun die Hauserin ins Wort. »Ich möcht einmal nicht so lang werken und mich abplagen. Wo doch heutigentags alles viel besser geregelt ist und ein jeder seine Rente kriegt – auch wenn’s nicht besonders viel ist.«
Etwas betroffen kam es von der Untereckerin herüber: »Jessas, Johanna, hast am End schon das Aufhören im Sinn? Geh zu, du bist doch weiß Gott keine, die die Händ einfach in den Schoß legen kann …«
»Das braucht’s auch gar nicht. Bloß ein bissl leichter möcht man’s schon einmal haben. – Weißt, der Markus verlässt sich halt ganz auf mich.« Nach einigem Zögern setzte sie energisch hinzu: »Heiraten sollt er halt endlich; an der Zeit wär’s!«
Dies brachte nun die Kathi in Verlegenheit. »Da kannst halt nicht dreinreden«, erwiderte sie unsicher. »Ist der Toni wieder bei euch?«, fragte sie dann, um von dem peinlichen Thema wegzukommen.
Und schon ereiferte die Johanna sich wieder. »Der hat mir grad noch gefehlt! Ich wett, der möcht sich bei uns wieder einnisten. Ich glaub’s nicht, dass er woanders eine Arbeit kriegt und bloß so lang bei uns bleiben will, bis …«
»Wo hat er denn die ganze Zeit gesteckt – ich mein, nachdem er … no, ja, nachdem er seine Straf abgesessen hat?«
»Das weiß der Kuckuck. Er sagt, er wär weit herumgekommen und hätt viel gesehen. Wer’s glaubt! So einer, der zwei linke Händ hat, sich bloß mit der Gaunerei fortbringen will, der ist nirgends gern gesehen.«
»Was will er denn arbeiten?«
»Keine Ahnung. Mit der Bauernarbeit hat er jedenfalls nichts mehr im Sinn. Uns liegt er bloß auf der Schüssel, tut kaum einen Handschlag. Ich versteh nicht, dass er sich wieder zu uns hergetraut hat, sich nicht schämt. – Er hat halt gewußt, dass der Markus nicht nein sagen kann. Und warum? Bloß weil der Toni früher etliche Jahr bei uns auf dem Hof gewesen ist und gearbeitet hat …, was heißt gearbeitet …«
»Vielleicht ist er ja bald wieder über alle Berge«, versuchte die Kathi die Hauserin zu beschwichtigen. »Ich glaub, ich schau jetzt doch lieber zum Hiasl hinüber, eh’s zu spät ist. Er ist bestimmt müd und will bald schlafen.«
»Soll ich mitgehen?«, erbot die Johanna sich eifrig.
»Das muss nicht sein. Ich bleib eh nicht lang, will ihn nicht anstrengen.« Die Kathi erhob sich und nahm ihr Honigglasl.
»Na, du, wer weiß, ob er sich nicht wieder eingesperrt hat«, wandte die Hauserin ein und stand ebenfalls auf
Im selben Augenblick kam aus der Küche ein Scheppern und Klirren, gefolgt von einem Aufschrei der Annamirl.
»Ich muss nachschauen, was sie schon wieder angestellt hat, dieses dappige G’schoß«, entfuhr es der Johanna und sie eilte hinüber.
Die Untereckerin verließ den großen Hof und ging zum Austragshäusl. Die Haustür war unverschlossen. So trat sie in den winzigen, dunklen Flur und klopfte.
»Wer ist da?«, ertönte eine etwas brüchige, dünne Stimme. Gleichzeitig hörte man ein jaulendes, schwaches Aufbellen.
»Ich bin’s, die Untereckerin.« Nachdem sie vorsichtig die Tür geöffnet hatte, verschlug es der Kathi den Atem. Ein Schwall abgestandener, miefiger Luft kam ihr entgegen.
Der Hiasl bot einen recht merkwürdigen Anblick in seinem Bett. Er trug ein bunt gewürfeltes Hemd und eine schwarze Zipfelmütze, die er tief ins faltig zerknitterte Gesicht gezogen hatte. Vor dem Bett lag sein großer rotbrauner Hund, der keinerlei Anstalten machte aufzustehen. Der Nero verfolgte schon lange keinen mehr, so dass die Kathi furchtlos herantreten und den Kranken begrüßen konnte.
»Na, wie ist dir denn, Hiasl? Wie geht’s?«, fragte sie, fühlte sich dabei aber nicht gerade kommod, so eingeklemmt mit den Füßen zwischen Hund und Bett.
»Nichts ist’s mehr, wenn sich der Mensch nimmer selber helfen kann«, greinte der Hiasl.
Da der Nero immer noch keinen Rucker tat und es keine Sitzgelegenheit gab, ließ die Kathi sich kurzerhand auf der hohen Bettstatt nieder. Dabei spürte sie etwas Hartes, Kantiges unter sich, schnellte auf und sagte entschuldigend: »Ich fürcht, ich hab mich auf deine Wärmflasche gesetzt.«
Plötzlich schaute der Hiasl sie erschrocken an, fuhr mit beiden Händen unter das Laken und murmelte: »Naa, naa, nicht die Wärmflaschen, bloß …« Damit zerrte er eine bunte, schon rostfleckige Blechschachtel hervor und drückte sie fest an seine eingefallene Brust.
»Heiland, Hiasl, was hast denn da?«
Wie ertappt blinzelte er aus wässrigen Äuglein zur Kathi auf und zögerte, ehe er kleinlaut gestand: »Halt bloß meine Büchsen.«
»Geh zu, so was Verrostetes gehört doch nicht ins Bett, kannst dir damit ja weh …«
»Naa, naa«, wehrte er ab, die Schachtel fest umklammernd, »die brauch ich bei mir, jetzt … no ja halt, weil ich nimmer so gut aufstehen kann, zusperren, dass kein Unrechter hereinkommt.«
Nun hatte die Untereckerin begriffen. Sie wusste um den schon sprichwörtlichen Geiz des Hiasl. »Versteh schon, deine Sparbüchsen«, meinte sie schmunzelnd. »Das nimmt dir doch keiner. Warum lässt es denn nicht auf der Sparkasse?«
»Nichts da! Da ist es mir schon einmal verreckt«, sagte er, während er die kantige Schachtel hinter sich zwischen die zerlegenen Kopfkissen stopfte.
Als die Kathi meinte, ob es nicht gescheiter wäre, die Schachtel im Schrank zu verwahren, war der Hiasl strikt dagegen, wollte nichts davon wissen.
»Wär’s nicht besser, Hiasl, wennst in den Hof hinüber …«
» Naa, naa, nichts da!«, fiel er ihr ins Wort.
»Warum denn nicht? Da wärst doch viel besser versorgt und man könnt sich besser um dich kümmern«, versuchte sie ihn umzustimmen.
»Das braucht’s nicht. Gelt, Nero, wir zwei bleiben da.« Seine Hand tastete sich suchend aus dem Bett, fand den zottigen Kopf des Hundes, streichelte ihn. »Lang wird’s ja eh nimmer dauern.«
»So was darfst nicht sagen, Hiasl! Du kommst schon wieder auf die Füß«, widersprach die Kathi und konnte doch deutlich sehen, wie verfallen der Hiasl schon war – gezeichnet von einem, der sich nicht abweisen oder aufhalten ließ.
Der alte Mann hatte derlei falschen Trost gar nicht mehr nötig. Er wischte ihn mit einer müden Handbewegung beiseite und erklärte kurzatmig, aber klar und entschieden: »Mir wär’s jede Stund recht; ich bin schon geschickt und gerichtet für drüben. Nur um meinen Nero ist es mir halt, wie’s ihm gehen wird, wenn ich nimmer bin.« Seine gekrümmten, schwieligen Finger glitten über das Fell des Hundes, der mit großen, wachen Augen zu seinem Herrn aufsah.
»Jetzt tust aber dem Markus Unrecht, wennst glaubst, er kümmert sich nicht um deinen Nero. Der Markus ist ein rechtschaffenes Mannsbild«, wies sie den Hiasl sanft zurecht.
»Gewiss, gewiss«, bestätigte der mit etwas schwankender Stimme. »Doch er hat halt was anders im Kopf, als drauf zu schauen, dass mein Nero sein Sach kriegt. Und die Johanna … die lässt ihn ja nicht einmal ins Haus hinein.« Plötzlich zuckte ein fast spitzbübisches Schmunzeln über das gelblich wächserne, faltenzerfurchte Gesicht. »Aber ich hab schon dafür gesorgt, dass er’s auf seine alten Tage gut hat. – Gelt, Nero! – Er war ja alleweil meine ganze Freud!« Dabei kugelten ihm nun doch ein paar Tränen über die eingefallenen Wangen.
Wie traurig musste es für einen Menschen sein, wenn ihm nach einem langen, mühevollen Leben nur die Liebe zu einem Tier blieb!
Die Untereckerin schob diesen Gedanken rasch beiseite. »Kann ich noch was für dich tun, Hiasl? Brauchst was?«, fragte sie und stieg über den Hund hinweg.
»Naa, naa, vergelt’s Gott, Kathi!«
»Sorg dich nicht! Unser Herrgott wird’s schon recht machen. Soll ich noch ein Vaterunser mit dir beten?«
Der Hiasl nickte dankbar und faltete die Hände.
Als das Gebet gesprochen war, wünschte sie ihm noch eine gute Nacht, dann ließ sie ihn wieder mit seinem Nero allein in der einsamen Behausung.
Kaum hatte die Untereckerin die Haustür hinter sich geschlossen, da kramte der alte Mann die Blechschachtel aus den Kissen hervor. Er öffnete den Deckel, so als wolle er sich vergewissern, dass noch alles drin sei, und dann schob er sie wieder unter das Laken. Er zog sich noch die verrutschte Zipfelmütze zurecht, murmelte dabei: »Naa, naa, Nero, da lassen wir uns von niemand nichts dreinreden!«, legte sich zufrieden zurück und begann wieder vor sich hin zu dösen.
Matthias Pichler, wie der Hiasl eigentlich hieß, war ein entfernter Verwandter der Obereckerischen und seit seiner Jugendzeit, den Zweiten Weltkrieg ausgenommen, als man ihn eingezogen und auf die Schlachtfelder nach Russland geschickt hatte, in ihrem Dienst gewesen. Ein Sonderling und Eigenbrötler war er von jeher gewesen, hatte sich nie viel aus Lustbarkeiten und schon gar nichts aus den Mädeln und Weiberleuten gemacht. Es hätte ihn wohl auch das Geld gereut. Freilich, viel hatte ein Bauernknecht nie verdient; ein paar Markl halt. Aber wofür er letztlich sparte, das wusste keiner, wahrscheinlich nicht einmal er selbst. Mit zunehmendem Alter hatte sich dieses Knausern und Sparen zu einem regelrechten Geiz ausgewachsen, zu einer ständigen Angst um das mühsam Ersparte.
Der Hiasl hielt sein »Erspartes« ständig irgendwo versteckt; früher unter gelösten Dielenbrettern, und nun, da er sich nicht mehr bücken konnte, eben halt in seinem Bett.
Wenn er sich zu allen heiligen Zeiten wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten einen Wirtshausbesuch leistete, dann steckte er sich vor dem Kirchgang gerade so viel Geld ein, dass es später zu einer Halben Bier und zwei Brezen reichte. Aber wenn zu Jakobi oder Michaeli Markt abgehalten wurde und zwischen den verschiedenen Händlern und Schaustellern auch ein Rossmetzger mit seinem Stand vertreten war, gönnte der Hiasl sich etwas Besonderes – nicht weil er Pferdefleisch gern mochte, sondern weil es um vieles billiger war. Dort erstand er eine Rosswurst, die er jedoch nicht sofort verzehrte. Er nahm sie mit ins Wirtshaus, aß die Hälfte frisch aus dem fettigen Papier zu Bier und Brezen und trug die andere Hälfte heim. Die wurde scheibchenweise aufgeteilt und musste noch für einige Tage reichen. Obgleich daheim auf dem Hof keiner auf derlei Brotzeit scharf gewesen wäre, suchte er auch dafür die ausgefallensten Verstecke und aß nur davon, wenn keiner ihn sah.
Natürlich wussten die übrigen Hofbewohner davon, auch von seiner Angst um sein »Erspartes« und seine ach so geheimen Verstecke. Schließlich bleibt in einer so engen Gemeinschaft kaum etwas verborgen. Doch man nahm seinen Geiz als seine persönliche Eigenart und ließ ihn in Ruhe.
Was der alte Hiasl mit seinem so mühsam zusammengekratzten Sümmchen vorhatte, das wusste also niemand. Und ehe er hinfällig und bettlägerig wurde, hatte er es auch selbst nicht gewusst. Dann aber war ihm allmählich bewusst geworden, dass er umsonst geknausert, für nichts und wieder nichts gespart hatte. Und da ist dem Hiasl, der stets bescheiden und für sich allein gelebt hatte, oft bespöttelt und belächelt worden war, eine Idee gekommen! Allesamt miteinander würde er sie überraschen, und keiner konnte sagen, dass er als Geizhals gestorben sei! Ob er sich da nicht auf seine alten Tage noch ein gutes Andenken erkaufen wollte? Hatte er erkannt, dass es letztlich das ist, was von einem Menschen bleibt?
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com