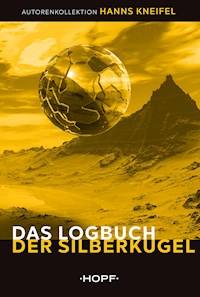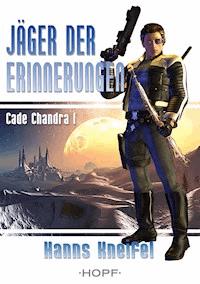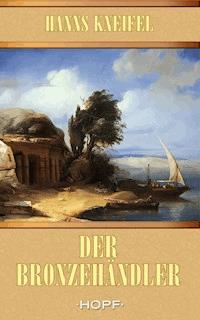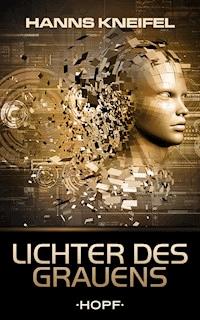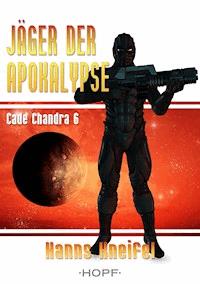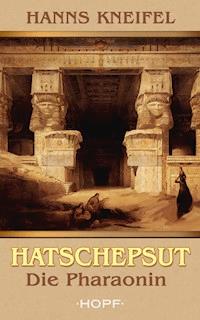Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Peter Hopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ägypten um 1900 v. Chr., unter der 12. Dynastie: Der Bronzehändler Karidon hat sich durch seine Spionagetätigkeit für Pharao Chakaura, mit dem ihn eine tragische Freundschaft verbindet, erbitterte Feinde geschaffen. Fürst Anatnetish, der durch Karidon Macht und Reichtum verloren hat, trachtet ihm und seiner Geliebten nach dem Leben. Sorgfältig wird der Anschlag vorbereitet. Karidon selbst ist unterdessen auf der Suche nach den wertvollen Zinnhäfen. Im Palast des Pharao kommt das Gerücht auf, der Bronzehändler habe seinen Freund verraten. Chakaura will nun zusammen mit Karidon eine letzte Reise antreten, um sich selbst von dessen Integrität zu überzeugen. Die Reise geht nach Punt, dem fernen, legendären Land des Goldes, des Weihrauchs und der seltsamen schwarzen Menschen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER
LETZTE TRAUM
DES PHARAO
Das Buch
Ägypten um 1900 vor Christus, unter der 12. Dynastie: Der Bronzehändler Karidon hat sich durch seine Spionagetätigkeit für Pharao Chakaura, mit dem ihn eine tragische Freundschaft verbindet, erbitterte Feinde geschaffen. Fürst Anatnetish, der durch Karidon Macht und Reichtum verloren hat, trachtet ihm und seiner Geliebten nach dem Leben. Sorgfältig wird der Anschlag vorbereitet. Karidon selbst ist unterdessen auf der Suche nach den wertvollen Zinnhäfen. Im Palast des Pharao kommt das Gerücht auf, der Bronzehändler habe seinen Freund verraten. Chakaura will nun zusammen mit Karidon eine letzte Reise antreten, um sich selbst von dessen Integrität zu überzeugen. Die Reise geht nach Punt, dem fernen, legendären Land des Goldes, des Weihrauchs und der seltsamen schwarzen Menschen …
Der Autor
Hanns Kneifel (1936-2012), begann seine schriftstellerische Laufbahn mit Science-Fiction, verfasste dann eine Reihe Jugendbücher, Hörspiele und Sachbücher. Er bleibt vor allem als Autor zahlreicher farbenprächtiger historischer Romane in Erinnerung.
Impressum
© Copyright Erben Hanns Kneifel
© Copyright 2017 der eBook-Ausgabe bei Verlag Peter Hopf, Petershagen
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Thomas Knip, nach einem Gemälde von Frederick Arthur Bridgman
E-Book-Konvertierung: Die Autoren-Manufaktur
ISBN ePub 978-3-86305-245-4
www.verlag-peter-hopf.de
Folgen Sie uns für aktuelle News auf Facebook.
Die in diesem Roman geschilderten Ereignisse sind rein fiktiv.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten, mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Verarbeitung und die Verbreitung des Werkes in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf fotomechanischem, digitalem oder sonstigem Weg, sowie die Nutzung im Internet dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages erfolgen.
Inhalt
Das Buch
Der Autor
Impressum
Der letzte Traum des Pharao
Im Zeichen der bronzenen Kriegsaxt
1. Nach dem Sturm: Rätsel und Aufbruch
2. Hekenua, Schilf und Wurfholz
3. Zwischen Inseln und Ländern
4. Gezeiten der Leidenschaft
5. Der Biss der Jaret-Natter
6. Die Skorpione
7. Der kurze Sommer
8. Die Pfade des Meeres
9. Nach Westen und Norden
10. Monde des Überflusses
11. Die roten Deshera-Vögel
12. Zinn für Chakaura
13. Küsten des Winters
14. Die Länge der Schatten
15. Stillstand der Sonnenuhren
16. Chakauras Hebsed-Fest
17. Letzter Frühling
18. Jahre des Goldes
19. Sieben Schiffe zum Weihrauchland
20. Die Festungen von Wawat
21. Am Ruder der Sonnenbarke
HANNS KNEIFEL
Der letzte Traum des Pharao
Historischer Roman
»ICH SINGE aus Imhoteps und Hordedefs uralten Worten; überall wiederholt man sie und fragt: Wo sind die Stätten der Dahingegangenen? Denn ihre Mauern sind zerfallen, ihre Plätze sind verschwunden, so als ob sie nie entstanden wären. Keiner kommt zurück aus dem Jenseits und kann beschreiben, wie sie leben. Keiner berichtet von ihrem Wohlergehen, um unsere Herzen zu beruhigen, bis auch wir dorthin gehen, wohin sie längst gegangen sind.
Du aber, Mensch, vergiss dies alles mit erfreutem Herzen. Es tut dir gut, dem Herzensruf zu folgen, solang du’s noch kannst. Setze duftende Myrrhenkegel auf dein Haupt! Kleide dich in feinstes Linnen! Salbe dich mit edlem Öl aus dem Krug für die Götter! Mehre mit fröhlichem Willen dein Wohlbefinden; zusammen mit deiner Geliebten folge dem Herzen. Verrichte auf Erden dein Werk und kränk nicht dein Herz, bis auch dich der Tag der Totenklage ereilt.
Osiris, der Toten Herr, der mit dem matten Herzen, hört die Schreie der Dahingehenden nicht; die Klagen retten das Herz der Rômet nicht vor der Jenseitswelt. Imhoteps uralte Stimme sagt wieder und wieder: Feiere unermüdlich den fröhlichen Festtag und bedenke, dass niemand mitnehmen kann, was er an Schätzen besitzt, und bedenk auch: Keiner, der fortging, kommt je wieder zurück!«
(Aus einem Lied des Harfners)
»HEIL EUCH, ihr vier Winde, ihr Stiere des Himmels! Ich nenne euch eure Namen; ich gab sie euch! Ich weiß, dass ihr geboren wurdet und entstanden seid, als die Rômet noch nicht geboren und die Götter noch nicht entstanden waren.
Ihr und eure Namen wurden mir gegeben durch die Mädchen der Träume, die mit den Stimmen der Götter Nun, Schu und Sehe zu mir sprechen.
Das ist der Nordwind, der die Meeresinseln umweht, der seine Arme öffnet zu den Grenzen der Welt; ein Lebenshauch ist der Nordwind; er gewährt mir, dass ich lebe durch ihn.
Das ist der Ostwind, der die Horizonte des Himmels öffnet, dass nach ihm der Sonne der Weg bereitet ist: Rê nimmt mich an der Hand und setzt mich in jenes Feld über den Binsen, dass ich mich nähre in ihm, wie Apis und Seth.
Das ist der Westwind, des Gottes Ha Bruder, Spross des Ja’au, der schon leibhaftig schwebte, als noch nicht zwei Dinge entstanden waren in dieser Welt.
Das ist der Südwind, ein Kushite des Südens; Wasser, Wachstum und Leben bringt er von den Horizonten Wawats. Heil euch, ihr vier Winde!«
(Lied der Vier Winde aus den sog. »Sargtexten«)
Im Zeichen der bronzenen Kriegsaxt
UNSER GERECHTER HERR SENWOSRET-HAKAURA, er lebe ewig und ewiglich, der beide Lande wieder zu Macht und Größe geführt hat und in tausend Tagen sein großes Hebsedfest feiern wird, ist in fünffacher Besorgtheit:
Vom Westen her überfallen räuberische Tjehenu-Nomaden wie Heuschrecken die Siedlungen am Rand der neuen Kornfelder, nördlich vom Scha-Resi-See. In Kush und Wawat sind die elenden Nehesi trotz Chakauras Festungen aufsässig; vierzehn Bollwerke hat Chakaura errichten lassen, aber noch sind nicht alle Mauern stark und hoch genug. Pije-Ipi, der Verwalter von Millionen Zahlen und Wörtern, ist im Körper und im Verstand hinfällig geworden; man sucht hapiauf, hapiab nach einem »Zahlennarr«, der ihm nachfolgt; bisher hat man keinen gefunden. Aus dem Asmach, den Ländern der Apiru und Chaosu, hören die Späher und Lauscher am Fürstenwall wenig Gutes: In den Ländern hinter den Hafenstädten gärt Aufruhr gegen die Rômet. Um schreiben zu können, was es im Westen gibt, warte ich auf Briefe des Feldherrn Sokar-Nachtmin, den Chakaura mit unzähligen goldenen Fliegen ausgezeichnet hat – Nachtmin bekämpft mit seinem Heer, das im Sand gen Sonnenuntergang schmachtet, kraushaarige und ziegenschänderische Nomaden. Ein hässliches Gerücht geht um im Großen Haus: Was mag der beste Bronzehändler von allen getan haben, dass Chakaura an der Freundschaft Karidons zweifelt?
ICH, MERIRE-HATCHETEF, Priester des Ptah, Month und der löwenköpfigen Sachmet zu Itch-Taui, der das Geheime im Großen Haus kennt, bester Schreiber zwischen den Festungen in Wawat und dem Großen Grünen, bin vom Herrscher Chakaura berufen worden, alles auf gebleichten Shafadurollen niederzuschreiben, was sich in den 27 Jahren zutrug, über denen der sonnenglänzende Name des Herrschers liegt.
Der kleine Priester spürte den Schweiß, der aus den Achselhöhlen rann, wischte mit dem feuchten Tuch über Kopf und Nacken und stand langsam auf. Er füllte die Schale mit kaltem Wasser und trank mit tiefen Schlucken; die mörderische Hitze, die seit einem Zehntag mit einer rätselhaften Windstille einherging, hockte tief in den ellendicken Mauern, in denen es Tag und Nacht knisterte und knackte.
ICH SCHREIBE DIE GESCHICHTE ALLER SIEGE, aller großen Taten, aller Bauwerke und der wunderbaren Jahre Chakauras:
Sie ist kurz, aber reich an wuchtigen Worten. Und ich schreibe selbst mit zwei Fingern eine andere Geschichte: den Bericht über das Leben meiner Freunde aus der Schreibschule, Karidons Schicksal, das des Heerführers Sokar-Nachtmin, des Gaufürsten Nefer-Herenptah, des keftischen Kaufmanns Jehoumilq und Ptah-Netjerimaats, der das Ruder der Auge der Morgenröte führt.
Merire-Hatchetef ging in den Tempelgarten, dessen vertrocknetes Gras unter den Sohlen raschelnd staubte. Aus Westen, unter dem dunkelblauen Himmel, der seit Tagen seine seltsame Farbe nicht gewechselt hatte, schien sich unsichtbar eine Glutwolke heranzuschieben. Kein Luftschlauch kräuselte bislang das Kanalwasser, das dumpf roch, als ob es faule. Fische schnellten in die Höhe und schnappten nach Luft. Die Schatten hatten feine, gelbe Ränder; das Gestirn des Rê schien das Land verbrennen zu wollen. Merire stöhnte und zwinkerte den Schweiß aus den Augen.
»O ihr guten Götter«, flüsterte er. Jede Bewegung trieb Schweiß auf die Haut; sein Herz schlug hart. »Warum straft ihr uns so im Mesore, der auch ohne euren Zorn schon heiß und trocken ist?«
Das Land wartete sehnsuchtsvoll auf das Erscheinen des Sepedet und die Hapiflut, die in weniger als einem Mond in Itch-Taui und im Scha-Resi-Land anschwellen sollte. Merire zuckte mit den Schultern und schleppte sich in den Schatten der Mauern, tröpfelte Wasser in die Tuschenäpfchen und achtete beim Schreiben darauf, dass keine Schweißtropfen auf die Shafadurolle fielen.
NUN RÜHRE ICH FRISCHE TUSCHE AN, viel schwarze und wenig rote: In diesen Tagen und Nächten, da die Hitze ungewöhnlich groß ist, trocknet sie allzu rasch.
Merire-Hatchetef ließ den Binsengriffel sinken und schloss die Augen. Unheil, fühlte er, kam auf das Land zu! Ohne sagen zu können, aus welchen Gründen er sich fürchtete – abgesehen von der sengenden Sonne, der Dürre und den vielen todkranken und gestorbenen Rômet –, rief er öfter als sonst die Götter an. Größeres Unheil drohte als räuberische Nehesi, Heuschrecken oder verderblich hohe oder niedrige Überschwemmung; anderes, unvorstellbares Verderben. Keines, von dem Chakaura wusste, über das die Priester sprachen oder solches, das die Götter offenbarten. Botschaften und Gerüchte krochen durch das heiße Land. Sie sprachen davon, dass die besten aller Bronzehändler-Kapitäne, Jehoumilq und Karidon, die Verwalter der Schatzhäuser betrogen und mehr für sich selbst als für das Große Haus Handel trieben, vielleicht die Feinde des Landes unterstützten. Tauschten sie jenes Nechoschet-Metall gegen Waren der Nomaden ein? Mit Waffen aus Bronze wären die Gegner Chakauras dessen Heer weit eher gewachsen; die Schlagkraft seiner Krieger wäre rasch dahin.
Nicht einmal die letzten Briefe Karidons, Nefer-Herenptahs oder Sokar-Nachtmins ließen eine Spur möglicher Erklärungen erkennen. Oder kündigte sich durch das Gefühl des nahenden Unheils eine neue Zeit an, in der selbst die Maat nicht mehr galt?
Merire wickelte behutsam ein Bronzedrähtchen von einer halb beschriebenen Shafadurolle ab, breitete das Blatt aus und tunkte den Riedgriffel in die Tusche. Ein Priesterschüler hatte es weichgekaut; Merires Zähne schmerzten zu sehr.
LANGE HAT DER GOLDHORUS NICHT MIT MIR GESPROCHEN. Dennoch erfahre ich vieles aus dem Großen Haus; von Schreibern, deren Briefe die Befehle der Ratgeber weiterleiten in die fernen Enden der beiden Lande. Mehr als 26 und ein halbes Jahr des Herrschens mit ihrer Last haben seine breiten Schultern niedergedrückt. Chakaura scheint das Licht Rê-Harachtes als Last zu fühlen; er zwingt sich und seine Taten zur Größe und zur Macht. Ich erkenne an ihm die kühle Gelassenheit der ersten Bronzejahre nicht mehr; zwischen den Säulen im Gewölbe der Zeit geht er einsam, ruhelos und ohne Schlaf umher. Und nun, in diesen Tagen, in denen Furcht in alle Herzen gekrochen ist, ruht die Last der unbewegten Luft und der Verantwortung für alle Rômet allein auf Chakaura.
Ich aber weiß, dass seit den Tagen seiner Krönung oder schon, seit Karidon ihn halb ertrunken aus dem Schlamm des Kanals gerettet hat, der Bronzekapitän der einzige Freund des Herrschers ist. So wie aus Kupfer mit einem Zehntel Zinn die vielfach härtere Nechoschet-Bronze geschmolzen wird, kann eine Freundschaft zwischen Ungleichen tiefer und länger sein als andere; verlöre der Sohn der Sonne das Vertrauen zu Karidon, würde seine Einsamkeit gottgleich werden. Ich, Merire-Hatchetef, werde die Wahrheit erfahren – ich versuch’s mit aller Kraft –, wenn die Auge der Morgenröte wieder hier in Itch-Taui anlegt.
WIR WISSEN, DASS DIE GEMEINSCHAFT aller Bewohner des Hapilandes den einzigen Schutzwall gegen die gottgeschickten Widrigkeiten der Natur bildet. Karidon ist für Chakaura der Wall gegen die Einsamkeit und die Verbindung zum Leben der einfachen Menschen. Werden die Schwingen des Goldhorus lahm, so trocknen die Mauern aus; sie brechen nieder und vergehen im ewigen Wehen des Sandes.
Der magere Priester lehnte sich zurück und schloss die Augen. Diesseits der großen Dinge, im vergänglichen Leben der Sterblichen, beschlich ihn tiefe Furcht: Sein Freund schien in Gefahr zu sein. Merire, Sokar-Nachtmin und Karidon galten fast seit drei Jahrzehnten als Vertraute des Herrschers, besonders Karidon, der Chakauras Schwester Tama-Hathor-Merit geliebt und zusammen mit Jehoumilq den Weg ins ferne Weihrauchland Punt erschlossen hatte. Die Mannschaft des Händlers Jehoumilq hatte gewaltige Mengen hartes, wertvolles und kampfentscheidendes Nechoschet ins Hapiland gebracht, jenes neue Zinn-Kupfer-Metall, war mit Chakauras Truppen hapiaufwärts in die wasserlosen Länder Kush und Wawat gesegelt und hatte die Bronzebergwerke an den nördlichen Felsküsten besucht, als verkleidete »Augen und Ohren« des Goldhorus; seit dessen Heer die selbsternannten Fürsten Abdim und Anatnetish entthront und vertrieben hatte, wurden die Bronzehändler von diesen mit unauslöschlichem Hass verfolgt. Die Tusche war wieder eingetrocknet. Merire-Hatchetef zuckte mit den Schultern und trank Wasser. Er war ebenso erschöpft wie jeder andere in Itch-Taui; nicht einmal seine Gedanken gehorchten ihm. Karidon und Jehoumilq versteckten sich vor Anatnetishs Rache, indem sie rastlos von Hafen zu Hafen segelten, und Sokar-Nachtmin ließ den Gutshof bei Menefru-Mirê bewachen. Vor Merire-Hatchetefs innerem Auge wanderten Menschen und Geschehnisse vorbei, in langer Prozession: Steuermann Holx Amr, die alte Horus der Brandung, die in Gublas Hafen auseinandergebrochen war, der Betrug mit Lederbeuteln, die mit Sand statt Goldkörnern gefüllt waren – Neider und Feinde der Bronzehändler hatten sie im Schatzhaus ausgetauscht! –, das neue Schiff, die Auge der Morgenröte, der qualvolle Tod der Prinzessin »Tamahat«, wie Karidon sie zärtlich genannt hatte, und seine abgrundtiefe Trauer, schließlich der Überfall durch Fürst Anatnetishs Leute auf die Morgenröte in Tjebnutjer, einem Örtchen am östlichen Mündungsarm. Karidon war fast zu Tode verwundet worden, und sein erster Besuch nach der langwierigen Heilung hatte ihm gegolten, dem Priesterlein Merire-Hatchetef. Und nun: Hässliche Gerüchte, denen Merire kein Wort glaubte – waren sie schon an die Ohren Chakauras gedrungen, des vergöttlichten Herrschers?
Die Spitzen und Kanten des roh behauenen Felsblocks drangen in die Haut von Ti-Djehutis Oberschenkel. Er saß, den Kopf gesenkt, am Rand des Platzes, dicht an der Hafenmole Djedans. Unter ihm trieben losgerissener Tang und Abfälle um einen aufgeblähten Katzenkadaver in engen Wirbeln zwischen den Bordwänden der Schiffe. Auch die Auge der Morgenröte lag längsseits an der Mole. Im Heck standen ein Rômet, den sie Ptah oder Netji nannten, der alternde, bärtige Kapitän Jehoumilq, und ein schlanker Mann mit heller, aber tief sonnengebräunter Haut und langem braunem Haar, an den Schläfen grau und weiß, das er in einem Nackenzöpfchen trug. An der linken Schläfe und zwischen dem Herzen und der Schulter trug der Seefahrer Narben, eine dritte, lange, sah Djehuti auf der anderen Schulter. Als Ti-Djehuti in der Schenke neben den jüngeren der beiden Kapitäne getreten war, hatte ihn ein prüfender Blick aus leuchtenden, grünen Augen getroffen: Dies war Karidon von Keftiu, dem Fürst Anatnetishs ganzer, gewaltiger Hass galt.
Die Morgenröte lag tief im Wasser. Ti-Djehuti hatte vierzig Barren Kupfer gezählt, die die Ladearbeiter herbeigeschleppt und im Kielraum gestapelt hatten. Die Ruderer – die Rômet nannten sie Wajermänner – hatten bis vor einer halben Stunde am Schiff gearbeitet, jetzt waren sie im Badehaus; die Morgenröte wollte früh mit dem ersten Landwind ablegen. Djehuti beobachtete und belauschte die Bronzehändler, seit das Schiff hier vor zwei Tagen hereingerudert worden war.
Präge dir Namen und Aussehen ein. Lerne ihre Eigenarten kennen. Versuche herauszufinden, wo sie im Hapiland leben, in welchen Häfen sie handeln, wer ihre Freunde sind, ob der Goldhorus sie beschützen lässt. Denke nach, ob sie besser mit Gift oder Waffen zu töten sind. Fürst Anatnetish, der sich hinter verschiedenen Namen und Masken verbarg, hatte ihm, Ti-Djehuti, einen Beutel Goldkörner gegeben und ihn mit eindringlicher Stimme, fiebernd vor Wut, beschworen: Ein Mann mit Macht und Amt im Palast zu Itch-Taui muss das Gerücht ausflüstern, dass Karidon von Keftiu das Große Haus betrügt, dass er den Nomaden verrät, an welchen Stellen die Grenzen durchlässig sind; dass die Bronzehändler den Feinden des Goldhorus bronzene Waffen überlassen und die Handelswaren, die sie dafür bekommen, selbst behalten …
Er hatte gefragt: »Warum hasst du den Bronzehändler Karidon, Fürst?«
»Sieh mich an: Bevor er mich an das Heer des Goldhorus verriet, war ich reich, hatte Macht, Frauen, Gold … alles. Jetzt bin ich ein Bettler; meine Männer sind Wegelagerer. Finde sein Versteck!« Anatnetish legte die Hand auf den Dolchgriff.
Vor einem Zehntag hatten sie sich an einem Brunnen in Menefru-Mirê getroffen, zum zweiten Mal. Seither hatte sich Ti-Djehuti viel umgehört, mit Handelskapitänen und Hafenverwaltern gesprochen und vielen Seefahrern volle Weinkrüge bringen lassen. Nun war er in Gedjed und schätzte die Ladung der Bronzehändler; bald würde er wissen, wo sie im Hapiland wohnten, trotz der Wachsamkeit Karidons, Ptahs, Jehoumilqs und des anderen Steuermanns, Holx-Amr.
Drei waagrechte schwarze Streifen teilten das zusammengedrückte Abendgestirn; dennoch vermochte niemand in die Sonne zu sehen. Rechts und links der verformten Scheibe erstreckten sich, drei Finger hoch über der Linie, an der sonst Himmel und Wüste einander berührten, schwarze Bänder von Nord nach Süd. Ein großer, schwarzhäutiger Bogenschütze berührte Sokar-Nachtmin an der Schulter.
»Sie sagen, Herr, das ist der Große Braune Würger. Er wartet. Noch gibt es keinen Wind. Kommt Wind, kommt der Würger über uns.«
Sokar-Nachtmin nickte langsam und drehte sich um. Er, Hekenua und Kholay standen auf dem Kamm einer riesigen Düne, die sich an einen Felsen schmiegte; ein sandiger Teil des baum- und strauchlosen Gebirgsausläufers. Die Kette der Posten, Wasserträger, Eselgehege und leinwandgedeckten Unterstände verschmolz in der Richtung zum Mu-Wer-See mit dem Horizont; sie war in Wirklichkeit Hunderte von Chen-Nub lang, und nur ihr Vorhandensein sicherte der Truppe Wasser, Bier, Proviant und das gute Gefühl, von denen an den Hapiufern nicht vergessen worden zu sein. Nachtmin deutete zum Lager, das am Fuß des Sandberges begann.
»Geh zu Anführer Userhet. Sag ihm von mir, er soll den Sturm beobachten und die Nomadenspäher fragen. Sie kennen den Würger besser als wir.« Er nickte Hekenua zu. »Sag, er und alle Männer sollen sich vorbereiten; Tücher, Wasser eingraben, Windwände flechten. Schick einen Boten zum Anfang der Wasserträgerkette mit der gleichen Botschaft. Im Sturm werden auch die Nomaden nicht anzugreifen wagen. Welcher Tag ist heute eigentlich?«
»Achtundzwanzigster im Mesore. Ich gehorche, Herr.« Kholay verbeugte sich, packte Bogen und Köcher fester und stolperte durch den hochstiebenden Sand den Dünenhang hinunter. Nachtmin sah schweigend zu, wie die Sonnenscheibe versank und Fackeln an den ersten Lagerfeuern angezündet wurden, wie einige Soldaten anfingen, sich gegen einen Sturm zu schützen, den noch niemand spürte. Im letzten Sonnenlicht sah er den Boten mit flackernder, rauchender Fackel nach Südost rennen. Dann trat er in Kholays Spuren, ging zum Feuer vor seiner spitzen Leinenhütte und setzte sich auf einen Flechtwerkschemel. Hekenua brachte einen Krug, der mit einem feuchten Tuch umwickelt war. Nachtmin nickte und trank das dünne, bittere Henket; er sagte bedächtig:
»In all der trockenen Trostlosigkeit ringsum, schönste Freundin, bist du wie der Anblick vieler aufbrechender Lotosblüten. Danke fürs Henket.«
»Es ist eine Auszeichnung, die einzige Frau unter fünfmal tausend Männern zu sein. Auch wenn wir bisher nur ein paar Dutzend Nomaden gefangen haben.«
»Nomaden, mit denen du nichts mehr zu tun hast, außer dass du ihre Sprache sprichst.«
Es begann nach Zwiebeln, Lauch, Salzfisch, Pökelfleisch, frischem Fladenbrot und saurem Wein zu riechen. Ein Bote näherte sich und berichtete, dass die halbkreisförmige Postenkette stand und dass die eingeborenen Späher versichert hatten, der Sandsturm, der das Heer und die Nomaden umbringen konnte, komme nicht in dieser Nacht. Nachtmin schärfte ihm ein, weiterzusagen, dass jeder Krieger sich unabhängig von der Unwahrscheinlichkeit eines Überfalls bei Tageslicht dennoch schützen solle. Dann richtete er seine Blicke auf Hekenua, die ihm von Chakaura anvertraut worden war. Hier, in der Wüstenei und unter dem lodernden Gestirn, das mit erbarmungsloser Hitze das Leben aus den Menschen sog, wirkte sie, als liefe sie durch einen taufeuchten Palastgarten.
Hekenua war die Tochter eines gefangenen Tjehenu-Nomaden, eines Jematet-Fürsten aus dieser Gegend, etwas weiter gen Sonnenuntergang, und einer Kushitin des Frauenhauses. Sie war im Palast aufgewachsen, sprach drei Sprachen und konnte sie verhältnismäßig gut schreiben. Größe und schlanke Glieder hatte sie vom Vater, wohlige Rundungen, hellbraune Haut und blauschwarzes, leicht krauses Haar von der Mutter geerbt; ihr schmales Gesicht mit der fein gekrümmten Nase und den vollen Lippen strahlte Entschlossenheit und Stärke des Willens aus; Hekenua war eines der seltenen Beispiele dafür, dass selbst Töchter von Sklaven es im Hapiland weit bringen konnten, trotz ihrer höchstens siebzehn Jahre. Nachtmin hatte Zeit und Ruhe, sie im Licht des Lagerfeuers und der Fackeln genau zu betrachten. Er kannte die Wirkung seiner Blicke unter schweren, dunklen Lidern hervor; seine Soldaten fürchteten das scheinbar träge Starren seiner Augen. Er grinste kurz und sagte:
»Unser Herr im Per-Ao, Shenet Hekenua, hat viel mit dir vor.«
Sie richtete sich gerade auf und flüsterte:
»Das sagst du jetzt, Shemer Feldherr?«
»Eine der möglichen Erklärungen, Schwester, warum ich mich dir nur bis an den Rand einer bestimmten Grenze genähert habe. Klare Befehle aus dem Per-Ao.«
Sie ertrug seine lastenden Blicke mit ihm ungewohnter Selbstsicherheit. Nachtmin verbiss sein Grinsen und nahm das Kopftuch ab, schlug es über die Spannschnur der Leinenfläche und sagte leise:
»Vor Jahr und Tag waren die Halbschwester des göttlichen Herrschers und einer meiner klügsten Freunde die Zuträger wichtiger Nachrichten aus Kush, Wawat und dem Asmach zum Thron Chakauras. Tama-Hathor-Merit starb; seither sucht der Große Chakaura – er lebe ewig und ewiglich – nach ähnlich guten Spähern. Nun ist die Bedrohung von hierher größer geworden. Du wirst, wenn wir diesen Kriegszug und den würgenden Sturm überleben, in Itch-Taui einen Freund treffen. Grünauge Karidon, den Bronzekapitän aus Kefti. Ihn liebte die Prinzessin; ein guter, kluger Mann, kein Jüngling mehr, zuverlässig. Manch einer zweifelt an seiner Ehrlichkeit – ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Befehl aus dem Per-Ao, Schwester!«
Hekenua, deren Körper ebenso schweißbedeckt war wie jeder andere am Anbruch dieser Nacht, füllte aus dem mühsam gekühlten Krug die Schalen. Sie atmete tief und sagte nach langem Nachdenken so leise, dass es Nachtmin fast nicht verstand:
»Ich soll die Gefährtin, Geliebte, Freundin oder Frau deines Freundes werden? Hat das unser Herr schon entschieden?«
»Nein.« Nachtmin hatte sich so gesetzt, dass er beobachten konnte, was im halbmondförmigen Lager vor sich ging. Seine Blicke huschten umher wie Fledermäuse; der Nachthimmel teilte sich in ein schwarzes und zwei sternenflirrende Drittel. Ein Bogenschütze brachte Brot, Braten und Tonschalen voller dicker Suppe. »So nicht, Shenet. Chakaura braucht Helfer, Freunde, zuverlässige Vertraute. Du wirst Karidon mit den grünen Augen treffen; dann wird man weitersehen. Ich glaube, ihn besser als dich zu kennen. Er zählt zu Chakauras mächtigen Männern. Er wird dich nicht nehmen wollen wie eine Tanzsklavin.«
»Bruder Nachtmin! Ich bin keine Tanzsklavin, keine Harfenistin, keine Flötenspielerin.«
»Ich weiß es. Chakaura weiß es. Karidon, der dich nicht kennt, aber allein mit allerlei düsteren bis schwarzen Gedanken ist, wird dich prüfend ansehen. Auch wenn ihr miteinander die Nachrichten für Chakauras Tatji schreibt, ist alles andere, was du tust, dein freier Wille. Ich zwinge dich nicht, Chakaura auch nicht, und Karidon hat es nicht nötig, Zwang auszuüben.« Er zwinkerte und legte kurz die Hand auf sein Gemächt. »Unter uns, Schwester: Kari ist die wahre Freude für jedes gute Weib. Schön, nachdenklich, reich und mutig; einer unserer Besten. Ich kenn ihn seit mehr als dreißig Jahren. Wenn ich eine junge Frau wäre wie du, würde ich …«
»Beleidige ich dich, wenn ich sage, du bist ein liebenswerter Schurke, und ich möchte mit dir befreundet bleiben, Feldherr Sokar-Nachtmin?«
Hekenua griff nach einem Tuch, wischte Schweiß vom Gesicht und aus dem Nacken und hob die runden Schultern.
»Ich bin schwer zu beleidigen.« Nachtmin wartete, bis der Soldat das Essen auf dem Tuch, das über dem Sand ausgebreitet war, abgestellt hatte. »Ich werde, was ich dir erzählt habe, nicht wiederholen. Merk dir jedes Wort und handle, wie du es für richtig hältst. Dennoch: ein keftischer Seefahrer, den Chakauras schöne und kluge Schwester liebte, ist weder dumm noch missgestaltet.«
Sie aßen schweigend; die Hitze ließ auch in den ersten Nachtstunden nicht nach. In der Luft über dem öden Land schien sich etwas wie eine göttliche Ausstrahlung zu befinden; drohend wie der Pfeil auf einer gespannten Bogensehne.
»Ich habe gehört, Feldherr. Ich denke über deine Worte nach, bis ich den Fremden sehe. Aber: Ich weiß, dass Tjehenu-Häuptlinge mit Bronzewaffen kämpfen. Ich sah auch viele bronzene Pfeilspitzen.« Sie deutete nach Westen. »Und was soll ich jetzt und morgen tun?«
»Jetzt sollst du trinken, essen und schlafen, Shenet Hekenua.« Nachtmin tunkte ein gerolltes Fladenbrot in den Würzbrei und biss ab. »Morgen oder übermorgen befragen wir entweder gefangene Nomaden, oder du wirst nach Itch-Taui zurückgebracht. Oder der Sandsturm hat uns alle erstickt.«
Hinter den Dünen, in unbekannter Entfernung am Großen Grünen, schob sich der Mond auf den sternenlosen Teil des Himmels zu. Er war gelb wie Sand; die Narben seiner Fläche wirkten, als käme das Unheil von ihnen.
Merire-Hatchetef senkte den Kopf. Er hatte zu lange in den riesenhaften, giftig gelben Mond geblickt; jetzt kroch wieder die Furcht in sein Herz. Merire rückte einige Lämpchen, deren Flammen zusätzliche Hitze verströmten, näher zum Schreibblatt und sah, dass die Tusche schon wieder zu trocknen begann. Nach einigen Atemzügen schrieb er weiter:
NUR DIE GÖTTER WISSEN, wie viele Jahre das erste Leben unseres Herrschers dauern wird. Jeder Rômet wünscht, seine Jahre mögen Million sein. Meine Aufzeichnungen wachsen in die Länge und Breite wie die Palastmauern: Ziegel um Ziegel, und aus Zeichen, Worten und Sätzen entsteht das Bauwerk, ein Gefäß der Erinnerungen und Träume. Die rote und schwarze Tusche ist wie Hapiwasser, das Sand, Lehm und Hapischlamm tränkt, die mit geschnittenem Gras und gehacktem Schilf vermengt und mühsam zu dickem Brei geknetet werden; gebunden von den Schweißtropfen der Stirnen, Arme und Füße der Kneter und Mischer und in Kästen zu schwärzlichen Quadern geformt. Bevor der Ziegel trocknet, gärt es in seinem Inneren: der Gesang und die Flüche der Arbeiter sind hineingemengt, die Gedanken an Gesundheit und Würde, an den Segen der Götter und die Not von Krieg und Hunger, Geburt und Tod, Gelächter und Schmerzensschreie, und alles vergoren und verklebt zur allmählich härtenden Masse. Der Sand, auf dem der Ziegel trocknet, ist millionenmal aufgewühlt und wieder geglättet worden, er hat alles gesehen seit Ewigkeiten, wird vom Wind hierhin und dorthin geweht und ist unstet, aber bedeckt bald die neuen Mauern. Jene Mauern, die schon standen, ehe die Erinnerung war, werden in fernen Zeiten aus dem ewig strömenden Sand auftauchen, und man wird Shafadurollen finden, auf denen geschrieben ist, was ich weiß und woran ich mich erinnere. Mögen die Götter meinen Worten die gleiche Schönheit und Farbigkeit wie den Mauern verleihen. Ohne Hast schreibe ich, um die Stille vor dem Unheil auszufüllen, über Götter, Menschen, Geschehnisse und über Chakauras siebenundzwanzigstes bronzenes oder goldenes Jahr.
In der reglosen Stille klirrte Sat-Hathor-Iunits Schmuck, als zerschelle ein Tongefäß. Chakaura zuckte zusammen. Sein Schatten und der seiner Schwester bewegten sich nicht, ebenso wenig wie die Flammen der Öllämpchen. Das Palastdach war leer, in den Mauern des Palasts, der Tempel und der Stadt herrschte ungewohnte Ruhe. Chakaura zeigte auf den Mond und sagte leise:
»Ich habe mit den ältesten Ratgebern gesprochen. An eine solch lange, verderbliche Hitze erinnern sie sich nicht. Auch nicht die Priester. Nichts steht in den Aufzeichnungen der Tempel. Aber alle sagen, dass ein gewaltiger Sturm von Sonnenuntergang kommen wird.«
»Dorther, wo Nachtmin jetzt mit deinem Heer steht.«
»Als er aufbrach, konnte niemand an diesen Sandsturm denken. Die Priester sagen, es wird ein Fünfzigtagesturm.«
»Er wird das Land heimsuchen, noch ehe Sepedet aufgeht, und viele Menschen werden sterben, Bruder«, sagte die Prinzessin. »Du hast getan, was zu tun war?«
»Mehrmals und mit allem Nachdruck.«
Zahlreiche Boten bis hinauf nach Tjeni hatten überall die gleichen Befehle ausgesprochen: die Öffnungen der Häuser verschließen, die Herden zusammentreiben, den Sand mit nassen Tüchern fernhalten, Wasser, Bier und Nahrungsmittel vorbereiten, in jeder Pause des Sturms Sand wegschaufeln und von den Eingängen kehren; und beten, dass der Braune Würger erst nach der Hapischwelle das Land verwüstet – oder sich in ein Dutzend kleiner Sandstürme auflöst, deren Dauer und Wirkung bekannt war und deren Schäden meist gering blieben. Chakaura nickte, tief in Gedanken, hob einen Krug und mischte, ehe er der Schwester eingoss, etwas Wein ins Wasser.
»Ich wiederhol’s«, sagte er und senkte den Kopf. Seine Stimme war rau. »Länger als ein Vierteljahrhundert waren die Götter gnädig. Aber im Zeichen von Sachmet und Sopdu scheinen sie mich im siebenundzwanzigsten Jahr prüfen oder strafen zu wollen. Hast du im Frauenpalast Gerüchte über Karidons Verrat gehört?«
»Kein Wort, göttlicher Bruder. Unser großes Land wird auch einen Fünfzigtagesturm überstehen.« Sat-Hathor-Iunit stellte die Schale ab und wandte sich zur Treppe. »Noch ist es zwischen den Mauern kühler. Vielleicht kann ich ein paar Stunden schlafen.«
»Niemand im Land schläft kürzer und schlechter als ich.« Chakaura setzte sich und starrte das reglose Spiegelbild des Mondes im Palasthafen an. »Und ich bezweifle, ob jemand üblere Träume hat. O Karidon – betrügst du mich mit meinem Gold? Gibst du Nechoschet an die Nomaden? Sprichst du mit ihnen über unsere Grenzen?«
Chakaura seufzte und blinzelte in den Mond. Als das Geräusch der Schritte Hathor-Iunits verklungen war, senkte sich wieder grässliche Stille über den Palast und die Stadt. Obwohl der Schweiß über die Brust und den Rücken lief, begann Chakaura plötzlich zu frösteln.
WIE ICH ES ERLEBT HABE, SCHREIBE ICH ES: Vom vierten Tage des Thot bis zum 20. desselben Mondes, also drei mal drei und einen Siebentag lang, während von Ta-Seti und Suenet her die Überschwemmung zwölf Ellen hoch stieg, gössen Schu und Nut den Sturm mit Sand und Staub über uns aus. Er begann wie alle Stürme, aber fast gleichzeitig mit dem Jahr 27 unseres göttlichen Herrschers, weit im Westen, wie mir Sokar-Nachtmins Boten berichteten, gerade als das Heer im Zeichen der Kriegsgötter Sopdu und Sachmet den Ring um drei Nomadenvölker geschlossen hatte.
Die ersten harten Windstöße kamen, eisig kalt, aus dem Norden; gerade als kurz vor dem Morgengrauen des dritten Tages der Achet-Jahreszeit der Feldherr den Arm senkte. Rechts und links von ihm stießen Signalbläser in die Kupfertrompeten. Die Töne, die den Schreien großer, sterbender Tiere glichen, setzten sich wie Echos nach beiden Seiten fort und schienen leiser zu werden und zu verklingen, als sie in beiden Halbkreisen weitergegeben wurden. Sokar-Nachtmin setzte den Helm aus geflochtenen Lederschnüren auf und sagte zu Hekenua:
»Keine Hast. Meine Krieger stoßen als Keil in der Mitte vor.«
Im vagen Licht sahen die Soldaten Chakauras im Norden die Gewitterwolke wachsen. Ihre klobige, brodelnde Spitze wurde von den ersten Sonnenstrahlen getroffen. Die Männer rückten von allen Punkten der kreisförmigen Umfassung auf den Standort der Nomaden zu; weit hinter Nachtmin beluden die Eseltreiber ihre Tiere und warfen angstvolle Blicke auf die beiden Wolken. Hekenua hielt mit Nachtmin mühelos Schritt.
»Du willst die Entscheidung, Feldherr? So wie voriges Jahr in Iken, als ich euch von der Mauer aus zusah.«
»Ja. Wenn wir den Sturm abwarten«, knurrte Nachtmin und rückte das Kampfbeil im Gürtel über die rechte Hüfte, »zerstreut er uns, die Herden und alle Nomaden. Ich bin Vater des Heeres, nicht Großvater ereignisloser Tage.«
Sein Plan hatte lange Vorbereitungszeit gekostet und sollte noch an diesem Tag zum Erfolg führen. Bis jetzt schien jeder Schritt so erfolgreich zu sein, wie es sich Nachtmin gewünscht hatte. Der Kreis zog sich zusammen wie eine Seilschlinge. Nachtmin und Hekenua, geschützt von zwölf Dutzend Bogenschützen und Speerträgern mit großen Schilden, verließen die Täler der schützenden Dünen; als sie den Rand des offenen Hügellandes erreichten, zuckte lautlos ein gewaltiger Blitz von der Spitze der Wolke, die sich aufblähte und näherkroch.
»Dein Siegeszeichen, Shemer Feldherr.« Hekenua war zusammengezuckt; sie hielt lächelnd den Mantel am Hals zusammen. Die Säume peitschten gegen Knie und Waden. »Es wird die Nomaden erschrecken!«
Sokar-Nachtmin zuckte mit den Schultern. Sonnenstrahlen schossen beinahe waagrecht übers Land, strahlten die von brodelnder Schwärze geschwollene Gewitterwolke an, zeichneten über der Savanne einzelne Baumkronen, ließen in weiter Entfernung einzelne Bronzewaffen aufblitzen. Noch immer waren die Geräusche der Schritte und winselnde Windstöße die einzigen Laute des Morgens. Wieder zuckte ein vielverzweigter Blitz in der Wolke. An einigen Stellen konnten die Soldaten sehen, wie das Gewölk den Boden berührte. Unbeirrt gingen sie weiter, in Sichtweite die ersten Gräser und Büsche der Halbwüste. Vor Nachtmins Trupp senkte sich der Boden zum Geröllband eines Trockenflusses. Noch waren keine Herden, keine Nomaden zu sehen, nur dünner Rauch zweier Feuer geradeaus im Westen.
Dort trafen Sonnenstrahlen auf die Staubwolke. Sie war wie eine hellbraune, fast goldfarbene Mauer, die sich in die Gewitterwolke hineinschob. Sokar-Nachtmin ging schneller, und als er zu sprechen anfing, war ferner Donner zu hören. Nachtmin nickte, als gehöre das dumpfe Grollen zu seinen Überlegungen.
»Weißt du, dass es der Neid ist? Neid und das Nicht-Verstehen von Bewohnern der Wüste, von Bergvölkern und Nomaden; Neid auf die Städte. Unsere Städte.« Zwei lange Blitze und Donner; lauter, schärfer. »Was sie nicht verstehen, die Jematet mit ihren dürren Ziegen, verfilzten Schafen und mageren Rindern, dass wir Land in Besitz nehmen und darauf pflanzen, ackern, weiden und bauen. Als ich vor einer Ewigkeit den ersten Nehesi getötet hab, töten musste, ahnte ich es – sie hassen schon eine Lehmhütte, einen Kanal und erst recht jeden Menschen, der sich abends unter ein Dach setzt – wie ich, Karidon, der Goldhorus …«
Wieder knatterten Blitze, als wollten sie jedes hervorgestoßene Wort in den Boden schmelzen. Beide Wolken stießen zusammen. Die Sonne stieg höher, aber ihr Licht hatte sich geändert: Jedes Sandkorn, jeder Grashalm bekam eine Farbe, die aus einer anderen Welt zu kommen schien. Nachtmins Blicke, die bis zum jenseitigen Rand seines Umschließungskreises zu reichen schienen, zuckten hierhin und dorthin, und noch bevor der nächste Donner seine Worte übertönen konnte, rief er Hekenua zu:
»Sieh dich um! Hier fängt die neue Grenze an. Kein Nomade soll sich wieder an Mu-Wer-Siedlern vergreifen. Jede Nachricht wird hier ihren Anfang haben!« Er lachte rau. »Und viele Leben enden heute hier; die Fürstin der Einöde hat der Goldhorus das Land genannt. Schneller, ihr Tapferen!«
Das Gewitter walzte heran; eine Erscheinung, die nur Bewohner des Mündungsdreiecks kannten. Aus den harten Windstößen war der Vorbote eines Sturms geworden, der nach Süden jagte und die Soldaten traf. Zwischen den Donnerschlägen war Kampflärm zu hören. Trillerndes Geschrei drang hinter den Hängen des Trockenflusses hervor, Klirren, dumpfe Laute, Bronze schlug gegen Bronze. Nachtmins Trupp lief durch staubendes Gras am Rand der zerklüfteten Geröllader. Vor der Sonne bildete sich ein Schleier, ihr Licht wurde gelbrot. Nachtmin blieb stehen, seine Lippen bewegten sich, dann nickte er und brüllte:
»Sie treiben uns die Nomaden entgegen. Ein paar hundert!«
Zweihundert Schritte später trafen sie die ersten Wassertropfen, die wie kleine Steine aus dem Himmel fielen. Das Gewitter, das sich krachend und blitzend näherte, kämpfte gegen den Sandsturm aus dem Westen. Der Kampf am Boden hatte sich, soweit es Hekenua und Nachtmin erkennen konnten, an einem Dutzend Stellen festgefressen. Eine Rinderherde preschte mit gesenktem Gehörn heran und zwang Nachtmins Bogenschützen zum Ausweichen, und als sie die Bögen spannten und auf dunkle, fast nackte Gestalten schossen, rauschte das Wasser schräg aus der halben Dunkelheit. Das also ist Regen, dachte Nachtmin; ich hab’s Karidon nie recht glauben können. Der Regen vertrieb den aufgewirbelten Staub und die gnadenlose Hitze, drang in die Mäntel ein, tränkte sie und machte sie schwer, wusch in breiten Bahnen Staub und Schweiß von Körpern und Gesichtern, hämmerte Sand und Staub von Büschen, Gräsern und Baumkronen und verwandelte sich am Rand des Trockentals in kleine Rinnsale. Durch die Flut rannte, von Hunden bekläfft, eine Herde Schafe mit triefenden Fellen. Ein schleuderschwingender Hirte wurde von einem Wurfspeer in die Brust getroffen und fiel schreiend zwischen die Tiere. Inmitten der Wasserflut, des brüllenden Donners, der die Männer und Tiere taub machte, inmitten greller Blitze im roten Sonnenlicht schien Nachtmin verwirrt zu sein; er packte Hekenua an der Hand und rannte zu einem kleinen Hügel. Rings um ihn kämpften die Soldaten der Schutzgarde. Ihr Geschrei konnte niemand hören; jeder sah nur aufgerissene Münder. Einige Zeit später, nachdem Nachtmin seinen Unterführern Befehle gegeben hatte, hatte sich der Ring in ein unregelmäßiges Oval zusammengeschnürt und verkleinert. Zwischen den Soldaten vermochte niemand mehr durchzuschlüpfen. Sie trieben die Nomaden, die sich mit ohnmächtiger Wut wehrten, Schritt um Schritt dichter zusammen und nach Südost, auf das verlassene Lager zu. Nachtmins Männer hieben die Nomaden nieder, umzingelten Frauen und Kinder und fesselten sie; wieder galoppierte eine Rinderherde durch das Flussbett, in dem bereits knöchelhoch gelbstrudelndes Wasser stand. Das Gewitter war über dem Schlachtfeld, donnerte und spie gewaltige Wassermassen aus, ein Blitz spaltete einen Baum, setzte ihn in Flammen; der Regen löschte sie wieder. Ein Hund, die eigenen Eingeweide hinter sich herschleppend, sprang geifernd neben einer Schar Ziegen her und biss einen Speerträger. Er erschlug ihn mit der Kampfkeule. Pfeile flogen unhörbar durch die Schleier des Regens. Die Sonne war hinter der Wolke verschwunden, zwei Soldaten trugen einen Verwundeten auf dem Schild zur Seite, eine kämpfende Nachhut der Nomaden watete durchs Wasser auf die andere Seite des Flusses und wurde dort umstellt. Nachtmin schien eingesehen zu haben, dass niemand sein Geschrei hörte. Hekenua, die sich gegen die Rinde eines Baumstammes presste, an der Wasser herunterrann, schmeckte den salzigen Regen auf ihren Lippen und starrte den breitschultrigen, krummbeinigen Feldherrn an, der auf magische Weise die Blicke seiner Männer auf sich zog. Er deutete auf einen Spalt unter der Masse der Gewitterwolken. Dort zeigte sich strahlender Himmel über Dünen, an deren Flanken zäh ein seltsamer Brei aus Sand und Wasser herunterkroch.
Eine Doppelreihe Soldaten, die gefesselte Männer mit den Speerspitzen vor sich hertrieb, kam aus westlicher Richtung. Sokar-Nachtmin gestikulierte, die Männer schüttelten die Köpfe, der nächste Blitz knatterte, als bräche ein Berg, zehn Chen-Nub weit im Süden; der Donner, sieben Atemzüge später, erschütterte die Körper. Hekenua begriff: Niemand kam mehr hinter diesen Speerkämpfern, denen schwarze Rinnsale aus den Perücken liefen.
Nachtmin deutete mit der Axt zum Lager. Hekenua versuchte ihren Mantel zusammenzurollen, sah in Nachtmins Gesicht und nickte. Der stürmende Regen war kalt gewesen, nun erwärmte er sich: Die Erde schien zu dampfen, aus Süd und Nord stapften Soldaten heran und folgten den anderen, ließen sich von Nachtmin die Richtung zeigen. Undeutlich verstand Hekenua:
»Nicht mehr als drei-, vierhundert. Mehr als die Hälfte Männer.«
Als die Bogenschützen, die am Fuß des Hügels gewartet hatten, Nachtmin und Hekenua sahen, bildeten sie einen schützenden Kreis und begleiteten sie. Ein Krieger hielt erbeutete Köcher in die Höhe: An vielen Pfeilen funkelten Bronzespitzen. Die Blitze, der Donner, der leiser geworden war, und der Regen, dessen Tropfen nicht mehr schmerzten, walzten nach Süden. Man konnte wieder seine eigenen Worte verstehen.
»Ein schwerer, aber schneller Sieg«, rief Sokar-Nachtmin. »Das Schwerste kommt noch.«
Er zeigte auf den Sandsturm. Tagelang hatte die gigantische Walze scheinbar bewegungslos in der Luft gestanden und war nicht einen Schritt näher gekommen. Jetzt, als die dunklen Wolken sich auflösten und das Sonnenlicht seinen bösen Glanz verlor, sich zur Tageshitze unerträgliche Feuchtigkeit in der Luft staute, kam die Sandwolke näher, als habe sie das Gewitter aufgescheucht. Wieder brüllte der Feldherr:
»Wir gehen zum Lager. Wir nehmen mit, was wichtig ist. Dann immer weiter, mit den Gefangenen, zu unseren Eselmännern. Nicht lange stehenbleiben, ihr Tapferen.«
Die Unterführer hoben zum Zeichen, dass sie ihn verstanden hatten, die Arme. Die Truppen des Hapilandes waren in großer Überzahl gewesen, dachte Hekenua, aber dies sicherte einen Sieg ohne große eigene Verluste. Vom Lager aus waren sie etwa fünfzehn Chen-Nub weit gegangen, achttausend Schritte. Hekenua kannte Sandstürme aus Wawat und selbst aus Itch-Taui, aber was sich in ihrem Rücken zusammenbraute, war der wütende Großvater aller Stürme, der sie alle, Nomaden und Krieger, umbringen konnte. Schweigend folgten sie dem Hauptteil des Heeres und blinzelten in die Sonne; der Wind hatte eine Hälfte des Himmels leergefegt. Den Weg markierten Zeugen der Kämpfe: tote Schafe, im Todeskampf zuckende Hunde, Rinder mit gebrochenen Läufen die Soldaten schnitten ihnen die Kehlen durch alte Frauen mit Pfeilen in der Brust, ein lächelnder Säugling, dessen Körper von Speerwunden aufgerissen war, einige Greise mit zerschmetterten Schädeln, ein toter Rômet, verlorene oder weggeworfene Nomadendolche aus Bronze und Hausrat. Plötzlich hörte der Regen auf. Als die ersten Dünen vor ihnen auftauchten, sagte Hekenua:
»Es ist weit bis nach Itch-Taui, Feldherr. Oder bis zu den Schiffen im Mu-Wer.«
»Der Sturm wird uns in drei, vier Stunden erreichen, Shenet.« Nachtmins Gesicht zeigte Besorgnis und Unruhe. »Für uns ist es gleich, ob er uns in den Schiffen erstickt, in der Wüste oder in der Stadt. Wenn wir es den elenden Nomaden abschauen, glaube ich, überleben wir zwischen dem Lager und dem Rand vom Scha-Resi-Gau besser.«
»Du fürchtest dich nicht davor zu ersticken?«
»Wer Schläge austeilt, Schönste, wer tötet, ohne lang zu zögern, muss einstecken können.«
»Ich will weiterleben, Feldherr.«
»Ich auch. Wir alle. Mitunter stirbt es sich schnell, Hekenua. Im Allgemeinen, wenn ein paar tausend Männer dich – auch mich – beschützen, ist es schwerer, ganz einfach zu sterben.«
Er verdoppelte das Maß seiner Schritte, um zu seinen Männern aufzuschließen. Noch immer hielt sie mühelos mit. Er lächelte ihr zu, und sie sah wieder einmal verwundert, dass trotz der vielen Narben seines Körpers seine Zähne vollständig und weiß waren. Ungeachtet ihres Zweifels an Karidons Ehrlichkeit sagte sie:
»Denk daran, Nachtmin, dass ich in Itch-Taui deinen grünäugigen Freund treffen und seine Nachrichten von den Grenzen weitergeben muss.«
»Seit hundert Schritten denke ich wieder daran.«
Die letzten des Heeres erreichten das Lager, aßen und tranken hastig, schulterten Teile der Ausrüstung, die von den Eselmännern halbwegs ordentlich zurückgelassen worden waren, und folgten deren Spuren, die Gefangenen vorwärtstreibend. Woher, dachte Hekenua, hatten die Nomaden bronzene Axtklingen, Pfeilspitzen und Dolchschneiden? Von den Bronzehändlern? Eine Stunde nach Mittag peitschten die ersten Sandkörner des Sturms in ihre Rücken und Nacken.
Bis zu den Schiffen, dem Kanal im Sumpf und der Straße nach Itch-Taui verstrich eine Ewigkeit voller Qualen.
Zwölf Stunden am Tag bestand die Luft aus einem Gemenge aus kochendem Staub und Sand. Die Männer drängten sich zusammen; Esel und Krieger, knatternde Leinwand, nasse Tücher, Krüge voll Wasser, Haufen im Sand verschwindender Schilde, Speere und Waffen bildeten Hügel in der unendlichen Flut rasender Myriaden und Abermyriaden scharfkantiger Körner, die in den Nasen bissen, zwischen den Zähnen knirschten, Ohren verstopften, die Augen blendeten, sich in die Atemluft mischten, die Männer und Tiere verschütteten und unter kleinen Dünen und langgezogenen Verwehungsdreiecken begruben. In den kalten Nächten, wenn der heulende, wimmernde, kreischende Sturm vorübergehend an Kraft verlor, begannen diese Haufen zu leben, bewegten sich, entließen unkenntliche Körper, die stöhnend und ächzend nach Luft schnappten, gierig tranken, kaltes Zeug herunterwürgten: Sand war überall. In stinkenden und verlausten Perücken, zwischen Stoff, Leder und Haut, in den Ohren, Waffengehängen, unter den Nägeln der Finger und Zehen, in den Augenwinkeln ebenso wie in den Alpträumen. Nachts, wenn nur wenige Sterne blinkten, in der Wolke aller Wolken, schleppten sich Soldaten, Unterführer, Esel und Gefangene weiter, dem Sepedet entgegen, der sich manchmal blinkend zeigte; jeder wusste, dass der Sandsturm längst im Hapiland wütete, Mauerkanten rundschliff, Farben tilgte, Bilder zerstörte, Häuser und Tempel zuwehte, Kanäle füllte, Tiere und Menschen erstickte und wandernde Dünen auftürmte und wieder abtrug.
Sokar-Nachtmin fluchte, zerrte Esel aus dem Sand, trug Nomadenkinder auf den Armen ins Freie, schleppte Wasserkrüge, half, Brunnen freizuwühlen, verteilte Fußtritte, Fausthiebe, Lob und Tadel, sammelte Kampfkolben auf und hielt seine Männer samt den Gefangenen zusammen und kam, verwahrlost, halb verhungert und verdurstet wie alle anderen, zugleich mit dem Ende des Sturms nach Itch-Taui. Den Soldaten war die Stadt fremd geworden, die Bewohner erkannten ihre eigenen Söhne nicht wieder.
Eben brachte mir ein Bote ein Shafaduröllchen, das mit einem dünnen Bronzedraht umwickelt war. Obwohl mein Tisch übersät ist von flüchtigen Niederschriften anderer Schreiber – Nachtmins, Hekenuas, etlicher Boten aus den Gauen hapiaufwärts –, wickle ich den glänzenden Faden auf, rolle das Blatt auseinander und lese:
KARIDON VON DER AUGE DER MORGENRÖTE an Merire-Hatchetef. Fünfmal abgeschrieben, durch Boten: Mit viel Nechoschet kommen wir am Beginn des Choyak, wenn wir den Hapi befahren können, nach Itch-Taui. Millionen Grüße an dich, Sokar-Nachtmin, Nefer-Herenptah, an den Verwalter des Parennefer-Hauses und – an Chakaura. Wir sind gesund, wohl und reich: Vielleicht hat der Goldhorus eine neue Aufgabe für uns, bei der wir uns nicht langweilen. Zinn ist teurer geworden, der Preis für Kupfer fiel. Lass Henket-Krüge ins kalte Wasser stellen. Der Goldhorus möge für Wein und wohlgeformte Tänzerinnen sorgen.
Merire-Hatchetef legte das Blatt zur Seite, lächelte und hob die Trinkschale an die Lippen. Sie war, wie der Krug, voll mit starkem Keftiwein. Merire unterdrückte den Schmerz in den Zähnen, nahm einen zweiten Schluck und las mit halb zugekniffenen Lidern das bisher Geschriebene. Er nickte, kaute mit schmerzenden Zähnen einen Binsengriffel weich und tunkte die Spitze ins Schwarze; er schrieb:
SIEBEN MAL SIEBEN TAGE des Jahres 27 sind vergangen. Es ist weit nach Mitternacht. Jeder Tag, an dem die Spuren des Braunen Würgers um ein weniges getilgt werden, ist wichtig. Viel wird zu schreiben sein aus den Gauen. Viel Arbeit ist nötig, bis Tempel, Palast und Stadt wieder im alten Glanz erstrahlen. Viele drängende Fragen werde ich Karidon stellen. Auch der Goldhorus wird die Auge der Morgenröte mit sorgenvollem Herzen und Argwohn willkommen heißen.
1. Nach dem Sturm: Rätsel und Aufbruch
Die roh bearbeitete Säule, fünfundzwanzig Ellen lang, lag halb im Sand versunken am Hang des Dammweges. Karidon und Priester Merire-Hatchetef sahen zu, wie Fischer, deren Boote langsam in der Strömung trieben, gekrümmte Amaahölzer in Entenschwärme schleuderten; ab und zu brach der wirbelnde Holzschenkel das Genick eines Vogels im Schilf. Modergeruch zog vom Wasser heran. Der Priester deutete auf einen Strauch, der von handgroßen Blüten übersät war. Bienen summten davon, eine Blüte löste sich und fiel zu Boden.
»Am Morgen hat sich die Blüte geöffnet, einen Tag lang erfreut sie durch Schönheit und Duft. Am Abend welkt und fällt sie, nachts verdorrt sie. Ihr Dasein hat sich erfüllt, Kari.«
»Was willst du mir damit erklären, Sesh Merire?«
»Tage und Nächte unser aller Leben gleichen der Blüte: dem, was wir sind und was wir recht zu tun glauben. Die Spanne unseres Lebens ist länger als das Leben der Blüte; wenn wir am Ende des letzten Abends dahingehen, welken wir nur scheinbar; wir blühen und leben im Seelenland Amenti. Auch wenn wir es nicht erkennen können – alles, was wir getan haben, tun und tun werden, ist Teil des Großen Gefüges. Eines bedingt das andere, ist verwoben mit dem Tun aller Menschen. Von jedem bleibt etwas, auch wenn du es nicht sehen kannst.«
»Das sagen deine Götter, Merire?«
»An die du nicht glauben musst. Ich will damit sagen, dass du an allem, was mit dir geschieht, nichts wirklich ändern kannst. Denk an die Worte des Priesters in Alashia.« Karidons Blicke verfolgten eine grüne Eidechse, die sich sonnte und auf eine Fliege zukroch. »Die Lähmung, die ich spüre, hat verschiedene Gründe; du kennst sie nicht alle.«
»Deine Gründe sind Erinnerungen, Gefühle und vielleicht Selbstvorwürfe. Schwarze Träume der Einsamkeit nach dem Tod deiner schönen Prinzessin. Dein angeblicher Verrat. Sie werden vergehen: Morgen öffnen sich neue Blütenknospen. Unordnung ist nichts anderes als die unbegreifliche Ordnung der Götter; das gilt auch für Wellen und ferne Inseln. Wenn es dir gelingt, dich in den Kern deines Ka zu versenken, wirst du erkennen.«
»Was werde ich erkennen?« Karidon erinnerte sich nicht, Merire jemals so überzeugend sprechen gehört zu haben. »Meine Unfähigkeit, mein Leben so gut zu steuern wie die Morgenröte?«
Die Fliege summte davon, die Eidechse verschwand im raschelnden Gras, eine Katze, deren Schwanzspitze zuckte, näherte sich. Frühabendliche Ruhe senkte sich über den Tempelbezirk. Merire nickte bedächtig.
»Vielleicht erkennst du in der Unterwelt düsterer und mutloser Gedanken ein hilfreiches Licht, wie den Sepedetstern, der abermals die Flut ankündigt.«
»Wenn es ein anderer sagen würde, Merire … dir kann ich es glauben.« Karidon sah in die riesige gelbrote Sonne, die hinter senkrechten Gattern aus Palmenstämmen und Ried sank. »Nach all dem Reden: Was soll ich tun? Ich fürchte mich vor denen, die hinter den bösartigen Gerüchten stehen, und noch mehr fürchte ich die Rachsucht dieses Kupfergruben-Fürsten.«
Merire-Hatchetef streckte die knochige Hand aus. Durch einen schmalen Seiteneingang, dessen Tür offenstand, kamen sie hinter den Säulen zum Garten, der das Gästehaus umgab. Viele Schäden des Sandsturms waren beseitigt. »Woran denkst du, Karidon? An lebenslange Verfolgung durch Anatnetish? An Chakaura, der an deiner Freundschaft zweifelt?«
»An beide. Und an die Quader, mit denen die Höhle meiner Erinnerungen vermauert ist. An den einäugigen Priester, an die Ahnung des Sonnenaufganges an Keftis Küste.«
»Schlaf dich aus.« Merire zeigte zum Palast. »Vieles hat sich geändert seit dem letzten Besuch der Morgenröte, damals, nachdem du wieder steuern konntest. Ich weiß nicht, ob Sokar-Nachtmin in der Stadt ist. Aber Chakaura wird dich bitten, ihm und dem Hapiland zu helfen. Frag nach Hekenua; eine junge, schöne Frau wartet auf dich.«
»Im Gästehaus?«
»Ich weiß es nicht.«
»Und du, Sesh Merire? Glaubst wenigstens du mir?«
»Ich glaube dir. Ich geh in mein Kämmerchen; mögen weiterhin Thot und Imhotep sowie Sachmet und Sopdu mein Tun gnädig betrachten; später soll man’s ohne Schwierigkeit lesen können.«
»Was wäre das Hapiland ohne dein emsiges Schreiben?« Karidon zog Merire an seine Brust. »Unwissend, ohne Erinnerungen, Träume, gelöste Rätsel und feine Erklärungen!« Merire richtete sich auf und schüttelte den Kopf. »Schwerlich, o keftischer Kapitän. Von der Million Fragen, die man später stellen mag, würde man ein paar Dutzend beantworten können. Der Hapi schwemmt täglich Abermillionen Tropfen ins Große Grüne. Es gibt mehr Sandkörner, als alle Priester zählen können; mein Schreiben ist nur ein Lehmziegel zwischen unzähligen gleichartigen, bald vermauert im plumpen Irrgarten der Vernunft.«
Karidon winkte Ptah, der aus dem Eingang trat, und sagte leise:
»Eines fernen Tages werde ich deine Bescheidenheit begreifen können, Priesterlein. Noch vermag ich’s nicht.«
»Keine Bescheidenheit, Kapitän. Nur Einsicht ins Maß der Dinge, ein klarer Blick auf die Waage der Maat.«
Ti-Djehuti wartete geduldig. Er lehnte in der Abenddämmerung an der Mauer außerhalb der Tore von Gubla; mit halb geschlossenen Augen beobachtete er eine Karawane trippelnder Esel mit riesigen Lasten auf den Rücken. Die Eselmänner zerrten und schoben die Lasttiere zum Brunnen. Dort, zwischen Zelten und Verschlagen, lagerten Händler aus dem Osten. Aus der sinkenden Staubwolke am Ende des Zuges löste sich eine einzelne Gestalt, sah sich um und kam langsam näher.
Djehuti hob langsam die rechte Hand, legte sie auf die Brust und verneigte sich. Er murmelte: »Es war nicht einfach, Fürst, aber – hier bin ich.«
»Ich seh’s.« Der hochgewachsene Mann, dessen Haar im Nacken von einem Bronzering zusammengerafft war, ergriff Djehutis Handgelenk und schüttelte es. Im schwarzen Haarschopf leuchteten silberne Strähnen; der Wanderer, der Schild, Wurfspeer, Bogen und Köcher auf dem Rücken trug, war von der Stirn bis zu den Sandalen mit Staub bedeckt. »Was kannst du berichten?«
»In der Schänke beim Tor hab ich zwei Nachtplätze für uns. Traust du dich in die Stadt?«
»Nur in der Nacht. Sind sie hier?« Die Stimme des Wanderers war leise und schneidend. In seinem Gesicht voller Schweißspuren rührte sich kein Muskel. Die Augen blickten scharf und schnell wie die eines Falken; der Fürst schien überall mögliche Gefahren zu wittern. Er starrte Djehuti forschend an.
»Nein. Zuletzt waren sie in Djeden und Iqarat. Sie sind nach Menefru gesegelt.«
Beide Männer schwiegen ein paar Atemzüge lang. Die Esel, deren Lasten abgeschnürt wurden, schrien schauerlich. Einige Männer trieben die Tiere von den Trögen zurück. Djehuti und Anatnetish gingen zum Tor.
»Was weißt du von ihnen?«
»Sie segeln unermüdlich von Hafen zu Hafen, sie werden reicher; das Glück der Götter verfolgt sie. Im Winter ruhen sie meist in einem Gutshof nahe Menefru-Mirê. Dort werden sie von Kriegern bewacht. Ein Freund des Bronzehändlers ist Sokar-Nachtmin, der Oberste Herr aller Heere.«
Der Fürst zog langsam den Dolch aus der staubigen Scheide. »Weißt du, wo der Gutshof ist?«
»Ja, Herr. Meine Späher sind zuverlässig.«
»Kannst du dich unbemerkt heranschleichen?«
»Nur auf weiten Umwegen, durch die Wüste.«
»Also kannst du ihnen schaden. Wirst du sie töten können?«
»Vielleicht. Aber nur aus dem Hinterhalt.«
»Wir reden in der Schenke darüber.« Anatnetish ließ sich von Djehuti ins Halbdunkel der baumbestandenen Gasse ziehen. »Einmal haben meine Getreuen jenen jungen Bronzehändler fast erschlagen; man fing, befragte und tötete sie. Du brauchst viel Mut.«
»Und viel Gold für jene Männer, die ihre Augen zur rechten Zeit abwenden.« Djehuti zeigte auf das Vordach der Herberge.
»Es ist genug da. Spüre sie auf, komm zurück und berichte: Ich will, dass keine Zeit verloren wird.«
Die Männer traten ein und setzten sich an einen kleinen Tisch unter dem Gebälk. Djehuti rief nach Henket.
»Viel Zeit, Fürst, viel Gold und Geduld, viel Gefahr. Niemand bleibt lange unentdeckt an den Ufern des Stromes. Ich vermag allein viel zu tun, aber um die Bronzehändler zu töten, brauche ich ausgesuchte Krieger.«
Die Sklavin stellte große Becher auf den Tisch. Die Männer tranken, als wären sie halb verdurstet. Anatnetish stützte die Arme schwer auf die Platte, holte tief Luft und blickte sich um. Niemand beachtete die Fremden.
»Zuerst schlagen wir uns die Bäuche voll. Dann ins Badehaus.« Der Fürst leerte den Becher. »Wir werden über jeden deiner Schritte lange reden. Und wenn es das Letzte ist, was ich schaffe – ich will den Bronzehändler und seine Mannschaft, alle!, tot sehen.«
»Ich weiß, Fürst.« Djehuti trank den letzten Schluck Bier und winkte der Sklavin. »Dafür gebe ich dein Gold anderen Männern; es sind geübte Mörder.«
Als Karidon am nächsten Morgen vor der Götterstatue im Palastgarten stehenblieb, sah er sein Spiegelbild in der goldenen Sonnenscheibe des Rê-Harachte: scheinbar älter als Jehoumilq, weißhaarig an den Schläfen, sonnengebräunt und selbstbewusst lächelnd. Er blickte auf und atmete frische Luft, schüttelte sich und hörte eine ruhige Stimme; Ptah-Netjerimaat sagte mit bedeutungsvollen Pausen zwischen den Worten:
»Du musst ausruhen, Krabbe. Hast du etwa die ganze Nacht geredet und Wein getrunken?«
Karidon schüttelte den Kopf und sah sich im Garten um. Ptah zog ihn zum Eingang.
»Ich muss nachdenken, ohne Henket und Wein.« Karidon starrte seine Zehen an. »Ich hab fast nichts getrunken. Es war ein langer, seltsamer Traum. Wir waren mitten im Sandsturm: Nachtmin, Ikhernofret und Cha-Osen-Ra … wir haben unendlich viel geredet. Hat eine Frau, Hekenua, nach mir gefragt?«
Ptah-Netjerimaat schüttelte schweigend den Kopf.
Die Auge der Morgenröte war am einundzwanzigsten Athyr hapiaufwärts gesegelt und durch den Kanal nach Itch-Taui gerudert worden. Die Mannschaft ruhte sich in Mlaissos Häuschen aus. Ptah-Netjerimaat und Karidon, im Gästehaus des Per-Ao, warteten auf Chakauras Rückkehr aus dem Süden und auf Ladungen besonders wertvoller Beute; teure Handelsgüter, die sie gegen Zinn und Bronze tauschen wollten. Karidon konnte sich nur zögernd aus dem klebrigen Gespinst des Traumes lösen. Er forschte, während er sich badete, den Bart schabte und einölte, nach etwas Greifbarem im Schatten des Bedeutungsvollen. Er schlief im kühlen Halbdunkel des kleinen Raumes, wankte zum Eingang: später Nachmittag. Er leerte einen halben Krug abgestandenen Dünnbiers und schien nach kalten Wassergüssen wieder klar denken zu können. Vorsichtig trug er Becher, rußige Lämpchen, Schalen und Krüge in die Küche des Gästehauses und sagte zu der hochgewachsenen Kushitin: »Etwas Brot, Shenet, Brühe und kaltes Henket. Nein, nichts von dieser Suppe. Danke.«
Der missfarbene Brei roch durchdringend nach gerösteten Palmnüssen. Karidon hockte sich auf einen Schemel und aß. Er zwinkerte, als von den Kesseln Dampfschwaden und Holzkohlenrauch in sein Gesicht schlugen; die Kushitin blinzelte zurück und lächelte mit kleinen, weißen Zähnen. Sie strich sich über die Hüften und streckte die Brüste vor.
»Du bist der Bronzehändler, Herr, nicht wahr?«, sagte sie. Karidon nickte und wischte die Schale leer. Er schob das frische Brot zwischen die Zähne. »Mit den grünen Augen. Der Freund von Ptah, der so freundlich lächelt, ein Shemer-Freund im Palast. Bleibst du lange, Herr?«
»Bis Chakaura und das Heer kommen, Shenet.«
»Ich bin die Oberste Aufseherin der Vorratskammern.« Sie hielt ihm einen Korb voll süßem Flechtgebäck entgegen, dessen Rand sie gegen die Brüste presste. Karidon nahm ein kleines Stück der braunen Dattelküchlein. »Abends sitz ich am Teich und langweile mich.«
»Wenn ich mich langweile«, brummte Karidon und biss in den Kuchen, »komm ich zum Teich. Dann langweilen wir uns zusammen.«
Sie lachte gurrend, als er die Küche verließ und langsam zum Kanalweg ging. Karidon näherte sich der Säule, auf der sie gestern gesessen hatten. Jetzt hämmerten und meißelten Künstler Bilder und Schriftzeichen in einen Teil der Rundung. Schwarze und rote Gitterlinien waren zu sehen; die Männer gebrauchten Bronzemeißel, solche mit Eisenspitzen, und doppelt faustgroße Steine, die härter waren als der Stein der Säule und die Oberfläche polierten. Karidon sah ihnen zu und grinste in sich hinein.
Es schien, als gelänge es ihm, seinen Lebensbogen wieder zu spannen und den Pfeil hoch und weit zu schießen; wo er einschlagen würde, konnte Karidon nicht ahnen.
Als er auf eine der westlichen Türöffnungen zuging, sah er auf der Terrasse eine Frau auf der gemauerten Bank sitzen, die langen Beine übergeschlagen, mit schwarzem Haar, dessen dünne Zöpfchen wie eine Perücke geflochten waren. Abendwind hob und senkte das Sonnensegel. Karidon blieb stehen, als die Frau die Hand hob.
»Du bist der keftische Bronzekapitän Karidon, Neb?«
»Ich bin Karidon.« Er lehnte sich gegen die Säule und betrachtete die Frau. Sie war höchstens achtzehn, gekleidet wie eine einflussreiche Rômet; von kühler, ungewohnt selbstsicherer Schönheit. »Du wartest auf mich? Bist du Nebit Hekenua?«
»Ja. Ich zähle, wie du, zu Sokar-Nachtmins Freunden. Ich war mit ihm in Kush, Wawat und im Großen Sturm. Ich weiß vieles von dir; auch über einen Köcher voll übler Gerüchte. Wollen wir reden?«