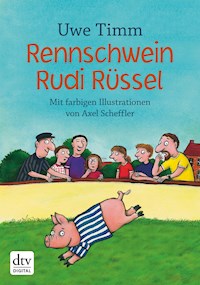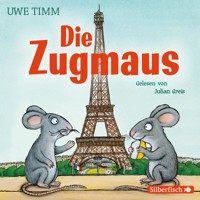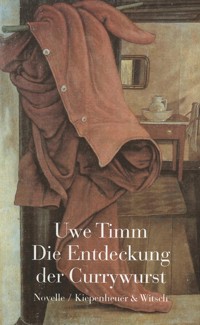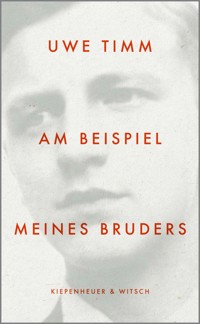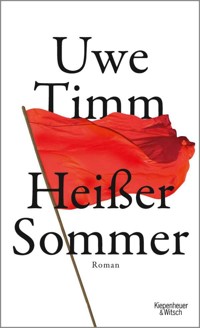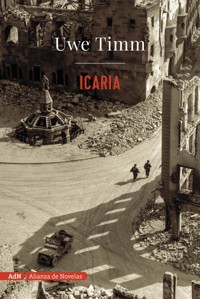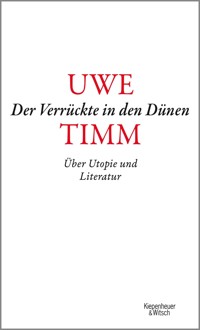9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Coburg Ende des 19. Jahrhunderts: Ein Mann, der Präparator Schröder, radelt auf einem Hochrad durch die Straßen. Diese Pioniertat bringt die Kleinstadt in Bewegung. Ungeheuerliches geschieht: Anna die Präparationsgattin, fährt im syrischen Unterkleid durch die Stadt, die Kopfstürze mehren sich und ein als Mann verkleidetes Freifräulein sinkt bei ihren Fahrversuchen immer wieder in Schröders Arme. Uwe Timm erzählt eine ebenso wahre wie phantastische Geschichte aus der noch nicht allzu fernen Zeit der großen Erfindungen und des unbeirrten Fortschrittsglaubens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Uwe Timm
Der Mann auf dem Hochrad
Legende
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940 in Hamburg, lebt in München und Berlin. Sein Werk erscheint seit 1984 bei Kiepenheuer & Witsch in Köln, u.a.: »Heißer Sommer« (1974), »Morenga« (1978), »Der Schlangenbaum« (1986), »Kopfjäger« (1991), »Die Entdeckung der Currywurst« (1993), »Rot« (2001), »Am Beispiel meines Bruders« (2003), »Der Freund und der Fremde« (2005), »Halbschatten« (2008), »Vogelweide« (2013), »Ikarien« (2017), »Der Verrückte in den Dünen« (2020).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Coburg Ende des 19. Jahrhunderts: Ein Mann, der Präparator Schröder, radelt auf einem Hochrad durch die Straßen.
Diese Pioniertat bringt die Kleinstadt in Bewegung. Ungeheuerliches geschieht: Anna die Präparationsgattin, fährt im syrischen Unterkleid durch die Stadt, die Kopfstürze mehren sich und ein als Mann verkleidetes Freifräulein sinkt bei ihren Fahrversuchen immer wieder in Schröders Arme. Uwe Timm erzählt eine ebenso wahre wie phantastische Geschichte aus der noch nicht allzu fernen Zeit der großen Erfindungen und des unbeirrten Fortschrittsglaubens.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1984, 2015, 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einem Entwurf von Mendell & Oberer, München
ISBN978-3-462-30872-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Von Möpsen und Menschen
Für Anna Timm
1
Neben meiner Schreibmaschine liegt ein kleiner silberner Stab. Er ist fast sechs Zentimeter lang und hat den Durchmesser eines Strohhalms. Seine Oberfläche zeigt ein fein getriebenes Rautenmuster. Das eine Ende ist offen, das andere mit einer winzigen Silberkapsel verschlossen, dazwischen, fast über die ganze Länge, zieht sich ein schmaler Schlitz, der von einem kleinen zweifach gerillten Ring abgeschlossen wird.
Bisher hat niemand auf Anhieb die Funktion des Stabes erraten können. Die meisten vermuten darin eine kleine Signalpfeife. Erst wer den Ring hochschiebt, sieht den Dorn aus Schildpatt, der dann aus dem Stab fährt – ein Zahnstocher.
Dieses zierliche Gerät ist ein Erbstück von meinem Großonkel Franz. Es liegt schon seit Jahren auf meinem Schreibtisch. Manchmal, wenn ich grüble, wenn ich nicht weiterweiß, spiele ich mit seinem Mechanismus oder kratze mit der Schildpattspitze den Dreck aus den Typen meiner Schreibmaschine. Bislang habe ich dabei nicht an Onkel Franz gedacht. Jetzt aber, seit dem Besuch meiner Mutter vor gut drei Wochen, die ganz zufällig auf Onkel Franz zu sprechen kam, ergibt das alles eine Geschichte: der Zahnstocher aus Schildpatt, die Erinnerung meiner Mutter, meine Erinnerung an ihre Erzählung und an Onkel Franz, den Hochradpionier, den Erfinder des Klammer-Gepäckträgers und den Schöpfer des ausgestopften Riesengorillas im Victoria and Albert Museum zu London.
Meine Recherchen gehören zu dieser Geschichte und die Erinnerung an eigene Kindheitsvorstellungen und neuerdings auch ein Traum.
Ich war auf einer Beerdigung. Es waren nur wenige, meist ältere Leute gekommen. Ein kleiner, mit Büschen und Bäumen bestandener Friedhof. Neben mir, eingehakt, geht eine schwarz verschleierte Frau, deren Gesicht ich nicht erkennen kann. Ich weiß aber, dass es meine Tante Anna ist. Sie ist noch sehr jung. Sie hechelt wie ein durstiges Tier. Ich versuche, unter dem Schleier ihr Gesicht zu erkennen, und bin nicht sicher, ob sich darunter nicht der Kopf eines Schäferhundes verbirgt. Ich frage sie, warum sie so hechelt, ob sie Durst habe. Sie sagt, das Hecheln mildere den Schmerz. Wir bleiben stehen. Eine kastenförmige, ganz mit Blech verkleidete, mannshohe Maschine wird auf kleinen Metallrädern zu der Stelle gefahren, wo Onkel Franz begraben werden soll. An der Schmalseite der Maschine ist eine Öffnung mit einem Klappverschluss wie bei Abfalleimern. Über die Breitseite verläuft ein schmaler Schlitz, durch den man etwas von dem inwendigen Mechanismus sehen kann. Die Maschine wird von einem Pastor in Gang gesetzt, und Tante Anna beginnt heftiger zu hecheln. Die Maschine sticht mit guillotineähnlichen Messern das Erdreich in der Größe eines Grabs ab. Deutlich sehe ich das rosige Fleisch halbierter Würmer, die sich zuckend in die Erdbrocken zurückziehen. Die Maschine ist eine Erfindung meines Onkels Franz, deren Funktion er durch seinen Tod demonstrieren kann: Er begräbt sich selbst, ohne Fremdhilfe und zeitsparend. Die Maschine sitzt jetzt auf der Grube auf, und ich kann nur noch die Grabgeräusche der Messer hören und das dumpfe Poltern der in den oberen Blechbehälter fallenden Erdbrocken. Dann steht die Maschine still. Selbsttätig beginnt sie den Sarg, der unsichtbar im Inneren hängt, abzusenken. Deutlich ist das Knirschen der Gliederketten zu hören, an denen der Sarg befestigt ist. Abermals verstärkt sich das Hecheln meiner Tante. Die Angehörigen, von denen ich zu meiner Verwunderung niemand kenne, gehen zu der Maschine und werfen durch den Schlitz die mitgebrachten Kränze und Blumen. Die Maschine zerkleinert sie sogleich zu einer Lockspeise. Was für ein eigentümliches, nie gehörtes Wort, denke ich und wache über meiner eigenen Verwunderung auf.
Ich habe Onkel Franz im Traum nicht gesehen, wusste aber, dass er tot im Sarg liegt. Tatsächlich waren wir, als er starb und beerdigt wurde, schon nicht mehr in Coburg, wohin meine Mutter und ich 1943 aus Hamburg evakuiert worden waren. Und dort, in Coburg, vor jetzt fast hundert Jahren, beginnt die Geschichte.
Der Morgenzug aus Lichtenfels war gerade eingelaufen. Die Gepäckarbeiter hoben, eingehüllt in eine grauweiße, nach Kohle und Öl riechende Dampfwolke, die einem Seitenventil der Lok entströmte, eine Kiste aus dem Gepäckwagen. Quadratisch groß, aber flach und ungewöhnlich schwer, zog sie sogleich die Aufmerksamkeit des Hallenmeisters auf sich. Die Kiste kam aus England, und zwar aus Coventry. Nun waren aus England kommende Kisten, Päckchen und Briefe in der Residenzstadt Coburg nichts Ungewöhnliches, denn Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha war ein Schwager der englischen Königin Victoria, und da er kinderlos war, sollte ein Sohn der Queen sein Nachfolger werden. So kamen über die engen verwandtschaftlichen Bande in großen und kleinen Mengen Tee, Porridge, Ingwer, Whisky und Krocketbälle in die Stadt, sogar ein Wasserklosett, als Vorbote eines lang geplanten Besuchs der Queen Victoria, das erste und für lange Zeit einzige Wasserklosett in der Stadt, das, nachdem man es im Schloss aufgestellt hatte, als Kartoffelwaschmaschine benutzt worden war, bis mit der Ankunft der Queen der staunende Hofstaat über die wahre Funktion aufgeklärt wurde.
Das Ungewöhnliche an der eben ausgeladenen Kiste war ihr Adressat: Nicht der herzogliche Hof, sondern der ortsansässige Dermoplastiker Franz Schröter, von dem man zwar wusste, dass er zwei Jahre in England gelebt und gearbeitet hatte, der aber bislang von dort weder einen Brief noch ein Paket bekommen hatte, von einer solch riesigen Kiste ganz zu schweigen. Der Hallenmeister schärfte dann auch dem Frachtfahrer ein, bei der Ablieferung der Kiste etwas über deren Inhalt herauszufinden. Nur zwei Stunden später lief das Gerücht durch die 16463 Einwohner zählende Stadt, der Präparator Schröter habe eine Platte reinen walisischen Bleis bekommen, das sich schon bei einer niedrigeren Temperatur als normales Blei verflüssige und auch schneller wieder erstarre. Schröter stellte nämlich die Schrotkugeln für die Kaninchenjagd selbst her. Er hatte aus der Dachtür seines zweistöckigen Fachwerkhauses eine Bohle wie einen Steg über die Regenrinne hinausgeschoben und an einem Dachbalken verschraubt. An das Ende der Bohle hatte er ein Eisensieb gebunden. Das Blei schmolz er auf einem Kanonenofen, eine Feuerpatsche und zwei Wassereimer in der Nähe, balancierte mit dem Tiegel auf der Bohle hinaus und goss das Blei durch das Eisensieb. Die Bleitröpfchen fielen unten als heiße Schrotkugeln auf den mit Sand bestreuten Boden.
Der Frachtfahrer, der die seltsame Kiste vom Fuhrwerk heruntergewuchtet und in den Laden geschleppt hatte, war überzeugt, dass es bei der Kiste nicht mit rechten Dingen zuging, so wenig wie bei diesen ausgestopften Vögeln, die so aussahen, als würden sie gleich losfliegen. Der Frachtfahrer trank das Gläschen Kirschwasser, das Schröter ihm angeboten hatte, und beobachtete aus kleinen, schon am frühen Morgen rauschgetrübten Augen, wie Schröter den Frachtbrief quittierte. Er stellte das Glas auf den Ladentisch, wischte sich die Hand an der schweren Lederschürze ab und sagte zum zweiten Mal: Des is fei schö schwer, des, net. Doch Schröter konnte oder wollte nicht verstehen, schenkte dem Kutscher ein zweites Glas ein, das schnell mit einem dröhnenden Schluckgeräusch geleert war. Schröter starrte plötzlich durch die Schaufensterscheibe nach draußen. Als sich der Kutscher umdrehte, sah er nichts weiter als seine beiden schweren Belgier, die vor dem Wagen standen, die Köpfe im Futtersack, und der eine, der Hans, hatte sich wie gewöhnlich auf die Spitzen seiner Hinterhufe gestellt, um sich beim Pissen nicht nass zu spritzen. Was war daran so sonderbar? Er kippte das dritte Glas, sah Schröter an und dann das Käuzchen, das da von seinem Ast auffliegen wollte, aber zum Gotterbarmen nicht konnte, ging schließlich aus dem Laden, nahm die Futtersäcke ab, stieg auf den Kutschbock, drehte die Bremse los und knallte kräftig mit der Peitsche.
2
Vor zwei Jahren hatte Schröter, aus England kommend, in der Judengasse ein Geschäft eröffnet. Das Haus hatte er mithilfe zweier Hypotheken gekauft. Seine im Schaufenster ausgestellten präparierten Tiere erregten in der Stadt ein ganz ungewöhnliches Aufsehen. Denn die ausgestopften Tiere, die man bislang kannte, meist Füchse und Fasane, ähnelten nur vom Fell oder Gefieder her ihren lebenden Vorbildern. Eher glichen sie pelzigen Würsten und gefiederten Säcken. Jetzt standen die staunenden Coburger, unter ihnen die drei alteingesessenen Präparatoren, vor dem neu eröffneten Laden und starrten durch die Schaufensterscheibe in den Ausbauer, wo ein Fuchs gerade eine Ente gerissen hatte. Die Daunen und Federn klebten ihm noch am blutverschmierten Maul, Lefzen und Zähne glänzten feucht. Das Tier stemmte mit der rechten Pfote den am Boden liegenden, seitlich aufgerissenen Entenkörper für den nächsten Biss fest. Der Fuchs wirkte, zumal durch die tote Ente, auf eine erschreckende Weise lebendig. Mütter führten ihre Kinder vor das Schrötersche Schaufenster und drohten mit dem Fuchs gegen spätes Zubettgehen, Unsauberkeit und Bettnässen. Es gab in der Stadt ältere Leute, die behaupteten, Schröter stehe mit dem Leibhaftigen in Verbindung. Der Altphilologe Doktor Nipperdey vom Casimirianum sagte, von den Erzählungen seiner Primaner angelockt, nur ein Wort: Laokoon. Ein dunkles Wort. Niemand konnte diesen trojanischen Priester sinnvoll auf den Fuchs beziehen. Vom regierenden Herzog wurde erzählt, dass er, der sich die Tiergruppe nach einer Ausfahrt angesehen hatte, Folgendes gesagt habe: Richtig gruselig.
Allerdings ließ er sich auch nach der Besichtigung die selbst geschossenen Hirsche und Sauen von seinem Hofpräparator zu den vertrauten harmlosen Pelzwürsten ausstopfen. Noch heute kann man die von herzoglicher Hand erlegten Greifvögel auf der Veste Coburg bestaunen: plump und unförmig hocken sie auf ihren Ästen und irritieren den Betrachter nur dadurch, dass sie nicht herunterfallen, was dicke, um Klauen und Äste gewickelte Drähte verhindern.
Schröter hingegen zeigte die Vögel im Augenblick ihres Abflugs. Schon hatten sie die Schwingen ausgebreitet, die Köpfe in einer energischen Linie nach oben gestreckt, die eine Klaue gelöst, die andere umkrallt noch den Ast, den sie im Augenblick loslassen muss – so waren sie in einer wilden Bewegung erstarrt. Und man sah, was man sonst nie sah: den Aufschwung ins Reich der Lüfte.
Mittags, nach der Bleilieferung, kam Schröter aus seinem Laden. Auf dem Kopfsteinpflaster stand noch immer ein Rest der Pferdepisse. Schröter zog sich die blaue Schürze über den Kopf und guckte hoch. Der Himmelsspalt über der Gasse war wolkenlos. Schräg gegenüber kam jetzt auch Metzgermeister Schön, ein kleiner zierlicher Mann, aus seinem Laden, in dessen Schaufenster ein abgebrühter Schweinskopf lag, ein Bündelchen Petersilie im Maul. Schröter und Schön wünschten sich eine gesegnete Mahlzeit und schlossen sodann die Läden ab. Schröter stieg in den ersten Stock zum Mittagessen hinauf.
Man hatte sich in der Nachbarschaft schon damit abgefunden, dass die morgens gelieferte Kiste nun wohl doch nicht so schnell ihr Geheimnis preisgeben und auch dieser Mittag einem ganz gewöhnlichen Nachmittag entgegendämmern würde, begleitet vom Abwaschgeklapper. Die in Gassen und Höfen gestaute Sonnenwärme stieg, vermischt mit Rotkohldünsten und dem Duft verblühenden Flieders auf und türmte sich über der Stadt zu einer mächtigen Kumuluswolke.
Schwalben schossen in Dachluken, Hunde lagen im Schatten und knackten Knochen, Katzen wärmten sich in der Mittagssonne. Es wurde still. Die Stadt hatte sich eben zum Mittagsschlaf gelegt, als ein nie gehörtes Getöse aus Schröters Hof kam. Nur der Milchhändler Zapf konnte von seinem Dachfenster aus in den Schröterschen Hof sehen. Unten am Boden lag Schröter, und auf ihm ein sonderbares Eisengestell, das Schröters Frau gerade wieder hochwuchtete. Es muss eine sehr resolute Frau gewesen sein, meine Tante Anna Schröter, geborene Werner, Tochter eines Bäckers aus Rostock. Nur mittelgroß, aber kräftig, mit einer eigenwilligen Nase, durchsichtigen blauen Augen und dichtem braunem Haar, das gegen jeden glättenden Versuch eine hartnäckige Welle warf. Anna klappte das Gestell auseinander, das, wie sich jetzt zeigte, ein sehr großes und ein sehr kleines Speichenrad hatte, an dem sie herumbog. Schröter war inzwischen aufgestanden und klopfte ganz beiläufig den Staub aus Jacke und Hose, sah nicht zu dem Zapfschen Fenster hoch, wo immer mehr Köpfe von Nachbarn, die kein Fenster zum Schröterschen Hof hatten, erschienen. Dann stellte Schröter sich links neben das Gestell, eine Hand, die linke, an der Lenkstange, die rechte auf dem Sattel, hinter sich Anna. Er stieg mit dem rechten Fuß auf einen Eisentreter am Radrücken, stieß sich ab und stemmte sich hoch, schwang sich mit einer raumgreifenden Bewegung des linken Beins in den Sattel, saß starr und mit stierem Blick da oben, umklammerte den Lenker, trat, während Anna das Gefährt seitlich abstützte, in die Pedale, bekam Fahrt, wenn auch nicht selbstfahrend, denn links ging, lief Anna, das Rad stützend gegen die immer stärker werdende Schräglage, stemmt sich gegen Mann und Rad, schreit: lot mol, lot mol, da versucht Schröter, mit einer letzten verzweifelten Anstrengung die Last von Anna zu nehmen, auch war das Ende des Hofs schon erreicht, er versucht, vom fahrenden Rad zu springen, kriegt auch noch das rechte Bein über den Sattel, stürzt dann aber mit gewaltigem Schwung und samt dem Rad, unter einem vielstimmigen Entsetzensschrei aus dem Zapfschen Fenster, auf Anna.
Was hat Onkel Franz in diesem Augenblick gedacht? Aufgeben? Einen anderen Übungsort ohne Zuschauer suchen? Und was hat Tante Anna gedacht? Überliefert ist, dass sie in jäher Wut gegen das kleine Hinterrad des Gefährts trat. Das hohe Zweirad, Hochrad, Bicycle, Ordinary, Velociped, Boneshaker, Headbreaker war nun auch in diese Stadt gekommen.
Es hatte in der Stadt schon vor Onkel Schröter Versuche gegeben, das Fahrradfahren einzuführen, schließlich fuhr man in Berlin, München und Frankfurt schon seit Jahren. Aber die Vorgänger – oder genauer Vorfahrer – von Onkel Franz gaben, nachdem sie die beträchtliche Fallhöhe am eigenen Leib verspürt hatten, schnell wieder auf. Der Fahrer saß nämlich ziemlich genau auf der Mitte des übergroßen Vorderrades. Bei scharfem Bremsen, steilem Bergabfahren oder aber, wenn ein größerer Stein im Weg lag, wurde er mit kräftigem Schwung über das Vorderrad gehoben und mit dem Kopf voran zu Boden geschleudert. Header, Cropper oder Kopfsturz nannten die Fahrradpioniere diesen Sturz.
Von alldem wusste Schröter, als er am nächsten Nachmittag das Rad aus der Haustür hob und es, gefolgt von einer neugierigen Menge, die Mohrenstraße hinunter zu einem kleinen Platz an der Itz schob. Er hatte am Abend zuvor überlegt, ob er sich irgendeinen geheimen Ort außerhalb der Stadt suchen sollte, hatte sich dann aber gesagt, dass ihm auf jeden Fall irgendjemand folgen würde. Die Erzählungen über seine Fahrversuche hätten dann nur umso fantastischer ausgeschmückt in der Stadt die Runde gemacht. Allerdings hatte er Anna verboten mitzukommen, angeblich, weil ihre Nähe ihn dazu verleiten könne, doch ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, tatsächlich aber wollte er ihr nur die höhnischen Bemerkungen der Gaffer ersparen. An dem Platz angekommen, begann sofort sein wütender Kampf mit diesem Gestell. Er war ja notgedrungen Autodidakt und hatte sich eine Broschüre zur Erlernung des Hochradfahrens besorgt, in der in zahlreichen Abbildungen das richtige Auf- und Absteigen illustriert worden war.
Schröter erlebte an diesem Nachmittag den großen und grundlegenden Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Er stieg auf und fiel um. Die Menge stand und schwieg. Er stand wieder auf und fiel wieder um. Nachdem er das einige Male wiederholt hatte, einmal auch in den Sattel kam, dann aber umso schneller nach vorn kippte – er konnte gerade noch den Kopf einziehen und sich über die Schulter abrollen –, hatte sich schon unter den nun begeistert Klatschenden ein spontaner Schlachtruf gefunden: Hopf, hopf, hopf, immer aufem Kopf! Es muss eine Stimmung wie siebzig Jahre später in einem Catcherzelt gewesen sein, als er sich wieder aufrappelte, einen Moment benommen hin und her tappte, das Rad aufhob, das Vorderrad und das kleine Schwanzrad vorschriftsmäßig in einer Linie aufstellte und nunmehr anschob, da er mehrmals die Erfahrung gemacht hatte, dass er nie so schnell aus dem Stand in den Sattel kommen konnte, wie das Rad umfiel.
Ich bewundere ihn und frage mich, warum er sich dieser Tortur unterzog, denn da waren ja nicht nur die schmerzhaften und oftmals auch gefährlichen Stürze, sondern auch das sie begleitende widerliche Gelächter all der Neugierigen. Er machte sich auf eine schmerzhafte Weise lächerlich. Warum? Hatte man ihn als Säugling in einem jener Steckkissen herumgetragen, die damals noch gebräuchlich waren und den Müttern während ihrer Arbeit erlaubten, die Kinder als gut verschnürte Pakete abzulegen? Musste er, der Jüngste, dem ein ausgeprägter Wille nachgerühmt wurde, mit ohnmächtiger Wut ansehen, wie alle Geschwister schneller weglaufen konnten als er? Oder hatte sich in ihm später, während seiner Dienstzeit bei der Infanterie, ein solider Hass auf diese schwachsinnige Lauferei gestaut, wenn ihm die Gewaltmärsche trotz sorgfältigst gewickelter Fußlappen die Haut von den Hacken zogen? Natürlich reichen solche Mutmaßungen nicht aus, um diese seltsame Mischung aus Tollkühnheit, Kraft, Entdeckerfreude, Eitelkeit, Bewegungslust und Hartnäckigkeit zu erklären, mit der er das Radfahren erlernen wollte. Und wieder stürzte er. Die schadenfrohe Menge feuerte ihn jetzt mit dem Reim an: Los, Schröter, hopp, fall mal aufn Kopp!
Aber dann, nachdem es einen Moment so ausgesehen hatte, als wolle er aufgeben, richtete er das Rad wieder auf, starrte kurz zu den Grölenden hinüber, entdeckte nicht Anna, die trotz seines Verbotes gekommen war, im Korb ein Verbandspäckchen, und in der tobenden Menge still und erschrocken stand, denn was sie sah, war nicht das vertraute Gesicht ihres Mannes: Der da mit stierem Blick und verkniffenem Mund Anlauf nahm, den kannte sie nicht, das war ein anderer; der stieg jetzt mit wutverzerrtem Gesicht auf das Rad, stieß, als er oben sitzen blieb, einen erlösenden Schrei aus, trat in die Pedale, nahm mit bedrohlicher Schräglage Fahrt auf, tretend, tretend, tretend, wurde schneller, richtete durch eine vorsichtige Gewichtsverlagerung das Rad auf und fuhr immer schneller werdend über den Platz, hinter sich die verstummende Menschenmenge, die zum ersten Mal staunend sah, was doch jeder Erfahrung widersprach, was so ganz und gar gegen den gesunden Menschenverstand ging, dass zwei Räder rollten, nicht kippten. Schröter fuhr, den Oberkörper weit vornübergelegt, was, wie er wusste, falsch, gefährlich und unelegant war, aber er fuhr und hatte plötzlich das Gefühl, als schwebe er, ein Gefühl, das er später als das reine Glück beschrieb, ein Gefühl der Mühelosigkeit, das ihm jetzt, nach all den Qualen, umso reiner erschien und dessen Geheimnis darin lag, dass er sich erstmals aus eigener Kraft schneller und ruhiger vorwärtsbewegen konnte, als es ihm allein auf sich gestellt je möglich gewesen wäre. So fuhr er ein gutes Stück, bis er an das Ende des Platzes kam, der dort fast vier Meter steil zum Fluss abfällt. Vergeblich versuchte er, eine Kurve zu fahren. Die Geschwindigkeit war zu groß. Bremste er, hob sich sofort das Schwanzrad bedrohlich hoch. So blieb nur der Notabstieg. Das Absteigen vom Hochrad aber, das wusste Schröter, war die schwierigste Sache der Welt. Und natürlich hatte er den Absatz aus der Hochradfahrschule, den er gestern Abend noch gelesen und rot unterstrichen hatte, nicht mehr vor Augen: Beim Absprung über die Steuerstange wird das eine Bein in die Höhe gehoben, das Bein wird über die Stange geschwungen und mit der Hand der Griff wieder gefasst. Nunmehr wird das Bein bei der anderen Hand in derselben Weise wieder herausgelassen, sodass die Beine auf eine Seite hängen, worauf man abspringt. Dieser Absprung macht den Eindruck der Kühnheit, sieht aber viel schwerer aus, als er ist, und verlangt nur ein wenig Mut und Selbstvertrauen.
Es waren weder Mut noch Selbstvertrauen, die Onkel Franz einen neuen, stark vereinfachten Absprung finden ließen, es war die Angst vor der Uferböschung. Er stieß sich von dem dahinrasenden Rad ab, machte eine damals von allen Turnlehrern hochbewertete Rückwärtsrolle, kam auf dem Hintern zu sitzen, aber mit solchem Schwung, dass er mühelos aufstehen konnte und so wie ein Artist, wenn auch mit zitternden Knien, seinem Publikum gegenüberstand. Alle klatschten begeistert.
Abends, nachdem er sein Rad geputzt und Speiche für Speiche mit Öl abgerieben hatte, stieg er steif die ausgetretene Holztreppe zum Schlafzimmer hinauf, wo er sich die verdreckte Jacke und die aufgerissene Hose auszog, sich wie Odysseus nackt auf dem Ehebett ausstreckte, einer kolossalen Burg mit Holzpalisaden und wehrhaften Ecktürmen, und sich von Anna mit Ponds die Blutergüsse und Hautabschürfungen einsalben ließ. Sie wisse jetzt, warum er sich so abquäle, sagte Anna, warum er unbedingt auf dieser Maschine fahren wolle, sie habe ihn beobachtet, nachdem er das Rad aus der Itz gezogen habe, da, als er an all den gaffenden Leuten vorbeiging, habe sie den Grund in seinem Gesicht lesen können, genau das, wovor Hauptpastor Hahn in jeder seiner Predigten warne: Hochmut. Und Hochmut, sagte Anna, kümmt vor de Fall.
3
Am nächsten Tag hatte Onkel Franz einen Unfall, der ihn zwei Fingerglieder kosten sollte. Er machte dafür später immer Annas Bibelspruch verantwortlich: Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Spruch habe das Unglück regelrecht angezogen, behauptete er und hob dann jedes Mal wie zum Schwur die verstümmelte Linke.
Onkel Franz war nie sonderlich abergläubisch, nicht zu vergleichen mit meinem Onkel Fritz aus Dietersdorf, der sich alles an den Knöpfen abzählte und zeit seines Lebens das Siebte Buch Moses suchte, das wohl so ziemlich gegen jedes Übel gut sein musste: gegen Fallsucht, gegen den bösen Blick, Feuer auf dem Dach, Pelzniesen, Konkurs und Unfruchtbarkeit. Er stellte sich und anderen lange und komplizierte Horoskope, glaubte an das Zweite Gesicht, das ihm gesagt haben soll, sein Schwager Franz werde an jenem Tag etwas Wertvolles verlieren, ablesbar auch an der Mars-Uranus-Opposition. Onkel Franz hingegen sagte, er habe, als er vom Rad stürzte, an Annas Drohung denken müssen und sich darum am Vorderrad, wovor immer wieder gewarnt wurde, festgehalten. Die Speichen trennten ihm säuberlich die beiden obersten Glieder seines kleinen Fingers ab. Er muss das sehr gefasst ertragen haben. Jahre später noch erzählte man sich, wie Schröter die Mohrenstraße heraufgekommen sei, mit der Rechten das Rad schiebend, in der Linken den blutverschmierten dreckigen kleinen Finger wie ein Würstchen vor sich her tragend. Er hatte seinen kleinen Finger im Staub gesucht und aufgesammelt, damit der nicht von irgendeinem vorbeikommenden Köter aufgefressen werde. Das sagte er dem Doktor Schilling und bat ihn, den Finger zu vernichten. Schilling nahm Schröters kleinen Finger und warf ihn, ohne ihn auch nur einmal anzusehen, in den Abfalleimer. Dann trank er mit Schröter eine halbe Flasche Branntwein, die Schröter den Schmerz und ihm das Flattern aus der Hand nehmen sollte. Mit ruhiger Hand nähte er sodann die Wunde.
Als Anna in das Ordinationszimmer gestürzt kam, weil sie gehört hatte, ihr Mann habe bei einem Unfall alle Finger der rechten Hand verloren, saß Franz Schröter rotgesichtig und grinsend da, an der linken Hand eine dicke weiße Wurst. Die anderen Finger waren abgeschrammt, aber heil, und Schröter konnte sich auf dem Nachhauseweg gar nicht darüber beruhigen, was er doch für ein Glück gehabt habe, diesen überflüssigen kleinen Finger verloren zu haben und nicht etwa den unersetzlichen Daumen. Der Daumen ist alles, grölte er, dem jetzt, nach dem Schock, dem Blutverlust und der abendlichen frischen Luft, der Branntwein in den Kopf gestiegen war, was ist dagegen der Zeigefinger. Denn die Bedeutung der Finger nimmt von vorn nach hinten ab. Der kleine Finger ist ein Nichts. Dann sang er, von Anna stützend untergehakt: Nick, nack, padiweck, give the dog a bone, this old man comes rolling home. Er schrie umso lauter, je heftiger Anna: Pscht sagte. Er brüllte, als habe er mit dem kleinen Finger auch jede Scheu verloren: Diese Stadt sei nur Rad fahrend zu ertragen. Wenn man genau hinsehe, seien auch das Spital- und das Judentor Zinnenfahrer. Nicht der Hochmut kommt vor dem Fall, sondern der Ungeübte.
Erst viele Jahre später, er hatte schon Rheuma, und merkwürdigerweise schmerzte ihn besonders der kleine Fingerstumpf, begann er Anna Vorwürfe zu machen und ihr die Schuld an dem Unfall zu geben. Sie habe ihn mit diesem Bibelspruch regelrecht verstümmelt. Jetzt aber, an diesem kühlen Juniabend, konnte ihm nicht einmal der Spottvers die gute Laune vertreiben, den irgendjemand in der Wartezeit, als sich all die Neugierigen vor dem blutverschmierten Rad an Schillings Gartenzaun drängten, gefunden hatte: Schröters Franze, geht aufs Ganze / wandelt auf dem schmalsten Grade / mit seinem hohen Zweirade / stürzt dann aber o weh / und verliert erst den Finger, dann den Zeh.
Ein Vers, der die damals einsetzende Wilhelm-Busch-Lektüre verrät und sich – ein Beweis für das lange Gedächtnis einer Kleinstadt – bis in die Zeit gehalten hat, als wir, in Hamburg ausgebombt, dreiundvierzig nach Coburg kamen. Wir kamen in das verwinkelte Haus von Onkel Schröter, in dem ich mich anfangs immer wieder verlief und nur durch mein kräftiges Schreien wiedergefunden wurde. Später, nach einigen Wochen Eingewöhnung, bot es Verstecke, die den Erwachsenen unzugänglich waren, wie jene Nische unter der Holztreppe, die ich nur kriechend durch einen engen, muffig riechenden Gang erreichen konnte. Dann saß ich unter der Treppe und hörte das dumme Treppauf-treppab-Tappen der rufenden und suchenden Erwachsenen.
Das Haus war über die Jahrhunderte durch die beständigen An- und Umbauten seiner Bewohner auf eine fast vegetative Weise gewachsen. Es gab keine rechten Winkel und keine Symmetrie. Alles hatte sich in einer langsamen Bewegung von Bewohner zu Bewohner versetzt und verschoben. Die Innenwände waren aus Weidenzweigen geflochten und dann mit Lehm beworfen worden. Nachts, in der Zeit der Stromsperre, waren sie im leicht bewegten Kerzenlicht kleine senkrechte Landschaften, mit Tälern und sanften Hügeln, in denen sogar Schätze vergraben lagen. Onkel Franz hatte in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts zur Erweiterung des Wohnzimmers eine Zimmerwand einreißen lassen. Zwischen den Lehmbrocken fand sich ein kleiner steinharter Lederbeutel, der, nachdem ihn Onkel Franz aufgemeißelt hatte, 30 Goldstücke freigab. Die Goldstücke waren während des Dreißigjährigen Kriegs von den Bewohnern in der Zimmerwand eingemauert worden, weil die Schweden oder die Kaiserlichen oder die Franzosen oder wieder die Schweden ins Haus standen. Was aber war aus den Besitzern der Goldstücke, den Juden, die in dieser Gasse vor dem Stadttor lebten, geworden?
Jedenfalls konnte Onkel Franz zu einer Zeit, als bankrotte Bankiers aus den Bürofenstern ihrer Wolkenkratzer in die Wall Street sprangen und man zum Brotkauf das Papiergeld im Blockwagen fahren musste, mit diesen 30 Goldstücken die letzte und höchste Hypothek tilgen.
So hatte sich ihm, wie Onkel Franz sagte, das Haus selbst geschenkt.
Was ich damals nicht verstehen konnte, war, warum Onkel Franz nicht auch all die anderen Wände einreißen ließ, vor allem aber das aus unbehauenen Feldsteinen gebaute Kellergewölbe nicht nach weiteren Schätzen durchsuchte. Ein Keller, der eher einem Verlies glich, von dem die Nachbarn sagten, es ginge da unten nicht geheuer zu. Mehrmals hatte man Lichter gesehen, Schatten, eine Gestalt, die durch das Haus wanderte. Das Haus hatte lange leer gestanden, bevor Onkel Schröter es zu einem günstigen Preis erwerben konnte.
Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Lirum larum Löffelstiel. Eines Tages liegt ein Fremder im Bett meiner Mutter, in das ich jeden Morgen krieche. Der Mann liegt da wie von der Decke gefallen, in aufgeknöpfter Uniform, eine Pistole auf dem Nachttisch, von dem das Lederkoppel herunterbaumelt, vor dem Bett Langschäfter, deren verstaubte Lederstulpen wie erschöpft umgeknickt sind. Das Zimmer ist von einem schweißigen Ledergeruch erfüllt. Der Mann schnarcht. Er liegt da mit weit offenem Mund. Ich sitze und warte, ob sich nicht doch eine Maus zeigt, die ihm in den Mund kriecht. Wie in dem Märchen mit dem schlafenden Mann. Dem war eine Maus aus dem Mund gekrochen, und als man sie verjagte, war der Mann tot. Man sagt mir, der Mann, der da auf dem Bett liegt, sei mein Vati. Er kommt von der Front, irgendwo aus Finnland oder Russland. So lernte ich meinen Vater kennen. Er passte nicht ins Haus. Er musste vor jeder Tür den Kopf einziehen. Bald hatte er die erste Schramme auf der Stirn. Für Onkel Franz dagegen war das Haus wie zugeschnitten. Es hatte sein Maß, und auch die verschachtelten, unsymmetrischen Räume entsprachen ihm auf eine geheimnisvolle Weise, oder er hatte sich ihnen langsam anverwandelt.
Damals, nach seinem unglücklichen Sturz, saß er meist im Wohnzimmer am Fenster, skizzierte oder unterhielt sich in der verkaufsschwachen Zeit kurz vor Mittag über die Gasse hinweg mit Metzgermeister Schön, der in seiner strahlend weißen, ein wenig rot gesprenkelten Schürze vor der Ladentür stand. Schön, dessen Wunsch es gewesen war, Sänger zu werden, hatte nach dem Tod des Vaters die Metzgerei übernehmen müssen und sich daraufhin und wie aus Trotz der Tierlautforschung verschrieben.
Schön berichtete dem am Fenster sitzenden und für jede Abwechslung dankbaren Schröter, bei dem er darüber hinaus auch ein berufliches Interesse voraussetzen konnte, vom Stand seiner neuesten Forschung, der Stimme des Gaurs oder Dschangelrinds, das in den Bergwäldern Indiens und Burmas lebt.