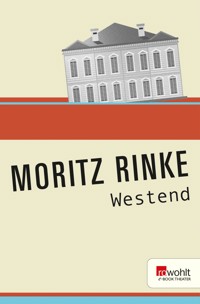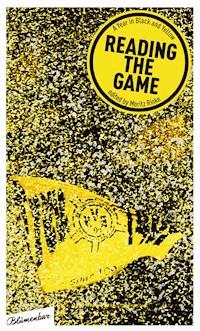9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel – Moritz Rinkes furioses Romandebüt über Familiengeheimnisse, Künstlerleben und norddeutsche Eigenheiten Gerade als Paul Wendland mit seinen kuriosen Kunstprojekten in die Zukunft starten will, holt ihn die Vergangenheit ein: In Worpswede drohen das Haus seines Großvaters und sein Erbe im Moor zu versinken. Die Reise zurück an den Ort seiner Kindheit zwischen mörderischem Teufelsmoor, norddeutschem Butterkuchen und traditionsumwitterter Künstlerkolonie nimmt eine verhängnisvolle Wendung ... Mit hinreißender Tragikomik erzählt Moritz Rinke in Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel von unheimlichen Familiengeheimnissen, vom Künstlerleben, von Ruhm, Verführung und Vergänglichkeit, vom Lieben und Verlassenwerden. Ein Roman über ein Dorf im hohen Norden, das berühmt ist für seinen Himmel und das flache Land – Worpswede in Niedersachsen. Rinkes Debütroman begeistert mit Wortwitz, Humor und Tiefgang. Eine Geschichte, die den Leser mitnimmt auf eine Reise voller unerwarteter Wendungen, skurriler Begegnungen und berührender Momente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Moritz Rinke
Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Moritz Rinke
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Moritz Rinke
Moritz Rinke, geboren 1967 in Worpswede, studierte »Drama, Theater, Medien« in Gießen. Seine Reportagen, Geschichten und Essays wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine Theaterstücke, zuletzt »Wir lieben und wissen nichts« (2012), erreichen ein Millionenpublikum. Moritz Rinke lebt und arbeitet in Berlin. »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel« ist sein erster Roman und wurde zum Bestseller.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: »Erinnerungen an die Gegenwart« (KiWi 1362), »Also sprach Metzelder zu Mertesacker … Lauter Liebeserklärungen an den Fußball (KiWi 1257), »Das große Stolpern. Erinnerungen an die Gegenwart«, (KiWi 899).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ausgerechnet als Paul Wendland in Berlin mit seinem Leben und seinen kuriosen Kunstprojekten in die Zukunft starten will, holt ihn die Vergangenheit ein. In Worpswede drohen das geschichtsträchtige Haus seines Großvaters und sein Erbe im Moor zu versinken – samt lebensgroßen Bronzestatuen von Luther über Bismarck bis zu Max Schmeling und Ringo Starr.
Die Reise zurück an den Ort der Kindheit zwischen mörderischem Teufelsmoor, norddeutschem Butterkuchen und traditionsumwitterter Künstlerkolonie nimmt eine verhängnisvolle Wendung. Vergessen geglaubte Familienfragen, aus dem Moor steigende historische Gestalten und die skurrile Begegnung mit einem mysteriösen Vergangenheitsforscher spülen ein ungeheuerliches Geflecht an Lügen und Geheimnissen aus einem ganzen Jahrhundert an die Oberfläche.
Moritz Rinke rührt sanft, aber vollkommen anarchisch und mit einer umwerfenden Tragikomik an die Lebensmotive, die Geschlechter-, Generations- und Identitätskonflikte seiner Figuren und an ihre seelischen Abgründe. Er erzählt vom Künstlerleben, von Ruhm, Verführung und Vergänglichkeit und von einem Dorf im Norden, das berühmt ist für seinen Himmel und das flache Land - und überzeugt als raffinierter Komponist einer überschäumenden, irrwitzigen Realität in diesem furiosen Romandebüt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2010, 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30483-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1 Prolog vom Ende
Erster Teil Berlin–Worpswede
2 Paul lebt in der Stadt und sucht einen Grund
Pläne und die Salatköpfe der Mutter
Kovac und das Halmer-Projekt
Christina, das Pornoprojekt und der Butterkuchen
Rilkesohn
Paul Kück (Rodin des Nordens)
Beim Händler mit den verlorenen Ostzeiten
Zweiter Teil In der Künstlerkolonie
3 Ankunft im Moor (Nullkück und das Großvaterhaus)
Wie erklärt man die ganzen Kücks und die inneren Kühe?
Johanna Kück (Muttertelefonat Nr. 1 im Moor)
4 Ohlrogge im Don-Camillo-Club (I)
Sommer 1967, gleich nachdem er verlassen wurde (Das Duell)
5 Muttertelefonat Nr. 2 (Der Künstler des Jahrhunderts)
6 Ohlrogge im Don-Camillo-Club (II)
Spätsommer 1967, Güllefahrt (Zweiter Amoklauf)
Es wird Herbst (Über Eifersucht, Demütigung, Krank-werden)
Winter 1967 (Das Trennungsjahr nimmt kein Ende)
7 Die erste Nacht nach langer Zeit
Der norddeutsche Herr Brüning (Der zweite Tag im Moor)
Elternstreit (Und nie gelebte Vatertage)
8 Die Mariegeschichte
Frühjahr 1944 auf der Treppe bei Stolte: Der Kolonievater trifft eine junge Frau
Frühjahr 1944 in der alten Scheune: Paul Kück und sein Modell Marie
Frühjahr 1944 im Moor: Mackensen und sein Modell Marie
Mai 1953: Mackensens Begräbnis, danach gehen die Künstler kegeln (Über Liebe, Schuld und Marie)
9 Ohlrogge liest Zeitung, gerät außer sich und läuft zu den Kühen
Sommer 1967: Geisterstunde bei den Kücks
Sommer 1967: Die Funktion des Orgasmus von Wilhelm Reich (Danach: Trennung und Rausschmiss)
10 Paul beginnt zu graben und kann wieder nicht atmen (Und Bauer Renken kommt seit 1945 mit der Milch)
Die Moorallergie! (Und das schreckliche Lachen von Bauer Gerken)
11 Ohlrogge bleibt bei den Kühen und lässt die Vergangenheit nicht los
Sommer 1967: Wie er hinter die Ortsgrenze zieht und im Moor versauert
1989 geschieht etwas: 7 Paula- und 7000 Ohlrogge-Tage (Über die Ruhmsucht der Menschen)
12 Nullkücks Briefe an Tille und Else (Und das Muttertelefonat Nr. 3)
13 Der Fund im Moor
14 Ohlrogge kann immer noch nicht loslassen und trinkt Kaffee von 1933
Frühsommer 1967, noch vor der Trennung: Mit Jahn auf dem Moordamm (Fragen zu Maries Tod)
Herbst 1972, vier Jahre nach der Trennung: Ohlrogge bei einem Fachmann für Vergangenheit (Dr. Anton Rudolph)
15 Paul sitzt im Café Central, erinnert sich an fremde Schlafzimmer und alte Marie-Fragen (Dann kommt der Mann mit der Würde)
Herbst 1974, Familiengespräche: Kann ein toter Onkel ein Kind zeugen? Und liegt Marie doch im Moor?
16 Ohlrogge beschließt, hinter der Kück-Scheune nach der Vergangenheit zu graben, und schickt die Frau mit der Gottfrage weg
Sommer 1967, kurz vor der Trennung: Wie er Johanna gegen ihren Willen in der Scheune nimmt
17 Der Reichsbauernführer – Vom Umgang mit Geschichte (Pauls dritter Tag im Moor)
18 Ohlrogge schaut für einen Augenblick auf sein gegenwärtiges Leben und wird um Punkt zwölf Uhr alt
Sommer 1967: Die letzten Tage, nachdem sie vom Meer gekommen und in der Scheune gewesen sind
19 Mit dem Reichsbauernführer in der Nacht
20 Ohlrogge steht im Bett und versteht, warum Paul Kück den Güllegarten damals nicht umgraben ließ (Die Meldung!)
21 Nullkück beginnt die Vergangenheit auszudrucken (Und die Tochter kämpft für den Vater – Muttertelefonat Nr. 4)
Dritter Teil Zwei Russen steigen mit ins Moor
22 Georgij, der Mann mit der Tetris-Melodie
23 Ohlrogges Telefonate über den Fall Kück
24 Die sprechenden Räume, die Ödlandfrauen, und Herr Brüning bereitet die Bohrungen vor
1. Oktober 1978: Das Großvater-Begräbnis (Und wie eine angebliche Medaille von Adolf Hitler im falschen Kück-Grab landet)
25 Ana in Worpswede (Märchenland mit Möbeln in den Bäumen)
26 Ohlrogge in der Worpsweder Loslassgruppe
27 Der fremde Mann
28 Kindheitsknoten
29 Ohlrogge mit Malgruppe im Moor
30 Ana und Georgij (Der Kampf mit dem Keilrahmen)
31 Die unheimliche Scheune (Fragen zu den Huren der Zeit)
32 Vergangenheitsbewältigung mit Hanomag-Ackerschlepper (Und das Muttertelefonat Nr. 5)
33 Einschlafversuche und Lesen im Bett (Orgasmusformel, Brodem des Moores, Großvaters Notizen)
34 Ana und Georgij (Zwei Russen auf der Hamme)
35 Anton Rudolph mit Dutschke im Badesee, Nullkück bei landflirt.de – und erneuter Besuch
Der Neue im Garten!
36 Mutterwand
Vierter Teil Finale
37 Heller Schmerz
38 Großvater in der Scheune (Der Brief und Maries Tod)
39 Ohlrogges verstopftes Leben
40 Schweigen (Muttertelefonat Nr. 6)
41 Ohlrogge im Don-Camillo-Club (III)
42 Nullkück will die Augen nicht mehr schließen
43 Ana und Ohlrogge im Himmelbett
44 Die Neugründung (Und die Naht bei Marie)
Nullkück und Marie (Armreif und Kunstraub)
45 Mutterverarbeitungen: Paul schluckt das letzte Telefonat, Nullkück baut einen Altar und sammelt Kraft
46 Ohlrogge stellt sich auf den Kopf und lässt los
47 Muttersuche, Vaterflucht, Amokfahrt
48 Grundbruch (Und Nullkück kann nicht mehr)
49 Finale im Don-Camillo-Club
50 Vom Ende
Für R. C. & H. R.
Und meinem alten Weltdorf
»Nun stehst du starr,
schaust rückwärts, ach! wie lange schon!
Was bist du Narr
vor Winters in die Welt entflohn?«
Friedrich Nietzsche
1Prolog vom Ende
Seine Kindheit, das hatte die Baufirma Brüning auch gar nicht mehr zu beschönigen versucht, würde in der Mitte auseinanderbrechen, eher früher als später, in zwei Teile.
Der Westflügel, in dem er mit seiner Mutter und ihrer übermächtigen Liebe groß geworden war, mit seinem Großvater, dem Bildhauer, den man den Rodin des Nordens nannte, sowie seiner Großmutter, die jeden Tag norddeutschen Butterkuchen backte – dieser Westflügel des Hauses würde zuerst absacken und im Teufelsmoor untergehen. Dabei würde sich der Ostflügel, in dem der Rest der Familie gelebt hatte, gleichzeitig in die Höhe heben, bis das ganze Haus in der Mitte in zwei Stücke breche. Und dann würde der Ostflügel zurück in den Schlamm fallen und vermutlich früher oder später auch dieser Teil der Familie Kück herabsinken – mit seinen sommersprossigen Johans, den blauäugigen Hinrichs, den Milchkühen und Mördern, dem Schnaps und dem schönen strohblonden Bauernmodell Marie, das noch heute auf dem Bild eines alten Worpsweders wie ein Gespenst erschien.
»Grundbruch«, flüsterte Paul vor sich hin.
»Grundbruch« war das Fachwort, das die örtliche Baufirma Brüning für solche Katastrophen benutzte. Solch ein Grundbruch hatte sich nicht zum ersten Mal ereignet hier im Norden, in der Tiefebene, in den sumpfigen Wiesen am Rande des Teufelsmoors, wo früher nur Torfbauern lebten und mit braunen Segeln über Flüsse fuhren.
Paul stellte einen Stuhl in das Moor und versuchte ruhig zu atmen, während er die schrägen, rissigen Wände betrachtete und den Westflügel des Hauses, der aussah wie der geneigte Rumpf eines Schiffes. Aus der Ferne hörte er eine Kuh, dann eine weitere aus der Nähe, die der anderen Kuh ein paar Wiesen weiter zu antworten schien.
Er spürte, dass auch der Stuhl, auf dem er saß, versank und zog sein kleines schwarzes Notizbuch aus der Hosentasche, »Paul Wendland« stand auf der ersten Seite und seine Handynummer. Eigentlich hieß er »Wendland-Kück«, aber er nannte sich nur Paul Wendland, weil »Kück« sowieso niemand draußen in der Welt verstand. Er schlug eine freie Seite auf, gleich hinter dem »Halmer-Projekt«. Er schrieb sich all seine Projekte ins Notizbuch, auch die persönlichen Vorsätze, Probleme und ihre möglichen Lösungen; schon seit seiner Kindheit setzte er dem Durcheinander in der Familie Kück und dem allgemeinen Chaos seine Notizen, Listen und Gleichungen entgegen.
Aktuelle Probleme:
1. Grundbruch
2. Die Toten im Garten (In Bronze gegossene Marie!!!)
3. Der Letzte der Kücks liegt im Koma und wird sterben. (Armer Nullkück!)
4. Wie noch leugnen, dass der Mann in den Wiesen und im Nachtclub mein Vater war? (Nun kann ich Wendland auch streichen. Jetzt heiße ich nur noch Paul.)
Paul zog mit einem Ruck seine Schuhe aus dem Moor, das gluckste und zischte, als würde man einem seltsamen gierigen Tier die Beute wegnehmen. Er notierte unter die Vater-Thematik:
5. Schon wieder nasse, sumpfige Füße. Mein ganzes Leben nasse, sumpfige Füße.
Dann lief er mit seiner Tasche in die Wiesen hinein, die sich weit nach dem Westen hin erstreckten und am Ende mit den Wolken zusammenflossen.
Erster TeilBerlin–Worpswede
2Paul lebt in der Stadt und sucht einen Grund
Paul hielt den Löffel mit dem Zucker in der Hand und starrte durch das Fenster des Cafés.
Christina, die er seit vier Monaten kannte, war gestern nach Barcelona geflogen, um dort eine Stelle in einem Forschungslabor anzutreten.
»Komm doch mit, du kannst ja auch da leben«, hatte sie vorgeschlagen.
»Ich kann nicht nach Barcelona und einfach da leben. Ich muss mich erst hier in Berlin durchsetzen«, hatte er geantwortet.
Paul drehte sich am Flughafen noch einmal zu ihr um. Irgendwo hatte er gelesen, dass sich die wirklich Liebenden niemals umdrehten oder lange winkten, aber was war dann mit ihm? Er beobachtete durch die Glastür, wie sie bei der Kontrolle ihren Gürtel aufmachte, und stellte sich vor, sie erst in ein paar Jahren wiederzusehen: Sie würde immer noch so schön sein mit ihren dunklen Augen und er sie umarmen und küssen wollen, aber in seiner Vorstellung hatte sie plötzlich Kinder im Arm und einen spanischen Torero oder Juniorprofessor zur Seite mit einer Stechlanze in der Hand. So schnell kann das Leben vorübergehen und man hat die richtige Frau verpasst, dachte er, als er im Bus Platz nahm und ein Flugzeug in den Himmel steigen sah.
Café am Rosenthaler Platz, es war 8 Uhr 30 am Morgen und Paul war der Einzige, der an einem Tisch saß, neben ihm der Latte Macchiato und das schwarze Notizbuch. Andere warteten auf ihren Latte Macchiato zum Mitnehmen, blätterten dabei flüchtig in Magazinen herum und warfen Blicke nach draußen zu ihren Autos mit Warnblinkzeichen auf dem Seitenstreifen. Sie nahmen den Pappbecher, rührten weißen oder braunen Zucker hinein, wobei sie sich meist gegenseitig im Weg standen, sodass manche ohne Zucker auf die Straße eilten und erst die Zeit für ihren Kaffee nutzten, wenn sie schon im Auto oder zu Fuß vor der Ampel warteten.
Vielleicht war es übertrieben, vielleicht vergrößerte er solche Dinge, aber wann gab es so etwas bei ihm, dass er einen kleinen Moment nutzte, weil er eingerahmt, umschlossen war von Berufswegen und Notwendigkeiten, von verplanter Zeit? Es machte ihn traurig, dass er den ganzen Tag an einer Ampel stehen könnte mit einem Pappbecher in der Hand – aber er würde nie die Zeit nutzen wie die anderen, bei denen sie aus dem Rahmen, der Umschlossenheit hervorleuchtete wie Freiheit, ja, wie Glück. Paul glaubte, er müsste in einem Urlaub sterben, denn wie sollte man diese Zeit ertragen, wenn sie nicht umschlossen war vom verplanten Leben?
Er hielt immer noch den Löffel in der Hand und strich mit einer energischen Bewegung den verschütteten Zucker aus seinem Notizbuch:
Pläne:
1. Galerie / Beruf: Händler u. Sammler kennenlernen.
Chinesen. Russen. Dubaianer. (Dubaier? Welche aus Dubai!)
2. Liebe / Leben: Barcelona-Reise (Easy jet)
Er googelte nach dem besten Restaurant in Barcelona und notierte:
3. Mit Christina Essen gehen ins Set Portes (7 Türen)!
(Adresse: Passeig d’Isabel)
4. Rioja Vallformosa bestellen! (Una ampolla!)
5. Heiratsantrag machen! (Entweder am Anfang oder nie!)
Er wollte gerade »6. Kinder!« schreiben, dann ließ er es weg. Er schrieb stattdessen:
1. a) Galerie / Beruf: Halmer-Projekt
Pläne und die Salatköpfe der Mutter
Paul führte eine kleine Galerie in der Brunnenstraße. Sie bestand aus einem etwas dunkleren Raum, in dem vor Kurzem noch ein Waschsalon gewesen war. Der Boden hatte durch die jahrelangen Schleuderprogramme an manchen Stellen Vertiefungen bekommen und es roch noch leicht nach alter, muffiger Wäsche, obwohl Paul immer neue Sorten von Räucherstäbchen einsetzte: Harze, Balsame, Hölzer, Wurzeln, Blüten, zuletzt brannten in seiner Galerie ganze Kräuterbündel aus dem Urwald. Links von der Galerie war Brillen-Meyer, rechts Ginas Hundestudio und gegenüber der kroatische Schrotthändler Kovac. Brillen, Hunde und Schrottautos wirkten auf den ersten Blick nicht wie das ideale Umfeld, dennoch glaubte Paul an seine Galerie. Er war überzeugt, dass der Standort mit der Zeit immer zentraler werden und sich das Zentrum vom Osten her auf ihn zubewegen würde.
In dem Showroom konnte er ungefähr fünf Bilder großzügig hängen, ein sechstes, wenn er noch die Fläche hinter seinem Worpsweder Heinrich-Vogeler-Tisch nutzte, der sicherlich wertvoller als alle Bilder zusammen war. Manchmal legte er seine Yogamatte in den Raum, machte ein paar Übungen (Schulterstand, die Krähe sowie den fliegenden Hund). Er schlief auch dort, wenn Christina ewig lange in ihrem Biologie-Institut forschte. Er wachte dann morgens in der Galerie auf, räumte die Yogamatte beiseite, holte sich bei der Bäckerei ein Brötchen und machte Kaffee mit der Maschine »Primera Macchiato Touch Next Generation«, ein Geschenk seiner Mutter für den Neustart. Pünktlich um zehn Uhr öffnete Paul, er hätte auch um halb elf öffnen können, um zwanzig vor oder gar nicht, es machte keinen Unterschied, weil sowieso niemand kam. Oft dachte er schon beim Brötchen, dass er Punkt zehn öffnen und sich mit dem Essen beeilen müsste. Wenn die Disziplin stimmte, kam auch irgendwann der Erfolg, davon war er überzeugt.
Die Brunnenstraße war wirklich eine gute Straße, nur wurde sie durch die Bernauer Straße in zwei verschiedene Welten geteilt, in den besseren Osten und in den schlechteren Westen. Im Prinzip vertauschte hier die Welt, wie sie einmal war, komplett die Rollen. In der unteren, der »östlichen« Brunnenstraße gab es Hot-Spot-Cafés, Feinkostläden, Galerien, bei denen angeblich Limousinen mit russischen und chinesischen Händlern und Sammlern vorfuhren. Paul überlegte: Die Entfernung von der östlichen Brunnenstraße bis zu seiner Galerie in der westlichen Brunnenstraße betrug nur 250 Meter, er müsste einfach an den richtigen Stellen ein paar Hinweise lancieren, dass die Straße nach Westen noch weiterginge. Die Händler kamen aus Peking, Schanghai, Dubai, Moskau, Bombay, New York oder Miami Beach, da würden sie die restlichen Meter ja wohl auch noch zurücklegen können.
»Die östliche Brunnenstraße ist Mitte, aber die westliche Brunnenstraße Wedding. Das ist vielleicht das falsche Territorium?«, hatte Christina gesagt, als sie vor wenigen Tagen in die Galerie gekommen war, um ihn doch noch davon zu überzeugen, mit nach Barcelona zu gehen.
»Du tust ja so, als sei das hier Nordkorea! Zur östlichen Brunnenstraße sind es nur ein paar Meter. Ich weiß, dass der Wedding kommt! Neukölln und Pankow sind auch gekommen, da kommt der Wedding auch, das ist doch logisch, vor allem, wenn Mitte nur eine Minute entfernt ist«, erklärte Paul, man müsse sich an so eine Straße nur dranhängen, der Rest komme von alleine.
Ein nasser Hund lief in die Galerie, danach eine Mitarbeiterin aus Ginas Hundestudio mit einem riesigen Fön in der Hand. »So was machen wir doch nicht, du Süßer!«, sagte sie, »Frauchen wird mir was husten, wenn ich dich so patschnass abgebe!« Sie drängte ihn in eine Ecke, dann flüchtete der hysterische Hund aus der Galerie, die Frau vom Salon folgte.
»Scheißköter«, sagte Paul.
»Ich war noch nie in Neukölln. Wann soll das denn gekommen sein?«, fragte Christina.
»Da kannst du jeden Immobilienmakler fragen. Die Gegend hat in letzter Zeit angezogen in den Preisen, das wird hier auch passieren. Und wenn sich das Zentrum auf uns zubewegt, dann werden hier auch keine Hunde mehr gefönt. Stell dir vor, in der Brunnenstraße macht jetzt Tarantinos Bar auf, die Tarantino sogar selbst besuchen will, da hängen Original-Kill-Bill-Schwerter.«
»Okay, vielleicht ist es ja doch der richtige Ort. Erst kommt ein Hund und dann John Travolta«, sagte Christina und fuhr anschließend in ihr Institut, um sich von ihrem Professor zu verabschieden.
Insgesamt saß Paul schon seit ein paar Monaten in der westlichen Brunnenstraße und wartete auf den kommenden Wedding und den globalen Kunstmarkt, aber das Einzige, was in seiner Galerie ankam, waren die Pakete seiner Mutter. Es waren große, leichte Pakete, seine Mutter schickte ständig Pakete aus Lanzarote, wo sie lebte.
»Danke für die Post, aber ich glaube, der Salat ist vielleicht doch frischer, wenn ich ihn hier kaufe«, erklärte ihr Paul am Telefon, nachdem er aus dem Café in seine Galerie zurückgegangen war.
»Nein, der, den ich dir schicke, ist ein ganz besonderer. So einen habt ihr gar nicht in eurer vitaminlosen Großstadt«, entgegnete sie. »Vitaminlose Großstadt« war bei ihr schon ein feststehender Begriff, er bedeutete: In Berlin kann man nicht überleben, wie kann man nur freiwillig in so eine Stadt ziehen? Diese Stadt ist unorganisch, ohne richtige Nährstoffe, eine Mangelstadt, komm lieber zurück zu mir auf die Insel.
»Das ist ein ganz normaler Kopfsalat, den haben wir auch, den kriegt man in jedem Supermarkt«, sagte Paul, er hatte es schon oft gesagt.
»Als ich neulich in der vitaminlosen Stadt war, habe ich nur Schnittsalat in euren Supermärkten gesehen, ganz kraft- und energielose einzelne Blätter lagen da herum«, behauptete seine Mutter, die allerdings zuletzt in Berlin gewesen war, als es die Mauer noch gegeben hatte.
Vielleicht sah damals der Salat wirklich nicht gut aus, dachte Paul, weil er aus Westdeutschland geliefert und erst noch durch die DDR transportiert werden musste.
»Es kann schon sein«, räumte er ein, »dass es hier damals keine richtigen Salatfelder gab für Westberlin, aber das hat sich geändert seit der Wende. Ganz Brandenburg ist voll mit guten Ackerböden. Auf jeden Fall leben wir nicht mehr zu Zeiten der Luftbrücke! Damals war es nötig, dass die Westalliierten Berlin versorgten, aber doch jetzt nicht mehr.« Weil jedoch seine Mutter auf die historischen Ausführungen nicht einging, versuchte er noch einmal auf den Punkt zu kommen: »Darum geht’s auch gar nicht. Ein Paket aus Lanzarote braucht mehr als eine Woche. Glaub mir, der Salat, der hier ankommt, sieht ganz anders aus, als der, den du losgeschickt hast. Und manchmal wird er auch noch übers Wochenende postgelagert.«
Es gab Samstage, da musste Paul gegen das Verfaulen seiner Muttersalate in der Postlagerung richtig anrennen, um noch vor Schließung das Amt zu erreichen.
»Die geben immer Kärtchen ab und ich laufe dann durch den halben Bezirk, die Post ist übrigens viel weiter weg als der Supermarkt! Da gibt es absurde Schlangen, stundenlang füllen Omis irgendwelche Formulare aus und je länger ich in der Schlange stehe, umso mehr Angst bekomme ich, deine Pakete zu öffnen.«
Er hatte ihr bereits mehrmals erläutert, dass es durchaus sein könne, dass der Salat, den sie auf Lanzarote kaufte, vom spanischen Festland komme und dass es doch irre sei, einen Salat um die halbe Welt zu schicken. Schon die Vorstellung, dass seine Mutter mit ihrem Corsa über die Insel raste, nur um den Salat noch schnell auf das Postamt in Playa Blanca zu bringen, beunruhigte Paul, denn seine Mutter kümmerte sich nicht viel um Regeln, Vorfahrten oder Fahrbahnmarkierungen in Kurven oder beim Abbiegen, was sie völlig ohne Ironie mit den gesellschaftlichen Infragestellungen seit der Revolution von 1968 begründete; seitdem fahre sie nun mal so, es sei eben so drin. Am gefährlichsten waren die ständigen Lanzarote-Verkehrskreisel; sie behinderten die schnellen Salatfahrten seiner Mutter, sodass sie ohne anzuhalten und mit allem Urvertrauen, das sie in ihre Unsterblichkeit zu haben schien, in die Kreisel hineinraste.
»Was ist mit Christina?«, erkundigte sie sich.
»Sie ist schon in Barcelona. Ich bin hiergeblieben«, sagte Paul.
»Gut. Dann kannst du dich ganz auf dich konzentrieren. Wie geht es mit der Galerie voran?«
»Danke. Sehr gut. Die Ausstellung von Tobias Halmer läuft«, antwortete Paul.
»Hast du schon etwas verkauft?« Sie konnte mit ihrer Económica-telefónica-Vorwahl ewig lange telefonieren und Fragen stellen.
»Ich bereite gerade Verkäufe vor«, erklärte er.
»Du hättest dich auf dem Markt besser umsehen müssen, nicht gleich den Erstbesten nehmen, nur weil er dir sympathisch ist. Meist sind es die Unsympathischen, mit denen man Geschäfte macht. Ich habe von diesem Maler noch nie etwas gehört. Bist du dir mit deinem Halmer-Projekt überhaupt sicher?«
»Ja«, sagte Paul.
Er war sich nur noch nicht sicher, ob er seiner Mutter mitteilen sollte, dass es sich bei Halmer um einen blinden Maler handelte. Paul hatte sich sofort in dessen Bilder und Farben verliebt, vielleicht war es auch die tragische Geschichte gewesen, die ihn so berührt hatte, oder die Idee, dass blinde Malerei etwas ganz Neues sein könnte, da man ja immer Neues auf dem Kunstmarkt haben musste. Ob er nun berührt gewesen war oder die Sache schon berechnet hatte, Paul konnte das nicht mehr so genau unterscheiden.
»Weißt du was?«, sagte sie, »ich schicke jetzt per Express Chicoree und lege ihn in feuchte Tücher, dann hält er sich noch länger. Du wirst zu deinem Geburtstag einen herrlich frischen Salat haben!«
Kovac und das Halmer-Projekt
Der einzige Händler, der in seiner Galerie vorbeischaute, war der kroatische Schrotthändler Kovac. Er hatte gegenüber von »Pauls Painter« seine Montagehalle, in der er aus verschiedenen Einzelteilen Autos zusammenbaute. Paul gab ihm des Öfteren beim Rückwärtsrangieren mit dem Schrottlader Winkzeichen, damit er ohne Probleme auf die belebte Brunnenstraße fahren konnte.
Kovac war sehr klein, hatte trotz seiner mittleren Jahre ein junges, verschmitztes, meist mit Öl oder Rost verschmiertes Gesicht und pfiff immer irgendeine Melodie, obwohl er total unmusikalisch war. Dennoch trällerte es unentwegt unter Blechen und Karossen hervor, an denen er gerade herumschraubte. Paul war sich sicher, dass Kovac auch mit Autodealern zusammenarbeitete, weil manchmal nachts Frontlader vorfuhren, deren Scheinwerfer in Pauls Raum strahlten, und er von seiner Yogamatte aus sehen konnte, wie Autos abgeladen wurden. Am nächsten Tag wimmelte es dann bei Kovac nur so von weiteren Männern, die auch wie Kovac aussahen und alle Autos auseinanderbauten und so wieder zusammenbauten, dass es andere Autos waren. Paul war sogar der Meinung, dass Kovac in der Lage war, aus vier Autos fünf zu machen. Außerdem hatte er immer schwarzgebrannten kroatischen Schnaps, der genauso viel Lebensenergie besaß wie Kovac selbst.
Paul verbrachte den Vormittag seines Geburtstages in der Galerie und wartete auf das Express-Paket seiner Mutter, damit er nicht wieder mit einem Kärtchen zur Post rennen musste. Schon um neun Uhr kam Kovac mit einem Kanister und zwei Gläsern herüber, gratulierte und schenkte den ganzen Schnaps, den Kanister würde er wieder abholen. Sie stießen an, Kovac warf den Kopf zurück, schüttete den Schnaps herunter und erklärte mit einer Hingabe, als ob er soeben die Lösung für Pauls Probleme gefunden hätte: »Paulus!«, er nannte ihn immer »Paulus«, »Abschleppen, Kovac sagt: Abschleppen, die Kunsthändler!«
»Wie meinst du das, abschleppen?«, fragte Paul, »das sind doch keine Autos, die Kunsthändler?«
Draußen liefen zwei Kunden vom Brillen-Meyer vorbei. Sie kamen einfach herein, stellten sich vor die Bilder von Tobias Halmer und testeten die Sehqualität von Meyers Gläsern, immerhin sahen sie mit diesen fetten schwarzen Probebrillen aus wie Andy Warhol.
»Abschleppen, Kidnapping, Mafia diplomacija, nicht böse, Paulus, nur Trick!«, sagte Kovac, er war, seit ihm Paul von den Verkaufsrekorden für Kunst berichtet hatte, wie benommen von dieser Branche. Er staunte wie ein Kind, als er hörte, dass man für ein Osama-bin-Laden-Foto, das ein Künstler an der Oberfläche mit seiner eigenen Samenflüssigkeit bearbeitet hatte, umgerechnet acht Mercedesse kaufen konnte, nur für ein bespritztes Foto von einem Topterroristen. Und für einen eingelegten Hammerhai in Formaldehyd sogar ungefähr hundertsechzig nagelneue Mercedesse!
»Die Welt ist verrutscht!«, stöhnte er, Kovac sagte sehr oft »verrutscht«, meist schrie er es, wenn er beim Rückwärtsrangieren mit seinem Schrottlader das Eisentor streifte und Paul schuld war, weil er »verrutscht« guckte oder »verrutschte« Winkzeichen gab. Manchmal hörte er, wie Kovac beim Schrauben mit sich selbst schimpfte und er »Verrutscht!« aus seiner Schrotthalle fluchte.
Paul bekam zweimal die Woche neue Exponate, weil Tobias Halmer nicht aufhören konnte, Bilder zu liefern. Auf allen malte er seine Tochter, die bei einem Unfall tödlich verunglückt war. Halmer hatte noch versucht, sie an sich zu reißen in ihrem blauen Kleid für den Kindergeburtstag und mit ihrer Blume in der Hand. Der Lkw stieß durch ihren kleinen Rücken und ihr Vater verletzte sich so schwer an den Augen, dass er seine tote Tochter nicht mehr sehen konnte. Schon gleich nachdem er aus der Klinik entlassen worden war, tastete er sich durch seine Wohnung ins Atelier, hämmerte blind auf Keilrahmen herum, versuchte mühselig Leinwände aufzuspannen und Farben anzumischen, von denen er nicht wusste, welche es waren. In schrecklicher Ungeduld, Hast und Verzweiflung fieberte er dem ersten Bild entgegen. Dann malte er, begann mit dem zweiten; er malte seine Tochter immer und immer wieder und stellte sich vor, wie sie Tag für Tag ausgesehen hätte, so sollte sie weiterleben und älter werden.
Paul musste schon vierzig Bilder bei Kovac in der Montagehalle lagern, weil er gar nicht wusste, wie er sie alle in seinem Raum hätte unterbringen sollen. Bei ihm hingen fünf, die größten, buntesten, verkaufsträchtigsten. Halmer malte wie ein Besessener, und wenn er die Arme oder Füße zu weit weg vom Körper der Tochter setzte, sagte sein Zivi »weiter nach links« oder »mehr nach oben«, wobei Paul die Bilder am berührendsten fand, die entstanden, wenn der Zivi bereits nach Hause gegangen war. Halmer ließ dann die Farben und Erinnerungen an seine Tochter frei über die Leinwände fliegen.
Kovac schenkte gerade wieder seinen Schnaps aus dem großen Kanister in die kleinen Gläser ein, ohne dass er dabei etwas überschüttete.
»Lieber Kovac, kannst du das neue Bild vielleicht auch bei dir lagern?«, fragte Paul. »Ich weiß nicht mehr, wohin damit.«
»In Ordnung«, antwortete Kovac. »Aber muss endlich Kunsthändler mit Bus abschleppen bis in diese Nummer von Brunnenstraße. Mafia diplomacija, ich hole dir.« Dann kippte er beide Gläser mit seinem Gebräu herunter und atmete tief ein. »Riecht in diese Nummer immer noch wie Waschsalon!«
»Mafia diplomacija, was ist das überhaupt? Kroatischer Autohandel? Wieso sollte denn ein Kunsthändler etwas kaufen, wenn er vorher unfreiwillig hierher abgeschleppt wurde, der findet das doch nicht witzig«, sagte Paul, ihn strengte das mit dem Kunsthändler-Abschleppen langsam an, bei Kovac wusste man allerdings nie, vielleicht glaubte er wirklich, die Händler zu ihrem Glück zwingen zu müssen. »Und das mit dem Waschsalon verstehe ich überhaupt nicht! Eigentlich müsste das hier jetzt nach Urwald riechen!«
Pauls Handy piepte, SMS von Christina:
Habe mein zimmer hellblau gestrichen + eingerichtet. Schreibtisch am fenster. Morgen geht’s im labor los. Draußen sonne. Leben. Alles so neu, so schön. Man kann ja in barcelona warten, bis der wedding gekommen ist. Besuch mich doch! LG
Paul sah auf sein Display. Er überlegte, was er antworten sollte. Oder überhaupt erst später antworten? Als er sein Galerie-Projekt startete, da war Christina ihm nah, aber jetzt hatte sie sich innerhalb von vier Tagen ein neues Leben eingerichtet: »Besuch mich doch! LG.« Er konnte sie nicht einfach so besuchen, das war ihr Weg, nicht seiner, er würde sich nur dranhängen in Barcelona und herumsitzen, während sie im Labor forschte und Karriere machte, außerdem hatte sie seinen Geburtstag vergessen. Und überhaupt: »LG«?!
Christina, das Pornoprojekt und der Butterkuchen
Silvester war er mit ihr durch den Botanischen Garten gelaufen. Er in seiner alten roten Schneejacke, sie mit einem Küchenmesser, mit dem sie an Fruchtknotenfächern von Rosskastanien herumschnitt, um Samenanlagen für das Labor zu entnehmen, die sie in einem Tuch in ihre Tasche steckte, Paul dachte noch, dass dies wenigstens Sinn machen würde im Gegensatz zum Kunstmarkt und dem völlig geisteskranken Samen auf dem Osama-bin-Laden-Foto. In der Ferne flogen einzelne Raketen in den tief hängenden Nachmittagshimmel.
Paul zündete eine Wunderkerze an und hielt die andere Hand hoch wie zum Schwur: »Ich werde im neuen Jahr die blinde Malerei zu einer begehrten Marke machen. Alle Maler, sogar die erfolgreichen, die natürlich immer weiter Erfolg haben wollen, werden zu mir kommen und behaupten, sie seien plötzlich erblindet. Es wird in Kürze nur noch so wimmeln von erblindeten Erfolgsmalern!«
Er stand direkt unter den rotbraunen Kronblättern der Rosskastanie, sehr selten im Winter, wie Christina noch bemerkte.
»Ich stelle mir vor, dass ich mit den marktgierigen Künstlern Blindentests durchführe und sie immer wieder gegen eine Wand laufen lasse, da ich wirklich nur erwiesenermaßen blinde Erfolgsmaler ausstelle. Und obwohl sie die Wand genau sehen in ihrer Verlogenheit, weil sie ja nur vortäuschen, blind zu sein, müssen sie immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennen! Vielleicht lege ich dazu sogar Musik auf, bis irgendwann die Wand voller Blut ist von all den verlogenen und gegen die Wand rennenden Künstlern. Dann stoppe ich das Projekt, Kovac schmeißt alle raus, und ich stelle nur die Wand aus, mit einem kleinen Erläuterungstext im Katalog. Mit der blutigen Wand ist ja alles gesagt über die Welt.«
»Paul, ich glaube, das funktioniert nicht mit deinen blinden Malern im Wedding«, erklärte Christina, »aber ich bin verliebt.«
Er schwieg und sah auf ihr Küchenmesser.
»Ich werde dich erforschen«, sagte sie. »Und die Rosskastanien auch, darüber schreibe ich meine Arbeit, über Seifenbaumgewächse. Ich habe mich gerade entschieden.«
Sie küsste ihn, umarmte dabei das Gewächs mit, an dem Paul lehnte, und er mochte sich in dem Moment sogar selbst, er hätte sich auch geküsst: Wenn er so, wie er eben geredet hatte, immer denken und sein könnte, dann wäre er frei, dann würde er zwischen sich und die Welt so etwas wie einen unverbitterten Stolz schieben.
»In der Galerie liegt ein Paket«, sagte Christina. »Deine Mutter schickt dir Salat?«
»So ähnlich, eher symbolisch«, antwortete Paul.
»Symbolische Pakete mit Salat?«, fragte sie weiter, befremdet. »Aus Lanzarote nach Berlin?«
»Heute wird ja sowieso alles kreuz und quer herumgeschickt. Meine Mutter spielt gerne Luftbrücke«, erklärte er.
»Warum macht sie das?«, wollte Christina wissen.
»Damit ich Salat esse, was denn sonst?«
Er hatte sie im Supermarkt kennengelernt beziehungsweise sich nicht getraut, sie anzusprechen vor der Gemüsetheke, wo sie etwas genauer die Tomaten untersuchte. Als er schon bei den Joghurts war, entschloss er sich. Er lief zu einem dieser Beobachtungsspiegel gegen Diebstahl und betrachtete sein Aussehen. Er legte den Hemdkragen über das Jackett und lächelte; er sollte überhaupt mehr lächeln, dachte er. Seine Grübchen funktionierten, sie passten gut zu den braunen Locken, er sah lächelnd mit Locken so verspielt aus, eher undeutsch, mehr international. Er bemerkte, dass sich das Haar an den Seiten über Nacht verlegt hatte, es stand unförmig und unvorteilhaft ab, vielleicht war es auch dieser Diebstahlspiegel. Er überlegte, ob ein Spiegel mit Weitwinkelwirkung die Haare abstehen ließ, aber dann hätten auch seine Ohren abstehen müssen, standen sie aber nicht. Er lief zur Kosmetikabteilung, nahm eine Forming Cream und schmierte sie sich ins seitliche Haar.
Sie war immer noch in der Gemüseabteilung. Paul stach vor ihren Augen lächelnd und mit Herzrasen seine neue Visitenkarte »Pauls Painter« in eine holländische Wintertomate. Danach lief er zur Kasse. Eine Woche später schrieb Christina eine SMS.
Schön, wie Paul Wendland so im Fruchtfleisch steckte.
Machen Sie das immer so? Christina.
Paul fand, dass dies die beste SMS war, die er je bekommen hatte, da war alles drin: Nähe, Sex, Distanz, das Spiel dazwischen. Wenn man so eine Beziehung führen könnte wie diese SMS! Überhaupt fand er im Rückblick alle Beziehungsphasen am schönsten, die sich noch zwischen der ersten und der 25. SMS bewegten. Was danach kam, war ihm schon zu eingespielt und ab der 100. SMS gingen die Forderungen ein.
Am Ende nahm ich sie, sie sah so glücklich aus.
(2. SMS von Christina über die Wintertomate)
Christina war Ende zwanzig, eine große Frau, sehr dunkle Augen, ein Haar wie Vollmilchschokolade, Brüste, die nicht zu groß und nicht zu klein waren, umwerfende Stupsnase und auf dem linken Augenlid war ein hinreißendes, winziges, zartes Muttermal. Und sie war eine der vermutlich zielstrebigsten Frauen, die Paul seit seiner Mutter getroffen hatte, denn schon allein die Sache mit der glücklichen Wintertomate schien so was von eindeutig und klar.
Ihr Vater kam aus Spanien, seine jüdischen Eltern waren nach Barcelona emigriert. Christina lebte seit ihrer Geburt in Berlin, wo die Mutter ein etwas gesetzteres Modegeschäft in Charlottenburg führte. Christina war eher bürgerlich groß geworden, trug meist Kaschmir- oder Seidenteile aus der Boutique ihrer Mutter, die sie mit dem gängigen Berlin-Style aus Trainingsjacken und hohen Lederstiefeln kombinierte. Überhaupt schien sie sich nach etwas zu sehnen, das ihr einerseits eine Gegenwelt darstellte, andererseits aber auch das Gefühl gab, Vertrautes zu finden. Ein angehender Stargalerist war da genau die richtige Mischung, und Paul hatte ihr das Brunnenstraßen-Projekt lange Zeit genauso dargestellt, wie er es seiner Mutter und sich selbst darstellen musste, um nicht den Glauben zu verlieren. Natürlich wurde ihr irgendwann bewusst, dass meist sie die Kinokarten zahlte, aber da war sie schon zu verliebt in Paul mit seinen Projekten und seinem Geschäftssinn für blinde Seelenmaler.
Paul hatte einige Jobs hinter sich: gekellnert in Kreuzberg; Ausschank in einer Hotelbar am Lützowufer, er konnte am besten »Dark & Stormy« mixen; Abenddienst in einer anspruchsvollen Videothek am Prenzlauer Berg; Mitarbeit in einem Baumarkt, da war er einer der typischen Baumarktberater, die man nie zu greifen bekam, bei Paul lag es daran, dass er sich in den Korridoren ständig auf der Flucht befand, weil er von nichts eine Ahnung hatte, außer von Pinseln, mit Pinseln kannte er sich aus. Kurz vor dem Galerie-Projekt gab es das Helmholtz-Projekt, das war der Plan einer Biosaftbar am Helmholtzplatz, mit dem er sich nicht wirklich identifizieren konnte, er wollte die Bar nebenher betreiben und Studenten einstellen, was sich jedoch nicht rechnete, obwohl der Helmholtzplatz als Standort für Bio sehr gut war.
Er besuchte auch Existenzgründungsseminare: Gewerbeamt, Rechtsformen, Zuschüsse, wie das alles funktionierte. Dazu Coachings für Kapitalbedarf, Businesspläne, Ideen-Check, Marktanalysen, Akquise, Internetpräsenz, doch Paul hatte schon während der ersten Seminarstunde das Gefühl, dass die Gründungsberater selbst nur nach einer Gründung gesucht hatten und jetzt fein raus waren, da sie den letzten, gefährlichen Schritt nicht mehr gehen mussten.
Über Wasser hielt er sich schon seit längerer Zeit mit dem Pornoprojekt. Auf diese fantastische Idee war er während einer Nacht im »Best Western am Kirchheimer Dreieck« gekommen: Seine alte Ente 2CV hatte den Geist aufgegeben, aber Paul war ADAC-Mitglied, was sich mit einer Ente schon mehrmals als sinnvoll erwiesen hatte. Man kam auch für die Hotelkosten auf. Er saß auf dem schmalen Bett und starrte ein Bild mit einem Hund in Kakaobraun an. Irgendwann nahm er es von der Wand, stellte es mit der Rückseite nach vorne ins winzige Badezimmer und trat nach dem Duschen versehentlich von hinten durch die Leinwand. Er versteckte den kaputten Hund im Kleiderschrank und hoffte, dass es niemand bemerken würde. Als man ihm eine Sonderrechnung über 247 Euro nachschickte, bekam er seinen Geistesblitz: Für so einen dämlichen Kakaohund 247 Euro?!, dachte Paul und versuchte einen Pool von Herstellern für Hotelbilder aufzubauen, an die er über Möbelart-Häuser, Kunsthandwerkläden und Internetportale herantrat. Zwei sehr gute Zimmerbildmaler fand er unter den Kunstpädagogen der FU. Sie hießen Jonas und Ingo und malten Katzen, Hunde, Hirsche, Pferde, Hühner, Bäume, Blumen, Birnen, Engel, Melonen und den Mond. Manchmal machten sie auch auf abstrakt, was noch fürchterlicher war, aber die Zimmerbilder waren gefragt. Die Übergaben waren heimlich und diskret, so als handelte es sich um einen Kinderporno-Ring, und Paul spezialisierte sich vor allem auf Hotels in Autobahnnähe: A 4 Görlitz bis Zwickau, A 14 Leipzig bis Döbeln und Dresden bis Magdeburg, A 20 Wismar bis zum Dreieck Uckermark. Natürlich fragte er sich, was eigentlich perverser war, der globale Kunstmarkt oder sein Projekt mit den Katzen, Engeln und Hirschen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Was wäre denn, wenn er einen vollgespritzten Osama bin Laden in Lutherstadt Wittenberg aufhängen oder in Tangermünde einen halbierten Hammerhai auf den Nachttisch legen würde, was würden denn da die Hotelgäste sagen?
Er fuhr alle sechs bis acht Wochen mit einem Kleinbus von Kovac los und belieferte die einzelnen Regionen. Manchmal hängte er die Bilder auch selbst auf und seine raumgestalterische Tätigkeit war ihm so widerlich, dass er dachte, er bräuchte Gummihandschuhe. In einem größeren Hotel am Kreuz Erfurt hatte er einfach in allen Zimmern das Pay-TV eingeschaltet und nebenbei Pornos gesehen, während er Hirsche, Engel und den Mond an die Wände nagelte, überhaupt stellte er seit Erfurt in allen Hotels, die Pay-TV hatten, Pornos an wie jeder andere Geschäftsmann auf Reisen.
Paul nahm wieder sein Handy und sah auf die SMS von Christina:
… Morgen geht’s im labor los. Draußen sonne. Leben. Alles so neu, so schön …
Was hieß das denn? Leben, alles so neu, so schön? – Wollte sie ihm andeuten, dass sie das alte Leben nun dort vergessen könnte und ihn gleich mit, wenn er sie nicht ganz schnell besuchen würde?
Besuch mich doch!
War das indirekt eine Drohung? Entweder du kommst oder ich werde es mir hier richtig schön machen! – Paul starrte immer noch auf sein Handy und das »LG« ganz am Ende der SMS, damit hatte sie schon ihr Entfernen angedeutet, dachte Paul, nicht »Kuss«, sondern »LG«, LG war die Strafe dafür, dass er nicht nach Barcelona mitgekommen war, vielleicht hatte sie seinen Geburtstag auch bewusst vergessen.
Kovac kippte noch einen Schnaps hinunter und wollte zurück in seine Montagehalle, das neue Halmer-Bild nahm er unter den Arm.
»Was dagegen ist faule Fisch und Osama-Quatsch? Die Welt ist verrutscht!«
»Weißt du eigentlich, wie lange eine Expresslieferung dauert?«, fragte Paul. »Ich warte auf Post.« Beim »faulen Fisch« war ihm wieder der Chicoree seiner Mutter eingefallen, den sie per Express aus Playa Blanca abgeschickt und der wahrscheinlich gerade eine Zwischenlandung in Nordafrika hatte. »Kann ich einen Zettel an die Tür kleben, dass man das Paket bei dir abgibt, falls es doch noch heute kommt? Meine Mutter hat was geschickt.«
»Ja«, sagte Kovac, er stand mit dem Halmer-Bild so anklagend da, als sei es ihm ernst mit der »verrutschten Welt«.
Außerdem schien es, dass er das Bild wirklich mochte und als bedeutend betrachtete, zumindest wollte es ihm nicht in den Kopf, dass man für faule Tiere und Terroristen Millionen zahlte und für Halmer und seine Kunst nichts.
»Warum du nicht verkaufen alles in Heimat, in Künstlerdeponie?«, fragte er. »Muss alles sofort mit Bus von Kovac in Künstlerdeponie und verkaufen! Nach Wolfsburg!«
»Nach Worpswede!, nicht Wolfsburg. Und das heißt Künstlerkolonie, nicht Deponie!«
Paul hatte ihm erzählt, dass er aus der »Künstlerkolonie Worpswede« komme und eine »Künstlerkolonie« etwas sei, wo fast alle Kunst machen würden, was Kovac sofort mit der Autostadt Wolfsburg verglichen hatte, nur dass in Worpswede nicht Automenschen lebten, sondern Kunstmenschen.
Am Mittag zündete Paul ein chinesisches Räucherwerk an und verließ seine Galerie. Er lief bis zur Zionskirche und bestellte beim Inder Mattar Paneer und einen Mango Lassi. Gerade das Zu-Tisch-Gehen, das Mittagessen, dass er auch wirklich mittags aß – Paul hatte danach eine große, unerfüllte Sehnsucht. Wenn er früher mit den Bauernkindern im Moor und in den Wiesen spielte, riefen sie plötzlich »Mahlzeit« oder »Mahltiet« und liefen weg. Und wenn dann Paul zu Hause hörte, wie seine Eltern zwischen drei und vier Uhr diskutierten, ob man vielleicht mittagessen könnte und vor allem, wer das Mittagessen machen sollte, stand er vom ungedeckten Tisch auf, tippte mit seinem Kinderfinger anklagend auf die Küchenuhr und erklärte: »Ist ja gar nicht mehr Mittag!«
Seine Eltern waren Künstler in der Künstlerkolonie. Der Vater hatte große Ziele, er wollte mit seinem Bleistift und seinen Zeichnungen den Kapitalismus stoppen; Pauls Mutter hielt es sich noch offen, mit welcher Kunstform sie ihre fernöstlichen Ideale aus Indien zum Ausdruck bringen würde. Auf jeden Fall verstanden beide nicht, dass das Mittagessen den Tag in zwei gleich große Hälften gliederte, in einen Vormittag und einen Nachmittag, und dass man so etwas brauchte, das hatte mit Indien und Kapitalismus nichts zu tun. Die anderen Kinder, die bereits Stunden zuvor auf den Wiesen »Mahltiet« gerufen hatten, waren unterdessen schon in der zweiten Hälfte kurz vor dem Abendbrot, und Paul lief ihnen mit dem Tag immer hinterher, er war immer der Letzte. Es war, als lebten die Bauern und die Künstler im Moor in unterschiedlichen Zeitzonen.
Das Einzige, was Paul pünktlich einnahm, war Kaffee und Kuchen. Um Punkt vier stellte Pauls Großmutter ihren Butterkuchen auf den Gartentisch und beendete die Diskussionen um Abläufe und Ordnungen, dann strömte es aus allen Ecken des Hauses auf das ofenfrische Blech zu, und man saß beisammen im Garten, den der Großvater entworfen und sein Leben lang gepflegt hatte, mit Rhododendron, Fliederbeeren, der alten Eiche und seinen Bronzemenschen der Geschichte.
Immer pünktlich und die Erste am Tisch, wenn der Butterkuchen kam: Johanna Kück, Pauls Mutter – die Beine im Schneidersitz, blätterte sie in ihren Schriften über den Schöpfergott Brahma herum und schaute sich Krishna mit seinen heiligen Kühen an. Als ob zu Hause nicht schon genug Kühe herumgestanden hätten, aber mit normalen norddeutschen Milchkühen gab sie sich nicht ab. Sie beschäftigte sich nur mit indischen Kühen, deren Augen enger beieinander standen und nicht so stark vorgewölbt waren und daher für Pauls Mutter auf ein tieferes Wissen hindeuteten. Sie hielt die glubschäugigen Kühe von Bauer Renken oder Gerken für dämlich, weil sie stundenlang von den angrenzenden Weidewiesen in den Kückgarten herüberglotzten, ohne dass seine Mutter aus ihren Blicken irgendetwas Tieferes oder Heiliges herauslesen konnte.
»Na, ihr dummen Nordkühe«, rief sie meist hinüber,wenn sie am Tisch eintraf, und Paul hatte das Gefühl, er müsste sich bei den Kühen sofort dafür entschuldigen, sie konnten ja vom Indientick seiner Mutter nichts wissen. Er saß dann da und sah mitleidig Renkens Kühe an, während Johanna Briefe an Ringo Starr von den Beatles schrieb oder an die Gründer von irgendwelchen Heilungsbiotopen. Dabei aß sie ein Stück Butterkuchen nach dem anderen.
»Kommt die Milch für unseren Butterkuchen aus Indien oder aus Worpswede?«, fragte Paul, als sie wieder einmal »Na, ihr dummen Nordkühe« gesagt hatte. Er wollte ihr damit deutlich machen, dass es ungerecht war, sich an den Tisch zu setzen, selbst Butterkuchen zu essen und dabei die herüberguckenden Nordkühe zu beschimpfen.
Wenn es Sommer war, befand sich der Vater sowieso schon am Gartentisch und zeichnete und zeichnete. Schöpfertage, wie er sie nannte, hatten eine andere Einteilung als Menschentage und beim Vater gab es nur Schöpfertage. Sie waren wie eine heilige Glocke, unter der Ulrich Wendland die Jahre verbrachte, und manchmal klopften die Menschentage an die Glocke, doch es kam keine Antwort. Er bemerkte seinen Sohn gar nicht, wenn der sich auch an den Tisch setzte, um bei seinem Vater zu sein. Der Butterkuchen wurde einfach um ihn herum platziert und um die von der niedersächsischen Kunstkritik hoch gerühmten »Hasenmenschen im Zeitalter der Angst«. Mit den »Hasenmenschen« war Ulrich Wendland bekannt geworden, das waren Fabelwesen, die entweder dem Konsum nachjagten oder selbst von der kapitalistischen Warengesellschaft verfolgt wurden wie Hasen vom Jäger. Auf einer Zeichnung war zum Beispiel ein Hasenmensch dargestellt, der von Hunderten Lockenwicklern angegriffen wurde wie Tippi Hedren von den Vögeln bei Hitchcock.
Ebenso und fast pünktlich zum Butterkuchen: Paul Kück, der berühmte Großvater, der Rodin des Nordens, wie es Pauls Großmutter ihrem Enkelkind beigebracht hatte, mit kurz gerolltem »R« bei Rodin. Er schoss gleichzeitig zum Kuchenessen mit einer Bockflinte auf Maulwurfshügel, wenn er meinte, darin einen Rüssel dieser kleinen Grabviecher gesehen zu haben, oder er holte Spatzen vom Strohdach, was keinen, nicht mal mehr die Kühe aufregte, solange er nicht auf Exfreunde seiner Tochter zielte, was auch schon vorgekommen war.
So saß die Familie da auf der Gartenbank: Die Mutter mit Ringo Starr, indischen Kühen und den immer neuesten Zeitströmen, die sie in ihren Clubnächten in Bremen aufgesogen hatte; der Vater mit seinen Hasenmenschen, und der Großvater hielt Ausschau nach Rüsseln, ballerte auf kleine Haufen oder knallte »Volksschädlinge« ab, wie er sie nannte, die dann herunterrollten vom Dach und neben der Kuchentafel aufschlugen, wenn er traf.
»Agrarschädlinge bitte, die heißen Agrarschädlinge, Volksschädlinge, das ist Hermann Göring!«, das war das Einzige, was Pauls Vater unter seiner Schöpferglocke hervorbrachte, während die Großmutter zwischen Gartentisch und Backofen hin- und herlief, um die Familie mit weiteren Blechen Butterkuchen zu versorgen.
Nur Paul und »Nullkück«, sein leicht geistesgestörter Verwandter, sahen sich an und konzentrierten sich ausschließlich auf Großmutters Werk. Der Butterkuchen war wie eine zusammenhaltende Kraft in diesen Zeiten, wo die Generationen so aneinanderstießen, dass sich alles neu ordnen musste. Der Butterkuchen konnte die Menschentage mit den Schöpfertagen verbinden, und wenn es nur das gemeinsame Kauen war, das für Geschlossenheit und Verlässlichkeit sorgte in der Künstlerkolonie Worpswede – an diesem Ort im Norden, in den sumpfigen Wiesen am Rande des Teufelsmoors.
Der Inder stellte das Mattar Paneer auf den Tisch. Paul schüttete den gesamten Reis auf seinen Teller und starrte in den leeren Topf. Wie alte, bereits vergangene Leben fortdauern; als ob man an den alten Leben und Geschichten hängt wie an einer Kette, dachte Paul und starrte immer noch in den Topf des Inders. Vielleicht zog es ihn auch hinein, vielleicht fiel er auch durch den Topf in die Erinnerung.
Rilkesohn
Clara hieß sie, die Frau von Rilke, von der seine Großmutter immer erzählt und die sie als ihre beste Freundin bezeichnet hatte. In ihren Erzählungen kam Clara oft mit dem Fahrrad, was Paul beeindruckte, er konnte sich kaum vorstellen, wie die Frau von Rainer Maria Rilke, dessen Gedicht »Der Panther« er in der Schule lernen musste, seine Großmutter besuchte. »Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt« – und dann kam die Gattin von dem mit einem Fahrrad. Sie brachte für Pauls Großmutter zum Geburtstag einen Topf mit, es war ein doppelwandiger kalifornischer Patent-Kochtopf (Fabrikat: For everything), den Rilke 1901 aus Worpswede-Westerwede in Amerika per Katalog bestellt hatte und in dem nichts anbrannte, auch wenn man gar nicht umrührte.
»Der ist von Rainer, was soll ich noch immer an ihn denken? Koch du damit!«, sagte Clara und legte ihn Greta in den Schoß.
Greta, Pauls Großmutter, erzählte die nächsten zwanzig Jahre sehr viel von dem Topf. Der Rilketopf spielte in der Familie Kück und damit auch in der Künstlerkolonie eine zentrale Rolle. Wenn jemand zu Besuch kam, dauerte es keine zehn Minuten, bis es Linsensuppe gab. Greta stellte den Topf auf den Tisch, wünschte »Guten Appetit!« und bereits nach dem ersten Löffel Suppe kam ihr Satz: »Auch Rilke kochte in diesem Topf, Sie kennen doch sicher RAINER MARIA RILKE, den weltberühmten Dichter? Es war einmal sein Topf.« Dabei unterbrach sie die eigene Mahlzeit, um den Gast zu betrachten, so als überprüfte sie den Grad seines Erstaunens. Immer wenn Besuch eintraf, saß Paul als Erster am Tisch und wartete schon gespannt auf das Staunen.
Eine gewisse Zeit verkehrte auch der uneheliche Sohn von Rilke unter den Kücks, ihn konnte man mit dem Topf natürlich nicht beeindrucken. Er war ein hagerer Mann mit länglichem Hals und abfallenden Schultern, der im Archiv der Künstlerkolonie arbeitete. Rilke hatte ihn nach seiner Flucht aus Worpswede in Südschweden gezeugt, in der Nähe von Sundsholm, mit einer Cousine der Reformpädagogin Ellen Key, die das Buch »Das Jahrhundert des Kindes« geschrieben hatte. Später sagte man, dass die Mutter eine etwas ältere, reiche Münchner Pelzhändlergattin gewesen sei, mit der Rilke eine Nordafrikareise unternommen und die dann in Kairouan erotische Begehrlichkeiten entwickelt habe.
Der Sohn, der nun ein älterer Herr geworden war, erschien meist zu Fuß, wanderte durch die Wiesen und brachte alte Ausgaben seines Vaters mit, in manchen lag noch Rilkes taubenblaues Briefpapier. Wenn Greta nicht vom Rilketopf sprach, zitierte sie Verse, in denen bei Rilke die Blätter trieben und die Menschen allein blieben und lange Briefe schrieben, wenn der Herbst gekommen war.
»Oh, dieser Ton, dieser ganz bestimmte Rilketon!«, schwärmte sie und der Sohn stellte sich mit Anzug und Manschettenknöpfen im Garten neben die ebenfalls hagere Skulptur seines Vaters und rezitierte alle Gedichte von Rilke, in denen Blätter fielen, trieben oder der Herbst gekommen war. Danach roch der Garten immer nach seinem speziellen Eau de Toilette, das er direkt in Frankreich bestellte. Paul saß oft auf seinem Schoß und ließ sich erzählen, wie die Künstlerkolonie entstanden war und wie man früher mit dem Pferdebus oder dem Torfkahn nach Worpswede fuhr.
»Warum hast du denn so schwarze Hände?«, fragte Paul, als er die dunklen Innenflächen sah.
»Ach, die viele Arbeit mit der alten Zeit und den Dokumenten«, antwortete er mit leiser Stimme.
»Und warum hast du deinen Vater nie gesehen?«, wollte Paul wissen.
»Als Rilkekind hätte man auch mit den Wildgänsen leben können«, erklärte Pauls Mutter.
Abends zeigte ihm der alte Sohn, wie man die Hose und das Hemd zusammenlegte und über den Heinrich-Vogeler-Stuhl hängte für den nächsten Tag – und Paul beobachtete, ob die Hände mit der alten Zeit sein Hemd beschwärzten, aber es blieb immer sauber und duftete nach Frankreich.
Wenn Paul als Kind gefragt wurde, woher er denn komme, sagte er klar und deutlich »Aus Worpswede!« und sah die Menschen prüfend an. Er unterschied wie sein Großvater Dummköpfe und Nichtdummköpfe nur dadurch, ob sie Worpswede kannten.
»WORPSWAS?«, erkundigten sich die Dummköpfe.
»WORPSWEDE!«, sagte Paul, »das ist das berühmteste Dorf, das es auf der Welt gibt.«
»Ah, aus Worpswede«, riefen die Nichtdummköpfe, »aus der KÜNSTLERKOLONIE! Da willst du doch bestimmt auch Künstler werden, hast du denn schon das Moor gemalt, ist doch Moor, Teufelsmoor, oder?«
Von Wollen konnte keine Rede sein, Paul musste Künstler werden und irgendwie das Teufelsmoor thematisieren!
Kein Moor auf der Welt wurde mehr gemalt und beschrieben als diese sumpfigen Moorwiesen von Worpswede. Generationen von Malern waren nach Worpswede gekommen, Maler mit so erdigen Namen wie Mackensen, der Gründer der Künstlerkolonie, Modersohn, Overbeck, Vogeler oder Hans am Ende. Die Bilder, die sie malten, trugen Titel wie: »Das Moor«, »Die Moorwiese«, »Der Moorweg«, »Der Moorgraben«, »Der Moorkanal« oder »Wolken über dem Moor«, »Sturm im Moor«, »Herbststurm über dem Moor«, es gab auch »Gewitterwolken über dem Moor«, »Moor mit Mond«, »Moor vor Birkengruppe«, »Bauernmädchen auf Moorwiese« oder auch »Moorwiese mit Wollgrasbüschel im Morgenwind«, »Gottesdienst im Moor«, »Ein Mann geht ins Moor« und so weiter. Irgendwann kam noch der Dichter Rilke nach Worpswede, wanderte zwei Jahre durch die Wiesen und beobachtete die Maler, wie sie das Moor malten, worüber er ein Buch verfasste. Aber das war alles lange her und Paul hatte es schon tausendmal gehört. Er wusste, dass die Maler in seinem Dorf gelebt, das Moor in allen erdenkbaren Variationen gemalt hatten, und dass Paula Modersohn-Becker am Ende die Berühmteste von ihnen gewesen war, weil sie zwischendurch auch mal einen anrührenden Menschen auf die Leinwand gebracht hatte.
Und dann gab es natürlich auch noch den Heinrich-Vogeler-Kult! An Heinrich Vogeler kam man in Worpswede nicht vorbei, er hatte einfach alles hergestellt: Moorbilder, andere Bilder, auch Bücher, Buchumschläge, Stühle, Betten, Tapeten, Kaffeetassen, Teller, Gabeln, Messer, Löffel, sogar jede dritte Türklinke, die man in Worpswede herunterdrückte, war von Heinrich Vogeler entworfen. Als Kind lernte man über Heinrich Vogeler in der Grundschule:
1) Weltberühmte Bilder und Zeichnungen
2) Stühle und Betten
3) Tassen und Teller
Die Welt möblierte sich mit Ikea, Worpswede mit Vogeler.
Einen Satz seiner Mutter hatte Paul nie vergessen. Wieder war der Rilkesohn da, wieder falteten sie die Hose und legten sie ordentlich über den Vogeler-Stuhl.
»Vielleicht wirst du mich einmal in Erinnerung behalten als den Mann, der so gerne Hosen faltete«, sagte der alte Sohn. »Und was willst du einmal werden?«
Bei der Frage kam Pauls Mutter ins Zimmer.
»Du kannst meinen Sohn schon in dein Archiv aufnehmen«, erklärte sie. »Er wird zusammen mit deinem und meinem Vater der größte Künstler, den diese Kolonie je gesehen hat.«
Danach meldete sich Paul sogar von selbst in der Malschule an. Die ersten Bilder entstanden mit Tusche und mit Bienenwachs-Malstiften von Stockmar. Paul zitterte die Hand, wenn er auf das Moor, die Flüsse, Bäume und den Himmel der anderen Malkinder sah. Mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen stand er vor seinem Bild. Der Gedanke, dass ihn seine Mutter abholen würde, bevor er eine halbwegs modersohnhafte Landschaft mit Himmel auf dem Malbogen hatte, erfüllte ihn mit Panik.
Auch musste man in der Malschule lernen, warum der berühmte Himmel über Worpswede glänzte wie Seide, schimmerte wie Opal, brannte und glühte wie Feuer, mit wilden Wolkenheeren kämpfte wie eine Armee und in Schwermut trauerte wie eine Ballade.
1) Der Brodem des Moores
2) Die wasserhaltige Nordseeluft
3) Die Luft des Binnenlandes
Also: Nordseeluft, Binnenluft, Brodem des Moores. Manchmal hieß es auch das »Wrasen des Moores«, aber warum sagte man nicht, was es heißen sollte? Dieses »Brodem« oder »Wrasen« konnte sich Paul nicht merken, ihm reichte es schon, sich »Seide«, »Opal«, »Wolkenheere« und »Ballade« zu merken, und am Ende war er nicht nur schlecht im Himmelmalen, er konnte auch nicht anständig erklären, warum der Himmel über Worpswede glänzte, schimmerte, brannte, glühte, kämpfte und trauerte.
Nach ein paar Wochen Malschule entschied Paul, einen anderen Weg zu gehen. Er schloss sich in seinem Zimmer ein und legte siebenhundert Blatt weißes Papier vor sich hin, was laut seinen Berechnungen ungefähr den »Buddenbrooks« von Thomas Mann entsprach, ein Kunstwerk, das der Großvater ausdrücklich gerühmt hatte. Aus dem Fenster sah er seinen Vater draußen über den Zeichnungen der Hasenmenschen sitzen. Der Großvater ließ sich einen seiner historischen Bronzemenschen im Garten aufstellen und verschwand mit ein paar Ladungen Ton im Atelier, während Greta Butterkuchen backte oder Linseneintopf vorkochte. Nur Pauls Mutter saß unruhig im Garten, fing Dinge an und ließ sie wieder liegen. Sie war in einer Minute begeistert, erfüllt und in der nächsten schon wieder kalt, ungeduldig und stritt mit seinem Vater, der nicht gerne vom Menschentag unterbrochen wurde. Wenn Paul seine Mutter beobachtete, dachte er oft, dass sie vielleicht auch noch nicht ihren Weg gefunden hatte. Ein paar Tage wanderte er noch in seinem Zimmer um die weißen Papierberge herum und fragte sich, wie sie sich wohl in ein Kunstwerk verwandeln ließen, dann tauschte er sie gegen ein kleines Notizbuch ein, das ihm seine Großmutter bei Stolte gekauft hatte.
Paul lief vom Inder den Weinbergsweg hinunter. Er wollte sich am Rosenthaler Platz noch etwas in sein Weltverlorenheitscafé setzen, bevor er wieder in die Brunnenstraße zurückkehren und Pauls Painter öffnen würde. Am Anfang hatte er überlegt, die Galerie einfach »Kück« zu nennen. Die anderen, im besseren Teil der Brunnenstraße, hießen »The Curators without Borders«, »Nice & fit« etc., er überlegte »Galerie Kück«, aber auch nur, weil er es für origineller hielt als dieses englische Herumgetexte.
Kück war da, wo er herkam, kein ungewöhnlicher Name. Innerhalb des Teufelsmoors war Kück ein Name, der so bekannt war wie die Modersohns oder die Buddenbrooks. Man kannte und achtete die Kücks. Nur außerhalb des Moors und der Künstlerkolonie führte der Name zu Nachfragen, Belustigungen, Aufforderungen zu buchstabieren, Paul hasste das.
»Sie meinen mit vorne und hinten einem K und in der Mitte ein Ü, das ist doch türkisch?«
»Nein, das ist nicht türkisch, es gibt ganz viele Kücks bei uns da oben.«
»Kommt das von Küken?«
»Nein, mit ck, so wie Glück!«
So stolz er anfangs auf sein hinteres Kück war, umso mehr empfand Paul mit den Jahren eine Art Kück-Komplex und nannte sich nur noch Wendland, obwohl ihn seine Mutter manchmal so komisch anschaute, wenn er sich gegenüber anderen als Paul Wendland ausgab, ohne Kück.
Die Kücks mit »ck« so wie Glück gingen davon aus, dass ihre Vorfahren nicht türkische, sondern wichtige niederländische Berater vom kurfürstlichen Johann Christian Findorff gewesen waren, der hier mit ihnen die Moorkolonisation, die umfassende Entwässerung durchgeführt hatte im Auftrag des Königs von Hannover. Pauls Großvater hielt sich als geborener Kück für einen Urbarmacher und Künstler in einem, eigentlich für den Ideal-Worpsweder. Paul junior lernte sehr früh: Kück, abgeleitet vom niederländischen »kijk«, heißt Blick, Einblick, Einsicht, also Erkenntnis.
Paul Kück (Rodin des Nordens)
Pauls Großvater war unter armseligen Verhältnissen aufgewachsen. Er fühlte sich von seinem Vater, einem Tarmstedter Bauern, schlecht behandelt und lehnte es ab, auf dessen marodem Hof zu arbeiten. Er ging in eine Steinmetzlehre bei einem Grabmal-Unternehmen, lernte in der Region alle Friedhöfe kennen und setzte die Gedenksteine auf die Gräber der verstorbenen Bauern. Irgendwann ernannte er sich zum Künstler und erschuf große Bronzeskulpturen von Persönlichkeiten, die er für bedeutend erachtete und die er in seinem Moorgarten aufstellte, bis sie von Landesmuseen, Städten, Gemeinden oder Sammlern wie Ferdinand von Schulenburg gekauft wurden.
Eine seiner für die Region bedeutendsten Skulpturen stellte Jürgen Christian Findorff dar, den Moorkommissar. Er stand auf einem Sockel direkt vor der Großen Kunstschau, in der die berühmten Moorbilder der Worpsweder Meister hingen.
Oder die Roselius-Skulptur: Ludwig Roselius, der Erfinder des koffeinfreien, herzschonenden Kaffee-HAG und Erbauer der weltbekannten Bremer Böttcherstraße, er hatte seine Skulptur selbst gekauft. Auch August Bebel, Gründer der Sozialdemokratie, stand als Skulptur im Moorgarten, wurde aber nach dem Krieg in der SPD-Kreiszentrale in Osterholz-Scharmbeck aufgestellt.
Die Gemeinde Tarmstedt besaß die Skulptur »Die Bauern von Tarmstedt«, eine Figurengruppe, die Paul Kück auch für Worpswede gewählt hatte, allerdings waren die Ausführungen unterschiedlich: Merkte man der sechsköpfigen, mehr gebückten Tarmstedter Bauerngruppe noch an, welche Mühen es bedeutet haben musste, das Teufelsmoor urbar zu machen, so blickte die Worpsweder Gruppe nach oben. Die sechste Figur stellte einen Maler dar, der den anderen mit erhobenem Pinsel seine Eindrücke vom Himmel schilderte, der ja bekanntlich in Worpswede so ungewöhnlich zu leuchten imstande war, während sich die Bauern, die Hände in die Hüften gestemmt, eher Gedanken über das aufkommende schlechte Wetter zu machen schienen. Ein Bauer war schon im Begriff wegzueilen, um vielleicht noch schnell das Heu einzufahren. Die Skulptur wurde unter dem Titel »Die Bürger von Worpswede« zu einem der Wahrzeichen der Kolonie.
Im Privatgarten von Paul Kück standen noch Willy Brandt, Luther, Bismarck, Rembrandt, Rodin, natürlich Rilke, Heinrich Schliemann, Heinz Rühmann, Pauls Großmutter, der Rote Franz, das war die berühmte norddeutsche Moorleiche, und andere Persönlichkeiten wie Max Schmeling oder Thomas Mann aus Lübeck. Es gab auch Skulpturen von Menschen, die man nur zwischen Bremen und Hamburg kannte: Henrich Focke zum Beispiel, den Bremer Flugzeugkonstrukteur, der Paul Kück erzählte, er habe sich zu Hause im Schuppen einen aero-dynamischen Windkanal gebaut. Oder Gorch Fock aus Finkenwerder, der nicht nur Namenspate für ein deutsches Segelschiff war, sondern ein richtiger Dichter, dessen Erzählung über die Hochseefischer bei den Kücks im Buchregal stand.