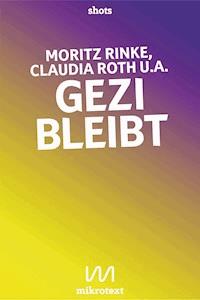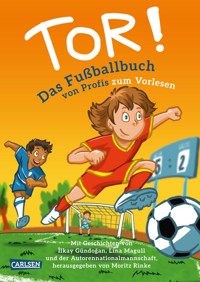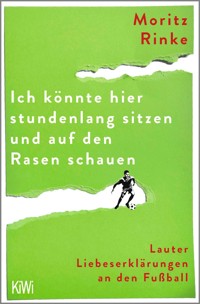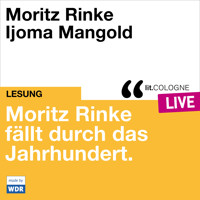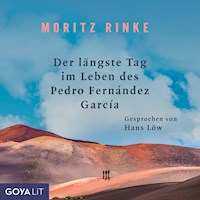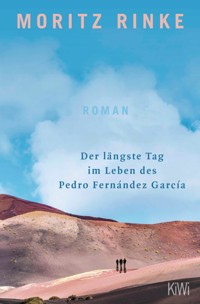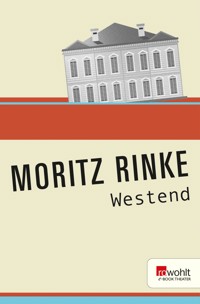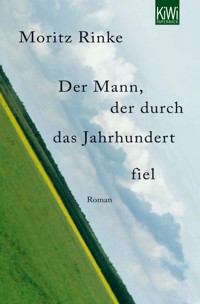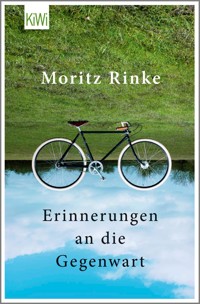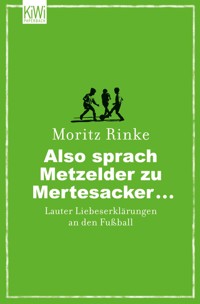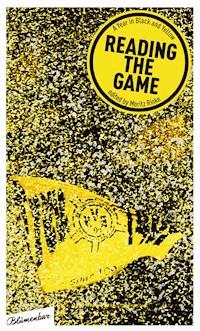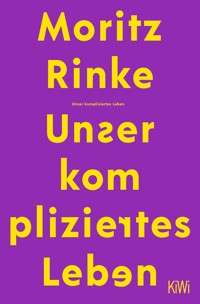
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In scharfsinnigen, anrührenden und umwerfend komischen Texten durchmisst Moritz Rinke unsere Gegenwart. Im Ghostbusters-Anzug an der Seite seines besorgten Sohnes jagt er Corona-Geister, schreibt nach dem Vorbild von Dürrenmatts Die Physiker das neue Virologen-Drama und führt Selbstgespräche nach endlosen Netflix-Abenden, während das Land sich mit Faxmaschinen und Leitzordnern dem Virus entgegenstellt. Begleitet von den Spürhunden des Altkanzlers oder gut versteckt in Olaf Scholz´ Aktentasche reist er durch die deutsche Zeitgeschichte und schreibt Briefe für Angela Merkel. Er versucht, den Brexit mit einer Gabel zu verhindern und läuft mit Trump als Räuber Hotzenplotz zum Kapitol; er lauscht dem Flüstern in den Straßen Antalyas nach dem gescheiterten Putschversuch und sucht verzweifelt Antworten auf unmögliche Fragen, als russische Panzer durch die Ukraine rollen; er schaut auf das Mittelmeer und nach Syrien und denkt über die Idee Europas nach, die in den letzten Jahren immer kleiner und kälter zu werden schien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Moritz Rinke
Unser kompliziertes Leben
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Moritz Rinke
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Moritz Rinke
Moritz Rinke, geboren 1967 in Worpswede, ist einer der führenden Dramatiker seiner Generation. Seine Theaterstücke, u. a. »Republik Vineta«, »Wir lieben und wissen nichts« oder »Westend«, werden national und international gespielt und erreichen ein Millionenpublikum. Sein Debütroman »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel« (2010) wurde zum Bestseller. Zuletzt erschien bei Kiepenheuer & Witsch der Roman »Der längste Tag im Leben des Pedro Fernández García« (2021). Moritz Rinke lebt in Spanien und in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Erinnerungen an die Gegenwart von einem ihrer schärfsten Beobachter: Moritz Rinke träumt von Karl Lauterbachs roter Fliege und schreibt nach dem Vorbild von Dürrenmatts Die Physiker das neue Virologen-Drama. Begleitet von den Spürhunden des Altkanzlers oder gut versteckt in Olaf Scholz´ Aktentasche reist er durch die deutsche Zeitgeschichte. Er versucht, den Brexit mit einer Gabel zu verhindern und spaziert mit Trump als Räuber Hotzenplotz zum Kapitol. Vor einem Fenster in Antalya bewacht er den Schlaf seines Sohnes nach dem gescheiterten Putschversuch und sucht verzweifelt Antworten auf unmögliche Fragen, als russische Panzer durch die Ukraine rollen. An einem Strand auf Lanzarote sieht er die Boote Geflüchteter landen und denkt über die Idee Europas nach, die in den letzten Jahren immer kleiner und kälter zu werden schien.
Es sind erhellende, nachdenkliche und zugleich absurd-heitere Streifzüge, die Moritz Rinke durch unsere Wirklichkeit unternimmt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
ISBN978-3-462-30363-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
I Der Frieden in Kinderhänden
1. Zeitenwende – und der Versuch, sich neu zu sortieren
10. März 2022
2. Das Herz-Kopf-Drama des Westens
21. März 2022
3. Die kleine Robbe aus Odessa
02. April 2022
4. Tatiana flüchtet aus Kiew und ich muss in der Schweiz lesen
09. April 2022
5. Über das Böse
24. April 2022
6. Krieg der Briefe
15. Mai 2022
7. Die immer stillere Sehnsucht
08. Juli 2022
8. Rede auf die pazifistischen Frauen im Teufelsmoor
15. Juli 2022
9. Die Szenen der Wahnsinnigen
25. Juli 2022
10. Vom Reden und vom Fühlen
01. August 2022
11. Der Fluch des nächsten Toooooors
07. August 2022
12. Von der Angst der Kinder
09. August 2022
13. Der Frieden in Kinderhänden
16. August 2022
II Mein Leben mit Lauterbachs roter Fliege
1. Erst ist man zu elft, dann kommen immer mehr
11. März 2020
2. Lockdown
April 2020
3. Verschwörer
April 2020
4. Die Virologen – Skizze für ein Theaterstück nach Dürrenmatt
10. April 2020
5. Systemrelevanz
27. April 2020
6. Unsere gelehrigen Körper
03. Mai 2020
7. Abstand, Masken, Einsamkeit & Geisterspiele
16. Mai 2020
8. Ich war noch nie so lange an einem Ort
Juli 2020
9. »Negativ« – Ich will Weihnachten unbedingt weg!
Winter 2020
10. Donald Trump ohne Maske und Friedrich Dürrenmatt mit seiner Gesamtausgabe auf dem Weg zum Kapitol
07. Januar 2021
11. Das traurige Zoomen der Kinder
10. Januar 2021
12. Homeoffice
18. Januar 2021
13. Die Pandemie in deutschen Leitz-Ordnern
02. Februar 2021
14. Die deutsche Impfkrise
07. Februar 2021
15. Immer noch im Homeoffice
14. Februar 2021
16. Warten auf Godot
07. März 2021
17. OOOH Deutschland – Skizze für ein Theaterstück
28. März 2021
18. Maskenskandal, Bananenrepublik!
04. April 2021, Ostern
19. Und immer noch im Homeoffice
10. April 2021
20. Manchmal sehe ich, umschwirrt von Aerosolen, die rote Fliege von Karl Lauterbach durch meine Träume fliegen
Mitte April 2021
21. Zurück zur Normalität
15. Juni 2021
22. Man leugnet die laufende Nase des eigenen Kindes, glaubt aber an die Weltherrschaft von Bill Gates oder Angela Merkel
Ende Juni 2021
Coronasommerpause
23. Es geht weiter – vierte oder fünfte Welle
November 2021
24. Ich bin geboostert!
13. Januar 2022
25. Omikron und die Berliner Falzmaschinen
30. Januar 2022
26. Abstand bei Putin
09. Februar 2022
III Europas kälteste Zeit
1. Unterhaltung mit Flüchtlingen
Juni 2021
2. Die Kriminalisierung der Menschenliebe
November 2021
3. Die Welt hinter dem Wort Flüchtling (Der syrische Dichter Kheder Alagha)
September 2017
4. Europas kalter Sommer
Juni/Juli 2019
5. Das Europa der Intellektuellen
Mai 2014
6. Die Spur des Unendlichen im Antlitz des Anderen
September 2015
7. Pegidagesichter
Februar 2015
8. Über Schildkröten
März 2015
9. »Hase, du bleibst hier« (Deutschland als Farce)
September 2018
10. Brexit beim Essen
Februar 2019
11. Somebody to love
Juni 2022
IV Mein anderes Land
1. Die Autokratien meiner Frauen
März 2017
2. Diese türkische Nacht
15. Juli 2016, später Abend
3. Mein Leben im Gegenputsch
August 2016
4. Stille Tage in Antalya
September 2016
5. Das andere Land meines Sohnes
April 2017
6. Wenn ich in Deutschland bin, sehne ich mich nach der Türkei
September 2018
7. Frau Mahlzahn wohnt in der Türkei
Juni 2019
V Kinderkanzlerträume
1. Für eine infantile Radikalität
August 2021
2. Für diesen einen Satz möchte ich Angela Merkel umarmen
September 2019
3. Unser Milchbauer war wie er (Nachruf auf Helmut Kohl)
Juni 2017
4. Die Spürhunde des Altkanzlers
April 2014
5. Das Geheimnis der Scholztasche
Dezember 2021
6. Mit Olaf Scholz in der Elmau-Sauna
Juni 2022
7. Die blaugraue Dämmerung (Meine Lesung anstelle von Günter Grass)
Juli 2022
Unser kompliziertes Leben (Epilog)
August 2022
Nachweis der Veröffentlichungen
IDer Frieden in Kinderhänden
»Gestatten Sie uns, in einen Dialog zu diesem Land zu treten, das auch das unsrige ist, und nicht nur das Putins. Genauso wie Alexander Solschenizyn glaube auch ich, dass zu guter Letzt das Wort den Beton sprengen wird. Er schrieb: ›Deshalb ist das Wort wichtiger als der Beton. Deshalb ist das Wort kein geringes Nichts.‹ (Wir) sitzen vielleicht im Gefängnis, aber ich halte uns nicht für besiegt.«
(Aus der Schlusserklärung der russischen Pussy-Riot-Aktivistin Nadeschda Tolokonnikowa, nachdem sie und Marija Aljochina aufgrund ihres Punkgebets in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 2012 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurden.)
1.Zeitenwende – und der Versuch, sich neu zu sortieren
Am 24. Februar 2022, am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, war in Deutschland alles noch wie immer: abwarten, keine voreiligen Entscheidungen treffen, der Angela-Merkel-Kurs. Keine achtundvierzig Stunden später dann: Waffenlieferungen an die Ukraine. Und, am vierten Tag des Krieges, die Ausrufung der »Zeitenwende«, die Ankündigung des Bundeskanzlers, dass er ein Sondervermögen von hundert Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr bereitstellen werde. Es dauerte also vier Tage, bis sich die SPD von dreißig Jahren friedensbewegter Außen- und Sicherheitspolitik verabschiedete und die Grünen vom »Frieden ohne Waffen«.
10. März 2022
Jetzt also deutsche Panzerfäuste. Vorher waren die Zauberworte: Nachhaltigkeit,Green Culture und Gender-identity, jetzt heißen sie plötzlich NATO, Wehrpflicht,Panzerabwehrwaffen oder schultergestützte Stinger-Boden-Luft-Raketen.
Zeitenwende.
Und auch ich habe versucht, mich nach diesen ersten Tagen des Krieges neu zu ordnen. Vielleicht, dachte ich mir, geht es ja vielen so, die von sogenannten Pazifisten erzogen worden sind, die länger an ihrer Kriegsdienstverweigerung formuliert haben als am Abituraufsatz, und sich vielleicht für all das jetzt insgeheim sogar schämen? Haben die Franzosen und Amerikaner nicht schon immer über uns gesagt, wir seien »Neopazifisten« und hätten »German Angst«?
In der Süddeutschen Zeitung steht heute der Bericht des Philosophie-Professors Volodymyr Abaschnik von der Karazin-Nationaluniversität im belagerten Charkiw. Statt ein Seminar über »Freiheit und Menschenwürde als Werte« zu halten, meldete er sich nach der Mobilmachung bei den Behörden, um mitzukämpfen. Sergiy Rozhko, ein ukrainischer Autorenkollege, mit dem ich vor Jahren in Kiew Fußball gespielt habe, postete bei Facebook, er würde jetzt in Charkiw kämpfen, territoriale Verteidigung, er trug auf dem Bild Outdoor-Kleidung. Und so entschlossen, wie er in die Kamera blickte, wollte ich glauben, die Ukrainier könnten gegen das russische Militär Wunder bewirken.
Ja, dachte ich, gebt Sergiy und dem Professor Waffen, sie sollen ihre Werte auf der Straße verteidigen können, nicht nur im Seminar oder in Texten. Vielleicht stimmt es, was die Franzosen über uns Deutsche sagen. Also, weg mit dem Pazifismus, weg mit diesem Ghandi-Kram, diesem Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky und dieser Bertha von Suttner und Judith Butler, zurück zur maskulinen Ästhetik: Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, mit Maschinengewehr, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im schlammfarbenen Pullover.
Bedeutet »Zeitenwende« also nun, dass man erkennt oder erkennen muss, dass auf Gewalt nur mit Gewalt geantwortet werden kann? Und bedeutet es, dass nun erst so richtig die große Zeit der Waffenindustrie gekommen ist? Wäre es sogar absurderweise okay, Rheinmetall-Aktien zu kaufen, die ja immer noch so schön weiter steigen? Oder ist es am Ende doch nicht ganz so selbstverständlich, Rheinmetall-Aktien zu kaufen und ukrainische Autoren und Professoren mit Panzerfäusten auszustatten?
Schaue ich die Videobotschaften des ukrainischen Präsidenten, denke ich: Mehr Waffen! Sehe ich das Grauen und die Toten auf Instagram, verzweifele ich – und zweifele wieder. Ich kaufe mir nun extra Zeitungen mit linker Gesinnung, in der Hoffnung, dort meinen eigenen Pazifismus wiederzufinden. In der Anteilnahme und Zuwendung für die Ukraine, lese ich zum Beispiel in der taz, sei auch etwas anderes: »eine neue Art von Pandemie«. Sie sei »geistig-politischer Art, ein mentales Strammstehen, das sich über Nacht unter jenen verbreitet hat, die öffentlich Stimme haben«[1]. Dabei sei es nicht der Angriffskrieg Putins, der diese Zeitenwende einläute, sondern die Reaktionen darauf.
Darf so etwas gerade geschrieben werden?, denke ich. Werde ich nicht wütend, so etwas zu lesen, während ein russischer Präsident in sein Nachbarland einfällt, Bomben auf Wohnhäuser und Kernkraftwerke wirft und Hunderttausende flüchten? Ich lese doch lieber die FAZ, die FAZ forderte immer Waffenlieferungen. »Es sind ja nicht allein westliche Wirtschaftssanktionen, die Putin nach einem Einmarsch in die Ukraine in Bedrängnis bringen könnten«, hieß es dort in einem Kommentar. »Noch gefährlicher für sein Ansehen in der eigenen Bevölkerung dürften lange und schwere Kämpfe werden. Deshalb muss das ukrainische Militär gut ausgerüstet sein.«[2]
Je länger ich darüber nachdenke, umso empörter werde ich. Sergiy und der Professor sollen also möglichst lange durchhalten (oder sogar sterben), damit das Ansehen Putins in der eigenen Bevölkerung schwindet? Das ist strategisch bestimmt gut gedacht und lässt sich auch leicht aus dem Homeoffice schreiben, aber die FAZ und wir sitzen hier alle rum, schauen aus der Ferne zu und hoffen, dass die in der Ukraine möglichst lange durchhalten?
Dann sollten wir vielleicht doch, emotional gesprochen, unseren eigenen Arsch bewegen. Man könnte ja in die Ukraine reisen und mithelfen beim Durchhalten. Oder irrationaler gefragt: Könnte die NATO nicht doch eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten? Wie lange könnten wir dann noch so bequem aus unseren Homeoffices die Weltlage kommentieren, wenn NATO-Kampfflieger russische Bomber abschießen …? Aber die Hähne, aus denen russisches Gas strömt, die sollten wir doch nun wenigstens mal mutig zudrehen? Ist das nicht eigentlich total irre, Ex-DDR-Raketen in die Ukraine zu liefern, aber gleichzeitig mit unserem Geld fürs russische Gas Putins Kriegskasse zu füllen? Und wie ist das überhaupt möglich, dass wir schon am vierten Tag des Krieges bei einer Debatte über unsere eigene Kriegskasse und Grundausstattung der Bundeswehr angekommen sind?
Ich schaue sogar die ZDF-Talkshow Markus Lanz, um auf all das Antworten zu bekommen. Am siebten Tag des Krieges gerät dort der SPD-Politiker Ralf Stegner ins Kreuzfeuer, weil er behauptet, Waffenlieferungen an die Ukraine würden das Leiden der Menschen dort nur verlängern. Ich denke an Sergiy und den Professor und bin geneigt, ihm zuzustimmen. Ich sehe dieses Blitzen in den Augen des Moderators, wenn er kampfeslustig in seinem Fernsehsessel wippt und versucht, Stegner fertigzumachen, weil der eben keine Waffen liefern will. Ich denke: Oh Gott, was ist nur mit unseren öffentlich-rechtlichen Anstalten los? Sieben Tage vor dem Krieg nahm sich der Moderator den ukrainischen Botschafter in Deutschland vor und fragte ihn, sichtlich genervt, welche Waffen er denn bitte schön von uns haben wolle. Ja, es ist schrecklich, wie manche Leute plötzlich immer auf der richtigen Seite stehen.
Aber wo stehe ich denn nun? Vielleicht zeigen solche Talkshows, in welchem unlösbaren moralischen Dilemma wir stecken. Muss ich Waffenlieferungen unmoralisch finden, weil sie Kriege verlängern? Muss ich es unmoralisch finden, Waffen nicht zu liefern, weil dann den Angegriffenen nicht geholfen wird, sich zu verteidigen?
Es sind so unfassbar traurige Fragen. Gestern hat mich mein siebenjähriger Sohn gefragt, was ein Luftschutzbunker sei. Heute hat er in seinem Zimmer Spielzeugkisten umgeworfen und gesagt, er zerstöre die russische Armee. Erst musste ich ihm die Pandemie erklären, jetzt Putin und den Krieg. Und was soll ich ihm nun sagen? Schmeiß die anderen Kisten auch noch um, ich bin zwar der Sohn von Pazifisten, aber mach bitte alles kaputt?
Ich denke darüber nach, auf Anregung meines Nachbarn im Hinterhaus, eines sehr gebildeten Ungarn, ob es vielleicht mindestens drei Putins gibt. Und ob die Entwicklung von Putin I zu Putin III vielleicht auch mit uns selbst zu tun hat: mit unserer eigenen moralischen Schwäche (und der fossilen Abhängigkeit), die wir jetzt umso stärker mit unserer neuen Selbstgewissheit bekämpfen.
Putin I haben wir im Bundestag sprechen lassen und gefeiert (»Heute erlaube ich mir so die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant zu halten …«); wir hängten ihm sogar in der Semperoper in Dresden Orden an, Medaillen im griechischen Parlament und das Großkreuz der Ehrenlegion Frankreichs.
Den Putin II haben wir lange gewähren lassen: Georgienkrieg, Annexion der Krim, Invasion im Donbass, Giftgas- und Mordanschläge gegen Kritiker, die blutige Beihilfe für Assad in Syrien. Und es fällt auf, dass sich unsere Anteilnahme an Kriegen besonders eurozentrisch ausnimmt.
Nun haben wir also Putin III. Und wir wissen, dass wir ihn uns irgendwie auch selbst gezüchtet haben.
Ich habe meinem Sohn aber auch von den liebevollen Figuren in den Stücken von Anton Tschechow erzählt. Und jetzt, wo so viele russische Künstler und Künstlerinnen ausgeladen, boykottiert und gleich mitsanktioniert werden, lese ich Dostojewski, den eine Universität in Mailand sogar aus dem Lehrplan streichen wollte.
»Ja, die Bestimmung des russischen Menschen ist zweifellos alleuropäisch und allweltlich«, sagte Dostojewski in seiner berühmten Rede im Juni 1880 bei der Einweihungsfeier für ein Puschkin-Denkmal, bei der angeblich Frauen vor Begeisterung in Ohnmacht fielen. »Ein wirklicher Russe, ganz Russe sein heißt vielleicht nur (letzten Endes, ich bitte das zu unterstreichen) ein Bruder aller Menschen sein, ein Allmensch, wenn man so will. Unser ganzes Slawophilentum und Westlertum ist nur ein großes, wenn auch historisch notwendiges Missverständnis.« Für die Bezüge zu den Westlern in Form dieses Dostojewski’schen Allmenschentums wurde er damals, wie bestimmt auch heute, von den konservativen Panslawisten oder Panrussisten scharf kritisiert, ein »Allmenschentum« entsprach ihnen nicht. »Wenn unser Gedanke nur eine Fantasie wäre«, sprach Dostojewski vor dem Denkmal weiter, »so könnte sich diese Fantasie auf Puschkin stützen. Hätte er länger gelebt, hätte er vielleicht unsterbliche Bilder der russischen Seele geschaffen, die unseren europäischen Brüdern verständlicher wären, er hätte uns ihnen gewinnender und vertrauter gezeigt, als wir ihnen jetzt sind.«
Ich wünschte, man könnte sich für die Zukunft auf solche Worte stützen.
2.Das Herz-Kopf-Drama des Westens
21. März 2022
Heute bekam ich eine E-Mail eines Deutschlehrers, in dessen Abiturklasse ich einmal aus meinen Büchern gelesen hatte. Ich solle, hieß es in der Nachricht, umgehend meine Schriftstellerkollegen versammeln und eine internationale Brigade gründen, mit der man dann, wie damals im Spanischen Bürgerkrieg, Richtung Ukraine ziehen könne.
Er verwies auf all die Schriftsteller, die vor Hitler fliehen mussten und die Spanische Republik gegen die Faschisten verteidigten. Er erwähnte das berühmte Guernica-Bild und zitierte Picasso: »Es ist mein Wunsch, Sie daran zu erinnern, dass ich stets davon überzeugt war und noch immer davon überzeugt bin, dass ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt und umgeht, angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann.«
Da dieser Deutschlehrer seit seiner Pensionierung alte Saab-Autos restauriert, schickte er auch gleich Anweisungen, wie man die Kriegsmaschinerie der Russen an ihren verwundbarsten Stellen trifft. Es waren Anleitungen, wie die Schriftsteller Kühlkreisläufe der russischen Fahrzeuge durch Stiche in die Wabenkühler zerstören, die Bremsleitungen zertrennen oder bei Panzern Magnetbomben an den Kettengliedern fixieren können.
Eigentlich sollte ich gerade einen Vortrag für das Literaturhaus Hannover über die Narrative meines literarischen Schreibens vorbereiten, aber nun beschäftige ich mich mit Wabenkühlern und Kettengliedern. Ich zitiere: Für Panzer gilt: Kühler, Ansaugstutzen, Auspuff und Bremsleitungen sind schwer zugänglich und fallen aus. Aber: Schwachpunkte sind die Kettenglieder. Ein Sprengsatz, vorn auf der Innenseite der Kette mit Magneten fixiert. Voraussetzung a.) kleine Magnetbombe, Größe Kastenbrot. Zündung erfolgt unter starkem Druck. b.) Geländemotorrad, luftgekühlt, Umbau auf großen Tank, Halterung für die Kleinbombe, Tarnanstrich. Bei voller Fahrt einen Panzer von hinten ansteuern, Bombe auf die Innenseite der unteren Kette anbringen und schnellstmöglich im Zickzack abdrehen.«
Diese Vorschläge des Lehrers, der an einem humanistischen Gymnasium unterrichtete, beschäftigen mich so sehr, dass mir ein Vortrag über die Narrative meines literarischen Schreibens plötzlich peinlich vorkommt, irreal.
Wie viel lieber würde ich jetzt russische Kettenglieder zerstören oder Kampfjets über der Ukraine abschießen … In meinen plötzlich so militarisierten Träumen kämpfe ich mit schultergestützten Stinger-Boden-Luft-Raketen oder Panzerabwehrwaffen der Firma Dynamit Nobel und fliege in olivgrüner Jacke über Moskau und werfe sogar Bomben auf den Kreml. Man braucht keine Nord Stream 2, man muss einfach die Macht über die ganzen russischen Ölfelder erlangen – sage ich mir im Traum –, dann müsste ein grüner Wirtschaftsminister auch nicht in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Hampelmann machen und dort die Füße derer küssen, die damit die Menschenrechte treten.
Es sind wirklich schwierige Zeiten, auch, was die geistige Verfassung von uns Künstlern und Schriftstellern betrifft. Im Prinzip sollen wir ja unter unserer Zirkuskuppel sitzen und wie gewöhnlich Friedenstauben herunterwerfen, aber je mehr Social-Media-Bilder ich sehe, je näher ich diesem Krieg komme – Minute für Minute und Tod für Tod in Mariupol, Kiew, Odessa und anderswo –, umso mehr beschämt es mich, dass ich weit entfernt untätig herumsitze. Und je mehr Bilder ich sehe, umso mehr muss ich mich selbst damit beruhigen, dass ich etwas entschieden fordere, nur damit ich etwas getan habe. Auf jeden Fall keine Vorträge mehr halten über die eigenen Narrative!
»Schließt den Himmel über der Ukraine!«, verlangen jetzt immer mehr Schriftsteller und Künstler, #closethesky heißt es immer häufiger im Netz. Ich verstehe das.
»Aber die Gefahr des Dritten Weltkriegs …«, mahnen die alten, pensionierten Generäle in den Talkshows, die jetzt plötzlich in den Sesseln der Virologen sitzen.
Nein, die NATO soll sich endlich trauen, sagt das Herz, die Bestie Hitler sei auch nicht mit Sanktionen besiegt worden, denk an Picasso oder lies nach, wie Thomas Mann sogar die Zerstörung Lübecks begrüßte!
»Liebe Europäer, machen Sie sich keine Illusionen: Dies ist kein lokaler Konflikt, der morgen zu Ende sein wird. Dies ist der dritte Weltkrieg. Und die zivilisierte Welt hat kein Recht, diesen zu verlieren, wenn sie sich für zivilisiert und unabhängig hält«[3], schreibt Serhij Zhadan, ein ukrainischer Autor, mit dem ich vor Jahren, wie mit Sergiy, in Lemberg Fußball gespielt habe.
Und müsste man nicht für all die Schlampigkeit im Umgang mit unseren Partnern, die Kriegsverbrechen begingen und Menschenrechte verletzten, mit denen wir dennoch handelten, bandelten und Fotos machten – müsste man für diese Schlampigkeit und für dieses Irgendwie-immer-Weitermachen oder -Wegsehen jetzt nicht mit einer neuen und alles wagenden, mutigen Haltung bezahlen und endlich Klarheit schaffen? Es würde sich – fast – irgendwie richtig anfühlen.
Und dennoch stelle ich ein wachsendes Unbehagen fest. Auch, wenn ich uns Schriftsteller beobachte, die wir plötzlich irgendwie militärischer wirken als die Talkshow-Generäle, und die wir von westlichen Schreibtischen aus Flugverbotszonen fordern, Waffensysteme zu kennen glauben, psychologische Ferndiagnosen erstellen und Putin einerseits für wahnsinnig erklären, aber andererseits für nicht wahnsinnig genug, um zu seinen Nuklearwaffen zu greifen, wenn russische Kampfflieger von der NATO abgeschossen werden. Und was, wenn es bei Putin in Wahrheit gar nicht um dessen möglichen Wahnsinn geht, sondern einfach nur darum, dass die russische Nukleardoktrin Atomwaffen als legitimes Mittel der Verteidigung ansieht? Was ist dann? Woher um Gottes willen sollen wir hinter unseren Schreibtischen denn wissen, was der Kreml aus seiner Nukleardoktrin macht? Und da wollen wir trotzdem den Himmel über der Ukraine schließen?
Diese Frage stellt der Kopf, auch wenn das Herz dabei blutet, weil ich nun doch so fragen muss.
3.Die kleine Robbe aus Odessa
02. April 2022
Vor ein paar Tagen saß ich im Zug und bereitete ein Interview vor, das 3sat-Kulturzeit mit mir führen wollte, das Thema: der Streit in der deutschen Schriftstellervereinigung PEN. Im Präsidium hatte es heftige Verwerfungen über die Frage nach einer Flugverbotszone über der Ukraine gegeben, die der neue, jüngere Präsident auf einem Literaturfestival erörtert und irgendwie auch gefordert hatte, was die Altpräsidenten als Aufruf zum Dritten Weltkrieg betrachteten und zum Anlass nahmen, den neuen Präsidenten zum unverzüglichen Rücktritt zu drängen.
Im Zugabteil saßen zwei Frauen und ein Kind. Sie sprachen eine slawische Sprache, ukrainisch, dachte ich sofort. Die eine der Frauen starrte auf ihr Smartphone, die andere versuchte offenbar, eine Netzverbindung zu bekommen. Manchmal sahen beide aus dem Fenster, auf Häuserblocks in Göttingen, auf die Kasseler Berge.
Ab und zu schaute der Junge von seinem Bilderbuch auf, eine Geschichte über eine kleine Robbe im Eismeer. Ich überlegte, meine Maske abzusetzen, um ihm und den Frauen zuzulächeln, aber ich müsste mir erst etwas zu trinken holen, dachte ich, denn einfach so die Maske abzustreifen, um zu lächeln, wäre mir irgendwie übergriffig vorgekommen.
Ich widmete mich wieder dem neuen PEN-Präsidenten, der sich in einer weiteren Stellungnahme geweigert hatte, zurückzutreten, worauf die Altpräsidenten und Vizepräsidenten und der Generalsekretär weitere Stellungnahmen auf die Nichtrücktrittsankündigung verfasst hatten, die mir als Mitglied allesamt vorlagen. Offenbar gab es nämlich noch ein paar andere Gründe, warum man den neuen Präsidenten wieder loswerden wollte. So habe er zum Beispiel die Älteren im Präsidium als »Flusspferde« und »Silberrücken« bezeichnet und nun musste also die Flugverbotszone über der Ukraine als Rache für die »Flusspferde« und »Silberrücken« herhalten.
Irgendwann setzte ich mit einem Ruck meine Maske ab, lächelte einer der Frauen zu und fragte auf Englisch, ob ich das Buch mit der Robbe für den Jungen übersetzen solle.
»Auf Ukrainisch?«, fragte die eine der Frauen. »Wir können nicht so gut Englisch.«
»Woher kommen Sie?«, fragte ich noch.
»Odessa«, antworte sie.
Odessa, dachte ich, da war ich einmal, an den Stränden, auf der berühmten Potemkinschen Treppe. »Okay«, sagte ich und googelte einen deutsch-ukrainischen Übersetzer: »Die kleine Robbe lebte am Nordpol« – »Malen’kyy tyulen’ zhyv na Pivnichnomu polyusi«, las ich radebrechend vor. Bis kurz vor Frankfurt googelte ich die ganze Übersetzung der Geschichte.
Du machst das natürlich alles, weil du selbst einen kleinen Sohn hast, sagte ich mir. Aber es ist auch dein schlechtes Gewissen, hier im Zug Kriegsflüchtlingen gegenüberzusitzen, während du dich mit den Stellungnahmen von Alt- und Jungpräsidenten befasst. Ja, seit Wochen beschäftigst du dich mit den Stellungnahmen von Schriftstellerkollegen, die entweder aufhören wollen, Deutsche zu sein, oder mit Aplomb verkünden, mit dem Schreiben aufzuhören, oder bedauern, sich im amerikanischen Geheimdienst geirrt zu haben, bzw. sich berufen fühlen, Flugverbotszonen zu fordern, oder geforderte Flugverbotszonen dafür benutzen, um sich für »Flusspferde« und »Silberrücken« zu rächen.
Das scheint ja überhaupt ein deutsches Phänomen zu sein, dieser Blick aus der Verzweiflung und dem Grauen der anderen auf uns selbst. Es kann woanders noch so schlimm sein, wir aber, wir sind ganz schnell wieder bei uns: bei unseren eigenen Befindlichkeiten, der eigenen Wehrfähigkeit (bereits am vierten Tag des Krieges!); bei den Tankrabatten oder erhöhten Pendlerpauschalen; bei all unseren empfundenen Zumutungen und unserem Blick auf die eigenen intellektuellen Standpunkte, vorgetragen in Talkshows oder Feuilletons.
Dabei spüre ich diese Sehnsucht nach einer feineren Aufmerksamkeit im Reden über einen Krieg (bewusster, vorsichtiger, tastender), bei dem wir so nah im Netz zuschauen und doch unser Leben in einer ganz anderen Wirklichkeit weiterführen.
Die Robbe musste in dem Buch noch gefährliche Abenteuer überstehen. Ein schrecklicher Eisbär wollte sie fressen, die Pole drohten zu schmelzen, ihre Eisscholle löste sich und trieb immer weiter aufs Meer, von ihrer Heimat weg.
Der Junge hörte mir aufmerksam zu. Manchmal korrigierte er meine Aussprache, während die Frauen mittlerweile auf dem Gang auf und ab liefen, um eine Verbindung nach Odessa zu bekommen.
Beim Abschied in Frankfurt fragte ich, wohin sie denn wollten, und eine der beiden Frauen zeigte auf das Zugticket: Mannheim.
»Ach, eigentlich eine ganz nette Stadt … Mannheim ist schon okay«, sagte ich aufmunternd und dachte an Odessa, an die Boulevards, Promenaden und diese schönen Strände. Und hoffte, dass diese kleine Robbe im Zugabteil dort bitte, bitte irgendwann wieder auftauchen würde.
4.Tatiana flüchtet aus Kiew und ich muss in der Schweiz lesen
09. April 2022
Tatiana kommt aus Kiew. Sie ist vor zwei Wochen mit ihrer dreijährigen Tochter geflüchtet und beide wohnen durch Vermittlung einer Bekannten ein paar Tage bei uns, dann wollen sie weiter. Sie wäre nie weggegangen, erklärte Tatiana mit Google-Translator, aber russische Soldaten würden Frauen vergewaltigen, vor den Augen der Kinder. Ihr Mann sei in der Heimat geblieben und habe sich gemeldet, um Kiew zu verteidigen.
In der ersten Nacht saß Tatiana in der hintersten Ecke der Wohnung, wo sie ihr Smartphone so einstellte, dass sie den Bombenalarm in Kiew live hören konnte, sie fragte noch, ob es uns stören würde. Ganz im Gegenteil, antwortete ich, sie könne sich auch ins Wohnzimmer setzen.
Es waren noch die Tage vor den schockierenden Bildern aus Butscha, und ich googelte, ob es wirklich Nachrichten gab, die belegten, was Tatiana über die russischen Soldaten gesagt hatte – ich schämte mich sogar für meine Recherche, aber ich konnte (oder wollte) mir so etwas nicht vorstellen, mit meinen Überresten von Optimismus.
Einmal kam ich mit Erkältungsmedikamenten aus der Apotheke, und Tatiana saß im Wohnzimmer, aus dem Smartphone schallte der Bombenalarm in Kiew. Es war irgendwie unangenehm, Hustensaft und Nasentropfen aus einer Tüte zu holen, während Bomben auf Kiew fielen.
Ein paar Tage später musste ich auf eine Lesereise in die Schweiz. Beim Landeanflug auf Zürich sah ich direkt unter mir braune Kühe, die Glocken trugen und auf grünen Wiesen grasten. Auf meinem Schoß lagen die Zeitungsberichte aus Butscha, sie erzählten von gefolterten, vergewaltigten, gefesselten und hingerichteten Zivilisten; von Überlebenden, die das Wasser aus ihren Heizkörpern trinken mussten. Wie entrückt, wie irreal, dachte ich, mit solchen Berichten über grasende Kühe zu einer Literaturlesung in die Schweiz zu fliegen.
Nach der Lesung zappte ich mich im Hotelzimmer durch die Fernsehsender. Im ZDF gab es eine Satiresendung, in der ein Kabarettist Putin spielte und sich darstellerisch sehr ins Zeug legte. Im rbb-Programm, das ich genauso wie das russische Sputnik-Programm empfangen konnte, lief eine Talkshow, in der sich vier Medienvertreter, jeder an einem kleinen Tisch, über den Krieg unterhielten. Ein Feuilletonist von der FAS hatte ein gefülltes Bierglas, einen Cappuccino, ein Glas Wasser und gelbe Tulpen in einer schmalen Vase vor sich. Dann sprach er, mit sichtbarer Lust an seinen Formulierungen, über Butscha und stellte die Frage in den Raum, ob die Verbrechen dort möglicherweise nicht von der offiziellen russischen Armee, sondern von einer entfesselten »Soldateska« verübt worden seien, woraufhin ich das Wort erst einmal googelte.
Ich stellte mir vor, wie Tatiana zu Hause im Wohnzimmer mit ihrem Smartphone-Übersetzer diesen Mann im Fernsehen sieht, vor dem Bierglas und den gelben Tulpen; ich stellte mir vor, wie sie den Putin-Kabarettist im ZDF sieht und das klatschende Publikum nach dessen Sketch. Ich überlegte mir, wie ich ihr erklären sollte, dass solche Leute im Fernsehen von ihren witzelnden Darbietungen oder oberschlauen Einlassungen lebten. Und dass das Sendeformate seien, bei denen man immer klatsche und lässig Bier oder Cappuccino trinke – auch wenn es ihr sicher unpassend vorkomme, weil ja ihre Landsleute, wenn sie noch leben, Wasser aus den Heizkörpern trinken müssen.
Vielleicht ist das Unbehagen, das ich spüre, aber auch meiner eigenen Profession geschuldet? Vielleicht machen die einen Witze, die anderen sagen schlaue Sachen – und die Aufgabe von uns Schriftstellern ist es, auf alles möglichst empfindsam zu reagieren?
5.Über das Böse
24. April 2022
Tatiana aus der Ukraine, die immer noch über ihre App den Bombenalarm in Kiew verfolgt, ist in den letzten Tagen etwas ruhiger geworden. Die Kampfhandlungen haben sich wieder in den Donbass und in den Süden verlagert, ihr Mann scheint nun in Kiew sicherer zu sein.
Ich selbst habe nach den schrecklichen Bildern aus Butscha oder Mariupol angefangen, Bücher über »das Böse« zu lesen. Ich habe immer geglaubt, dass es solche Rückfälle hinter das, was wir für die hoch entwickelte Zivilisation halten, nicht mehr möglich wären.