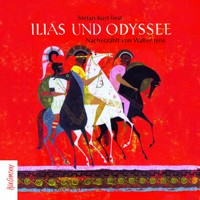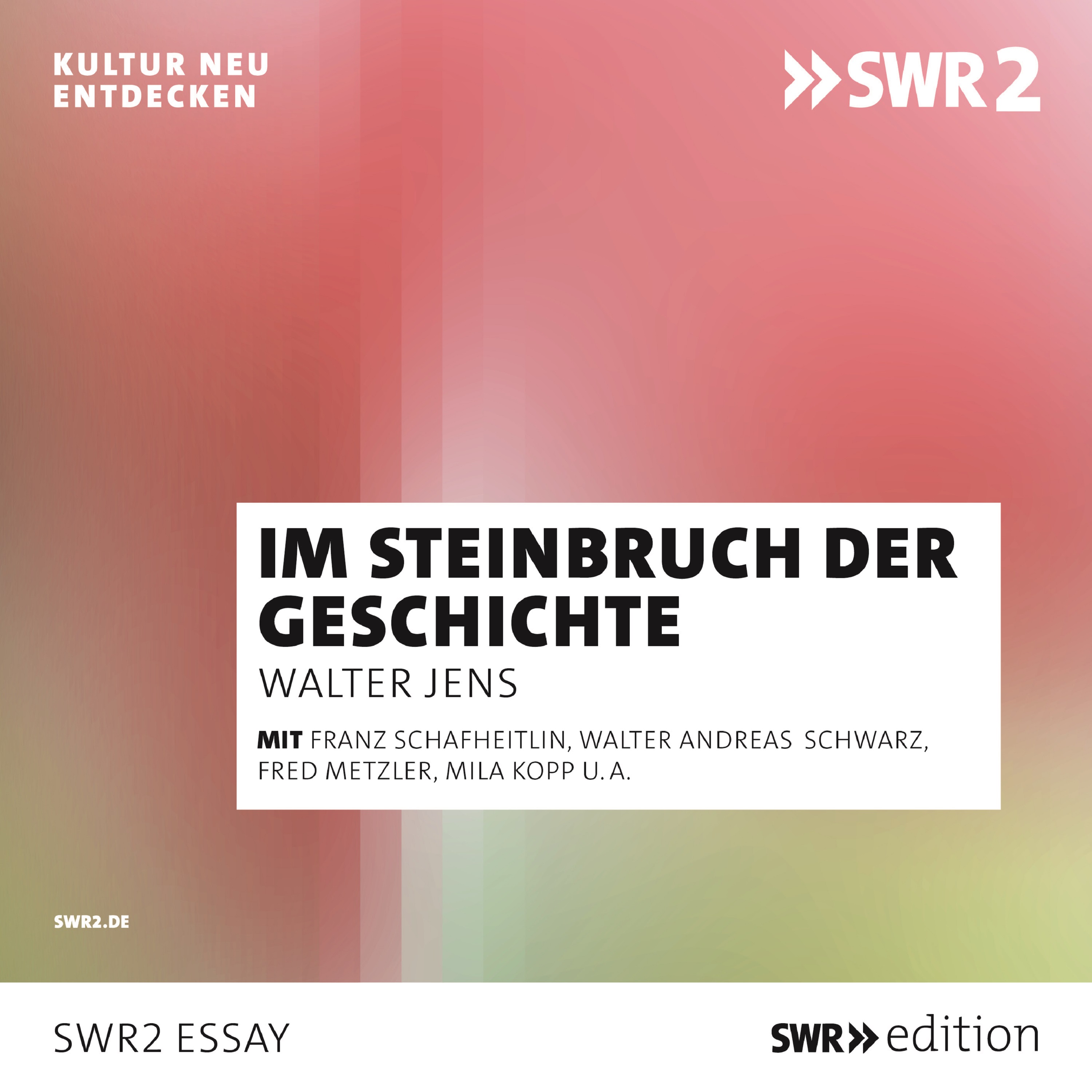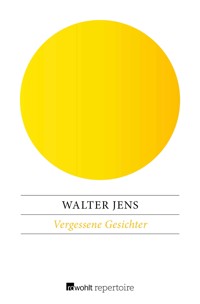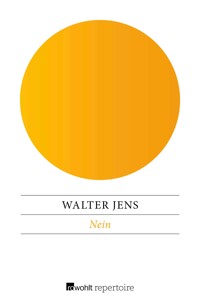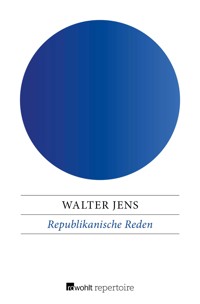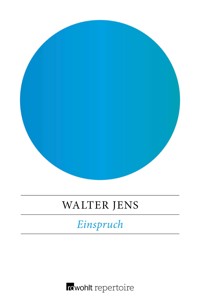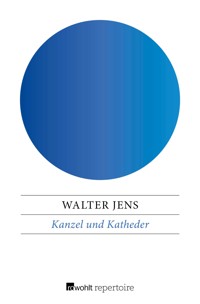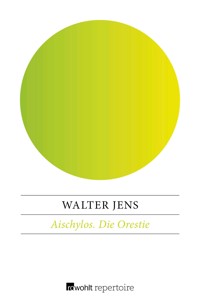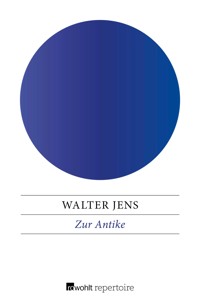9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Professor Friedrich Jacobs, der Erzähler des Romans, ein siebzigjähriger Literaturwissenschaftler, spürt dem rätselhaften Tod eines jungen Dichters nach. Er fahndet nach Zeugen, die ihm helfen könnten, das Geheimnis zu lüften, stellt merkwürdige Entsprechungen zwischen Bugenhagens Leben und seiner schriftstellerischen Arbeit her und macht sich schließlich an die Aufgabe, Bugenhagens hinterlassenes Hauptwerk, das Romanfragment «Der Mann, der nicht alt werden wollte» zu deuten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
FÜR WOLFGANG HILDESHEIMER
I
1
IN DIESEM AUGENBLICK, da ich, Friedrich Jacobs, zwei Jahre nach meiner Emeritierung dieses Buch beginne, endlich frei für Aufgaben, die zu lösen mich bisher mein Lehramt hinderte, – in diesem für mich so bedeutsamen Augenblick kommt mir ein merkwürdiger Gedanke. Ich sehe mein Buch im Schaufenster einer Buchhandlung in einer Kleinstadt liegen. Es steht ziemlich weit hinten, neben anderen Büchern, auf einem kleinen Podest, unauffällig, aber deutlich sichtbar. Links von meinem Buch steht die Römische Geschichte Mommsens, rechts ein zeitgenössischer Roman, der Titel heißt: «Frühe Begegnung». Hinter meinem Buch, vorsichtig auf einer schmalen Leiste aufgebaut, liegt eine Reihe bunter Taschenbücher, wahllos, scheint es mir, zusammengestellt.
Es ist ein nebliger Oktobermorgen, gleich weit entfernt von den Sommerferien und von Weihnachten. Die Scheibe des Schaufensters ist beschlagen. Ein paar Schulkinder gehen lärmend vorbei, ein Auto hupt, irgendwo wird ein Fenster zugeschlagen. In diesem Augenblick biegt ein älterer Herr um die Ecke. Er geht langsam, beinahe bedächtig, die Aktentasche unter dem Arm, den Hut tief und gerade ins Gesicht gezogen.
Ich habe diesen Mann nie gesehen, und doch kenne ich ihn ganz genau. Er geht gedankenlos an einem Juwelierladen vorbei, biegt den Kisten aus, die vor einer Gemüsehandlung aufgeschichtet sind, Kisten mit Apfelsinen und Spinat, und bleibt jetzt vor der Buchhandlung stehen. Er überfliegt die Titel, gleichmütig, beinahe ein wenig gelangweilt. Aber nun stutzt er. Er hat mein Buch gesehen, den schmalen grauen Band mit der großen Antiqua-Schrift in Weiß. Er schüttelt den Kopf und lächelt ein wenig verwirrt. Gleich wird er hineingehen und sich das Buch betrachten. Ich brauche ihn nicht weiter zu verfolgen, ich weiß, was er denkt.
Tatsächlich, jetzt geht er hinein. Die Ladentür öffnet sich schleifend. Ich kann ihn nicht mehr erkennen. Ich warte noch einen Augenblick, aber niemand nimmt das Buch aus dem Fenster. Vielleicht haben sie drinnen noch ein zweites Exemplar – es sollte mich wundern, denn ich bin an kleine Auflagen gewöhnt –, vielleicht will er sich auch nur vergewissern, ob das Buch im Fenster wirklich von mir ist.
Es ist von mir. Ich kann ihm nicht helfen. Eine Sekunde lang tut er mir leid. Ich lege den Federhalter nieder und denke darüber nach, wieviele Menschen ich mit diesem Buch genauso enttäuschen werde wie den alten Mann mit der Aktentasche: einen Studienrat vielleicht, der gerade eine Freistunde hat und ein wenig spazierengeht, um die Homerverse, die er gleich in der Prima behandeln wird, noch einmal zu memorieren. Er kennt mich schon lange, dieser Mann mit der Aktentasche, obgleich er noch nie mit mir gesprochen, mich vielleicht noch nie gesehen hat – es sei denn bei einem Vortrag, den ich zufällig einmal in seiner Stadt, an der Volkshochschule oder vor dem Gymnasialverein, gehalten habe. Ich weiß, er hat meine Wielandbiographie gelesen, die nun schon bald ein Menschenalter zurückliegt, er kennt mein Buch über den deutschen Roman im neunzehnten Jahrhundert, meine Arbeit über Wilhelm Raabe als Erzähler, vielleicht auch meine Aufsätze über den oberrheinischen Humanismus und das viel umstrittene Buch «Von Goethe zu Geibel. Untersuchungen zum Problem der literarischen Dekadenz», das mir seinerzeit, es ist schon fünfzehn Jahre her, so viele Feinde gemacht hat.
Was muß er denken, der alte Studienrat in der Provinzstadt, der meinen Weg so lange und getreulich verfolgt hat, wenn er plötzlich dieses Buch im Schaufenster sieht? –
Gleich wird er wieder aus dem Laden kommen, er hat ja nicht viel Zeit, die Freistunde ist bald vorbei und ein paar Iliasverse wollen bedacht sein, auch wenn man sie schon tausendmal gelesen hat. Ich sehe lieber weg. Ich fürchte mich vor seinem Gesicht. Es wird traurig sein, enttäuscht, vielleicht ein wenig älter, resigniert oder spöttisch, vielleicht auch voll Genugtuung: «Eine Torheit, auch er macht eine Torheit. Das ist gut.»
Oh, meine Freunde haben mich gewarnt, dieses Buch zu schreiben. Ich weiß, es ist gefährlich, wenn man am Ende eines Gelehrtenlebens das ganze Werk aufs Spiel setzt, nur weil man plötzlich über jemanden schreibt, den keiner kennt, der schon vergessen ist, obwohl er erst ein Jahr und zehn Tage tot ist.
Aber ich muß dieses Buch schreiben. Ich muß zu erklären versuchen, warum ich gerade von diesem Mann betroffen wurde wie von keinem anderen, obgleich er nichts als zwei oder drei schmale Bände geschrieben hat und in keiner Literaturgeschichte genannt wird. Reizt es mich nur, den Lesern zu beweisen, daß sie Toren sind, weil sie diesen Mann vergessen haben? Lockt mich das Wissen, das ich mit keinem anderen teile, weil ich ganz allein im Besitz vieler unveröffentlichter Studien dieses Einzigen bin, weil nur ich sie kenne und diese Kenntnis mir den Schlüssel auch zu dem gibt, was bisher von ihm erschienen ist? Oder erblicke ich nur mich selbst in seinem Werk, meine unerfüllten Hoffnungen, blinden Träume, nie gestillten Wünsche? Liebe ich ihn so, weil in seinem kurzen Leben mein eigenes enthalten ist und mir durch ihn die Jahre hinter mir erst sichtbar wurden? Beschreibe ich sein Werk, weil es die zitternden Strahlen wankelmütiger eigener Erfahrungen in einen Brennspiegel preßt und das Verloren-Zerstreute meiner Kindheit, Jugend und Mannesjahre mir im Alter versammelt, so daß ich plötzlich, im Spiegel seines Werks, heiter und gelassen Rückschau halten kann?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich gar nicht fragen sollen. Jetzt, wo ich das bisher Geschriebene durchlese, scheinen mir die Fragen viel zu allgemein, ja banal zu sein, in einer Sprache geschrieben, die mir fremd ist. Es ist nicht leicht, im Alter noch eine sorgfältig geschützte Festung aufzugeben, die in langen Jahren aufgeschichteten Wälle niederzureißen und in die Ebene zu gehen, die man bisher nur von oben, dazu noch aus dem sichersten Winkel, betrachtete. Immer wieder bin ich geneigt, meine Arbeit aufzugeben, immer wieder quält mich die Frage, ob ich der Richtige bin, um dieses Buch zu schreiben. Nirgendwo ist Sicherheit; keine Sekundärliteratur, keine Vergleiche, keine Regulative in Anmerkung, Einschub und Nachtrag. Nicht einmal ein Umweg ist möglich, ein heimliches Ausweichen, etwa durch einen verborgenen Hinweis: «Ich übergehe das. Sie kennen es ja.» – Ich muß ganz von vorn beginnen, kann nichts voraussetzen, mich auf nichts berufen. In der Ebene, in der ich mich jetzt befinde, unmittelbar nachdem ich freiwillig die geschützte Bucht verlassen habe, gibt es keine Vergleiche und keine Anhaltspunkte, auf die man verweisen könnte. Die Ebene ist baumlos und kahl, am Horizont sind keine Berge, der Himmel ist kalt und leer, und auf der Erde wächst noch nicht einmal Gras. –
Von weither kommt er mir entgegen, der andere; ruhig und ohne zu eilen kommt er näher. Wir beide sind jetzt ganz allein auf der Welt. Er ist noch sehr jung, in diesem Augenblick vielleicht vierundzwanzig Jahre. Er hat den Kopf ein wenig gesenkt, seine Bewegungen sind unbeholfen und hölzern, die Arme zu lang für den schmalen Körper. Jetzt sieht er auf und ich kann sein Gesicht erkennen. Das Gesicht ist uralt, zur Hälfte schon vom Schatten seines frühen Tods verdunkelt. Nun ist er so nahe, daß ich ihn ansprechen kann.
«Wolfgang», sage ich. Aber er hört nicht.
«Wolfgang Bugenhagen.» Er nickt.
Ich schreibe die Geschichte des Schriftstellers Wolfgang Bugenhagen, der nach einem Leben voller Seltsamkeiten vor einem Jahr, an einem Herbstabend, in Paris gestorben ist. Er war damals sechsundzwanzig Jahre alt und hatte nichts als einige Geschichten: «Legenden vom Tode», von denen «In Sachen Carlo Pedrini» die bekannteste ist, und ein zwei- oder dreimal aufgeführtes Drama: «Der weiße Tänzer» veröffentlicht. Aber all das ist nur Vorstufe, Skizze, Entwurf und Prämisse für seinen großen Roman, sein aus Hunderten von Studien bestehendes Lebenswerk, die auf drei Bücher berechnete Epopöe «Der Mann, der nicht alt werden wollte».
Weil also die erschienenen Bücher lediglich Nebenwerke, flüchtig hingestreute Gelegenheitsarbeiten und Versuche sind, die nur von dem gigantischen und wahrhaft einzigartigen Fragment des Hauptwerks aus deutbar sind, von dem allein ich Kenntnis habe, schreibe ich über Wolfgang Bugenhagen. Ich betrachte es als die große Aufgabe meines Alters, den Blick der Verständigen auf die Arbeit jenes Mannes zu richten, nicht zuletzt – ich leugne diese Absicht nicht –, damit «Der Mann, der nicht alt werden wollte» eines Tages einen großzügigen Verleger finden möge.
Hinweis und Eröffnung also wird das Ziel meines Buches sein, und um Unberufene von vornherein fernzuhalten, bemerke ich schon jetzt ausdrücklich, daß ein großer Teil dieses Versuches, bei flüchtigem Überschlag etwa ein Drittel des Manuskripts, aus Zitaten bestehen wird: Zitaten aus Briefen und Tagebüchern, Zitaten aus den Nebenarbeiten, Zitaten vor allem aus dem «Mann, der nicht alt werden wollte». Über das Dokumentarische hinaus möge das Bekenntnis ebenso wie die Beschreibung der Umstände, unter denen ich auf dieses Werk stieß, das Verzeihen der Leser und das Verständnis meiner Kollegen finden.
Und damit beginne ich, und zwar scheint es mir die einzig mögliche Art des Beginns zu sein, nicht mit der Geburt meines Helden anzufangen, nicht mit der Konzeption seines ersten Werks, so entscheidend sie ist, gewiß nicht mit der Begegnung zwischen ihm und mir – die war ganz peripher –, sondern mit seinem Tod im Oktober des Jahres 1949, jenem rätselhaften und doch so verständlichen selbstmörderischen Akt in einer kleinen Mansardenwohnung in der Rue Manot, mitten im Quartier Latin. Die Tat geschah wenige Tage vor Bugenhagens Hochzeit und war doch nicht die Verzweiflungstat einer Sekunde, kein Eingeständnis von Elend, Sünde und Schuld, sondern der Endpunkt notwendiger Entwicklung, ja, Ziel, Abschluß und Ausklang des Romans. «Der Mann, der nicht alt werden wollte» ist ein Buch, das zwar als Roman begonnen, fortgesetzt und nah ans Ziel geführt werden konnte, dessen Ende jedoch, simpel und unmißverständlich, nur das Leben zu schreiben vermochte. Am 17. Oktober 1949 wurde nicht der Epilog, sondern das Schlußkapitel geschrieben. –
So lassen Sie mich denn mit der Lebensgeschichte dieses seltsamen Mannes und seines Werks beginnen, indem ich zunächst das Ende seines Lebens und damit zugleich das Schlußkapitel seines Romans in wenigen Sätzen behandle: den Tod des Verkannten und zugleich die letzte Zeile eines Buchs, in dem auf Hunderten von eng beschriebenen Blättern der Versuch unternommen wird – frevelhaft und demütig zugleich – zu wissen, was Zeit sei, und weit im voraus zu erfahren, was das Alter bedeute. Zu welchem Ziel? Um es zu vernichten? Um es zu verlängern und die Jugend zu zerstören? Um die Konsequenz und Logik der Zeit durch sich selbst ad absurdum zu führen? Handelt es sich um das hybride Unternehmen, die Zeit dem Menschen unterzuordnen und damit Gott das letzte Attribut zu nehmen, das ihn in unseren Tagen noch über den Menschen zu erheben scheint: die Einsicht in die Zeit? Wollte Bugenhagen seinen Helden bis zu jenem Punkte führen, wo das Nacheinander im Nebeneinander zerfließt? Erstrebte er die endgültige Zerstörung der schrittweisen Folge durch die Inthronisation der ewigen Gegenwart? – Wir werden es sehen.
Von nun an habe ich nur noch zu berichten. Bitte verzeihen Sie, meine Leser, den ein wenig gespreizten Stil dieser einleitenden Worte, der sich – ich sehe das jetzt ganz klar – nur aus einer gewissen Befangenheit gegenüber meinem Gegenstand, vielleicht aber auch aus der Angst ergibt, daß ich, im Falle eines Mißerfolges dieser Biographie, mein ganzes Lebenswerk zweideutig und fragwürdig machen könnte.
2
JETZT STEHT ER NEBEN MIR und sieht mich an. Ich erkenne seine Augen und im gleichen Augenblick erschrecke ich. Er winkt mir, ihm zu folgen, und ich gehe langsam hinter ihm her. Wohin wird er mich führen? Wo werde ich sein, wenn ich am Ende dieses Buches angekommen bin? Unter welchem Himmel und in welchem Land?
Ich sehe nur seinen Rücken. Ich muß mich anstrengen, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Es beginnt Abend zu werden, ein nebliggrauer Himmel liegt über der Stadt.
Bugenhagen trägt einen Trenchcoat, der ihm an den Schultern zu weit ist. Er geht schnell und sieht sich nicht mehr um.
Zwei Männer gehen durch den Herbst von Paris. Nur wenige Schritte trennen sie voneinander. Sie gehen einmal schnell, einmal langsam – der Abstand zwischen ihnen verändert sich nicht. Sie gehen durch dunkle Straßen und bleiben manchmal vor einer Kneipe stehen, aus der Musik und Stimmen von Menschen kommen. Dann lauschen sie und gehen weiter.
Wenn der vordere gedankenlos das Plakat an einem Metroschacht betrachtet, betrachtet es sein Verfolger auch, und wenn der erste ein Blatt in die Hand nimmt, ein gelbes, welkes Blatt von einem herbstlichen Baum, dann sieht ihm der andere im Schein einer Straßenlaterne aufmerksam zu.
Sie gehen und gehen. Sie gehen durch die Straßen von Paris. Während sie gehen, wandern die Zeiger weiter: wie die Menschen, die durch die Alleen schlendern, wie die schlafenden Tiere und die träumenden Kinder. Aber die beiden merken es nicht. Sie haben die Zeit vergessen.
Sie sehen die Lichter der Ampeln, die über den Geleisen der Bahnhöfe schweben, sie sehen die wechselnden Schatten über dem fallenden Laub, sie sehen die länglich-goldenen Spiegel in der Schwärze der Seine, sie sehen ein Boot, das ein kleiner Junge am Steinrand eines Teiches vergessen hat.
Sie bemerken die Nässe weißer Statuen und das Nebelgrau versunkener Paläste, und sie sehen die Silhouetten der großen Kräne am Wasser.
Sie fühlen, wie sich die Stahlstühle eines verlassenen Cafés in der Pfütze spiegeln, sie sehen ein Mädchen, das sich vor einer Fensterscheibe die Lippen nachzieht. Sie weichen zwei Betrunkenen aus und sie sehen dem Liebespaar zu, daß sich zärtlich vor einem alten Bistro umschlungen hält. Über den Schatten spiegeln sich Flaschen, über den Köpfen steht schwärzlich ein Wort: Téléphone.
Zwei Menschen gehen durch die Straßen von Paris, durch tausend kleine Gassen, an tausend herbstlichen Bäumen vorbei. Es beginnt zu regnen, und es wird Nacht. An der Place de la Concorde brennen die Lampen, in der Rue Vaugirard weint ein Kind in einem Schusterladen. Ein leuchtendes Fenster durchschneidet das Dunkel der Place Marinette. Ein Streichholz fährt flammend an weißlichen Knöpfen entlang und erhellt für Sekunden den Namen: «Yvonne Donnerot».
Bugenhagen läutet. Die Tür wird geöffnet und schließt sich schnell wieder. Ich warte im Dunkel. Es dauert nicht lange, bis er zurückkommt. Zum zweiten Mal winkt er mir zu, und ich folge ihm lautlos. Die Place Marinette ist still wie zuvor.
Wir gehen durch die Straßen von Paris. Es ist ein Herbstabend voll Nässe und Nebel. Der 17. Oktober 1949. Die Straßen sind leer und verlassen. «Tic» heißt die Bar an der Ecke, er ist häufig zu Gast hier, um am Abend seinen Wermut zu trinken. Ich folge ihm nicht, sondern warte draußen und sehe ihm zu. Hinter den Scheiben kann ich ihn deutlich erkennen. Er trinkt sehr viel heute abend, nicht nur Wermut, wie sonst, sondern Schnaps und grünen Pernod. Er schäkert mit Madeleine, der Kellnerin. Seltsam, das hat er früher nie getan. Er hat sie sonst kaum beachtet. Heute aber lacht er ihr zu und spricht auf sie ein, doch wenn sie sich abwendet, wird sein Gesicht plötzlich schattig und alt. Schließlich gibt sie ihm hastig ein kleines Paket. Er nimmt es und streichelt ihre Hand, als ob sie ein Kind sei.
Zum dritten Mal winkt er mir dann. Ich folge ihm hastig. Er biegt in eine kleine Gasse ein. Plötzlich überfällt mich die Erinnerung. Ich höre den Militärmarsch, den der Rentner Poulnet auf seinem Grammophon abspielt. Ich sehe die erleuchteten Fenster der Wohnung von Frau Monne, ich sehe die verregneten Atelierfenster des Malers Favre – und da ist auch die alte Kastanie, um die die Kinder, wenn es Tag ist, Ringelreihen spielen, da ist der Wind, und da ist auch der Geruch, der faulig-süße Geruch der Rue Manot.
Jetzt dreht er sich um und nickt mit dem Kopf. Dann geht er in ein Treppenhaus. Eine Sekunde lang zögere ich, ihm zu folgen, aber die Concierge schaut nur flüchtig über ihre Brille, stopft weiter an ihrem Wollstrumpf und läßt mich vorbei, ohne nach meinen Absichten zu fragen. Ich gehe die Treppe hinauf. Der Militärmarsch dröhnt schon ganz laut. Ich gehe immer schneller. Bugenhagen öffnet eine Tür. Ich sehe ein Regal mit Büchern, verstaubten Mappen und unordentlich aufeinandergeschichteten Zeitungen. Ich sehe ein Bett mit bunten Kissen, und ich sehe ein Bild. Auf dem Bild geht ein Mann mit einem langen schwarzen Mantel durch eine häuserlose Straße. Vor dem Mund trägt er eine weiße Binde, die in zwei hinter dem Kopf verknotete Schnüre ausläuft. Am Ende der Straße türmt sich eine schwarze Stadt in den Himmel. Der Mann ist ein Mongole, das Lächeln seines Munds ist noch unter der Binde erkennbar. Hinter ihm steht ein Schild mit chinesischen Schriftzeichen. Vielleicht ist der Mongole ein Arzt, der in eine vom Tode befallene Stadt eilt, in eine schwarze Zone des Schweigens, die niemand betreten darf: so will es das Schild.
Vorsichtig schließt sich die Tür. Flüchtig sehe ich noch einmal Bugenhagens Hand, als letztes den kahlen Schädel des mongolischen Arztes und das Lächeln unter der schneeigen Binde.
Ich wende mich ab. Der Militärmarsch des Rentners Poulnet ist zu Ende. Ich gehe langsam die Treppen hinunter und verlasse das Haus.
Ich bin allein.
3
ICH brauchte nicht mehr als ein paar Wochen, um den Abend des 17. Oktober so deutlich und bis in alle Einzelheiten verständlich vor mir zu sehen, wie ich es auf den letzten Blättern zu schildern versuchte. Damit war freilich noch nicht viel gewonnen. Es bedurfte des sorgfältigen Studiums von beinahe einem Jahr, vieler Reisen, mancher Lektüre und unzähliger Besuche, bis ich mich in der Lage sah, das Leben und Werk Wolfgang Bugenhagens in einer umfassenden Darstellung einem größeren Publikum vorzutragen. Dieser Augenblick ist jetzt, ein Jahr nach seinem Tode, gekommen. Damit ist für mich der Zeitpunkt erreicht, wo es Rechenschaft über die Methode meiner Untersuchung und den Verlauf des von mir eingeschlagenen Weges abzulegen gilt.
Aber ich halte ein. Nun, wo ich am Ziel der Reise bin, kommen mir plötzlich Bedenken. Ist es richtig, daß ich im Folgenden verfahre, als handle es sich bei meinem Unternehmen um eine Biographie, die sich in nichts von anderen unterscheidet: eine Biographie, wie ich sie selbst vor 30 Jahren schrieb, als ich das Leben des Christoph Martin Wieland aus Oberholzheim im Schwäbischen darstellte? Tue ich recht, wenn ich, gemächlich Zeile an Zeile reihend, das Leben meines Freundes in chronologischer Folge vor Ihnen ausbreite, angefangen bei Geburt und Kindheit, Ahnen und Herkunft und mit dem letzten Tag seines flüchtigen Daseins endend … so, als ginge es um die selbstverständlichste Sache der Welt? Nein. Das vermag ich nicht. Er war es, der mich leitete, er führte meinen Weg von Stufe zu Stufe, von Station zu Station, so daß am Ende die Spur seines Lebens mit meiner eigenen zusammenfiel, ja, daß mein Leben aufhörte, mir zu gehören, und ich in seinem Namen weiterlebte. Schreibe ich also die Geschichte Wolfgang Bugenhagens, so schreibe ich damit auch meine eigene; und weil das so ist, bleibt mir keine andere Wahl, als an Hand meines Tagebuches noch einmal den Weg zu verfolgen, den ich in den letzten zwei Jahren, seiner Fährte folgend, ausgemessen habe.
Ich weiß, daß mancher mich eines unerlaubten Kunstgriffs zeihen und mir vorwerfen wird, ich hielte mit meiner Erkenntnis hinter dem Berge; aber ich kann es nicht ändern. Ich habe keine andere Möglichkeit, als den Schleier im gleichen Maße zu lüften, wie er sich mir nach und nach und immer deutlicher aufhob. Deshalb bringe ich es nicht über mich, das gesammelte Material nur als Voraussetzung gelten zu lassen, um dann wie ein Märchenerzähler mit den Worten «es war einmal» abermals von vorn zu beginnen. Nein, ich muß dort anfangen, wo es wirklich begann, wo die Nachricht von seinem Tod mein Leben veränderte. Ich will Sie, meine Leser, an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen, gewiß, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen, die gleichen Wege abzugehen, die ich selbst entlanggewandert bin.
Ich lege meine Karten offen auf den Tisch. Sie können sich dann selbst ein Bild über den Grad der Glaubwürdigkeit machen, die meiner Erzählung zukommt. Was nützte es Ihnen, wenn ich das Leben meines Freundes enthüllte, aber die Schlüssel verbärge, mit denen ich die Türen öffnete? Würden Sie nicht an allem zweifeln – wer weiß, am Ende vielleicht sogar an der Existenz meines Freundes und der Realität seines Werks –, würden Sie nicht an Fiktion und Täuschung denken, wenn ich mir die Legitimation ersparte und Ihnen keine Rechenschaft über all meine Bemühungen, über Weg und Irrweg, Forschung und Verfehlung, ablegte?
So beginne ich denn, indem ich mein Tagebuch öffne und den Ausgangspunkt meiner Reise bezeichne, den Beginn einer Fahrt, die ins Ungewisse führte und die ich nun wiederhole, indem ich ihr in vollem Bewußtsein den Charakter einer biographischen Analyse verleihe.
Wir schreiben den November des Jahres 1949. Wir, Sie und ich, stehen am gleichen Punkt … oder doch nicht ganz, denn Sie wissen nach meinen erklärenden Worten bereits, daß uns eine lange Reise bevorsteht, eine Reise aber auch, die endlich ans Ziel führt. Ich wußte beides noch nicht, damals, als ich nach Paris fuhr. Ich reiste ins Ungewisse, und mein Gepäck reichte allenfalls für ein paar Wochen.
4
Auf meinem Schreibtisch liegt ein Brief des Notars Maistre aus der Rue Massonne in Paris. Darin wird mir in schlichten Worten mitgeteilt, daß am 17. Oktober dieses Jahres, vor einem Monat also, der deutsche Schriftsteller Wolfgang Bugenhagen in Paris seinem Leben ein Ende gemacht hätte. In seinem Zimmer habe man, in einem Couvert verschlossen, eine Aufstellung seines Besitzes zusammen mit einer letztwilligen Verfügung über die Aufteilung des von ihm hinterlassenen Gutes gefunden. Der erste Punkt seines Testaments – als ein solches könne man seine Verfügung mit Fug und Recht, der juristischen Terminologie entsprechend, bezeichnen – beträfe seine gesamten Manuskripte, Aufzeichnungen, Tagebücher, Briefe und einen unvollendeten Roman mit dem Titel: «Der Mann, der nicht alt werden wollte». Er, der Notar Maistre, habe die Ehre, mir mitzuteilen, daß alle diese Papiere durch den Willen des Verstorbenen in meinen Besitz übergegangen seien.
Jetzt, wo ich meine Tagebuchaufzeichnungen vom 17. November 1949 überlese – es handelt sich bei meinen Eintragungen nur um Stichworte, aber ich glaube recht daran zu tun, wenn ich sie ein wenig ausfülle und das Tagebuch, was freilich streng genommen eine Falsifikation ist, in dem gleichen Stil abfasse, den ich auch für die berichtenden Passagen dieser Darstellung verwende – jetzt erinnere ich mich wieder genau des Gefühls, das mich überkam, als ich den Brief des Notars gelesen hatte und das Schicksal Wolfgang Bugenhagens mir zum ersten Male greifbar vor Augen stand. Ich war weder erstaunt noch verwirrt, sondern nur von einer tiefen Trauer über das unerwartete Ende dessen erfüllt, den ich noch vor einem halben Jahr bei mir zum Tee gesehen und mit dem ich eingehend über seinen damals gerade veröffentlichten Erzählungsband: «Legenden vom Tode» gesprochen hatte. Daneben fühlte ich eine heimlich aufkeimende Sehnsucht, die ich mir freilich nicht ganz einzugestehen wagte, Näheres über den Tod und die letzten Lebenstage des Verstorbenen zu erfahren.
So telegraphierte ich noch am Abend des 17. November an den Notar Maistre in Paris, er möge alles unangetastet lassen, ich käme schon im Laufe des nächsten Vormittags an der Gare de l’Est an. Ein Blick ins Kursbuch hatte mich belehrt, daß ich den Nachtzug noch erreichen konnte. Das Abenteuer reizte mich. Von keiner amtlichen Verpflichtung behindert, hatte ich Zeit, meiner Sehnsucht Befriedigung zu verschaffen.
Die Reise war anstrengend und lähmend. Ich fand keinen Schlaf; die Gedanken über das Schicksal Bugenhagens ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Ich hatte die Fährte aufgenommen: ohne daß ich es ahnte, war bereits über mich entschieden worden.
Vom Bahnhof aus begab ich mich unverzüglich zu Herrn Maistre in die Rue Massonne. Der Notar, ein kleiner geschäftiger Südfranzose, überließ mir nach meiner Legitimation bereitwillig die Schlüssel zu Bugenhagens Wohnung. Die Wertgegenstände, so eröffnete er mir, Schmuck, Silbersachen und etwas Geld, wären schon von der Braut des Verstorbenen abgeholt worden. Sonst sei alles unverändert. Beiläufig erfuhr ich den Namen der Verlobten: Yvonne Donnerot, Place Marinette 2. Darauf – die ganze Zeremonie mochte eine halbe Stunde gedauert haben – eilte ich ohne weitere Umschweife in die Rue Manot. Dort angekommen, mietete ich Bugenhagens Zimmer für ein weiteres Vierteljahr und begann sogleich die ersten Erkundigungen über die Lebensgewohnheiten des Toten einzuziehen.
Ich öffne wieder mein Tagebuch, das, wenn ich es auch im Laufe meiner Darstellung immer seltener wörtlich zitieren werde, weiterhin das Gerüst dieser Untersuchung bilden soll; denn, so lästig eine Unterbrechung durch Tagebuchnotizen auch sein mag, der Nutzen, trotz aller Abschweifungen und Verweise, Erklärungen und Vorblicke immer einen Fixpunkt zu haben, zu dem man auch im verschlungensten Dickicht langer Parenthesen zurückkehren kann, einen Punkt, der noch in das scheinbar unentwirrbare Gerank mutwillig gehäufter Relativsätze Maß und Ordnung hineinträgt: dieser Nutzen der Fixierung wiegt, so meine ich, den Nachteil lästiger Unterbrechungen auf.
Jetzt ist es Abend. Ich habe Licht gemacht – eine Birne hängt schirmlos über dem Schreibtisch – und unterziehe das Zimmer einer ersten eingehenden Untersuchung. Die Manuskripte, Briefe und Tagebücher liegen gebündelt im Schreibtisch. Alles scheint unversehrt, nur die Bettwäsche ist abgezogen, und auch die Kleider hat man aus dem Schrank genommen. Rings an den Wänden stehen Regale mit Büchern, Mappen und Zeitschriften, ungeordnet und wirr durcheinander. An der Wand hängt ein Bild, das einen Chinesen darstellt. Es ist eine Photographie: die Darstellung einer Ortschaft, über die man strenge Quarantäne verhängt hat.
Ich öffne das Fenster. Um die Kastanie in der Mitte des Hofes spielen noch Kinder Ringelreihen.
Heute nachmittag machte ich die Bekanntschaft des Rentners Poulnet. Er erzählte mir viel von Bugenhagen. Ich erfuhr, daß er meistens zu Hause gewesen wäre und ein stilles, unauffälliges Leben geführt hätte.
Am Abend darauf begann ich mit der Lektüre des Romans. Langsam sah ich klarer. Zugleich wurde mir von Stunde zu Stunde deutlicher, daß ich die nächsten Monate – damals glaubte ich mit Monaten auszukommen – einem eingehenden Studium von Bugenhagens Leben widmen würde. Die Wichtigkeit und Bedeutung seines hinterlassenen Werks erschütterte mich in gleichem Maße wie sie mich an vielem verzweifeln und irre werden ließ, was mir bis dahin selbstverständlich war. Ich sah mich auf einmal der Maßstäbe beraubt, an deren unantastbare Heiligkeit ich ein Leben lang geglaubt hatte. Zugleich bedrückte mich der Gedanke, daß nur ich Kenntnis von einem Fragment hatte, das, in wenigen Jahren entworfen, mein ganzes Leben, all meine Hoffnungen und Jugendwünsche, meine Gedanken und Erkenntnisse enthielt, die ich in meinen wissenschaftlichen Publikationen nur unvollkommen darzustellen vermochte. Oft überfiel mich angstvoll der Gedanke, meine Tage könnten gezählt sein, ehe ich Zeugnis von meinem Fund abgelegt hätte. Ich schrieb deshalb schon am 22. November an Obergefell, meinen besten Schüler (die Dissertation, die er, ein Jahr vor meiner Emeritierung, bei mir anfertigte: «Stifters erzählerische Technik», eine hervorragende Analyse, ist durch den Druck in der Reihe der «Germanischen Studien» einem größeren Kreis zugänglich geworden), unterrichtete ihn, unter dem Hinweis auf strengstes Stillschweigen, von meinen Absichten und verband das, vorsichtig umschrieben, mit der Bitte, das Begonnene fortzusetzen, falls mir etwas zustoßen sollte. Nach diesem Brief fing ich an, sehr genau Tagebuch zu führen, damit Obergefell jederzeit in der Lage war, die Arbeit an dem Punkt wieder aufzunehmen, wo ich sie niederlegte. Diese Genauigkeit kommt mir heute, bei der Rekonstruktion meines Weges, in der willkommensten Weise entgegen.
Bald schon sah ich mich in der Lage, das übertünchte Bild freilegen zu können: der Palimpsest war abgekratzt, die Handschrift des ersten Schreibers wieder lesbar geworden. Freilich muß ich bemerken, daß ich mich von Anfang an bewußt beschränkte. Obwohl der Plan, eine Biographie über Wolfgang Bugenhagen zu schreiben, wenn ich mich recht erinnere, schon im Laufe der zweiten Novemberhälfte aufgetaucht ist, zwang ich mich doch zur Bedächtigkeit. Es galt, nichts zu überhasten, sondern einen Schritt vor den anderen zu setzen. Zunächst mußten die Umstände seines Todes geklärt werden, dann konnte man weitersehen.
Auf einen kleinen Zettel schrieb ich die Namen derer, die mir bei der Enträtselung der Ereignisse des 17. Oktober helfen konnten: Rentner Poulnet, Polizeiarzt Cannes, Aufwartefrau Monne, Yvonne Donnerot.
Zu Yvonne, Wolfgangs Verlobter, ging ich zuerst. Sie bewohnte eine einfache, für meinen Geschmack ein wenig zu modern eingerichtete Wohnung im Quartier Latin – die Adresse habe ich schon genannt – und machte auf mich den Eindruck einer außerordentlich gut aussehenden, wenngleich ein wenig «fremdartigen» jungen Frau. Den Ausdruck «fremdartig» entnehme ich meinem Tagebuch; das Urteil sollte sich später bestätigen, und ich werde davon zu berichten haben: von wenigen Ausnahmen abgesehen, möchte ich, wie gesagt, das zunächst nur skizzierte Bild erst nach und nach ausmalen und lediglich in den dringendsten Fällen ein zeitlich später gelegenes Ereignis vorwegnehmen.
Yvonne war recht gesprächig und erzählte mir, nach kurzer Vorstellung und einigen Fragen, die zur Verständigung notwendig waren, daß Bugenhagen, ganz gegen seine Gewohnheit, am Abend des 17. Oktober noch einmal für kurze Zeit bei ihr gewesen sei. Damals hätte sie nichts Besonderes bemerkt, aber später wäre ihr aufgefallen, daß er sehr verstört gewesen war. Auch hätte er immer von einem gewissen Taji gesprochen. Sie hätte aber nicht gewußt, was es mit diesem Namen auf sich habe, dem wohl auch keine besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie erzählte viel von dem Zusammenleben mit Bugenhagen, freimütig und ohne etwas zu verbergen. Ja, Wolfgang hätte manchmal von mir gesprochen.
Nachdem ich erfahren hatte, daß die Hochzeit der beiden auf Bugenhagens Bitten immer wieder verschoben, zuletzt aber endgültig auf den 1. Dezember festgesetzt worden war, verabschiedete ich mich mit dem Versprechen, bald wiederzukommen, und begab mich zu der Aufwartefrau Monne. Durch sie erfuhr ich, daß auf Veranlassung des Polizeiarztes Cannes – der mir später, wenngleich widerwillig, die Aussagen der Frau Monne bestätigte – eine gewisse Madeleine Sachout, Kellnerin in der Bar «Tic», wo Bugenhagen abends häufig verkehrte, festgenommen, dann aber wieder freigelassen worden sei.
Die Aussagen Yvonnes und Madeleines – ein Trinkgeld machte sie gesprächig – fügten sich eng ineinander. Ja, der junge Herr wäre an diesem Abend ganz verändert gewesen. Sonst hätte er immer nur einen Wermut getrunken und sei ganz still an einem Tisch in der Ecke geblieben, ohne sich weiter um sie zu kümmern, aber damals, am 17. Oktober – sie wisse es noch ganz genau und hätte es schließlich auch oft genug zu Protokoll geben müssen –, damals hätte er lange und eindringlich mit ihr gesprochen und sogar – sie lächelte – ein wenig geschäkert. Schließlich hätte sie ihm das Gift gegeben; er brauche es ganz dringend für das Ungeziefer, habe er gesagt. Hätte sie denn wissen können …?
Niemand, weder Yvonne noch Madeleine, weder Frau Monne noch der Rentner Poulnet, die Bugenhagen beide als verträglichen Mieter geschildert hatten, der nur manchmal ein wenig verstört (effaré … hieß es nicht so?) gewesen sei, weder Monsieur Cannes noch Madame Lesage, die halbtaube und schon ein wenig wunderliche achtzigjährige Concierge konnten es sich erklären, warum der junge Deutsche auf diese schreckliche Art aus dem Leben geschieden war. Auch ich selbst, um es offen zu gestehen, tappte lange im Dunkel. Erst nachdem ich den Roman zu Ende gelesen und auch die Tagebücher einer ersten flüchtigen Musterung unterzogen hatte, sah ich plötzlich klar: ER STARB, WEIL ER NICHT ALT WERDEN WOLLTE.
Die Gewißheit Karl Heydenreichs, des Helden des Romans, an jenen Punkt gekommen zu sein, wo das Altern nicht mehr vor, sondern hinter dem Menschen liegt, war eine Täuschung. Am Abend des 16. Oktober muß Bugenhagen erkannt haben, daß es eine Täuschung war, und daß er in seiner Jugend niemals alt genug werden konnte, um dem Alter nicht immer wieder, Tag für Tag, entgegengehen zu müssen. Am 17. Oktober zog er aus dieser Erkenntnis den Schluß. Der Selbstmord war die letzte Konsequenz des greisenhaften Wissens eines Sechsundzwanzigjährigen, der eine Zeitlang vermeint hatte, mit dem Gedanken allein das Alter durch sich selbst aufheben zu können. Am 17. Oktober mußte er erkennen, daß nur der Tod die Zeit überwindet.
Wolfgang Bugenhagen wollte jung bleiben und dennoch das Alter erfahren, ohne jemals ein Greis werden zu müssen. Eine Sekunde lang schien ihm beides friedlich vereint. In der Sekunde danach trank er das Gift.
5
«DER MANN, DER NICHT ALT WERDEN WOLLTE» besteht aus drei Büchern, von denen das erste Heydenreichs Kindheit, das zweite das Jahr seiner entscheidenden Wandlung, das dritte einen Tag in seinem Leben beschreibt. Die Bücher sind so komponiert, daß die dargestellte Zeitspanne in der gleichen Weise abnimmt, wie die Beschreibung dieser Zeit an Raum und Gewicht gewinnt. Die im ersten Buch abgehandelte Kindheit und Jugend umfaßt zweiundzwanzig Jahre und wird auf achtzig Seiten beschrieben, für das Jahr der Wandlung benötigte Bugenhagen schon einhundertzwanzig Seiten, während die Analyse des einen Tages wahrscheinlich einen Aufwand von fünfhundert Seiten erfordert hätte.
Von diesen geplanten siebenhundert Seiten des Gesamtwerks ist freilich nur ein Drittel ausgeführt worden, ein zweites Drittel liegt in Skizzen vor, für den Rest bestehen, mit Ausnahme des Schlusses, mehr oder minder detaillierte Pläne. Bedauerlich bleibt, daß der fragmentarische Charakter des Romans am Ende immer deutlicher in Erscheinung tritt, während die ersten beiden Bücher weiter ausgeführt sind, obwohl gerade sie nach Beendigung des dritten Buchs wahrscheinlich noch einmal neu geschrieben worden wären, da sie – Notizen deuten darauf hin – Bugenhagen nicht mehr genügten. (Das kann jedenfalls für das in vielem noch konventionelle erste Buch gelten, das weder die Plastizität noch die stilistische Vollkommenheit des letzten Teils besitzt. Buch zwei liegt seinem Rang nach zwischen eins und drei.)
Die Problematik des Romans tritt, von Vordeutungen abgesehen, zum ersten Mal in der Mitte des zweiten Buches auf, dort, wo Heydenreich anläßlich des Besuchs eines Mädchens die Erfahrung macht, daß er sich während des Gesprächs mit dem vor ihm sitzenden Mädchen zugleich mit seiner Mutter unterhält, an die er durch die Sprache des Mädchens in einer geheimnisvollen Weise erinnert wird. Dieser Vorgang wiederholt sich im Folgenden häufig. Mit jedem Tag, den Heydenreich weiterlebt, werden die durch winzige Kleinigkeiten ausgelösten Erinnerungen stärker, so daß er am Ende kaum noch etwas Neues zu erleben scheint. In der Sorge, mehr und mehr dem Alter zu verfallen, beschließt er zu rebellieren und die Macht seiner Erinnerungen durch ungekannte Eindrücke zu brechen. In der Absicht, seinen Zweck zu erreichen, verfällt er neuen, ihm bis dahin fremden Reizen und Gewohnheiten: er kostet geheimnisvolle Gifte, sucht Erlebnisse in den untersten Schichten der Gesellschaft und wird am Ende zum Verbrecher, um in der erinnerungslosen Welt waghalsiger Ecarté-Spieler sich selbst zu vergessen. Aber auch dieser Versuch schlägt fehl, und Heydenreich ist sich bewußt, daß die Entscheidung nahe bevorsteht. Wenn es ihm nicht gelingt, den Verführungen seines Gedächtnisses zu entrinnen, ist er verloren. Mit jeder Erinnerung, die ihn fortreißt, mit jedem Bild, das ihn sein Gegenüber vergessen läßt und ihn in die zeitfremde Welt des Vergangenen zurückführt, schwindet seine Jugend mehr und mehr dahin: er wird alt und der Raum des noch Erlebbaren verringert sich von Tag zu Tag. Zugleich aber weigert er sich, sein Wissen aufzugeben, noch einmal in die gedächtnislose Leere der Vergangenheit zurückzugleiten und der Verführung durch das nackte Handeln ein zweites Mal zu verfallen. Vielmehr strebt er danach, seine Gedanken und seine Erwartungen, das Gestern und Morgen, in einer riesigen Anstrengung zusammenzukoppeln und dem Genuß des Augenblicks dienstbar zu machen. Auf der Ebene seiner vielfältigen Erinnerungen, dem von seinen Plänen und Hoffnungen ausgezirkelten Quadrat, will er ein neues Leben beginnen. Nach vielen Fehlschlägen scheint er an dem Abend, mit dem Bugenhagens drittes Buch endet, zu einer neuen Erkenntnis gekommen zu sein.
Doch der Roman bleibt Fragment. An die Stelle der Schilderung letzter Erkenntnis, die für immer den Gegensatz zwischen Jugend und Alter aufhebt, tritt der Gang zur Kellnerin Madeleine Sachout, die trübe Stunde in der Bar, da mein Freund das Scheitern seines Werks einsah und die Phantasmagorie der glückverheißenden Koinzidenz der Zeiten sich ins Wesenlose verflüchtigte.
Und doch: Wolfgang Bugenhagen starb nicht voll Verzweiflung, nicht in bitterer Anklage, sondern wissend und still. Wie wären sonst die Worte, die letzten, in Bleistiftschrift hingekritzelten Worte des Romans zu erklären: «Bring denn auch du, Taji, dem Asklepios einen Hahn, wenn du dorthin gekommen.»?
Ich versuchte alles, um die Bedeutung dieser Zeilen zu erklären. Gewiß, der Anschluß an die letzten Worte des Sokrates war ebenso offensichtlich wie der versöhnende Sinn, der dem Satz zugrunde lag; aber es blieb ein Rest, der mich unbefriedigt ließ. Wer war Taji? Ein Zauberer? Eine geschichtliche Figur? Ein Freund Bugenhagens? Vergebens schlug ich in Lexika und Spezialbiographien nach, nicht einmal Kollegen von der Sorbonne, die ich in dieser Angelegenheit konsultierte, konnten mir raten. Endlich kam mir der Zufall zu Hilfe.
Als ich Anfang Dezember das Bild mit dem Chinesen noch einmal gründlich studierte, entdeckte ich – was mir bis dahin verborgen geblieben war – in der linken unteren Ecke einen kleinen Stempel. Da es sich um das Signum eines nicht unbekannten Antiquariats handelte, machte ich mich sogleich auf den Weg, in der Hoffnung, vielleicht ein paar Mosaiksteinchen, die mir in meinem Rahmen noch fehlten, in der Kunsthandlung aufzutreiben. In der Tat hatte ich Glück. Ein älterer Angestellter konnte sich genau an den Herrn erinnern, der das Bild gekauft hatte. Die Beschreibung ließ keinen Zweifel darüber, daß es sich bei dem Käufer um Bugenhagen gehandelt hatte.
Der Herr hätte sehr lange gesucht, sagte der Angestellte, ehe er auf die übrigens nicht ganz billige Aufnahme verfallen wäre. Ein Chinese hätte sie gerade ein paar Stunden vorher abgegeben, schweren Herzens, da es sich bei dem Mann mit der weißen Maske um einen Freund von ihm handle, einen gewissen Taji. Er, der Angestellte, habe Bugenhagen den Namen genannt.
Nach dieser Erklärung hellten sich die Zusammenhänge wie von selbst auf: Taji ist der Arzt, der in die Totenstadt geht. Ihm vertraute sich Bugenhagen am Abend des 17. Oktober als Wegbegleiter an. Taji, der Arzt, sollte zum Zeichen, daß der Verlorene heimgekehrt sei, drinnen in der Stadt seinem Gott einen Hahn opfern.
Es war Mitte Dezember, als ich mich in der Lage sah, die Umstände von Wolfgangs letztem Lebenstag bis in die Einzelheiten hinein zu rekonstruieren. Am Morgen des 17. Oktober muß er versucht haben, den am Abend vorher unfertig gebliebenen Abschnitt seines Romans zu beenden: darauf deuten zahlreiche zerknüllte Blätter, die ich in seinen Schreibtischschubladen fand, Seiten, die oft wenige Sätze, manchmal auch nur Worte enthalten und von einer großen Erregung des Schreibers zeugen. Gegen Mittag mag er ein paar Bissen gegessen haben – Frau Monne glaubte sich zu erinnern, bei der Reinigung am Nachmittag frische Brotkrumen und Spuren von jüngst verschüttetem Rotwein gesehen zu haben –, dann, nach dem Eintritt der Aufwartefrau, ist Bugenhagen offenbar in die Stadt gegangen, und zwar zunächst nicht zu Yvonne, wie er es Frau Monne gegenüber äußerte, sondern zu einem Spaziergang an der Seine entlang, wo er gegen sechs von einem Bekannten, dem Maler Favre, gesehen wurde. Anschließend fuhr er zu Yvonne, um danach offenbar noch einmal eine Fortsetzung des Romans zu versuchen. Darauf deutet die Notiz in seinem Tagebuch: «Leerer Tag. Bleierne Schwere. Die Zeiger rücken nicht von der Stelle. Zum zweiten Mal vergeblich zu arbeiten versucht.» Ob der Entschluß, das Gift zu nehmen, erst in der Bar oder schon zur Zeit der Niederschrift dieser Tagebuchnotiz in ihm gereift ist, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls muß Bugenhagen, nach der Untersuchung des Polizeiarztes, das Gift zwischen halb zehn und zehn Uhr getrunken haben; wahrscheinlich wenige Minuten vor zehn, weil eine Nachbarin, die Kassiererin Prenet, gesehen haben will, wie er gegen viertel vor zehn die Rolläden vor seinem Fenster herunterließ … nein, das sei sonst nicht seine Gewohnheit gewesen, deshalb hätte sie auf die Uhr geschaut.
II
1
FÜNF TAGE VOR WEIHNACHTEN war das Hauptgeschäft in Paris erledigt: ich hatte die Manuskripte gelesen und die Ereignisse des Todestags auf eine verhältnismäßig einfache Art geklärt. Jetzt stand ich vor der Frage, ob ich nach den Weihnachtsferien, die ich wie immer bei meiner Tochter in Hannover zu verleben gedachte, nach Paris zurückkehren oder meine Nachforschungen in dem Hannover so verführerisch nahen Hamburg fortsetzen sollte. Das Nachdenken über diese mir zunächst nicht sehr wichtige Frage – schließlich war ich ein freier Mann und konnte, bei bescheidenen Ansprüchen, tun und lassen was ich wollte – führte mich bald zu grundsätzlichen Erwägungen über die vor mir liegende Aufgabe, und ohne daß ich es wollte, sah ich mich unversehens an einem Kreuzweg vor die Entscheidung gestellt, zum mindesten für die nächsten Monate eine feste Marschroute bestimmen zu müssen. Ich hatte zwei Möglichkeiten, um meine Studien über Wolfgang Bugenhagen fortzusetzen; zwei Wege, von denen ich nicht mußte, welcher von ihnen mich zum Ziel führen würde, lagen vor mir.
Ich konnte meine Nachforschungen in Paris weiterführen und später versuchen, Schritt für Schritt rückwärts zu gehen, bis ich, in der Sekunde, da ich den Augenblick seiner Geburt erreicht hatte, am Ende meiner Reise angelangt war. Das war der eine Weg, und er hatte viel für sich, weil ich zunächst einmal den Roman am Entstehungsort bearbeiten und bei dieser Gelegenheit Studien über Bugenhagens Gewohnheiten während seines letzten Lebensjahres machen konnte. Yvonne würde mir eine gute Zeugin sein, und auch auf den Maler Favre und den Rentner Poulnet, auf Monsieur Hélot, den Besitzer des «Tic», und den Schauspieler Batteux, deren Bekanntschaft ich mittlerweile gemacht hatte, war durchaus Verlaß. Dennoch befriedigte mich dieser Weg nicht; ich würde mit zu vielen Unbekannten rechnen müssen, da ich über Wolfgangs Kindheit und die langen Jahre vor dem Pariser Aufenthalt nicht das Geringste wußte – eine Tatsache, die mir auch das Verständnis großer Abschnitte des Romans wesentlich erschweren würde.
Deshalb entschloß ich mich, den zweiten Weg zu gehen und, mit dem Ziel, meine Unternehmungen an Ort und Stelle zu fördern, nach Hamburg, Wolfgang Bugenhagens Geburtsstadt, zu reisen.
Was ich vor meinem Entschluß, noch einmal von vorn zu beginnen, über das Leben meines Freundes in Erfahrung gebracht hatte, war dürftig genug: Wolfgang Bugenhagen war, soviel stand fest, schon als Kind häufig krank gewesen, er hatte studiert – wo, das vermochte Yvonne, der ich meine Nachricht verdankte, nicht zu sagen –, war viel herumgereist und endlich, nach einigen Jahren, die er als Journalist in seiner Vaterstadt verbracht hatte, nach Paris gekommen. Über Freunde und Verwandte hatte er offenbar nur selten und beiläufig gesprochen; lediglich seine Mutter war auch für Yvonne eine vertraute Gestalt, da Wolfgang ihr manchmal Bilder und Briefe von Clara Bugenhagen gezeigt hatte.
Die wichtige Rolle, die seine Mutter im Leben meines Freundes gespielt hat, überraschte mich nicht, da ich in seinem Nachlaß schon bald die Briefe entdeckte, die Clara ihrem Sohn nach Paris geschickt hatte.
Einstweilen schreckte ich noch davor zurück, die säuberlich gebündelten Umschläge zu öffnen; es war mir, als griffe ich in eine Beziehung ein, deren Kenntnis mir versagt bleiben sollte. Zum ersten Mal lernte ich die Qualen kennen, die der Kampf zwischen der Gewissenhaftigkeit des Forschers und dem Takt des Außenstehenden bereitet. Zunächst siegten Scheu und Zurückhaltung, aber später, gierig nach greifbaren Ergebnissen, wurde ich immer skrupelloser, drang ein, wo es mir beliebte, forschte und plünderte, wenn nur die geringste Aussicht bestand, weiterzukommen und dem Ziel ein Stück näherzurücken.
Damals packte ich die Briefe ungeöffnet in meinen Koffer und fuhr nach Hannover in den Feiertagen, die ich nicht recht genießen konnte, da meine Gedanken längst weitergeeilt waren und eine quälende Unruhe mich ergriffen hatte, am 30. Dezember des Jahres 1949 nach Hamburg. Schon am Morgen des Silvestertages machte ich mich auf den Weg, um in der Hartwicusstraße – die Adresse stand auf dem Absender von Claras Briefen – mit Wolfgangs Mutter zu sprechen.