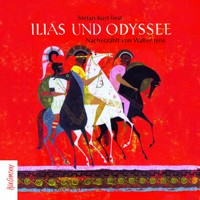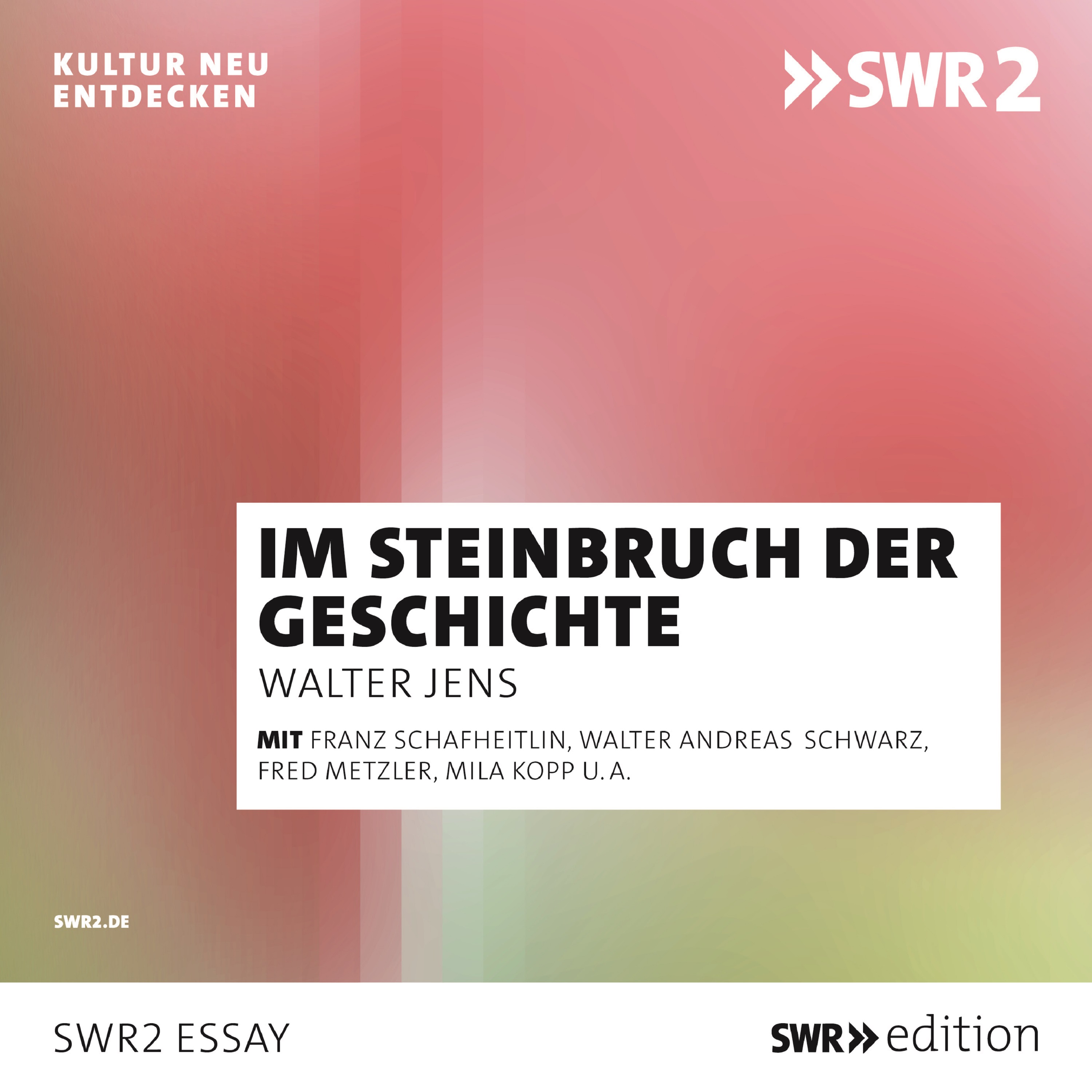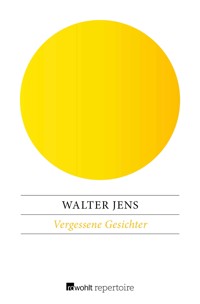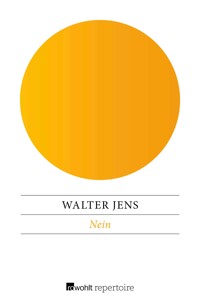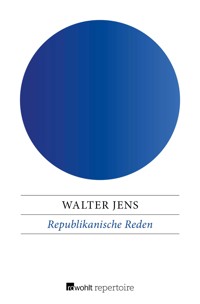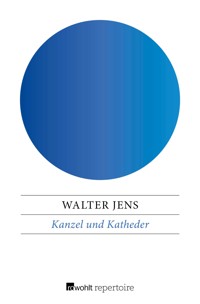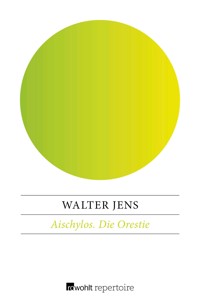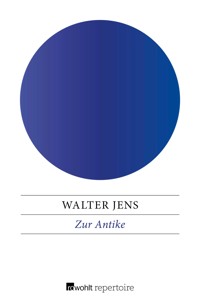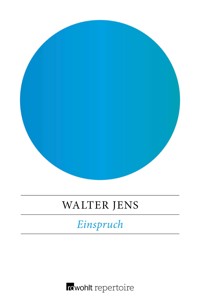
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die intellektuelle Vielseitigkeit des Schriftstellers, Philologen, Kritikers und Übersetzers Walter Jens spiegelt sich im Spektrum der Themen dieses Buches wider, das die besinnliche Gedenkrede ebenso umfaßt wie das psychologische Porträt, das leidenschaftliche Plädoyer gegen Krieg ebenso wie die kritische Auseinandersetzung mit literarischen Werken. Die hier versammelten zwanzig Reden sind brisante und unbequeme Gegenentwürfe zu den zunehmend vereinheitlichten Wahrnehmungs- und Deutungsmustern in unserer Gesellschaft. Sie verbinden eine kenntnisreiche Dokumentation und behutsame objektive Analyse historischer Fakten mit der radikalen und provokativen Stellungnahme des Autors, dessen Streitlust den Leser zu eigener, kritischer Auseinandersetzung herausfordern will. Ob Walter Jens über Büchner, Erasmus oder Lessing redet, über Richard Wagner oder Tucholsky, über Frisch, Schnitzler oder Freud, stets verfolgt er damit ein doppeltes Anliegen: Vor dem historischen Hintergrund erörtert er den kulturgeschichtlichen Rang der einzelnen Personen und fragt zugleich nach ihrer überzeitlichen, die Grenzen der jeweiligen Epoche überschreitenden Wirkung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Einspruch
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Über dieses Buch
Die intellektuelle Vielseitigkeit des Schriftstellers, Philologen, Kritikers und Übersetzers Walter Jens spiegelt sich im Spektrum der Themen dieses Buches wider, das die besinnliche Gedenkrede ebenso umfaßt wie das psychologische Porträt, das leidenschaftliche Plädoyer gegen Krieg ebenso wie die kritische Auseinandersetzung mit literarischen Werken.
Die hier versammelten zwanzig Reden sind brisante und unbequeme Gegenentwürfe zu den zunehmend vereinheitlichten Wahrnehmungs- und Deutungsmustern in unserer Gesellschaft. Sie verbinden eine kenntnisreiche Dokumentation und behutsame objektive Analyse historischer Fakten mit der radikalen und provokativen Stellungnahme des Autors, dessen Streitlust den Leser zu eigener, kritischer Auseinandersetzung herausfordern will.
Inhaltsübersicht
Vorwort
»Man stelle sich einen Arbeiter, etwa einen Dachdecker vor, der sich zum Krüppel gefallen hat und nun an der Straßenecke bettelnd sein Leben fristet. Man komme nun als Wundertäter und verspreche ihm, das krumme Bein gerade und gehfähig herzustellen. Ich meine, man darf sich nicht auf den Ausdruck besonderer Glückseligkeit in seiner Miene gefaßt machen. Gewiß fühlte er sich äußerst unglücklich, als er die Verletzung erlitt, merkte, er werde nie wieder arbeiten können und müsse verhungern oder von Almosen leben. Aber seither ist, was ihn zunächst erwerbslos machte, seine Einnahmequelle geworden; er lebt von seiner Krüppelhaftigkeit. Nimmt man ihm die, so macht man ihn vielleicht ganz hilflos; er hat sein Handwerk unterdessen vergessen, seine Arbeitsgewohnheiten verloren, hat sich an den Müßiggang, vielleicht auch ans Trinken gewöhnt.«
Ein unbekannter, auf einem Paradox aufgebauter, ebenso präzise wie poetisch strukturierter Text: anschaulich und durchdacht zugleich. Ein Kafka-Notat, aus den »Hochzeitsvorbereitungen« zum Beispiel? Oder ein Zeugnis aus der Werkstatt des frühen Musil: luzide durchkalkuliert, mit kleinen austriazensischen Saloppheiten? Keineswegs. Der Text stammt nicht von einem Schriftsteller, sondern von einem Arzt. Verfasser: Sigmund Freud. Quelle: »Bruchstück einer Hysterie-Analyse«.
Ich denke, die Geschichte vom verunglückten Dachdecker, die ein Glanzstück jeder Anthologie sein könnte, macht deutlich, wie entschieden dort Einspruch erhoben werden müßte, wo Literatur sich immer noch mit Belletristik verwechselt sieht. Als ob nicht wissenschaftliche Texte genauso »fiktional« sein könnten wie lyrische Etüden, als ob Bismarck, Mommsen und Freud nicht eher in eine Geschichte der deutschen Literatur gehörten als Scheffel oder Spielhagen.
Einspruch also – ein Einspruch unter vielen, die in den folgenden Reden dem Leser zur Beurteilung vorgetragen werden. Einspruch nicht zuletzt gegen die »Einschüchterung durch Klassizität« im Sinne Brechts: darum, wieder und wieder, der Versuch, Texte gleichsam gegen den Strich zu lesen, um derart Meister der Literatur in frischer neuer Beleuchtung erscheinen zu lassen. Erasmus – ein Pazifist, der nicht nur in lateinischem Ambiente gesehen werden will, in Bibliotheken und Druckereien, sondern ein Literat, der, gut lutherisch, auch dem Volk aufs Maul zu schauen verstand – ein witziger, alltäglicher Praxis vertrauter Mann und ein Polemiker dazu, der’s in seinen Satiren, Dialogen und Kolloquien mit der Poetenzunft jederzeit aufnehmen kann.
Und dann Lessing: der »gelehrte Landstörzer« – auch er nicht nur in der Klause, dem Theater (und am Spieltisch, natürlich) zu Hause, sondern auf den Straßen und Jahrmärkten seiner Zeit – im Bund mit einem höchst gemischten Publikum, verkrachten Existenzen, gelehrten Sonderlingen und jener species humani generis, die er, da sie so geistreich sei und überzeugend zu parlieren verstünde, den Hofbeamten, Professoren und geistlichen Hirten voranstellte: den Frauen.
Einspruch also um des Neufigurierens, der Hervorhebung bisher allzu beiläufig abgehandelter Stil- und Charaktereigenschaften willen: Büchner – ein Schriftsteller, der eher fürs Mitleid plädiert, für Erbarmen und Humanität, als für behende Gewalt; Tucholsky: als Gesprächspartner Fontanes zu sehen (in einem jener imaginären Dialoge, die ein bevorzugtes Stilelement dieses Buches sind); Mozart – im Pantheon der Poeten auftretend - ein genialer Stilist, unterwiesen in der Kunst geistreicher Brief-Verlautbarungen durch einen bis heute verkannten homme de lettres, Vater Leopold.
Schließlich Friedrich Dürrenmatt, dem ich, zusammen mit Kurt Marti, im Berner Münster das Totengeleit gegeben habe – kein »Vollblut-Dramatiker«, wie man ihn nennt, sondern ein Denk-Spieler, der in seinem Prosa-Spätwerk die Grenze zwischen Dichtung und Philosophie aufzuheben verstand, indem er beschrieb, wie Menschen denken, die zugleich als Kopernikaner und Ptolemäer zu leben versuchen.
Einspruch aber nicht nur, um die fixierte Beurteilung von Literaten in Frage zu stellen und so Fremdheit und Anderssein vermeintlicher Bekannter zu illustrieren, Einspruch auch gegen die Vernachlässigung von Phänomenen, die wortwörtlich lebensbestimmend sind: der Freude, zum Beispiel; und vor allem Einspruch gegen das Vorurteil, das besagt, die Beschreibung von Institutionen müsse notgedrungen fad, akademisch und trocken sein. Als ob das Portrait eines Theaters, eines Krankenhauses, eines Seminars nicht ebenso vielfältig, widersprüchlich, apart, abstoßend, lustig und tieftraurig ist, wie das Gesicht eines Menschen: Wie sah, um 1800, ein idealer Frauenarzt aus? Wie verlief der Lehrbetrieb einer Schule? Wie wurden Kranke versorgt, Seelenheilkundige unterwiesen, Menschen in ihrer Eigenart verstanden, auf den Stationen der Hospitäler? Ist die große Debatte über das Pavillon-System der Krankenhäuser wirklich langweiliger als die Erörterung von literarischen Strömungen oder als die Physiognomie eines Künstlers? Einspruch, in vielfacher Weise und auf vielen Gebieten, der – sonst wäre er langweilig und gäbe sich autoritär – selbstverständlich nach abermaliger Entgegnung verlangt und die Diskussion nicht beenden, sondern, aufs Offene der behandelten Phänomene verweisend, beginnen möchte – im Sinne Goethes, der Eckermann im März 1827 bedeutete: »Das Gleiche läßt uns in Ruhe; aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.«
Tübingen, im Juli 1992
Walter Jens
I. Personen
Erasmus von Rotterdam
Die Vision vom Frieden
»Jeder, der Christus verkündet, verkündet Frieden. Jeder, der den Krieg verkündet, verkündet denjenigen, der Christi Widersacher ist«: Nicht auf der Kanzel, sondern in der Gelehrtenstube, nicht von einem Prediger, sondern von einem Wissenschaftler wurde zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts die These vertreten, daß sich die Glaubwürdigkeit einer christlichen Gemeinschaft, der Kirche voran, nach der Konsequenz bemesse, mit der sie, in täglicher Praxis, in Amt und Geschäft, Jesus von Nazareth durch die Bewahrung des inneren und äußeren Friedens befördere: in klarem, die Tätigkeit leitenden Wissen, daß die Begriffe pax und Christus Synonyma seien.
»Mein Volk wird in der Schönheit des Friedens weilen«: Jesajas Prophetie war die Lebensmaxime eines Mannes, Erasmus von Rotterdam, der, so zaghaft, furchtsam, unentschieden, vorbehaltsreich und zaudernd er gewesen ist, in einem Punkt zumindest unbeirrt und beharrlich, ja couragiert bis zur Verwegenheit argumentiert hat: dann, wenn er als Pazifist gefordert war; wenn es galt, seine christozentrische Friedensliebe zu artikulieren; wenn es um den unverzichtbaren, auf Verwirklichung im Hier und Jetzt angelegten Geist der Bergpredigt ging; wenn der Satz beati pacifici einem Jahrhundert der Kriege, der Massenexekutionen und der mephistophelischen Gewalt in jederlei Form konfrontiert werden wollte.
Tota Christi philosophia dedocet bellum, Christi gesamte Lehre ist ein Appell gegen den Krieg: Diese Maxime bestimmt, leitmotivartig, Erasmus’ politisch-theologisches Schrifttum, von der Interpretation des Sprichworts dulce bellum inexpertis (»Schön ist der Krieg für jene, die ihn nicht kennen«) bis zu seinen späten Äußerungen über den Kampf gegen die Türken, von der »Erziehung eines christlichen Fürsten« bis zu jenen Debatten in den »Colloquia familiaria«, in denen er die Ruchlosigkeit der Europas Länder durchplündernden Soldateska allgemeiner Verachtung preisgibt; von der »Klage des Friedens, der von allen Nationen verbannt und niedergeschlagen wird«, seiner pazifistischen Hauptschrift, bis zu jenem von Resignation und Bekümmernis bestimmten Dialog, Charon, in dem der Totenferge, der sich angesichts der zu ihm kommenden Verstümmelten und Geschändeten darüber wundert, daß auf der Welt da oben überhaupt noch jemand am Leben sei, auf einen gewissen »Vielschreiber« verweist, der nicht aufhöre, »mit seiner Feder dem Krieg Abbruch zu tun und zum Frieden zu mahnen«.
Erasmus als einzig gewichtiger (und deshalb zu fürchtender) Widerpart jenes höllischen Fährmanns, der gerade dabei ist, sich einen tüchtigen Dreiruderer zu beschaffen, da sein altersmorscher und geflickter Kahn die Totenschübe nicht bewältigen könne: Die Phantasmagorie vom kleinen Männchen aus Holland, das tauben Ohren seine Friedenstöne vorbliese und dem Fergen im Tartaros, dessen Fähre für die Unmengen von Schatten längst zu klein geworden sei, enthält, bei allem kaustischen Witz und der Erasmus eigenen Selbstironie, ein Quentchen Wahrheit. Viele waren es nicht, die um 1520 sich jenem allerchristlichsten Aberwitz widersetzten, den Alastor, der Strafgott, im Dialog Charon seinem Partner erläutert: »Vögel gibt es, in schwarzweißen Mänteln, aschfarbenen Kutten, mit mancherlei Gefieder geschmückt« – Mönche als Höllenfurien und Todesgespenster –, »die weichen nicht von den Höfen der Fürsten, sie träufeln ihnen die Liebe zum Krieg ins Ohr und stacheln die Großen wie das Volk dazu auf. In ihren Predigten schreien sie, der Krieg sei gerecht, heilig und gottesgefällig. Und damit du dich noch mehr (mein lieber Charon) über den starken Geist dieser Leute wundern kannst: Sie schreien dasselbe bei beiden Parteien aus. In Frankreich predigen sie, Gott stehe auf seiten Frankreichs, wer Gott zum Schirmherrn habe, könne nicht unterliegen. In England und Spanien sagen sie, dieser Krieg werde nicht vom Kaiser geführt, sondern von Gott selbst.«
Daraufhin Charon: »Und das alles wird geglaubt?« Antwort des Strafgottes Alastor: »Was vermag nicht eine erheuchelte Religion? (Außerdem können die Mönche auf diese Weise) von den Sterbenden größeren Profit herausholen als von den Lebenden. Da gibt es Testamente, Seelenämter, Bullen … (kein Wunder also, daß) es ihnen im Heerlager besser gefällt als in ihren Zellen. Der Krieg macht manchen zum Bischof, für den im Frieden keiner einen roten Heller gegeben hätte.«
Ein Mann, ein Einzelner, Erasmus, führt Krieg gegen den Krieg, kämpft mit dem Schwert des Geistes gegen das Mordschwert und zerrt »fette Satrapen, Eisenfresser und Säbelraßler« samt deren geistlichem Gefolge vor den Richtstuhl jenes Christus pacificus, in dessen Namen er seine mit ebensoviel Frömmigkeit wie Aggressivität ausgetragene Bataille gegen den Bellizismus der Päpste, Kardinäle, Mönche, Theologen, Fürsten und dummen Hänse (jeglicher Nationalität) vorträgt, den Friedenskampf im Zeichen des geschundenen und gemarterten Herrn, dessen Lehre und Leben als Gegenbilder der auf Krieg, Kreuzzug und ideologische Pestilenz heruntergekommenen Macht-Kirche erscheinen.
Ein Vierteljahrhundert lang wird, in Lessings Sinn, die Religion Christi gegen die christliche Religion ausgespielt oder, mit Kierkegaard, die Friedensbotschaft des Christentums gegen die rabies militaria der Christenheit. Christus allein sei nachzueifern: IHM ganz und gar (Christus solus est totus imitandus); Christus, dem Ausgangs- und Zielpunkt jeglichen Lebens (Christus scopus totius vitae), dem Vorbild aller humanen Existenz; Christus, dessen gelebter Liebeskommunismus der von ihm vertretenen Theorie voraus gewesen sei: Glaube und Wort als der Tat nachgeordnete Elemente; Doktrin und Philosophie: Resultate (und nicht Voraussetzungen) einer Ethik der Frömmigkeit!
Nulla doctrina efficacior quam ipsius vita, kein Dogma ist wirkungsmächtiger als Jesu Leben. Dieser Satz, bezogen auf die Realität seiner Zeit, hat für Erasmus den Charakter eines Credos. Wie friedlich habe Christus gelebt und wie unfriedlich wir! Wie verpflichtend die Niedrigkeit Seines Daseins: eine humilitas sub specie pacis, die in ergreifender, hier nüchterner, dort dramatischer Rede zu beschwören Erasmus nicht müde wird; so wenn er in der Theologischen Methodenlehre den Schlafenden, Hungernden, rasch Ermüdeten, Seufzenden und Schmerz Empfindenden (»Im Garten ängstigt sich seine Seele bis zum Ausbruch blutigen Schweißes; am Kreuze dürstet er … er weint, als er die Stadt Jerusalem sieht, er weint auch am Grabe des Lazarus und ist in der Seele erschüttert«) mit dem Auferstandenen in der Glorie konfrontiert.
Und dann – ein geheimes, rührendes Selbstporträt – die Beschreibung des homo duplex und Proteus: Jesus, des Zwiespältigen, als eines alter ego des doppelgesichtigen Erasmus von Rotterdam. »Bisweilen flieht er, gleichsam von Ekel gepackt, die Menge; ein andermal wieder sucht er, von Mitleid gerührt, die Massen aus freiem Antrieb und duldet, daß man ihn umdrängt. Einmal zieht er sich zurück in die Abgeschiedenheit, um zu beten, dann wieder begibt er sich aus freien Stücken in das dichte Gedränge eines vollgestopften Tempels; anders spricht er zu seinen Jüngern, anders zur breiten Masse; schließlich zeigt er sich den Seinen von seiner Auferstehung an einmal in dieser, dann wieder in jener Gestalt. Nichts, scheint es, ist einfacher als unser Christus, und doch stellt er nach einem verborgenen Ratschluß in seiner Vielfalt des Lebens und der Lehre einen gewissen Proteus dar.«
Jesus – ein Spiegelbild des griechischen Meergotts; Jesus, ein Doppelwesen, das – beschrieben in dem Silenen-Gleichnis des Alkibiades – jenem am Schluß des platonischen Gastmahls beschriebenen Zwie-Menschen gleicht, der, wie Sokrates, äußerlich häßlich, innerlich aber reich an Kostbarkeiten ist. Abermals ein Selbstporträt – Erasmus, mit dem corpusculum, der, hofiert von den Größen Europas, ein Fürst im Reiche des Geists war. Erasmus, der Niedergeborene, evoziert den Silen aller Silene, das Kind im Stall mit den armen Eltern, den Freund der Zöllner und Fischer: »Aber in dieser Niederkeit – welche Größe! In dieser Armut – was für ein Reichtum! In diesen Qualen – welch ein Friedensglanz!«
Und dann, wiederum, die Umkehr! Der Vergleich des äußerlich Bescheidenen, innerlich Königlichen von einst mit den Robengeschmückten, Reichberingten, Purpurbereiften, deren Seelen leer und ärmlich seien. Er: der Arme, der den Liebeskommunismus predigte. Sie, seine Nachfolger: Majestäten, deren Zeichen nicht das Fischernetz, sondern der Beutel sei. Er: der Anwalt uneingeschränkter Gewaltlosigkeit. Sie: die Ideologen des »gerechten« Kriegs. »Der Bischof schämt sich nicht, sich im Feldlager aufzuhalten; dort ist das Kreuz; dort der Leib Christi, und mit höllischen Sakramenten vermengen sie die himmlischen, und auf blutige Auseinandersetzungen wenden sie die Symbole der höchsten Liebe an.«
Zeigt sich da wirklich, wie Erasmus seit Jahrhunderten vorgehalten wird, weltfremde Rigorosität? Ein Moralismus, der sich um Realitäten nicht schere? Hochfahrendes Idealisieren angeblich zeitübergreifender Normen aus dem sicheren Hort der Gelehrtenstuben und Bibliotheken? Erasmus – ein aus dem Mittelalter ins Jahrhundert Machiavellis verschlagener Mann: unfähig, den Geist der Moderne mitsamt beginnender Säkularisation, Völkerrecht und strikter Trennung von Politik und Moral zu verstehen? Ein Träumer, halb Literat, halb Theolog (Proteus, weder auf der Erde noch im Himmel zu Hause), der einerseits das Reich der Territorialstaaten mit dem Reich Christi verwechsele und, andererseits, was Cicero und die Stoa unter kosmischer Harmonie und Eintracht des Goldenen Zeitalters verstanden, mit der Volte des auf Synkretismen aller Art verpflichteten Versöhnungs- und Verschwisterungs-Künstlers ins staatskirchliche Zeitalter Karls V. und Heinrichs VIII. zu übertragen versuche?
Erasmus: ein Friedens-Utopist, der von Politik nichts verstand? So heißt es bis heute; so wird der Verteidiger des christozentrischen Pazifismus, der Zwist und Totschlag aus der für ihn einzig glaubwürdigen Sichtweise, der Perspektive des Feindesliebe lehrenden Christus, sah, auch von seinen Verteidigern genannt. Ein bißchen viel Ethik, hört man, zu viel Anthropozentrismus und zu wenig Theologie bei Erasmus; mehr Stoa als Christentum; viel von Eintracht und Frieden, Eloquenz und Humanität, aber wenig vom Kreuz; pax: als Quintessenz der evangelischen Botschaft – etwas dürftig, eher nach Vor-Aufklärung klingend (Lessing, hätte Johann Melchior Goeze gesagt, läßt schön grüßen) als genuin christlich. (Erasmus, schreibt Luther im September 1521 an Spalatin, »non ad crucem, sed ad pacem spectat in omnibus scriptis«).
Nur auf den Frieden, nicht aufs Kreuz: Welch ein Mißverständnis in Wittenberg! Als ob Erasmus seine Friedensvision nicht gerade aus der am Kreuz verbürgten Versöhnung zwischen Gott und den Menschen gewonnen hätte! Als ob das Gebot, Frieden zu halten, nicht durchs Sakrament der Eucharistie besiegelt und im Aufblick zum Kreuz für unübertretbar erklärt worden wäre! Als ob das Evangelium von der pax Christi nicht – theologia crucis – durch einen Rekurs auf die Märtyrer der präconstantinischen Kirche abzusichern sei: »Wir sind gekommen nach den Weisungen Jesu«, schreibt, Erasmus vordenkend, Origines, »um die geistigen Schwerter, mit denen wir unsere Meinungen verfochten und unsere Gegner angriffen, zusammenzuschlagen zu Pflugscharen, und die Speere, deren wir uns früher im Kampfe bedienten, umzuwandeln zu Sicheln. Denn wir ergreifen nicht mehr das Schwert gegen ein Volk, und wir lernen nicht mehr die Kriegskunst, da wir Kinder des Friedens geworden sind durch Jesus Christus, der unser Führer ist.«
Nein, nicht als Schwärmer, sondern als »ernster Christ« hat Erasmus, in Übereinstimmung mit den Geboten der alten Kirche, die einen Fahneneid nur auf Jesus Christus zuließ, aber nicht auf einen weltlichen Herrscher, die evangelische, von Jesus vorgelebte Vision einer die Freunde verpflichtenden und die Feinde staunenmachenden Liebes-Gemeinschaft, Schrift für Schrift, verteidigt, und zwar nüchtern und von Hellsicht erfüllt: immer bestrebt, die Welt des real existierenden Christentums auf dem Weg eines Vergleichs mit den Prämissen ihres Selbstverständnisses kenntlich zu machen. Durch die Eucharistie mit dem Leib Jesu verbunden, sind die Christen darangegangen, das Friedensangebot verleugnend, diesen Leib und damit sich selbst zu zerstückeln.
Jeder Krieg: eine Kreuzigung; jeder Anschlag auf die pax Christi ein Attentat auf deren Begründer. »Ist Jesu ganzes Leben«, heißt es in der »Querela pacis«, »etwas anderes als Unterweisung zu Eintracht und gegenseitiger Liebe? Was prägen (uns) seine Lehren, was seine Gleichnisse ein, wenn nicht Frieden, Versöhnung untereinander und Nächstenliebe? Verhieß, erfüllt vom göttlichen Geist, der Prophet Jesaja, das Kommen des Großen Versöhners: des Messias ankündigend, etwa einen Statthalter? Einen Städtezerstörer? Einen Krieger und Triumphator? Nein, all das nicht. Den Friedefürsten hat er verheißen.«
Idealistische Phantasterei, nochmals? Keineswegs. Vielmehr: Ernstnehmen der biblischen Botschaft. Der Realismus eines Christen, der weiß, daß er Maßstäbe einer christlichen praxis pietatis setzt, wenn er den Satz des »mystischen Zitherspielers«, Davids, des Psalmisten, zitiert: Im Frieden wurde dem Herrn sein Platz zuteil; wenn er auf die Engel als Boten des Friedens verweist; wenn er die Friedensstifter und Friedenstäter, Salomons Enkel, preist, wenn er, mit Jesus, die Segensformel »Friede Euch allen« den für einen Christen einzig würdigen Gruß nennt und, immer wieder, in dramatisch-appellativer Rede, die Worte wiederholt, die den kriegerischen Herren der Welt zum Gericht werden möchten: »Meinen Frieden gebe ich Euch, den Frieden lasse ich Euch.«
So betrachtet war Erasmus der erste Christ in der Neuzeit, der zeugnisgebend, konsequent und verläßlich Jesus als Inbegriff einer Friedensordnung beschrieb, in deren Zeichen sich der verhängnisvolle Gegensatz zwischen Christperson und Weltperson, innerem und äußerem Geschöpf, dem leidenden Frommen und dem handelnden Weltkind, dem Menschen »für sich« und dem Menschen »für andere«, dem Reinen und Feinen coram deo und der sündigen Kreatur coram mundo et civitate aufhob. Keiner hat die zumal vom Luthertum (aber auch vom politischen, auf Augustins Trennung zwischen civitas terrena und civitas dei pochenden Katholizismus) oft grobschlächtig zugespitzte Antithese von Gottesreich und Menschenstaat, vom Privatbezirk des Gesinnungsethikers und öffentlichem, durch Ämter regierten Feld der Verantwortungsethiker so heiter und fromm außer Kraft gesetzt wie jener Erasmus von Rotterdam, der, in Brief und Traktat, biblischer Text-Exegese, Dialog und Pamphlet, wieder und wieder betont hat, daß ein Christ in Glaube und Werken nichts anderes als (im Sinne der Bergpredigt-Preisung) ein Pazifist sein könne.
Beati pacifici: ein Gerichts-Wort für jene, die aus der jesuanischen Gemeinde einen Heerhaufen machten, Diener des Herrn in Krieger des Teufels verwandelten und statt der Mitra das Schwert, statt der Bibel den Schild, statt der Trompete der Evangelien die Posaune des Mars okkupierten.
»Mit welcherlei Waffen, o unsterblicher Gott, bewaffnet der Zorn die wehrlos geborenen Menschen? Mit Höllenmaschinen fallen Christen Christen an. Wer möchte glauben, daß Kanonen (bombardas) eine Erfindung des Menschen seien?« (Geschrieben mehr als vierhundert Jahre vor dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.)
Das ist Spott unter Tränen; eine Invektive, die, um der Verfremdung willen, dem Frieden in den Mund gelegt wurde – so wie sich das Lob der Torheit der alles regierenden stultitia souffliert sah –, weil für Erasmus dort Distanz am Platz war, wo die eigene Rede den Rahmen des Schicklichen gesprengt und das Pathos herzbewegender Trauerrede allzu unvermittelt ins Spiel gebracht hätte.
Der Autor der »Querela pacis« haßte die ungestüme Expektoration; Ausbrüche von Bekennertum und ungeschützter Konfession waren ihm zeitlebens zuwider, Grobianismus, auch wenn er sich fromm gab, erst recht … und trotzdem ist die Klage des vertriebenen Friedens auch als Rollenprosa noch von zermalmender Beredsamkeit: »Was willst du mit dem Kreuz, verruchter Soldat … Ich frage dich, wie betet (einer wie du) das ›Vaterunser‹? Du unverschämter Hund wagst es, ihn Vater zu nennen, der Du Deinen Bruder abzuschlachten wünschst? – ›Geheiligt werde Dein Name.‹ Wie kann der Name Gottes schlimmer entehrt werden (als durch den Krieg)? – ›Dein Reich komme.‹ So betest Du, der Du mit so viel Blutvergießen Deine Tyrannei begründest? – ›Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.‹ ER will Frieden, und Du rüstest zum Krieg? – Das tägliche Brot erbittest Du vom … Vater, der Du die Saatfelder verbrennst, und willst sie Dir lieber auch selber verderben, als jemandem den Nutzen gönnen? Und wovon sprichst Du jetzt …? – ›Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern‹, das sagst Du, der Du zum Brudermorde eilst?«
So zürnt und klagt, betet, flucht, beschwört und warnt der in den Zeugenstand gerufene Frieden, hinter dessen Maske Erasmus die These vertritt, daß, angesichts des verwüsteten Europa, selbst der schlechteste Friede immer noch dem schönsten Kriege vorzuziehen sei: Möge er sein, wie er wolle, der Krieg – das Volk bliebe auf der Strecke, wenn er regierte, und habe Grund, ihn zu hassen. Aber so zornig die Fluchrede gegen die Fürsten, die Schinder der Völker, und die mordbesessenen Soldaten auch gerät: Sarkastisch und in offenen Hohn übergehend gerät Erasmus’ Kampfansage erst dort, wo es um die eigenen, die Waffensegner, Kreuzessticker und ins Meßgewand gehüllten Heerführer geht. Man stelle sich vor: Da wird in der Schrift »Papst Julius vor der verschlossenen Himmelstür« (deren Autor zu sein, Erasmus übrigens abgestritten hat: er wußte warum) … da wird ein stinkendes und rülpsendes Ungeheuer – der gerade eben verstorbene Stellvertreter Christi – von Petrus als ein macht- und geldbesessener Belial zur Ordnung gerufen, ein leibhaftiger Antichrist, an dem gemessen Dostojewskis Großinquisitor nahezu wie ein pater seraphicus in einer Heiligen-Vita erscheint, ja sogar Luthers Antithese von Jesus und dem Papst zu Rom, weiß Gott ein saftiges Pamphlet, wird, mit Erasmus’ Attacke verglichen, zu einer fast betulichen Schrift.
Julius II., ein Militär, der mit einer Schar von Ermordeten und etlichen wertlosen Bullen anrückt, papistischen Dokumenten, sieht sich von Petrus (den er, Julius, zu exkommunizieren leider versäumte) kurzweg vor der Tür stehengelassen.
Papst: Mach endlich auf, sag’ ich!
Petrus: Erst nenn mir deine Verdienste.
Papst (versteht nicht): Verdienste?
Petrus: Hast du durch Kenntnis der heiligen Lehre geglänzt?
Papst: Dafür fehlte mir die Zeit. Ich war mit Kriegen beschäftigt.
Petrus: Hast du, durch ein heiliges Leben, Menschen für Christus gewonnen?
Schutzgeist des Papstes: Nein, für die Hölle.
Petrus: Hast du dich durch Wunder ausgezeichnet?
Papst: Je! Spricht der altmodisch!
Petrus: Hast du eifrig und mit reinem Herzen gebetet?
Papst (kopfschüttelnd): Über was für Schmarren sich der Mann ereifern kann.
Da redet, nicht absetzbar leider – zum Ärger des Erasmus, der die lebenslange Amtszeit von Päpsten für verhängnisvoll hielt … da redet ein Geschäftsmann und Militär aus Rom, der, sofern nur der Heilige Stuhl seine Besitzungen nicht verliert, selbst einen Weltbrand, angefacht durch die Machenschaften der Kirche, in Kauf nimmt: Armut, Nachtwachen, Schweiß, Prozesse, Kerker, Fesseln, Beschimpfungen, Schläge, das Kreuz, jesuanische und apostolische Martyrien – papperlapapp! »Ich sehe jetzt«, so Petrus’ Resümee, »daß ausgerechnet derjenige, der Christus am nächsten ist und daher gleich ihm eingeschätzt werden will, am tiefsten im Schmutz steckt, in Geld, Macht, Truppen und Kriegen … Bedachtest du denn nie, obwohl du doch der höchste Hirt der Kirche warst, wie sie entstanden ist …? Etwa durch Krieg und durch Geld? … Nein, durch Blut … Kerker und Peitschenschläge … Du aber sagst, die Kirche sei geschützt, weil die gesamte Welt für das Vermögen der Priester die schrecklichsten Kriege führt; du sagst, sie blühe, weil sie trunken ist von den Genüssen der Welt … Und mit diesen Begriffen hast du die Fürsten hinters Licht geführt, die, von dir belehrt, ihre Raubzüge und ihre gräßlichen Schlachten die ›Verteidigung Christi‹ nennen (Papst: ›Das habe ich noch nie gehört.‹).«
Erasmus von Rotterdam: ein friedlicher Mann mit einem Witz, der tödlich war. Wo Luther, das Breitschwert schwingend, seine Gegner zu Boden hieb, erledigte Erasmus die Kontrahenten mit einem Rapier. Er focht Florett – und traf genau dabei. Genau und schneller als Luther, der dort, wo Erasmus zur Sache kam (Petrus: »Jetzt wundere ich mich nicht mehr, warum so wenig Kirchenfürsten hierher kommen, wenn Unholde wie dieser Julius die Kirche regieren«), erst einmal in der Luft herumfuchtelte. Nicht so Erasmus, der auf Taubenfüßen, aber zielstrebig, daherkam, traurig, geduckt und entschlossen, wenn’s zum Gefecht ging. Ins Gefecht, zum ersten, um der Verteidigung des Friedens (also um der Wahrung der jesuanischen Gerechtsame) willen, und zum zweiten im Bund mit dem Volk, das Erasmus nie auf den ewigen Frieden vertröstete (so wie’s, im 19. Buch der civitas dei, Augustin tat), sondern dessen Glück und Wohlfahrt er allein durch das Ende aller Kriege im Hier und Jetzt gewährleistet sah. Deshalb die großen, in Beschwörungsform vorgetragenen Apotheosen der pax Christi in dieser Welt am Schluß der »Erziehung des christlichen Fürsten« und der »Klage des Friedens«: »Der größte Teil der Völker verwünscht den Krieg und betet um Frieden. Nur ganz wenige, deren verruchtes Glück vom allgemeinen Unglück abhängig ist, wünschen den Krieg. Darum bedenkt, (ihr Fürsten) was Versöhnung und Güte vermögen.«
Erasmus, ein Literat, Gelehrter, Theolog, der an die Macht des Wortes glaubte, an die Überzeugungsfähigkeit des Arguments und die Autorität, die den Besonnenen, Abwägenden, Gebildeten zukäme: Jawohl. Ein homme de lettres, der, von der pax Christi als dem Grundgesetz jeder gesitteten Sozietät träumend, für Aktualität in politicis hielt, was bestenfalls Potentialität war? Unbestreitbar, auch dies. Aber ein realitätsferner Gelehrter, der, bei Aldus Manutius in Venedig oder bei Froben in Basel, die Tagesaffären vergaß? Eben nicht! Erasmus kannte das europäische Kräfteverhältnis genau, durchschaute die Schwierigkeit burgundischer Friedenspolitik so gut wie die Kooperation zwischen Kurie und weltlichen Potentaten, er wußte, daß der Kampf gegen die Türken ein binneneuropäischer Interessenkonflikt war … und wenn er, nach dem Amtsantritt des irenischer als sein Vorgänger gesinnten Papstes, Leos X., nach dem Beginn einer von den jungen Monarchen bestimmten Ära und nach dem Friedensschluß zwischen England und Frankreich, anno 1514, für kurze Zeit von einer dauerhaften europäischen Friedensepoche träumte, so teilte er die Illusionen, zwischen 1514 und 1518: in der »utopischen Phase« (Heinz Holeczek), immerhin mit den ersten Geistern seines Jahrhunderts, Thomas Morus voran.
Nein, ein Moralist im Wolkenkuckucksheim war Erasmus gewiß nicht. Wie wenig, das beweisen zuallererst seine meist brieflich vorformulierten und dann zu mächtigen, freilich auch wiederholungsträchtigen und durch Selbstplagiate bestimmten Friedenstraktate. (Deren früheste, Encomium Pacis, Antipolemos, leider verschollen sind.) Pax als Leitidee einer Schriftsteller-Existenz; pax als religiös-politischer Zentralbegriff; pax als jesuanische Gegen-Vorstellung zu den auf strikte Trennung des politischen und ethischen Bereichs abzielenden Unternehmungen der Fürsten und Landsknechtstruppen; pax als äußerer, aber auch als Ich-Identität garantierender innerer Frieden – ein Seelen-Frieden, der die tranquillitas animi gewährleistet: Ist, gilt es zu fragen, pax in der europäischen Literatur jemals umfassender, in immer neuen Anläufen und Variationen, von einem einzelnen gedacht worden? Hat es, vor und nach Erasmus, eine Friedenskonzeption gegeben, in der sich, wie bei diesem Einen, klassisch-antiker und christlicher Pazifismus, jesuanische und humanistische Irenik, das Hinblicken auf die geeinte Kosmopolis, den waffenlosen, alle Nationalitäten transzendierenden Universalstaat und das Bedenken des inneren Friedens zu einer vergleichbaren Gesamt-Vorstellung verband?
Dabei sei nicht vergessen, daß Erasmus seine Visionen nicht, als seien sie naturgewachsen und spontan entwickelt, ohne Begleiter formulierte – im Gegenteil: Das sechzehnte Jahrhundert war nicht nur durch Kriege weltlicher und pseudo-geistlicher Art, durch Aufstände, Revolutionen und Metzeleien bestimmt (zwischen Bauern- und Türkenkrieg: ein Kampf aller gegen alle) – es war auch die hohe Zeit einer in kleinen Zirkeln entworfenen Friedenskultur, die sich in John Colets berühmter Karfreitagspredigt, gerichtet an die Adresse Heinrichs VIII., ebenso deutlich zu erkennen gab wie bei dem aufgeklärten Minoriten, Origenes-Leser und Vorsteher des Franziskanerklosters in St. Omer, Jean Vitrier.
Und dazu dann, ein Pazifist auch er, der spanische Erasmus-Freund Juan Luis Vives, mit den Traktaten de pacificatione und de concordia et discordia in humano genere. Dazu die Schar von Kombattanten für den Tag und die Stunde, die, humanistisch geschult und durch Erasmus’ Begriff der pax Christi zu ausgreifender Lektüre veranlaßt, bisher übersehene Friedenstendenzen bei Nikolaus von Cues oder Pico della Mirandola entdeckten. Da lernte einer vom anderen. Zwingli zum Beispiel, der sich Sätze aus dem erasmianischen Friedenskompendium ausschrieb und mit roter Tinte markierte, von dem Verfasser der »Querela pacis«, dem so Zwingli, »Psalm der evangelischen Eintracht«.
Und dann die Nachfolger, Sebastian Franck, mit dem »Kriegsbüchlein des Friedens«, Valentin Weigel, auch er ein Spiritualist, mit der Absage an den politischen Krieg; dazu die großen Mitstreiter, Paracelsus an der Spitze, der jede kriegerische Auseinandersetzung, die religiöse zuerst, als Absage an das 5. Gebot verstand: »Den Türken zu erschlagen … was ist das anders als vermessentliche Mörderei! Der Feind Christi soll erwürgt werden – und (der Würger) hat den Ablaß davon. Gewiß, das ist die Wahrheit: Der Feind Christi soll überwunden werden, aber mit der Lehr, nicht mit der Mörderei. Denn Gott hat nicht gemordet, er setzte sein Reich nicht in die Welt mit Cäsar, Nebukadnezar, Alexander, sondern er hieß seine Jünger das Wort Gottes verkündigen, aber nicht Feldschlachten tun. (Die Pfaffen jedoch) … heißen arme Leute gegen die Türken ziehn, sie aber bleiben sitzen und geben Ablaß aus«, wo es den Glauben zu verkünden gilt. Der Glaube! Würde der im Geiste Jesu gepredigt »von Bischöfen Pfaffen mit solchem Ernst wie sie den Wein aussaufen und auf Huren warten: Es gäbe schon lange keine Türken mehr«.
In einer Friedensbibliothek des sechzehnten Jahrhunderts wären Humanisten und Rechtgläubige, Vertreter des linken Flügels der Reformation und liberale Vertreter der alten Lehre, Spanier, Holländer, Engländer, Deutsche in gleicher Weise vertreten: an ihrer Spitze, neben Erasmus, der Mann, Thomas Morus, in dessen Schule der junge, in England Studien treibende Verfasser der »Antibarbari« die humaniora (wenn man so will, von Lukian bis hin zu Ficino und Pico della Mirandola) im Zeichen der docta pietas und pia doctrina einzusetzen lernte, wenn es gegen den Fanatismus religiöser Bellizisten in die Schlacht zu ziehen galt. (Die »Schlacht«: jawohl. Wie später Lessing, hatten Morus, Erasmus e tutti quanti ihre Freude daran, kriegerische Begriffe ins Humane umzufunktionieren: Das »Dölchlein eines christlichen Soldaten« ist … ein irenischer Traktat.)
In der Tat, die imaginäre Friedensbibliothek des 16. Jahrhunderts enthält nicht nur eine halb verschollene, nie zusammengestellte, überraschende und von der Emphase des christlichen Humanismus bestimmte, sondern dazu auch eine witzige Bücherei. Über den Frieden, zeigt sich, kann einer auch amüsant, aggressiv-lustig, doppelsinnig und entlarvend-heiter schreiben: so wie Thomas Morus, der in seiner »Utopia«, neben der »Querela pacis« der zweiten geheimen Gegenschrift zum »Principe« Machiavellis, von den Bewohnern seines Traumlandes sagt: »Den Krieg verabscheuen sie aufs äußerste als etwas schlechthin Bestialisches, das dennoch bei keiner Gattung von Raubtieren so gang und gäbe ist wie bei den Menschen. Und im Gegensatz zu der Gewohnheit fast aller Völker halten sie nichts für so unrühmlich wie den Krieg. Wenn sie sich daher auch beständig im Kriegshandwerk üben, und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen an bestimmten Tagen, um für den Notfall ausgebildet zu sein, so greifen sie doch nicht leichtherzig zu den Waffen, sondern nur dann, wenn es heißt, die Grenzen zu schützen oder die Feinde, die in das Gebiet ihrer Freunde eingedrungen sind, zu vertreiben, oder um aus Mitleid ein durch Tyrannei bedrücktes Volk zu befreien … (oder) wenn durch einen feindlichen Einfall das Hab und Gut ihrer Freunde geraubt wurde, (oder – dann handeln sie besonders hart –) wenn deren Kaufleute irgendwo ungerecht behandelt werden.« Ein Hohelied des Friedens, wie der Eingang der Passage – nur er freilich – nahezulegen scheint: Jawohl, aber ein hochironisches! Nicht Morus – dies hat eine faszinierende Interpretation von T.S. Dorsch deutlich gemacht –, nicht der Humanist, der bereit war, sich in einen Sack binden und hernach in die Themse werfen zu lassen, vorausgesetzt, durch diesen Suizid würde der europäische Frieden gerettet, nicht der Weise, sondern der Narr, der Unsinnsschwätzer Hythlodäus, hat im zweiten Teil der »Utopie« das Wort … und in der Tat, der bringt nun durcheinander, was immer zu verwechseln ist, läßt Friedens freunde ständig kämpfen, und das nicht etwa nur im eigenen Land; läßt sie Expeditionen ausrichten, Kolonialkriege führen, eine imperialistische Handelspolitik treiben, das Selbstbestimmungsrecht der Völker mißachten und, am Ende, sogar noch Mörder anwerben und Gelder auf die Köpfe ihrer Gegner aussetzen. Hat sich hier etwa ein Quäker in einen Tory verwandelt, ein Pazifist in einen General, dem nichts so verhaßt ist wie das appeasement? Wird der Friedensfreund ganz klammheimlich zum Weltpolizisten, der selbst die schlimmste Untat – Humanität nennt? »Stets sorgen sie dafür« – man höre und staune –, »daß sofort nach der Kriegserklärung an besonders auffallenden Stellen des feindlichen Landes Anschläge angebracht werden, auf denen sie dem gewaltige Belohnungen versprechen, der den gegnerischen Fürsten aus dem Felde räumt … Was sie für den Mörder bestimmt haben, verdoppeln sie für denjenigen, der einen von den Geächteten lebend zu ihnen bringt, und auch die Geächteten selbst hetzen sie durch die gleichen Belohnungen und dazu noch mit der Zusicherung der Straflosigkeit gegen ihre Genossen auf … Dieser Brauch, auf den Kopf eines Gegners einen Preis auszusetzen, wird bei anderen Völkern als abscheuliches Verhalten mißbilligt. Sie aber betrachten ihn als ebenso löblich wie klug …, ja sie halten sich sogar für menschlich und barmherzig, da sie mit dem Tode weniger Schuldiger das Leben zahlreicher Unschuldiger erkaufen.«
Ein Loblied zugunsten des Friedens: o ja – nur eben richtig zu lesen! Frieden, will Morus zeigen, wird nur dort gewahrt, wo die imperialistischen Machenschaften der mit (genialisch präfigurierten) CIA-, Fünfte-Kolonne- und ausgepichten Kalte-Kriegs-Methoden operierenden – und dabei von Menschlichkeit sprechenden – Utopier ein für allemal außer Kraft gesetzt werden.
»Lest meinen Text andersherum«, heißt Morus’ Devise, »lest ihn als ein Stück ironischer Zustimmung, hinter der sich tiefernste Abkehr verbirgt.«
Kein Zweifel, der Autor des »Lobs der Torheit« wird bei dem von lukianischem Witz erfüllten Abschnitt über die Friedens-(sprich kaltblütige Mord-)Politik der Utopier in die Hände geklatscht haben: nicht ohne hinzuzufügen, wie wir vermuten, daß Morus das Wechselspiel von Ernst und Scherz, offenem Bekenntnis und verdeckter Satire nicht immer konsequent in Szene gesetzt habe. (Allerdings wäre es hier Morus ein leichtes gewesen, den gleichen Fehler im »Lob der Torheit« zu finden, wo ebenfalls Autoren- und Personenprosa, auktoriale Verkündigung und Rollenprosa höchst unzureichend voneinander abgegrenzt waren.) Satz-für-Satz-Konsequenz war nicht gerade Erasmus’ besondere Force; wer ihm Widersprüche nachweisen möchte, hat leichtes Spiel: nicht zuletzt in der Frage des Pazifismus, wo gelegentlich eben doch einmal für den im großen und ganzen rigoros verdammten »gerechten Krieg« ein gutes Nebenwörtlein eingelegt wird, der Verteidigungskampf sich – als Begriff weit ausgelegt – ebenso gebilligt, wie der absolute Pazifismus sich, als Ketzerei, abgelehnt sieht.
Es gibt Passagen in Erasmus’ Werk, ein paar Seiten, mehr nicht, wo der Anwalt der pax Christi sich duckt und resigniert klein beizugeben scheint, dem Krieg zumindest conditionaliter das von Kirche und Gesellschaft Verlangte zubilligend. »Nicht völlig ist er zu verurteilen«, heißt es in der Paraphrase zur Johannis-Predigt – nicht völlig: das ist für Erasmus schon viel! –, »wenn er aus einem gerechten Grunde unternommen wird, das heißt zur Verteidigung der allgemeinen Ruhe, unter Umständen, die ihn unvermeidlich machen, wenn er durch gerecht denkende Fürsten begonnen wird und mit Zustimmung derjenigen, für die er geführt wird« – eine utopische Kondition! –, »wenn er nach der allgemein anerkannten Weise angekündigt und auf eine gerechte und gemäßigte Art geführt wird, so daß blutige Verluste und sonstiges Unrecht möglichst vermindert werden.«
Da wird Bedingung um Bedingung aufeinandergehäuft und, im sechzehnten Jahrhundert, eine Art von Haager Landkriegsordnung entworfen. Zugeständnisse an die herrschende Doktrin, die Lehre vom gerechten Krieg – aber mit einem Aufwand an Einschränkungen, daß der Leser zu dem Schluß kommen muß: Dann doch lieber gleich Frieden, und zwar sofort!
O ja, er redet, zumal in der ultissima consultatio de bello Turcis inferendo, 1530 an den Kölner Bürger Johannes Rinck adressiert, sehr wohl vom Verteidigungskrieg zumal gegen die Ungläubigen, Erasmus (vom bellum iustum weniger gern, bestenfalls in Frageform), lehnt Gegenwehr im Fall von Aggressionen nicht grundsätzlich ab – und hält dabei doch immer an der Meinung fest – der unumstößlichen –, daß, auch bei der Auseinandersetzung mit Heiden, das Reich Christi nicht auf eine Weise zu verteidigen sei, die seiner Entstehung, Ausbreitung und Festigung widerspreche: »Wenn es um die Sache des Glaubens geht, dann wird dieser Glaube durch das Leiden der Märtyrer und nicht durch Truppen vermehrt und verherrlicht. (Andernfalls) … könnte es eher geschehen, daß wir zu Türken entarten, als daß jene zu Christen werden.«
Nein, ein Renegat, wie oft behauptet wurde, ist Erasmus am Ende seines Lebens bestimmt nicht geworden; der heilige Krieg blieb ihm verhaßt, seine Türken-Schrift ist kein Kampfappell, sondern eine – im Unentschieden endende – Psalm-Meditation: Nur das Gebet, nur die Besinnung auf das Friedenswort Jesu, nur die Moral, nicht die Macht, nur das Vorbild einer einigen, im Geist ihres Gründers versammelten Christenheit werde die Türken überwinden. Besiegt durch Jesus Christus, könnten sie sich ihrer Niederlage freuen, weil sie mit der besseren Sache konfrontiert worden seien.
Der drohende Krieg – eine Mahnung zu Umkehr und Einkehr auf beiden Seiten: Dies war Erasmus’ letzter Gedanke. Sosehr ihn die Türken ängstigten – den Verrat der pax Christi und damit die Revolution seines Lebensprogramms fürchtete er mehr. Dieser Mann wußte, was Krieg war; er hatte, im Bund mit den Betroffenen, auf seinen Wanderungen rheinaufwärts, rheinabwärts die Ängste der Menschen erlebt; er kannte den Hochmut der Söldner (»Fleischer lehrt man Rinder töten; warum also unser Handwerk tadeln, die wir abgerichtet sind, Menschen zu schlachten?«); er durchschaute, wer, oben, am Krieg verdiente und wer, unten, auf der Strecke blieb, und er hörte niemals auf, in immer neuen Anläufen jene große Krieg-Frieden-Antithese zu entwickeln, die auf dem Gegensatz zwischen dem hilflosen, auf Geselligkeit, Kommunikation und Vernunft angewiesenen Menschen und der Inhumanität jener Kriege basiere, die nicht Handwerk, sondern Torheit seien: Elemente, die den auf Harmonie, Balance und Ausgleich, auf Versöhnung und die coincidentia oppositorum angelegten Kosmos am Ende zerstörten. Auf Frieden verwiesen, auf Gespräch und verständigen Austausch, sei der Mensch, gegen Gottes und seine eigenen Interessen handelnd, dabei, den Heilsplan der Schöpfung zu revozieren und das Feld, statt dem friedfertigen Jesus, seinen Gegenspielern, den Kriegs-Verbrechern, deren Mannschaft Erasmus in wahrhaft homerischen Katalogen aufführt, zu überlassen.
»Wenn ich der Frieden bin«, heißt es am Eingang der »Querela pacis«, »der von Göttern und Menschen gleichermaßen gepriesen wird, der Quell, der Erzeuger, der Erhalter, der Vermehrer, der Schützer aller Güter … wenn ohne mich nichts sicher, nichts rein, nichts heilig, nichts den Menschen angenehm und den Göttern wohlgefällig ist, (und) wenn im Gegensatz zu alledem ein einziger Krieg ein Ozean allen Unheils ist, das es jemals in der Natur geben kann, wenn durch seine Schuld plötzlich alle Blüten welken, alles, was gesammelt wurde, zerfällt, alles, was gefestigt ist, entgleitet, alles Wohlgegründete zugrunde geht … wenn nichts für die Menschen verhängnisvoller ist als ein einziger Krieg … wer würde glauben, daß es Menschen seien, daß sie auch nur einen Funken gesunder Vernunft haben, die sich mühen, mich … mit riesigen Kosten, großen Anstrengungen und ungeheuren Gewaltanwendungen zu vertreiben?«
Sobald er auf den Krieg zu sprechen kommt, wird der Meister der Ironie, der sanften Worte, der urbanen Plauderei und des sittigend-gefälligen Worts zum Buß- und Fluch-Prediger, einem Savonarola im Gehäus, den es beim Zornwort, das ihm nicht lag und zu pathetisch für seine moderate Natur war, freilich nie lange hielt: Nur ein kurzer Ausbruch, dann beginnt der Mann, der eben noch eiferte, wieder zu plaudern, beschwört, Europäer und Universalist, der er war, die Kosmopolis, wo jedermann einträchtig, ciceronisch, franziskanisch, benediktinisch mit dem anderen lebt, wo Seneca und Hieronymus, Sokrates und Christus einander freundlich begegnen, wo, folgern wir mit Erasmus, Montaigne zu Hause ist, Stefan Zweig, der Verfasser einer Erasmus-Biographie, und Thomas Mann, den es am Ende seines Lebens reizte, zum Helden seines opus ultimum den Bruder im Geiste aus Holland zu machen. (Er hätte es, wie die Tagebücher zeigen, nur zu gern getan; aber die Kräfte reichten nicht mehr; außerdem hatte die geplante Kontamination der beiden Weltbürger, Goethe und Erasmus, ihre Schwierigkeiten: »Visiere von weitem die neue Goethe-Arbeit. Erasmus’ Charakterbild irritiert mich oft durch Verwandtschaft … Sein Verhältnis zur Reformation ist durchaus goethisch. Sehr ähnlich ausweichend hätte der sich benommen.«)
Erasmus: eine sehr nahe, geliebte Figur in Thomas Manns Diarien – geschätzt als Zivilist und Plaudertalent, ein toleranter Mensch (mit Ausnahme des Antisemitismus, vor dem nun freilich auch Thomas Mann nicht gerade gefeit war). Die Übereinstimmung ist überzeugend, vor allem, wenn man bedenkt, daß der Causeur und Rollenspieler, Maskenträger und Proteus Erasmus ein homo duplex (wie Thomas Mann) auch, und vor allem deshalb war, weil er es verstand, ein Höchstmaß an Spiritualität – seine Visitenkarte in der Kosmopolis der Gelehrten – mit einem Maximum an Realismus zu vereinigen. Die Intensität, mit der er, im Gespräch mit John Colet, die Pathologie Jesu Christi beschrieb! Sein genialer Sinn für die Eigenart Dürerscher Imitations-Kunst! Und, vor allem, seine zumal in den »Colloquia familiaria« bewährte Kunst der Menschenbeschreibung: mürrische Gastwirte, leichte Mädchen mit dem Sinn fürs Höhere, dumme Geistliche und intelligente Frauen (das Gespräch zwischen dem Abt und der gebildeten Dame sollte zur Pflichtlektüre aller Emanzipierten utriusque generis gehören!), geschulte Fischhändler, Aristoteliker geradezu, raffinierte Gourmets, die im locus amoenus ihre saloppen Gespräche beginnen, Konversationen im Geiste Ciceros, Lorenzo Medicis und – Fontanes, und dann die abergläubischen Schiffbrüchigen, die unterhaltsamen Französinnen und, immer wieder, die bis zur Grobheit verschlossenen Deutschen: »Wenn man ankommt, begrüßt einen kein Mensch. Das halten sie für kriecherisch und unvereinbar mit deutscher Ernsthaftigkeit. Wenn du lange gerufen hast, steckt endlich einer den Kopf aus dem Fensterchen der Wärmstube – denn in diesen Stuben hausen sie fast bis zur Sommersonnwende –, es ist, als schöbe eine Schildkröte den Kopf aus ihrem Panzer hervor. Den muß man fragen, ob man übernachten kann. Winkt er nicht ab (denn sprechen tut er nicht), dann ist noch Platz.«
Wann, frage ich, wird man beginnen, den Lateinunterricht statt mit Cäsars »Gallischem Krieg« mit den »Colloquia familiaria« des Erasmus von Rotterdam zu beginnen: den Dialogen eines Manns, von dem zu lernen ist, wie mühelos sich Sanftmut mit Entschiedenheit, ein friedlicher Sinn mit Courage und Witz vereinigen läßt – da wird nicht gepoltert, aber auch nicht à part geflüstert, da teilt man, wohl dosiert (nicht jeder, so Erasmus’ Devise, verträgt die ungeschminkte Wahrheit ohne Einschränkung), gesprächsweise und vorläufig Sentenzen aus, deren Ziel es ist, das Humanitätspo3tential, mit dem Frieden im Mittelpunkt, zu vergrößern; nie trocken-magistral, nie gar zu feierlich, sondern immer in jenem mittleren, dem Ethos verbundenen Stil, der, einfach und elegant, mit Erasmus zu sprechen, weder »Geschmeide« noch »Lumpen« enthält.
Nur keine Spitzfindigkeiten, keine scholastischen Tüfteleien über Gott und die Gurke, wohl aber eine Manier, mit deren Hilfe, simpel und anmutig zugleich, jene concordia discors zu verteidigen war, die Erasmus als ein humanes Lebensprinzip unters Volk bringen wollte. Unters Volk, an dessen Unterweisung er mehr gedacht hat, als man gemeinhin annimmt. Lateinisch schreibend suchte er Lehrer für jene Bauern und Fischer, Mädchen und Schlingel aller Art zu gewinnen, deren Glück durch Fürsten und Päpste bedroht sei: Thesen, mit denen der Praktizist in der Gelehrtenklause am Ende der Zensur zum Opfer fiel. Friedensschriften – sie voran – indiziert; spanische und französische Übersetzungen der »Querela pacis« verboten; »Colloquia« und »Lob der Torheit« aus dem Handel gezogen; Bücher – und nicht nur Bücher, auch Verteidiger der erasmianischen Humanität – mit Brand und Feuer bedroht: »Dieser Autor gefällt uns nicht«, formulierte, in der Rolle eines Kardinalgroßinquisitors, Ignatius von Loyola. Kein Wunder also, daß die Orthodoxie, vertreten durch Papst Paul IV. – nachzulesen in Franz Heinrich Reuschs Kompendium »Der Index der verbotenen Bücher«, Kapitel »Erasmus im Index« –, den Verfasser antipapistischer Streitschriften in die erste Verbotsklasse reihte (zu seiner Ehre) und das Verdikt mit einem Zusatz versah, der weder Martin Luther noch Calvin zuteil geworden ist: »Zu indizieren mit allen seinen Commentaren, Anmerkungen, Scholien, Dialogen, Briefen, Censuren, Übersetzungen, Büchern und Schriften, auch wenn dieselben gar nichts gegen die Religion oder über die Religion enthalten.«
Wenn irgendwo, dann wird am Beispiel der erasmianischen Schriften und ihrer Wirkung die Stärke der Schwäche und die Macht der Behutsamkeit sichtbar. Dieser Mann wußte, wie wenig ein Wort, ein lateinischer Begriff wie pax Christi, in einer Welt bewirkt, die von Bombarden bestimmt wird. Aber er vertraute der Langzeitwirkung von Literatur – sprich: Theologie im Bund mit Rhetorik und Poesie – und hatte recht damit. War es ein Zufall, daß Bebel und Jaurès im November 1912 auf dem Kongreß der sozialistischen Internationale zu Basel, im Münster, nah dem Grab des Erasmus, versprachen, nie müde zu werden im Kampf gegen den Krieg? Ist es nicht vielmehr bezeichnend für die utopische, auf der Einheit von Realismus und Prophetie beruhende Kraft der erasmianischen Schriften – mit ihrem Autor zu reden: »der Bibliothek Christi« –, daß seine Thesen, von der totalen Naturbedrohung bis hin zur Gefahr der Selbstvernichtung unseres Planeten durch hybride Militärtechnizisten, heute im 20. Jahrhundert als handgreifliche Wahrheiten erscheinen? Antizipiert von einem Mann, der, mit seinem christozentrischen Pazifismus, eine bewußte und konsequente Friedenserziehung betrieb – am Rande der Resignation oft; aber gleichwohl, wie nach ihm Lessing, von der Überzeugung erfüllt, daß das Flämmchen der Aufklärung zumindest am Glimmen zu erhalten sei; fähig, in freundlicheren Zeiten neu zu erstrahlen.
Ein schwacher Mann? Nein. Ein mutiger Mensch: Einer, der, mit seinem Jesus pacificus vereint, nicht zögerte, um der Menschen willen auch der Kirche und deren geheiligten Lehren Paroli zu bieten: »(Ich weiß) …, die kirchlichen Vorschriften verwerfen nicht jeden Krieg. Auch Augustin billigt ihn irgendwo. Auch der heilige Bernhard lobt einige Soldaten. Aber Christus selbst … lehrt überall das Gegenteil.« Warum gilt (seine) Autorität bei uns so wenig, wo doch »die gesamte Lehre Christi gegen den Krieg gerichtet ist?« Warum halten wir an dem fest, was unsere Laster fördert, indem wir Jesu Botschaft »nicht zur Kenntnis nehmen«?
Geschrieben vor 470 Jahren – als ein Testament, dessen Verfügungen bis heute nicht akzeptiert worden sind. Erasmus, so scheint es, wartet darauf, mit frischem und unverstelltem Blick neu gelesen zu werden. Und nicht nur gelesen.
Wie hat er gesagt? »Die Speise für den Geist taugt erst dann, wenn sie nicht im Gedächtnis wie im Magen liegenbleibt, sondern (handlungsleitend) alle Regungen des Intellekts ergreift.«
Pax Christi: eine Devise frommer Vernunft, die zum wirklichkeitsgestaltenden Prinzip werden will – am gewissesten in Umkehrung der erasmianischen Titel: Laus pacis. Querela stultitiae. Lob des Friedens. Abgesang der Unvernunft.
Anmerkung
Der vorstehende Essay weiß sich vor allem folgenden Arbeiten über das Thema »Erasmus und der Friede« verpflichtet:
Robert P. Adams, The Better Part of Valor. More, Erasmus, Colet and Vives, on Humanism, War, and Peace, 1496–1535, Seattle/Wash. 1962.
Elise Constantinescu Bagdat, La »Querela Pacis« d’Erasme, Paris 1924
Roland H. Bainton, »The Querela Pacis of Erasmus, Classical and Christian Sources«, in: Archiv für Reformationsgeschichte, 42, 1951, S. 32–48.
T.S. Dorsch, Thomas Morus und Lukian, eine Interpretation der ›Utopia‹, in: Englische Literatur von Morus bis Sterne (Interpretationen 7), Frankfurt/M. 1970, S. 16–35.
Kurt Goldammer, »Friedensidee und Toleranzgedanke bei Paracelsus und den Spiritualisten«, in: Archiv für Reformationsgeschichte, 46, 1955, S. 20–46 und 47, 1956, S. 180–211.
Erasmus von Rotterdam. Ein Klag des Frydens. Leo Juds Übersetzung der »Querela pacis« von 1521 zusammen mit dem lateinischen Original, Hg. Alois M. Haas und Urs Herzog, Zürich 1969.
Otto Herding, Einleitung zur Querela pacis, in: Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. IV–2, Amsterdam/Oxford 1977.
Manfred Hoffmann, Erkenntnis und Verwirklichung der wahren Theologie nach Erasmus von Rotterdam, Tübingen 1972.
Heinz Holeczek, »Friedensrufer Erasmus«, in: Erasmus von Rotterdam, Vorkämpfer für Frieden und Toleranz. Ausstellung zum 450. Todestag des Erasmus von Rotterdam, veranstaltet vom Historischen Museum Basel, Basel 1986.
Guerre et Paix dans la pensée d’Erasme, Hg. Jean-Claude Margolin, Paris 1973.
Joachim Rogge, Zwingli und Erasmus. Der Friedensgedanke des jungen Zwingli, Berlin 1962.
Inés Thürlemann, Erasmus von Rotterdam und Joannes Ludovicus Vives als Pazifisten, Diss. Fribourg (Schweiz) 1932.
Siegfried Wollgast, Zur Friedensidee in der Reformationszeit. Texte von Erasmus, Paracelsus, Franck, Berlin 1968.
Gotthold Ephraim Lessing
Streit und Humanität
»Vor dem Lessingschen Schwerte zitterten alle. Kein Kopf war vor ihm sicher. Ja, manchen Schädel hat er sogar aus Übermut heruntergeschlagen, und dann war er dabei noch so boshaft, ihn vom Boden aufzuheben, und dem Publikum zu zeigen, daß er inwendig hohl war. Wen sein Schwert nicht erreichen konnte, den tötete er mit den Pfeilen seines Witzes. Die Freunde bewunderten die bunten Schwungfedern dieser Pfeile; die Feinde fühlten die Spitze in ihrem Herzen … Sein Witz war kein kleines französisches Windhündchen, das seinem eigenen Schatten nachläuft; sein Witz war vielmehr ein großer deutscher Kater, der mit der Maus spielt, ehe er sie würgt.« Ein martialisches Bild, fürwahr, das Heinrich Heine in seinem Traktat »Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland« vom zweiten großen Deutschen entwirft (der erste hieß Luther; den Namen des dritten, des großen Befreiers in »goldener Rüstung« und »purpurnem Kaisermantel«, unterschlug der Autor: Er war vorsichtig – und bescheiden).
Lessing, ein Kämpfer und Triumphator, der seine Gegner mit jenem tödlichen Witz niederstreckt, Lessing, ein Haudegen, dessen Sarkasmen eher biderber Lutherscher Polemik als französischer Belustigung folgten, dem »Enjouement«, der »Gaieté« und den »springenden Saillies«: Mit patriotischer Emphase sieht sich hier ein Mann apostrophiert, der dank der Solidität seines Stils (»gleich Quadersteinen ruhen die Sätze auf einander«) der Kritik und Polemik die Würde großer Kunst gegeben habe: den artistischen Glanz »heilsamer Geisterbewegung«, und der in solchem Tun, statt zu ermatten und am Ende, von Siegen erschöpft, aufzugeben, mit jedem Erfolg noch erstarkt sei. »Er glich«, läßt Heine, gewiß nicht ohne autobiographischen Nebensinn, sein Publikum wissen, »ganz jenem fabelhaften Normann, der die Talente, Kenntnisse und Kräfte derjenigen Männer erbte, die er im Zweikampf erschlug, und in dieser Weise endlich mit allen möglichen Vorzügen begabt war.«
Welch ein seltsames Schauspiel! Da spricht ein jüdischer Kosmopolit über einen zivilen Weltbürger in einer Weise, die eher triumphalistisch als urban anmutet: Kampf und Sieg für den einen, und für die anderen Tod und Verderben – das Eisen im Herzen und den deutschen Kater im Nacken.
Lessing, so scheint es, könnte gründlicher nicht mißverstanden sein (man sieht ihn vor sich, bei postumer Lektüre der Heineschen Sätze: wie er, erst geschmeichelt, dann verwundert und schließlich von purem Entsetzen erfüllt, das militärische Parlando seines alter ego verfolgt); aber schuldlos an der Pariser hommage, einem deutschen Donnerruf über den Rhein hinweg, der sich gegen die französisierende Putzsucht richtete, das geschmeidige Drechseln und Wechseln des Stils (»Daher in der Lessingschen Prosa so wenig von jenen Füllwörtern und Wendungskünsten, die wir bei unserem Periodenbau gleichsam als Mörtel gebrauchen. Noch viel weniger finden wir da jene Gedankenkaryatiden, welche ihr la belle phrase nennt«) … schuldlos an dieser hommage, die eine wahre Flut vergleichbarer Huldigungen einleiten sollte (Lessing der Deutsche, der Recke, der Gradausschreiter und, so von Herder bis Thomas Mann, der männliche Kämpfer), schuldlos ist der Polemiker von Berlin, Hamburg und Wolfenbüttel nicht an der Paradoxie, daß ausgerechnet ein Schriftsteller, der Inbegriff eines Zivilisten war (»o, Herr Major, so gar militairisch wollen wir es mit einander nicht nehmen«, sagt das Fräulein von Barnhelm zu ihrem Tellheim), bis zum heutigen Tag mit Attributen aus dem Bereich des Kriegswesens, der Belagerungstechnik und Zeugmeisterei etikettiert wird. (Ich nehme mich dabei nicht aus: »Feldzüge eines Redners«.)
Militaria in saecula saeculorum: So rächt sich die Nachwelt an einem Poeten, der nicht nur in seinen »Gesprächen für Freimaurer« die These vertrat, jede Sache, die Blut koste, sei gewiß kein Blut wert, und der gleichwohl nicht davon lassen mochte, seine Debatten und Diskurse, kritischen Gänge und komödiantisch zugespitzten Polemiken derart zu strukturieren, daß sie wie Zurüstungen, wie »Kriegserklärungen« aussahen, die einer unmittelbar bevorstehenden Schlacht galten: »Nächster Tage« – Brief an Bruder Karl, Wolfenbüttel, den 25. Februar 1778 – »sollst Du auch eine Schrift wider Goezen erhalten, gegen den ich mich schlechterdings in Positur gesetzt habe, daß er mir als einem Unchristen nicht ankommen kann. Doch das sind alles Scharmützel der leichten Truppen von meiner Hauptarmee. Die Hauptarmee rückt langsam vor, und das erste Treffen ist meine Neue Hypothese über die Evangelisten, als bloß menschliche Geschichtsschreiber betrachtet.«
Die Hauptarmee also – bestehend aus einer Hypothese: Da wird die Kampfmetapher gleichsam spiritualisiert, statt des Blutes fließt viel Tinte, die Scharmützel finden in Büchern statt, die Bollwerke sind Festungen des Glaubens, die Burg-Verteidiger erscheinen als orthodoxe Kämpen in der Rüstung des Glaubens (will heißen: ausgestattet mit Schilden aus Stroh), und die Attacken-Reiter gleichen Rittern, die ihre Sturmleitern ans Mauerwerk setzen (auch wenn sie schon etwas abgenutzt sind: »Was tut das? Heran kömmt, nicht wer die Leiter machte, sondern wer die Leiter besteigt; und einen behenden kühnen Mann trägt auch wohl eine morsche Leiter«).
Kriegs-Spielerei? Im Gegenteil! Übertragung des Militärischen ins Erzzivile; Transposition der Schlacht- und Kampfbilder in den Bereich der schönen Künste und, dies vor allem, der Theologie! Nicht in friderizianischen Bataillen, zeigt Lessing, sondern in den großen Auseinandersetzungen über Fundamentalismus und Liberalität, Glaubensstrenge und beseligende Toleranz, akademische Rigidität und humanes Sich-Umtun fallen jene Entscheidungen über die Humanität einer Epoche, denen einzelne Attacken, wie sie der Ungenannte vortrug, vorausarbeiteten: »Wahrlich, er soll noch erscheinen, auf beiden Seiten soll er erscheinen, der Mann« – so die »Gegensätze des Herausgebers« der Reimarus-Fragmente – »welcher die Religion so bestreitet, und der, welcher die Religion so verteidiget, als es die Wichtigkeit und Würde des Gegenstandes erfordert. Mit alle den Kenntnissen, aller der Wahrheitsliebe, alle dem Ernste! – Stürme auf einzelne Bastionen wagen und abschlagen heißt weder belagern noch entsetzen. Und gleichwohl ist bisher noch wenig mehr geschehen. Kein Feind hat noch die Feste ganz eingeschlossen; keiner noch einen allgemeinen Sturm auf ihre gesamten Werke zugleich gewagt. Immer ist nur irgend ein Außenwerk, und oft ein sehr unbeträchtliches angegriffen, aber auch nicht selten von den Belagerten mit mehr Hitze als Klugheit verteidiget worden. Denn ihre gewöhnliche Maxime war, alles Geschütz auf den einzigen angegriffenen Ort zusammenzuführen; unbekümmert, ob indes ein anderer Feind an einem anderen Ort den entblößten Wall übersteige oder nicht.«
Attacke? General-Angriff? (Im Bereich des Geistes wohlgemerkt: um Herzen zu gewinnen und nicht um Köpfe zu fällen!) Das Blasen zur großen Reveille? Anlegen der Leitern, der neuen und der schadhaft gewordenen alten (»denn in der belagerten Stadt waren auch Männer«, heißt es in der »Duplik«, »die zerschmetternde Felsstücke auf den Feind herabwarfen«). Aufstöbern der versteckten Winkel, in denen immer noch gehütet wird, was längst nicht mehr zu halten ist? Gewiß, gewiß. Aber eben auch die Gegen-Attacke! Auch die Verteidigung von seiten der Frommen, die eher der Religion Christi als der christlichen Religion vertrauen!
»Auf beiden Seiten soll er noch erscheinen, der Mann« – nicht nur auf einer! Der Polemiker Lessing – dies an Heines Adresse – war kein herrischer Erlediger, sondern ein Anwalt des offenen, von jeder Partei mit gleichen Ressourcen zu bestehenden Kampfs; ein Anwalt jener Streitkultur, die es, im Hinblick auf die Chancengleichheit aller Menschen, zu humanisieren gelte; ein Anwalt des freien, durch keine »machtgeschützte Innerlichkeit« im voraus entschiedenen Disputs; ein Anwalt von Fehden also, in denen das Argument alles und die vorab definierte Glaubenswahrheit nichts, die auctoritas der Streitenden viel und ihre potestas, der Schutz durch die Obrigkeit, die Priesterkaste oder die tonangebende, den Kulturkampf beherrschende Clique wenig galt.
»Sein Witz war ein großer deutscher Kater, der mit der Maus spielt, ehe er sie würgt«? Nichts falscher als das! Wenn Lessing etwas als verachtenswert galt, dann war es der Sieg – der Zufallserfolg auf militärischem oder gelehrtem Feld, dessen Zwiespältigkeit schon sehr früh, anno 1750, in den »Gedanken über die Herrnhuter« auf den Begriff gebracht wurde: Der Sieg – ein problematischer Beweis für die bessere Sache, im Krieg so gut wie in gelehrter Streiterei. Der Sieg: wie häufig ein Triumph des einen, »welcher Recht behält«, und wie selten ein Erfolg des andern, »welcher Recht behalten sollte«. Der Sieg: ein Zufallswurf. Ein bißchen Glück. Ein wenig Laune, die nicht zu berechnen sei: »Laßt den und jenen großen Gelehrten in einem Jahrhundert geboren werden, benehmt ihm die und jene Hülfsmittel, sich zu zeigen, gebt ihm andere Gegner, setzt ihn in ein ander Land; und ich zweifle, ob er derjenige bleiben würde, für den man ihn jetzo hält.«