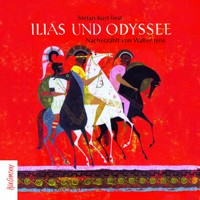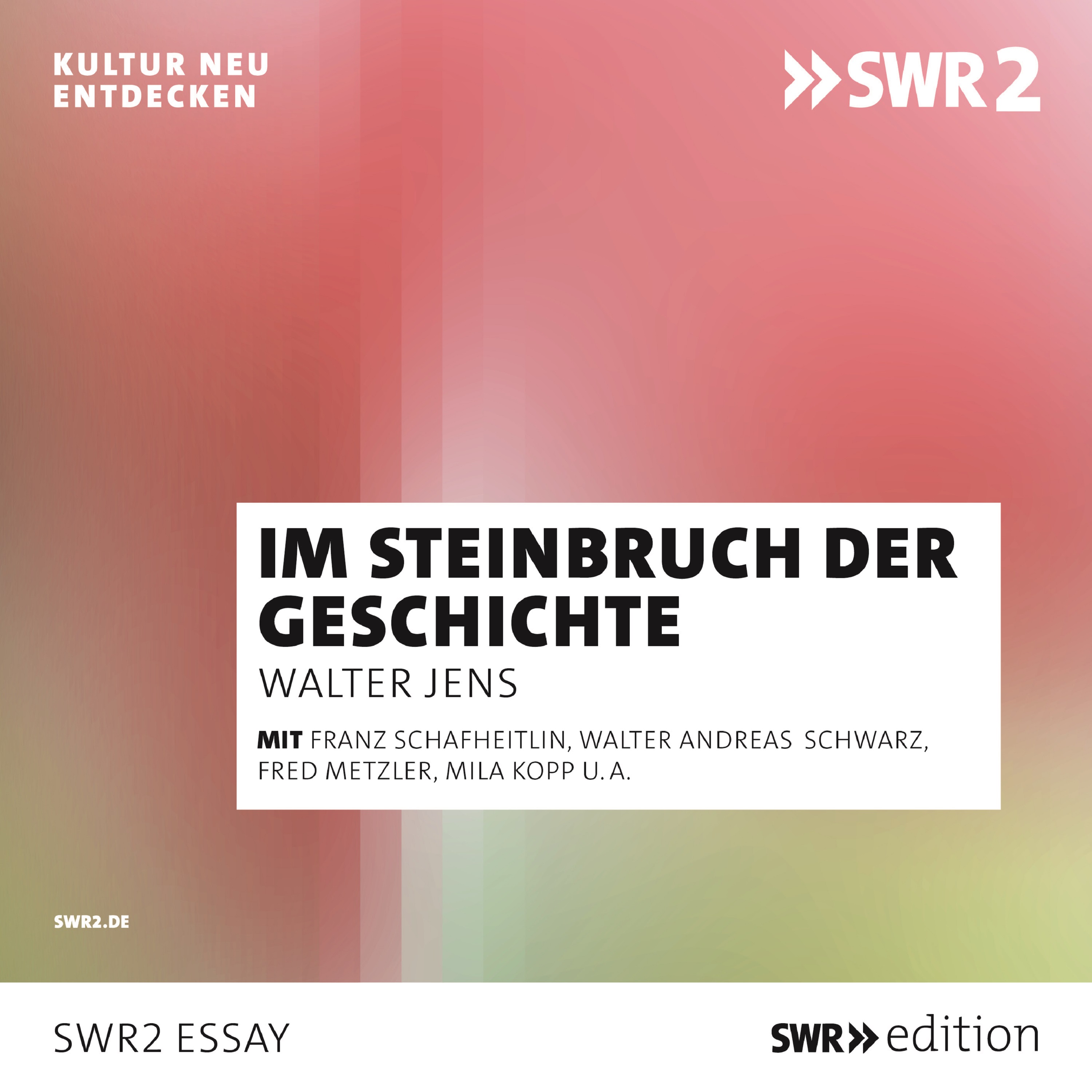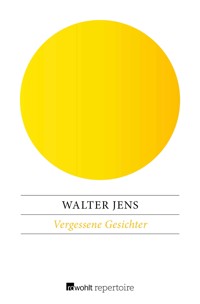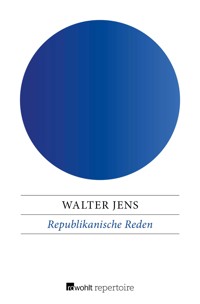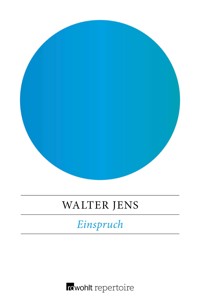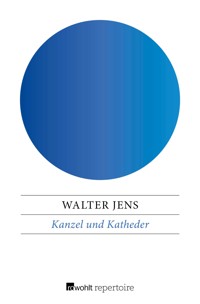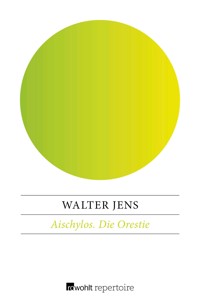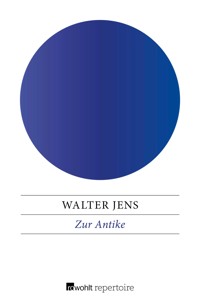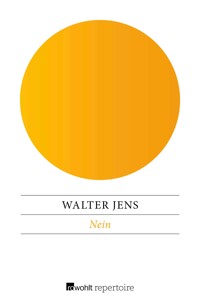
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Walter Jens schildert hier den Untergang des "letzten Individualisten" in einem totalitären Zukunftsstaat, in dem die Vermassung der Menschheit endgültig vollzogen ist. Dieser Zukunftsstaat ist – im Gegensatz zu Koestler – nicht politisch gemeint, sondern steht stellvertretend für eine in uns allen vorhandene bedrohliche Welt. Kälte und Klarheit des Gedanklichen vereinen sich mit einem Stil der Präzision, der alles Überflüssige unerbittlich ausmerzt, den Stoff aber mit schonungslosem Realismus anpackt. – Der Roman ist in vielen Sprachen erschienen und erlebte besonders in der französischen Ausgabe Aufsehen und hohe Auflagen. Die "Nouvelles Littéraires" Paris machten ihn zu ihrem "Livre de la Semaine", und eine von Emile Favre bearbeitete Bühnenfassung errang 1953 den Preis der "Amis de la Liberté".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Nein
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
HERBERT MHEZUM GEDÄCHTNIS
Dieses Buch richtet sich weder gegen eine bestimmte Person noch gegen eine bestimmte Macht. Das heißt nicht, daß es nicht wahr sei.
Erstes Buch Angeklagter
I
DER Wind war noch stärker geworden.
Die Straßen waren menschenleer.
Walter Sturm saß an seinem Schreibtisch.
Auch der Richter saß an seinem Schreibtisch und zündete sich gerade eine Zigarette an.
„Noch fünf Stunden, dann werde ich ihn sehen“, sagte der Richter. Außer ihm war niemand im großen weißgetäfelten Raum. Der Richter sah sich das Paßbild Walter Sturms an. Er löschte das Licht und ging zum Fenster. Er beugte sieh weit hinaus und starrte in die Tiefe des schmalen Hofes.
„Noch zwanzig vor ihm“, sagte der Richter.
Dann schloß er das Fenster, so leise er konnte.
Fünf Jahre nach dem letzten Kriege, den eine einzige, nun allgewaltige Macht überlebt hatte, zerstörten sie die Kirchen. Sieben Jahre nach dem Kriege begannen sie die ersten Universitäten zu schließen. Neun Jahre nach dem Kriege erließen sie das Gesetz über die Kunst, das die Dichter, Maler und Musiker zum Schweigen verdammte. Einige Neuauflagen alter Bücher wurden noch gemacht, einige alte Bilder hin und wieder gezeigt, einige Kompositionen hier und dort gespielt. Dann versickerte der Strom, und seit drei Jahren sprachen nur noch die Toten aus längst vergangenen Zeiten und die willfährigen Werkzeuge der Obrigkeit.
Ein Jahr nach dem Siege begannen die Prozesse. Es fing damit an, daß man den Autor des „Requiem auf die Gefallenen“, den großen Belhardy, hängte, und es schien mit dem Selbstmord der Zaranowa zu enden, deren Bilder kein Auge mehr sehen durfte.
Nur in dem kleinen Bergland lebten noch einige Gelehrte und Künstler. Aber seitdem am ersten November der Gouverneur Pakeley plötzlich von seinem Posten abberufen worden war, wußten sie dort, daß ihre Frist bald abgelaufen sein würde.
Sie waren die Letzten. Es waren zweiundzwanzig Jahre seit dem Ende des Krieges vergangen.
An diesem Abend liefen die Staatszüge ein. An diesem Abend erhielten die Letzten eine Vorladung vor die Inquisitionsbehörde; eine Vorladung in den Justizpalast. Die ersten mußten sich noch in der Nacht stellen, andere in den frühen Morgenstunden. Der Letzte war auf neun Uhr am nächsten Morgen bestellt. Der Name dieses Letzten war Walter Sturm.
Um sechzehn Uhr am Nachmittag hatte Walter Sturm von seiner Mutter erfahren, daß die Vorladung auf seinem Schreibtisch läge. Stundenlang verharrte er unschlüssig, mit geschlossenen Augen in seinem Zimmer. Dann verließ er das Haus und stieg in eine Straßenbahn ein. Ein Schaffner veranlaßte ihn, zum Hauptbahnhof zu fahren. Dort kam ihm ein Strom von Menschen entgegen. Es waren die Beamten, die aus den Staatszügen gestiegen waren. Sie erkannten ihn, aber er erkannte sie nicht. Später wollte er sich eine Bahnsteigkarte lösen. Aber es gab keine Bahnsteigkarten mehr. Er sprach lange mit dem Beamten hinter dem Schalter, wo er die Bahnsteigkarte hatte lösen wollen. Dann ging er nach Hause, setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb.
„Jetzt ist es zwei Uhr nachts. Der Wind draußen ist noch stärker geworden. Ich sitze allein an meinem Schreibtisch. Ein weißes Buch mit dreihundert leeren Seiten liegt vor mir. Karl-Heinz, der den Einband für dieses letzte Buch besorgen sollte, hat es mir gegeben. Das Buch wurde verboten, bevor es in den Druck ging. Und nun schreibe ich auf die leeren weißen Seiten. Dreihundert Seiten – – –, wieviele werde ich vollschreiben können? Es wäre gut, wenn es nur wenige Blätter würden.
Auf die linke Seite des Schreibtischs habe ich die Bücher gestellt, die ich geschrieben habe. Es ist entsetzlich, daß mein Leben nicht mehr war als diese wenigen Bücher. Wenn ich gewußt hätte, was mir bevorstünde, hätte ich keine einzige Zeile in meinem Leben geschrieben.
Nebenan in Mutters Zimmer scheint das Licht, das mich quält. Heute abend habe ich die Vorladung bekommen. An Walter Sturm – steht auf dem Umschlag. Nichts weiter als das. Kein Titel und auf der Rückseite keine Anrede. Sie haben mich schon abgeschrieben.
Nun führe ich also noch einmal in meinem Leben ein Tagebuch. Vor neunundzwanzig Jahren schloß ich das letzte ab; als Sechzehnjähriger. Ich muß heute racht noch darin lesen, wenn ich es kann. Jetzt, die letzten Blätter vor dem Ende. Niemand wird sie lesen. Ich kann also ganz ehrlich sein. Ich will jetzt aufzeichnen, was mir von heute an begegnet. Ich will schreiben, wie es gewesen ist. Ich will mich selbst vergessen.
Es ist zwei Uhr nachts. Ich habe noch sieben Stunden Zeit. Draußen weht der Wind; es ist kalt in meinem Zimmer, nebenan wacht meine Mutter, ich kann ihr nicht helfen. Ich kann ihr so wenig helfen wie vor zehn Stunden, als ich nach Hause kam.
„Du hast eine Vorladung bekommen“, sagte sie, als ich den Flur betrat. „Es wird das beste sein, wenn ich dich jetzt allein lasse.“
Ich wollte die Tür meines Zimmers öffnen; aber meine Hand blieb schwer auf der Klinke ruhn. Während ich die Tür betrachtete, fiel mir auf, daß der Lack auf der Mittelleiste kleine Risse hatte. Die Visitenkarte – Dr. Walter Sturm – war an den Rändern gelb und aufgewellt.
Da ich brennenden Durst verspürte, wollte ich mir aus der Küche noch ein Glas Wasser holen. Aber dann sagte ich mir, daß Mutter ganz umsonst beunruhigt würde, wenn ich noch einmal in die Küche ging. Es war ja möglich, daß sie hinter der Tür stand, erschrocken, daß ich immer noch nicht eingetreten war. Ja, es war sogar sehr wahrscheinlich, daß sie hinter der Tür stand und ungeduldig darauf wartete, daß ich endlich einträte. Ich wußte genau, daß jede Sekunde, die ich unschlüssig vor meiner Tür verbrachte, Mutters Unruhe vergrößern mußte. Ich hatte entsetzliche Angst, sie könnte jeden Augenblick die Tür öffnen und herauskommen. Dann würde sie fragen, fürchtete ich, was ich zur Vorladung meine, die ich doch noch gar nicht gelesen hatte. Denn niemals würde sie fragen, warum ich immer noch nicht eingetreten sei. Das konnte sie mir unmöglich zumuten: vielmehr wußte ich genau, sie würde fragen: „Nun, suchst du etwas? kann ich dir helfen? Aber leg doch erst einmal deinen Mantel ab, Walter!“ Dabei müßte sie genau wissen, daß ich ihre Lüge durchschaute, wenn sie mich dann nach der Vorladung fragen würde. Sie müßte sich natürlich völlig darüber im klaren sein: ich hätte längst erraten, daß sie die ganze Zeit hinter der Tür gelauscht hatte. Es war also ganz ausgeschlossen, daß ich die Kraft aufbringen würde, meine Mutter zu sehen oder gar ein Gespräch mit ihr zu beginnen.
Dennoch konnte ich mich nicht entschließen, mein Zimmer zu betreten und das sichere Todesurteil, das auf meinem Schreibtisch, auf der Schreibmappe liegen mußte, so durchzulesen und aufzunehmen, wie es der Schwere der Nachricht entsprochen hätte. Schon zu viele meiner Bekannten haben durch diese Karte Kunde von ihrem bevorstehenden Tode erhalten.
Obwohl ich Mutters ständig steigende Furcht spürte – ihr grauer Kopf würde sich an das Holz der Wohnungstür pressen, die Finger hielten die Klinke fest umspannt – und obschon ich fühlte, daß sie es dort unmöglich länger als wenige Sekunden aushalten würde, konnte ich es nicht unterlassen, mit dem Gedanken zu spielen, Mutter hätte mit ihren Worten eine andere Art von Vorladung bezeichnen wollen. Ich stemmte mich gegen den Rahmen meiner Zimmertür, ohne dabei den Blick von der Klinke des Wohnzimmers abzuwenden. Das geringste Senken des Drückers hätte mich zu jäher Flucht in mein Zimmer veranlaßt. Ich vergewisserte mich, daß der Riegel weit zurückgeschoben war. Schon wollte ich die Tür um einen winzigen Spalt öffnen, da fiel mir ein, daß Mutter es hören mußte, so leise ich auch ans Werk ging. Dann aber hätte sie neue Hoffnung geschöpft. Unmöglich konnte ich ihr zumuten, die Tür zu öffnen und dann doch nicht einzutreten. Ich wollte nicht zum Mörder meiner Mutter werden. Nein, mir blieb nichts anderes übrig, als unaufhörlich auf die Wohnungstür zu starren und zugleich bereit zu sein, mit einem einzigen Riesensatz in mein Zimmer hineinzuschnellen und die Tür hinter mir zuzuwerfen. Aber würde diese überstürzte Flucht Mutter nicht noch mehr verletzen, als wenn ich sie durch ein Öffnen der Tür hinterging?
Obwohl ich keine Antwort darauf fand, suchte ich mich noch einmal zu rechtfertigen. War nicht doch noch die Möglichkeit gegeben, daß ich mich irrte? Konnte es sich nicht doch um eine Vorladung zum Vormundschaftsgericht oder um eine Vorladung vor die Kulturpolizei handeln? Aber dann hätte Mutter nicht einfach gesagt: eine Vorladung; eine Vorladung, ohne jeden Zusatz – nein, das war eindeutig. Es konnte sich nur um eine Vorladung vor die Inquisitionsbehörde handeln.
Ich starrte auf die rostige Klinke der Wohnungstür. Ich glaubte sie zum erstenmal zu sehen. Ein kleines gehämmertes Stück Eisen, eine Klinke, die die Türen öffnet. Sie zuckt tief hinab und dann liegt sie wieder in der gleichgültigen Waagerechten. Es war also eine Vorladung vor die oberste Behörde. Aber ich fragte mich, warum Mutter so ruhig gewesen war, als sie mir die Nachricht mitteilte, vor wenigen Sekunden auf dem Flur. Vielleicht hatte sie sich ein wenig beruhigt. Der Postbote mußte schon vor einigen Stunden die Mittagspost gebracht haben. Aber über dieses Schreiben hätte sie sich nicht in wenigen Stunden beruhigt; und wußte ich, ob die Karte überhaupt mit der gewöhnlichen Post gebracht worden war? Je länger ich darüber nachgrübelte, desto unwahrscheinlicher erschien mir das. Wenn aber die Karte schon vor einigen Tagen gekommen war und Mutter sie bisher ängstlich verborgen gehalten hatte, bis jetzt, bis zum Abend vor dem Gericht; wenn sie tagelang gewartet hätte, bis zu dem Punkt, wo es kein Warten mehr gab?
Da stieß ich die Klinke hinunter. Ich öffnete die Tür, drückte sie ganz wenig nach innen. Dann schlüpfte ich in den schmalen dunklen Spalt hinein. Obwohl es vollkommen dunkel war, schloß ich die Augen. Jetzt weiß ich – – – nein, ich darf mich nicht verlieren. Ich muß so schreiben, wie es gewesen ist. Das ist das Letzte und Ehrlichste, was ich noch tun kann. Sonst gewinne ich niemals Klarheit.
Ich ließ die Tür langsam ins Schloß zurückgleiten. Kühl und feucht war die Klinke im Innern des Zimmers. Einen Schritt vom Türrahmen entfernt, lehnte ich mich an die Wand. Ich nahm den Hut vom Kopf und legte ihn behutsam auf den Schrank. Dann nahm ich den Shawl ab und tastete nach dem Kleiderhaken. Dort wand ich den Shawl mehrfach herum. Ich öffnete den Mantel und verschränkte die Hände auf dem Rücken. Von der Straße her drangen Motorengeräusche und aufgeregte Schreie von Straßenbahnen. Eine Lokomotive auf dem nahen Güterbahnhof fuhr fauchend an. In der Nähe lärmte Stimmengewirr und, plötzlich, tobendes Lachen.
Ich fühlte mich an der Wand, am Kleiderschrank, der kleinen Kommode, dem Sofa mit den zwei hohen Kissen entlang bis zum Fenster. Ich ließ die Rolläden langsam hinurtergleiten. Nach einigem Suchen fanden meine Finger die Gardinenschnüre. Die schweren Portieren glitten ineinander. Es wurde sehr still im Zimmer. Dann stellte ich mich wieder an meinen alten Platz neben der Tür. Mit geschlossenen Augen stand ich dort, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Es war mir, als habe man mich bereits verurteilt. Auf dem Schreibtisch lag die Vorladung. Morgen würde ich mich zu stellen haben. Es konnte keinen Zweifel mehr geben.
Unmöglich, alle Gedanken noch einmal zu denken, die in den Stunden über mich herfielen, als ich in meinem Zimmer stand. Lieber schweigen, als etwas hinzuzusetzen.
Ich wartete so lange, bis ich Mutters Schritte auf dem Korridor hörte. Sie verschloß die Haustür. Dann ging sie, wie immer, in die Küche, um nachzusehen, ob die Gashähne verschlossen waren. Ich hörte, wie sie sich vor meiner Tür herabbeugte. Sie seufzte; ein schmales schwaches Seufzen. Dann ging sie ins Wohnzimmer zurück. Ich wartete, bis sie das Licht gelöscht hatte. Dann tastete ich mich zum Schreibtisch, meine Finger glitten auf der blanken Platte herum. Ich steckte die Karte in meine Manteltasche. Ich schlich mich aus dem Zimmer und öffnete, so leise ich konnte, die Haustür. Ach, es wäre ehrlicher gewesen, wenn ich laut mit den Stiefeln geknarrt hätte. Natürlich schlief Mutter noch nicht. Natürlich wußte sie, daß ich die ganze Zeit über im Zimmer gestanden hatte, ohne zu wagen, das Licht anzuschalten. Aber ich konnte ihr nicht helfen.
Draußen war es noch kälter geworden. Obwohl nur ganz wenige Menschen unterwegs waren, neigte ich den Kopf tief zur Erde, um nicht von einem Nachbarn erkannt zu werden. Als ich in der Ferne eine Straßenbahn läuten hörte, begann ich schneller zu gehen. Aber an der Haltestelle stiegen nur ganz wenige Leute ein, viel weniger, als ich erwartet hatte. Ich bin ja seit Jahren nicht mehr so spät abends mit der Straßenbahn gefahren und hatte mir ein ganz falsches Bild gemacht, weil morgens, wenn ich zu meinen Nachhilfestunden fahre, immer sehr viele Leute einsteigen.
Da gerade eine Bahn aus der entgegengesetzten Richtung die Haltestelle erreichte, stieg ich schnell ein. Ich war auf dem hinteren Perron allein mit einem jüngeren Herrn mit einer Baskenmütze, der in einer Zeitung las und mich nicht weiter beachtete. Nach einiger Zeit kam der Schaffner. Er ging geradewegs auf mich zu und sah mich fragend an.
„Sie wollen zum Hauptbahnhof?“ sagte der Schaffner.
Ich blickte verwundert auf, dann sagte ich – – – ja, so begann ich das seltsame Gespräch, von dem ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich habe mich wieder unterbrochen, es soll das letztemal sein.
„Wie kommen Sie darauf, daß ich zum Hauptbahnhof will?“ sagte ich. „Ich habe doch gar kein Gepäck bei mir.“
Der Schaffner lachte. „Das Gepäck macht es nicht. Wenn man so lange im Dienst ist wie ich, bekommt man allmählich einen Blick dafür, wohin die Leute wollen. Morgens ist das sehr leicht zu erkennen. Dann fahren sie alle zur Arbeit. Darum sind die Morgentouren für Leute meines Schlages auch immer die langweiligsten. Auch nachmittags, wenn die Kinder der hohen Beamten hier herumsitzen, ist es keine Kunst festzustellen, wohin sie fahren wollen. Aber nachts. Um diese Zeit, da muß man schon sehr lange dabei gewesen sein, um den Leuten das Reiseziel anzusehen.“
„Sie sind also zufrieden mit Ihrem Beruf?“ fragte ich.
„Wie sollte ich nicht?“ sagte der Schaffner. „Man muß nur das richtige Auge haben. Allerdings, bei Ihnen ist es nicht schwer festzustellen, wohin Sie wollen.“
„Aber ich muß Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, daß ich ja gar kein Gepäck bei mir habe.“
„Sie verstehen mich nicht“, sagte der Schaffner. „Offenbar haben Sie sich bisher wenig Gedanken gemacht über mich und meinesgleichen.“
„Aber ich will wirklich nicht zum Hauptbahnhof!“
Der Schaffner trat ganz nahe auf mich zu. „Sie vergessen vollständig, daß Sie ja nicht deshalb zum Hauptbahnhof zu fahren brauchen, um zu verreisen. Sie könnten ja auch jemanden abholen wollen. Oder Sie könnten zum Hauptbahnhof fahren, um die Züge abfahren und ankommen zu sehen. Und um in die Gesichter zu sehen, die aus den Wagen klettern. Sind Sie nicht ganz anders als die, die einem täglich auf der Straße begegnen? Man hat ein gutes Auge dafür, wenn man Schaffner ist wie ich. Sie könnten auch zum Hauptbahnhof fahren, weil Ihnen nichts Besseres einfällt und Sie nicht wissen, wohin Sie sollen. Das ist freilich unwahrscheinlich, denn Sie haben ja einen Beruf. Sehen Sie, so viele Möglichkeiten gibt es, und da wollen Sie mir einreden, es sei unwahrscheinlich, daß Sie zum Hauptbahnhof wollen?“
„Keinesfalls habe ich behauptet, es sei unwahrscheinlich, daß ich zum Hauptbahnhof will“, wagte ich zu entgegnen, ärgerlich, daß er mich in die Enge getrieben hatte. „Außerdem muß ich hier aussteigen.“
„Wohin wollen Sie denn, wenn ich fragen darf?“
Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. „Das dürfte Sie wirklich nichts angehen. Ich habe nicht die geringste Lust, mich mit einem Straßenbahnschaffner in ein Gespräch über mein Reiseziel einzulassen. Es mag ja verständlich sein, daß Sie nach einem so langen Tag Lust haben, mit einem Fahrgast zu plaudern, aber gerade dazu dürfte ich kaum die geeignete Persönlichkeit sein. Unterhalten Sie sich doch mit dem Herrn hier.“
Entrüstet wies ich auf den jungen Mann zu meiner Linken, der noch immer, anscheinend ganz unbeteiligt, in einer Zeitung las.
Der Schaffner zuckte mit den Achseln.
„Diesen Herrn kenne ich zu genau, als daß ich mich noch mit ihm zu unterhalten brauchte. Wir wechseln kaum mehr als einige belanglose Worte. Der Herr ist Nachtredakteur bei einer Zeitung, deren Namen ich vergessen habe. Es ist ja auch ganz unwichtig. Aber – – soll ich abklingeln? Sonst steigt hier nämlich niemand aus.“
„Dann bleibe ich natürlich auch“, sagte ich.
„Ich wußte es vorher“, sagte der Schaffner.
„Sie wollen also damit sagen, daß ich es nicht fertigbrächte, hier auszusteigen?“ Wieder wurde ich ärgerlich. „Bitte klingeln Sie sofort ab!“
Der Schaffner, ein älterer Mann mit einer randlosen, starkgeschliffenen Brille zupfte mich behutsam am Ärmel.
„Aber, aber“, sagte er. „Warum wollen wir uns denn wegen so einer Lappalie erzürnen? Meinen Sie denn wirklich, ich könnte es mit ansehen, daß Sie jetzt aussteigen, um dann doch in die nächste Straßenbahn zu steigen, die zum Hauptbahnhof fährt? Bedenken Sie doch, wie Sie auf diese Weise ganz unnötig eine Viertelstunde verlieren! Haben Sie so viel Zeit?“
„Natürlich nicht. Im Gegenteil, ich habe es sogar sehr eilig.“
„Danach sehen Sie nun auch wieder nicht aus“, sagte der Schaffner. „Sonst wären Sie niemals auf den Gedanken gekommen, hier auszusteigen. Ich maße mir nicht an, Sie erst darauf aufmerksam gemacht zu haben, wie wenig Zeit Sie in Wirklichkeit hätten. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte für einen Augenblick. Ich muß mein Fahrtbuch überprüfen. Ich werde nämlich gleich abgelöst.“
Der Schaffner machte eine kleine Verbeugung. Ja, es schien mir, als lächle er mir im gleichen Augenblick, da er sich abwandte, spöttisch zu. Auch der Redakteur sah sekundenlang auf. Dann verglich der Schaffner seine Fahrscheinhefte mit dem Fahrtbuch und trug mit erstaunlicher Gewandtheit Zahlen in die vielfach unterteilten Rubriken seines Fahrtbuches ein. Die Bahn fuhr sehr schnell; ich kann mich nicht entsinnen, daß sie überhaupt ein einziges Mal gehalten hat, seitdem ich eingestiegen war; nein, natürlich, sie hat vor dem Hauptbahnhof überhaupt nicht gehalten.
Ich sah dann aus dem Fenster. Draußen flammten Lichtzeichen auf und ab, Bänder und Kreise in tausend Farben. Taghelle Buchstaben machten Reklame auf den Dächern der Hochhäuser. Aus den Versammlungslokalen drangen lärmende Stimmen. Die Bahn mußte längst die Innenstadt erreicht haben. Ich war sehr ärgerlich, überhaupt mit der Straßenbahn gefahren zu sein. Wäre es nicht viel richtiger gewesen, ich hätte meinen Weg zu Fuß gemacht? Dann hätte ich in Ruhe meine wirren Gedanken ordnen und mir am Ende vielleicht doch etwas Klarheit verschaffen können. Jetzt aber konnte ich es unmöglich wagen, die Karte zu lesen, um aus ihr Ort und Zeit der Vorladung zu entnehmen. Denn wenn ich auch allzugenau wußte, was die Karte enthielt; so war dennoch der eigentliche Grund meines Ausgangs gewesen: wie immer, bei einem Spaziergang, Klarheit zu gewinnen, um endlich die Karte lesen zu können. Statt dessen hatte ich mich mit einem Schaffner in ein Gespräch eingelassen, der mich dazu noch beschwatzt hatte, zum Hauptbahnhof zu fahren, woran mir doch nicht das Geringste liegen konnte. Tief erschrocken stellte ich fest, daß ich schon jetzt, sieben Stunden, nachdem ich die Vorladung erhalten hatte, nicht mehr Herr meiner selbst war. Vielleicht träumte ich alles nur. Wirklich, ich glaubte, ich hätte richtiger gehandelt, wenn ich zu Hause geblieben wäre, statt Mutter in neue Unruhe zu versetzen.
Es war höchste Zeit auszusteigen, um wenigstens noch ein Stück bis zum Hauptbahnhof gehen zu können.
„Bitte klingeln Sie ab, Herr Schaffner!“
„Sie haben noch Zeit, mein Herr. Wir haben gerade – jetzt – die Landshauser Straße passiert. Sie sehen also, es ist bereits zu spät zum Aussteigen. Wenn Sie sich natürlich etwas eher an mich gewandt hätten, wäre das Aussteigen auch hier möglich gewesen. Ich hätte Ihnen allerdings abgeraten, noch so kurz vor dem Hauptbahnhof die Bahn zu verlassen.“
Der Schaffner lächelte.
„Es begleiten einen ja nicht die angenehmsten Vorstellungen, wenn man so handelt, wie Sie es eben ganz ernsthaft vorhatten. Teils ärgert man sich, daß man nicht eher ausgestiegen ist, teils ist man unwillig, nun, wo es ohnehin zu spät ist, nicht wenigstens ganz bis zum Ziel gefahren zu sein. Kurz, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe das zu oft bei meinen Fahrgästen erlebt.“
Ich bemühte mich, dem Blick des Schaffners auszuweichen und gar nicht auf seine lange belehrende Rede einzugehen.
„Derlei Gründe sind müßig, da wir ja die Haltestelle längst passiert haben“, sagte ich nur. „Bitte klingeln Sie an der nächsten rechtzeitig ab. Bei Ihren sonderbaren Reden vergeht die Zeit so schnell, daß man eben erst eingestiegen zu sein glaubt, während man in Wahrheit schon an der Endstation ist.“
Ich versuchte zu lachen, während der Schaffner sich, plötzlich, tief verbeugte: „Das kann schon sein.“ Und dann:
„Sie wollen also wirklich hier aussteigen?“
„Natürlich. Oder bin ich hier nicht am Hauptbahnhof?“
Der Schaffner malte mit seinem Zeigefinger Kreise auf die beschlagene Scheibe.
„Doch, doch, am Hauptbahnhof, wohin Sie ja wollen, wie ich Ihnen gleich gesagt habe. Aber ich will mich nicht damit brüsten, daß ich mit meiner Vermutung recht gehabt habe. Es war ja eigentlich selbstverständlich, nicht wahr? Schließlich verstehe ich etwas von meinem Beruf. Außerdem war es gerade Ihre Gegenrede, die eine so interessante Unterhaltung zwischen uns überhaupt erst ermöglichte. Ich habe Ihnen also nur zu danken.“
Der Schaffner sah mich an. „Seien Sie versichert, daß es lediglich dieses Gefühl des Dankes ist, das mich fragen läßt, ob Sie nicht doch noch eine Haltestelle weiter fahren und dann durch den Südeingang den Hauptbahnhof erreichen wollen? Dann könnte ich Sie begleiten. Ich will nämlich auch zum Hauptbahnhof.“
„Aber dann können Sie doch genau so gut mit mir gemeinsam aussteigen.“ Ich wollte endlich zu einem geeigneten und für mich nicht ganz ungünstigen Abschluß des Gespräches kommen.
„Sind Sie des Teufels?“ rief der Schaffner. Er hörte auf, Kreise auf die ohnehin schon ganz glattgewischte Scheibe zu malen, und stemmte den linken Arm in die Hüfte. „Mann, ich bin doch Schaffner. Ich kann doch nicht einfach den Wagen verlassen, wann es mir gefällt. Wohin kämen wir denn da? Bitte überlegen Sie doch einmal, wohin kämen wir, wenn jeder Schaffner den Wagen dort verläßt, wo es ihm paßt? Bedenken Sie, es braucht ja nichts weiter zu geschehen, als daß es eines Tages plötzlich den Schaffnern gefiele, den Wagen an einem ihnen genehmen Punkt zu verlassen. Das genügte, jawohl, das genügte, mein Freund, um jegliche Ordnung und alles geregelte Leben vollständig aus dem Gleise zu werfen.“
Er hatte sich in Erregung geredet, fuchtelte wild mit den Armen, und erst als ich ihn an der Schulter faßte und nach draußen ins Dunkel hinein deutete, kam er wieder zu sich.
„Natürlich, Sie wollen hier aussteigen. Verzeihen Sie, daß ich mich einen Augenblick vergaß. Ja, ich werde abklingeln. Sie wollen also wirklich nicht bis zur nächsten Haltestelle fahren? Dort werde ich doch abgelöst.“
Ich schüttelte den Kopf. So sehr es mich reizte, die Worte des Schaffners zu überprüfen und, wenn es ging, sogar mit seinem Kollegen einige Worte über diesen sonderbaren Alten zu wechseln, so sehr mußte ich fürchten, daß ich den Schaffner am Abend nicht mehr abweisen könnte, wenn ich jetzt seine Begleitung annahm. Was sollte ich sagen, wenn er mich etwa noch in eine Wirtschaft einlüde oder mich gar zu sich nach Hause bäte? Nein, wenn ich jetzt zusagte, dann würde ich nie mehr in die Stimmung kommen, in der allein ich die Karte in Ruhe lesen konnte. Es war höchste Zeit auszusteigen.
„Ich muß hier aussteigen“, sagte ich. Im selben Augenblick verlangsamte die Bahn ihre Schnelligkeit. Was wollte der Schaffner überhaupt auf dem Bahnhof?
„Ich fahre meistens mit der 31. Bestimmt treffen Sie mich immer um diese Stunde.“
„Guten Abend, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr.“
„Vielen Dank auch für die gute Unterhaltung.“
Wollte er mich verhöhnen? Ich hatte schon den Bahnsteig erreicht. Die Bahn fuhr schnell wieder an. Ich sah noch, wie der Schaffner sich weit hinausbeugte, mit der Hand bald auf sich, bald auf den Bahnhof deutete und mir aufgeregt etwas zurief. Aber ich konnte es nicht mehr verstehen.
Langsam ging ich auf das große, von Scheinwerfern angestrahlte Nordportal zu. Offensichtlich waren vor kurzer Zeit Züge angekommen, denn ich hatte Mühe, mich an den vielen, mir scheinbar drohend entgegenkommenden Menschen vorbeizuwinden. Immer wieder stieß ich an Koffer und herumstehendes Gepäck. Je weiter ich ging, desto mehr schien ich mich vom Bahnhof zu entfernen. Fast fürchtete ich, mich in dem Strudel aus Koffern, Gerät und schimpfenden Reisenden vollkommen zu verirren. Flüche und Scheltworte schlugen über mir zusammen. Endlich, als ich mich nicht mehr zu retten vermochte, wagte ich es, einen höheren Offizier anzureden, der die schwarze Uniform des Staatsheeres trug.
„Verzeihen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wie ich hier zum Hauptbahnhof komme? Es ist des Teufels, man findet ja nirgends ein Durchkommen. Sind denn so viele Züge angekommen?“
Der Offizier sah mich nicht an. Ich konnte nichts anderes erwarten. Es war ja selbstverständlich, daß er mich nicht beachtete; dann sagte er etwas zu mir, aber während er sprach, ging er unentwegt weiter, so daß ich, um wenigstens eine Auskunft zu bekommen, genötigt war, in entgegengesetzter Richtung zu gehen.
„Offenbar weißt du nicht, daß dieser Teil des Bahnhofs heute abend abgesperrt ist“, sagte der Offizier.
Ich wollte noch nicht nachgeben.
„Aber warum das? Es müßte doch vorher bekanntgegeben werden. Das ist doch gänzlich gegen jede Ordnung, so plötzlich den Haupteingang des Bahnhofs abzusperren. Jedenfalls verstehe ich nicht, wozu man das Ganze veranstaltet.“
„Wie du dir denken kannst, könnte ich es dir schnell erklären“, sagte der Offizier. „Aber es würde dir ja doch nicht das Geringste nützen. Begnüge dich damit zu wissen, daß die Staatszüge angekommen sind.“
„Aber diese gewiß sehr wichtige Tatsache ist doch kein Grund, die Absperrung, die selbstverständlich nur zu loben ist, nicht vorher bekanntzugeben.“
„Darum geht es nicht“, sagte der Offizier. „Ich sagte dir außerdem, erinnere dich daran, daß es dir nichts nützt, wenn ich mich in ein längeres Gespräch mit dir einlasse. Ich fürchte, ich habe mich schon über Gebühr lange mit dir unterhalten. Statt mir dankbar zu sein …“
Ich mußte vollständig vergessen haben, wen ich vor mir hatte, denn ich wagte es, dem Offizier ins Wort zu fallen:
„So wollen Sie mir wirklich die wahren Gründe nicht angeben?“
„Ich erkläre dir jetzt zum drittenmal, daß ich keine Zeit und vor allem keine Lust habe, mich mit dir zu unterhalten. Du scheinst gar nicht zu merken, wie verdächtig du dich machst, wenn du ständig fragst, warum die Staatszüge angekommen seien. Noch einmal: mag dir die Tatsache als solche genügen.“
Plötzlich blieb der Offizier stehen, winkte einen Soldaten heran und forderte mich zugleich auf, näher zu treten.
„Warum haben Sie diesen Mann passieren lassen?“
Der Soldat schlug die Hacken zusammen. Ich sah, wie sehr er es zu verbergen suchte, daß ihn die Worte des Offiziers in tiefe Bestürzung versetzt hatten.
„Es war nur Befehl, den inneren Bahnhofsgürtel zu besetzen und dort abzusperren“, sagte der Soldat.
„Dein Glück!“ Der Offizier hatte sich wieder zu mir gewandt. Ich stand unbeweglich und suchte eine zugleich unschuldige und ergebene Miene zu machen.
Dann sagte der Offizier zu dem Soldaten:
„Das Benehmen Ihrer Vorgesetzten zeugt nicht gerade von übertriebener Hochachtung vor den Neuangekommenen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich es zur Kenntnis genommen habe und zu gegebener Zeit, das heißt also zu einer für Sie nicht gerade erfreulichen, verwerten werde. Und jetzt führen Sie mich zu meinem Wagen.“
Ich wartete, bis der Soldat zurückkam, ein junger unbeholfener Mensch mit groben Gesichtszügen und großen unförmigen Händen.
„Ich meine nur, verstehen Sie das?“
Der Soldat zuckte die Achseln.
„Beamtenschaft und Heer der Landeshauptstadt werden um ein vielfaches vermehrt. Ich habe viele Richter gesehen. Es wird wohl neue Prozesse geben. Aber nicht für uns dieses Mal.“
Er gähnte.
„Neue Prozesse? Wieso?“
Der Soldat sah mich an:
„Ich sehe, du willst mich aushorchen. Aber ich sage dir, da bist du an den Falschen gekommen. Ich bin gänzlich unbestechlich, sage ich dir. Außerdem habe ich zu tun. Was wartest du noch?“
Ich blieb stehen und sah an ihm vorbei.
„Ich sage dir, du sollst dich zum Teufel scheren. Du, ich sage dir, daß ich dich nach deinem Ausweis fragen kann. Du scheinst ja verdammt neugierig zu sein wegen der Prozesse. Laß mich in Ruhe, sage ich dir. Und nun mach, daß du fortkommst.“
Der Soldat wandte sich um und ging in sein Wachhaus zurück.
Nachdem sich das Menschenknäuel gelöst hatte, konnte ich schneller gehen. Ich bog in die Talstraße ein, um den Südeingang des Hauptbahnhofs zu erreichen. Hier war es dunkel, und plötzlich spürte ich wieder die Kälte. Die fernen Scheinwerfer vor dem Nordeingang bildeten die einzige spärliche Lichtquelle. Nur wenige Menschen, meistens in Gruppen zu vieren und fünfen, standen vor den Eingängen. Als ich vorbeikam, unterbrachen die Leute ihr Gespräch und zerstreuten sich. Offenbar hatten sie mich schon längst beobachtet und vom Nordeingang her kommen sehen. Ich spürte, wie sie mir feindselig nachsahen. Einige schliefen in ungelenken Stellungen auf Hockern und Kisten gerade unter dem Portal. Ich ging in die Bahnhofshalle hinein. Im trüben Licht trieb Papier umher. Die meisten Fahrkartenschalter waren schon geschlossen; ein einziger nur mit einem kleinen Lichtschein hinter dem Gitter schien noch geöffnet. Wenige Menschen standen schweigend davor. Der Wind war noch stärker geworden, er orgelte in der toten leeren Halle. Eine letzte verspätete Scheibe fiel von dem schon fast glaslosen Hauptdach und zerklirrte am Boden. Niemand schien darauf zu achten.
Ich ging zum Schalter. Als ich an der Reihe war, verlangte ich eine Bahnsteigkarte. Der Beamte hinter dem Schalter zuckte die Achseln.
Ob ich auf dem Mond lebe?
Ich sah ihn fragend an.
Ob ich nicht wüßte, daß es seit langer Zeit gar keine Bahnsteigkarten mehr gäbe?
Ich sagte, das wäre das Neueste, was ich hörte. Seit wann denn diese Verfügung bestünde?
Schon sehr lange, sagte der Beamte, jedenfalls so lange, seit er hinter diesem Schalter säße. Und er säße schon Jahrzehnte hier.
„Haben Sie denn schon jemals eine Bahnsteigkarte gelöst?“ fragte mich der Beamte.
„Das nicht. Jedenfalls entsinne ich mich nicht“, sagte ich. „Aber ich bin schon häufig an den Blechautomaten vorbeigekommen, an denen ein Spalt für Bahnsteigkarten vorhanden ist.“
Ich wies nach rückwärts in die Halle, wo ein solcher Automat stand. „Ich muß allerdings gestehen, daß ich niemals auf die Vermutung gekommen bin, diese Vorrichtung, die doch offenbar für die Öffentlichkeit bestimmt ist, könne schon seit langem gar keinen Zweck mehr erfüllen.“
„Haben Sie denn schon jemals versucht, in diesen Automaten eine Bahnsteigkarte zu lösen?“
„Das freilich nicht.“
„Ich habe es mir gedacht“, sagte der Beamte. „Sonst hätten Sie nämlich gemerkt, daß die betreffenden Schlitze längst versiegelt worden sind.“
Ich wurde zornig.
„Dann ist es aber im höchsten Grade unverantwortlich von der Obrigkeit, die Automaten immer noch äußerlich in ihrem Zustand zu belassen, obwohl sie längst keine Funktion mehr ausüben.“
„Sie sollten etwas vorsichtiger sein mit Ihren Äußerungen“, sagte der Beamte. „Natürlich hat es einen guten Grund, daß man die Automaten immer noch stehen läßt. Denn gerade dadurch, daß man sie in ihrem alten Zustand beläßt und nur die Schlitze verschließt, zeigt man ja überdeutlich, daß es in Wirklichkeit gar keine Bahnsteigkarten mehr gibt. Stillschweigend – meinetwegen mit Hilfe dieses oder jenes Plakates – kann man so eine Sache doch nicht beseitigen.“
Der Beamte lächelte befriedigt über seine Worte, dann, mit einem Augenzwinkern zu mir, zündete er sich eine Zigarette an.
„Ihre Worte haben mich nicht überzeugt“, sagte ich. „Sie sehen doch gerade an mir, wie wenig es bekannt ist, daß es keine Bahnsteigkarten mehr gibt.“
„Sie überschätzen Ihre Bedeutung, mein Herr. Nicht die Obrigkeit ist schuld, die diese Maßnahme veranlaßte, sondern ausschließlich Sie selbst, weil Sie immer gedankenlos an den Automaten vorbeigegangen sind, ohne, wie es Ihre Pflicht gewesen wäre, der Sache auf den Grund zu gehen und so zu erkennen, was die Obrigkeit eigentlich wollte. Dann wären Sie nämlich von selbst auf die versperrten Schlitze und damit auf die Lösung des Rätsels, das natürlich in Wahrheit gar keines ist, gekommen. Sie haben sich geradezu strafbar gemacht durch Ihr Verhalten, und wenn ich wollte, könnte ich Sie jetzt anzeigen. Sie wissen, daß all die durch Tat oder Wort beweisen, daß sie von den durch die Obrigkeit geschaffenen Zuständen keine Notiz genommen haben, wegen Nachlässigkeit und einer dadurch gegebenen Beleidigung des Regimes zur Verantwortung gezogen werden.“ Der Beamte hustete. „Und Ihr Fall wiegt besonders schwer, weil Sie der Einzige sind, der während meiner ganzen Dienstzeit jemals eine Bahnsteigkarte verlangt hat. Sie sehen also, in wie außerordentlicher Weise Sie sich vergangen haben. Ich will dieses Mal von einer Anzeige absehen. Freuen Sie sich, daß Sie an den Richtigen gekommen sind. Wartet sonst noch jemand? Nein? Dann kann ich wohl für heute Feierabend machen. Der letzte Zug geht in sieben Minuten.“
Ich blieb unschlüssig stehen. Unmöglich konnte ich einfach fortgehen und so die Freundlichkeit des Beamten geradezu in den Wind schlagen. Andererseits war es unmöglich, ihm einige Zigaretten oder etwas Geld durch den Schalter zu schieben. Ich wußte zu gut, wie ich mich dadurch erst recht strafbar gemacht hätte. Endlich entschloß ich mich, mir noch eine Fahrkarte zu lösen. Natürlich konnte ich wegen der Vorladung unmöglich wegfahren, aber ich sagte mir: eine Fahrkarte zu lösen wäre die einzige Möglichkeit, den Beamten zufriedenzustellen. Ich trat ganz dicht an das Gitter heran.
„Wohin fährt der letzte Zug?“
„Nach Barwicke. Güterzug mit Personenwagen.“
Barwicke –, ja Barwicke, wo ich vor zehn, – nein, es sind zwölf Jahre her, mit Karl-Heinz und Inge zum Skilaufen war. Die erste Station auf der Strecke nach Barwicke?
„Dann geben Sie mir bitte eine Karte nach Altensteig.“
Der Beamte schob die Karte hindurch.
„Der Herr zahlt eine Mark.“
Ich verbeugte mich ein wenig, er war also zufriedengestellt.
„Bahnsteig drei. Die letzten beiden Wagen sind Personenwagen.“
Langsam ging ich die Treppen hinunter. Als ich schon ganz unten war, es mochten zwei Minuten vergangen sein, wurde mir plötzlich bewußt, in welche Lage ich den Beamten durch mein Verhalten gebracht hatte. Hatte ich mich nicht im höchsten Grade verdächtig gemacht durch meine Unwissenheit wegen der Bahnsteigkarte? Und dann der plötzliche Entschluß, mir eine Fahrkarte zu lösen! Kein Zweifel, der Beamte hätte die Pflicht gehabt, mich zur Anzeige zu bringen. Das war ja Flucht, wilde überstürzte Flucht, was sich da vor seinem Schalter abgespielt hatte. Ich mußte ihm als ein Verbrecher erscheinen, der sich unwissend stellte und ihn zu übertölpeln suchte. Das wäre schlimm. Aber schlimmer noch wäre es, wenn der Beamte mich jetzt für einen Spitzel der Obrigkeit oder gar für einen hohen Beamten hielt, einen Vorgesetzten, der ihn auf die Probe stellen wollte. Gerade durch seine Gesetzeskenntnis, von der er keinen Gebrauch gemacht hatte, hatte der Mann hinter dem Schalter sich in hohem Maße vergangen. War ich ein Verbrecher, dann wäre ihm schwerste Strafe gewiß; war ich ein Vorgesetzter, dann könnte ihn seine Unachtsamkeit einige Jahre Zuchthaus kosten. Es blieb ihm also keine andere Wahl, als den Fall selbst zur Anzeige zu bringen. Nur so hatte er wenigstens eine geringe Chance, mit einer Verwarnung davonzukommen.
Und wenn er mich weder für einen Verbrecher, noch für einen Beamten, sondern für einen harmlosen Passanten hielt? Natürlich würde er die Möglichkeit erwägen, aber niemals Gewißheit bekommen. Jahre der Ungewißheit und peinigenden Sorge, daß man ihn am Ende doch überführen werde, standen ihm bevor. Das konnte er unmöglich aushalten. Auch dieser Beamte mußte zu oft erlebt haben, wie ein kleines Versehen nach Jahren grausam gerächt wurde. Er mußte sich sagen, daß man sein Vergehen längst bemerkt hätte. Morgen oder in einem Jahr oder in zehn Jahren würden sie ihn stellen. Und je länger er wartete, desto furchtbarer mußte die Qual für ihn sein. Nein, er mußte sich selbst anzeigen.
Ich stürzte die Treppe hinauf. Der Rolladen vor dem Gitter war bereits herabgelassen. Aber durch die Ritzen sickerte noch schwaches Licht. Ich trommelte gegen die Eisenstangen. Es kamen Schritte näher. Dann sagte jemand, der letzte Zug sei fortgefahren und es habe keinen Zweck mehr zu warten. Ich ließ mich nicht beirren; obwohl meine Knöchel zu bluten begannen, trommelte ich unentwegt weiter. Endlich wurde der Vorhang hochgezogen. Ich erkannte den Beamten wieder. Über einen grauen Strickpullover hatte er sich seine Uniformjacke geworfen. Ich sah, wie er erschrak, als er mich erkannte.
„Sie haben den Zug verpaßt?“
„Ja, ich kam nicht mehr ganz zur rechten Zeit. Aber es macht nichts, ich kann auch morgen fahren.“
„Und warum kommen Sie noch einmal?“
Er wußte nicht, wie er sich verhalten sollte.
„Sie können Vertrauen zu mir haben“, sagte ich. „Sie brauchen den Fall nicht zur Anzeige zu bringen. Ich bin weder ein Verbrecher, noch ein Spitzel, noch Ihr Vorgesetzter.“
„Das habe ich niemals behauptet“, sagte er. „Unser Gespräch ging ja um ganz andere Dinge.“
Ich wußte, daß etwas Entscheidendes geschehen mußte, wenn ich ihn retten wollte. Ich griff in die Tasche und holte die Vorladung heraus, dazu legte ich meinen Ausweis. Der Beamte verglich beides sorgfältig miteinander.
„Sie werden verurteilt werden“, sagte er dann. „Was haben Sie getan?“
Ich nahm die Karte wieder an mich, eine rote Karte: Vorladung für den siebzehnten November neun Uhr in den Justizpalast. Ganz ruhig steckte ich sie wieder in meine Tasche.
„Ich werde Sie nicht verraten“, sagte ich. „Sie brauchen sich nicht anzuzeigen.“
Ich streckte dem Beamten die Hand unter dem Gitter hindurch zu. Er berührte sie flüchtig. Seine Hand war feucht.
Der Beamte schloß das Gitter, zog den Rolladen hinunter. Dann hörte ich, wie er die Tür abschloß. Das Licht erlosch. Die Schritte des Mannes am Schalter verloren sich in der Nacht. Ich war allein. Erst jetzt wurde mir bewußt, in welcher Lage ich mich befand. Jetzt war alles noch schlimmer als vorher. Ich stürzte nach Hause. In Mutters Zimmer brannte Licht. Ich habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt und alles ganz ruhig zu erzählen versucht, um zu vergessen, – um nicht wahnsinnig zu werden bis morgen früh. Es gibt keinen Ausweg mehr.
Jetzt ist es vier Uhr morgens. Ich habe noch fünf Stunden Zeit. Nebenan in Mutters Zimmer ist das Licht erloschen. Aber ich weiß, daß sie nicht schläft. Sie wartet auf mich. Sie weiß, wie sehr ich spüre, daß sie auf mich wartet, aber wir können uns nicht helfen. Wenn ich jetzt zu ihr ginge, würde ich nicht die Kraft aufbringen, morgen früh den Weg zu gehen, den man mir bestimmt hat.
Die Bücher zu meiner Linken starren mich an, aber ich finde keine Antwort aus meinem Leben auf das, was jetzt mit mir geschieht. Kein Mensch kann mir die Antwort geben, der Schaffner so wenig wie der Mann hinter dem Schalter, und der Mann hinter dem Schalter so wenig wie meine Freunde.
Da stehen die acht Bücher. Am Anfang „Die blauen Vögel“, unbeholfene Lyrik des Primaners, und am Ende der dreibändige Roman über Nero, der nun seit vier Jahren auch verboten ist. Dazu die Novellenbände, das Drama vom ungetreuen Sohn, die große Biographie über Shakespeare, die Aufsätze und Essays. Dann im Schreibtisch all’ die Manuskripte, die nicht mehr gedruckt werden durften, und endlich die Blätter, die ich ohne die geringste Hoffnung schrieb, sie jemals veröffentlichen zu können. Zehn Jahre ist es jetzt her, daß ich nichts mehr veröffentlicht habe, und acht Jahre, daß sie mir meine Stellung als Dozent für Literaturgeschichte an der Universität gekündigt haben, ein Jahr, bevor sie diese letzte Universität schlossen. Seit acht Jahren habe ich mich mit Nachhilfestunden ernährt. Ich muß lächeln, wenn ich an die früheren Zeiten denke, wo man ins Ausland fliehen konnte, wenn das eigene Land einen verriet und dem Gutwilligen die Lebensberechtigung abstritt. Man ging ins Ausland und fand Gleichgesinnte und schrieb weiter und wußte um ein Ziel und hoffte, eines Tages wiederzukommen. Aber seit zweiundzwanzig Jahren, seit dem Ende des letzten Krieges, seitdem alle Menschen der Erde der einzigen Macht untertan sind, die allein aus den Wirren des Krieges übrigblieb, gibt es kein Ausland mehr.
Jetzt also sind wir an der Reihe, die letzten. Ach, wir wären es längst schon gewesen, wenn sich nicht der Gouverneur dieses Landes bisher so unverständlich duldsam gezeigt hätte. Aber als sie ihn vor einem Monat verjagten, wußte jeder von uns, daß wir unsere Tage zu zählen hätten. Heute sind die Staatszüge angekommen. Ich will zum Spiegel gehen und mir den Mann ansehen, der die Ehre hat, einer der letzten Menschen zu sein, die man aufs Schafott zwingt. Ich kann nicht einmal mehr schreiben.“
Die Sonne schwamm bleich und krank über den Hochhäusern. Die Leute hasteten durch den Straßendunst. Sie hatten den Kragen hochgeschlagen und sahen zur Erde.
Walter Sturm hatte zu lesen versucht. Aber es war ihm nicht gelungen Am Morgen ging er ans Fenster, zog die Gardinen zurück und erschrak, als er die Menschen sich wie immer auf der Straße bewegen sah. Er nahm einen Bleistift und schrieb auf einen Zettel:
„Jetzt ist es acht Uhr. Ich habe die Nacht auf meinem Bett gesessen und zu lesen versucht. Aber die Bücher haben nur Seitenzahlen und gedruckte Buchstaben ohne Sinn, wenn man sterben muß. Dann habe ich mich gewaschen und meinen hellen Winteranzug angezogen. Ich dachte, daß ich sehr fröhlich aussehen müßte. Dann habe ich mich im Spiegel angesehen und breit zu lachen versucht. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Der Mensch, den man verurteilen will, lebt gar nicht mehr. Man meint einen ganz anderen, dessen Namen ich heute zufällig noch trage. Aber meine Richter werden mich wiedererkennen.
Es ist so weit. In der Straßenbahn werde ich Bekannte treffen. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich grüßen?“
Dann legte er den Zettel in das Tagebuch zwischen die letzte beschriebene Seite und die nächste, die noch ganz leer war. Die Schrift hatte die letzte Reihe der dreißigsten Seite erreicht. Walter Sturm schloß das Buch.
Der Richter rührte mit einem feinen Silberlöffel in einer Tasse schwarzen Kaffees herum. Seine Hand zitterte, und sie war bläulich und wie erfroren. Er sah sich das Bild Walter Sturms an:
„Wenig mehr als eine Stunde“, sagte der Richter. Er stand auf und ging dann Mal für Mal in seinem Zimmer auf und ab. Ein Pendelschlag: von der Tür zum Schrank und vom Schrank wieder zur Tür.
II
UM fünf Minuten vor neun stand Walter Sturm vor der Portierloge des Justizpalastes. Er zeigte dem Portier die Karte und sagte:
„Ich habe eine Vorladung erhalten.“
Der Portier sah ihn mißmutig an.
„Das sehe ich“, sagte er, „Ihre Bemerkung ist also ganz überflüssig. Sie scheinen keineswegs die nötige Achtung zu haben, die in Ihrer Lage nur zu angebracht wäre. Sonst hätten Sie sich etwas bescheidener aufgeführt und nicht noch ausdrücklich erklärt, daß Sie eine Vorladung hätten.“
„Verzeihen Sie bitte“, sagte Sturm. „Aber während ich Ihnen die Karte gab, sagte ich, daß ich eine Vorladung hätte. Bedenken Sie, es war gleichzeitig, hatte mehr den Charakter einer Bestätigung und war ganz gewiß nicht böse gemeint.“
„Sie können es sich sparen, mir hier Lehren zu erteilen“, sagte der Portier. „Ich erkläre noch einmal, daß Ihr Ton gänzlich unangebracht ist. Außerdem halten Sie mich offenbar für weit dümmer als ich bin.“
Der Portier grinste. „Das ist aber das Verkehrteste, was Sie tun können, mein Junge. Wenn ich auch nur ein kleiner Portier bin, so bin ich Ihnen in Ihrer jetzigen Lage immer noch so weit überlegen, daß wir darüber kein Wort zu verlieren brauchen. Mit Staatsfeinden möchte ich nicht auf eine Stufe gestellt werden.“
„Aber ich betonte doch ausdrücklich, daß es ganz gewiß nicht böse gemeint war, wenn ich eine – das gebe ich zu – vielleicht überflüssige Erklärung abgegeben habe.“
„Böse oder nicht, – das interessiert uns hier keineswegs in dem Sinn, wie Sie es vielleicht annehmen. Außerdem ist dieses Verhältnis schon von vornherein durch die Stellung gegeben, in der wir uns befinden. Sie zeigen immer noch Ihren alten Hochmut, Angeklagter, wenn Sie von Ihrer vielleicht verfehlten Erklärung sprechen. Sie war überflüssig, ja, Sie hätten mir noch nicht einmal die Karte zu zeigen brauchen! Ich wußte von vornherein, daß es sich bei Ihnen nur um einen Angeklagten handeln konnte. Doch Sie darüber aufzuklären, habe ich keine Befugnis. Wir haben viel zu viel Zeit verloren, es ist gleich neun Uhr.“
„Dann bitte ich Sie, mir den Weg zu zeigen, der nach Zimmer eins führt“, sagte Sturm, indem er wider Willen eine kleine Verbeugung vor dem Mann hinter dem Glasfenster machte.
Aber da sprang der Portier auf. Er warf die Mütze auf den Tisch, so daß sein kahler glattrasierter Schädel sichtbar wurde, und schrie auf den Angeklagten ein.
„Wann Sie auf Ihr Zimmer zu führen sind, das bestimme hier allein ich. Im übrigen kann ich Ihr Benehmen nur als eine unerhörte Herausforderung der Obrigkeit auffassen. Sie ist so schwer, daß ich sofort davon Meldung machen werde. Es erscheint mir jetzt überhaupt fraglich, ob Sie unter diesen Umständen heute noch vorgelassen werden können. Ich glaube, daß Ihr Fall wegen Ihres Benehmens noch einmal von vorn aufgerollt werden muß.“
Dann sagte der Portier: „Einstweilen kommen Sie mit!“
Er drückte auf einen Knopf, wartete, bis ihm ein Klingelzeichen verriet, daß man ihn verstanden habe, und schloß dann die Loge. Ohne ein Wort an Sturm zu richten, sprang er die Stufen hinauf, so daß der Angeklagte Mühe hatte, ihm zu folgen. Endlich, im dritten Stock, bog er ab und führte den Gefangenen durch einen Nebengang zu einem kleinen, am Ende eines dunklen Flurs gelegenen Zimmer. Obwohl dieses Zimmer auf einem Schild die Nummer 272 trug, wagte Sturm nicht, den Portier auf einen Irrtum hinzuweisen, um ihn nicht noch mehr zu erzürnen. Der Raum, in den man ihn führte, war offensichtlich ein Schulzimmer. Vorn auf dem Katheder saß eine junge Dame. Sie mochte siebenundzwanzig Jahre alt sein, sie trug eine dunkle Brille und sah freundlich aus. Die Bänke der Klasse waren leer.
Der Portier schlug die Hacken zusammen.
„Dieses ist Nummer 56“, sagte er. Und dann: „Es scheint ein besonders schwerer Fall zu sein. Sein Benehmen ist geradezu herausfordernd. Ich werde Meldung machen müssen.“
Die junge Dame schien den Worten des Portiers kein besonderes Interesse zu schenken. Sie blätterte in einem großen Stapel Akten und nickte nur beiläufig, als der Portier salutierend den Raum verließ.
„Sie dürfen sich setzen“, sagte sie dann. „Aber ganz vorn, hier auf die erste Bank. Sie sind Nummer 56?“
„Der Portier sagt es“, erwiderte Sturm, nun ängstlich darauf bedacht, nicht noch einmal einen Fehler zu begehen.
Das Fräulein lächelte. „Das ist hier ganz unwichtig, was der Portier meint“, sagte sie. „Hat er Sie unhöflich behandelt?“ Ehe Sturm antworten konnte, fuhr sie fort: „Er sollte schon mehrfach entfernt werden. Der Mann ist unzuverlässig. Jetzt sucht er durch ein übertrieben barsches Auftreten seinen Posten zu behaupten. Das wird ihm nicht viel nützen, fürchte ich.“
Sturm erschrak. „Keinesfalls möchte ich der Anlaß dafür sein, daß der Portier seine Stellung verliert.“
„Sie können ohne Sorge sein“, sagte die Dame, indem sie ihre Brille abnahm und die Gläser mit einem kleinen gelben Lappen putzte. „Die Szene, die Sie mit Herrn Schmelke hatten, ist ganz unwichtig. Doch verlieren wir keine Zeit, es ist schon neun Uhr, und bis zehn Uhr müssen Sie fertig sein, wenn nicht unser ganzer Tagesablauf in Unordnung geraten soll. Das aber wäre ein nicht wieder gutzumachender Schaden und würde die Verantwortlichen nicht freundlich gegen Sie stimmen, fürchte ich. Sie heißen Walter Sturm?“
„Ja.“
„Sie sind Schriftsteller?“
„Ich war Schriftsteller.“
„Darauf kommt es hier nicht an. Einstweilen, laut unseren Akten, sind Sie noch Schriftsteller. Greifen Sie dem Urteil nicht voraus!“
Sturm stand auf. Die Dame sah ihn erstaunt an. „Warum stehen Sie auf? Es ist keineswegs Zeit für Sie zu gehen. Außerdem bestimme ich das, – fürchte ich.“
Die Lehrerin putzte ununterbrochen an ihren Gläsern. Sturm sah aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Mauerwand. Sie war fensterlos. Es mußte sich um den anderen Seitenflügel des Justizpalastes handeln. Zwischen beiden gähnte ein tiefer Schacht. Sturm erschrak, als er sich vorstellte, wie der Blick in die Tiefe sein würde, hinab zum grauen Asphalt des Bodens, zu den Kellertreppen und den Abfallkörben auf den zertretenen Fliesen.
„Sie sind fünfundvierzig Jahre alt?“
„Ich werde im Mai sechsundvierzig.“
„Sie haben hier nur meine Fragen mit ja oder nein zu beantworten. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen das sagen muß.“
Sturm verbeugte sich wieder.
„Sie sind verheiratet?“
„Nein.“
„Sie haben Kinder?“
„Nein.“
„Sie waren im Kriege?“
„Nein.“
„Sind Sie krank?“
„Ja.“
„Was fehlt Ihnen?“
„Ich habe einen schweren Herzfehler.“
„Wie lange?“
„Seit meinem achtzehnten Lebensjahr. Ich hatte damals …“
Die Dame war aufgestanden. Sie lehnte sich an die Wandtafel, und ihre linke Hand fuhr über das glattgekämmte, im Nacken zu einem großen Knoten zusammengefaßte Haar. „Sie haben keine Reden zu halten. Außerdem sind Sie sich offenbar über die Art Ihres Verhörs gänzlich im Unklaren. Es handelt sich hier nicht darum, etwas festzustellen. Unsere Akten belegen jede Kleinigkeit Ihres Lebens nur zu genau. Dieses Verhör ist eigentlich nur eine Formalität, allenfalls eine Probe der Ehrlichkeit des Angeklagten. Aber vor allem haben die Fragen, wie Sie ja sicher schon festgestellt haben, einen gewissen humanen Sinn. Sie sind so zusammengestellt – und zwar in jedem Fall anders – daß sich der Angeklagte aus seinen Antworten schon ein ungefähres Bild über den Ausgang seines Verfahrens machen kann.“
„Dann habe ich also keine Aussicht?“
„Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, damit sich der Angeklagte ein ungefähres Bild machen kann. Die Entscheidung liegt nicht bei mir.“
Sturm mußte lächeln. „Da müßte ich also eine Frau und Kinder haben und im Krieg gewesen sein und ich müßte gesund sein, und alles stünde besser?“
„Sie vergessen, daß die Fragen ja in jedem Fall verschieden gestellt sind. In dem Fall hätte ich Sie nach Ihrem Vermögen gefragt, nach Ihren Vorfahren oder nach Ihren Ämtern in der Organisation.“
„Ist es überhaupt möglich, die Fragen so zu beantworten, daß man Hoffnung schöpfen kann?“
„Das sei dahingestellt“, sagte die Lehrerin. „Doch müssen Sie bedenken, daß hier niemand vorgeladen wird, der unschuldig ist.“
„Damit wollen Sie also sagen, daß das Ergebnis im voraus feststeht?“
„Das habe ich nicht behauptet“, sagte die Lehrerin. „Ich könnte es Ihnen auch gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, daß nur Angeklagte durch den Eingang A gehen. Und die Angeklagten sind schuldig.“