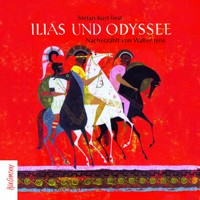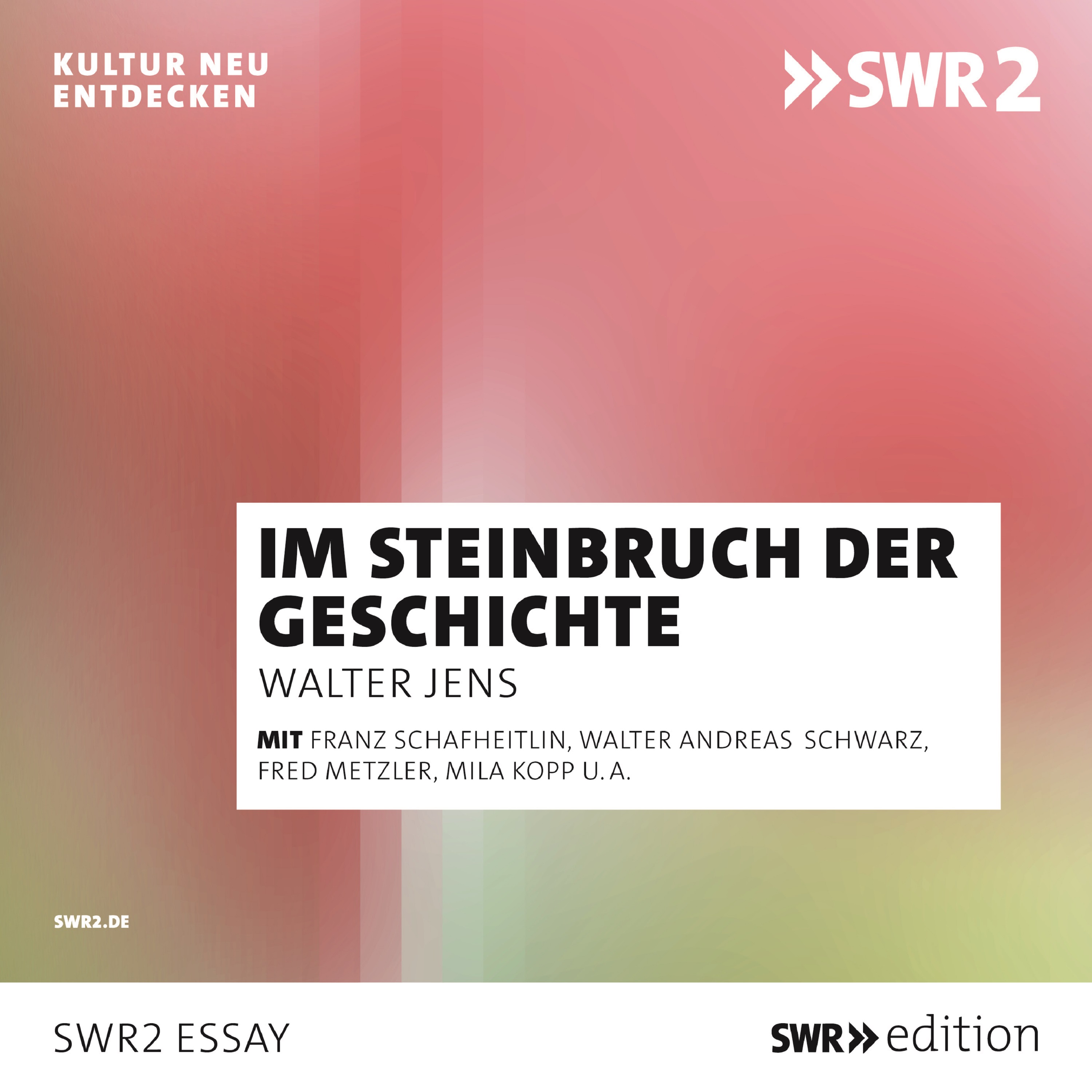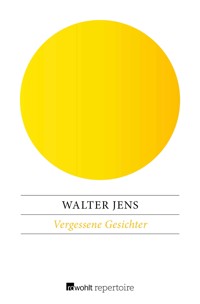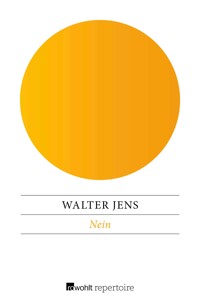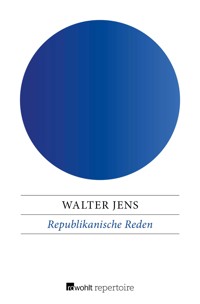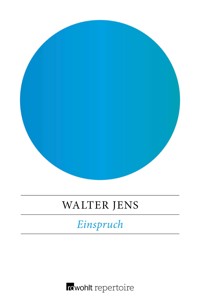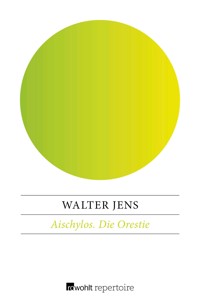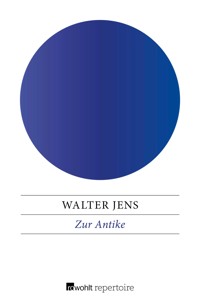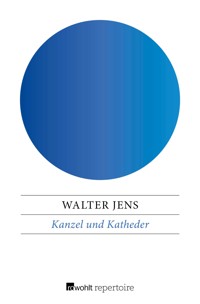
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, da der endgültige Holocaust zum politischen Kalkül und das Wort Pazifismus fast schon wieder ein Schmähruf geworden ist, erfüllen die hier gesammelten Reden eine doppelte Aufgabe: Mit untrüglicher Scharfsicht analysieren sie jene Momente unserer Geschichte, in denen Vernunft und Humanität einem militanten Nationalismus geopfert wurden; doch zugleich bewahren sie das Vermächtnis der aufklärerischen Geister, die sich der Intoleranz entgegenstellten, indem sie aus der Perspektive der Opfer unseren Blick auf die Heilsbedürftigkeit der Welt lenken. In seinen Predigten entwirft Walter Jens das Bild eines Jesus von Nazareth jenseits aller Dogmen und Doktrinen: eines Bruders der Mühseligen und Beladenen, den die Mächtigen der Welt zwar ans Kreuz schlagen konnten, dessen Leben und Opfer aber über die Zeiten hinweg ein unauslöschliches Zeichen der Hoffnung für alle Leidenden und Verfolgten geblieben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Kanzel und Katheder
Reden
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
In einer Zeit, da der endgültige Holocaust zum politischen Kalkül und das Wort Pazifismus fast schon wieder ein Schmähruf geworden ist, erfüllen die hier gesammelten Reden eine doppelte Aufgabe: Mit untrüglicher Scharfsicht analysieren sie jene Momente unserer Geschichte, in denen Vernunft und Humanität einem militanten Nationalismus geopfert wurden; doch zugleich bewahren sie das Vermächtnis der aufklärerischen Geister, die sich der Intoleranz entgegenstellten, indem sie aus der Perspektive der Opfer unseren Blick auf die Heilsbedürftigkeit der Welt lenken.
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Walter Jens starb am 9. Juni 2013 in Tübingen.
Inhaltsübersicht
Vorwort
… glaubhafte Bilder, die den Betrachter, als ob er dabei sei, in die Geschehnisse hineinversetzen
Quintilian
Die in diesem Band zusammengestellten politischen, literarischen und geistlichen Reden, in ihrer Mehrzahl auf Kanzeln und Kathedern beider deutschen Staaten gehalten, in der Rostocker Aula oder dem Tübinger Festsaal, in einer Hannoverschen Messehalle oder einer Magdeburger Kirche, in einem Greifswalder Auditorium, einer Berliner Akademie oder in Luthers Augustinerkloster zu Wittenberg: Sie alle, die Proklamationen, Gedenkansprachen oder Predigten, haben das gemeinsame Ziel, die behandelten Gegenstände von unten aus zu betrachten, aus der Perspektive der Besiegten und Vergessenen – von Kreuz und Fleisch aus also und nicht, mit Hilfe planetarischen Überblicks, aus der Sicht der frommen oder unfrommen Macht.
So betrachtet handelt es sich bei den zehn Reden um eine Sammlung von moralischen Meditationen: Erinnerungen an verschüttete, aber auf die Dauer unverzichtbare Traditionen sollen geweckt, Namen – wie Gervinus, Riesser oder, immer wieder, Virchow – im Zusammenhang einer vom Gedanken allgemeiner Emanzipation bestimmten Geschichte nachdrücklich akzentuiert, Schriften, die, wie Herders »Sieben Gedanken der großen Friedensfrau«, in jedes republikanische Lesebuch gehörten, wieder ins Bewußtsein gehoben werden. In jedem Fall kam’s darauf an, historisch festgelegte Figuren in neuer Beleuchtung erscheinen zu lassen: Darum die Evokation des »armen« Jesus oder die Vorstellung des Humanisten, Rhetors und Dichters in nürnbergisch-behutsamer Weise, Martin Luther; darum das Zwiegespräch mit unserem Zeitgenossen Kierkegaard, darum schließlich auch die mehrfache Inszenierung eines imaginären Gesprächs, in dessen Verlauf Poeten, Philosophen und Theologen aus vielen Jahrhunderten, um ein gemeinsames Thema bemüht, Möglichkeiten humanen Miteinanders sichtbar machen, das von einer Wirklichkeit, in der Isolierten ihr unverrückbarer Platz angewiesen ist, verhindert wird.
Spiel und Kombinationslust, Spaß bei der Entwicklung ungewöhnlicher Synopsen, auch provokantes Zusammenbenennen von Gegensätzlichkeiten, die à la Hegel aufzuheben mehr als Gedankenspiel (vielmehr Nachweis mancher verborgenen concordia discors) ist: All das, steht zu hoffen, mag den vorliegenden Reden auch in gedruckter Form ihren appellativen, zu Applaus und Widerspruch reizenden Charakter belassen und jene Evidenz, im Sinne von leibhaftig-plastischer Erscheinung der charakterisierten Personen und Probleme, zumindest indirekt aufleuchten lassen, die zu realisieren immer noch das höchste Ziel des Rhetors ist: Da, schaut her, so ist es gewesen unter dem Kreuz; so haben sie gelebt, die Juden in Deutschland; so würde er reden, der Reformator, wenn er, der große Polterer, der sich auf die sanftesten Töne verstand, die zu seinen Ehren gehaltene Festansprache unterbräche.
Sich nicht selbst vorzudrängen, sondern die anderen und Größeren durch Zitat, plastische Benennung und die Einfügung in einen hier konkreten, dort imaginären Zusammenhang zum Reden zu bringen, ist die eigentliche Absicht dieser Verlautbarungen vom Katheder und der Kanzel herab. Die rhetorisch-moralischen Meditationen verstehen sich als Bemühungen, zur Verlebendigung des Historischen beizutragen, indem sie, wie es im literarischen Totengespräch geschieht, Objekte gelehrter Bemühung wieder in Menschen aus Fleisch und Blut zu verwandeln und akademischen Problemen die Aktualität zeitgenössischer Debatten zu geben versuchen – beides getreu dem rhetorischen Postulat, das da lautet: Aufgabe des Redners ist es, sich selbst und sein Publikum in die Lage von Augenzeugen zu versetzen.
Tübingen, 1. Juni 1984
Walter Jens
Geist und Macht
Literatur und Politik in Deutschland
»Solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Kopf, d.i. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut … Jetzt endlich ist der Mensch dazu gekommen zu erkennen, daß der Gedanke die geistige Wirklichkeit regieren solle. Es war dies somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche (der Französischen Revolution) mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes … die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen«: Mit diesen Sätzen beschwor, aus jener Perspektive von Abstand und Am-andern-Ufer-Sein, die gleichwohl der entzückten Begeisterung des Redenden nicht abträglich ist: denn gestern war er dabei, an der Tête! … mit diesen Worten beschwor ein Berliner Professor, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, zwischen 1822 und 1831 in einem fünfmal gelesenen Kolleg über Philosophie der Weltgeschichte den Geist jener großen bürgerlichen Revolution, die ihre erste – und entscheidende! – Anregung durch die »Weltweisheit« gewonnen habe.
Gedanke und Realität, Kultur und Politik miteinander verschwistert; die Philosophie der Aufklärung als Prämisse einer Radikal-Veränderung von Politik: Jawohl, das war noch einmal der Geist Robespierres, den Hegel ein Menschenalter nach dem neunten Thermidor, Juli 1794, beschwor (»Das Einleitungskapitel der Revolution« hatte Robespierre die Enzyklopädie, das Werk d’Alemberts, genannt); das war der Glaube, daß die Politiker, nach 1789, ausgeführt hätten, was ihnen von Poeten, Pädagogen und Philosophen vorausgeträumt worden sei: die Literaten – Geburtshelfer der Anwälte politischer Praxis! (»Maximilian Robespierre«, rief Heine in seinem Traktat über Religion und Philosophie den »stolzen Gedankenmännern« zu, »war nichts als die Hand von Jean Jacques Rousseau, die blutige Hand, die aus dem Schoße der Zeit den Leib hervorzog, dessen Seele Rousseau geschaffen hat.«)
Ein halbes Jahrhundert lang, bis hin zur Revolution von 1848, klingt nach, wird verklärt, sieht sich in feierlicher Rede evoziert und als »vergangen«, aber »wiederholbar«, »verloren« und zugleich »unverlierbar« beschworen, was einmal leuchtende Gegenwart war. Kein Zufall, daß selbst in den Versen des entschiedensten Gegners, den die Französische Revolution (sieht man von Justus Möser ab) unter Deutschlands Schriftstellern hatte: in Goethes Hexametern die Begeisterung nachklingt, der Enthusiasmus und die verwegene Hoffnung, von der die europäische Intelligenz, und die deutsche voran, im Zeichen einer der Aufklärung verpflichteten Politik ergriffen wurde: »Denn wer leugnet es wohl«, heißt es im 6. Gesang von »Hermann und Dorothea«: mitten in der Beschreibung des Emigranten-Elends – also auch hier aus der Position des Anders- und Besser-Wissens, einer Kenntnis der Folgen, heraus! –, »denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen, als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob (»Sonne«: bei Hegel wie bei Goethe!), als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein sei, von der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit … Schauten nicht alle Völker in jenen drängenden Tagen nach der Hauptstadt der Welt, die es schon lange gewesen und jetzt mehr als je den herrlichen Namen verdiente? … Wuchs nicht jeglichem Menschen der Mut und der Geist und die Sprache?«
Geschrieben 1797 – zu einer Zeit also, da die wundersamen großen und schrecklichen Begebenheiten – so ein Topos der Literatur – längst verblaßt waren: Vorbei die Zeit zwischen Bastille-Sturm und Hinrichtung der königlichen Familie, da deutsche Paris-Reisende die Revolution wie ein erhabenes Theaterstück analysierten, ein auf den Straßen gespieltes Shakespeare-Drama, dessen Held das Volk war. Vergangen, vorbei: der Aufstand der Massen – in Paris gescheitert und in Deutschland – nie mehr als ein Traum!
Je elementarer sich die Revolution, von Mirabeau bis Robespierre, radikalisierte, je stärker Deutschland durch den Koalitionskrieg betroffen wurde – Goethes »Campagne in Frankreich«, »Die Belagerung von Mainz«! –, je unmittelbarer die Intellektuellen diesseits des Rheins, in unmittelbarer Auseinandersetzung mit der Revolutionsmacht, »Jakobinismus« und »Sansculottentum« in concreto erlebten, desto stärker sahen sie sich genötigt, den Unterschied zwischen deutschen und französischen Verhältnissen zu akzentuieren und, mit einem am Pariser Gegen-Bild geschulten Blick, die Misere des eigenen Landes mit seinen – so Marx – »gewesenen Ständen und ungeborenen Klassen« ins Blickfeld zu rücken: das Elend einer zerstückelten Nation, in der das Bürgertum ohnmächtig, die Bauernschaft isoliert und die Intelligenz gedemütigt waren: Deutschland – ein territorialstaatlicher Club, in dem, wie es das Testament eines württembergischen Regenten belegt, Untertanen neben Pferden, Schafen und Gehölzen als »Zubehör« von Burgen, Schlössern, Festungen aufgeführt wurden; Deutschland – ein adeliger Herrschaftsbereich, in dem ein Hochwohlmögender von Stand und Geblüt es sich leisten konnte, einen Schornsteinfeger vom Dach herunterzuschießen, um seiner Maîtresse, die »so einen Kerl« gern mal herabpurzeln sehen wollte, eine bescheidene Freude zu machen. (Die Witwe des Ermordeten wurde dafür mit fünf Gulden »entschädigt«.)
Deutschland im Zeitalter der Französischen Revolution: Das war ein zersplittertes, aus Duodezfürstentümern bestehendes Reich, dessen Schriftsteller, anders als ihre französischen Kollegen mit ihrer mächtigen Presse in der Metropole, allenfalls in praxisfernen Provinzzirkeln bescheidenen Einfluß gewannen, in literarischen Salons, Logen, Clubs und, mit Einschränkungen, auf dem Theater: Kein Wunder, daß die politischen Programme der vielfach Disziplinierten – Schubart: eingekerkert; Fichte: entlassen wegen »Propaganda für Demokratie und Revolution« –, kein Wunder, daß die Programme der Schriftsteller eher auf eine Reform von oben als eine Revolution von unten abzielten. Nicht durch die Gewalt der Straße, sondern durch Erziehung und Bildung lautete nach 1792 die Generalthese der »Mehrheitsfraktion« in den Kreisen der deutschen Intelligenz, nicht durch ökonomisch-soziale Umwälzung, sondern durch Erziehung und Bildung der Allgemeinheit, der Fürsten voran, werde sich, befördert von Angehörigen der deutschen Gelehrtenrepublik, die den Postulaten der Aufklärung treu zu bleiben gedächten, jene Reform des öffentlichen Lebens ermöglichen lassen, die, wie das Terreur-Regiment der Jakobiner beweise, die Revolution verhindere. Kein Zweifel: Wenn es – nehmen wir die Mainzer Jakobiner aus – am Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland ein von der literarischen Intelligenz geprägtes Gesellschaftsmodell gab, dann war es die Vorstellung der durch ein aufgeklärtes Regiment gewährleisteten concordia omnium in einem Land, dem – gottlob, hieß es – Klassengegensätze wie in Frankreich fehlten. Einerlei, ob so unterschiedliche politische Temperamente wie Jean Paul oder Humboldt, Hardenberg oder Kant die Reform von oben als einzige Möglichkeit beschworen, die Revolution zu verhindern – einerlei, ob selbst ein dezidierter Republikaner wie Georg Friedrich Rebmann (mitsamt seinem Blick aufs Mainzerische: das jakobinische Deutschland) die These vertrat, daß bei garantierter Gedanken- und Pressefreiheit »die Demokratie um den Thron blühe« –, in jedem Fall ging es, in Übereinstimmung mit reformabsolutistischen Zielen, darum, den – zur Humanität erzogenen – aufgeklärten Monarchen (der halb idealisierter pater familias, halb Gottvater im Duodezformat war) als Bewahrer und Erneuerer einer auf Versöhnung widerstreitender Interessen abzielenden Gemeinschaft zu apostrophieren.
Und trotzdem, über Jahrzehnte hinweg, der Traum vom August 1789! Trotzdem das nie endende Vivat auf den Bastille-Sturm! Trotzdem der Glaube, die Revolution könne nachgeholt werden – und zwar in Deutschland: im Bereich der Literatur und Philosophie.
Französische Praxis: aufgehoben und in ihrer Intention, eine absolute Umwälzung im Sozialen so gut wie im Geistigen zu bewirken, überboten durch die deutsche Theorie! »Kantische, Fichtesche und Schellingsche Philosophie« – noch einmal ein Blick in Hegels Berliner Hörsaal! –, »in diesen Philosophien ist die Revolution in der höchsten Form des Gedankens niedergelegt und ausgesprochen, zu welcher der Geist in der letzten Zeit in Deutschland fortgeschritten ist. An dieser Epoche haben nur zwei Völker teilgenommen, das deutsche und das französische.«
Revolution in der philosophisch-literarischen Welt als eine auf höherer Stufe durchgeführte – gut Musilsche – Parallel-Aktion zur gesellschaftsverändernden Revolte in Frankreich, dienlich, das Praktischwerden der Vernunft in einem aufgeklärten Gemeinwesen, halb preußisch-fritzisch, halb nach Weimaraner Maß, zu befördern: Diese geistige Revolution war das große Gesprächsthema der deutschen Literatur in der Epoche zwischen Goethe und Heine.
Säßen sie, zurückverwandelt in Figuren aus Fleisch und Blut, hier vor uns auf dem Podium, Hegel und Kant, Goethe und Schiller, Heine und Hölderlin, Humboldt, Börne e tutti quanti: wir dürfen gewiß sein, daß zwischen denen aus Mainz und Königsberg, Weimar und Altona binnen kurzem eine erbitterte Debatte über das Thema Nummer eins begänne – eine Debatte, die von einem sehr weit rechts postierten Mann eröffnet würde, der unverzüglich daranginge, sein Literatur-Programm zu interpretieren – das folgenreichste Kunst-Papier, das es in Deutschland je gegeben hat.
Literatur, ließe der rechte Flügelmann, Johann Wolfgang von Goethe, erklären – Literatur als die große Sitten- und Humanitätsförderin habe die Aufgabe, das Politische zu transzendieren und, jenseits des tristen Hic et Nunc, das Menschliche in seine Rechte zu setzen. (»Dass alles aufhört politisch zu seyn und bloß menschlich wird«: Goethes Diktum, das »Wallenstein«-Finale betreffend, war ihm das höchste Lob, das einem Kunstwerk zuteil werden konnte.)
Politisch: ein Negativ-Wort. Politik: ein gefährliches Feld, bedrohlich für den einzelnen durch Außen-Anforderungen und darum von jenem Bezirk des Geistigen abzusondern, in dem allein Kultur, als »Reich der Freiheit«, realisiert werden könne: Das Enthobensein von Zwängen und Zwecken – so das Kunst-Programm der Weimaraner Klassik –, die nachdrücklich erklärte Neutralität des Poeten in Fragen des politischen Alltags, Abstinenz in praxi und – ein Wort von Herder – »aesthetische Selbstgenügsamkeit« seien Voraussetzungen, daß Humanität sich gegen Politik durchsetzen könne: »Je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüther in Spannung setzt«, schrieb Schiller – immerhin Ehrenbürger der Französischen Revolution – in der Einleitung zu der von ihm edierten Zeitschrift »Die Horen«… »je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüther in Spannung setzt, einengt und unterjocht, desto dringender wird das Bedürfnis, durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Einfluß der Zeit erhaben ist, die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen.«
Roma locuta – causa finita? Die Debatte um die deutsche, der révolution française Widerpart bietende Parallel-Aktion: durch einen Richtspruch aus Weimar entschieden? Keineswegs. »Liebe Kinder! Still! Nur nichts Politisches! Das mag er nicht!«: Die Bitte des Reichsfreiherrn vom und zum Stein, geäußert während einer Rheinfahrt, 1815, gegenüber Goethes Begleitung, trifft, allzu salopp, nicht den Kern des Problems. Wäre sie nämlich gelungen, die Französische Revolution: gelungen im Sinne der Übereinstimmung von aufklärerischer Theorie und Politik, dann, dies hat Schiller nachdrücklich in einem Brief vom Juli 1793 an den Herzog von Augustenburg statuiert: dann Valet, ihr Künste! Valet, da durch die Revolution im Hier und Jetzt Verstand, Herz, Phantasie und Gesittung der Menschen umgedreht worden wären – umgedreht in jenem republikanischen Freiheitsstaat, der den Notstaat des entarteten Feudalismus zum Gespött gemacht hatte!
»Wäre das Faktum wahr«, schreibt Schiller, »wäre der außerordentliche Fall wirklich eingetreten, daß die politische Gesetzgebung der Vernunft übertragen, der Mensch als Selbstzweck respektiert und behandelt, das Gesetz auf den Thron gehoben und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht worden, so wollte ich auf ewig von den Musen Abschied nehmen und dem herrlichsten aller Kunstwerke, der Monarchie der Vernunft, alle meine Thätigkeit widmen. Aber dieses Faktum ist es eben, was ich zu bezweifeln wage. Ja, ich bin so weit entfernt, an den Anfang einer Regeneration im Politischen zu glauben, daß mir die Ereignisse der Zeit vielmehr alle Hoffnungen dazu auf Jahrhunderte benehmen.« Kunst als Stellvertreterin der Politik, deren Schwester und nicht deren Fremde: auch dieser Aspekt – Literatur als die getreue Magd, die nach dem Scheitern aufklärerischer Praxis in die Bresche springt! – will nachdrücklich artikuliert sein, wenn man den Beitrag der Weimaraner »Rechten« – zumindest Schiller war es nicht! – zur Generaldebatte über »Literatur, Politik und Revolution« gerecht beurteilen will: Aufgabe der Kunst sei, so Schiller, nicht vorschnelle Negierung, sondern Vollendung der Französischen Revolution im Sinne einer Erfüllung ihrer geheimsten, auf die Überwindung menschlicher Entfremdung zielenden Intentionen – die Überwindung des »gesellschaftslosen«, auf sich selbst und die Verfolgung seiner Privatzwecke zurückgeworfenen Menschen.
Kunst als Meta-Politik: War’s wirklich nur ein Luftgespinst, nur Kompensation politischer Ohnmacht, dieses Theorem von der Literatur als der humanen Lückenbüßerin? Für Schiller gewiß nicht! Die »Briefe über Aesthetik« zeigen mit gebotener Klarheit, daß hier einer sehr genau wußte, wie wenig es eine Befreiung im Geiste ohne materielle Befriedigung gebe: »Erst muß der Geist vom Joch der Nothwendigkeit losgespannt werden, ehe man ihn zur Vernunftherrschaft führen kann« – Brief an den Herzog von Augustenburg, 11. November 1793 –, gewiß, »der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich satt gegessen hat, aber er muß warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll.«
Nicht um Humanität im Wolkenkuckucksheim, sondern um Verbesserung der theoretischen und praktischen Kultur war es »Weimar« zu tun, sofern es der Revolution eingedenk blieb – um die Vision einer Sozietät, in der die Fron der nur für sich schaffenden Individuen ins gesellige Spiel der frei assoziierten Gattungswesen umschlüge.
Eine Vision, wohlgemerkt: die Vision einer durch die Kunst befreiten Menschheit – aber nicht nur: Vision! Indem Schiller zeigte, daß die – sich autonom setzende – Kunst, vorscheinartig, zu versöhnen habe, was in der Realität widerspruchsvoll bliebe, denunzierte er, indirekt, die Inhumanität der politischen Wirklichkeit und machte ihre Heilsbedürftigkeit offenkundig: Das ästhetische »Ja« verweist auf ein politisches »Noch nicht«, aber erkauft sich dieses »Ja«, erkauft sich die Unbedingtheit eines utopischen Erziehungsauftrags – Kunst als Weg zur Freiheit – mit konsequenter und rigider Mißachtung des politischen Alltags.
Absehen von der Wirklichkeit um der Poesie und der Erfüllung ihrer Sinn stiftenden Aufgabe willen lautete die Devise der Klassik: Darum das Sich-Verschließen gegenüber sozialer Not (»Hier will das Drama gar nicht fort«, schreibt Goethe, die »Iphigenie« betreffend, an Frau von Stein, »es ist verflucht, der König von Tauris soll reden, als ob kein Strumpfwürker in Apolda hungerte«); darum, im Vertrauen auf Erziehung von oben und Klassenversöhnung durch eine besonnene Politik der altregierenden Schichten, der Verzicht auf jede Form politischer Agitation zugunsten der eines Kunstgenusses unfähigen Schichten; darum die Entschlossenheit, Literatur vor einer Okkupation durch das auf Unterhaltung und Belehrung erpichte Volk zu bewahren – Schillers Verhöhnung des um Popularität der Poesie bekümmerten Bürgers! –; darum am Ende sogar die elitäre Wiederbelebung jener höfisch-aristokratischen Stilmuster, die schon Lessing und die Stürmer und Dränger, unter Berufung auf Shakespeare, als obsolet erwiesen hatten: »Es droht die Kunst vom Schauplatz zu verschwinden« – Schiller über Goethes »Mahomet«-Inszenierung: Voltaire in Weimar! –, »Ihr wildes Reich behauptet Phantasie. Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, das Niedrigste und Höchste menget sie. Nur bei den Franken war noch Kunst zu finden, erschwang er gleich ihr Urbild nie, gebannt in unveränderlichen Schranken hält er sie fest und nimmer darf sie wanken.«
Da redet Fritz Schiller aus Marbach wie Friedrich II. von Preußen – Shakespeares Stücke, heißt es in »De la littérature allemande«, seien, in ihrem »wunderlichen Gemisch aus Tragischem und Harlekinpossen«, allenfalls würdig, »vor den Wilden von Canada« gespielt zu werden; da tritt die utopischaufklärerische Rolle der Poesie hinter der Funktion zurück, überalterte Herrschaftsformen, in strikter Abweisung revolutionärer Form-Experimente, zu verteidigen; da wird Literatur – entgegen der Geheim-Vision von der zweiten, nunmehr totalen Revolution – zum Vehikel der Weltflucht und des politischen Quietismus – »Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, und das Schöne blüht nur im Gesang«… und eben das war es, was die Demokraten unter den deutschen Schriftstellern, diese durch Europa ziehenden, bis nach Rußland, ja in die Südsee verschlagenen Literaten, die Forster und Seume und Weerth, den Weimaranern vorwarfen: daß sie ihre progressiven, auf mittelbare Veränderung der Wirklichkeit abzielenden Kunst-Intentionen immer leiser formulierten und immer lauter die literarische Apotheose des in neuer Gewandung wiedererstandenen ancien régime.
Literatur und Politik in Deutschland: Es wird Zeit, den »Neutralisten« von Weimar endlich ihren großen Widersacher, den letzten Jakobiner der Nation, gegenüberzustellen: jenen Einen, der, nach Goethes Tod, mit der Kraft seines Witzes Literatur wieder in ihre politischen Rechte einsetzte: Heinrich Heine – auf unserem imaginären Podium, Goethe gegenüber, auf der Linken angesiedelt … Heine, der nur jene Poesie anzuerkennen bereit war, die es wage, »den Schritt ins öffentliche Leben zu tun« und dem Versuch Paroli zu bieten, Literatur in ein wirklichkeitsfernes Reservat zu verweisen – einen Raum, in dem sich allenfalls ästhetische Kartoffelkriege, aber keine Literatur-Kämpfe austragen ließen, in denen die »große Suppenfrage«, die Frage nach Armut und Reichtum, Hütte und Palast obenan stand: »Heut helfen euch nicht die Wortgespinste der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen. Sie springen über die feinsten Sophismen. Im hungrigen Magen Eingang finden nur Suppenlogik mit Knödelgründen. Nur Argumente mit Rinderbraten, begleitet mit Göttinger Wurstzitaten. Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten, behaget den radikalen Rotten viel besser als ein Mirabeau und alle Redner seit Cicero.«
Hüben Heine und drüben die Weimaraner, hier der republikanische Reveille-Trommler und drüben der Herr von Goethe, der bis zum Tod nicht davon lassen mochte, Napoleon »seinen« Kaiser zu nennen; auf der einen Seite, Sprecher der Sozialisten und Demokraten, der »Tribun und Apostel«, Jude und Emigrant, Harry Heine aus Düsseldorf, und auf der anderen die nobilitierten Höflinge von Weimar: so plausibel die Fraktionierung des literarischen Parlaments der Deutschen zwischen 1789 und 1848 auf den ersten Blick erscheint, mit Heine und Goethe als Flügelmännern, so problematisch wird die Gliederung in rechts und links, wenn man bedenkt, daß keiner die Revolution im Hier und Jetzt derart gefürchtet hat wie Heinrich Heine – Demokratisierung bedeute das Ende der Kunst, den Triumph der Kartoffel über den Vers – und keiner, auf der anderen Seite, die befreiende, Fesseln lösende Funktion der Poesie inständiger beschworen hat als Friedrich Schiller.
Rechts oder links: Das Problem erweist sich als zweitrangig, sobald sichtbar wird, daß es den einen wie den anderen, den Republikanern so gut wie den Vertrauten der herrschenden Klasse, um Wahrung von Distanz zu tun war: Distanz der Literatur gegenüber rascher Indienstnahme – durch welche Fraktion auch immer! –, Distanz zu Parteiparolen, Distanz zur Macht, die auf ein klares »Ja« oder »Nein« erpicht war, Distanz vor allem – dies ist entscheidend – gegenüber dem imperativischen Anspruch des Faktischen, dem rüden Sosein des politisch Gegebenen.
Wie immer sie sich unterschieden, die Literaten, die, halb Unterhaus, halb Oberhaus, irgendwo zwischen der Exzellenz vom Frauenplan und dem Juden in der Matratzengruft beheimatet waren, in Residenzen oder Emigranten-Zirkeln: wie gering, dank disparater Lebensschicksale, die Verständigungsmöglichkeiten untereinander auch waren – eins zumindest hatten alle gemeinsam, Linke und Rechte: den Glauben, daß es die Grundaufgabe der Literatur sei, Faktizität, durch das Austräumen von Gegenwelten, zu transzendieren und Wirklichkeit, mitsamt ihren sozialen Antagonismen, durch den poetischen Entwurf eines Möglichkeitsreichs in Frage zu stellen: durch die Erinnerung an jenes Beinahe-Paradies zum Beispiel, das für die Dauer weniger Jahre Realität geworden zu sein schien – in den Tagen, da Immanuel Kant in Königsberg der Post entgegenging, weil er es nicht abwarten konnte, neue Zeitungen aus Paris zu erhalten.
Und dagegen nun das große Debakel nach 1848; dagegen jene allgemeine Tristesse im Zeichen einer totalen, die Erinnerung an den Menschheitsfrühling von 1789 auslöschenden Reaktion, die einer der letzten Aufrechten, der Reiseschriftsteller, Romancier und Pamphletist Georg Weerth, mit den Worten beschrieb: »Die – verlorene – Revolution hat schauderhaft unter den Menschen gewirtschaftet. Außer den tausenden von Existenzen, die dabei verloren gingen, ist eine solche Mutlosigkeit und Leere in die Gemüther gefahren, daß man selbst seine Freunde kaum wiedererkennt.«
Eine solche Mutlosigkeit und Leere: Vom beginnenden Bismarckreich aus gesehen gab es keinerlei Verbindungen literarischer Art mehr zum Vormärz – und auch zum andern, vom Willen zur konkreten Utopie in litteris erfüllten Weimar nicht. (Dafür eine Fülle von Bekenntnissen zu einem deutschen Olymp, von dem aus sich der Wilhelminismus absegnen ließ.)
Und damit begann dann, nach der gescheiterten Revolution und dem Sieg der preußischen Waffen anno 1866, jene Borussierung der deutschen Literatur, deren Ausmaß eine der wenigen Gegenschriften, die in Deutschland-Preußen noch publiziert werden konnten, Gervinus’ Ermahnung an das Königshaus, demonstriert, in der verlangt wird, die Tätigkeit eines Kulturvolks nicht für die eines Machtvolks dahinzugeben und, derart, von Krieg zu Krieg verwickelt zu werden.
Der Triumph Preußens, das war der Triumph Potsdams über Weimar, des monarchistischen Machtstaats über ein Stück Klein-Europa, ein Triumph, der bildungsbürgerliche Gesinnung süddeutsch-liberaler Provenienz durch den Ungeist jenes durch und durch »verassessorten« und »verreserveoffizierten« Bourgeois ersetzte, dem – neben Raabe einer der letzten Altliberalen – Theodor Fontane den Spiegel vorgehalten hat.
Vorbei die Zeit, da Literatur den Charakter einer wirklichkeitstranszendierenden Gegenkraft hatte: Affirmation oder Flucht ins Traumreich des höheren Menschen, wo die Klassiker in Goldschnitt regierten – ein Drittes gab es, zumindest idealtypisch, nicht im borussischen Deutschland der zweiten Jahrhunderthälfte – und das schon deshalb nicht, weil die Literaten, die lebenden jedenfalls, gesellschaftlich kaum mehr als Parias waren: »Catilinarische Existenzen«, pflegte Bismarck zu sagen, »Menschen: unfähig zum Elementarschullehrer und zu arbeitsscheu zum Postsekretär.«
Während die Dahns und die Heyses und die Scharen borussischer Barden in Dichterhallen einhergingen – und in der Deutschen Bank natürlich –, hatten Fontane und Raabe bürgerliche Periodica zu bedienen: darauf verwiesen, literarischen Ruhm – und den Adlerorden vierter Klasse, wenn’s hoch kam – mit Hilfe von Leihbüchereien und deren Kundschaft aus Adel und Bourgeoisie zu gewinnen.
Das hieße also: Es herrschte Friedhofsruhe im Land? Literarische Opposition – Erinnerung an den August 1789, die Befreiung des Bürgertums aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, sei zwischen Heines Tod und Hauptmanns Anfängen im von Preußen bestimmten Deutschland unmöglich gewesen?
Nein, das am Ende denn doch nicht. Schließlich ging es an der Isar immer noch liberaler zu als an der Spree – es gab den Simplizissimus, gab freisinnige Gazetten; doch selbst in Berlin, dies zeigt das Beispiel Fontanes – Pastor Lorenzens großes Geschichtskolleg im »Stechlin«! –, war es immerhin möglich, nicht nur der herrschenden Klasse die Kultur abzusprechen, sondern gelegentlich sogar ein Wörtchen für die verhaßten Sozialdemokraten fallenzulassen, in der Möglichkeitsform jedenfalls – so wie der Oberlehrer Willibald Schmidt in »Frau Jenny Treibel«: »Wenn ich nicht Professor wäre, würde ich am Ende noch Sozialdemokrat.«
Freilich, was er ganz insgeheim dachte, Theodor Fontane, das konnte er nicht einer Gesellschaft zumuten, deren obere Kreise selbst den Roman »Irrungen Wirrungen« für eine Hurengeschichte erklärten, das mußte vertraulich bleiben zwischen Mann und Frau, dem Freund und den Freunden: »Die neue bessere Welt fängt erst beim Arbeiter an; das, was die Arbeiter denken, sprechen, schreiben, hat das Denken, Sprechen, Schreiben der altregierenden Klassen tatsächlich überholt«; aber der gleiche Fontane, der sich im Brief so revolutionär gab, war als Romancier nicht in der Lage, einen Arbeiter zu beschreiben; bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein blieb – Ausdruck politischer und kultureller Rückständigkeit der Nation – die Arbeiterschaft mitsamt ihrer Millionenpartei, der Sozialdemokratie, »illiterat«, tauchte allenfalls als malerische Gruppe auf … oder als Demonstrationsmaterial, in der Pathologie eines Professors, der unter Deutschlands Literaten wahrscheinlich der fortschrittlichste war: Rudolf Virchow, der mit dem Blick auf seine von Elend und Ausbeutung zeugenden Opfer auf dem Sektionstisch für eine Assoziation der Besitzlosen plädierte, damit die Ausgebeuteten endlich aufhörten, Maschinen der Reichen zu sein: »Capital und Arbeit«, so Virchow, »müssen mindestens gleichberechtigt sein und es darf nicht mehr die lebendige Arbeit dem todten Capital unterwürfig sein.«
Jawohl: Es gab Ausnahmen, die die Regel bestätigen – einen Literaten, Fontane im Kaiserreich, der die Arbeiter für intelligenter als Adel und Bürgerstand hielt, es gab einen Virchow, gab den Historiker Mommsen, der anno 1902 für das historische Bündnis zwischen den Liberalen und den »durch die Habsucht der Interessencliquen gedrückten und zum Teil erdrückten« Arbeitermassen plädierte. Aber die Wirkung dieser drei – und eines Gervinus’, zu dessen obersten Zielen die Entschädigung des von Preußen gedemütigten Österreich gehörte –, die Wirkung dieser drei war null und nichtig: Das Testament Theodor Mommsens, der von Bismarck sagte, er habe der Nation das Rückgrat gebrochen, spricht für sich selbst: »Ich wünschte ein Bürger zu sein. Aber das ist nicht möglich in unserer Nation, bei der auch der Beste über den Dienst im Gliede und den politischen Fetischismus nicht hinauskommt. Diese innere Entzweiung mit dem Volke, dem ich angehöre, hat mich durchaus bestimmt, mit meiner Persönlichkeit nicht mehr vor das deutsche Publikum zu treten, vor dem mir die Achtung fehlt.«
Triumph Potsdams über Weimar; Triumph der durch die Waffen geschaffenen Fakten über die humanen Vorträume der Neutralisten von der Ilm und der auf Distanz zur Parteiherrschaft jeglicher Art bedachten Jakobiner à la Heine: Mommsens Testament macht deutlich, was er bedeutete, für die Gesittung und Kultur der Nation, dieser Sieg, zeigt an, wer das Sagen hatte, in Preußen, und wem die Referenz zu gelten hatte, nach 1866: dem Ungeist einer Nation, die keine Geschichte hatte, sondern im gleichen Maße »Kunstprodukt« war wie die Ideologie, die sie trug – schwarz-weiß-rote Gesinnung, die Konturen nur ex negativo gewann: in entschiedener Absetzung von der republikanisch-demokratischen Erbschaft von 1789 und 1848 und in rigoroser Kampfansage an den Internationalismus der sozialdemokratischen Arbeiterschaft. Wie künstlich sie war, die deutsche Ideologie à la Heinrich von Treitschke, die einen Nationalstaat zu adeln hatte, der auf den preußischen Bajonetten ruhte, beweist das Faktum, daß es zu ihrer Verlebendigung eines Krieges bedurfte – einer gleichsam »nachgereichten« nationalen Revolution, in der, was »von oben« oktroyierte und mit militärischem Drill eingebläute Ideologie war, den Charakter einer mit Blut besiegelten Gemeinschaftsvision gewann: »Deutschland, Deutschland über alles« – das Symbol jener Volk-Werdung eines Verbands von Bayern, Preußen, Mecklenburgern, Schwaben, die zuallererst die Schriftsteller begeisterte: »Krieg«, heißt es in Thomas Manns »Gedanken im Kriege« (Gedanken, die am Ende des Zweiten Weltkriegs Serenus Zeitblom, der Erzähler des »Doktor Faustus«, noch einmal in entzückter Rede evoziert), »Krieg«, das war »der nie erhörte, der gewaltige und schwärmerische Zusammenschluß der Nation in der Bereitschaft zu tiefster Prüfung – einer Bereitschaft, einem Radikalismus der Entschlossenheit, wie die Geschichte der Völker sie bisher nicht kannte.«
Das sind Worte, denen Stellvertretungscharakter zukommt: Nach 1789 redet, anno 1914, zum ersten Mal wieder nahezu die gesamte Intelligenz des Landes mit einer Stimme – jetzt freilich nicht dem bürgerlichen, die Emanzipation der Unterdrückten befördernden Internationalismus, sondern einem bornierten Chauvinismus das Wort leihend –, reden die Dichter nicht anders als die Professoren oder – rabiateste Gruppe der Kriegsapologeten! – die Pastoren: Kein Ereignis – mit Ausnahme der Französischen Revolution, wie gesagt – ist von Deutschlands Poeten so einhellig und emphatisch begrüßt worden wie der »Aufbruch« vom August 1914.