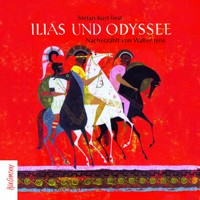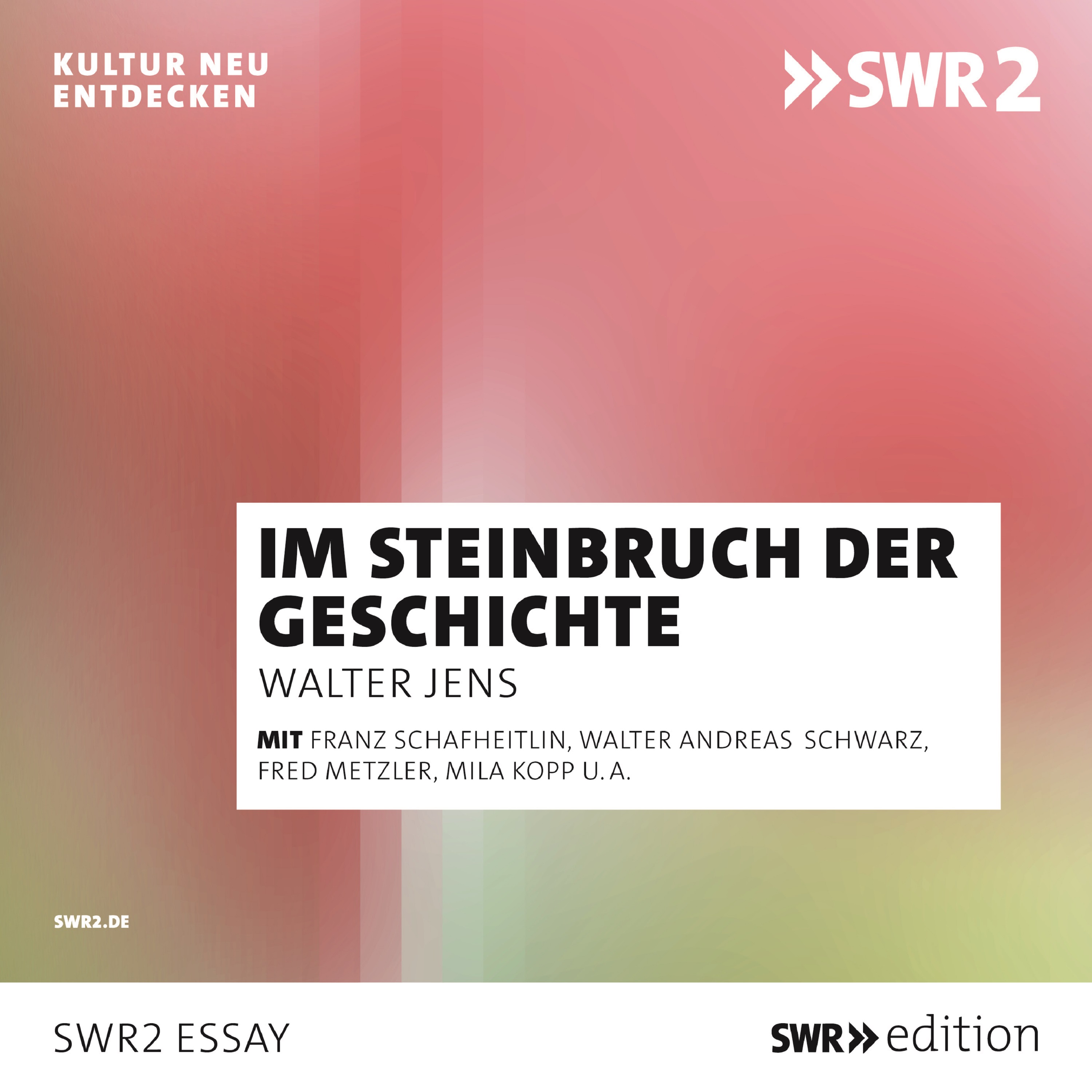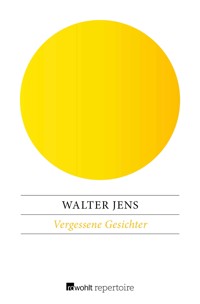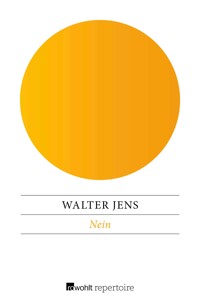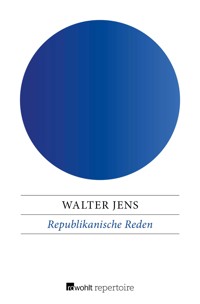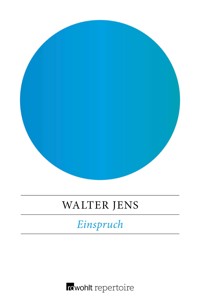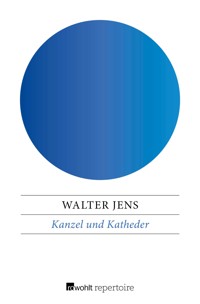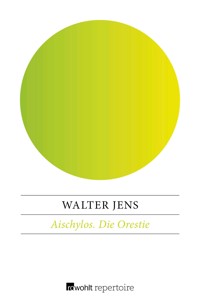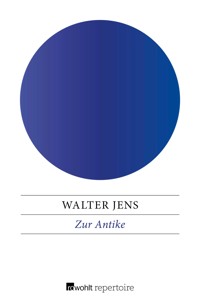
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Walter Jens zeigt sich hier in seiner Vielfalt: Schlaglichtartig werden in seinen Essays, Fernsehspielen und Übersetzungen Gestalten und Motive der Antike beleuchtet, geschichtlich-mythische bzw. dramatische Stoffe der Weltliteratur originell umgestaltet und aktualisiert, die Wechselbeziehungen zwischen Antike und Moderne veranschaulicht. Die äschyleische Tragödie, die Antigone des Sophokles und der Dramatiker Euripides sind sein Gegenstand ebenso wie Cäsar, Philoktet, Odysseus und die Götter des Olymp. Mythisches tritt in die Dimension der Gegenwart ein und wird zur behandelbaren Geschichte. Die interpretierende Variation gibt dem Mythos seine Zeitlichkeit, dem Modell seine Konkretheit, dem Archetypus seine Historizität zurück. In der Form eines themengebundenen Readers präsentiert der Band den Autor in der Fülle seiner poetisch-essayistisch-wissenschaftlichen Tätigkeit: als gelehrten Ciceronen, der die Modernität des Altertums nachweist, als Novellisten und Fernsehspiel-Autor, als poeta doctus, dem es, im Sinne Thomas Manns, gelingt, den Mythos ins Humane umzufunktionieren und als Übersetzer von Sophokles' Ajas – ein Wissenschaftler, Essayist und Schriftsteller in alledem, der mit Hilfe vielfacher Annäherungsweisen an das klassische Altertum dem scheinbar Fernen Zeitbezogenheit und dramatische Aktualität gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Meinem Lehrer
Bruno Snell
Meinen Kollegen und Konfratern
Richard Kannicht
Ernst-Richard Schwinge
Meinem Schüler und Freund
Wilfried Barner
Vorwort
»Herodot, Xenophon, Thukydides, Demosthenes und der göttliche Platon, Homer, Cornelius Nepos, Caesar, Livius, Sallust, Tacitus, Ovid, Vergil, Catull, Horaz … nimm eine Geschichte der Kultur, der Wissenschaft, der Kunst, der Literatur zur Hand – diese Namen leuchten darin. Seit Jahrtausenden leuchten sie, und sie werden noch Jahrtausende leuchten. Lernst du sie nicht kennen, du wirst sie nie kennenlernen. Du verlierst Unendliches fürs ganze Leben. Wie gern hätte ich jetzt meinen Vergil, Horaz, Homer, Sophokles, Platon hier. Wie lebendig sind mir viele horazische Oden wieder geworden, sie kommen nachts – in den langen, langen Nächten und leisten mir Gesellschaft – wie glücklich wäre ich, wäre mein Schatz an solcher Kenntnis zehnmal größer, lessingsch groß«: Das sind Sätze aus einem Brief, den ein Strafgefangener aus der Haftanstalt an seinen Sohn schreibt, um ihn vom Sinn und Nutzen der Klassiker griechisch-römischer Provenienz zu überzeugen. Sätze, die ein Mann formuliert hat, für den – dies hat ihm die Grenzsituation seiner Inhaftierung gezeigt – Platon und Catull zum eisernen Bestand gehören: zum Unveräußerlichen und Unverzichtbaren. Sätze von Karl Liebknecht.
Liebknecht und Ovid, der Revolutionär und die homerischen Epen: Wie kommt das zusammen? Wer so fragt, verkennt die Tatsache, daß die antiken Klassiker für die literarische Avantgarde im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts den Charakter von Nothelfern hatten: Am Beispiel der Griechen hat Hegel verdeutlicht, wie, jenseits von Despotismus und bürgerlicher Privatheit, republikanische Freiheit aussehen könnte, hat Marx, der Aischylos-Leser, gezeigt, welche Struktur ein Gemeinwesen haben sollte, in dessen Bezirken es dem Menschen möglich ist, nach dem Maß der Schönheit zu formieren, hat Wilhelm von Humboldt die »einzige eigentlich gesetzmäßige Verfassung in Griechenland« beschworen.
Graeca sunt, non leguntur: Das ist eine Devise, in deren Bannkreis sich ein großes imaginäres Gespräch erfinden ließe – ein Disput, den die Gräkomanen von Humboldts oder Marxens Schlag gegen die Verteidiger der Römer ausfechten müßten: Friedrich Nietzsche allen voran. Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein, man kann es nicht oft genug sagen, hatte die Geisterbeschwörung der Jakobiner und Republikaner in Deutschland oppositionellen Charakter: mit den Alten gegen die -ismen des ancien régime, den Territorialismus, den Feudalismus, den Romanismus, den Klerikalismus und für nationale Einheit, bürgerliche Verfassung, kulturelle Souveränität und allgemeine Aufklärung.
Lang, lang ist’s her. Nach dem Debakel von 1848 begann sich – erst langsam, dann rapide – die Funktion der Humaniora im Bildungswesen zu wandeln. Was einst, nach dem Willen der Neuhumanisten, zur Beförderung eines demokratischen Unterrichtswesens dienlich sein sollte: das Studium der Antike wurde mehr und mehr zum Privilegium einer machtgeschützten Elite. Hatten die Republikaner in der ersten Jahrhunderthälfte, durch die Beschwörung des ganz Anderen und Besseren, Wert auf Distanz zur bestehenden Ordnung gelegt, hatten das Freiheits-Reich der Kunst, des Spiels und schönen Scheins dem Obrigkeits-Staat gegenübergestellt, das »so war’s einmal« und »so könnte es sein« dem »so ist es«, hatten, auf Emanzipation des Bürgertums bedacht, nach oben hin argumentiert, so kämpften, in der zweiten Jahrhunderthälfte, die auf die Einheit von Bildung und Besitz pochenden Bourgeois mit umgekehrter Frontstellung. Bestrebt sich nach unten hin abzugrenzen, von den Volksschul-Plebejern und den Realschul-Banausen des Kleinbürgertums, stellten die Anwälte der klassischen Bildung die Humaniora in den Dienst der Macht. Wer Griechisch und Latein konnte, »gehörte dazu« und war aufgenommen in den Kreis jener konservativen Elite, die sich als »geistiger Generalstab« verstand, »der durch die Schulen von Hellas und Rom hindurchgegangen« sei – aufgenommen in den Zirkel der upper ten, wo man Kultur gegen Zivilisation und hellenische Paideia gegen das Unterrichtswesen im Zeitalter der Vermassung ausspielte: das Humanistische Gymnasium als Hort eines Geistes, durch den legitimiert und ideologisch geweiht sich, im Bereich der Macht, trefflich Politik auf Kosten des Volks machen ließ.
Vergangen und vorbei, auch dies: Heute, in einem Augenblick, wo Bildung unter dem Diktat der Zwecke und der Zwänge steht (wozu dient das? wem nützt es? was ist damit anzufangen?), ist das Studium des Altertums zu einem Geschäft von Glasperlenspielern geworden: Die entente cordiale zwischen den Rechten (die ihren Hegel vergessen) und den Linken (die von Marx und Liebknecht nichts wissen) hat der Beschäftigung mit der Antike den Charakter einer Kloster-Arbeit gegeben … und das ist, wie die Dinge im Augenblick stehen, nicht einmal das Schlechteste. Im Kloster hat schon mancher überlebt und in der Zelle jene auf dem Markt nicht mehr gefragten Güter bewahrt, die sich plötzlich, wenn der Wind sich dreht, als eiserner Bestand erweisen (unverzichtbarer Vorrat in Liebknechts Sinn), ohne den es wohl Existenz, aber kein Leben mehr gibt: Wenn alles nur Augenblick und Unmittelbarkeit ist – ein von der Hand in den Mund leben, dann wird es, da der Blick auf das »nächste Fremde« und den »vertrauten Kontrast« des Antiken verstellt ist, zumindest erschwert sein, das schlechte Wirkliche in kritischer Opposition zu transzendieren.
Die in diesem Band gesammelten (teils gedruckten, teils noch unpublizierten) Studien, eine Reihe von Abhandlungen und Essays, ein Reisebericht, eine Erzählung, ein imaginäres Gespräch, zwei Fernsehspiele und eine Übersetzung … diese Studien sollen zeigen, wie viel, das sei mit aller Nüchternheit gesagt, verloren geht, wenn in den »langen, langen Nächten« jene Überlieferung nicht mehr verfügbar ist, deren produktive, zum Selbst- und Besser-Machen herausfordernde Aneignung (so hat Lessing die Beschäftigung mit der Antike verstanden) der Literatur bis in unsere Tage hinein (ein Name für viele: Heiner Müller) ein Plus an Tiefenschärfe und Verweiskraft gegeben hat, an Evokation der nahen Ferne, die Gegenwärtiges mitbedeutet … ein Plus, das nicht leichtfertig verspielt werden sollte.
»Wir würden noch in der Barbarei leben, wenn nicht die Überreste des Altertums in verschiedener Gestalt vorhanden wären«: Wer den Appell-Charakter antiker Texte bedenkt, die ungebrochene, zur Konkurrenz zwingende Herausforderung, wird den anno 1830 formulierten Goethe-Satz so unrichtig nicht finden. Auch und gerade heute nicht.[*]
Essays
Die griechische Literatur
Wer die griechische Literatur zu klassifizieren sucht, muß, aus vier Gründen, besonders vorsichtig sein. Zuerst: da die Griechen in den Wissenschaften und Künsten jene Modelle erdachten, an deren Perfektion wir noch heute arbeiten, ergibt sich leicht eine fatale Vertraulichkeit, ein Identifizieren und spielerisches Vergleichen: sind »Damals« und »Heute« nicht ähnlich, war in Griechenland nicht schon alles vorhanden, fragt der Betrachter, von der poetischen Chiffre bis zur Fach-Terminologie? Schien nicht selbst die christliche Religion vorgebildet zu sein – Paulus auf dem Areopag, Ödipus als präfigurierter christlicher Märtyrer, der »katholische Charakter der griechischen Tragödie« (W. von Schütz)?
Auf der anderen Seite sucht man, nicht minder extrem, Nietzsches Warnung vor der impertinenten Familiarität beherzigend, zwischen »Hellas« und »Hesperien« gewaltsam zu trennen, griechische Denkweisen als fremd, widerchristlich und ganz und gar eigen zu zeigen: wie könnte man glauben, heißt es, das Hellenische recht zu erfassen, wenn man mit Vokabeln wie »Das Böse« oder »Die Sünde« operiere, während die Griechen doch nur »Das Schlechte« oder »Den Fehler«, Worte ohne moralische Fixierung, kannten?
Die zweite Schwierigkeit: auch der Kenner entgeht nicht leicht der Gefahr, das Überlieferte mit der griechischen Literatur zu verwechseln. In Wahrheit ist die Auswahl willkürlich: von pädagogischen Gesichtspunkten geleitet, dem Aristotelischen Zielbestimmungs-Gedanken folgend, wollte man schon zur Zeit der Spätantike vor allem jene Werke erhalten, in denen, wie man meinte, eine Gattung »ihre eigene Natur fand«. Darüber hinaus war der Gesichtskreis der Zensoren nicht gerade weit: allen Kompilationsinteressen, aller sammelnden Gelehrsamkeit zum Trotz suchte man gerade in einer Zeit, da die koine, das Allerweltsgriechisch, Straßen und Foren beherrschte, die attische Prosa mit dem Signum der Klassizität zu versehen (»Attizismus«). Vom ersten vorchristlichen Jahrhundert über die Hadrians-Ära und die Epoche der zweiten Sophistik (zur Zeit der Antonine) bis zum Ausgang der Antike, bis zur Schließung der Platonischen Akademie, 529 n. Chr., und, im gleichen Jahr, der Eröffnung des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino, entschied der Attizismus, rigoros und pathetisch, über Gedeih und Verderb der griechischen Literatur.
Wer bedenkt, wie manches bedeutsame Zeugnis der klassizistische Purismus nicht des Tradierens für wert befand, wird die von »romantischen« Gesichtspunkten bestimmten Auswahl-Prinzipien beklagen – doch zugleich bedenken müssen, daß agonale Sichtungen und gnadenlose Siebungen seit eh und je dem griechischen Wesen entsprachen: Wettkampf allüberall, und nur einer kann siegen; nur einer, der Finder, stößt auf das Geheimnis der Form, er-findet nicht, sondern entdeckt ein Prä-Existentes, befreit es aus der Hüllung des Steins, hebt die Gestalt aus dem Gefängnis des Marmors, löst das Hexametermaß aus dem Sprachfleisch heraus … und diesem Mann gilt es zu folgen, seine Errungenschaften muß man kunstreich verwandeln – auf keinen Fall eine zweite Schöpfung, mit der ersten rivalisierend! War einmal der Grundstein gelegt, dann hielt man in Griechenland zäh und entschlossen am Gegebenen fest, sprach von kanonischer Geltung und vergaß das tastende Versuchen des Beginns … SOPHOKLES, nicht Thespis; HOMER, nicht die Kykliker; THUKYDIDES, nicht Hekataios: der Klassiker, nicht der Schöpfer ist der Finder.
Nachdem das Verborgene ans Licht gekommen war, konnte man nur noch im Detail variieren; die großen Linien waren, bis in den Dialekt hinein, fixiert: das Epos blieb jonisch, das Chorlied dorisch, die Liedkunst äolisch, Drama und Geschichtsschreibung attisch. Wie winzig erscheint uns Heutigen die Spanne zwischen AISCHYLOS und EURIPIDES! Doch ist das ein Wunder? Die Norm war nun einmal bestimmt, der Bezirk umgrenzt, den die Nachfolger im Zeichen des Agons immer vollkommener einzufassen suchten. In Zeiten, da es gut um die Künste steht, heißt es bei Valéry, kann man sehen, wie sie sich Schwierigkeiten schaffen, die nur Geschöpfe ihrer Einbildung sind … und sich den Gebrauch der Fähigkeit untersagen, mit sicherem Griff im Augenblick alles machen zu können, was in ihrem Wollen liegt.
»Selbstbeherrschung« heißt das Zentralgebot der griechischen Klassizität – deshalb die Anerkennung der Normen, die Repetition auf vorher bezeichnetem Feld, deshalb Agon und Polemik, Invektiven, die von jedermann zu beurteilen waren, da Stoff und Regel, Mythos und Grundstruktur als bekannt gelten konnten. Noch die groteskeste Variation (Antigone als Schäfermädchen von Haimon versteckt, Orest und Aigisth als Verbündete), noch die verzerrende Paratragödie der Komödie weist auf das Urbild zurück.
»Originalität« war, sieht man von den Erfindungen der Komödie ab, durchaus verpönt – AGATHONS Fabel-Erfindung scheint eine Ausnahme gewesen zu sein –; und eben deshalb konnte man immer vergleichen und mochte es, als Freund des Agon, nicht für ungebührlich halten, wenn ein Autor auf seine Vorgänger einhieb, um das Eigene desto sichtbarer zu demonstrieren: so kämpfte, im Theogonie-Prooimion, HESIOD gegen HOMER (spätere Zeiten ließen die Dichter im Agon einander begegnen), so ARISTOPHANES gegen EUPOLIS, so, noch viele Jahrhunderte später, POLYBIOS gegen TIMAIOS. Einer gegen alle – deshalb die sphregis, das »Siegel« in der Lyrik, deshalb die Parabase der Komödie.
Kurzum, wenn der Agon, der Wettstreit, als konstitutives Prinzip des Kosmos erscheint (»monologische« Formen gab es erst im Hellenismus), wenn Götter gegen Götter und – nach ANAXIMANDER – Elemente gegen Elemente kämpfen, wenn sich, bei KORINNA aus Tanagra (um 500 v. Chr.), der Kithairon und der Helikon, bei KALLIMACHOS (ca. 305 – 240 v. Chr.), im vierten Iambos, Lorbeer und Ölbaum befehden, dann wird der Betrachter, um ein Prinzip der griechischen Dichtung wissend, auch den streitlustigsten Attizisten Abbitte tun, zugleich freilich bedenken, daß antike Kanonisierung die Perspektive denn doch gehörig verzeichnet: HOMER und SAPPHO begannen nicht jenseits des Nichts; ein AMEIPSIAS, dessen Komasten die Preisrichter – sicherlich nicht durchweg dumme Leute! – über die Vögel des ARISTOPHANES stellten, mag so wenig wie der Tragiker AGATHON von den klassischen Dramatikern durch einen Abgrund getrennt sein. Kurzum, die Überlieferung trügt; Aristotelische Entelechie-Erwägungen haben das Bild nicht anders als attizistische Dogmen und didaktische Spekulationen – die Erfordernisse der Schule! – verzerrt.
Die dritte Schwierigkeit. Nachdem man jahrhundertelang die griechische Autochthonie, das Eigenständige hellenischer Praktik verklärte, droht das Pendel heute nach der anderen Seite hin auszuschlagen. Ist man nicht allzusehr geneigt, wie einst zu Zeiten Novalis’ und Creuzers, das Hellenische »vom großen Orient aus« zu betrachten, den Raum zu erweitern und, wie der späte Hölderlin oder der Autor der Ägyptischen Helena, hinter dem Griechischen Bezirke Asiens heraufdämmern zu lassen? Östliche Kosmogonien überschatten das vorsokratische Denken, HESIOD (um 700 v. Chr.) erscheint als kunstreicher Verwerter hethitischer Mythen, und der Mathematiker THALES (um 600 v. Chr.) greift auf ägyptische Archetypen zurück. Rückt eine solche Betrachtungsweise nicht die Eigenart des Griechischen: lernend zu verwandeln, aus praktikablen Modellen wissenschaftliche Systeme, aus Geschichten stringente Gleichnisse zu machen, nur allzu langsam in den Blick?
Die vierte Schwierigkeit. Wir sprechen von der hellenischen Literatur als von einer sehr hohen Kunst (von der Volkskunst wissen wir so wenig wie von den fabulösen Vorstufen der Gattungen), und dabei identifizieren wir einmal »Literatur« mit »Poesie« und bedenken zum anderen nicht, daß unser Begriff »Kunst« im Griechischen kein Äquivalent hat – techne heißt Handwerk, der homerische Sänger steht neben dem Zimmermann und dem Arzt, der Poet gehört einer Zunft an, ist Gildengenosse, sein Können vererbt sich – Aischylos’ Sippe! – vom Vater auf den Sohn, seine Praktiken können, als Technik, durch Preis und Richterspruch gebilligt oder verworfen werden: als ein »Macher« stellt sich der griechische Dichter im Agon der Kritik; nur ein Scharlatan wie der Rhapsode Ion sucht, bei Platon, mangelndes Können durch den Hinweis auf göttliche Gaben zu tarnen.
Mag sich der Poet auch, aus Gründen der Legitimation, auf die Musen berufen, seine Dichtung ist niemals reine Selbstaussprache, sondern immer auch Anruf und Lehre; die Grenzen zwischen reiner Poesie und Didaktik, Vision und Analyse sind fließend: Privates wird, im Mund des Chors, objektiviert; lyrische »Stimmung« verflüchtigt sich im starr-responsorischen Rhythmus; Persönliches gewinnt im dialogischen Akt den Charakter der gnome; SAPPHO trägt persönliche Erfahrungen – Schöner als Reiter und Schiffe ist das in Liebe Ersehnte – objektiviert als Maximen und Sentenzen vor.
Wo also endet die Poesie und wo beginnt die Lehre, wo ist der Trennungsstrich zwischen Bild und Gedanke? Wird die griechische Antike nicht gerade durch die Verschränkung von Wissenschaft und Kunst geprägt? Von dem Philosophen PARMENIDES (um 500 v. Chr.) bis zu dem Astronomen ARAT von Soloi (315 – 239 v. Chr.) analysiert man die schwierigsten Fragen im Hexametermaß; die Baumeister und Bildhauer, POLYKLET und IKTINIOS, nehmen zu Fachfragen Stellung; SOLON (um 600 v. Chr.) legt Rechenschaft in Distichen ab; THUKYDIDES (ca. 455 – 398) ist, ungeachtet der strengen Methodik, auch ein Meister der Szene; welcher Autor, von Boccaccio und Defoe bis Camus, erreichte, bei der Beschreibung der Pest, die farbenreiche Sprache des attischen Historiographen? PLATON (427 – 347 v. Chr.), die Beispiele ließen sich häufen, war Systematiker und Mythenbildner, Zeichner des Tugendsystems und Schöpfer des Höhlengleichnisses zugleich; SOPHOKLES (497–406 v. Chr.) auf der anderen Seite führte, im Chorlied, eine »philosophische« Auseinandersetzung mit der Sophistik (das Stasimon Ungeheuer ist viel als Protagoras-Replik!); EURIPIDES (ca. 480–406 v. Chr.), ein erster poeta doctus, wurde zum Lehrer der Zeit; durch MENANDERS (ca. 343 – 293) Masken tönten die Maximen des Peripatos, der aristotelischen Schule.
Vom Epos zur Tragödie
Epik – Lyrik – Drama: HOMER und HESIOD (um 700); Iambos, Elegie, Melik und Chorlyrik (7. bis 5. Jahrhundert); Tragödie und Komödie (5. Jahrhundert), der Dreischritt der frühgriechischen Literatur, die Entwicklung von der Ilias bis zum Schwanengesang der Tragödie, dem Ödipus auf Kolonos, liegt offen zutage. Doch wie zögernd öffnet sich der Vorhang, wie spät setzt unser Wissen ein: tausend Jahre Licht zwischen HOMER und PLOTIN, und davor mehr als tausend Jahre Dunkel, von der indogermanischen Einwanderung bis zur Niederschrift des Verses: Vom Zorn des Achilleus künde mir, Göttin. Alles, was vor Homer, vor der Zeit geschah, da man jene griechische Buchstabenschrift erfand, die uns zuerst das 8. Jahrhundert bezeugt, verliert sich in der Dämmerung. Düstere, mit der dorischen Wanderung (um 1200 v. Chr.) verbundene Zeitläufe, tote Jahrhunderte, machen es unmöglich, die Brücke zwischen der kretisch-mykenischen und der griechischen Kultur, zwischen einer Epoche, in der man nach Troja aufbrach, und jener anderen, in der man den Aufbruch anachronistisch und archaisierend beschrieb, mit Zuversicht und Evidenz zu schlagen.
HOMER: das ist, ungeachtet künftiger Neufunde in der Linear B (der heute wahrscheinlich entzifferten griechisch-minoischen Silbenschrift des 2. Jahrtausends), für uns immer noch ein Gipfel jenseits des Nichts, eine Summe, deren Teile niemand kennt. Ilias und Odyssee sind die Zeugen früher Klassizität: während die Epiker, Verfasser von Zyklen, gemeinhin Historien schilderten, Chroniken verfaßten und Handlungsabläufe beschrieben, ordnete HOMER, ein erster genialer »Finder«, die Geschehnisse – leitmotivisch, raffend und verkürzend – mit Hilfe eines gliedernd-strukturierenden »Problems« und führte so das Epos »zu seiner eigenen Form«. Hier der Zorn und dort die Irrwege, hier der tragische Groll und dort die unselige Heimfahrt: zum erstenmal in der europäischen Literatur werden vielschichtige Zusammenhänge aus der Perspektive eines isolierten Helden betrachtet.
Das Generalthema der griechischen Dichtung klingt schon im frühesten Kunstwerk, der Ilias, an: Vereinzelung und Schuld. Im gleichen Augenblick, da die Hellenen die Züge des Individuums zeichneten, beschrieben sie seine Ambivalenz, seine Größe, die es so tief fallen, seine Isolation, die ihm Profil gibt und es schuldig sein läßt: von HOMER bis SOPHOKLES, von ANAXIMANDER bis EURIPIDES die Darstellung des principium individuationis, die Analyse des tragischen Gegensatzes von Selbst- und Weltverwirklichung, das Interpretieren einer Un-geheuerlichkeit, die, nach griechischer Auffassung, das Wesen des Menschen bestimmt.
HOMER freilich beschreibt Individuen, ohne als einzelner selbst in Erscheinung zu treten. Die Berufung auf die Muse genügt, um ihn zu legitimieren; nur sehr allmählich kommt das Subjekt des Schreibenden ins Spiel. Bei HOMER ist die Göttin sehr groß, der Dichter, als Spiegel und Medium, klein; aber schon HESIOD läßt die Mädchen von Helikon Wahres, doch auch Falsches verkünden; Schein und Sein sind zu trennen; die Deutung ist Sache des Menschen; SOLON fordert, Homer umkehrend, die Göttinnen auf, ihn zu hören; PARMENIDES macht sich selbst auf den Weg, der Wahrheitsschwelle entgegen: die Muse wird zum literarischen Emblem.
Dennoch, so sehr sich Ilias und Odyssee, so sehr sich die homerisch-jonische Adelswelt und der böotische Bauernkosmos eines HESIOD voneinander unterscheiden: der Dichter bleibt in einer festen Gesellschaftsordnung geborgen; der Raum ist in der Vertikalen und Horizontalen, theologisch und soziologisch, in gleicher Weise gegliedert. Erst auf dem Scheitel des siebenten Jahrhunderts tritt ein Mann, ARCHILOCHOS von Paros, als ein einzelner den anderen gegenüber, fordert die Welt in die Schranken und nennt seinen Namen.
Während die Zeit sich rapide verwandelt, der Äon der Kolonisation, von Sizilien bis Ägypten, beginnt, und die Geldwirtschaft den Handel mit Naturalien ersetzt, während die Tyrannen eine präfigurierte Demokratie schaffen, zerfallen die überindividuellen Gesetze der alten Standesgesellschaft: Recht, dike, nicht Ansehen, time, erscheint von nun an als Leitwort. Anders als für Achilleus, der, dem Adelskodex entsprechend, seinem Gegner Agamemnon vorwirft, er habe ihm die Ehre und die Geltung geraubt, gibt es für den Vertreter des lyrischen Zeitalters, für ARCHILOCHOS, nichts Schändlicheres als die Verletzung der Gerechtigkeit.
Der Raum erweitert sich: time ist der Zentralwert einer Klasse, das unbezweifelte Ideal der Ilias-Anakten, dike hingegen gilt allüberall, verpflichtet den König nicht anders als den Proleten, den Herrscher so gut wie den Sauhirten, den Mächtigen in gleicher Weise wie den Geschlagenen.
Schon in der Odyssee, wo Odysseus im Namen der Gerechtigkeit die Freier ermordet, macht sich der Wandel bemerkbar – erscheint der Zyklopen-Staat nicht wie eine Parodie der Ilias-Welt, Polyphem als Zerrbild eines reisigen Fürsten? –; aber erst HESIOD gibt der dike die Würde eines Prinzips: die Herrschaft der Gerechtigkeit ist von nun an identisch mit dem Walten des Zeus.
Auch der Vertreter des lyrischen Zeitalters, das um 700 beginnt und sich bis zur Klassik erstreckt … auch der isolierte, im Zustand der Ohnmacht sich selbst findende Dichter, SAPPHO, ARCHILOCHOS, ALKAIOS, entdeckt am Ende die verlorenen Gesetze aufs neue. Mag auch der einzelne seine Eigenwelt errichten, und, wie Sappho, die Liebe schöner finden als Reiter und Fußvolk, mag die Homerische Identität von Gutsein, Schönsein, Rittertum und Erfolg zerbrechen, mag Archilochos dem gestriegelten Feigling den krummbeinigen Haudegen gegenüberstellen und damit die revolutionäre These verkünden: ein Häßlicher kann tapfer und ein Schöner feige sein; mag der gleiche Archilochos die Clan-Normen mit Füßen treten, die da lauten: kehre mit deinem Schilde oder, wenn du gefallen bist, auf deinem Schilde zurück; mag er seinen Schild, der nicht länger mehr ein mythisches Symbol, sondern ein Gebrauchsgegenstand ist, von sich schleudern – an der Weltordnung rütteln die Lyriker, die, liebend und leidend, ihre Individualität verkünden, darum noch nicht: das Verlorene wird wiedergefunden, die Gerechtigkeit eines ewigen Wechselns als Lebensgesetz analysiert.
Lyriker und Denker, Poeten und jonische Wissenschaftler, die Zeugen des 7. und 6. Jahrhunderts, stellen die gleiche Frage: Was erhält die Welt? (Dem »Was bin ich?« der Lyriker entspricht das »Was war im Anfang?« der milesischen Philosophie.) Die Antwort lautet: das Recht allein gewährleistet Stabilität, nur es verbürgt den Ausgleich der Extreme in einer ordnenden Mitte. ANAXIMANDER, SOLON, ARCHILOCHOS, ALKMAION bedenken, so betrachtet, das gleiche Problem. Dike, das Recht, ist an keinen Raum, aber – und dies ist die neue Entdeckung – auch an keine Zeit gebunden. Zeus straft nicht im Jähzorn; oftmals fällt das Recht erst die Kinder und Kindeskinder der Schuldigen an.
Raumerweiterung und Zeitvertiefung, Loslösung von einer Klasse, Entfernung vom Augenblick, Verabsolutierung: das sind die geistigen Errungenschaften der Jahrhunderte zwischen Homer und der Klassik. Erkennt man die Pendelbewegung? Das Zentrum liegt zunächst im kleinasiatischen Kolonisationsraum; hier ist HOMERS Reich, hier liegt Milet, die Heimat der Philosophie und Wissenschaft, hier waltet jonischer Erfindungsgeist, jonische Seefahrerfreude an Expeditions-Resultaten, hier, im Inselreich der Kykladen, erwächst die eigentliche Lyrik: melische Poesie, Inkarnation äolischer Kunst. Dann, im 6. Jahrhundert, der Umschwung zum Westen: Elea und Kroton, PYTHAGORAS’ Spekulationen und PARMENIDES’ Beschwörung eines unveränderlichen Seins auf italischem Boden, Mystik und Kalkulation, Reinkorporationsgedanken, doch auch Meditationen über Zahl und Gestalt, dazu die Chorlyrik des Westens, STESICHOROS und IBYKOS, endlich, schon im 5. Jahrhundert, von Tyrannen gefördert, die Inthronisation der sizilianischen Dichtung: Mimos und Beredsamkeit, PINDAR, BAKCHYLIDES und AISCHYLOS an Hierons Hof.
Vom Osten zum Westen, vom Westen ins attische Zentrum, von dort an die Peripherie, nach Alexandria, Pergamon und endlich nach Rom … das ist der »Rhythmus«, dem die griechische Poesie folgt. Jahrhundertelang bleibt das Mutterland im Schatten der Kolonialkunst; die Zeugnisse sind spärlich: HESIOD aus Böotien, der Athener SOLON, TYRTAIOS in Sparta, PINDAR, der Thebaner, … das sind einzelne Namen, Spätlinge, ja – Pindar! – Reaktionäre, gemessen am jonischen Geist, und doch Vorboten der großen mutterländischen Kunst, die, auf Attika konzentriert, um 500 mit der Inauguration des Dramas beginnt. Der Philosoph ANAXAGORAS verläßt seine jonische Heimat und wird zum Bürger Athens … das erscheint wie ein Symbol. Von AISCHYLOS bis DEMOSTHENES, von THEMISTOKLES bis PHILIPP VON MAKEDONIEN, von HERODOT bis THEOPOMP, von SOPHOKLES bis ISOKRATES, von ANAXAGORAS bis ARISTOTELES beherrscht Athen, das Zentrum Griechenlands, jenes Zeitalter, das mit Marathon (490 v. Chr.) begann und mit dem Siegeszug des jungen Alexander (334–323 v. Chr.) endete.
Lyriker und Philosophen hatten die Welt in der Weite des Raums und der Tiefe der Zeit bewohnbar gemacht; der Wechselschlag von ate bis tisis, Verblendung und Vergeltung, war im naturwissenschaftlichen und humanen Bereich analysiert worden; die Milesier hatten, denkend und experimentierend, thesenreich und chronikalisch zugleich, die Vielfalt der Erscheinungen auf Grundprinzipien reduziert; Individuum und Kosmos, Ich und Es, Mensch und Gott waren in gleicher Weise charakterisiert. Jetzt, um 500, kam es auf die Synthese an, auf die demonstrierte Begegnung der Pole, auf sichtbaren Austausch und auf Objektivierung der Individualitäten; das Persönliche wollte typisiert, das Überindividuelle anschaulich gestaltet sein. Auf dem Scheitel der griechischen Geschichte, im Augenblick einer letzten großen Zusammenfassung, eine Sekunde vor dem Zerfall der politischen Ordnung, zog die Tragödie, generalisierend und in Spiel und Gegenspiel veranschaulichend, die Summe der Vergangenheit.
Von der Polis zum Weltreich
Klassik: das ist der Moment des Gelingens, die Bezeichnung einer Vollkommenheit, die nicht aus sich selbst, sondern nur durch eine Konturierung von außen, durch die Beschreibung des »Davor« und »Danach« erklärbar ist. ARISTOPHANES wußte darum, als er in den Fröschen Aischylos und Euripides zu Protagonisten bestimmte und die Mitte, das Sophokleische Werk, gleichsam ausklammerte. Nur sehr zögernd wollen sich die Elemente zusammenfügen, die den Geist dieses Jahrhunderts ausmachen, das die Geschichte Europas wie kein anderes bestimmt hat; nur höchst vage läßt sich eine Zeit bezeichnen, deren Profil am deutlichsten in den Thukydideischen Perikles-Reden erscheint.
Konzentration, Sammlung der Kräfte an einem winzigen Punkt heißt das erste Gebot griechischer Klassizität: nicht Milet und Tarent, Klazomenai und Syrakus, sondern athenische Polis, Theater, Agora, Akropolis. Ist es ein Zufall, daß sich die milesischen Kosmogonien, kühne jonische Spekulationen, zupackende Gedanken, die in gleicher Weise den Schiffermärchen wie den ethnographischen Exkursen eines HERODOT Plastizität und Farbe verliehen, in die Sokratischen Marktgespräche verwandeln?
Während die Jonier die Geheimnisse der Welt betrachteten, Sternenflug und Nilschwellen, verläßt SOKRATES die Vaterstadt nur im Krieg oder, wie der Phaidros lehrt, für die Dauer eines Spaziergangs. Die Zeit steht still, die Gegensätze werden in einer ordnenden Mitte gebannt: nicht umsonst verlangt SOKRATES, am Ende des Gastmahls, daß ein und derselbe Mann Tragödien und Komödien schreiben müsse … die Wächterszene aus der Antigone, der Auftritt der Amme in den Choephoren, Herakles’ Gehabe in der Alkestis: all das ist Komik, Witz und Burleske inmitten des tragischen Spiels. ARISTOPHANES andererseits, an den sich Sokrates wendet, war – wie die Lysistrate beweist – zugleich ein großer Tragödienschreiber.
Damit aber das Getrennte zusammenkommen, die Gegensätze sich aufheben können, bedarf es einer glücklichen Stunde, bedarf es der Hauptstadt und vor allem überragender Politiker vom Range jenes Perikles (ca. 500 – 429), der nicht nur – wie Periander von Korinth oder Peisistratos (beide etwa 100 Jahre früher) – ein Mäzen war, sondern ein Staatsmann, der es verstand, das Gesetz des Jahrhunderts: »Beschränke dich, spanne nicht allzusehr an« zur Maxime seiner Politik zu machen und ein Regiment auszuüben, das die Demokratie nicht aufhob, sondern sie integrierte: spiegelt die epische Frühzeit die Adelsherrschaft (und ließ zugleich noch eine ferne Ahnung des mykenischen Königtums durchscheinen), repräsentierte die lyrische Epoche, Zeugin der Kolonisationsjahrhunderte, Zeitgenossin der jonischen Wissenschaften, die Tyrannis, so ist das Drama, als Protagonist des klassischen Jahrhunderts, getragen und erfüllt vom Geist der Demokratie … mag auch die Formung durch die großen Adelsgeschlechter nicht zu unterschätzen sein.
Nur die freiheitliche Ordnung eines vernünftigen Volksregiments gab dem Theatraliker die Möglichkeit, seine eigenen Thesen ungestraft, mit rigoroser Deutlichkeit zu entwickeln. Nie war der Einfluß der Kunst so groß wie im 5. Jahrhundert, als ARISTOPHANES es wagen durfte, im Angesicht der Bundesgenossen die athenische Politik – und vor allem die Bündnispolitik – erbarmungslos zu zerfetzen. Wo, in der Literaturgeschichte, gibt es sonst noch ein Beispiel dafür, daß ein Komödienschreiber es sich erlaubte, den führenden Staatsmann – und dies im Kriege! – als einen Wurstverkäufer und Hansnarren verächtlich zu machen?
Das Drama als soziale Form und eigentliche Schöpfung der Demokratie: Literatur war eine »öffentliche Affäre«, Priester, Staatsbeamte, und – man hat das lange verkannt – Sklaven saßen im Theater; von PHRYNICHOS, dem Tragiker, bis zu ARISTOPHANES tönte die Orchestra von Zeitanspielungen wider; nicht Anytos und Meletos, die öffentlichen Ankläger, sondern die Komödienschreiber bereiten jenen Prozeß gegen Sokrates vor, der die Wende der Zeiten markiert: 399, der Einschnitt ist deutlich – das Ende des Peloponnesischen Krieges bezeichnet auch das Ende der Tragödie; Euripides und Sophokles waren tot, der Platonische Dialog trat an die Stelle der Stichomythie; auch dem komischen Spiel wurde der Boden entzogen: die politischen Verweise und persönlichen Polemiken setzen nun einmal deutliche Konstellationen, mächtige Freunde und Feinde und ein allgemeines Interesse an den Grundfragen der Polis voraus. Das 4. Jahrhundert aber steht im Zeichen des politischen Chaos, der Hinneigung zum Privaten und Intimen, das zu den Zeitparolen panhellenistischer oder attisch-reaktionärer Herkunft in einem bezeichnenden Gegensatz steht.
Die Entwicklung der Komödie von ARISTOPHANES (ca. 445 – 385 v. Chr.) bis MENANDER (ca. 343 – 293 v. Chr.) symbolisiert den Prozeß: das alte Kernstück, die Parabase, verschwindet, Märchenmotive, Szenen, erfüllt von Lyrismus und Irrealität, dominieren. Die Züge eines Jahrhunderts zeichnen sich ab, in dem man aus der Wirklichkeit flieht, den Idealstaat (der freilich immer noch das Antlitz der alten Polis trägt) beschwört und sich selbst als historisch, die Geschichte Athens als vergangen betrachtet. Schon im 5. Jahrhundert hatten sich die musealen Tendenzen gemehrt: ARISTOPHANES erscheint – nicht nur in den Fröschen – als laudator temporis acti; EUPOLIS’ Demen rufen, inmitten einer führungslosen Zeit, die großen Gestalten der Marathon-Ära aus dem Hades herbei; später ging man dazu über, die alten Tragödien regelmäßig zu wiederholen, jedes dritte Jahr ein Drama des EURIPIDES; und wenn man auch noch häufig mit demosthenischem Pathos von athenischer Größe sprach oder, wie ISOKRATES, die Ideale des Panhellenismus verklärte und Philipp von Makedonien als Vorkämpfer griechischer Freiheit verherrlichte … es war die Größe von gestern. Die Polis zerbrach: dem Einzelnen, nicht der Gemeinschaft, galt seit den Tagen der Sophistik das Augenmerk: die Welt des letzten bedeutenden attischen Dichters, MENANDERS Bezirke, in denen es urban und bürgerlich zugeht, leuchtet auf: Tragödie und Komödie vereinen sich im Schauspiel.
Die Rhetorik trat an die Stelle der Philosophie; System und Abstraktion, auf der anderen Seite, ersetzten Mythos und Bild. Man ordnete, sammelte, schrieb Gedichte und fragte, pragmatisch gesonnen, nach Nutzen und Verwertbarkeit. Hier die Atthis, die athenische Lokalgeschichte, Rückschau und historische Glorifizierung, dort die emanzipierten Fachwissenschaften … die alten Fronten zerfielen, nur hundert Jahre noch, und auch der von ARISTOTELES beibehaltene Gegensatz zwischen Griechen und Barbaren, Sklaven und Freien löst sich im Zeichen der Diatribe, der »Moralpredigt«, der kynischen Popularphilosophie und der stoischen Lehre endgültig auf; erst im Hellenismus und der Kaiserzeit gibt es »proletarische« Dichter!
Die oikumene der Stoa vor allem repräsentiert die hellenistischen Jahrhunderte, in denen man sich von Pergamon bis zum Atlantik in einer einzigen Sprache, der koine, zu verständigen wußte. Die Zeit der einzelnen war, so konnte man denken, für immer vorbei: Uniformität herrschte, nicht nur im Sprachlichen, vor. In den Riesenbibliotheken arbeiteten Forscherstäbe; Denkmäler, kolossal und exorbitant, künden vom Fleiß anonymer Handwerkerheere mehr als von der Ingeniosität überragender Architekten; das gewaltige Reich zwang zur Synopse: Philosophenschulen, Epikureer, Akademiker, Stoiker und Peripatetiker setzten das Erbe ihrer Gründer fort; aber die Grenzlinien verwischten, und der Eklektizismus feierte wahre Triumphe.
Auf der anderen Seite entsprach den unabsehbaren Dimensionen des Weltreichs, in augenfälligem Kontrast, ein Zug zur Idylle, zur Beschaulichkeit, zum Feinen und Besonderen. Die Dichter vor allem, poetae docti aus Alexandrien, vom Schlage des Bibliothekars KALLIMACHOS (310 – 240 v. Chr.), verkündeten – seltsam modern! – die Lehre, daß nicht der Zyklus, nicht ein monströses Epos wie die Argonautica, sondern nur noch das Aparte und Kleine, Ziselierte und kunstreich Erdachte, Epyllion und Epigramm, Rang und Bedeutung beanspruchen dürften.
Unter solchen Zeichen entstand ein neuer Gegensatz: nicht mehr Grieche und Barbar, sondern Gebildeter und Ungebildeter trennten sich, und ein Prozeß kam ans Ziel, der zu Isokrates’ Zeit, im 4. Jahrhundert, begann. Man spielte nun mit der Tradition, suchte immer reizvollere Variationen, immer raffiniertere Veränderungen der Vorlagen zu ersinnen, erging sich in dunklen, nur einem kleinen Kreis von Gebildeten verständlichen Anspielungen, löste die poetische Diktion von der Umgangssprache, probierte, höchst artistisch, die alten Dialekte durch, erforschte in der Maske des Wissenden, parodistisch und ironisch, die Zeit und den Raum: jonische Novellen und – Kunst der späten Epochen! – Reiseromane, Universalgeschichte und, ein Erbe Siziliens, der Mimos als Domäne der Charakterzeichnung, die, durch LYSIAS bestimmt, von THEOKRIT und HERONDAS perfektioniert worden war: schwatzende Frauen, Prozessionsteilnehmer und Hirten! Der Hellenismus scheint uns heute die hohe Zeit der Gegensätze zu sein: hier der Leuchtturm von Rhodos, dort die Idylle THEOKRITS; hier die Säulen des Herkules, dort, minuskelgleich, das Epigramm; hier Mammutkompendium und episches Konvolut, dort die Preziosität des Details; hier Eingeweihtenkunst, dort heitere Belehrung der Massen; hier die Spezialwissenschaft, vor allem die Astronomie, dort das studium generale der Alexandrinischen Bibliothek, deren Vernichtung den letzten Abschnitt der griechischen Poesie, die Kunst der Kaiserzeit einleitet.
Doch während hellenische und attische, attische und hellenistische Epoche sich, bei aller Verzahnung, deutlich voneinander abheben lassen, ist der Einschnitt zwischen Hellenismus und Kaiserzeit gering, die Trennung willkürlich. Die Tendenzen änderten sich nicht: eklektische und parodistische Strömungen: Polyhistoren und Pragmatiker, Sammler und Kritiker bestimmten, von PLUTARCH bis LUKIAN, weiterhin das Bild der Zeit – und was die Wendung zum Westen betraf, so hatte sich das Schwergewicht schon mehr und mehr nach Rom verlagert: griechische Bildung fand, über die großen Lehrer, den Historiker POLYBIOS und den Philosophen PANAITIOS, über den Scipionenkreis Einlaß in Rom. Auf italischem Boden wurde das griechische Erbe – oftmals kümmerlich genug – in Florilegien bewahrt; hier wurde die Auswahl mit attizistischer Emphase getroffen. Griechenland selbst war zur Provinz geworden: der hellenische Geist, mit orientalischen und jüdischen, bald auch mit christlichen Elementen vermischt, fand in Rom eine Herberge. Zweite Sophistik, Neuplatonismus – die Namen bezeichnen den Repetitionscharakter der Spätantike, den ein Anekdotenschreiber vom Schlage ATHENAIOS’ in gleicher Weise wie der parodistisch gesonnene, mit alten Vorstellungen spielende LUKIAN, HELIODORS romaneske Kompilation des Endlichen nicht anders als PLOTINS universaler Synkretismus bezeichnet.
Griechisches Vermächtnis
Griechische Idealität, Typus, Zeitlosigkeit und Exempel, konkretisierte sich, dem hic et nunc des Augenblicks anheimgegeben, in der politischen Realität der Kaiserzeit. Die Römer, Meister des Praktischen, Realisten kat’ exochen: Biographen und Porträtisten, Straßenbauer, Juristen und Verwaltungsbeamte, gaben dem Griechischen im Raum des Imperium Romanum jene Form, in der es sich mit dem christlichen Glauben vereinigen konnte. Eine kühne Synthese, zu der das Griechische in besonderer Weise prädestiniert war, weil Synthese, Zusammenschau des Disparaten, zu seinem Wesen gehörte: Innen und Außen sind, in hellenischer Sicht, nicht voneinander zu trennen, menschliche Schuld und göttliche Ahndung, ate und tisis, entsprechen einander; Gegensätze heben sich auf: alles ist von Zeus, sagt der Tragiker, und dennoch bleibt der Mensch verantwortlich.
Niemand hat sich so sehr an Spekulationen verloren wie gerade die Griechen; niemand aber war auch so exakt. Aberglaube und Wissenschaft, Orphik und Apollonkult gehören ebenso zusammen wie Bild und Abstraktion, Mythos und Logos, deren Ungeschiedenheit noch das Platonische Werk demonstriert. Synthese – das heißt nicht: Überspielen der Kontraste, sondern Synopse des Disparaten, Zusammenschau, die sich sehr wohl mit jener aitiologischen Betrachtungsweise vereinen läßt, in der wir das zweite Charakteristikum der griechischen Literatur sehen dürfen.
Von HOMER bis zur Spätantike, von den Kyprien, die den Trojanischen Krieg auf die Übervölkerung zurückführen, über KALLIMACHOS’ Aitia bis hin zu dem EinenPLOTINS bleibt die Frage nach der prima causa die wichtigste Frage der hellenischen Dichtung. Der Zorn des Achilleus (HOMER), die Gerechtigkeit des Zeus (HESIOD, SOLON), der Gegensatz zwischen Griechen und Barbaren (HERODOT), das Unendliche, das Wasser, die Luft (ANAXIMANDER, THALES, ANAXIMENES), der Streit (HERAKLIT), der Machtzuwachs (THUKYDIDES), der Nus (ANAXAGORAS), die Hybris (AISCHYLOS und SOPHOKLES) … immer wurde die Fülle der Erscheinungen, die es am Ende mit einem Blick zu überschauen gilt, zu einem Urprinzip zurückgeleitet. Das Reich des Scheins in seiner Vielfalt und die Einheit zu erkennen, das Komplexe zu reduzieren und vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, von der Erscheinung auf die Idee zu schließen und hinter dem Trug die Wahrheit zu zeigen, ist hellenisch. Opsis adelon ta phainomena, Sicht des Undeutlichen: das Erscheinende – dies mag vielleicht das Schlüsselwort der griechischen Literatur sein.
Strukturgesetze der frühen griechischen Tragödie
Es war die Eigenart der Griechen, daß sie ihre literarischen Formen nicht im langsamen Prozeß der Reife, sondern, nach wenigen Versuchen tastender Erprobung, beinahe im ersten Ansprung, beim ersten ernsthaften Versuch erschufen. Jedenfalls scheint es uns Heutigen so: der erste Epiker, Homer, ist zugleich der vollkommene Meister seiner Gattung, die frühen Dichter der Elegie, Solon und Tyrtaios, fassen in ihren Gedichten bereits alle kommende Entwicklung elegischer Gestaltung zusammen, der Jambus ist durch Archilochus so sehr geprägt, daß »in der Weise des Archilochus dichten« soviel wie Jamben schreiben hieß, und die Struktur der Tragödie schließlich wird zwar im einzelnen nuanciert und abgewandelt, behält aber im Grunde das Antlitz, das Aischylos ihr gab: schon fünfzig Jahre nach Thespis hatte sie jene Form gewonnen, in der sie dauern sollte.
Der fehlende oder doch nur sehr kurze, kaum mehr als zwei oder drei Menschenalter währende Weg, der nötig ist, um mit der Blüte auch die Vollendung einer Kunstform heraufzuführen, läßt erkennen, daß die Griechen, an einem bestimmten Punkt der Entwicklung angekommen[*], sich literarischen Formen verschrieben, die sie mit immer neuen Variationen und Wiederholungen zu umkreisen suchten. Epos, Lyrik und Drama entstanden, jeweils ungefähr 100 Jahre voneinander getrennt, in jenen Augenblicken, da der griechische Mensch sie sich bewußt als Aufgabe setzte, um mit der neuen Form etwas mit den alten Mitteln literarisch nicht mehr Darstellbares auszusagen. (Das führte dazu, daß sich die alten Formen nach der Eroberung der neuen Gattung nicht mehr lange zu halten vermochten. Die literarischen Ausdrucksmöglichkeiten überlagerten sich nicht, sondern lösten sich nach einer kleinen Strecke der Überschneidung ab.)
Waren die Aufgaben einmal gesetzt und das Ziel bestimmt, dann hielt man mit erstaunlicher Zähigkeit und Observanz an der gewählten, in Übereinklang mit der jeweiligen Gesellschafts-Situation stehenden Form fest. In immer neuen Anläufen, Mal für Mal, versuchte man den vorgesetzten Rahmen mit neuem Leben zu erfüllen. Ein Akt freiwilliger Selbstbeschränkung, so scheint es zunächst: das verpflichtende Metrum um keinen Preis zu zerstören, die Baugesetze des Epos oder der Tragödie als verbindlich anzuerkennen, den strengen »Vers-für-Vers-Schritt« der Stichomythie nicht zu sprengen, immer wieder den engen, zu gleichen kompositorischen Gestaltungen zwingenden Raum des Giebeldreiecks auszufüllen. In diesem Verhältnis von Aufgabe und Leistung, vorgeschriebener Form und Lösung liegt eines der Geheimnisse der griechischen »Klassizität« – im freiwillig begrenzten Feld das Höchstmögliche zu leisten, die Ideallösung der übernommenen Aufgabe zu suchen[*].
Nicht zufällig haben sowohl Vertreter der klassischen Philologie als auch Archäologen in den letzten Jahrzehnten den Versuch unternommen, durch eine systematische Analyse und Interpretation der den jeweiligen Kunstformen zugrunde liegenden Baugesetze einen Einblick in die Technik gerade jener Künstler zu gewinnen, denen es gelang, die durch die Gattung aufgegebenen Formprobleme vollkommen zu lösen: Wolfgang Schadewaldt zum Beispiel zeigte für Homer und das Epos ebenso Aufbau, Machart und Struktur[*] der Ilias, wie Karl Reinhardt in seinem Buch über Sophokles die Typik der sophokleischen Tragödie und ihrer Helden näher bestimmte und ihr zugleich eine Terminologie abgewann, mit der zu arbeiten sich seit langem als fruchtbar und nützlich erwiesen hat[*].
In diesem Aufsatz soll versucht werden, die Form der frühen griechischen Tragödie genauer zu definieren und zu zeigen, wie Aischylos als der erste große abendländische Dramatiker sich im Sinne der oben gezeigten Tendenzen eine als Aufgabe erkennbare Form wählte, die er bei fortschreitendem Werk mehr und mehr differenzierte und veränderte: wobei »verändern« bedeutet, daß immer noch der Ausgangspunkt, das, was verändert worden ist, erkennbar bleibt und man mit Recht von »Abwandlung« sprechen kann.
Um zum Ziel zu kommen, erscheint es am ratsamsten, das früheste Werk des Dichters[*], die ›Perser‹, eingehender zu beschreiben und dann bei den anderen Dramen die Verwandlung der Grundstruktur zu beobachten.
Die im Jahre 472 v. Chr. aufgeführten ›Perser‹ beginnen mit dem Einzug und der Selbstvorstellung des Chors. Die Choreuten, persische Greise aus den edelsten Geschlechtern, sind in Sorge um das Ergehen ihres Königs und um das Schicksal des nach Griechenland gezogenen Heeres. –
Angst und Erwartung bezeichnet den Anfang aller aischyleischen Tragödien; ein Geschehen ist aufgegeben, das seiner Lösung harrt; ein verborgener Tatbestand wartet darauf, in Spiel und Gegenspiel enthüllt zu werden. Die Interpretation des Xerxes-Zuges durch den Chor deutet bereits die kommende Tragödie an. Hybris war es, eine Brücke über den Hellespont zu schlagen, »das Joch des dichtbalkigen Heerwegs über den Nacken der See zu werfen«[*]; ein Gott hat Xerxes in das Garn gelockt, aus dem er nicht mehr entkommen wird.
Was der Chor »mit von Angst zerrissenem Herzen« ahnungsvoll vorwegnimmt, bestätigt Atossa, die Mutter des Königs. Ohne Umschweife stellt sie sich auf den Boden des Chors: »Mir auch wühlt im Herzen Sorge.« Beide, Atossa, mit ihren unheilvollen Träumen und der Chor mit seinen scharfsichtigen Interpretationen, ahnen das Kommende, das von Vers zu Vers bedrohlicher näherrückt. Einzige Rettung scheint es zu sein, sich an den Toten, den großen verstorbenen König Dareios, zu wenden. Er allein wird Rat wissen, er allein helfen können.
Enthüllung der Katastrophe und Anruf des Dareios sind die Zielpunkte, auf die das Drama zustrebt. Am Anfang ist alles unklar-verworren, aber in der Begegnung der Unwissenden, des Chors und der Atossa, wird mit der Darstellung des Geschehens zugleich die Richtung bestimmt, in der das Drama seinen Verlauf nehmen muß. Es wird eines Anstoßes von außen, wird neu auftretender Personen bedürfen, um einerseits den Vorgang zu erhellen und andererseits die Triebkräfte, die hinter der Faktizität des abrollenden Geschehnisses stehen, zu interpretieren.
Mit dem Erscheinen des Boten (V. 249) tritt die Handlung in ein neues Stadium. In der für Aischylos typischen Vorwegnahme berichtet der ἄγγελος die eingetretene Katastrophe: »Wie hat hinweg ein Schlag der Schätze Pracht gerafft! Dahingesunken ist die Blüte Persiens!« Durch diese Worte ist die im Eingangsgespräch zwischen Atossa und dem Chor beschriebene Situation zu einem Teil geklärt, das Befürchtete hat sich bestätigt: das persische Heer ist vernichtet. In fünf großen Reden berichtet der Bote im einzelnen Art und Hergang der Katastrophe, erzählt in einem langen Katalog, wer von den Heerführern gefallen ist, nennt das Stärkeverhältnis der beiden Flotten, beschreibt den Kampf bei Salamis, läßt auch den Psyttalia-Sieg des Aristides nicht aus und deutet endlich die unsagbaren Qualen der wenigen mühevoll Überlebenden an. Am Ende bleibt nichts anderes als die Anklage des grausam-schlimmen Daimon, der die Menschen vernichtet und dem niemand entfliehen kann. Die Apokalypse scheint bevorzustehen: hin ist Persiens Macht unter den Völkern Asiens, das Unterste wird sich nach oben kehren … warum? Weder der Chor noch der Bote oder die Königin sind imstande, die Frage zu beantworten. Es bedarf abermals eines neuen Anstoßes von außen, um auch diese Frage zu klären, und erst in dem Augenblick, da auch sie beantwortet worden ist, können Ungewißheit und Zweifel des Anfangs als überwunden gelten. Erst Dareios, in jeder Weise Gegenspieler des Xerxes, findet die Lösung.
Der Fortschritt der dramatischen Handlung ist deutlich sichtbar: Ahnung, Bangen und Unsicherheit des Anfangs werden nach dem Auftritt des zweiten Schauspielers zu Gewißheit und klarer Erkenntnis. Ein langer, fünffach gegliederter nachholender Bericht orientiert die Versammelten über das Geschehene. Aber erst im Gespräch mit Dareios werden Atossa und der Chor über die wahren Gründe der Katastrophe und den Sinn des Unglücks verständigt, erst da ist der Vorgang in seiner Verwobenheit wirklich offenbar, die Wahrheit ans Licht getreten. Nicht zufällig zielt das Drama von Anfang an auf die Dareios-Szene hin, nicht umsonst wird Atossa durch den Chor auf den großen König, ihren Gemahl, verwiesen. Das Auftreten des »dritten« Schauspielers löst die Eingangssituation: die mit Atossas Rede V. 598ff. beginnende dritte Szene bildet das Zentrum der ›Perser‹. Erst jetzt wird offenkundig, daß es Xerxes’ Schuld war, das von den Göttern Beschlossene zu beschleunigen, das Bestimmte durch eigenes Dazutun schneller als nötig voranzutreiben. In seinem Knabensinn, töricht wie ein Kind, hat Xerxes das Vermächtnis seines Vaters zerstört und sich durch seine Hellespontüberquerung auf den Versuch eingelassen, mit Poseidon selbst zu kämpfen. Alles wird durch seine Schuld zugrunde gehen, auch das Heer, das noch in Griechenland steht, wird bei Plataia besiegt werden. Das Verhalten der Perser ist ein Zeugnis dafür, daß der Mensch sich nicht zu sehr überheben soll. Im Augenblick, da der Sohn selbst, Xerxes, auftritt, wird die Größe der Niederlage ganz offenbar.
Die ›Perser‹ gliedern sich deutlich in vier verschiedene Abschnitte, die jeweils durch den Auftritt einer neuen Person bestimmt werden. Der erste Abschnitt reicht bis Vers 248 und weist, indem die zu klärenden Probleme aufgeworden werden (was geschah mit dem Heer?, was wird Dareios sagen?), den kommenden Szenen den Weg. Im zweiten Abschnitt, Vers 249 bis Vers 597, löst der Botenbericht die erste Frage, während Dareios im dritten Abschnitt, Vers 598 bis 906, die Katastrophe erklärt und sie durch den Hinweis auf Plataia in vollem Umfang sichtbar macht. Der letzte, durch Xerxes’ Auftreten markierte Abschnitt endlich zeigt im Sinne der Doppelrichtung des Dramas noch einmal das Ausmaß der Katastrophe und zugleich den Gegensatz zu Dareios. Der Gesamtaufbau der ›Perser‹ wird also durch die zunehmende Erhellung eines in der Vergangenheit liegenden Geschehens bestimmt, wobei der Schwerpunkt des Dramas im dritten Teil zu suchen ist.
Auch die fünf Jahre später, 467 v. Chr., aufgeführten ›Sieben gegen Theben‹ zeigen den gleichen Aufbau wie die ›Perser‹. Abermals ist am Anfang ein Geschehen aufgegeben, das geklärt werden muß – was wird aus der Stadt Theben? –, abermals befinden sich Chor und Protagonist auf der Bühne, abermals ist der Chor von Angst und Sorge um die Zukunft erfüllt. Dennoch ist die Situation gegenüber den ›Persern‹ grundsätzlich verändert. Lag dort das Geschehen in der Vergangenheit und mußte nur nachholend berichtet werden, so steht in den ›Sieben gegen Theben‹ die Handlung noch bevor. Ging es in den ›Persern‹ nur darum, etwas zu erleiden, oder »noch einmal davonzukommen«, lautete also die einzige Frage τί πείσομαι, so kommt in den ›Sieben‹ die zweite Grundfrage der Tragödie[*] τί δράσω hinzu. Da die Entscheidung noch dahinsteht, kann man versuchen, einen Ausweg zu finden und vielleicht dem Kampf zu entgehen. Diese Situation ist die Ursache für die (gegenüber dem Verhältnis Atossa – Chor) grundsätzlich veränderte Beziehung zwischen dem Chor und Eteokles. Während in den ›Persern‹ Chor und Protagonist gleich unwissend sind und der Schauspieler sich vom Chorführer beraten läßt, hat sich das Verhältnis zwischen den Handlungspartnern in den ›Sieben gegen Theben‹ genau umgekehrt. Eteokles, der Schauspieler, dominiert, ihm gehören die ersten Verse des Dramas (wie in den ›Persern‹ dem Chor), er erteilt seine Befehle, weist den Chor zurecht und bringt ihn dazu, das Klagen und Stöhnen in ein geordnetes Gebet einströmen zu lassen. Eteokles zeigt sich durchaus auf der Höhe der Situation; er ist der Herr und weiß Rat, während Atossa zwar eine Königin ist, aber nicht von sich aus zu handeln versteht. Die Folge ist, daß die erste Szene der ›Sieben‹ in viel stärkerem Maße handlungsbestimmt, »dramatisch« ist als in den ›Persern‹. Zwei Schauspieler, nicht mehr nur einer, geben dem Anfang Farbe und Gewicht. Der kurze Auftritt des Spähers, der von der Auslosung vor den Toren berichtet, charakterisiert Eteokles als Steuermann und gibt ihm Gelegenheit, sich im Gebet an die Götter zu wenden und um Freiheit und Sieg zu bitten. Aber gerade der Sieg ist durch die Angst des Chores gefährdet, und deshalb sieht Eteokles seine Hauptaufgabe in der Bekämpfung dieser Angst.
Nach langer Auseinandersetzung zwischen Herrscher und Chor beschließt, wie in den ›Persern‹, eine Stichomythie das Gespräch zwischen den Hauptpartnern des ersten Abschnitts. Abermals wird hier die dramatische Straffung der ›Sieben gegen Theben‹ ganz offenkundig. Die Frage-und-Antwort-Stichomythie der ›Perser‹ steht der Überredungsstichomythie der ›Sieben‹, an deren Ende sich der Chor endlich fügt, diametral entgegen. Sachliche Erforschung eines Tatbestandes und präziser Bericht sind durch Pathetik und Streit ersetzt worden.
Mit Vers 375 setzt der zweite bis Vers 791 reichende Teil ein, der, wie in den ›Persern‹, durch das Auftreten einer neuen Person[*], des Spähers, gekennzeichnet wird. Auch in den ›Sieben‹ bestimmt der lange, vielfach gegliederte Bericht den zweiten Teil. Siebenmal holt der Späher aus, siebenmal berichtet er von dem Ergebnis der Auslosung, nennt Namen, Gehabe und Insignien der vor den Toren aufgestellten Kämpfer, siebenmal antwortet Eteokles. Abermals ist, bei gleicher Grundstruktur, der Unterschied zu den ›Persern‹ erkenntlich: während Atossa zuerst spricht, redet Eteokles nach dem Boten, während Atossa fragt, gibt Eteokles Befehle. In den ›Persern‹ ist das Geschehen als solches abgeschlossen und bedarf nur noch kundiger Interpretation; in den ›Sieben‹ dagegen ist es erst dabei, Ereignis zu werden. Das Ergebnis freilich ist nicht zweifelhaft, da Eteokles sich über beide Fragen, das τί πείσομαι sowohl wie das τί δράσω, im klaren zeigt. Der Versuch des Chors, den Herrscher umzustimmen, ist fruchtlos. Deutlich zeigt sich die Entsprechung der beiden ersten Abschnitte: in der Stichomythie des Eingangs sucht Eteokles den Chor mit Erfolg zu überreden, in der Stichomythie des zweiten Abschnitts versucht der Chor vergebens Eteokles zur Umkehr zu bewegen.
Der dritte Abschnitt, V. 792ff., bringt wie in den ›Persern‹ die endgültige Entscheidung. Der Bote tritt auf und berichtet den Mädchen von der Rettung der Stadt und dem Tode der beiden Brüder. Wiederum verwandelt sich bange Erwartung in Gewißheit, wiederum wird das Geschehen auf das Walten eines Daimon zurückgeführt. Alles ist klar enthüllt, am Ende bleibt nichts als Jammer. Mit dem gleichen ecce wie in den ›Persern‹ weist der Dichter auf das jammervolle Los der Hinterbliebenen: Antigone und Ismene treten auf und beweinen das Schicksal ihrer Brüder (Vers 875 bis Vers 1004).
Vierfach wie die ›Perser‹ sind auch die ›Sieben gegen Theben‹ gegliedert, vierfach, wohl erkennbar, sind die Zäsuren, die durch das Auftreten neuer Personen markiert werden. Gleich sind in beiden Dramen die Einleitungs- und Schlußszenen: am Anfang Erwartung, Ahnung, Befürchtung, das Drohende, beinahe schon Gewußte könne sich tatsächlich ereignen, am Ende der Abgesang der gänzlich Verlassenen, die über ihr eigenes Los und das Schicksal der Toten klagen. Gleich sind auch die vielfach gegliederten langen Berichtszenen des zweiten Teils, in dem der Bote den Protagonisten über die Lage orientiert. Variationen finden sich dagegen im dritten Abschnitt, der in den ›Persern‹ den zweiten überhöhend fortsetzt – Sinndeutung ergänzt den realen Bericht –, während in den ›Sieben gegen Theben‹ erst an diesem Punkt die Befürchtung zur Gewißheit wird. Die Verschiebung, die dazu führt, daß der dritte Teil der ›Sieben‹ zugleich auch dem zweiten der ›Perser‹ entspricht (jedesmal der Bericht der Katastrophe), hat, wie schon angedeutet, seinen Grund in dem verschiedenen Verhältnis zur Zeit. Was in den ›Persern‹ Nachholung eines abgeschlossenen Geschehens ist, wird in den ›Sieben‹ zur Enthüllung einer sich im Augenblick, im Prozeß des Dramas vollziehenden Katastrophe. Die dadurch bedingte Hinauszögerung der Gewißheit bis zum dritten Abschnitt, in dem wiederum der Handlungsschwerpunkt liegt, zeigt die (nicht nur inhaltlich bedingte) Entwicklung der dramatischen Technik über die ›Perser‹ hinaus.
Die wahrscheinlich vier Jahre nach den ›Sieben gegen Theben‹ aufgeführten ›Schutzflehenden‹[*] führen die aufgezeigte Entwicklungslinie geradlinig fort. Wiederum sind Variation und Ausgestaltung der überkommenen Gliederung die kennzeichnenden Elemente der Tragödie. Wie in den ›Persern‹ und den ›Sieben gegen Theben‹ stehen Angst und bange Erwartung am Anfang. Die Danaoskinder, nach ihrer Flucht aus Ägypten in Argos angekommen, gebärden sich als Schutzflehende und tragen mit Wollbinden umwundene Zweige in den Händen. Wie in den ›Persern‹ beginnt der Chor mit einer Art von Selbstvorstellung und Schilderung seiner Lage, wie in den ›Sieben gegen Theben‹ ist der Schauspieler dem Chor kraft seiner Stellung vorgesetzt, kann ihm Befehle erteilen und ihn zur Ordnung rufen. Genau wie in den beiden ersten Tragödien endet das Gespräch zwischen dem Chor und dem Schauspieler mit einer Stichomythie.
Der zweite Abschnitt der ›Hiketiden‹ wird V. 234 durch den Auftritt des Pelasgos eingeleitet. Das vielfach gegliederte Gespräch zwischen dem Chor und dem König erinnert an die Botenszenen der ›Sieben gegen Theben‹ und der ›Perser‹. Aber die Erinnerung trifft nicht genau. Der zweite Abschnitt der ›Schutzflehenden‹ zeigt deutlich, wie Aischylos die einmal eroberte und im Fundament beibehaltene Form zu variieren beginnt. Je weiter die Entwicklung fortschreitet, desto stärker wird der Bericht in Handlung, die Darstellung in Geschehen umgewandelt. Was in den ›Persern‹ Erzählung von Vergangenem war, was sich in den ›Sieben gegen Theben‹ zur Beschreibung augenblicklichen Geschehens wandelte, wird in den ›Hiketiden‹ ganz in Handlung aufgelöst. In der Begegnung zwischen Pelasgos und dem Chor ist die nachfolgende Analyse zum erstenmal vollkommen in dramatisches Hin und Her verwandelt worden. Schritt für Schritt geht der Chor vor, Schritt für Schritt weicht der König zurück. Nachdem die Entscheidungssituation – Aufnahme der Mädchen bedeutet Krieg mit den Aigyptossöhnen, Verweigerung der Aufnahme bedeutet einen Verstoß gegen Zeus, den Hüter des Gastrechts – bestimmt ist, steigert der Chor seine Argumente von Rede zu Rede. Der König ist anfangs schwankend (»ich schwanke; Furcht befängt mein Denken; soll ich’s tun? Soll ich es nicht tun?«), weiß keinen Ausweg und wird sich von Vers zu Vers stärker der eigenen Ohnmacht bewußt (»scheint da nicht not dir Sorgen, Rettung suchendes?«). Endlich fügt er sich (»ich hab’s bedacht. Zum Stranden kommt es doch; der Kampf mit diesen oder jenen – ein gewalt’ger Kampf ist unvermeidlich«), aber die Art, wie er nachgibt, zeigt seine Hoffnungslosigkeit (»mag’s wider mein Erwarten glücklich gehn«). Umringt von unauflöslichen Antinomien[*] bleibt ihm keine andere Wahl als, von den Selbstmorddrohungen der Mädchen in die Enge getrieben, dem Wunsch des Chores zu willfahren und Danaos in die Stadt zu schicken.
Wie in den ›Persern‹ und den ›Sieben gegen Theben‹ fällt die endgültige Entscheidung im dritten Abschnitt: Danaos berichtet von der Aufnahme der Mädchen durch die Volksversammlung. Damit ist, so scheint es, die Erwartung des Anfangs aufgelöst, die Frage beantwortet, das aufgegebene Problem – »wird man uns aufnehmen?« – geklärt worden. In allen drei Tragödien, ›Hiketiden‹, ›Persern‹ und ›Sieben gegen Theben‹ ist die Handlung nach dem dritten Abschnitt bis zum gleichen Punkt vorgeschritten: die bangen Zweifel sind erhellender Gewißheit gewichen. Danach freilich begnügt sich Aischylos in den ›Schutzflehenden‹ nicht mit der konkreten Darstellung des sichtbar gewordenen Zustandes, nicht mit sinnfälliger Exemplifizierung der Wahrheit, indem er die Reaktionen der Beteiligten zeigt und das Los der Hinterbliebenen beschreibt, sondern gibt der Handlung durch die zuletzt auftretende Person, den Boten der Aigyptossöhne, noch einmal neuen Auftrieb[*]. Ein zweites Mal kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung – jetzt zwischen Pelasgos und dem Boten –, die damit endet, daß der ἂγγελος nach der Kriegsandrohung abzieht und den Chor der Mädchen und Mägde in banger Sorge zurückläßt.
Die ›Hiketiden‹ beweisen eindringlich, wie Aischylos mit zunehmendem Alter mehr und mehr danach strebte, die Tragödie bei genauer Beachtung der einmal angenommenen Grundstruktur durch dramatische Akzente zu bereichern. Während der erste und dritte Abschnitt – Ahnung und Gewißheit, Vermutung und Eintreffen – eng aufeinander bezogen bleiben, verstärken sich die Handlungselemente sowohl im zweiten wie im vierten Teil. Der Bericht verliert an Bedeutung und bleibt auf den dritten Teil beschränkt, während der zweite durch die sich ständig steigernde Auseinandersetzung zwischen Pelasgos und dem Chor unerwartet an dialogischer Lebendigkeit gewinnt. Damit bahnt sich eine Entwicklung an, die in der ›Orestie‹ fortgesetzt und ans Ziel geführt wird.
Der erste Abschnitt des ›Agamemnon‹ steht unter den alten Zeichen: Erwartung, bange Hoffnung und Befürchtung. Eine Frage wird aufgeworfen, die im Verlauf der Tragödie schrittweise erhellt werden soll. (»Was wurde aus dem persischen Heer?« heißt es in den ›Persern‹, »was wird aus der Stadt?« in den ›Sieben‹, »was geschieht mit uns, den Flüchtigen?« in den ›Schutzflehenden‹, »was ist mit Troja?« im ›Agamemnon‹.)
Aber welche Veränderung gegenüber den früheren Werken! Kaum, daß der Wächter die Frage gestellt, kaum, daß er sein mühevolles Wachen beschrieben hat: da flammt auch schon das Feuer auf, und die Erwartung wird zur Gewißheit. Doch das Wissen ist hintergründig, ist als Wissen zum Problem geworden: kann der Wächter sich nicht geirrt haben? Es bedarf vieler Beweise, bedarf langer Reden der Klytaimestra, ehe der Chor endlich glaubt. Aber gerade in dem Augenblick, da er die Nachricht hinnimmt und sie als wahr und richtig anerkennt, kommen ihm neue Bedenken. Neue Sorgen treten an die Stelle der alten; die Sorge um die Heimkehr wird durch die Angst vor dem allzu großen Sieg ersetzt.
Mit der Ankündigung und dem Auftritt des Boten, V. 489ff., setzt, der Tradition entsprechend, der zweite Abschnitt ein. Der Bote berichtet, wird im Dialog befragt, man erkundigt sich nach dem Schicksal der Führer: alles in gewohnter Weise. Dennoch besteht zwischen der Botenszene im ›Agamemnon‹ und ihren Vorstufen in den früheren Dramen ein großer Unterschied. Während der Bote in den ›Persern‹ und ›Sieben‹ durch seine Nachricht die zuvor aufgetretenen Personen von ihrer Unwissenheit befreite, berichtet er im ›Agamemnon‹ ein Geschehen, das längst bekannt ist; denn nach dem Wächter und Klytaimestra erzählt der Bote als dritter von Trojas Fall.
Wozu dieser Aufwand? Wozu detaillierteste Beschreibung von etwas längst Bekanntem? Wozu ein Ereignis langatmig erzählen, das in den Botenszenen der ›Perser‹ und ›Sieben gegen Theben‹ als Neuigkeit Gewicht hatte, hier aber zu verblassen scheint? Die Absicht des Dichters ist offenkundig. Je stärker er den griechischen Sieg herausarbeitet, je häufiger er von ihm spricht und jeden Zweifel an seiner Größe nimmt, desto bedrohlicher wird die Frage, ob die Größe des Sieges nicht durch ein gleich großes Maß an Verlust aufgewogen werden müsse. Es zeigt sich, daß Aischylos zwar die alte Gliederung des Dramas, den strengen, durch Auftritte geregelten Vier-Schritt beibehält und weder die Erwartungsszene des Anfangs noch den Botenauftritt des zweiten Abschnitts von der Stelle rückt, zugleich aber die Bedeutung der Einzelszenen, ihren Sinngehalt und ihre Funktion, verändert. Es macht ihm nichts aus, das aufgegebene Problem, statt es in traditioneller Weise erst im zweiten oder dritten Auftritt erhellen zu lassen, sogleich zu klären und es zwei- oder dreimal bestätigen zu lassen. Im Grunde geht es ihm gar nicht um die Lösung der Eingangsfrage, vielmehr kann er jetzt über die der Tragödie zugrunde liegenden Gesetze in einer Weise verfügen, die es ihm ermöglicht, die traditionelle Hauptfrage zur Nebenfrage zu machen und sie nur deshalb so nachdrücklich und in den verschiedensten Formen zu beantworten, weil er einen Hintergrund braucht, vor dem er die eigentliche Frage – »wie ergeht es dem, der einen so großen Sieg erfocht?« – um so klarer zu lösen vermag.
Die traditionelle Steigerung der Handlung bis zur Enthüllung im dritten Abschnitt wird auch im ›Agamemnon‹ beibehalten, dagegen fällt die geradlinige Entwicklung, der Prozeß langsam – stufenweiser Erhellung fort. Alles Vorbereitende dient jetzt zugleich der Verschleierung, und die Lösung der Vorfrage führt nur auf Umwegen ins Zentrum. Nicht auf die klare Antithese von Vermutung und Gewißheit, sondern auf die mehr verdeckende als erhellende, mehr andeutende als klar bestimmte Vorbereitung der Katastrophe kommt es dem Dichter an. Wie zielstrebig-vorwärtsgerichtet ist die Entwicklung der ›Sieben gegen Theben‹! Wie verschlungen, ineinander verwoben, vordeutend und rückbezüglich sind dagegen die entsprechenden Abschnitte im ›Agamemnon‹! Auch hier liegt, wie immer, alles Schwergewicht auf dem dritten Abschnitt, aber im Unterschied zu den früheren Dramen wagt es Aischylos im ›Agamemnon‹ zum ersten Male, die Entscheidungsszene (nicht nur, wie in den ›Hiketiden‹, die Vorbereitung) nicht berichten, sondern geschehen zu lassen. Im ›Agamemnon‹ beginnt eine Entwicklung, die ein Menschenalter später von Sophokles zum Abschluß geführt werden wird: die vorderszenische Handlung ersetzt den Bericht über den hinterszenischen Vorgang, die Aktion auf der Bühne tritt an die Stelle der Botenrede.
Über 550 Verse, von Vers 782 bis Vers 1330, erstreckt sich die große Mittelszene des ›Agamemnon‹, in der zum ersten Male im europäischen Theater der Höhepunkt der Tragödie als Handlung auf der Bühne dargestellt und im Spiel und Gegenspiel abgehandelt wird. In genauer Entsprechung gehen König und Sklavin, Agamemnon und Kassandra, in den Palast, wo der Tod auf sie wartet … wissend und klar die Frau, unwissend und verblendet der Mann.