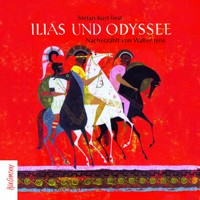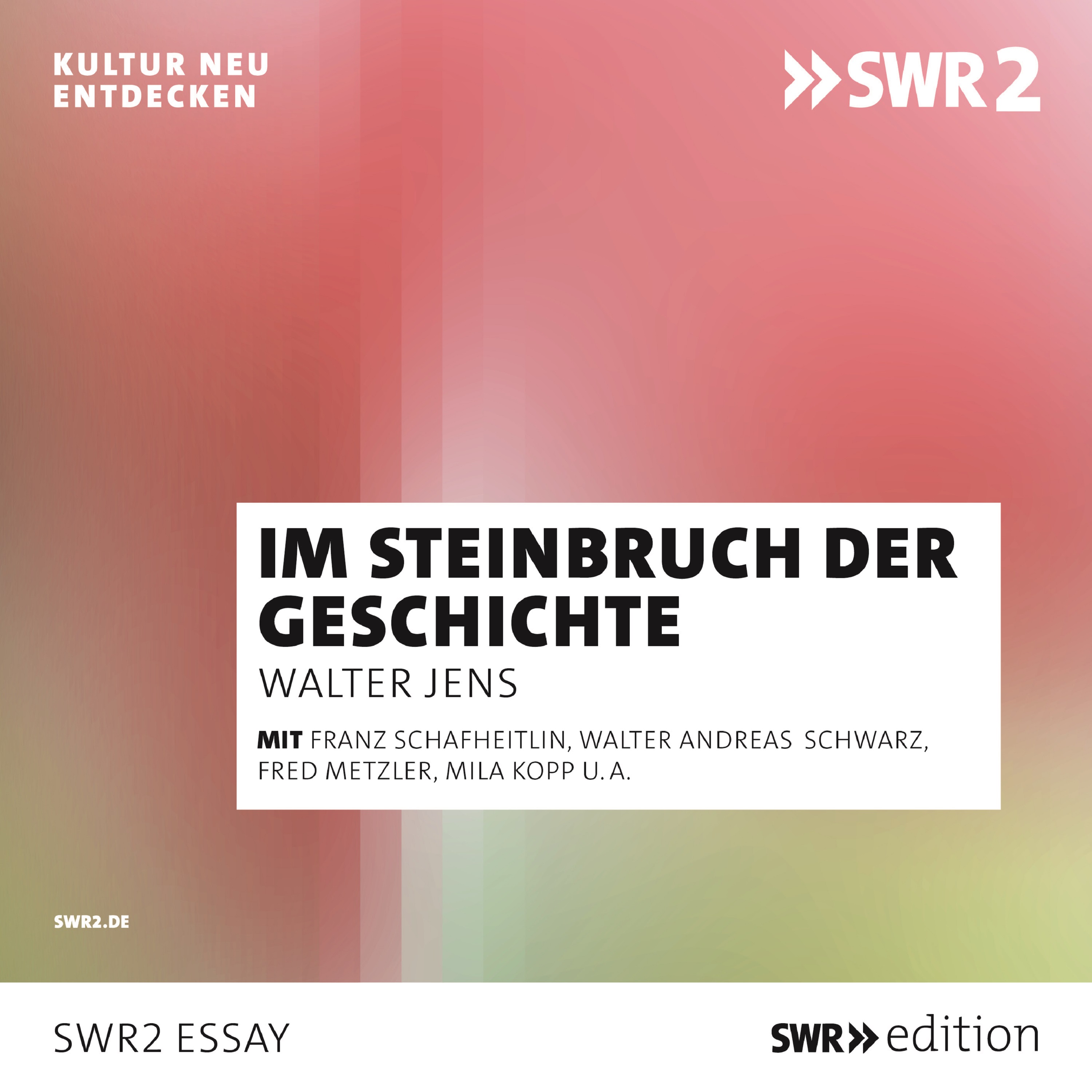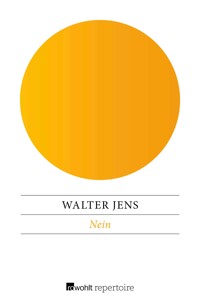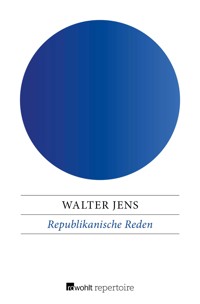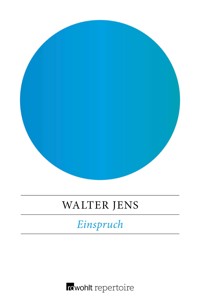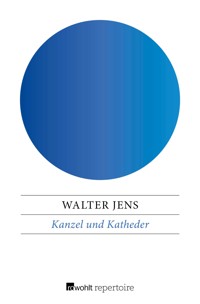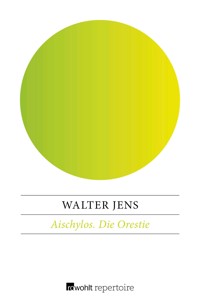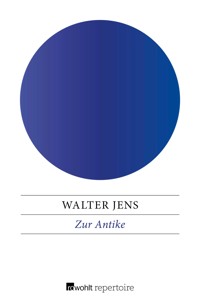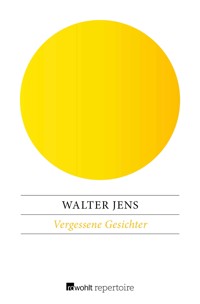
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das 1952 folgende umfangreichere Romanwerk, das wir hier wieder neu vorlegen, zeigt den Dichter in einer Hinwendung zu neuer Anschaulichkeit und Fülle, vor allem aber zu einem untergründigen Humor, dessen Lichter Gebälk und Gemäuer eines Altersheims für Schauspieler und seine skurrilen Bewohner umspielen, die nur noch von der Erinnerung an ihre Welt des Scheins, an Kulisse und Rampenlicht, an Ruhm und Mißerfolg zehren: geschminkte Gespenster. Erschüttert entdecken wir hier die geheimnisvollen Bezirke des Alters, in die wir alle einmal eintreten müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Vorspiel
«ABER ICH BIN nicht Gott», sagte Le Grand Auguste. «Ich sehe immer nur die blinden Scheiben und denke, daß wir nicht genug Geld haben, um die Putzfrauen zu bezahlen, die sie reinigen könnten. Ich sehe das Gras zwischen den Fliesen, die zerbrochenen Tassen und die Stühle ohne Lehnen, die Spinnweben und den Schmutz; den Schmutz und den Staub auf den Möbeln und Büchern. Die Regierung bezahlt so wenig, daß es kaum für das Essen reicht. Und sie selbst können sich ja nicht helfen, diese alten Leute. Früher gab es noch Mäzene, aber das ist lange her.»
«Lange, Le Grand Auguste?» fragte Le Petit Pierre, der Hausmeister.
«So lange wie der Frühling vom Winter entfernt ist», lächelte Le Grand Auguste.
«Sie sprechen immer in Rätseln, Auguste, statt etwas zu unternehmen. Wenigstens die Tassen sollten erneuert werden. Es ist eine Schande.»
«Du sprichst, wie du es verstehst, Pierre. Ich sagte doch, die Regierung …»
«Die Regierung! Immer die Regierung! Wir müssen uns eben selbst helfen.»
Le Grand Auguste sah aus dem Fenster: «Es wird gleich regnen.»
Le Petit Pierre stand auf: «Sie träumen, Auguste. Seit ich Sie kenne, also immerhin seit sechs Jahren, träumen Sie.»
«Wenn ich der liebe Gott wäre», flüsterte Le Grand Auguste, «würde ich es vielleicht ganz romantisch finden.» Er ging zum Fenster. «Sie lieben heute das Baufällige, die da draußen, Pierre. Niemand wird uns helfen. Ein verwilderter Park, ein Haus irgendwo in Frankreich, kilometerweit von der nächsten Kreisstadt entfernt, gerade noch gut genug, um hinter dem Schutt und Mörtel und dem morschen grauen Holz die Konturen des Louis seize zu sehen … das ist gerade das Rechte für sie. Sie werden uns vielleicht unter Denkmalsschutz stellen – aber helfen werden sie uns nicht. Ein einsames altes Schloß, das langsam in sich selbst stirbt, und darin zehn alte Leute, Schauspieler, die einmal berühmt waren und heute alle in dem Alter sind, wo die Leute von der ‹Revue du Théâtre› gut daran tun, sich über einen passenden Nachruf Gedanken zu machen – ein Verwalter, der dazu noch Le Grand Auguste heißt, und ein Portier, den alle Le Petit Pierre nennen, ein paar nichtsnutzige junge Dinger in der Küche, die mit den alten Leuten ihren Schabernack treiben – das ist so unglaublich beruhigend für die da draußen, zu denken, daß es so etwas noch gibt. Nein, sie werden nichts unternehmen.»
«Aber Auguste, was soll denn werden?» Der kleine Dicke, den Herr Manot, der Bürgermeister, wahrscheinlich mehr um Auguste zu ärgern denn aus Mitleid eingestellt hatte, kam näher.
«Du hast wieder getrunken», sagte Auguste. «Kannst du nicht wenigstens bis zum Mittag damit warten? Übrigens müssen wir hinunter. Ich höre ein Auto. Das wird der Metzger sein. Hoffentlich ist es Herr Pachoux nicht selbst. Wenn ich heute nicht bezahlte, würde er mir nichts mehr geben, hat er das letzte Mal gesagt. Und das Fleisch ist schon wieder teurer geworden.» Auguste öffnete das Fenster und beugte sich weit hinaus.
Pierre verstand nichts von Autos. Als musikalischer Mensch – er war der Sohn eines Klavierstimmers – verachtete er sie sogar. Aber wenn er Herrn Pachoux’ Vehikel ankommen hörte, mußte er jedesmal lachen.
«Wir haben Glück, Pierre», rief Auguste erleichtert. «Es ist nur der Gehilfe. Wir werden sehen, was er hat. Das letzte Mal war das Fleisch wirklich kaum zu genießen. Komm, wir dürfen ihn keinesfalls warten lassen.»
Im Treppenhaus begegnete den beiden ein alter Mann mit weißem Haar. Langsam und keuchend ging er die Treppe hinauf.
«Schönes Wetter heute, nicht wahr, du Maistre? Ganz klar und frisch. Das wird Ihrem Asthma guttun.» Auguste verbeugte sich sehr tief, während Pierre gelangweilt zur Seite sah.
Der alte Mann atmete rasselnd. «Nein, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Bei diesem Zug muß auch ein Gesunder zugrunde gehen.»
Auguste sah ihm nach. «Du könntest gern etwas höflicher sein, Pierre.» Er hob den Zeigefinger seiner Rechten. «Wie oft soll ich dir noch sagen, daß dieser Mann der größte Hamlet war, der jemals auf einer Bühne gestanden hat?» Auguste hatte die Stimme erhoben und sprach wie ein alter Studienrat bei der Erwähnung der Heldentaten des Kaisers Augustus. Aber er war sehr traurig und erbost.
«Darum könnte er sich trotzdem einmal in der Woche rasieren», ereiferte sich Pierre.
«Laß das, Kleiner», sagte Auguste leise, «vergiß nicht, daß er nicht mehr lange bei uns bleiben wird.»
«Sie meinen, Auguste?»
«Dr. Lefèvre sagt, er würde es nicht mehr … Also sei wenigstens zu ihm etwas netter, Pierre.»
«Die Fenster müssen abgedichtet werden», sagte Pierre eindringlich, «wenn er stirbt, wird man uns verantwortlich machen!»
«Sage das Herrn Manot. Aber es wird nichts helfen.»
Pierre antwortete nicht.
«Die Regierung ist arm, Pierre», sagte Le Grand Auguste bedeutsam, «aber, wie gesagt, wenn ich Gott wäre … ich fände alles unglaublich romantisch.»
Erstes Kapitel
«SIE GEHEN noch immer nicht, Auguste», sagte Le Petit Pierre, «haben Sie so etwas schon einmal erlebt?»
«Jedenfalls ist es lange her», erwiderte Le Grand Auguste, «es war vor drei Jahren, als Charles starb und wir Zimmer sechs aufgeben mußten.»
«Sie wollen damit doch nicht sagen …, Auguste?» flüsterte Pierre erregt und stellte seinen Besen, mit dem er gerade die Treppe des Portals gefegt hatte, zur Seite. «Sie wollen damit doch nicht sagen …?»
«Doch, Pierre. Es ist soweit. Wenn du nicht doch noch etwas bei Manot erreichst, werden wir bald auch Zimmer drei verlieren.»
«Sie meinen, du Maistre …?»
«Noch heute nacht, sagt Dr. Lefèvre.»
«Aber es geht ihm doch ganz gut. Ich habe es gehört. Er hat sogar gelacht. Ganz bestimmt, Auguste, ich habe es gehört, er hat gelacht.»
«Du hast wieder gelauscht, Pierre. Welche Unart kennst du eigentlich nicht? Daß ich dir das nicht abgewöhnen kann! Ich finde diese Horcherei wirklich außergewöhnlich ordinär.»
«Aber Sie wissen doch, Auguste, das Lauschen ist bei mir gewissermaßen eine erbliche Eigenschaft. Mein Vater, der Klavierstimmer, pflegte zu sagen …»
«Ich kenne die Geschichte, Pierre, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns über deinen Vater zu unterhalten. Was wird aus Evelyne, wenn ihr Mann stirbt?»
«Ich verstehe Sie nicht, Auguste.» Pierre machte ein paar wirkungsvolle Falten auf seiner Stirn.
«Der Herr Bürgermeister – du weißt, Manot kümmert sich um alles – wird es nicht dulden, daß das Zimmer mit einer … ich meine, nur mit einem Menschen belegt wird.»
«Sie sprechen so dienstlich, Auguste. Ist es ernst?»
«Ja, es ist sehr ernst, Pierre.»
Auguste dachte nach.
200 Jahre bestand jetzt das Maison Savarin, das der Comte Oreste Savarin in der Mitte des 18. Jahrhunderts als Stiftung für alte Schauspieler gegründet hatte. Niemals hatten sie unter Geldnot zu leiden gehabt, das Vermögen der Savarin war groß genug, um die Pfründe aufrechtzuerhalten. Aber der letzte Savarin war ein Spieler gewesen.
«Auguste!» rief Le Petit Pierre.
Le Grand Auguste hörte ihn nicht.
Eugène Savarin hatte Schulden hinterlassen, als er vor zwei Jahren seinem Leben in irgendeinem kleinen Badeort an der Riviera ein Ende machte. Die Schulden waren durch den Verkauf der Güter gedeckt, aber es blieb wenig zur Erhaltung des Maison Savarin übrig. Das Haus kam unter Kuratel der Stadt Imère – ein Gerücht, daß Eugène Savarin einen früh verschollenen Bruder hätte, war nicht beweisbar –, und damit wurde Aristide Manot Herr jenes Hauses, dessen Leben sich immer noch nach den altertümlichen Riten und Vorschriften seines Gründers Oreste Savarin richtete.
«Auguste!» Pierre kam näher und tippte Le Grand Auguste auf die Schulter.
Auguste sah ihn traurig an.
Aristide Manot war kein guter Herr. Die Zuschüsse waren immer kärglicher geworden, und seit dem Tod Charles Quenauds vor drei Jahren hatte Manot damit begonnen, die Zimmer, in denen durch den Tod eines Schauspielers ein Bett frei wurde, zu beschlagnahmen, den anderen Bewohner des Hauses zu verweisen und dann in die leere Kammer Möbel hineinbringen zu lassen.
«Wenn du Maistre stirbt», sagte Auguste leise, «werden sie Evelyne auf die Straße setzen und uns auch Zimmer drei mit den Möbeln der Savarins vollstopfen.»
«Aber Auguste, dann gehen wir ja zugrunde! Gibt es wirklich keine anderen Räume für diese Möbel?»
«Natürlich. Es gibt andere Räume. Man könnte die Möbel sogar verkaufen.»
«Oh», sagte Pierre, «meinen Sie wirklich? Diesen alten Plunder?»
«Es sind sehr kostbare alte Möbel. Wenn man sie alle verkaufen würde, statt sie auf dem Speicher des Bürgermeisteramtes und bei uns verkommen zu lassen, könnten wir von dem Erlös noch einige Zeit leben.»
«Wir sollten uns an die Regierung wenden», rief Le Petit Pierre erregt.
«Siehst du, jetzt sagst du es selbst. Aber es hat keinen Sinn. Man antwortet nicht. Manot weiß das ganz genau. Ich kann ihn nicht widerlegen, wenn er behauptet, kein Mensch wolle diese Möbel heute noch, nicht einmal mehr ein Museum. Nein, Manot wird uns kein Geld geben.»
Pierre dachte nach. «Sie können uns ja für die Zimmer, die sie nehmen, eine Miete zahlen.»
«Sie werden keinen Pfennig bezahlen.» Auguste beugte sich zu Pierre hinab. «Ich glaube manchmal, daß sie sich die Sache mit den Möbeln nur ausgedacht haben, um uns zu demütigen. Sie wollen uns zeigen, daß wir wertlos sind, wertlos wie diese alten Möbel, die nichts nützen, sondern uns nur den Raum wegnehmen. – Arme Evelyne!»
«Aber wenn wir auch noch Frau du Maistre verlieren … Immerhin hat sie die höchste Rente von allen. Ihr Bruder hat eine Meierei in Marseille. Sie wissen, er war früher Bürgermeister von Pleugon, und das ist ein Ort mit beinahe 4000 Einwohnern. Wir dürfen Frau du Maistre auf keinen Fall verlieren.» Pierre nahm wieder seinen Besen, umklammerte den aus irgendeinem nicht mehr erkennbaren Grund mit Leukoplast beklebten Knauf, legte sein Kinn darauf und sah Auguste von unten herauf an. Er versuchte, ein wenig schelmisch zu blinzeln, wie er es gern tat, wenn er scheinbar angestrengt zuhörte, in Wahrheit aber über die Anzahl der im Verlauf des Tages getrunkenen Gläser Pernod meditierte – doch seine Stimme war heiser. «Sie können uns doch nicht ein Zimmer nach dem anderen wegnehmen. Dann sind ja in ein paar Jahren alle Zimmer mit Möbeln vollgestopft. Was wird dann aus uns, Auguste? Ich dachte immer, man sähe es gern, daß unser Heim noch existiert?»
«Sie lieben uns, Pierre.»
«Na also, Auguste, sie lieben uns! Dann werden sie uns auch nichts tun.»
«Daß sie uns lieben, heißt noch nicht, daß sie uns helfen werden. Im Gegenteil. Du wirst es sehen.»
Eine Tür ging auf. Weit weg fing leises Murmeln an, dann wurden Schritte laut.
«Sie kommen», sagte Auguste, «feg den Speisesaal aus. Und daß du dir nichts merken läßt.»
«Aber Auguste», versicherte Pierre und verbeugte sich noch flüchtiger als sonst, um das vom Verwalter Gehörte möglichst bald unter das Volk zu bringen, das zu seinem Leidwesen allerdings im Augenblick nur aus der Köchin Berthe und den Mädchen Alice und Marie bestand. Immerhin hatte Marie seit langem ein Verhältnis mit dem Gehilfen eines Drogisten in Imère, so daß für die Verbreitung der Neuigkeiten am Ende doch noch ein vernünftiger Mann zu stellen war.
Le Grand Auguste schloß die Haustür, bemerkte noch, daß die Treppe wieder einmal nur sehr liederlich gefegt worden war, und ging in sein Büro gleich zur Linken der Eingangstür. Das Schild «Büro» an der Tür seines Zimmers bestand aus einem außergewöhnlich dicken Brett. Schon oft hatten sich Kurzsichtige an dem tiefhängenden Schild gestoßen, aber Pierre hatte sich bisher standhaft geweigert, das Schild durch ein Brett normaler Dicke zu ersetzen. Pierre war ein Liebhaber kleiner Tiere, und das weit vorspringende Brett bot den Spinnen eine geradezu ideale Gelegenheit, zwischen Brettkante und Türrahmen ihre Fäden zu ziehen. Da Befehle nichts halfen, hatte Auguste es mit Überredung versucht: «Siehst du, Pierre», pflegte er zu sagen, «der einzige Sinn dieser Spinnfäden wäre, daß sie in der Sonne aufleuchteten. Sicher gäbe das ein farbenprächtiges und lustiges Bild. Nun liegt aber meine Tür den ganzen Tag im Schatten. Was sollen also die Spinngewebe? Wie? Morgen machst du ein neues Schild.» Leider ließen diese Worte den Hausdiener gänzlich kalt, von Ästhetik hielt er nicht das geringste, und deshalb blieb alles beim alten.
Auguste schüttelte den Kopf. «Der Sohn eines Klavierstimmers», murmelte er, während er zum zweitenmal seine Taschen abklopfte, um den Schlüssel zu seinem Büro zu entdecken, «was kann man von so einem armen Teufel anderes erwarten?»
Der Schlüssel steckte, wie meistens, bereits auf der Tür. Auguste öffnete und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er schloß die mittlere Schublade auf und holte ein kleines in Leder gebundenes Buch heraus. In der Mitte des Buches, zwischen Seite 70 und 71, lag ein altes Briefkuvert, mit dessen Hilfe er die gesuchte Stelle schnell fand. Seite 70 war bedruckt, während das Blatt gegenüber in fünf Felder eingeteilt war, in die viele Hände eine lange Reihe von Namen eingetragen hatten.
«… so ein Schauspieler stirbt – aber nicht dessen Weib, sie habe denn selbst gespielt – und sieht sein Ende kommen und hat in Ehren gelebt, mögen die andern das Spiel von dem Tod und dem kranken Mann aufführen. Jeder Schauspieler möge bei seinem Eintritt in dieses Haus vom Verwalter eine Rolle zuerteilt bekommen – es sind aber fünf; Tod und der Kranke und Gott und Teufel und die Wünsche, figura, welche von Fraun sollte dargestellt werden. Die Verteilung der Rollen soll nur Sach’ des Verwalters und kein Streit darum sein, und mag dieser auch die Reihenfolge der Akteure wohl notieren. So der Spieler einer der fünf Rollen stirbt, soll an seine Stelle treten, wer nächst ihm ins Haus gekommen ist. Dies scheint ein Rechtes zu sein, auch wenn mancher Akteur niemals wird spielen, sondern das Spiel erleben, ohne jemals das Gelernte angewandt zu haben. Wer aber will in diesem Spiel mittun, muß vorher ein Gelübde ablegen, daß dieses seine letzte Rolle soll sein und er nicht mehr zurückkehren wird auf die Bühnen in den Städten und auch nicht auf die kleinen, so im Lande umherziehen. Die Akteure haben aber zwei Wochen nach ihrem Eintritt in das Haus ihre Rollen wohl memoriert zu haben und dann dem Verwalter vorzusprechen.»
Le Grand Auguste las die altertümlichen Sätze langsam und laut, wenngleich er sie längst auswendig kannte. Dann nahm er einen Federhalter und strich in der ersten Rubrik, auf der rechten Seite, über der, in der Schrift des Grafen Oreste Savarin, das Wort GOTT stand, den Namen Pierre du Maistre durch und schrieb darunter – es war das der 21. Name in dieser Reihe – Jean Forte. Am Ende der Spalten, unter den durchgestrichenen Worten, standen jetzt die Namen: Jean Forte, Paul Brownett, Richard Cavalier, Enrique Pleuse, Sylvia Cesarattes.
Ganz vorsichtig machte Le Grand Auguste das Buch wieder zu.
Pierre war inzwischen an der Tür des Speisesaals stehengeblieben und starrte den sechs Menschen nach, die langsam den Gang hinunterschlenderten. Etwas Ungeheures hatte sich ereignet. Während gewöhnlich die Heiminsassen nach dem Abendessen gleich aufstanden, die Männer sich im Spielzimmer versammelten und die Frauen in irgendeinem Zimmer noch ein Täßchen Kaffee tranken, geschah heute nichts dergleichen. Vielmehr blieben die Paare zusammen und verließen gemeinsam den Eßsaal. Voran gingen Richard Cavalier und seine Frau Sylvia Cesarattes, es folgten Jean Forte und seine Frau Anne Didier, den Schluß machten Paul Brownett und seine Frau Claudia Reigne. Claudia, die weder Tänzerin noch Schauspielerin gewesen war, hatte vor langen Jahren als eine der größten Mätressen von Paris viel von sich reden gemacht. Deshalb war sie die einzige, die von Pierre mit Hochachtung behandelt wurde. Jedesmal, wenn er sie begrüßte, lachte er dazu so gewinnend, daß man sein Zahnfleisch sehen konnte – und das wollte viel heißen, denn Pierre trug ein Gebiß von besonders großen Zähnen; der einzige Gegenstand außer seinem zur Aufnahme von Unmengen Alkohols befähigten Magen, auf den er wirklich stolz war.
Schweigend und langsam, eine stumme Prozession, gingen die Paare den Flur entlang. Sie waren offensichtlich nur darauf bedacht, den gleichen Abstand voneinander zu wahren. Als Richard Cavalier und Sylvia Cesarattes an der Eingangstür angekommen waren, dort, wo der Gang abging, an dessen linker Seite Augustes Büro lag, machten sie halt. Dann öffnete Richard die Tür, reichte Sylvia wieder den Arm, und schweigend gingen die drei Paare hinaus.
Pierre brauchte nicht erst nach rechts in den Speisesaal zu sehen, wo Enrique Pleuse, der beinahe gelähmte Tänzer, und seine Frau Madeleine Tombe schweigend und mit gesenkten Köpfen saßen – er wußte es auch so: Pierre du Maistre würde noch in dieser Nacht sterben. Niemand zweifelte mehr daran. Immer, wenn jemand starb, versammelten sich die Paare und gingen hinaus in den Garten. Pierre wußte nicht, was sie da taten – er durfte nicht dabei sein –, aber es interessierte ihn auch nicht sehr.
Ja, alle wußten es: Pierre du Maistre, der große Pierre du Maistre, Hamlet, vor dem der König von Spanien geweint hatte, würde sterben. Und Evelyne du Maistre, die einzige der fünf Frauen, die den Namen ihres Mannes angenommen hatte, die kleine Ophelia – Sie wissen es nicht mehr? Die Premiere im Théâtre midi in Grenoble liegt erst fünfzig Jahre zurück –, Evelyne würde allein bleiben.
Die Paare gingen die Treppe hinunter und überquerten den breiten Kiesweg. Dann lösten sie sich voneinander und erreichten durch einen schmalen Gang den rings von Taxushecken umrandeten Rasenplatz. Sylvia, Anne und Claudia, die Mätresse, setzten sich auf eine Bank. Alle drei waren zwischen 65 und 75, die Männer noch etwas älter. Richard und Jean zündeten sich eine Zigarette an, Paul zog eine Pfeife aus der Tasche. Paul war ein Neger und beinahe 80 Jahre alt. Da er zugleich der älteste Heimbewohner war, sprach er bei kleinen Versammlungen zuerst. Aber er wartete, und die Paare verharrten minutenlang schweigend. Endlich kamen von weit her Schritte.
«Er wird es sein», sagte der Neger, «sicher hat er die Hintertür benutzen müssen, damit Pierre nichts merkt.»
«Pierre ist ein Schnüffler», flüsterte Jean Forte. Er hütete sich, etwas zu sagen, was nicht schon allen längst bekannt war. Eines Tages hatte er die Stimme verloren. Er sprach selten darüber. Später war er Souffleur geworden.
«Verzeihen Sie bitte, daß ich so spät komme», sagte Le Grand Auguste, «aber ich mußte mich vor Pierre in acht nehmen.»
«Wir wissen es schon», sagte Paul. «Bitte gib mir Feuer, Auguste. Wir sind alle versammelt. Nachher, wenn Pierre auf seinem Zimmer ist, können wir zu Enrique gehen. Er wollte mitkommen, aber wir haben es nicht erlaubt.»
«Also, was sagt Dr. Lefèvre?» fragte Richard.
«Es ist hoffnungslos.»
«Aber Pierre meint, es sei gar nicht so schlimm», sagte die Mätresse laut.
Der Neger sah seine Frau traurig an: «Sie läßt sich alles von Pierre aufschwatzen», sagte er vorsichtig, «und dann plappert sie es aus. Es ist sehr seltsam, je älter sie wird, desto mehr redet sie.»
«Er hat heute schon drei Spritzen bekommen», sagte Auguste, «die Besserung hält immer nur für Stunden an.»
«Weiß er es?» fragte Richard.
Sylvia Cesarattes, seine Frau, schwieg wie immer. Sie saß unbeweglich und steif zwischen den anderen Frauen. Alle fürchteten sie, Richard am meisten. «Sie hat den bösen Blick», pflegte Pierre zu sagen. Er sagte es sehr häufig, weil es der einzige Ausspruch von ihm war, der nicht auf Ablehnung stieß. Auch Auguste traute ihr nicht ganz. Er hatte sie im Verdacht, daß sie die Hoffnung, zur Bühne zurückzukehren, noch nicht aufgegeben hatte. Aber wenn er sie darauf ansprach, lachte sie nur. Auguste hatte Angst, denn Sylvia spielte die Wünsche im Spiel von dem Tod und dem Kranken. Was sollte werden, wenn sie ihren Eid brach und wieder zum Theater ging?
«Weiß er es?» fragte der Neger.
«Sollen wir spielen?» fragte Richard.
«Wir müssen es jetzt wissen», flüsterte Jean.
«Ja, wir können spielen. Er hat mich darum gebeten. Sind Sie bereit?»
«Es ist gut», sagten Paul und Richard.
«Und Sie, Sylvia?»
«Ja.»
«Aber Jean, Sie müssen heute zum erstenmal für du Maistre spielen.»
«Ja», hauchte Jean.
«Er wird es schaffen», sagte Paul, «wir sind alle auf ihn eingestellt.»
«Dann wollen wir zu Enrique gehen.»
Auguste machte eine kleine Pause. Langsam standen Anne und Claudia auf. Claudia würde niemals spielen dürfen und Anne war noch nicht an der Reihe.
«Bitte, holen Sie Madeleine ab und gehen Sie auf ihr Zimmer», rief Le Grand Auguste ihnen nach, «und sagen Sie Enrique Bescheid, daß wir gleich kommen.»
Als sie außer Hörweite waren, trat er einen Schritt zurück und fragte: «Der Tod?»
«Ich», sagte der Neger.
«Gott?»
Jean hob die Hand. Er zitterte am ganzen Leib. «Ja, ich», flüsterte er.
«Der Kranke?»
«Enrique», sagte der Neger.
«Der Teufel?»
«Schon jahrelang ich», sagte Richard. «Seit Charles tot ist …»
«Die Wünsche?» unterbrach ihn Le Grand Auguste.
«Ja», sagte Sylvia.
«Dann wollen wir hineingehen.»
«Wann werden wir spielen?» fragte Paul.
«In einer Stunde treffen wir uns im Speisesaal. Alle.»
Dann gingen sie hinein, einer hinter dem anderen, als letzter Auguste. Es war dunkel geworden, und in Pierre du Maistres Zimmer brannte schon Licht.
Pierre du Maistre saß hoch aufgerichtet in seinen Kissen. Er hatte den Kopf lauschend zur Seite geneigt, und sein Atem ging rasselnd und schwer.
«Sie kommen zu mir», flüsterte er.
Evelyne du Maistre, klein, zierlich und behend, die Augen immer noch sehr blau und die Lippen wenig bemalt – Evelyne stand auf und ergriff die Hand des Kranken. «Sie kommen zurück, Pierre.»
«Zurück? Das verstehe ich nicht, Evelyne.»
«Sie hatten sich alle im Garten versammelt, Le Grand Auguste und die anderen, und jetzt kommen sie zurück ins Haus.»
Langsam kamen Schritte die Treppe herauf, und Gewisper wurde hörbar.
«Sie sollten laut sprechen», sagte Pierre erregt, «ich bin noch nicht tot.»
Die Schritte verliefen sich, einige Türen wurden zugedrückt, plötzlich gab es einen kurzen, heftigen Schlag.
Pierre lächelte. «Das war Sylvia. Gott sei Dank, sie ist die alte geblieben. Wie gut, daß sie keine Rücksicht auf mich nimmt.»
Evelyne ging im Zimmer auf und ab. Sie hatte die Hände vor der Brust gefaltet. Sie ging zwischen dem Bett und dem Waschtisch hin und her. Einmal links am Tisch, am linken Stuhl vorbei, einmal rechts am Tisch, am rechten Stuhl vorbei. Neben dem Bett stand ein Schrank und neben dem Waschtisch stand Evelynes Bett. Vor dem Fenster, der Tür gegenüber, lief ein schmales Bücherbord entlang. Das Bord war mit Manuskripten, Bildern, alten Büchern, Mappen mit Besprechungen, aber auch mit Vasen, Kakteentöpfen, Flaschenuntersätzen und verstaubten Keksdosen angefüllt.
Es war ein einfaches Zimmer, nicht anders als die übrigen Zimmer dieses Hauses, die sich alle nur durch Hausrat und Wandbehang voneinander unterschieden. In der Mitte war der Tisch mit zwei Stühlen, neben dem einen Bett stand der Schrank, neben dem anderen der Waschtisch.
Evelyne hütete sich, Pierre anzusehen. Schon seit Tagen hatte sie Angst, seinem Blick zu begegnen; nur wenn andere dabei waren, schien es leichter zu sein. Sie sah nach der Pendeluhr, die über Pierres Bett hing, und wünschte, daß Dr. Lefèvre bald käme. Aber die Uhr ging sehr gleichmäßig. «Soll ich die Gardinen vorziehen?» fragte sie.
«Geh ans Fenster», sagte Pierre.
Evelyne folgte. Aber sie wandte sich noch einmal um. «Du atmest ruhiger, Pierre. Versuch dich etwas hinzulegen.»
Beide hatten gelernt, die wenigen Minuten der Ruhe auszunutzen; die kurzen Pausen zwischen zwei Anfällen.
Pierre legte sich halb in die Kissen zurück, und die Halsknochen traten jetzt weniger scharf hervor, wenn er atmete. Im gleichen Augenblick schloß er die Augen, eine Hand fiel schlaff und entspannt am Bett herab, und ein Lächeln ging um den Mund des Kranken. Aus dem Garten kam eine kleine lustige Melodie herauf. Jemand pfiff ein Lied.
«Ist noch jemand draußen?» fragte Pierre ängstlich.
«Es ist nur Le Petit Pierre.»
«Welcher Wochentag ist heute?»
Evelyne drehte sich nicht um. «Mittwoch», sagte sie erschrocken, «Mittwoch, der 12. Mai.»
«Dann geht Pierre zum Kegelabend.»
«Natürlich, Pierre geht zum Kegelabend», sagte Evelyne erleichtert.
Le Petit Pierre pfiff: «Zu Straßburg auf der Schanz’.» Zweite Stimme.
«Es ist verteufelt, wie verkehrt der Kerl pfeift», sagte Le Grand Auguste, «und das Schlimmste ist, je lauter er pfeift, desto verkehrter wird es.»
Aber Jean Forte, der ihm gegenüber hinter dem Schreibtisch auf einem Stuhl saß, hörte kaum zu. Er hatte den Kopf tief gesenkt und atmete schwer.
«Er wird es nie lernen», sagte Le Grand Auguste, «aber was sollten wir ohne ihn machen?» Während er sprach, beobachtete er Jean genau, und zu gleicher Zeit lauschte er auf die Schritte, die über der niedrigen Decke langsam hin und her gingen.
«Sie müssen ruhig sein.» Le Grand Auguste hob den Kopf. «Sie müssen ruhig sein wie sie.»
«Sie ist nicht ruhig», flüsterte Jean.
«Doch, ich glaube, daß sie ruhig ist. Sie geht ganz sicher und gleichmäßig. Jetzt ist sie beim Schrank, hören Sie?»
«Nein, ich höre nichts.» Jean schüttelte unwillig den Kopf.
«Ihr seid immer so ungeduldig», sagte Le Grand Auguste, «und dabei seid Ihr doch alle älter als ich.» Er stand auf, ging um den Schreibtisch herum und legte Jean die Hand auf die Schulter. «Hören Sie doch, Jean», flüsterte er, «jetzt müssen Sie es auch hören. Das Pfeifen ist weg. Sie geht, sie geht … merken Sie, wie leicht ihr Schritt ist?» Auguste beugte sich ganz zu Jean hinunter, und was er sagte, hauchte er ihm beinahe ins Ohr. Er lächelte glücklich, und die Finger auf Jeans Schulter bewegten sich spielerisch im Takt zu seinen Worten:
«Oh, hören Sie doch, es sind die Schritte Ophelias, kleine, traurige Kinderschritte. Ein wenig schurrend natürlich, sie ist ja verwirrt, sie weiß, was ihr bevorsteht, aber sie geht doch ganz ruhig.»
«Ja, jetzt höre ich es auch», sagte Jean plötzlich. «Es ist Ophelia. Sie geht auf und ab. Aber sie hat nicht mehr lange Zeit.»
«Nein, nicht mehr lange, denn der Tod des Dänenfürsten ist nahe. Aber sie wird es tragen. Sie wird nicht mehr Ophelia sein, wenn er gestorben ist, aber sie wird leben. Wir werden ihr alle helfen.»
«Alle helfen», flüsterte Jean.
«Sie werden es schaffen, heute abend, Jean», sagte Le Grand Auguste, «ich bin ganz ruhig. Ich kenne Sie schon sehr lange.»
«Aber Sie haben mich niemals spielen sehen.»
«Nein, ich habe keinen von euch gesehen. Sie wissen ja, daß ich noch niemals im Theater war.»
«Sie sagen es immer, aber ich glaube es Ihnen nicht. Was sind Sie früher gewesen?»
«Früher?»
«Bevor Sie hierher kamen. Ich muß es wissen.»
«Ich weiß es nicht mehr, Jean. Ich habe es vergessen. Es gibt Dinge, an die man sich auch im Traum nicht mehr erinnert. Ich habe vergessen, was ich früher war.»
«Sie sprechen immer in Rätseln, Auguste.»
«Und Sie sprechen wie Le Petit Pierre, Jean.»
«Niemand von uns versteht Sie, und trotzdem tun wir alle, was Sie sagen.»
«Ja», sagte Auguste. «Sehen Sie, jetzt ist sie wieder beim Schrank. Wippend dreht sie sich herum. So. Jetzt geht sie weiter. Zwei … drei … vier. Der vierte Schritt ist etwas kleiner. Sie muß vorsichtig sein, um nicht gegen den Tisch zu stoßen. Jetzt kommt der kleine Auswärtsschritt und jetzt …» Er hielt erschrocken inne.
«Was haben Sie, Auguste?»
«Sie geht nicht weiter, Jean. Es muß etwas geschehen sein.»
Beide lauschten atemlos. «Nein, es ist nichts», sagte Le Grand Auguste. «Sie geht wieder zum Fenster.» Er atmete auf. «Soll ich Ihre Rolle noch einmal mit Ihnen durchgehen?»
«Ich glaube nicht, daß es noch nötig ist.»
«Ich glaube nicht, daß es noch nötig ist», sagte Pierre du Maistre. «Ich möchte mit der Spritze warten, bis Dr. Lefèvre kommt.» Sein Atem ging wieder schwerer und rasselnder, und unter das Rasseln war Pfeifen und Giemen gemischt. «Wie lange wird es noch dauern, bis er hier ist?»
«Er wird in wenigen Minuten kommen.»
«Und wann werden sie spielen?»
Evelyne schwieg.
«Und wann werden sie spielen, Evelyne?»
«Dr. Lefèvre wird es ihnen sagen.»
«Noch in dieser Nacht?»
«Noch in dieser Nacht, Pierre.»
«Du wirst alt werden, Evelyne.»
«Ich bin alt.»
«Du wirst noch viel, viel älter werden.»
«Nein, Pierre.»
«Sehr alt.»
«Oh, Pierre, nicht mehr als ein halbes Jahr. Noch einen Sommer lang will ich im Park herumgehen und abends deine Bilder ansehen und nachts mit dir sprechen. Aber ich will den November nicht mehr sehen.»
«Das sind noch sechs Monate.»
«Um keinen Preis der Welt länger.»
«Um keinen Preis?»
«Um keinen Preis, Pierre. Im November wird das Gespräch mit dir so leise geworden sein, daß ich dir näher kommen muß.»
«Gut, Evelyne.» Pierre hatte die Augen wieder geschlossen. «Wo stehst du nun?»
«Am Fenster.»
«Jetzt ist niemand mehr draußen?»
«Man kann nichts sehen.»
«Dann mach das Licht aus.»
Es war dunkel, und nur die Atemzüge des Kranken durchschnitten die Stille.
«Nein, niemand ist mehr im Garten. Nur die Sträucher bewegen sich leise. Es ist sehr ruhig draußen und schon ganz dunkel. Heute nacht wird es kalt sein.»
«Dann ist die Erde hart», flüsterte Pierre.
«Jetzt höre ich sehr weit weg ein Geräusch. Hörst du es auch?»
«Die Erde bebt.»
«Die Erde bebt, sagst du, und es ist doch nur ein Auto.»
«Ein Auto?»
«Es muß Dr. Lefèvre sein. Das Auto kommt näher. Jetzt wird es schon an der großen Biegung sein … jetzt an der kleinen … jetzt an der Einfahrt.»
Evelyne schloß das Fenster. «Es ist Dr. Lefèvre. Aber wir haben noch Zeit, er wird zunächst zu Auguste gehen.»
«Und wenn er hier ist?»
Evelyne schwieg.
«Und wenn er gegangen ist?»
«Wir haben auch dann noch Zeit.»
«Ich habe Angst, Evelyne.»
Enrique Pleuse, der zierlich-kleine Tänzer mit dem Gewicht eines Kindes, trug ein quergestreiftes schwarz-weißes Hemd. Sein Kopf war kahlgeschoren und gepudert. Enrique wollte ein Tänzer bleiben, auch wenn seine Beine immer unter einer dicken, grauen Wolldecke lagen. Neben ihm saß seine Frau, Madeleine Tombe. Sie hatte den Kopf etwas zur Seite geneigt und stützte ihn mit der Hand, um das Zucken zu verbergen, aber es gelang ihr nicht ganz. Sie trug einen bunten Schal und ein elegantes Kleid mit einer langen silbernen Brosche. Neben ihr saß Anne Didier, die Frau Jeans. Sie hatte die Augen geschlossen, auf denen eine Schicht dicken Puders lag. «Meint ihr, daß Jean es schafft?» fragte sie die anderen. Sie hatte eine tiefe, männliche Stimme. «Abends in ihrem Zimmer raucht sie immer Zigarren», pflegte Le Petit Pierre zu sagen, aber niemand glaubte es ihm. Man wußte, daß er auf Anne seit dem Tag nicht gut zu sprechen war, an dem sie ihn bei einem nicht eben rühmlichen Liebesabenteuer mit der Köchin Berthe ertappt hatte.
«Du brauchst dir keine Sorgen zu machen», sagte Madeleine. «Ich kenne ihn, er war immer so aufgeregt. Er hat uns mehr als einmal mit seiner Nervosität durcheinandergebracht. Du wirst sehen, nachher spielt er am besten von allen.» Madeleine sprach mit immer der gleichen etwas traurig eintönigen Stimme, langsam und ohne aufzublicken.
«Aber er hat seit 17 Jahren nicht mehr gespielt.»
«Und davor hat er 33 Jahre auf der Bühne gestanden. Seine Rolle ist nicht lang.»
«Aber die schwerste von allen.»
«Du solltest dich nicht aufregen, Anne», sagte Enrique, «wenn Madeleine sagt, daß es gut werden wird, dann wird es gut werden. Darauf kannst du dich verlassen. Sie hat schließlich lange genug mit ihm zusammengearbeitet … Gib mir noch eine Zigarette, Madeleine.»
«Du solltest jetzt nicht rauchen.»
«Unsinn», sagte Enrique. Aber er folgte.
«Du hast gut reden», sagte Anne. «Stell dir vor, du müßtest plötzlich wieder tanzen.»
Madeleine stand auf. «Ich werde Enrique jetzt hinausfahren. Ich sehe, daß du uns beleidigen willst.»
«Sei still», sagte Enrique, «sie ist dumm. Sie weiß es nicht besser. Vergiß nicht, sie ist nie über die Provinz hinausgekommen.»
Anne beugte sich weit vor. «Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe 1911 und 1913 und …» – bei jedem ‹und› tippte sie, während ihre Stimme immer lauter wurde, mit dem Zeigefinger auf den Tisch – «und 1927 mit dem Theater von Lyon in Paris gastiert, als Mimi, als Gretchen, als Madame Pompadour. Ihr habt die Kritiken nicht gelesen? Natürlich, ihr habt ja immer nur eure eigenen gelesen. Schlecht genug waren sie ja.»
«Das ist eine Lüge!» schrie Madeleine.
«Und wie war das 1934, Enrique, als du den Kellner im ‹Weißen Tisch› von Doumaunt tanztest? ‹Eine lächerliche Figur, reif, endlich abzutreten›, schrieb da jemand. Und dieser Jemand …»
«Schweig endlich!» Madeleine stampfte mit dem Fuß auf.
«… und dieser Jemand war kein anderer …»
«Laß sie doch reden», sagte Enrique.
«… und dieser Jemand war kein anderer als der große Gustave Arnoud.»
«Das ist eine Gemeinheit», sagte Madeleine. «Das hättest du nicht sagen dürfen, Anne. Du weißt genau, daß Enrique damals schon krank war. Es war nicht lange vor seinem Abtreten. Du hättest ein besseres Beispiel wählen müssen. Aber natürlich hättest du keines gefunden. Du bist dumm.»
«Wir wollen ihr verzeihen», sagte Enrique. «Weißt du, Madeleine, wenn jemand dreimal in Paris gespielt hat, dann muß man ihm vieles verzeihen. Schließlich kommt nicht jeder so weit. Stell dir das vor: dreimal in Paris, und dazu noch im schönsten Monat, im August, wo die ganzen Kritiker in den Ferien sind und man endlich unter sich ist.»
«Du kannst dir deine Ironie sparen», sagte Anne. «Wahrscheinlich hast du die Kritiken nicht gelesen, sonst würdest du wohl anders sprechen. Außerdem waren die Gastspiele im Juli.»
«Im Juli, im Juli!» rief Enrique. «Dann nehme ich freilich alles zurück. Dann hast du ja gerade in der Hochsaison gespielt, ich meine in der Hochsaison der Ferien. Aber sicher haben dich die Sommerbewohner von Paris, diese Engländer und Amerikaner …», Enrique schnaubte durch die Nase, «… sehr bewundert.»
«Ich rede nicht mehr mit euch.» Anne wandte sich ab.
«Wie einig wir uns sind», sagte Enrique und lehnte sich zurück. Aber er zitterte sehr. Er war früher ein großer Tänzer gewesen, und jetzt mußte er sich von einer Provinzschauspielerin beschimpfen lassen.
Madeleine stand auf. Ihr Gesicht war plötzlich müde und maskenhaft geworden. Man sah nichts mehr von jener anschmiegsamen und überlegenen Salondame, der einst die Suitiers von Paris riesige Blumenkörbe in die Garderobe geschickt hatten. «Wir streiten uns», sagte sie müde, «wir streiten uns wie jeden Abend, und Pierre stirbt.»
«Habt ihr ihn niemals als Hamlet gesehen?» fragte Enrique. «Niemand spielte ihn so wie er, niemand wird ihn wieder so spielen.»
Anne senkte den Kopf. «Verzeiht», sagte sie leise, «ich wollte euch nicht beleidigen, aber geht es Jean anders als Enrique?»
«Was hat Dr. Lefèvre gesagt?» fragte Pierre du Maistre, als Evelyne, die den Arzt hinausbegleitet hatte, wieder in das Zimmer trat.
«Was wir schon wußten, Pierre.»
«Heute nacht?»
«Ja, heute nacht.»
«Man kann sich niemals vorstellen, wie es ist. Nicht einmal jetzt kann ich mir vorstellen, daß etwas vorbei sein kann, ohne daß man fühlt, daß es vorbei ist. Es kommt nichts mehr, das ist unbegreiflich.»
«Man weiß es nicht genau.»
Während einer langen Pause tickte die Uhr.
«Der Vorhang fällt.»
«Aber du vergißt, Pierre: wenn der Vorhang sich senkt, bauen die Bühnenarbeiter schon die Kulissen für den nächsten Abend auf. Es geht immer weiter.»
«Das ist hinter dem Vorhang, aber was ist davor? Die Zuschauer gehen fort und es wird dunkel. Dann schließt man die Tür.»
«Um sie wieder zu öffnen. Neues Geraune entsteht. Die Lichter gehen an und aus.»
«Man weiß es nicht, niemand weiß es, aber vielleicht hast du recht, Evelyne.»
Als sie schwieg, sagte er: «Gut, daß du nichts sagst. Du bist klug. Bitte, gib mir jetzt die Kritiken. Lies sie mir vor.»
«Welchen Band soll ich nehmen?»
«Irgendeinen Band, Evelyne. Irgendeine Kritik.»
Eine Fliege summte an der Scheibe. Von fern hörte man wieder Stimmen.
«Dr. Lefèvre ist nicht abgefahren?» fragte Pierre.
«Nein.»
«Er wird heute nacht nicht schlafen.»
«Hier habe ich eine Kritik aus Berlin von 1927», sagte Evelyne schnell.
«Wir spielten damals im Schiller-Theater. Ich glaube, die wenigsten Zuschauer konnten Französisch.»
«‹Den Hamlet gab Pierre du Maistre› – kannst du es verstehen?»
«Du liest schlecht, aber ich verstehe dich schon. Es ist ja ganz leicht bisher. Lies weiter.»
«‹Aber es ist falsch zu sagen, du Maistre spielte den Hamlet – er war Hamlet.›»
«Schreibt er das wirklich?» flüsterte Pierre. «Es ist schön, daß er das sagt. Bitte, lies weiter. Aber nicht mehr lang. Es strengt mich an. – ‹Er war Hamlet› – man sagt das wohl oft, nicht wahr, Evelyne? Vielleicht ist es eine Phrase in Deutschland, eine geläufige Redensart. Aber es ist doch schön.»
«‹Drei Stunden lang war die Grenze aufgehoben zwischen Hamlet, Shakespeare und uns. Drei Stunden lang waren in der einen Person des Pierre du Maistre …›»
«Hör auf, Evelyne. Vielleicht meint er es gar nicht so. Vielleicht ist er ein berufsmäßiger Schreiber, der anschließend Skat gespielt hat oder vielleicht auch Billard in der Kneipe eines unbekannten Viertels, wo ihn seine Frau nicht findet. – Aber es ist doch schön. – War es wirklich so, Evelyne?»
«Ja, so war es.»
Eine Maus raschelte hinter der Tapete. Dann war wieder Stille.
Paul Brownett und Sylvia Cesarattes standen am Fenster von Pauls Zimmer. Am Tisch, einander gegenüber, saßen Richard Cavalier, Sylvias Mann, und Claudia Reigne, Pauls Frau. Sie spielten Sechsundsechzig.
Das Zimmer hatte zwei deutlich voneinander unterschiedene Hälften. Auf dem Schrank, hinter Pauls Bett, und auf seiner Hälfte des Bordes, das sich unter dem Fenster befand, standen Bücher in vielen Reihen. Auf dem Schrank waren sie sogar übereinandergestapelt, an den Rändern durch kleine gitterartige Leisten festgehalten, die vom Schrank bis zur Decke reichten.
Über dem Waschtisch dagegen und über Claudias Bett hingen Bilder, Photographien, Zeichnungen und Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften, die alle irgendwelche Berühmtheiten des Pariser Lebens der letzten fünfzig Jahre darstellten. Von den Staatspräsidenten bis zu bekannten Mördern und Hochstaplern war alles vertreten, was sich nur irgendeinen Namen in der Dritten Republik gemacht hatte. Präsident Poincaré beispielsweise hing neben jenem Toilettenmann Duvalle, der sich in den zwanziger Jahren durch die Verführung Minderjähriger einen traurigen Ruhm erworben hatte, während der Massemörder Petiot seinen Platz zwischen dem Langstreckenläufer Ladoumègue und dem singenden Wunderhund Adolphe hatte. Selbst an den Fensterrahmen hatte Claudia Postkarten angeheftet, und Postkarten standen auch auf dem obersten Bord ihrer Regalhälfte, die im übrigen ausschließlich Stapel von Verehrerbriefen enthielt. Allerdings behauptete Sylvia, daß der größere Teil dieser Briefe nur geliehen sei.
«Ich melde zwanzig», sagte Richard und legte den Herzkönig und die Herzdame auf den Tisch. «Es tut mir leid, Claudia, aber du wirst nicht mehr gewinnen.»
Claudia, die immer noch stark geschminkt war, lächelte herablassend.
«Es gibt Wichtigeres zu tun, Lieber, als dich im Kartenspiel zu schlagen.»
Richard sah sie erstaunt an, aber er wußte – wie immer – keine Antwort. Jetzt, im Alter, hatte er besonders darunter zu leiden, daß die Dichter ihren jugendlichen Helden zwar Kraft und Pathos, nicht aber Geist und Gewandtheit zuteil werden lassen.
Richard war einmal einer der besten jugendlichen Helden von Paris gewesen. Man hatte sogar, jedenfalls nach seiner Darstellung, ernstlich erwogen, ihn zum Ritter der Ehrenlegion zu machen; bis in seine Fünfzigerjahre hatte er sich zäh, mit erlernter Kraft und Emphase behauptet, aber dann mußte er doch in die Provinz, wo er bis in sein hohes Alter hinein mit wechselndem Erfolg jugendliche Helden kreierte. Der Absprung ins Charakterfach war ihm infolge seines Mangels an Geist und Eleganz niemals gelungen.
Es war allen ein Rätsel, warum Sylvia Cesarattes, eine der größten Charakterschauspielerinnen Frankreichs, noch im reiferen Alter Richard Cavalier geheiratet hatte, und zwar kurz nachdem ihr langjähriger Partner Paul Brownett – sicher erinnern Sie sich noch an ihr gemeinsames Gastspiel als König und Königin in Schillers Don Carlos; aber wissen Sie auch, daß beide 1931 als Jacques und Jacqueline in dem gleichnamigen Lustspiel von Parnette in der Comédie Française Triumphe feierten? – mit Claudia Reigne, der Lebedame, eine nicht minder seltsame Mesalliance einging. Allerdings verloren sich Paul und Sylvia nicht aus den Augen, und kurze Zeit nachdem man Paul, der lange krank gewesen war, einen Platz im Altersheim zugesprochen hatte, trat Sylvia von einem Tag zum anderen ab – sie spielte gerade in Paris die Phaedra – und folgte dem nun auch in der Provinz nicht mehr brauchbaren Richard. Freilich wußte jedermann, daß sie den Plan, einmal zur Bühne zurückzukehren, noch nicht aufgegeben hatte.
«Ist der Arzt schon da?» fragte Sylvia.
«Ja, schon lange», sagte Paul. «Ich sah ihn heraufkommen.»
«Siebenundachtzig», verkündete Richard, «ich habe hoch gewonnen.»
«Dafür kannst du mir jetzt noch eine Zigarette spendieren», sagte Claudia.
«Du solltest nicht immer betteln, Claudia.» Paul griff in die Westentasche und holte ein Zigarettenetui heraus. «Möchtest du eine Zigarette haben?»
«Nein, danke.»
Paul klappte das Etui wieder zu.
«Außerdem mag ich deine schwarzen nicht mehr.»
«Eine blonde?» fragte Richard und reichte Claudia die Zigarettenschachtel hinüber.
«Nein, mir ist der Appetit vergangen.»
Sylvia sah Paul an. Dann sagte sie so leise, daß die beiden anderen es nicht hören konnten: «Wie gewöhnlich sie sind. Entsetzlich gewöhnlich.»
Sylvia verachtete alle. Nur Paul und Pierre du Maistre nahm sie aus, weil beide große Schauspieler waren. Aber schon Madeleine Tombe, die einmal, wenn auch im beschränkten Fach der Salondame, eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, schätzte sie nicht sehr. Evelyne du Maistre und Jean Forte – «beide gewiß gute Schauspieler, aber auch nicht mehr», pflegte sie zu sagen – und Enrique, der in ihren Augen zwar ein gefeierter Tänzer, aber eben doch nur ein Tänzer gewesen war, waren ihr gleichgültig, während sie Claudia, Anne und auch ihren Mann Richard offen verachtete.
«Sie sind alt», sagte Paul ruhig. Er war mit neunundsiebzig Jahren der Älteste, Sylvia mit fünfundsechzig Jahren die Jüngste. Sie sah aber wie Ende fünfzig aus und war immer noch schön. Ihr Gesicht war kalt und klug.
«Ich bin nicht alt», sagte sie entschieden.
«Nein, du nicht, aber wir anderen.»
«Du bist auch nicht alt, Paul.»
«Du lügst.»
«Du wirst nie alt sein, und du Maistre ist auch nicht alt.»
«Pierre wird sterben.»
«Das ist gleichgültig. Er ist nicht alt.»
«Du solltest nicht so sprechen, Sylvia. Es tut mir weh.»
«Was tuschelt ihr denn da hinten?» rief Richard. Er hatte immer noch die starke, entschlossene Stimme seiner Helden. Aber Claudia war die einzige, die ihn deshalb bewunderte. Eine Zeitlang hatte sie sogar Richards Bild über ihrem Bett gehabt, im Panzer, als Ritter Florian; doch Le Grand Auguste hatte es verstanden, sie davon zu überzeugen, daß sie Paul damit kränken könnte. Da hatte sie es gelassen, denn sie wollte mit niemandem Streit haben.
«Vierzig», rief Claudia. «Ich werde gewinnen.»
«Laß sehen», rief Richard.
«Ich hoffe, du kannst deine Rolle», sagte Sylvia.
«Natürlich.»
«Ich würde an deiner Stelle ein bißchen darüber nachdenken. Du warst allzu schlecht das letzte Mal.»
«Der Teufel ist keine Rolle für mich», sagte Richard. «Du spielst aus, Claudia.»
«Da hast du allerdings recht.» Sylvia wandte sich wieder ab.
«Die Rollen passen für keinen von uns», sagte Paul, «aber das ist gut. Enrique ist ein schlechter Kranker, und ich bin vielleicht auch kein guter Tod.»
«Man hätte den Tänzer nicht mitspielen lassen sollen», sagte Sylvia scharf.
Paul legte ihr bedachtsam eine Hand auf die linke Schulter. «Du bist auch nicht gut für die Wünsche, Sylvia.»
«Achtundsechzig», sagte Claudia, «fünf zu vier für mich. Bitte gib mir fünfzig Francs. Wenn wir noch lange spielen, können wir wieder eine Flasche Wein bezahlen.»
Sylvia trommelte mit den Fingern gegen die Fensterscheibe. «Nein, Paul», sagte sie langsam, «du hast recht, die Wünsche sind keine Rolle für mich. Ich wollte, das Spiel wäre schon vorbei.»
«Es wird nicht mehr lange dauern», sagte Paul.
«Herz ist Trumpf», sagte Richard.
«Nein, dann hast du eben nicht bedient», sagte Claudia.
«Du darfst nicht mehr sprechen, Pierre.»
Pierre du Maistre saß jetzt ganz im Bett aufgerichtet. Sein Atem ging in kurzen, hastigen Zügen. Wenn er sprach, mußte er nach jedem Wort eine lange Pause machen. «Ich will nicht mehr viel sagen.»
«Nachher wirst du noch eine Spritze bekommen. Dann wird es besser werden.»
«Besser?»
«Verzeih.»
«Es macht nichts. Stehen die Bände mit den Kritiken wieder richtig?»
«Ja, Pierre.»
«Es sind sechs, nicht wahr?»
«Für jeden Monat einer.»
«Evelyne!»
«Ja?»
«Komm näher. Ich kann nicht mehr so laut sprechen.»
Evelyne nahm die Hände des Kranken und drückte sie fest. Dann strich sie ihm das dünne, klebrige Haar aus der Stirn.
«Der erste Akt ist nicht schwer.»
«Verzeih, aber ich verstehe nicht, was du meinst.»
«Wenn die Bühne hell erleuchtet ist und ihr alle um mich herum steht – ich sehe eure Gesichter und fasse deine Hand, und während Paul mir zunickt, denke ich: noch sechs Monate … und lange werden sie mich alle nicht warten lassen außer Sylvia – das ist nicht schwer.»
«Du darfst nicht so lange sprechen, Pierre.»
Pierre schrak hoch. «Sie kommen schon!»
Evelyne lauschte. «Nein, es ist nur der Wind. Sonst ist alles ganz still.»
«Hast du das Fenster zugemacht?» Pierre sah angstvoll auf die Gardinen. «Dahinter bewegt sich etwas.»
«Ich glaube, das Fenster ist zu, aber was schadet es, wenn es offen ist. Ich will jetzt nicht aufstehen.»
«Das Fenster», flüsterte Pierre.
«Sei ruhig.»
«Es ist offen.»
«Du brauchst nicht ängstlich zu sein. Es ist ein Abend wie alle Abende.»
Pierre sah sie mit großen, weit geöffneten Augen an. «Ja, Evelyne, ein Abend wie alle anderen.»
Sie senkte den Kopf.
Aber er sah nicht hin. «Das Fenster ist offen», sagte er hastig, «und das heißt: der zweite Akt kann beginnen. Der Inspizient winkt mir zu. Er ist sehr aufgeregt. Aber ich kann meine Rolle heute abend nicht. Ich habe sie nie gelernt.»
«Du träumst, Pierre. Gleich bekommst du die Spritze und dann wird alles wieder hell werden.»
«Nein, ich träume nicht. Ich kann meine Rolle nicht. Der erste Akt ist leicht. Er ist leicht – ihr steht um mich herum, und ich weiß, was Paul für ein Gesicht macht und was Claudia denkt. Auch der dritte Akt …»
«Du sollst dich schonen, Pierre.»
«Bitte unterbrich mich nicht. – Auch der dritte Akt ist nicht schwer. Der Vorhang fällt und niemand klatscht und niemand verbeugt sich. Langsam gehen die Lichter aus. Plötzlich fallen alle Türen zu und im gleichen Augenblick ist es ganz dunkel. – Aber der zweite Akt, Evelyne!»
«Pierre, ich beschwöre dich, halt ein, sonst …»
«Einen ganzen Akt lang Zwielicht. – Ihr steht um mich herum, und ich sehe euch nicht mehr von meiner Bahre herab. Ihr erkennt mich noch alle, aber ich erkenne niemanden mehr, auch dich nicht, Evelyne.»
«Ich stehe gerade vor dir. Die anderen können dich gar nicht sehen. Der Vorhang wird sehr schnell fallen.»
«Ja, das ist schön», sagte er, aber zwischen den Augen und dem Mund vergrößerte sich die Angst schnell und warf Schatten. Die Unterlippe fiel herab, und die Kerben an den Mundrändern verbreiterten sich rasch.
Evelyne saß unbeweglich auf dem Bett und blickte auf die Gardinen. Das Fenster war fest geschlossen.
Le Grand Auguste stand am Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit. Dann wandte er sich um. «Sehen Sie, jetzt geht es vollkommen fehlerlos», sagte er zu Jean Forte, der immer noch vor dem Schreibtisch saß. «Wir wollen jetzt nur noch einmal den lateinischen Satz üben. Ich sehe, daß er Ihnen die größten Schwierigkeiten bereitet. Also fangen wir an: ‹Zu spät! Zu spät!›»
«Bitte, Auguste, sagen Sie mir den ganzen Satz.»
«Sie haben recht, ich hätte es mir eher überlegen sollen. Aber Sie dürfen nicht so aufgeregt sein. Sie haben jetzt keinen Grund mehr. Ihre Stimme wird nur schwächer.»
«Ja.» Jean war dankbar, daß Auguste das Wort ‹noch› weggelassen hatte.
Le Grand Auguste hob die Stimme. «Jetzt endlich klagst du, jämmerlicher Mensch. Komm wieder, süßes Wort, daß ich dich schmecke: Zu spät! Zu spät!» Er hielt einen Augenblick ein. «Und jetzt kommt der Tod. Passen Sie auf die halbe Wiederholung auf. ‹Tempus mortis prope est, prope tempus mortis!›»
Ohne zu zögern fiel Jean ein: «Saeculum aeternitatis prope est. Gerettet. Amen.»
Le Grand Auguste stand auf. «Jetzt war es gut. Vergessen Sie nur nicht, daß jenes ‹tempus mortis prope est› wiederholt wird.» Er sah zur Decke. «Hören Sie die Schritte? Sie ist wieder aufgestanden.»