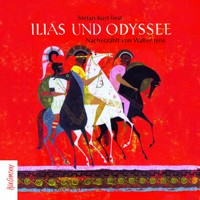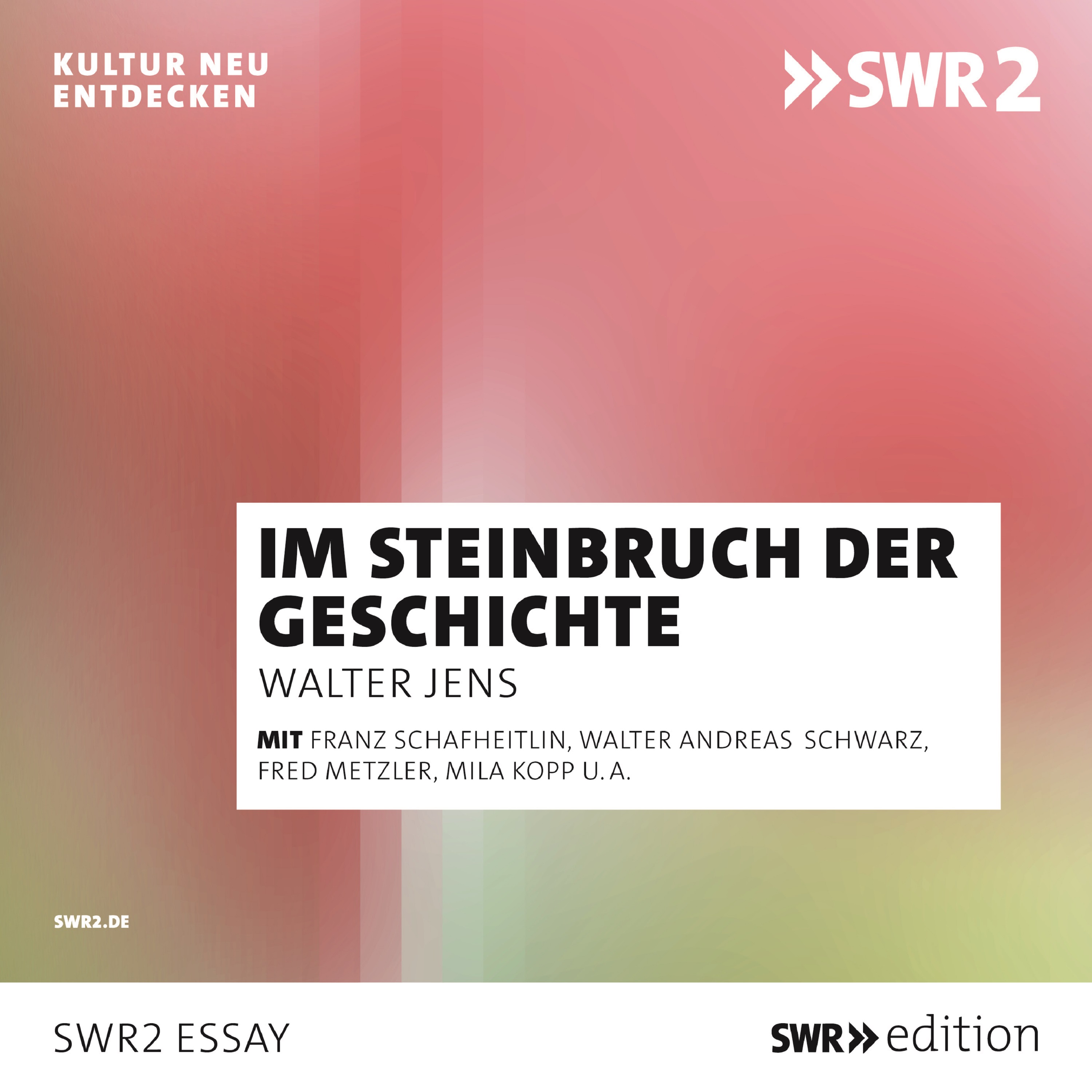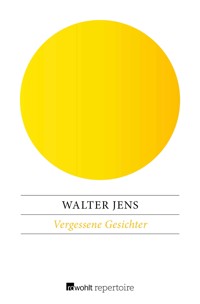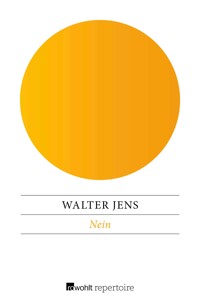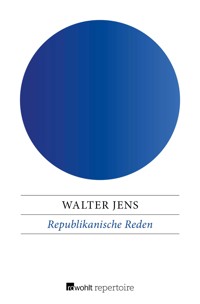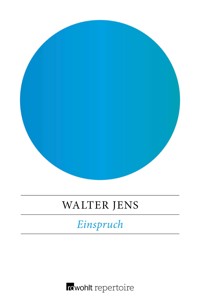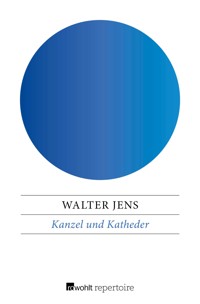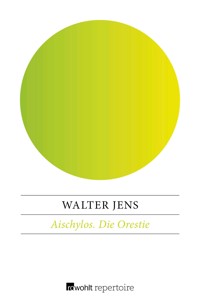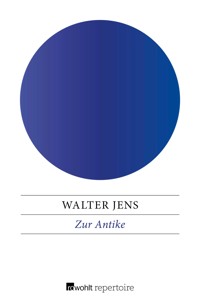9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vereint sind hier die Lobreden zu Ehren verdienter Männer, die Predigt in einer kleinen Seefahrerkirche, die Auseinandersetzung auf dem Berliner Parteitag der SPD, die Verteidigung Lessings, das Plädoyer für Hans Küng, mit dem sich die Deutsche Bischofskonferenz auseinanderzusetzen hatte. Leidenschaftliche Debatten im kleinen Kreis über die Geschichte einer christlichen Heilanstalt oder über das vertane Humboldt-Erbe eines humanistischen Gymnasiums zählen nicht weniger als die, dank der Fernsehübertragung einer Laudatio über Eugen Kogon, im größeren Rahmen entfachte Diskussion über das Verhältnis von jüdischen und christlichen Deutschen. In erinnerungsfeindlicher Zeit wird an das zu Unrecht Vergessene, Abgelegte, zur Kehrseite Erklärte erinnert, das schon beinahe Entschiedene wird aufs neue in Frage gestellt: all das dient zur Beförderung einer Debatte, in der Fragen des kulturellen Erbes mit dem gleichen Engagement wie politische Gegenwartsprobleme behandelt werden. Diesem Ziel ein Stück näherzukommen, ist die Intention aller hier vereinten Reden von Walter Jens, so sehr sich auch die Ausdrucksweise der Rhetorik, politische Apologie und Invektive, Predigt, Fest- und Gedächtnisansprache oder Laudatio voneinander unterscheiden. Gemeinsam ist ihnen die Erinnerung an ein Erbe, das bis heute nicht angetreten worden ist, und die Mahnung, die Parole der Aufklärung als dringenden gesamtgesellschaftlichen Appell zu begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Jens
Ort der Handlung ist Deutschland
Reden in erinnerungsfeindlicher Zeit
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Vereint sind hier die Lobreden zu Ehren verdienter Männer, die Predigt in einer kleinen Seefahrerkirche, die Auseinandersetzung auf dem Berliner Parteitag der SPD, die Verteidigung Lessings, das Plädoyer für Hans Küng, mit dem sich die Deutsche Bischofskonferenz auseinanderzusetzen hatte. Leidenschaftliche Debatten im kleinen Kreis über die Geschichte einer christlichen Heilanstalt oder über das vertane Humboldt-Erbe eines humanistischen Gymnasiums zählen nicht weniger als die, dank der Fernsehübertragung einer Laudatio über Eugen Kogon, im größeren Rahmen entfachte Diskussion über das Verhältnis von jüdischen und christlichen Deutschen. In erinnerungsfeindlicher Zeit wird an das zu Unrecht Vergessene, Abgelegte, zur Kehrseite Erklärte erinnert, das schon beinahe Entschiedene wird aufs neue in Frage gestellt: all das dient zur Beförderung einer Debatte, in der Fragen des kulturellen Erbes mit dem gleichen Engagement wie politische Gegenwartsprobleme behandelt werden.
Über Walter Jens
Walter Jens, geboren 1923 in Hamburg, Studium der Klassischen Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg/Br. Promotion 1944 mit einer Arbeit zur Sophokleischen Tragödie; 1949 Habilitation, von 1962 bis 1989 Inhaber eines Lehrstuhls für Klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.
Verfasser von zahlreichen belletristischen, wissenschaftlichen und essayistischen Büchern (darunter zuerst «Nein. Die Welt der Angeklagten» 1950, «Der Mann, der nicht alt werden wollte», 1955), Hör- und Fernsehspielen sowie Essays und Fernsehkritiken unter dem Pseudonym Momos; außerdem Übersetzer der Evangelien und des Römerbriefes. Walter Jens war seit 1951 verheiratet mit Inge Jens, geb. Puttfarcken. Als «Grenzgängern zwischen Macht und Geist» wurde beiden 1988 der Theodor-Heuss-Preis mit der Begründung verliehen: «Gemeinsam geben Inge und Walter Jens sowohl durch ihr schriftstellerisches Werk wie durch ihr persönliches Engagement immer wieder ermutigende Beispiele für Zivilcourage und persönliche Verantwortungsbereitschaft.»
Walter Jens starb am 9. Juni 2013 in Tübingen.
Inhaltsübersicht
Thaddäus Troll zum Gedächtnis
Vorwort
Habent sua fata orationes: Wie Bücher haben auch Reden ihr Schicksal – in welchem Ausmaß, das kann manche der hier vorliegenden Ansprachen bezeugen. Was in einer Kongreßhalle, einem Theater, einem Hörsaal, einer Kirche, einem Rathaus geäußert wurde, fand seine Weiterungen in Bürgerschafts-Debatten und Presse-Kampagnen, in Diskussionen des Deutschen Bundestags und im Für und Wider des Wahlkampfs. Ganz so wirkungslos, wie der eine oder andere glaubt, ist das flüchtige Wort eines Einzelnen nicht – wobei offen bleiben mag, ob die Lobrede zu Ehren verdienter Männer, zustimmend von jedermann akzeptiert, oder die Predigt in einer bescheidenen Seefahrerkirche nicht folgenreicher: weil länger wirkend sein könnte als die Auseinandersetzung über das in Sachen »Grundgesetz contra FDGO« auf dem Berliner Parteitag der Sozialdemokraten Gesagte, als die Verteidigung Lessings, die Johann Melchior Goezes kleinere Nachfahren aus dem Hause Springer und deren Trabanten auf den Plan rief oder als das Plädoyer für Hans Küng, mit dem sich die Deutsche Bischofskonferenz auseinanderzusetzen hatte.
Echo, gottlob, ist weder meß- noch berechenbar: Die leidenschaftlichen Debatten intra muros, im bescheidenen Zirkel, über die Geschichte einer christlichen Heilanstalt oder das vertane Humboldt-Erbe eines humanistischen Gymnasiums – zählen sie weniger als die, dank der Fernseh-Übertragung einer Dankrede (Eugen Kogon zu Ehren), im größeren und allgemeinen Rahmen entfachte Diskussion über das Verhältnis von jüdischen und christlichen Deutschen, das allzulang mit der Symbiose von Juden und Christen verwechselt worden ist?
Genug vielleicht, daß in gedächtnisfeindlicher Zeit an das zu Unrecht Vergessene, Vertane, Abgelegte, zur Kehrseite Erklärte erinnert werden konnte; genug, daß das eine oder andere Streitgespräch eröffnet wurde und das schon beinahe Entschiedene (wie die Abschaffung der Luther-Bibel) sich aufs neue in Frage gestellt sah: alles der Beförderung einer Debatte dienlich, in der Fragen des kulturellen Erbes und deren Präsenz, zivilisationsbestimmend wie sie sind, mit dem gleichen Engagement wie politische Gegenwartsprobleme behandelt werden – als öffentliche Affären, die zusammengehören.
Diesem Ziel ein kleines Stück näherzukommen, und sei es noch so bescheiden, ist die Intention aller hier vereinter Reden – so sehr sich auch, in Stil und Sujet, die Ausdrucksweisen der Rhetorik, politische Apologie und Invektive, Predigt, Fest- und Gedächtnisansprache oder laudatio, voneinander unterscheiden. Gemeinsam ist ihnen das Eine: die Erinnerung an ein allgemeine Emanzipation verbürgendes Erbe, das bis heute nicht angetreten worden ist, und die daraus resultierende Mahnung, die Parole der Aufklärung am Ort der Handlung, Deutschland, endlich als gesamtgesellschaftlichen Appell zu begreifen – jenen Gegen-Reformatoren politischer und geistlicher Herkunft zum Trotz, deren Position sich in der (durchaus erstrebten) Schelt- und Schimpfkampagne artikulierte, mit der sie auf die Thesen des Redners reagierten.
Festansprachen, oft verketzert und belächelt, können also auch im Zeitalter der Massenmedien ein Politikum sein.
Tröstlicher Gedanke – nicht nur für den Rhetor.
Tübingen, im November 1980
Walter Jens
Politische Reden
Eine freie Republik?
»Der liebe Gott«, so war’s vor Jahresfrist zu vernehmen, »ist kein Sozialist, denn er hat die Menschen ungleich geschaffen, und deshalb hat es auch keinen Sinn, von Chancengleichheit zu reden … Die Menschen sind nun einmal ungleich, die einen sind gescheit, die anderen sind weniger gescheit.« Nein, das ist kein Zitat aus dem 19. Jahrhundert; hier hämmert kein wilhelminischer Pfarrer den Plebejern draußen vor dem Kirchentor den altvertrauten Herrschafts-Satz ein »God made them high or lowly and ordered their estate« (»Hoch oder niedrig schuf sie Gott, und gab jedwedem seinen Stand«); hier redet – offenbar aus genauer Kenntnis des lieben Gottes und seiner Gedanken heraus – der Kanzlerkandidat der CDU/CSU; hier sieht sich, im Kampf gegen die »roten Systemveränderer«, die »wie Ratten aus ihren Löchern herauskommen«, Ungleichheit, im Sinne des »so ist das nun mal«, zum Weltprinzip erklärt, zur Ordnung verbürgenden Formel – womit sich, dank eines ex cathedra bavarica ergangenen Machtspruchs, neben bürgerlichen Liberalen auch ein Großteil christlicher Sozialreformer von einer Stunde zur anderen in Nagetiere verwandelt … all jene, die – weit entfernt von Gleichmacherei! – seit Rousseaus Zeiten darauf bestehen, daß jedermann die gleiche Chance haben müsse, ungleich zu werden.
Zurücknahme der Aufklärung und ihrer bis heute nicht realisierten Gleichheitsappelle heißt die Wahl-Parole der Rechten, Widerruf aller Reformen, die darauf abzielen, das zweite Prinzip der bürgerlichen Revolution endlich in seine Alltagsrechte zu setzen: Darum – unter der Devise: »Was ist, das ist gut, und was alt ist, das ist auch bewährt« – der Kampf gegen die Gesamtschule und die Unterscheidung zwischen einem Elternrecht, das schwarz und gut und einem anderen, das rot und böse ist; darum die unverhohlene Entschlossenheit, der überwältigenden Mehrheit unseres Volkes, die man von der Teilhabe an kultureller Betätigung ausschließt, ein Privatfernsehen vorzusetzen, das zu einer Volksverdummung ohnegleichen führen wird: TV à la ›Bild‹ als die Gesamtschule der Nation! – mitgeschaffen – auch das muß gesagt sein – wider Willen von jenen Grünen, die mehr Lebensqualität für alle erstreben und nun, in gespenstischer Umkehr ihrer Intentionen, den Profit der wenigen fördern. Ausgerechnet diejenigen, für die der NDR eintrat, die ehrenwerten Rebellen, haben durch ihre Stimmabgabe mit dafür gesorgt, daß er zerschlagen wird. Das pure Gegenteil des Erstrebten erreicht: bedenkt, im Blick auf die Wahl, diese politische Lektion, Freunde der Grünen! Bedenkt, mit welchem Zynismus die gleichen Kräfte, die sich gestern anklagend über die Hessischen Rahmenrichtlinien ergingen und mit nimmermüdem Elan für den ›Faust‹ und die ›Jungfrau von Orléans‹ stritten, heute für den kulturellen Ausverkauf plädieren (ein Geschäft das eine und das andere!), für den Ramsch vom Boulevard und jenes auf personality-shows eingeschworene Kommerzfernsehen, dem, ich bin dessen sicher, viele Schriftsteller in diesem Land (und nicht die schlechtesten) ebenso entschlossen wie einst dem Adenauer-Fernsehen ihre Mitarbeit versagen werden: Ihr, Sozialdemokraten, könnt in diesem Punkt auf uns zählen.
Und Ihr könnt auch dort auf uns zählen, wo es gilt, in nüchternrationaler Kritik ein Pseudo-Wertsystem zu entlarven, das sich jüngst auf dem CSU-Parteitag als kleinbürgerlich verworrene Ideologie offenbarte. Mit der kulturrevolutionären Umwälzung in unserem Land müsse jetzt Schluß sein, bedeutete der Vorsitzende Strauß den Delegierten und verlegte China trotzig an den Rhein, der Umwertung aller Werte (jetzt ein Salto von Mao zu Nietzsche!) sei nun genug, Wahrhaftigkeit(!) und Gewissenhaftigkeit, Leistung und Disziplin dürften nicht länger mehr abgetan werden – »ganz zu schweigen von religiös und ethisch begründeten Werten«. (Wahrhaftigkeit, man hört es mit Staunen, ist demnach kein moralischer Wert.)
Angesichts solchen Aberwitzes wird es begreiflich, warum gewisse Leute mit aller Gewalt eine andere – und bessere! – Schule verhindern möchten: eine Schule, in der beispielsweise gelehrt wird, daß Worte wie »Disziplin«, »Anstand« und »Familiensinn« oder was immer einer, scheinbar »ewige Werte« beschwörend, anführen mag, ohne konkreten Bezug nicht das Geringste bedeuten. Von »Anstand« und »Disziplin«, von »Sauberkeit« und »Pünktlichkeit« haben auch Goebbels und Himmler gesprochen, von »Familiensinn« die Anwälte autoritärer Herrschaftsstrukturen. Die Worte als solche, leerformelgleich und beliebig verwendbar, sind zunächst einmal Macht-Instrumente – wie sehr, das beweist der Begriff »freiheitlichdemokratische Grundordnung«, der heute für viele eher als Droh-Formel denn als Hoffnungs-Partikel erscheint und damit jene nicht nur Recht, sondern Gerechtigkeit versprechende Magna Charta dieser Republik, das Grundgesetz, aus dem Blick gerückt hat, von dem Adolf Arndt sagte, es beschreibe eine »offene« Verfassung, die nur im eigenverantwortlichen Selbertun der Bürger Wirklichkeit werde und keineswegs in Demuts-Haltung vor machtgeschützter Autorität.
In einem Augenblick, da die Grundrechte des Einzelnen in diesem Land gefährdet sind wie niemals zuvor seit der Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft: gefährdet durch die Folgen offener und geheimer Zensur und durch bürokratische Einschüchterung (ein ›Kursbuch‹ im Gepäck an der Grenze, ein Amnesty-International-Plakat im Spind, ein Marx-Zitat in der Klausur, ein aufmüpfiges Gedicht im Lesebuch – einerlei, ob von Grass oder Goethe –, eine Annonce zugunsten eines entlassenen Kollegen in der örtlichen Zeitung: wie leicht verstößt heute einer gegen jene FDGO, die für einen Großteil der kritischen Generation längst zu einer Panzerfaust des Staats geworden ist) … in einem solchen Augenblick kommt alles darauf an, die Grund- und Freiheitsrechte nicht nur defensiv: den Blick nach rechts gewandt, zu schützen, sondern sie, in entschiedenem Gegenentwurf zu den restriktiven Auslegungen der Konservativen, zu erweitern und damit der obrigkeit-verordneten FDGO wieder den Geist einer Verfassung zu geben, deren Qualität sich nach dem Engagement, dem nostra res agitur der Bürger, bemißt: Ja, das ist unser Staat.
Um dies zu erreichen, ist zweierlei nötig: Zum ersten die Aufhebung aller Gesetze, Vorschriften und Verordnungen, die, erlassen, um den Staat und seine Bürger vor den Feinden der Verfassung zu schützen, in den letzten Jahren dazu geführt haben, daß, in reaktionärer Gebots-Exegese, der Staat und die Verfassung als Feinde der Bürger erschienen.
Erweiterung der bürgerlichen Freiheitsrechte, Rückbesinnung auf ein Grundgesetz, das eher einlädt als befiehlt und, statt Gehorsam zu verlangen, Fragen aufwirft und Möglichkeiten skizziert: Das ist das eine. Das andere: Die Realisierung der Überlegung, daß es Demokratie, Volks-Herrschaft im eigentlichen Wort-Sinn, erst dann gibt, wenn die durch den liberalen Staat gewährleisteten Freiheitsrechte soziale Wirklichkeit werden; wenn der Rechtsstaat, gut hegelianisch, im Sozialstaat aufgehoben wird: dort wo er seine eigentliche Intention erfüllt, die Gesellschaft der Freien und Gleichen zu schaffen.
Gelingt diese Transformation nicht, bleibt der Zentralbereich, jenes Gebiet der Ökonomie, als eine Art von Feudal-Relikt erhalten, dessen Herrscher uns einreden möchten, die Wirtschaft sei so wenig zu demokratisieren »wie die Schulen, die Kasernen und die Zuchthäuser« (ein Vergleich, in der Tat, der für sich selbst spricht!), dann, dies hat der sozialdemokratische Staatsrechtslehrer der ersten Republik, Hermann Heller, gezeigt, »verzichtet man um der Erhaltung wirtschaftlich privilegierter Gruppen willen am Ende auf Rechtsstaat und Demokratie«.
Vergessen wir nicht, daß – ungeachtet aller materiellen und humanen Errungenschaften – Millionen von Bürgern auch heute noch zugleich in zwei Jahrhunderten leben: In der – freilich gefährdeten – Rechtsgemeinschaft unserer Zeit und, jenseits des Fabriktors, im hierarchisch gegliederten Feudalstaat, wo befohlen und gehorcht wird und die bürgerlichen Freiheiten den Charakter einer gewährten Gnade gewinnen – in einem Bezirk, wo nicht nur die großen Begriffe, sondern auch die ihnen nachgeordneten Worte sich umzukehren beginnen: »Leistung« – man muß einen Metallarbeiter reden hören: »Was leiste ich denn schon von morgens bis abends?«, um zu erkennen, daß »Leistung«, ohne konkreten Bezug, so gut eine Leerformel wie »Anstand« und »Wahrhaftigkeit« ist. Was, freiwillig gegeben, Selbstverwirklichung des Menschen in einer humanen Gesellschaft verbürgt, erweist sich, abverlangt, berechnet und unter Gewinn-Aspekt beliebig quantifizierbar, als Wertbegriff einer vordemokratischen Sozietät – einer Gesellschaft, in der, so anno 1931 die päpstliche Enzyklika Quadragesimo Anno, »die wirtschaftliche Diktatur in den Händen jener wenigen liegt, die den Blutkreislauf des Ganzen«, will heißen: den Geldfluß, »derart beherrschen, daß gegen ihren Willen niemand atmen kann«.
Das nenne ich mir eine Kampfansage, die sich übernehmen läßt: wenn auch nicht mit der Entschiedenheit jenes Johannes XXIII. formuliert, der sich, mit Strauß und Zimmermann und Biedenkopf verglichen, anno 79 wie ein roter Freischärler aus den Abruzzen ausnimmt, so doch immerhin schärfer als das Godesberger Programm. Grund genug also für die Verfechter der These, daß allein die Verwandlung des bürgerlich-liberalen Rechtsstaats in eine soziale Demokratie die Dreiheits-Formel der Französischen Revolution realisiert … Grund genug, um sich, man kann es nicht oft genug sagen, weniger verschämt als bisher, vielmehr mit der gelassenen Verve, die das gute Gewissen eingibt, zu seiner Position zu bekennen: »Wie?« fragt man, »Sie sind Sozialist?« – Antwort: »Ja, was denn sonst? Sie nicht? Dann muß ich für Sie beten, Bruder.«
So und nicht anders hätte z.B. einer sprechen können, der große Theologe Karl Barth, den man, von befreundeter Seite, im Jahre 1933 bat, er möge doch, aus Tarnungsgründen, seine Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands beenden. Aber Barth winkte ab: Nein, das täte er nicht, er hinge nun einmal an seinem »armen kleinen Mitgliedsbuch«… und was die Partei angehe, so könne er sich nicht von ihr trennen, weil sie die Partei der Arbeiter sei (pardon! »Arbeiterklasse« sagt Barth), dazu die Partei, die Demokratie in Deutschland verbürge und schließlich – die Partei des Nicht-Militarismus, will heißen: eine Vereinigung, die, in ihrer langen Geschichte, ein Gut höher als alle anderen eingeschätzt habe: den Frieden.
Ich denke, wir haben Grund, uns gerade jetzt der Sätze Karl Barths zu erinnern – in einem Moment, wo uns die Evangelische Kirche der DDR und mit ihr, in dramatischem Appell, diejenigen, die uns in zweifacher Weise die Nächsten sind, ermahnen: Wir möchten, um des Friedens und der Versöhnung willen, keine Beschlüsse mittragen, die allzuleicht, von mächtigen Lobbies weiterverfolgt, auf Kosten der Wehrlosen gehen.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Karl Barths Partei der Kleinen, denen man die entscheidende, ein Leben in Selbstbestimmung und Solidarität verbürgende soziale Gleichheit bis heute versagt … diese Partei, die darum kämpft: so wie sie um die Freiheit der Produzierenden kämpft, der Millionen, die vor Ort kooperieren … diese Partei wird, eingedenk ihrer Geschichte, das eine und das andere, Freiheit und Gleichheit, nur dann verwirklichen – dann aber gewiß! –, wenn sie die dritte Formel der Französischen Revolution: Brüderlichkeit im Zeichen des zu bewahrenden Friedens zu ihrem ersten Programmpunkt erhebt.
In Sachen der Menschen-Rechte – vor dem Gesetz und in der Arbeit – die erste zu sein, macht einer Partei hohe Ehre. In Sachen der Rüstung die letzte zu sein, macht ihr größere, weil sie, in Erfüllung sozialdemokratischer Tradition, der zur Feiertags-Ideologie von Konservativen heruntergekommenen Hinterlassenschaft der Aufklärung den Charakter eines Politikums gibt und den Rahmen aufzeigt, in dem Menschenrechte realisiert werden können. Und darum scheint es mir konsequent und recht zu sein, wenn die Partei in der Frage der Rüstungsbeschlüsse zuerst an jene denkt, die sich der von oben erzwungenen Unterzeichnung des Breschnew-Papiers verweigerten und uns – eben deshalb! – aus eigenem Antrieb um so inständiger mahnen, wir möchten als Patrioten und Anwälte des Friedens zugleich unsere und ihre Rechte vertreten: ohne Wenn und Aber und ohne Einerseits-Andererseits – möchten sie vertreten im Sinne eines geheimen gesamtdeutschen Auftrags und nicht mit den Interpreten vermeintlicher Zugzwänge und schon gar nicht mit jener militanten Rechten marschieren, die, kaum steht da die Vision noch schrecklicherer, noch grauenhafterer Waffen am Horizont, unter der Tucholsky-Devise »Gewehre rechts, Gewehre links, das Christkind in der Mitten« mit vorlauter Verwegenheit ihr dröhnendes Ja signalisiert: Aber klar doch! Und zwar sofort! Und auf deutschem Boden natürlich!
Beides zusammen, der Kampf für die sozialen und politischen Grundrechte des Menschen und für den Frieden, gibt, denke ich, der Partei, die für die andere und bessere Geschichte unseres Landes einsteht, die Geschichte der Besiegten, aber nicht Vergessenen, die Geschichte der Aufrechten, deren Namen kein Lesebuch nennt, die Geschichte der Opfer, die man, von Kenntnis so weit entfernt wie von Humanität, jüngst ihren Henkern gleichstellen wollte, die Geschichte der Emigranten, die, heute durch die deutsche Unfähigkeit zu trauern, verketzert, damals der Welt bewiesen haben, daß das Deutschland Bebels eines und das Deutschland Hitlers ein anderes ist … beides zusammen gibt der Sozialdemokratie jene verläßliche Humanität und Glaubwürdigkeit, die Thomas Mann meinte, als er die These vertrat: Allein »in der Gestalt des Sozialismus«, anders nicht, finde Demokratie heute ihre eigentliche: »ihre moralische Existenz«.
So, liebe Freunde, hat einmal ein deutscher Bürger gesprochen – ein Bürger, dessen Erbe, das Vermächtnis der Kunst und Philosophie, wir gegen den Ansturm derer verteidigen werden, die angetreten sind, Aufklärung: Befreiung aus der Unmündigkeit und Emanzipation des Gewissens zu widerrufen.
»Tut nichts, der Jude wird verbrannt« hieß es einst, »Ratten und Schmeißfliegen« werden Anwälte der Vernunft heute genannt. Doch keine Angst deshalb: die Stimme der Teufelsaustreiber ist heiser geworden, der Irrationalismus mit seinem Phrasen-Wirrwarr entlarvt sich selber Tag für Tag mehr: Während in Sonthofen auf Angst und Emotion und die dunklen Kräfte des Unbewußten gesetzt wird, den Kollektivrausch und die blinde Aggression, erklären wir mit Lessing – und wissen, was wir tun, wenn wir als unsere Parole ›Nathan, den Weisen‹, zitieren:
»Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder.«
Stadt und Staat als Kunstwerk
»Paris! Das Bild des alten Paris! Im Mittelpunkt die Île de la Cité: wie eine gewaltige Schildkröte, die ihre mit Dachziegeln geschuppten Brücken, als wären es Pfoten, unter dem grauen Rückenschild der Dächer herausstreckt. Links das Trapez der Universität: fest und dicht, gepreßt und störrisch. Rechts der weite Halbkreis der Stadt, gegliedert durch Gärten und Denkmäler – viel weiträumiger als die Insel im Zentrum. Die drei Blöcke, Cité, Universität und Neustadt: von einem Adernetz unzähliger Straßen durchzogen. Und in der Mitte die Seine, der nährende Fluß: verstopft durch Inseln, Brücken und Schiffe. Rundum eine ungeheure Ebene, zusammengepflückt aus tausenderlei Feldern, mit schönen Dörfern besät, und am Horizont ein Saum von Hügeln, angeordnet wie die Einfassung eines Beckens. Das ist Paris, das die Raben aus der Höhe der Notre-Dame-Türme erblickten«: Spricht hier ein Stadtbaumeister, der in poetischer Rede einen Bauplan beschreibt? Ein Architekt in der Rolle des Ciceronen: Paris als Inbegriff einer organisch gegliederten Stadt? Keineswegs. Der Mann, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Gassen in Adern, die Stadtteile in Netze und die Straßenbündel in Garben aus Stein verwandelte, war kein Fachmann, sondern ein Schriftsteller: Der Romancier Victor Hugo. Er ist es gewesen, der, im »Glöckner von Notre-Dame«, als erster die Poesie eines Stadtplans analysiert hat: Die Altstadt als Schiff, das Universitätsviertel, mit seinen nach einer einzigen geometrischen Formel errichteten Straßenschluchten, als geschlossener gleichartiger Block, das Ganze als ein gewaltiger homogener Kristall! Paris: die steinerne Chronik der von ihr durchlebten Zeit. Die cité als Kunstwerk: so stellt sich in der Literatur, aus der Vogelschau betrachtet, die eine Seite der Stadt dar: ihre romantische. (Paris im Jahre 1482.) Die andere, aus der Froschperspektive gesehen, nimmt sich anders aus: Da rücken, von Zola und Dickens beschrieben, die Slums und Markthallen, die schäbigen Kirchen und die Mietskasernen ins Blickfeld; da beschreiben Engels und Heine, in einer Mischung von Grauen und Faszination, die Londoner Armenviertel, das East End und die Dock-Szenerie an der Themse.
Das Janus-Gesicht der Großstadt, ihre Schrecken und ihre Menschlichkeit: Das ist ein zentrales Thema des europäischen Romans zwischen 1840 und 1930 … so sehr, daß man behaupten könnte, die eigentlichen Helden Balzacs oder Dickens’ hießen nicht Rubempré und Oliver Twist, sondern Paris und London. Die Stadt als Protagonist, als Puppenspieler und Partner: als ein lebendiges Wesen, das den Ausdruck einer Individualität besitzt, über Charaktereigenschaften verfügt und reden kann: Diese literarische Phantasmagorie läßt die Städte plastischer als auf tausend Abbildungen sein. Wie wird Berlin lebendig, das Berlin der zwanziger Jahre, wenn sich in Döblins »Alexanderplatz« die Straßen unterhalten und die Lokalitäten, Plätze und Häuserreihen, zu Franz Biberkopfs Mitspielern werden! Welche Anschaulichkeit gewinnt, im Wechselspiel mit der Personenbeschreibung, in Fontanes Roman-Anfängen die Angabe einer simplen Adresse – Straße und Hausnummer, und schon ist das Milieu präsent: »Am Schnittpunkt von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Zoologischen, befand sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei« oder: »In der Invalidenstraße sah es aus wie gewöhnlich: die Pferdebahnwagen klingelten, und die Maschinenarbeiter gingen zu Mittag, und wer durchaus was Merkwürdiges hätte finden wollen, hätte nichts anderes auskundschaften können, als daß in Nummer 98e die Fenster der ersten Etage – trotzdem nicht Ostern und nicht Pfingsten und nicht einmal Sonnabend war – mit einer Art Bravour geputzt wurden.«
Die City als Idylle und als Inferno, als Lasterhöhle und als strahlende Residenz des Kapitalismus (mit dem Parlament und der Börse und der Goldader, die beide verbindet), als Inkarnation der Decadence und als Zentrum von Apokalypse und Wiedergeburt: Hundert Jahre lang, zwischen 1840 und 1930, steht die Großstadt im Zentrum poetischer und essayistischer Evokationen; hundert Jahre lang waren es die Avantgardisten unter den Schriftstellern, Nietzsche und Trakl, Heym, Benn und Brecht, die das Problem der neuen Metropolen faszinierte; hundert Jahre lang wurde zwischen Marxisten und Kulturkritikern über die Großstadt als Sozialphänomen debattiert (wobei sich zwischen hüben und drüben, den Thesen Spenglers und den Gedichten des frühen Johannes R. Becher zum Beispiel, oft überraschende Parallelen ergeben) … und dann, auf einmal, in der Mitte unseres Jahrhunderts, ist es, Ausnahmen bestätigen die Regel, mit der Großstadtdichtung zu Ende: Der Weg Bertolt Brechts, zuerst »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« und das »Lesebuch für Städtebewohner« und am Ende die Beschreibung von Bäumen und Booten, von Gärten und Seen … der Weg Brechts ist exemplarisch: Die Stadt hat aufgehört, ein (geschweige das) literarisches Thema zu sein – und das aus einem simplen Grund: Im gleichen Augenblick, wo Häuser, Straßen und Plätze ihre Individualität verlieren, werden sie für den Schriftsteller so bedeutungslos wie Menschen ohne Alter, ohne Geschlecht und Charakter.
»Möhrings« – beginnt Fontanes Roman »Mathilde Möhring« »wohnten Georgenstraße 19, dicht an der Friedrichstraße«: Eine Introduktion wie diese wäre absurd, wenn die angegebene Lokalität nicht auf ein ganz bestimmtes kleinbürgerlich-proletaroides Ambiente verwiese … ein Ambiente, das, zu genauerer Schilderung reizend, mit seinen Optiker-, Barbier- und Schirmläden für ein unverwechselbares Milieu steht: Gründungsjahre und Petit-Bourgeoisie. Oder: »Der Kommerzienrat van der Straaten, Große Petristraße 4, war einer der vollgültigsten Financiers der Hauptstadt«: Sinnlos die Angabe der Adresse, wenn die Petristraße eine Passage wie hundert andere wäre!
Die Signifikanz ist es gewesen, das »so und nicht anders«, das den Schriftstellern erlaubte, die Physiognomie der Stadt in ein Wechselverhältnis zur Physiognomie der Personen zu setzen, das Haus auf den Menschen und den Menschen auf sein Arrondissement zu beziehen: Der Wohngegend entsprach die Diktion (je weiter im Osten, desto drastischer die Berolinismen), dem Straßenbild das Gehabe, dem Quartier das Mobiliar. Großstadt: Das war für die Poeten eine Lokalität, in der das Individuelle auf das Kollektiv, das Öffentliche auf das Private verwies – ein Doppel-Bezirk, dessen Inbegriff, an der Grenze von Straße und Haus, der Bürgersteig war: die Zone der Flaneurs und der Spaziergänger vom Schlage jenes Annoncenacquisiteurs Leopold Bloom, der in Joyces »Ulysses« die Straßen der Stadt Dublin durchwandert. Der Bürgersteig, auf dem sich zwischen Fahrbahn und Wohnung, vor Schaufenstern, Lokalen und Läden, das wahre Leben abspielt, frei und nicht funktionsbestimmt, ungebunden und zwecklos … der Bürgersteig als Literaten-Revier: Kein Wunder, daß, von Ernst Dronke, dem roten Chronisten des Vormärz-Berlin, bis hin zu Kracauer und Benjamin die glanzvollsten Großstadt-Darstellungen aus Straßenszenen bestehen – Szenen, in denen, vor der Kulisse der Häuser, Theater gespielt wird: die comédie humaine der großen Stadt. An diesem Punkt wird deutlich, warum die Metropolen heute kein Zentral-Sujet mehr für Schriftsteller sind: Die Flaneurs haben die Bürgersteige verlassen und sind abgewandert in die Reservate der Fußgängerzonen, die Freigehege unserer cities; zwischen Rasten und Rasen, dem Haus und der Straße, gibt es keinen Zwischenbereich mehr; statt der Verbindungen und Übergänge, des unberechenbaren Herüber-Hinüber, dominieren Kontrast, Gegeneinander und Negation: rush hour und gähnende Leere, Ruhe als Lärm-Abwesenheit!
Die Unmöglichkeit, jene Dialektik von »privat« und »öffentlich« anschaulich beschreiben zu können, die Hans Paul Bahrdt als Charakteristikum der cities benannt hat: die mangelnde Signifikanz des Vermittlungsbezirks Bürgersteig als eines kleinen und humanen Forums – das ist der eine Grund für den Rückzug der Poesie aus den Städten. Der andere, nicht minder wichtige: Das Verhältnis zwischen Straße und Haus hat sich, seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, den herrschenden Wirtschaftsprinzipien entsprechend, derart gewandelt, daß das alte Zentrum, Block und Bau, an die Peripherie getreten und das Haus zu einer Funktion der Straße geworden ist. An die Stelle der Häuser-Stadt, deren Beschreibung eines Dickens oder Victor Hugo würdig ist, tritt, in ihrer Fremd-Bestimmung und Monotonie nur noch soziologisch beschreibbar (aber kein Gegenstand der Poesie mehr), die Verkehrs-Stadt: Wenn die Ingenieure über die Architekten triumphieren und Kanalisationsprobleme wichtiger werden als Fragen des Stadtbilds samt seiner historischen Genese (Genese, wohlgemerkt, nicht organischen Entwicklung) und seiner zukünftigen Struktur; wenn also, aus Gründen des Verkehrs oder um militärischer Rücksichten willen – Haussmann baut die Boulevards von Paris! – eine Stadt durch äußere, ihrer Architektonik feindliche Kräfte zerstört wird, dann ist der Exodus der Literatur unvermeidlich.
Und hier nun müssen wir fragen, ob die Identifikation von Bebauungs- und Straßenplan: eine Gleichsetzung, die das ausgehende neunzehnte Jahrhundert zu keiner Zeit problematisierte … hier müssen wir fragen, ob es, anno 1977, nicht das Gebot der Stunde sei, eine These anzuzweifeln (und hernach daraus die Konsequenzen zu ziehen), die der »Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine« im Jahre 1874 mit den Worten beschrieb: »Die Projectierung von Stadterweiterungen besteht wesentlich in der Feststellung der Grundzüge aller Verkehrsmittel, die systematisch zu behandeln sind.« Ist, unter dem Aspekt der Städteplanung, nicht noch immer Gründerzeit? Gilt nicht auch heute noch das wilhelminische Gesetz, daß der Straßenverkehr als das A und O aller Dinge, über die Bauten befindet; daß das Transportmittel, da es den Kommerz befördert – »die beste Geschäftslage«, heißt es um 1899, »fällt im Allgemeinen mit dem größten Straßenverkehre zusammen« – wichtiger ist als die Wohnung, die Ware planungswürdiger als der Mensch, der sie produziert?
Ist die Zeit wirklich vorbei, da das Axiom alter Architekturbücher »Die Baublöcke ergeben sich aus der Straßenführung« von niemandem bestritten, seine Gültigkeit hatte?
Auch die kenntnisreichsten Debatten über die aufgelockerte, oder die verdichtete, die durchgrünte oder die urbane Stadt, bleiben, wie mir scheint, so lange akademisch, als das Verhältnis von Straße und Haus, dem Verkehr und dem Menschen, nicht in entschiedener Auseinandersetzung mit den Diktaten des gründerzeitlichen Kapitalismus, neu festgesetzt wird. Die Sprache bringt es an den Tag: Anforderung des Verkehrs: das ist ein terminus technicus; Forderungen des Menschen hingegen, Postulate einer auf Humanisierung des Lebens bedachten Gesellschaft: Das sind im Städtebau bestenfalls Floskeln aus der Präambel.
Bedürfnisse des Menschen: Wo kommt man ihnen, in der Praxis, nach? Waren die Architektur-Kompendien jener Zeit, der die Priorität »Straße vor Bau« zu danken ist, nicht ehrlicher, als sie, auf Ideologie pfeifend, die menschlichen Bedürfnisse nur im medizinisch-wortwörtlichen Sinn und nicht in metaphorischer Weise zitierten: unter dem Stichwort »Bedürfnisanstalt« – und dies durchaus im Stil der Zeit. »Die öffentlichen Bedürfnis-Anstalten«, heißt es in Josef Stübbens Handbuch ›Der Städtebau‹ (der kurze Exkurs sei gestattet), »sind entweder nur für die flüssigen Abgangsstoffe oder auch für die festen bestimmt. Erstere werden in Ermangelung einer besseren deutschen Bezeichnung ›Pissoirs‹, letztere Aborte genannt. Es läuft ungefähr auf dasselbe hinaus, wenn man die fraglichen Anstalten in solche für Männer und solche für Frauen eintheilt, da bei der letztgedachten Art die Trennung der Bedürfnisse fortfällt und die Sitze für Männer und Frauen sich nicht unterscheiden; indessen können mit den öffentlichen Aborten Pissoir-Stände für Männer verbunden sein, welche in Paris so eingerichtet sind, daß der Benutzer die Thür seines Standes öffnet und schließt, selbst aber mit den Füßen und von den gegenüberliegenden Häusern auch mit dem Kopf sichtbar bleibt. Alle diese unverdeckten oder halb verdeckten Pissoirs sind freilich nach unserm Schicklichkeitsgefühl für öffentliche Straßen und Plätze ungeeignet; nur für Parks und Promenaden, wo die Benutzer nicht von oben gesehen werden, sind sie zu empfehlen.«
So kurios die Passage auch klingt: Das Lachen vergeht einem schnell, wenn man bedenkt, daß dieser Abschnitt zu den ganz wenigen Stellen in einem Buch von fünfhundert Seiten gehört, in denen, und sei’s auch nur ansatzweise und nebenbei, vom Menschen, seinen Wünschen und Rechten, seiner Würde und seinem Schamgefühl aus gedacht wird … doch eben dies, das Individuum wieder in seine Rechte zu setzen, eine Stadt mit den Augen von Kindern zu sehen, die in ihr leben, mit den Blicken eines Behinderten oder aus der Perspektive jener Debattierer, die Monologe führen müssen, weil der Bürgersteig kein Bürgersteig mehr ist, sondern eine – immer noch viel zu breite – Straßenbegrenzung … dieses: die Städte wieder, wie Walter Benjamin das genannt hat, zur »Stube und Landschaft« zu machen, scheint mir die erste und selbstverständlichste Forderung zu sein, die zu artikulieren der Architekt, der Städtebauer voran, nicht müde werden darf: wohl wissend, daß sein Postulat, es sei unabdingbar, den Menschen an die erste und Profit und Rendite mitsamt ihrem Stahl und Eisen heischenden Verbund an die zweite Stelle zu setzen, zu einer Kollision mit jenen Vertretern der freien Marktwirtschaft führt, die ungeachtet aller von liberalen, ja, konservativen Architekten vorgetragenen Argumente, den Boden, die Grundlage der Zivilisation also, noch immer als ein mit anderen Wirtschaftsgütern vergleichbares Handelsgut etikettieren: unbekümmert um Verfassungsgebote, die Besonderheit der begrenzten, weder vermehrbaren noch zu transportierenden Un-Ware Boden schlichtweg ignorierend.
Hier tut Entschiedenheit not; hier gilt es mit Nachdruck darauf zu verweisen, daß Kapitalismus-Kritik zu den erlauchtesten Traditionen der Architekten gehört und daß sie sich, intra et extra muros, in vortrefflicher Gesellschaft befinden, die Baumeister unserer Tage, wenn sie betonen, daß Demokratie – das Kunstwerk Republik! – nicht partiell, sondern nur total, also unter Einschluß der Wirtschaft, oder überhaupt nicht realisiert werden kann: wenn sie sich, dieser Maxime folgend, dagegen wehren, daß der Grundstückshandel über die Stadtplanung bestimmt, die Städte von den ponderablen Interessen der Industrie abhängig bleiben … wenn sie darauf insistieren, das Enteignungsrecht zu verschärfen und den Boden, in einem Akt entschlossener Kommunalisierung, der privaten Verfügungsgewalt zu entziehen.
An Nothelfern ist bei der Durchfechtung dieses Kampfes wahrlich kein Mangel: einerlei, ob sich die Architektenkammern nun auf die Verfassung des Freistaats Bayern, auf das Godesberger Programm (es kann auch das Ahlener sein), auf die päpstlichen Sozialenzykliken, die Thesen der Vereinigten französischen Linken oder die Charta von Athen berufen: Von Konrad Adenauer – »Ich betrachte die falsche Bodenpolitik als die Hauptquelle aller physischen und psychischen Entartungserscheinungen, unter denen wir leiden«: Worte eines Oberbürgermeisters – bis hin zu Albert Einstein, der in seiner Studie »Warum Sozialismus?« die Oligarchie des Privatkapitals anprangerte, »dessen enorme Stärke selbst eine demokratisch organisierte politische Gesellschaft nicht bändigen« könne, von Pius XI. bis hin zu Hamburgs Baumeister Fritz Schumacher (»Das erste was wir verlangen müssen, ist ein neues rechtliches Verhältnis zur Grundlage alles menschlichen Daseins, dem Grund und Boden«), von aufgeklärten Konservativen bis hin zu Radikaldemokraten und Sozialisten ein einziger Chor: Enteignung ist kein Tabu; die Apotheose des Eigentums hat, im Zeichen der Grund und Boden beherrschenden Banken, längst den Charakter einer Farce gewonnen. Wer also die – weiß Gott behutsame! – Kritik der Architekten als »linke Pflichtübung« abtun möchte, sollte bedenken, daß sie, mag die Verfassungswirklichkeit ihren Forderungen noch so sehr widersprechen, der Verfassungsnorm getreu argumentieren: daß sie das Gesetz auf ihrer Seite haben, das bestehende so gut wie das Gebot aus der Zeit der bürgerlichen Revolution (»Doch soll zum Schaden des gemeinen Wesens oder zur Verunstaltung der Städte und öffentlichen Plätze kein Bau vorgenommen werden«: formuliert 1794, im Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten!): daß sie sich schließlich auf Postulate berufen können, die Baumeister und Architekten, die humanitäre Vereinigungen schon im Kaiserreich – bis heute folgenlos – formulierten: »Werden Häusergruppen oder Bezirke für unbenutzbar erklärt«, heißt es, am Ende der achtziger Jahre, in einer Erklärung des »Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege«, »so steht der Gemeinde bezüglich aller in dem umzubauenden Bezirk befindlichen Grundstücke und Gebäude das Recht der Zwangsenteignung zu.«
Mit aller Deutlichkeit gesagt: Wer vom »Staat als Kunstwerk« spricht; wer, in Schillers Sinn – die Phantasmagorie des ästhetischen Staats als eines Inbegriffs von Harmonie und Geselligkeit wird im 27. Brief des Traktats »Über die aesthetische Erziehung des Menschen« entworfen … wer in Schillers Sinn den dynamischen Staat, dessen Grundprinzip die zähmende Kraft ist, und den ethischen Staat, der auf der Pflicht und der »Majestät des Gesetzes« beruht, durch jenen ästhetischen Staat überhöht sehen möchte, dessen Grundprinzip es ist, Freiheit durch Freiheit zu geben, das Individuum mit der Gesellschaft und die Gesellschaft mit dem Individuum zu versöhnen; wer also, im Raum der Politik, die Ästhetik wieder in ihr Recht setzen will und einen Staat erträumt, der dem Menschen, mit Schiller zu reden, als »Objekt des freien Spiels« gegenübersteht und sich in seinen Bauten einer solchen Vision entsprechend manifestiert: Vielfalt und Strenge, Geometrie und Ornament, die Arabeske und das Gesetz beinahe spielerisch vereinend: dieser Mann hat zu bedenken, daß sein Idealstaat nur dann Realität werden kann, wenn ein Staat, dessen Bauten zugleich die Freiheit des Subjekts als auch die Harmonie des Ganzen repräsentieren, für die Gesellschaft jener Freien und Gleichen steht, in deren Umkreis es, mit Marx zu sprechen, jedem Menschen möglich ist, sich nach dem Gesetz der Schönheit zu formieren. (Nach dem Gesetz der Schönheit, wohlgemerkt: Marxens sozialistische Gesellschaft hat, nicht anders als die von der deutschen Klassik vorgeträumte ideale Sozietät, den Charakter eines Artefakts: »Kunstwerk« als Inbegriff einer humanen Gemeinschaft.)
Unter diesen Aspekten kommt den ihres sozialen Auftrags bewußten Architekten eine zwiefache Aufgabe zu: Sie haben, zum ersten, zu zeigen, daß die Baukunst Spiegel der Gesellschaft ist: daß also die City-Banken und Versicherungs-Hochburgen im Zentrum der Städte auf die Antinomie zwischen dem kritischen Anspruch und privater Verfügungsgewalt, zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen potenter Minoritäten verweisen.
Sie haben, sehr konkret, die Verpflichtung, den Widerspruch von Volksherrschaft und partieller durch den Staat abgesicherter Machtkonzentration am Beispiel unserer Städte, wie sie sein sollten und wie sie sind, zu illustrieren. Sie haben zu zeigen, daß Städte solange keine Kunstwerke sein können, als – ein Satz von Frank Lloyd Wright! – »dem Menschen sein angestammtes Recht auf den Boden fortgenommen wird«: daß die Vision der gebauten Freiheit und in Artefakten versinnbildlichten Öffentlichkeit ein Traum bleiben wird, wenn Mitbestimmung und allgemeine Partizipation an den Belangen des Gemeinwesens als unrealisierbar erscheinen.
Sie haben aber auch zu zeigen, die Architekten – das ist der zweite, nicht minder wichtige Punkt –, daß Kunst, Architektur so gut wie Poesie, das Bestehende nicht allein spiegelt, sondern ihm – vorgriffsweise: konkrete Utopien entwickelnd und Alternativen ausmalend, zugleich den Spiegel vorhält. (Ernst Bloch hat unter dem Stichwort »Bauten, die eine bessere Welt abbilden: Architektonische Utopien« eine Kunst analysiert, die grundrißartig verdeutlicht, wie sich, in vorausgebauter Heimat, gestaltete Ordnung mit subjektiver Freiheit verbindet.)
Kurzum, so richtig es ist, daß Architektur – der Städtebau zu allerletzt – nichts zeigen kann, was die Gesellschaft im hic et nunc den Menschen verweigert, so unabdingbar scheint mir auf der anderen Seite der Entwurf von Plänen zu sein, die antizipierend verdeutlichen, wie eine republikanische Baukunst aussehen müßte, eine Architektur, die jenes Entsprechungsspiel von solitaire und solidaire, von einsam und gemeinsam, realisiert, dessen Dialektik, den Gegensatz von Privatheit und Kollektivismus aufhebend, Demokratie verbürgt.
Wie läßt sie sich bauen, diese Demokratie, das ist die Frage, die im Zentrum dieser Tagung steht; der Staat als Kunstwerk, die im Plan vorweggenommene Republik: wie repräsentiert sie sich?
Der Faschismus hatte seinen »Bauwillen« und die ihm entsprechende, auf die Schaffung politischer Sakralstätten abzielende Tektonik: Wo, fragen wir, ist der demokratische Gegen-Entwurf? Der Staatssozialismus manifestiert sich in Mietskasernen, Pracht-Avenuen und Aufmarschplätzen, die, als künstliche Zentren, für eine Schein- und Feiertags-Öffentlichkeit stehen: Was ist die Antwort unserer Gesellschaft darauf? Ist die Frankfurter City, der Kern (der pervertierte architektonische core im Sinne Giedeons) des organisierten Kapitalismus, mit seinem Prunk und seinem Schmutz wirklich humaner als der Marx-Engels-Platz? Oder wird nicht, im Gegenteil, dem Menschen hüben noch drastischer als drüben verdeutlicht – die Dimension der Bauten und ihre Funktion bringt’s an den Tag –, in welcher Weise er von anonymen Mächten abhängig ist, undurchschaubaren Kräften, die über sein Leben verfügen?
Solitaire und solidaire: Läßt Dialektik sich bauen – und nicht nur das imperative »so und nicht anders?« Die Verbindung zwischen öffentlichem und privatem Bereich, den Zentren und Subzentren hier und den Quartieren dort: Die Aufhebung der Gegensätze im Zeichen des Geselligen: Ist eine solche Konzeption ästhetisch zu realisieren?
Das Zentrum eines demokratischen Gemeinwesens: Wie sieht es aus? Welche Baugestalt hat die Agora, das Forum, die Signorie der Selbstbestimmenden und Mitsprechenden? Gibt es architektonische Äquivalente für eine kommunitäre Gesellschaft (ein Ausdruck Erich Fromms); Gegenmodelle zu den Stadien der Tausende von Konsumenten: öffentliche Plätze und Häuser, in denen Menschen einander unter der Devise »omnia sunt communia« (hier gehört jedermann alles) begegnen – der Produzent dem Produzenten? Oder ist der – im Bau zu realisierende – Kollektiv-Ritus der Demokratie nur ein Hirngespinst? Muß Volksherrschaft, widersprüchlich wie sie ist, ausdruckslos bleiben, ohne Kirchen und ohne politische Arenen und Mausoleen? Bedarf die wahre Republik keines Zentrums, ist ihr core, dieses gebaute Herz-Innere, das Fußgängerviertel und der alltägliche Jahrmarkt: Inbegriff der Brechtschen Freundlichkeit – eine Vision im Stil Bruno Tauts?
Fragen wohin man auch blickt! Architektur, die nicht Macht zeigen will – die Macht des Feudalherrn, der herrschenden Bourgeoisie oder der allein regierenden Partei –, sondern Gleichheit ausdrückt, aber auch Individualität und auf diese Weise, repräsentativ, doch nicht monumental, Demokratie realisiert – Skepsis und Vernunft, Kompromiß und Balance – republikanische Architektur also: Seltsam, wie wenig man, allein aufs schlechte Wirkliche starrend, die Not und den Notbehelf, darüber nachgedacht hat, seit dem Ende des Krieges: auf realisierbare Utopien verzichtend. Das war nicht immer so.
Zehn Tage nach dem großen Brand, im Mai 1842, gingen in Hamburg zwei Männer daran, der Ingenieur Lindley und der Architekt Gottfried Semper, das Zentrum eines hanseatischen Gemeinwesens zu planen – ein Zentrum, das, von Chateauneuf gebaut, den Charakter eines Kunstwerks besaß. (Nachzulesen bei Fritz Schumacher: ›Wie das Kunstwerk Hamburg nach dem großen Brande entstand.‹)
Ein verschandeltes Kunstwerk, gewiß – das später gebaute Rathaus, so Alfred Lichtwark, sei überladen mit »Konditorformen und Möbelprofilen« und was die Aussichten vom Alten Jungfernstieg angehe, so sei sie durch Verkehrspavillons und Bedürfnisanstalten versperrt, die sich »wie Teile einer in den Boden versunkenen Kathedrale« ausnähmen – ein in der Gründerzeit zerstörtes Artefakt, dieses, nach Lichtwark »anmutigste Werk der ganzen Städtebaukunst des neunzehnten Jahrhunderts«, aber in der Planung dennoch ein Kunstwerk; und mit seinen von Semper projektierten zwei öffentlichen Plätzen, einem Markt für das tägliche Bedürfnis und einem Forum für das »höhere staatsbürgerliche Treiben der Bürger« eine Konzeption, an die sich – mutatis mutandis natürlich –, anknüpfen ließe, wenn es darum geht, die Prämissen einer demokratischen: Zweckmäßigkeit und technische Perfektion durch Schönheit – Schönheit im Schillerschen Sinn – überhöhenden Architektur zu entwickeln … eine Architektur, deren Anwälte von der Devise ausgehen werden, daß die vollkommene Stadt eine Absurdität ist (und eine inhumane dazu), daß es also darauf ankommt, zum ersten Mal in der Geschichte der Baukunst, die Unvollkommenheit zum ästhetischen Prinzip zu erheben: bedenkend, daß die Gesellschaftsform, die Republik, die diese Baukunst zugleich spiegelt und entwirft, unvollkommen, also menschlich ist: keine perfekte Maschinerie, sondern – ein Kunstwerk.
Ein Kunstwerk wie der Staat, der, unter die Botmäßigkeit der Ästhetik gestellt, aufhört, Staat im Sinne von Macht-Staat zu sein und zu einem Gemeinwesen wird, das es erlaubt, einem Begriff seine Würde zurückzugeben, der für die Architekten: eingeschüchtert von Ingenieuren und Verwaltungs-Angestellten wie sie sind, seit langem tabu ist: die Schönheit.
Die Schönheit, die identisch mit der Anmut des Unvollkommenen ist.
Volksbefreiung durch Volksbildung?
Es war Sonntag ums Jahr 1770, der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, als sich ein in der Oberlausitz ansässiger Edelmann, Baron von Miltitz, bei einem Gutsnachbarn verplauderte. Ein Aufenthalt unterwegs und das Gespräch mit dem Freunde hatten den Freiherrn, der ein frommer Sohn der Kirche war, daran gehindert, den Gottesdienst zu besuchen – und eine Predigt zu versäumen, das war nicht seine Art. Aber der Gutsherr beruhigte ihn: Wenn es nur das sei, könne man Abhilfe schaffen. Der Hütejunge des Dorfs habe schon mehr als einmal bewiesen, daß er in der Lage sei, die Sätze des Herrn Pfarrers Wort für Wort zu wiederholen. »Gut, mein Freund, dann bringen Sie ihn.« Der Gänsebub wurde zitiert, machte seine Aufwartung und artikulierte – kaum daß ihm der Baron sein Verlangen mitgeteilt hatte – den Predigttext in einer Weise, die den Freiherrn davon überzeugte: Dieser Junge hat nicht nur den Wortlaut, sondern auch den Sinn der geistlichen Ermahnung erfaßt. »Ich will dafür sorgen«, sagte der Baron, »daß du auf die Fürstenschule kommst, nach Schulpforta: dort gehörst du hin. Und nun sag deinen Namen.« Der Gänsebub, Sohn eines Bandwirkers aus Rammenau, antwortete: »Mein Name, Euer Ehren? Johann Gottlieb Fichte.«