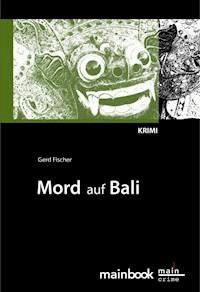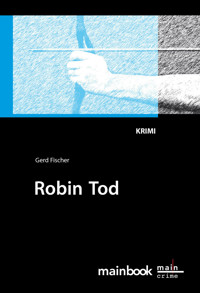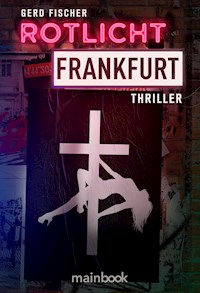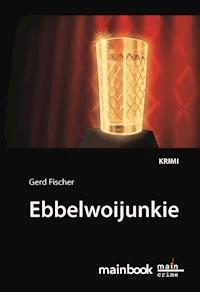Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MainBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Frankfurt-Krimis
- Sprache: Deutsch
Frankfurter Krimi-Serie um Kommissar Andreas Rauscher. Bisher erschienen: "Mord auf Bali" 2006 (Neuauflage 2011), "Lauf in den Tod" 2010, "Der Mann mit den zarten Händen" 2010, "Robin Tod" 2011, "Paukersterben" 2012, "Fliegeralarm" 2013, "Abgerippt" 2014, "Bockenheim schreibt ein Buch" (Hrsg.) 2015, "Einzige Liebe – Eintracht-Frankfurt-Krimi" Februar 2017, "Ebbelwoijunkie" Dezember 2017, "Frau Rauschers Erbe" 2018 und "Der Apfelwein-Botschafter" 2021. Zudem der Thriller "Rotlicht Frankfurt" 2019. Ein einsames Leben. Eine außergewöhnliche Gabe. Ein tödliches Schäferstündchen. In einem Bornheimer Mietshaus wird Marie-Luisa Bonner, 46, unter seltsamen Umständen getötet. In seinem dritten Fall stößt Andreas Rauscher, Frankfurter Kommissar und Apfelweinliebhaber, zunächst nur auf mysteriöse Blutergüsse, ein blondes Haar und viele offene Fragen. Es entwickelt sich ein mitreißender Krimi, der von einsamen Herzen, unerfüllten Sehnsüchten und schuldigen Händen handelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Fischer
Der Mann mit den zarten Händen
Krimi
main crime No.02
mainbook Verlag
Das BuchNicht genug, dass Andreas Rauscher mit seiner neuen Liebe Elke Erb hadert, weil sie sich nicht eindeutig zu ihm und Frankfurt bekennen kann, jetzt bekommt er es auch noch mit einem Mordfall zu tun, der den Frankfurter Kommissar und Apfelweinliebhaber vor viele Rätsel stellt.Er und sein Team der Frankfurter Mordkommission werden zu einem Tatort nach Bornheim gerufen. Eine Frau wurde ermordet, deren Körper eingeölt wurde und Blutergüsse aufweist.Bald stellen sich weitere Fragen: Was hat es mit der geheimnisvollen Frauenclique der Toten auf sich? Welche Rolle spielt der Ginnheimer Detektiv Kowalski, den der Ex-Ehemann der Toten engagiert hatte? Ist der Täter unter den jüngeren Liebhabern der Frau zu finden?Im Laufe der Ermittlungen erlebt Rauscher, wie die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, Macht und Ohnmacht, Schuld und Unschuld verschwimmen und sich begabte Hände verselbständigen können.
Der AutorGerd Fischer, 1970 in Hanau geboren, lebt und arbeitet in Frankfurt-Bockenheim. Krimi-Veröffentlichungen: „Mord auf Bali“ 2006 (Neuauflage 2011 mainbook Verlag); „Lauf in den Tod“ 2010; „Robin Tod“ 2011
1000 DANK
an meine Schwester Claudia, Ingeborg B., Anne F., Ute S, Elisabeth S., Claudia L., Thomas und Uli L., Astrid Z., Andrea und Alex v. K., Uwe H.; Frank D.
Copyright © 2010 mainbook Verlag, Gerd FischerAlle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet: www.mainbook.de
Signierte Bücher können ohne zusätzliche Versand- und Portokosten direkt beim Verlag auf www.mainbook.de bestellt werden
Lektorat: Ingeborg BellmannLayout: Anne FußTitelbild (bearbeitet): © Herbie – Fotolia.com
ISBN 978-3-9813571-6-5
Dieses Buch ist euch gewidmet,die mich im Laufe der Jahre immer wieder zum Schreiben animiert haben
Null
An meinen Händen klebt Blut. Sie schmerzen. Am liebsten würde ich sie abschneiden, um weiteres Unheil zu verhindern. Doch ich brauche sie noch. Sie müssen die Vorkommnisse aufschreiben, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Ungeschehen mache ich dadurch nichts, aber vielleicht vermögen diese Zeilen meine Hände und mein Gewissen reinzuwaschen.
Ich sitze hier in diesem kleinen Raum, in dem nur ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch und ein schmaler Schrank stehen. Wenn ich durch das winzige Fenster schaue, kommt mir die Erinnerung vor wie ein ferner Streifen am Horizont, unerreichbar weit weg. Aber die dicken weißen Wände schreien mich an: Schuldig!
Nur ich bin in der Lage, die Wahrheit niederzuschreiben. Denn ich bin der Einzige, der alles von Anfang an miterlebt hat. Mit jeder Zeile berge und befreie ich sie, erwecke mein Gedächtnis neu zum Leben. Das erfordert Disziplin. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Deshalb fange ich an. Dort, wo alles begann, vor etwa dreizehn Jahren, im Haus meines Onkels. Verdammt sei es!
Ich besitze eine Fotografie, die das Haus neben den anderen in der Straße zeigt. Ich hütete sie jahrelang wie einen Schatz und habe sie oft angeschaut, seit dem Tag, an dem ich dieses Haus zum letzten Mal betreten durfte.
Auf dem Foto – ich bin sechs oder sieben Jahre alt – stehe ich neben Onkel Manfred und Tante Klara. Direkt vor dem Haus. Eine Art Landhaus mitten in der Stadt, das sich deutlich von den anderen Häusern in der Straße abhebt.
Schlichtheit und Größe, sagte Onkel Manfred immer, sei eine kluge Kombination. Ich hatte nie richtig verstanden, wie er das meinte, aber wenn ich das Foto betrachtete, dachte ich, dass er damit den geräumigen Hof meinte, an den fünf Garagen grenzten, die langgezogene, leicht ansteigende Einfahrt, umringt von Platanen, den kurzgeschnittenen Rasen, den penibel angelegte Beete säumten, und den dunklen Teich hinterm Haus. Eine Oase inmitten des Getöses der Großstadt.
Haus und Grundstück waren einfach gehalten, schmucklos. Nicht protzig, aber großzügig, denn Onkel Manfred benötigte Platz, um seine Oldtimer zu reparieren. Jede freie Minute widmete er ihnen. Wertvoll sahen sie aus, blitzblank poliert.
Ich mochte das Haus meines Onkels schon deshalb, weil ich mit meinen Eltern immer in einer engen, miefigen Mietwohnung gelebt habe. Der Tag, an dem ich es zum letzten Mal betreten habe, ist in meinem Gedächtnis eingebrannt. Es war der 11.Oktober 1996 kurz vor meinem 14. Geburtstag.
Ich sollte auf Sabin, meine siebenjährige Cousine, aufpassen. Nur vier oder fünf Stunden, bis Onkel und Tante aus der Oper zurückkämen.
Als ich klingelte, war Tante Klara bereits ausgehfertig. Ihr rosa Kleid schien mir einen Tick zu exklusiv und die vielen Klunker glitzerten. Tante Klara empfing mich mit einem freundlichen Händedruck und ihrem Gesicht sah ich an, dass sie sich wahnsinnig auf die Oper freute. Onkel Manfred war ebenfalls bester Laune. Er warf sich ein Jackett über den Arm, lächelte mir zu und trat ins Freie. Seine herzliche Art erinnerte mich so gar nicht an meinen Vater.
Nachdem auch meine Tante endlich das Haus verlassen hatte, nicht ohne mich vorher ausdrücklich auf meine Pflichten als Babysitter hinzuweisen – Bettruhe für Sabin ab 21 Uhr, vorher sollte sie noch aufs Klo gehen und Zähneputzen nicht vergessen – setzte ich mich vor die Glotze und zappte drauf los. Zwanzig Programme zogen mich magisch an.
Zwischendurch stand ich mal auf, um nach Sabin zu schauen. Als ich von oben ihren leisen, fröhlichen Gesang hörte, ging ich davon aus, dass sie glücklich beschäftigt mit ihren Lieblingspuppen spielte, und machte es mir wieder im Sessel gemütlich.
Es war noch nicht annähernd neun, aber auf der Mattscheibe herrschte Langeweile. Also schlenderte ich durchs Haus.
Unglaublich, was Onkel Manfred und Tante Klara alles sammelten. An allen Wänden hingen Bilder, großflächige Landschaften und dunkle Stillleben. In jedem Zimmer antike Schränke, alte Kommoden und in den Regalen und feingearbeiteten Vitrinen standen selbst gebastelte Miniaturen. Autos. Flugzeuge. Motorräder. Clowns. Porzellanväschen. Stoffpuppen mit rosa und lila Kleidchen. Ich nahm manche Sachen heraus, bestaunte sie und stellte sie wieder an Ort und Stelle zurück. Plötzlich wunderte ich mich, dass ich gar nichts mehr von oben hörte und rief „Sabin“.
Stille.
Ich rief lauter.
Nichts.
Ich ging die Treppe hoch. Es war dunkel. Als ich oben ankam, ging ein Deckenstrahler an und erhellte den breiten Flur. Die Tür zu Sabins Zimmer war nur angelehnt und knarrte leise, als ich sie aufdrückte. Es brannte kein Licht. Ich erkannte zarte Umrisse: das Bett, einen Schrank, einen Tisch, Regale. Sabin sah ich nicht. Nirgends war ein Zeichen von ihr, nichts deutete darauf hin, dass sie sich im Zimmer befand.
„Sabin!“, rief ich.
Dann noch einmal, mit Nachdruck:
„Sabin!?“ Keine Reaktion.
Ich tastete nach dem Lichtschalter und drückte ihn.
Im Hellen sah alles viel vertrauter aus. Sabins Zimmer war ein langgezogener Raum mit bunter Dschungelbuchtapete. Auf dem grün-rot-blau-weißen Teppich lag allerlei Krimskrams herum, alles, was Mädchen sich wünschen: Barbiepuppen im Zehnerpack, ein selbstgebautes Puppenhaus, Stifte und Malhefte, ein Kassettenrekorder, stapelweise Kassetten, Spiele und Bilderbücher, um nur das zu nennen, was mir auf den ersten Blick aufgefallen war.
Ich stemmte die Hände in die Seite und schrie: „Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus! Oder ich versohl’ dir den Hintern.“ Nichts rührte sich. Ich wurde unsicher. War Sabin gar nicht hier? War sie hinunter gegangen, ohne dass ich es bemerkt hatte? Oder war sie im Schlafzimmer ihrer Eltern, zwei Türen weiter? Es gab noch das Badezimmer und ein Ankleide- und Bügelzimmer. Vielleicht war sie dort? Aber das hätte ich doch mitbekommen. Wahrscheinlich war die Göre viel flinker und geschickter, als ich dachte und spielte nur ein Spiel mit mir, beruhigte ich meine Sorgen, die sich langsam in meinem Magen breit machten. Oder gab es eine andere Erklärung für ihr plötzliches Verschwinden?
Gerade, als ich die anderen Zimmer inspizieren wollte, hörte ich ein kaum wahrnehmbares Geraschel. Jetzt war ich sicher: Sabin versteckte sich vor mir, irgendwo hier in ihrem Kinderzimmer.
Ich beschloss, ihr Spiel mitzuspielen, ging aus dem Zimmer, um in den anderen zu suchen, schlich aber zurück, versteckte mich hinter der halboffenen Tür und linste durchs Schlüsselloch.
Keine Minute später hob sich der Deckel des großen Wäschekorbs und zwei runde Äuglein lugten hervor, spähten durchs Zimmer und vergewisserten sich, dass es leer war. Behände kroch Sabin aus dem Korb und schlich auf Zehenspitzen Richtung Tür.
Ich grinste innerlich, jetzt würde ich ihr einen schönen Schrecken einjagen.
Sie hielt inne und horchte. Da alles ruhig war, setzte sie ihren Weg fort. Als sie die Tür erreichte, sprang ich aus meinem Versteck. Sabin fuhr zusammen und ihr Schrei zerschnitt die Stille. Die Augen weit aufgerissen, blieb sie starr stehen. Der Schreck saß tief in ihrem Gesicht. Die Überraschung war mir geglückt. Aber als ich sie packen und ins Bett stecken wollte, entzog sie sich mit einer geschickten Drehung blitzflink meinen Händen, rief: „Fang mich doch, du Eierloch!“ und rannte davon.
Ich ärgerte mich, dass ich nicht schneller und fester zugepackt hatte, und sah aus den Augenwinkeln, wie Sabin die Treppe hinunterrannte.
Jetzt geht das Spiel also von vorne los, dachte ich, und begab mich ebenfalls hinab. Es war mittlerweile allerhöchste Zeit, Sabin musste ins Bett. Ich hatte keine Lust, mir Vorwürfe meiner Tante anhören zu müssen.
Im Wohnzimmer empfing mich der Nachrichtensprecher. Einen Moment später vernahm ich eine Explosion und im darauf folgenden Kommentar fiel das Wort „Irak“. Ich ignorierte den Fernseher und konzentrierte mich auf die Situation hier im Haus.
Sabin war nirgends zu sehen.
Ich durchkämmte das Wohnzimmer, den Flur und die Küche. Nichts. Ich riss die Tür des Gästeklos auf. Fehlanzeige. Im Keller vielleicht? Die Tür war verschlossen. Aber irgendwo hier unten musste Sabin sein. Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gedacht, rannte sie an mir vorbei, die Treppe hinauf und zeigte mir eine lange Nase.
Meine Unlust auf dieses Versteckspiel stieg. Unmissverständlich forderte ich Sabin auf, sich bettfertig zu machen und wies nachdrücklich darauf hin, dass ich mich ansonsten gezwungen sähe, zu ganz anderen Methoden zu greifen, wenn sie nicht augenblicklich freiwillig ins Bett ginge.
Ein langgezogenes “Hihihihi“ war die Antwort und ich spürte, wie meine Wut langsam vom Bauch ins Hirn kroch.
Wieder ging ich die Treppe hinauf. Ich war mir sicher, dass ich Sabin innerhalb der nächsten Minute schnappen, ins Bett stecken und das Licht löschen würde.
Im Kinderzimmer knarrte und knackte es. Es hörte sich nach einem Sprungrahmen an, aus dem sämtliche Sprungfedern sprangen.
Ich hatte Angst, dass dieser Abend ausarten und ich meiner Tante gegenüber in Erklärungsnot geraten könnte.
Sabin sprang auf ihrem Bett herum und lachte. Sie hatte sichtlich Spaß an dem Spiel, das jetzt langsam zu Ende gehen sollte. Denn eines war klar: Dieses Mal würde sie mir nicht entwischen. Auch ihr schien das bewusst zu sein. Ich war hellwach, spürte das Adrenalin durch meine Adern fließen und sagte ganz ruhig, „Zieh jetzt bitte deinen Schlafanzug an.“
„Nein, du musst mir helfen“, jauchzte sie. Offensichtlich hatte sie ebenso genug von dem Rumgehetze wie ich und würde friedlich und freiwillig ins Bett gehen. Einerseits war ich beruhigt, andererseits fand ich es ein bisschen schade, dass sie so schnell aufgegeben hatte. Ein solch abruptes Ende der Jagd war mehr als unbefriedigend.
Sabin verschränkte die Hände vor der Brust und spielte Kindchen:
„Ich kann das noch nicht.“
„Du bist doch schon groß. Hier!“ Ich warf ihr das Nachthemd zu, das ich im Bett gefunden hatte. Sie nahm es und feuerte es in die gegenüberliegende Ecke des Zimmers:
„Nö. Bin noch zu klein.“
So etwas hatte ich bisher noch nicht erlebt. Ich war im Babysitten unerfahren und hatte auch keine kleinen Geschwister. Ich wusste nicht genau, was ich tun sollte, atmete erst einmal theatralisch durch, holte dann das Nachthemd und drückte es ihr in die Hände:
„Wenn du jetzt ganz schnell dein Nachthemd anziehst und ins Bett gehst ohne rumzuzicken, brauchst du dir nicht die Zähne zu putzen. Okay?“ lockte ich sie.
„Das verrat ich meiner Mama.“
Sabin nervte also weiter. Schlimmer: Sie reizte mich. Denn genau das, womit sie mir drohte, wollte ich ja unbedingt vermeiden.
„Also gut. Ich helfe dir“, willigte ich widerwillig ein und schnappte mir das Nachthemd. Leichter gesagt als getan. Sabin hopste auf der Matratze herum, dass es nur so krachte. Ihr Rumgehopse machte mich wütend, aber ich versuchte, mich zu beherrschen.
Zuerst zog ich ihr den rosa Pulli über den Kopf. Dabei verhedderten sich ihre langen blonden Haare im Kragen. Vorsichtig zog ich daran, um sie zu befreien. Das Unterhemdchen glitt ihr leicht über den Kopf. Die Hose, eine Jeans mit Blümchen bestickt, zog sie selbst herunter und ließ sich aufs Bett plumpsen. Ich schälte sie aus den Beinen und legte die Hose zusammen. Dann zog sie die Unterhose aus, die sie mir stolz präsentierte:
„Meine Lieblingsunterhose. Guck mal, der König der Löwen.“ Ich nickte, obwohl ich dieses Vieh noch nie gesehen hatte, und spornte sie an:
„Jetzt das Nachthemd und dann haben wir’s.“ Doch Sabin weigerte sich und meckerte, dass ihr kalt sei.
„Dann zieh dir was an“, forderte ich sie auf.
„Nö“, sagte sie, stellte sich nackt und mit verschränkten Armen vor der Brust vor mich hin und ließ sich aufs Bett fallen. Immer wieder stand sie auf, ließ sich hinfallen und lachte dabei wild auf. Es schien ihr Spaß zu machen.
Ich stand vor dem Bett und befahl mir, ruhig zu bleiben.
Ziemlich ratlos stemmte ich die Arme in die Seite, drohend, wovon sie sich natürlich nicht beeindrucken ließ. Aber ich muss auch zugeben, dass ich nicht besonders bedrohlich wirkte. Meine schmächtige, fast zarte Gestalt, die feinen blonden halblangen Haare, die abstehenden Ohren und mein blasser Teint strahlten alles andere als Autorität oder Männlichkeit aus. Sabin wusste, dass sie mich an der Nase herumführen konnte und spielte mit mir.
Das Hin und Her ging weiter. Ich versuchte Sabin zu fassen. Sie entzog sich mir, versteckte sich unter der Decke, bis ich sie wieder hervorholte. Es ging endlos so weiter und das Ziel, sie früh ins Bett zu stecken, schien weiter weg denn je. Dann schmiss sie ein Kissen nach mir und lachte dabei. Dieses Lachen. Ich kann es einfach nicht vergessen. Es war kein normales Kinderlachen. Irgendwie hörte es sich stärker und größer an. Ich begriff, dass ihr Lachen mir galt. Sie lachte nicht, weil sie sich freute und Spaß hatte, sondern sie lachte mich aus. Lachte, weil ich hilflos vor ihrem Bett stand und sie einfach nicht in den Griff bekam.
Ich packte sie energisch bei den Schultern und drückte sie nieder, damit ich ihr das Nachthemd über den Kopf ziehen konnte. Dabei strich ich ihr mit den Händen über Rücken und Bauch, als ob ich sie von Fusseln befreien wollte. Sie schaute mich erstaunt an.
„Du hast ja so Hände wie Mama! Papa hat dicke Hände und rau sind sie auch. Aber deine sind ganz zart.“ Zart? Das war mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich betrachtete meine Hände. Ganz normal fand ich sie, wie die Millionen anderer auch.
Ich legte meine Hände wieder auf ihre Haut und streichelte ihren Rücken. Sie blickte mich versonnen an. Eben noch wild und ungehorsam war sie mit einem Mal friedlich, sanft und zahm. Nicht wiederzuerkennen.
Sabin entspannte sich, genoss sichtlich die Berührungen, summte sogar eine kleine Melodie und schnurrte. Ich fühlte ein sanftes Wesen unter meinen Fingerkuppen, ertastete eine starke Persönlichkeit, gleichzeitig auch eine grenzenlose Wut. Steckte das alles in ihr? Verbarg sich das unter ihrer Oberfläche? Warum spürte ich das alles so klar?
Ich erinnerte Sabin an meine eigentliche Mission, indem ich auf das Nachthemd deutete, das ihr halb über dem Kopf hing.
Sie sprang auf und zog das Nachthemd herunter, so dass ihr Körper endlich bedeckt war. Aber meine Hoffnung, sie hätte genug von der Spielerei und würde sich nun schlafen legen, wurde enttäuscht. Sabin versuchte, aus dem Bett zu springen, um die Jagd fortzusetzen. Doch das ließ ich nicht zu.
Ich packte schnell ihre Arme, damit sie nicht entkommen konnte, und stieß sie zurück ins Bett. Sie befreite einen Arm und schlug nach mir, ich fing ihre Hand ab, drückte sie herunter und streifte dabei ihren Bauch. Sie fing an zu lachen.
Diesmal war es ein anderes Lachen. Sie war kitzlig, krümmte sich und versuchte, meine Hand abzuwehren. Aber meine Finger spielten auf ihrer Haut, der rechten Seite ihres Bauches. Offensichtlich hatte ich die richtige Stelle erwischt, denn sie quiekte immer heftiger und lachte immer jaulender. Längst schon hatte es nichts mehr mit einem fröhlichen Lachen zu tun.
Sabin wälzte sich von rechts nach links, griff nach meinen Fingern, die nicht locker lassen wollten und immer pikantere Stellen fanden. Den Übergang, wenn Kitzeln zur Qual wird, erwischte ich perfekt. Ich packte heftiger und fester zu. Schon lange war Sabin der Spaß vergangen und es kamen nur noch erbärmliche Schluchzer über ihre Lippen.
Das Merkwürdige war, dass ich nicht aufhören konnte, sie zu quälen. Mehr noch: Ich genoss ihre Hilflosigkeit. Ich spürte Macht. Durch meine Hände und Finger strömten Stromstöße in Sabins kleinen Körper, die ihn beben ließen, auf und ab, immer intensiver und kräftiger. Sie wandte sich, wollte sich nicht damit abfinden, unter meinen Kitzeleien zu leiden. Später jedoch erstarb ihre Gegenwehr, als sie erkannte, dass sie gegen meine Hände keine Chance hatte. Sie bettelte und jammerte. Aber ich ließ nicht locker, war erst am Anfang. Jetzt begann der Abend auch für mich, spaßig zu werden. Ich roch ihren hastigen Atem, doch ihre Bewegungen ebbten ab. War sie etwa schon erledigt?
In der Tat. Die Kraft war aus ihrem kleinen, schutzlosen Körper gewichen. Tränen rannen aus ihren Augen. Es waren keine Freudentränen, sondern Tränen der Bitterkeit und des Kampfes.
Als ihr Weinen nur noch ein Wimmern war, die Töne immer jämmerlicher klangen vor lauter Erschöpfung, ließ ich von ihr ab.
Der ins Bett gesunkene und unter der Decke verkrochene Körper lag reglos da. Sabin öffnete kurz die Augen. Der Bannstrahl ihres Blickes traf mich, aber sie war zu erschöpft, als dass er hätte Hass ausstrahlen können. Stattdessen war es ein ungläubiger und Mitleid erregender Blick, der Wehrlosigkeit ausdrückte.
Sie zog einen schiefen Mund. Das hatte etwas von beleidigt sein, was mich amüsierte. Sie atmete ruhig und gleichmäßig, bald schon würde sie eingeschlafen sein.
Ich saß noch eine Weile gebannt auf der Bettkante und starrte meine kleine Cousine an.
Sabin und ich.
Hier allein.
Meine mächtigen Hände hatten sie gezähmt. Wir beide hatten ein Geheimnis. Das Gefühl in mir schwankte zwischen Triumph und Trauer. Wie schön war es gewesen, sie zu beherrschen. Aber wie leicht war es auch. Keine wirkliche Herausforderung.
Nach fünf Minuten schlief sie ein. Von Zeit zu Zeit kam ein Seufzer über ihre Lippen, ein Stöhnen aus der Tiefe ihrer Brust. Zweifellos träumte sie das Erlebte noch einmal.
Einen Moment lang dachte ich an meinen Vater, der mich häufig schlug, obwohl es keinen plausiblen Grund dafür gab. An meine Mutter, die mich nie verteidigte. In ihren Augen war ich ein allzu durchschnittliches Kind, ohne jede erkennbare Begabung. Ich hörte die verärgerte, grausame Stimme meines Vaters, das Gegröle eines Besoffenen, der nach mir rief, weil er mich nicht fand in meinen Verstecken, die ich mir ausgedacht hatte.
Ein Nebel legte sich vor meine Augen. Ein kleiner Junge rannte hilflos davon, nirgends ein Ziel, kein Halt, kein Weg.
Meine Augen wanderten zurück zu Sabin. Manchmal zuckte sie im Schlaf, als sei ein böser Feind in ihrem ansonsten schlaffen Körper, der sie piesackte und ihr Schmerzen verursachte. Ich war ihr ganz nah. Ich konnte ihren Atem riechen. Mich umfing ein Gefühl. War es das Gefühl der Fürsorge? Ein sachter Schauer lief über meinen Rücken. Mir war einen Moment danach, in diesen Körper zu kriechen und Sabin von ihren Peinigern zu befreien. Schutz und Geborgenheit hätte ich ihr gegeben, gerne sogar, aber ich ließ sie schlafen. Sie brauchte Ruhe.
Gerade als ich aufgestanden war und sie ein letztes Mal angeblickt hatte, um mich von ihr zu verabschieden, hörte ich ein Auto auf den Hof fahren. Onkel Manfred und Tante Klara.
Hastig lief ich die Treppe hinunter. Ich zupfte meine Klamotten zurecht, legte mich in den Sessel vor den Fernseher, die Beine über der Lehne verschränkt, und tat, als schliefe ich.
Meine Tante kam herein, beugte sich über mich und stieß mich an die Schulter.
„Wir sind wieder da“, sagte sie und ging in die Küche. „Ich kann dir sagen: traumhaft, göttlich. Einfach phänomenal. Ich könnte jeden Abend in die Oper gehen.“
Als sie wieder ins Wohnzimmer kam, hatte sie ein Glas Mineralwasser in der Hand und trank. Dann streifte sie meinen Blick.
„War was?“ Ich schüttelte den Kopf, stand auf, reckte mich und schaute auf die Uhr:
„Ich hab’s ein bisschen eilig“, sagte ich und deutete auf die Haustür. Im Hinausgehen stolperte ich fast über meinen Onkel, er fing mich mit beiden Händen auf und schenkte mir ein Lächeln. „Hoppla, pass auf, wo du hinläufst.“ Er schaute mich an, und ich machte, dass ich schleunigst aus dem Haus kam.
Als ich ins Freie trat, traf mich die kühle Luft der Nacht. Das tat gut, allerdings war mir in diesem Moment die Tragweite des Geschehenen noch nicht annähernd bewusst. Ich konnte nicht ahnen, dass diese Begegnung mit Sabin mich erniedrigen und anspornen, mich hetzen und verurteilen würde. Mein ganzes Leben lang.
Montag, 18. September, 9.45 Uhr
An einem Montagmorgen im schönsten September seit Menschengedenken trat der Frankfurter Kommissar Andreas Rauscher ganz leise in das Büro seines Kollegen, Kommissar Jan Krause, um ihn zu überraschen. Rauscher, 1,80 m groß, Mitte dreißig, mittelschlank, schwarze kurze Haare und frisch rasiert, machte eine prima Figur in seinem dunklen Anzug, den er heute ausnahmsweise trug. Die beiden oberen Knöpfe des weißen Hemdes waren offen.
Frau Winter, die Sekretärin, hatte Rauscher mitgeteilt, dass Krause schon vor gut einer Stunde ins Präsidium gekommen und in seinem Büro verschwunden war.
Aber Krauses Büro war leer.
Rauscher schaute auf die Uhr: 9.45 Uhr. Die Teamsitzung war für 10 Uhr angesetzt. Hektik am Montagmorgen war nicht Krauses Ding, aber wo war er?
Rauscher wollte wieder gehen, als er ein Geräusch hörte. Er hielt inne. Es klang wie Sägen. Kein Sägen auf Holz, eher ein Schnauben oder Schniefen, unrhythmisch und sanft, es kam ihm bekannt vor.
Ja. Eindeutig. Es klang wie ein wohliges, zufriedenes Schnarchen. Hier, irgendwo in Krauses Büro schnarchte jemand!
Rauscher schaute sich um. Das etwa 30 Quadratmeter große Büro war nur mit dem Nötigsten eingerichtet. Ein Schreibtisch, schwarz lackiert, ein runder Tisch und drei Stühle, Computer und Drucker, ein Plakat an der Wand mit den meistgesuchten Terroristen Deutschlands, daneben ein Kalender, der das heutige Datum, „Montag, 18. September“ anzeigte, und ein Aktenschrank, der nicht hoch und nicht breit war, dafür aber tief im Raum stand und zwar direkt rechts neben der Tür.
Rauscher versuchte hinter den Schrank zu schauen. Er sah nichts. Dann senkte er den Blick, weil das Geräusch von unten kam. Lag dort eine Luftmatratze? Da er nicht im Entferntesten an die Existenz einer solchen im Büro des Kollegen Krause glaubte, hielt er das Gesehene für eine optische Täuschung und rieb sich die Augen. Vielleicht sollte er mal zum Augenarzt gehen, dachte er. Mit 35 war er nicht mehr der Jüngste, vielleicht brauchte er eine Brille. Er notierte vor seinem geistigen Auge einen Termin. Sicher ist sicher. Nachdem er die Hände von den Augen genommen hatte, sah er das Unfassbare, ja, tatsächlich: Kollege Krause lag in der Ecke am Boden auf einer Luftmatratze und ließ leise Töne über seine Lippen strömen. Eine Uhr lag in Höhe seines Kopfes.
Rauscher überlegte, ob er Krause selig weiterschlafen lassen sollte, entschied sich jedoch dagegen. Schließlich hatte er ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Außerdem zeigte der Blick auf die Uhr, dass in zehn Minuten das Teammeeting begann. Kommissar Ingo Thaler und die Hospitantin Elke Erb warteten sicher schon.
Rauscher dachte an Elke, seine neue Liebe. Ein Lächeln flog ihm übers Gesicht. Er hatte sich immer eine richtige Beziehung gewünscht und mit Elke schien es nun endlich soweit. Seit drei Monaten waren sie offiziell ein Paar. Schöne Monate. Voller Liebe, Abwechslung und Lust, aber auch Frust, denn der Job hatte ihnen des Öfteren dazwischen gefunkt. Aber nach seiner vierjährigen Affäre mit der verheirateten Lena war er sich diesmal sicher, eine vernünftige Grundlage für eine langjährige Beziehung geschaffen zu haben. Und das allein zählte.
Rauscher schlich an Krause heran. Gerade, als er ihn wecken wollte, klopfte es heftig an der Tür.
Krause schreckte aus dem Schlaf hoch, blickte Rauscher erschrocken an und begriff die Situation nicht. Erneut klopfte es. Dieses Mal lauter.
„Herr Krause, die Post!“ Es war unverkennbar Frau Winters Stimme, ein wenig hektisch, als habe sie keine Sekunde Zeit, um auf Krauses „Herein“ zu warten.
Rauscher beobachtete Krause, der immer noch vor sich hin dämmerte und keinerlei Anstalten machte, sich zu erheben. Also öffnete Rauscher die Tür, entriss der verdutzt dreinschauenden Frau Winter den Stapel Briefe und drückte die Tür vor ihrer Nase wieder zu. Schwungvoll warf er die Post auf den Schreibtisch, wo der Packen auseinander flog. Dann stellte er sich, beide Hände in die Seite gestemmt, vor Krause hin und schaute ihn an.
„Kannst du mir mal erklären, was hier vor sich geht?“
Krause schälte sich behäbig aus dem Schlafsack und fuhr sich durch die verwuschelten Haare:
„Wenn du frisch verliebt wärst, würdest du auch keine Nacht zum Schlafen kommen.“
Daher wehte der Wind, dachte Rauscher, und konnte sich ein hämisches Grinsen nicht verkneifen. Debbie also. Krauses Neue. Im selben Moment dachte er an Elke und daran, dass sie ebenfalls noch nicht allzu lange zusammen, aber trotzdem früh ins Bett und zum Schlafen kamen. Heißt denn frisch verliebt sein automatisch Nächte lang Rumvögeln? Sollte da etwas nicht stimmen in seiner Beziehung mit Elke? Oder wie war Krauses Bemerkung zu deuten?
Während Rauscher diesen Gedanken weiter spann und den Moment der Unsicherheit zu überspielen versuchte, indem er an sein eigentliches Vorhaben dachte, nämlich Krause eine wichtige Mitteilung zu machen, stand dieser auf, drückte sein Kreuz durch, rollte den Schlafsack zusammen und verstaute ihn im Schrank, in dem er ein eigens dafür angelegtes Eckchen reserviert hatte.
„Moin übrigens“, sagte Krause, der jetzt vor dem kleinen Spiegel stand, sich die kurzen braunen Haare zurecht legte, die Brille aufsetzte und seine Klamotten ordnete. Krause – ein großer, hagerer, kantiger Typ – sah mit seinen 36 Jahren ziemlich faltig und mitgenommen aus, doch ein vielsagendes Lächeln glitt über sein Gesicht und seine Gesichtshaut straffte sich.
„Bei euch scheint es ja bestens zu laufen“, sagte Rauscher. Krause war vollends wieder hergestellt und die junge Liebe spiegelte sich strahlend in seinem Gesicht.
„Sieht man, ne?“, lachte er eindeutig unverschämt. „Und wie läuft’s bei euch?“ Rauscher zuckte mit den Schultern: „Ich denke, es ist alles okay.“
Mit einem „Aha“ setzte Krause sich in seinen Sessel hinter dem Schreibtisch.
Rauscher stützte sich mit beiden Händen auf die Tischkante. „Das denke ich tatsächlich, was dagegen?“
„Mein’ ja nur. Ihr seid ja auch erst drei Monate zusammen, oder?“
„Was willst du damit sagen?“
„Gar nix.“
„Falls du denkst, bei uns läuft es nicht, kann ich dich beruhigen. Nur weil ich morgens frisch ins Büro komme, ganz im Gegensatz zu dir, heißt das noch lange nicht, dass wir nachts nicht, ich meine, dass wir …“
„Reg’ dich nicht auf. Das bezweifle ich doch gar nicht.“ Krause gähnte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten.
Wenn es um den Job ging, war Krause normalerweise die Zuverlässigkeit in Person, deshalb machte sich Rauscher etwas Sorgen seit sein Teamkollege mit Debbie, der ehemaligen Praktikantin der Abteilung, zusammen war. Krauses Telefon klingelte.
Thaler war am Apparat und wollte wissen, wo sie blieben. Rauscher entschied, Krause erst nach der Sitzung in die neueste Entwicklung im Fall des Friedhofmörders einzuweihen und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Konferenzraum.
Als die beiden den von der Sonne aufgeheizten Raum betraten, erwartete sie Ingo Thaler bereits. Thaler, ein schlanker Mann mit schwarzen halblangen Haaren, Anfang dreißig, gehörte seit knapp drei Jahren zum Stamm des Teams und wurde von manchem im Präsidium „Mister Recherche“ genannt.
Sie nahmen Platz an dem langen, massiven Holztisch. Krause gähnte, schenkte sich einen Kaffee ein, zählte fünf Stück Zucker ab, ließ sie einzeln hineinplumpsen und rührte langsam und genüsslich um.
„Wo ist Elke?“, wollte Thaler wissen.
„Keine Ahnung“, antwortete Rauscher und zu Krause, „du willst doch diese Plörre nicht etwa trinken?“
„Sicher“, erwiderte Krause, „ich brauche Energie.“
„Wir bräuchten noch Unterstützung für das Prof-Projekt“, sagte Thaler. Fragend schauten sie ihn an.
„Diese Datenbank. Ihr wisst schon, das habe ich euch vor einem halben Jahr schon mal erklärt, mit der man Fälle schneller und effizienter vergleichen kann. Aber nicht nur das: Wir arbeiten daran, dass die Software automatisch Verbrechens-Charakteristika mit Tätern oder besser gesagt mit deren psychopathologischen Profilen vergleicht. Bei Übereinstimmungen dürfte es ein Leichtes sein, potenzielle Täter ausfindig zu machen. Im Idealfall erstellt die Software handhabbare Diagramme und Täteranalysen, bereitet Tathergänge auf, vergleicht Gutachten und Prozessabläufe, um somit einen schnelleren Zugriff zu erzielen.“
„Und für was steht ‚Prof’-Projekt nochmal?“ wollte Krause wissen.
„Prof ist die Abkürzung für Profil. Weil es sich wichtig anhört, hat unser Oberchef“, er deutete mit dem Daumen nach oben, „den Namen abgesegnet. Heute Nachmittag findet die nächste Sitzung statt. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Also wie sieht’s aus?“
In diesem Moment ging die Tür einen Spalt auf und Elke Erb, Hospitantin in Rauschers Team, steckte den Kopf herein:
„Hey, ihr müden Krieger“, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln, „Einsatz. Tötungsdelikt!“
Eins
In den Wochen nach dem Babysitten war mein Leben die Hölle.
Meine kleine Cousine, die lustige Seele, hatte die Vorkommnisse brühwarm und haarklein ihren Eltern erzählt. Die wiederum warteten bei meinen Eltern auf und waren derart empört, dass sich meine Mutter in Grund und Boden schämte, als sei was weiß ich was geschehen.
Die Szene, die mir mein Vater anschließend gemacht hat, ist mir bis heute lebhaft im Gedächtnis. Überall hatte ich blaue, lila und grüne Flecken und ein Veilchen, so hatte er mich verdroschen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!