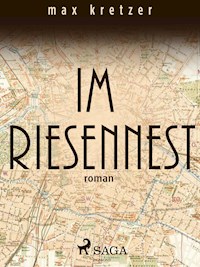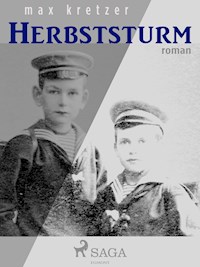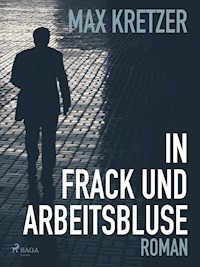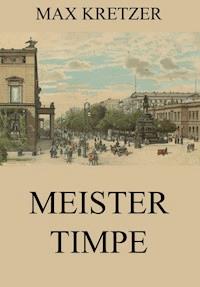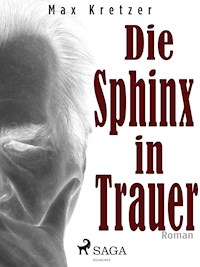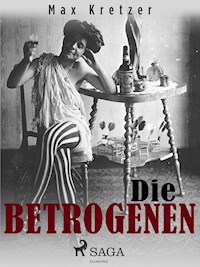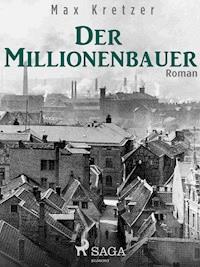
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof Forlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland in der Gründerzeit. Hans Köppke, ehemaliger Bauer, hat vom wirtschaftlichen Aufschwung des Großbürgertums profitiert und sich durch erfolgreiche Bodenspekulation ein Millionenvermögen angeeignet. Ihm gegenüber steht die Familie von Heckenstett – Repräsentanten des gerade durch die neue industrielle Blüte wirtschaftlich heruntergekommen und verarmten Adels, die ihre alten Werte von Ehre und Edelmut nicht aufzugeben gewillt sind, auch wenn sie daraus keinen gesellschaftlichen Profit zu schlagen vermögen. In diesem Beziehungsgeflecht entfaltet sich ein lebendiger Roman über Liebe und Leben, Gewinn und Verlust, materiellen Reichtum und soziale Kälte, der den Leser mehr und mehr in seinen Bann schlägt. In seinem sozial- und gesellschaftskritisch geprägten Roman zeichnet der bedeutende deutsche Autor des Naturalismus ein genauso detailgetreues wie schonungsloses Bild vom deutschen Kaiserreich unter dem Einfluss der Industrialisierung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Der Millionenbauer
Altberliner Roman
Saga
Der Millionenbauer
© 1891 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502686
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I
Als beide ihr Ziel in Wilmersdorf erreicht hatten und langsam den Gang entlangschlenderten, der dem tiefer gelegenen Teile des Gartens zuführte, drangen die letzten Klänge eines Walzers an ihre Ohren; und als die Musik verstummt war, sahen sie in der Entfernung eine Schar hellgekleideter Mädchen vom Tanzplatze aus ins Freie stürmen und den Tischen ihrer Angehörigen zueilen; ihnen folgte eine Anzahl junger Männer, die alle das Bestreben zeigten, in unmittelbarer Nähe ihrer Schönen zu bleiben. Lautes, fröhliches Lachen, das herüberdrang, zeugte für die lustige Stimmung, die dort herrschte. Schließlich kribbelte alles gleich den Ameisen die Treppe hinunter, um sich im Gewühle unter den Bäumen zu verlieren.
„Es scheint ja hier sehr fidel herzugehen“, sagte Heckenstett, indem er seinem Pincenez die richtige Lage gab und einige Augenblicke stehen blieb, um mit seinem dünnen Stöckchen den Staub von dem unteren Teile der Beinkleider zu klopfen. Sie hatten von der Bahnstation aus nicht gleich den richtigen Weg gefunden und waren eine Zeitlang quer über die Felder geschritten. „Verdammt viel Weiber, wie ich sehe“, fügte er in einem etwas schnarrenden Tone hinzu, der ihm noch von seiner Leutnantszeit her anhaftete und den er zeitweilig mit dem Ausdruck leiser Selbstironie anzuschlagen pflegte.
„Wir werden uns amüsieren. Die Donnerstage hier draußen sind berühmt“, gab Hartwig von Rigard in etwas schleppender Sprechweise zur Antwort.
Er war der Kleinere und auf den ersten Blick Unbedeutendere von beiden. Sein Wuchs war zierlich. Das Gesicht, in welchem das keimende rötlich-blonde Schnurrbärtchen sich kaum bemerkbar machte, hatte eine zarte, fast unmännlich zu nennende Färbung, die durch die großen, hellblauen Augen nicht gerade gehoben wurde. Dieses Antlitz, in dem nur weiche Linien zu erblicken waren und das überdies sehr regelmäßige, feine Züge hatte, gab ihm etwas Mädchenhaftes, das durch die leise, kraftlos klingende Sprechweise noch verstärkt wurde. Er säuselte mehr als er sprach, und es gehörte viel Aufmerksamkeit dazu, um jedes seiner Worte zu verstehen. Trotzdem er einen sehr jugendlichen Eindruck machte, zählte er bereits sechsundzwanzig Jahre. Da er das Talent zu einem großen Komponisten in sich entdeckt zu haben glaubte, so studierte er seit einigen Jahren Musik. Eine Folge davon war, daß er stets unhörbare Melodien vor sich hin pfiff.
Eberhard Hugo Freiherr von Heckenstett zeigte sich in der Fülle seiner Kraft als das gerade Gegenteil von ihm. Er war das, was man in gewissen Kreisen mit „schneidige Erscheinung“ zu bezeichnen pflegt. Hoch und schlank gewachsen, von reserviert-abgemessenen Bewegungen und mit vornehmer Eleganz gekleidet, trug er eine überlegene Miene zur Schau, die zuzeiten sehr herausfordernd erscheinen konnte, war er jeden Augenblick bereit, die weißen Zähne unter dem üppigen, kokett gezwirbelten, brünetten Schnurrbart zu zeigen, sobald er von einem hübschen Mädchen dazu ermuntert wurde.
Freiherr von Heckenstett stammte aus einer altadeligen Familie, die aber seit einem halben Jahrhundert bereits nicht besonders mit Glücksgütern gesegnet war. Sein Vater lebte als Major a. D. von seiner Pension und war als alter Haudegen, der drei Feldzüge mit Ehren überstanden hatte, von dem einzigen Wunsche beseelt gewesen, den jüngsten seiner zwei Söhne ebenfalls zu einem tüchtigen Offizier heranreifen zu sehen, nachdem der älteste diese Laufbahn, den Traditionen der Familie getreu, eingeschlagen hatte und jetzt, glücklich verheiratet, als „Premier“ in einer schlesischen Garnisonstadt stand.
Hugo wurde denn auch in die Kadettenanstalt zu Lichterfelde geschickt, erwies sich als ein begabter Mensch und wurde später Leutnant bei einem Ulanenregiment in Pommern. Ein Onkel, der keine Kinder hatte und dessen Liebling er war, gab den nötigen Zuschuß. Dadurch verführt und in Sicherheit gewiegt, gab sich Hugo, der zum Geldausgeben ein merkwürdiges Talent besaß, einem sehr flotten Lebenswandel hin und machte schließlich erhebliche Schulden, die einige Male auch vom Onkel gedeckt wurden. Plötzlich aber hatte diese Freigebigkeit ein Ende, denn der Onkel verlor bei einer unglücklichen Spekulation sein ganzes Vermögen. Die Gläubiger wollten nicht länger warten, es wurde ein Ultimatum gestellt, großer Familienrat gehalten, und als sich kein neuer Onkel fand, taten die Manichäer das, was sie in ähnlichen Fällen stets zu tun pflegen: sie machten Anzeige beim Oberst des Regiments, und Hugo sah sich genötigt, nach dreijähriger Dienstzeit mit schwerem Herzen seinen Abschied zu nehmen.
Nun baronisierte er in des Wortes wirklichster Bedeutung seit zwei Jahren, größtenteils abhängig von den Eltern, zeitweilig unterstützt von seinem Bruder, ohne rechten Beruf, aber in der steten Hoffnung auf einen solchen, seinen Neigungen zusagenden, und ohne zu wissen, was er mit sich selbst anfangen solle. Diese Situation wurde ihm auf die Dauer um so unerträglicher, als seine Lebenslust in einem ewigen Widerspruch mit den Beschränkungen stand, die er sich auferlegen mußte; obendrein wurde er von seinen Gläubigern hart bedrängt, die ihm das Dasein nach Kräften erschwerten. Einige Male hatte er den Versuch gemacht, „der Not gehorchend, nicht demeigenen Triebe“ durch irgendeine regelmäßige Tätigkeit seine Finanzen aufzubessern und die Vergangenheit vergessen zu machen. Da er einen leidlichen Stil schrieb und die nötigen Kenntnisse besaß, so lieferte er eine Zeitlang die Rennberichte für eine große politische Tageszeitung und wurde dann Mitarbeiter einer Fachzeitung für den Pferdesport. Beides dauerte aber nicht lange, weil ihm diese abhängige Tätigkeit auf die Dauer nicht behagte und die Arbeit nicht seine starke Seite war. Das Unglück war, daß seine Mutter, eine geborene Baronesse von Heckenstett-Pfingst, ihn vergötterte und in allen seinen Torheiten bestärkte. Als eine etwas bigotte, weniger beschränkte als adelsstolze Dame lebte sie beständig in der Hoffnung, daß der liebe Gott sich eines Tages der Heckenstetts erinnern und daß auch ihrem Hugo dereinst der wohlverdiente Weizen blühen werde. Und diese Hoffnung ließ sie lieber Entbehrungen um ihres Sohnes willen tragen, ehe sie von ihr abging.
Inzwischen verschönerte Hugo sich das Dasein einigermaßen durch die Wetten, die er regelmäßig auf der Rennbahn zu Charlottenburg gewann. Leider war das Geld mit guten Freunden beiderlei Geschlechtes sehr bald verjubelt, und die kleine Reservekasse der Mutter wurde aufs neue in Anspruch genommen. So führte er das mehr bemitleidenswerte als verdammungswürdige Scheinleben eines Mannes von vornehmer Geburt und Erziehung, der, aus einer glänzenden Karriere herausgerissen, mehr an diese denkt als an die Gegenwart.
Nach wenigen Minuten befanden sich die Freunde inmitten des Publikums. Der herrliche Augusttag hatte die Berliner Kleinbürger in Scharen hierhergelockt. An einzelnen Stellen waren die Tische zusammengesetzt, und so hatten sich lange Familientafeln gebildet, an denen es außerordentlich laut herging. Überall tauchten helle Kleider auf, die dem Ganzen ein feierliches Gepräge gaben. Trotzdem es bereits auf sieben Uhr ging, machten sich noch die großen, weißen Kaffeekannen bemerkbar, die hin und wieder sehr eifrig in Anspruch genommen wurden. Eine derartige Tafel, an der zwanzig Personen saßen und um welche die sorgsame Mutter oder die „Älteste“, mit einer frisch geplätteten Hausschürze angetan, eilfertig mit der Kanne in der Hand herumschritt, um jedermann noch eine „letzte Tasse“ aufzudrängen und die Überreste des Kuchens immer aufs neue anzubieten, machte einen sehr einladenden Eindruck. Die Harmonie wurde nur gestört, wenn die Musik im Saale begann und die Mädchen rücksichtslos aufsprangen, um unter Verzichtleistung auf Kaffee und Kuchen dem Tanzplatze zuzueilen. Sie waren nicht mehr zu halten. Selbst die Drohung, daß „alles alle“ würde, verfehlte ihre Wirkung.
Heckenstett und Rigard gingen gemütlich durch die Reihen und stellten mit stillem Humor ihre Beobachtungen an; der erstere, indem er lebhafte und selbstbewußte Blicke nach allen Seiten sandte und die weiblichen Erscheinungen einer raschen Kritik unterwarf, und der letztere mit der stillen Resignation eines Menschen, der im Schatten einer Sonne wandelt und alle herausfordernden Bemühungen für vergeblich hält. In der Tat konnte sich Heckenstett während des langsamen Vorbeiwandelns an den Tafeln einer hervorragenden Beachtung von seiten der jungen Damen erfreuen. Die Berlinerinnen haben einen außerordentlich scharfen Blick für vornehme Erscheinungen und verstehen wie alle Weiber das Kecke vom Zudringlichen zu unterscheiden. So wandten sie ihm denn ihre Aufmerksamkeit zu, erwiderten sein Lächeln und waren ihm nicht gerade böse, wenn er ihnen nochmals einen zweiten Blick zurücksandte.
Sie durchschritten den ganzen Garten und befanden sich dann an dem Ufer eines kleinen Sees, der das Lokal von dem Dorfe trennte. Es sah hier sehr ländlich aus. Aus dem Grün der gegenüberliegenden Seite ragten der Kirchturm und die roten Dächer der Wohnhäuser hervor, hin und wieder tauchte zwischen den Bäumen und Sträuchern eine Villa auf, die die Nähe von Berlin verriet. Still und schweigend, in tiefgrüner Färbung, lag der Spiegel des Sees da. Es war eine kleine märkische Idylle, der die Eisenbahn von Tag zu Tag immer mehr das städtische Gepräge gab. Die friedliche Ruhe wurde nur von dem Lärm der Gäste im oberen Teil des Gartens unterbrochen. Rechts zeigten sich die Buden der Badeanstalt. Als Heckenstett sie erblickte, fragte er sofort, ob das das berühmte Wilmersdorfer Seebad sei, von dem er bereits so viel gehört habe? Er erinnerte sich dabei, daß eine kleine Putzmacherin ihm scherzhafterweise erzählt hatte, sie pflege jeden Sommer „ins Bad nach Wilmersdorf zu reisen“. Rigard lachte. Dann kam man überein, etwas zu essen.
Sie kehrten wieder um und fanden bald einen Tisch, an dem sie ungeniert sitzen konnten. Rechts hatten sie die dichtbesetzte Terrasse vor Augen, und links konnten sie über den See blicken. Sonst war es leer um sie herum; nur zwei Tische weiter saß ein einzelner Herr, auf den sie erst nach einiger Zeit aufmerksam wurden. Ein Kellner eilte sofort herbei und machte die nötigen Armverrenkungen, indem er mit der Serviette über die Tischplatte fuhr, was er nur bei ausgezeichneten Gästen zu tun pflegte.
„Der Herr Baron befehlen?“ wandte er sich dann an Heckenstett, während er einen Schritt zurücktrat und zu gleicher Zeit die Speisekarte aus der Tasche zog und sie auf den Tisch breitete. Und da Heckenstett etwas verwundert aufblickte, fuhr er sogleich mit einem süßlichen Lächeln fort, das den Mittelpunkt zwischen Zurückhaltung und Zuvorkommenheit bildete: „Der Herr Baron werden sich meiner vielleicht noch erinnern ... Ich hatte im vorigen Jahre öfters die Ehre, dem Herrn Baron zu servieren – in den ‚Drei Raben‘ Unter den Linden ...“
Heckenstett knipste sein Pincenez ab und sagte dann etwas herablassend: „Ach so! Wie kommen Sie denn hierher?“
„Schicksalstücke, Herr Baron, Schicksalstücke! Man muß den Sommer mitnehmen. Aber ich werde hier nicht alt werden.“ Er warf einen verachtungsvollen Blick auf die Kaffeegesellschaft und beeilte sich dann, einzelne Speisen ganz besonders hervorzuheben und die Bestellungen zu notieren.
„Aber etwas plötzlich, wenn ich bitten darf“, schnarrte ihm Heckenstett diesmal sehr eindringlich entgegen.
„Wie der Wind, Herr Baron.“ Damit wollte er sich mit wehendem Tuche entfernen, wurde aber von einer anderen Seite wieder aufgehalten.
„Sie, Fritz, was is denn det für ’ne Sache!“ ertönte eine laute Stimme ganz in der Nähe. „Werden Sie mal bleiben! Ich sitze doch hier lange jenug, um in die Augen zu fallen. Gewöhnlich werden immer die Jäste zuerst bedient, die zuerst kommen ... Lassen Sie mal die Karte hier. Und dann bringen Sie mir ’ne halbe Rotspon und ’ne Selter. Aber etwas im Drapp.“
Fritz blieb stehen und warf lächelnd einen bezeichnenden Blick auf die beiden Freunde, trat auf den Nebentisch zu und bat für das Versehen höflich um Entschuldigung. Augenscheinlich war ihm der Herr bereits bekannt. Heckenstett und Rigard machten gleichzeitig eine halbe Wendung, um sich den Unzufriedenen anzusehen.
Breit und protzig, die Hände auf den Stock gestützt, saß er da und blickte mit unverkennbarer Genugtuung zu ihnen hinüber. Es lag mehr Trotz als Zorn in dem glattrasierten, gebräunten Gesicht, das scharf geschnitten wie das eines Mimen war. Um die tief eingegrabenen Mundwinkel machte sich sogar ein gutmütiger Zug bemerkbar, als er jetzt an die schmale Krempe des hohen braunen Strohhutes griff, denselben ein wenig lüftete und freundlich grüßte. „Bitte um Entschuldigung für die Störung“, sagte er weniger laut als vorhin. „Aber mein Geld ist ooch nicht von Pappe, und zum Bedienen sind die Kerls da ... Viel warm heute“, fügte er nach einer Pause hinzu, indem er den Hut völlig abnahm und mit der rechten flachen Hand über den kahlen Schädel fuhr, an dessen Seiten sich noch üppiges, aber bereits stark ergrautes Haar zeigte. Er schien sehr geneigt, ein längeres Gespräch anzufangen. Als er aber bemerkte, daß die beiden nicht die geringste Lust dazu zeigten, stülpte er den Hut wieder auf den Kopf, zog ein goldenes Pincenez hervor, setzte es langsam und bedächtig auf die Nase und begann nun mit ernster Miene die Speisekarte zu studieren, indem er das Papier weit von sich hielt und den Kopf seitwärts hin und her bewegte.
„Ein zudringlicher Kerl“, bemerkte Heckenstett, während er etwas unruhig mit den Fingern auf die Platte trommelte. „Es fehlte nur noch, daß er sich an unseren Tisch setzt.“
Der Kellner kam mit dem Biere zurück und deckte die Tafel. Trotzdem das Auflegen eines Tischtuches hier nicht Mode war, glaubte er doch diesen Herren gegenüber eine Ausnahme machen zu müssen. Dann wandte er sich mit dem Weine dem andern Tische zu.
„Gänsebraten und Gurkensalat“, sagte der Nachbar kurz und bat sich sehr energisch statt der Papierserviette eine andere aus. Es gab eine kleine Auseinandersetzung, begleitet von nicht mißzuverstehenden Blicken auf die bevorzugteren Gäste. Er war nahe daran, grob zu werden, als ein Kollege des Kellners auf diesen zutrat und ihm etwas zuflüsterte.
Heckenstett machte schon den Vorschlag, andere Plätze aufzusuchen, als Fritz ihnen zuflüsterte, sie möchten das Benehmen des Gastes nur entschuldigen. Es sei ein Bauer aus Schöneberg und hier sehr angesehen, was er, Fritz, allerdings nicht wissen könne, da er ihn erst zweimal bedient habe.
Man beschloß nun, gar keine Notiz weiter von ihm zu nehmen und nach dem Essen diesem gefährlichen Menschen aus dem Wege zu gehen. Als die Speisen für die drei fast gleichzeitig kamen, war der Friede hergestellt. Rigard bestellte Kognak und taute nun nach seiner Gewohnheit auf. Kognak mußte stets dabei sein, wenn er sich amüsieren wollte. Er wurde nun sehr gesprächig, machte nach der zweiten Lage bereits auf jedes vorüberwandelnde Mädchen aufmerksam und erging sich dabei in überschwenglichen Superlativen, die man ihm vorher nicht zugetraut haben würde. Er schwärmte besonders für Blondinen mit zierlichen Taillen, schlanken Hälsen, roten Wangen und dunklen Augenbrauen – eine Mischung, die Heckenstett für vollkommen genügend erklärte, um auch andere zu diesem Geschmacke zu bekehren.
„Siehst du – das wäre so etwas!“ rief der Kleine plötzlich aus und machte eine Bewegung nach rechts. Den Gang entlang kamen drei Mädchen, die bei ihnen vorüber mußten. Zwei von ihnen schienen Schwestern zu sein, denn sie sahen sich sehr ähnlich und trugen die gleichen gestreiften Modekleider. Sie waren nicht gerade häßlich, aber hatten wenig Interessantes an sich. Groß und lang aufgeschossen, zeichneten sie sich durch den Mangel jeglicher Haltung aus. Um so vorteilhafter machte sich die Mittlere bemerkbar. Es war diejenige, die Rigard gemeint hatte. Sie glänzte wie ein leuchtendes, tadellos weißes Juwel in einer etwas schlecht entworfenen, blau-roten Umrahmung. Alles an ihr war frisch und jung. Unter dem enganschließenden, einfachen, durchsichtig-weißen Kleide glaubte man die nach Entfesselung ringende Lebenskraft pulsieren zu sehen. Sie ragte nicht weit über die Mittelgröße hinaus, war aber außerordentlich ebenmäßig gebaut. Während sie mit ihrem Taschentuche dem vom Tanz noch geröteten Gesicht Luft zufächelte, naschte sie wohlgefällig von einer Tafel Schokolade.
„Nun, schmeckt’s?“ rief Heckenstett ihr freundlich zu.
„O ja, ich danke! Ihnen doch auch?“ gab sie ohne jede Ziererei zur Antwort.
Damit gingen alle drei vorüber. An der nächsten Biegung des Weges aber sahen sie sich noch einmal um. Als Heckenstett von demselben Drange geleitet wurde, fing er von der Mittleren noch ein Lächeln auf, das sie ihm zurücksandte.
Der Nachbar am Nebentisch, der seit einiger Zeit sehr eindringlich einen Knochen mit den Zähnen bearbeitete, wischte sich nun behaglich den Mund mit der Serviette, trank das letzte Glas Wein mit einem Zuge aus, blinzelte ihnen sehr keck und verständnisvoll zu und sagte: „Das glaube ich, da steckt Rasse drin.“ Dann holte er ein großes Portemonnaie hervor und klopfte laut und eindringlich nach dem Kellner.
„Er ist nicht totzukriegen, aber er scheint trotz alledem ein gemütliches Haus zu sein“, bemerkte Rigard, dem die ganze Situation nun äußerst spaßig zu werden begann. In einer gewissen Stimmung bekam er demokratische Anwandlungen, in denen er alle Menschen rosig fand. Heckenstett war nahe daran, dieses ewige Hineinmischen in fremde Dinge ganz unzweideutig für unverschämt zu erklären, aber der Kellner war bereits erschienen. Der Nachbar klapperte einige Augenblicke etwas auffallend mit den harten Talern, bezahlte und erhob sich dann. Bevor er ging, wandte er sich noch einmal zurück und grüßte so ausnehmend höflich, daß die beiden Freunde sich genötigt sahen, ihm zu danken. Während er schwerfällig auf den Stock gestützt von dannen schritt, machte er in dem langen grauen, weißpunktierten Zwirnrock, über dessen Kragen ein Teil der schwarzen Halsbinde hervorragte, allerdings einen etwas bäuerischen Eindruck.
Fritz, der augenscheinlich nicht ganz befriedigt von dem Trinkgelde schien, gab ihnen unaufgefordert einige Auskünfte, die er inzwischen eingeholt hatte. „Dem sieht man den schweren Jungen nicht an“, erlaubte er sich in etwas kordialem Tone zu sagen. „Erst vorgestern soll er Land für anderthalb Millionen Mark verkauft haben. Ein ganzes Terrain – da unten an der Berliner Grenze. So ein Stück Brachfeld, von dem eigentlich niemand wußte, wem es gehörte. Eine Aktiengesellschaft hat es erworben. Zwei Millionen soll er bereits gehabt haben ...“
„Was? Teufel!“ unterbrach ihn Heckenstett, indem er unwillkürlich den Blick nach rechts richtete, als wollte er nach diesen Enthüllungen des Davongegangenen noch einmal ansichtig werden.
„Hat er Töchter?“ fiel Rigard ein, der diese Frage jedesmal stellte, sooft er von reichen Männern sprechen hörte.
Fritz bedauerte, darauf augenblicklich keine Antwort geben zu können, versprach aber sofort nähere Erkundigungen einzuziehen, falls die Herren es wünschten.
„Ach ja – eine reiche Heirat wäre noch das einzige“, sagte Heckenstett mit einem Seufzer, als sie wieder allein waren. Er war plötzlich sehr ernst geworden. Sein Blick befand sich noch immer in derselben Richtung. „Aber die Schwiegereltern! Wenn diese Sorte von Schwiegereltern nicht wäre!“ fügte er dann hinzu und trank den Rest aus seinem Glase, um diesen üblen Gedanken zu ersticken.
„Heiraten wir also morgen und amüsieren wir uns heute noch einmal gründlich“, sagte Rigard lustig. „Fragen wir einmal erst die Kleine im Saale, wieviel sie mitbekommt.“
Beide lachten, berichtigten die Zeche und erhoben sich ebenfalls. Als sie die Stufen zum Tanzplatze emporstiegen, hatte die Musik gerade wieder begonnen. Mittlerweile war die Zeit herangerückt, wo die Bräutigams, Väter und Söhne erschienen waren, die das Geschäft noch in Berlin zurückgehalten hatte. Und so war denn der Saal und die Veranda, nach welcher die großen Fenster führten, überfüllt von Tanzenden und Neugierigen, die sich drängten und stießen. Im Saale selbst herrschte eine drückende Schwüle. Trotzdem wirbelten die Paare alsbald so dicht im Kreise, daß sie fast gegeneinanderprallten. Die Kreuzpolka setzte alle Füße in Bewegung, und nach dem Takte der Musik summten einige die Melodie:
„Siehst du wohl, da kimmt er,
Große Schritte nimmt er,
Siehst du wohl, da ist er schon,
Unser schöner Schwiegersohn.“
Dieser Gassenhauer grassierte augenblicklich so stark, daß er fast zur Plage geworden war. Trotz seiner Banalität prickelte er förmlich auf die Nerven, so daß schließlich die Stimmen immer lauter wurden. Man glaubte, einen tanzenden Gesangverein vor sich zu haben. Als Heckenstett und Rigard sich durch das Gewühl Bahn brachen, erblickten sie plötzlich die Schöne im weißen Kleide wieder, die mit ihren Begleiterinnen unter den Zuschauern stand. Heckenstett, der in eine animierte Stimmung geraten war und den Abend nicht als einen verlorenen betrachten wollte, besann sich nicht lange. Er forderte das Mädchen auf und drehte sich bald darauf mit ihr im Kreise, um dieses Heroismus willen im stillen bewundert von Rigard, der Stock und Hut des Freundes hielt und sich nun Mühe gab, mit den beiden blau und rot Gestreiften ein Gespräch über die Hitze im Saale zu beginnen. Als dasselbe sehr eintönig blieb, legte er Hüte und Stock auf einen Tisch in der Nähe und suchte sich zuerst die seiner Ansicht nach schönere von beiden aus, mit der er sich tapfer in das Gewühl stürzte. Trotzdem sie ihn beinahe um Kopfeslänge überragte, ging es doch ganz gut. Nachdem er sich einigemal im Kreise gedreht hatte, forderte er aus Höflichkeit auch die andere auf, wofür er mit einem überaus glücklichen Lächeln beehrt wurde.
Bereits während der Pause, die nach dem zweiten Tanze folgte, war man vertraut geworden. Die Schwestern waren ohne allen Anhang und in Gesellschaft der Mutter der Kleinen erschienen. Die würdige Dame, die Witwe eines Subalternbeamten, saß mit einer befreundeten Familie draußen im Garten, um ihren Neffen zu erwarten.
Alle fünf standen beisammen. Heckenstett hätte gern gesehen, daß man in einem hinter dem Saale liegenden Zimmer, das völlig unbesetzt war, einen Tisch ausgesucht hätte, um eine Weile bei einem Glase Bier ganz unter sich zu sein; aber die Kleine, die seine Galanterien mit Wohlgefallen entgegengenommen hatte und merkwürdig zutraulich geworden war, sträubte sich dagegen. Sie berief sich auf ihre Mutter und wies auf ihre Freundinnen hin, die etwas neidisch seien und sofort plaudern würden. Endlich wollte sie schon nachgeben, als ein langaufgeschossener junger Mann, dessen blutrote Krawatte unangenehm ins Auge fiel, in den Saal gestürzt kam und auf sie zueilte. Es war der längst erwartete Cousin, der soeben eingetroffen war. Er war Kommis in einem Manufakturwarengeschäft und hatte sich so sehr in seine Cousine verliebt, daß er sie auf Schritt und Tritt verfolgte, sobald er sich in ihrer Gesellschaft befand. Trotzdem machte sie sich gar nichts aus ihm, pflegte ihn vielmehr stets „links liegen“ zu lassen, wie sie Heckenstett während des Tanzes bereits erzählt hatte.
Als er die fremden Herren erblickte, schien er eine eifersüchtige Anwandlung zu bekommen, denn sofort brauste er hervor, ohne zuvor gegrüßt zu haben: „Deine Mutter sucht dich überall. Ist das eine Manier, dich allein so lange hier im Tanzsaale herumzudrücken?“
„Wenn meine Mutter es wünscht, so werde ich kommen. Du hast mir aber gar nichts zu sagen, und ich verbitte mir ein für allemal jegliche Belästigung.“
Er stürzte wütend davon; die Mädchen folgten ihm aber schließlich. Die Kleine drehte sich noch einmal um, bat wegen der „Ungezogenheit dieses Menschen“ um Entschuldigung und raunte beiden ein „Auf Wiedersehen“ zu.
„So trinken wir einen Kognak auf diesen Schreck“, sagte Rigard. Heckenstett, der etwas ärgerlich geworden war, stimmte zu. „Ich sehe schon, daß wir uns heute bezechen werden. Zum Glück kennt uns niemand“, sagte er, während sie dem Büfett auf der andern Seite des Saales, wo nicht getanzt wurde, zuschritten. Plötzlich fiel ihm etwas ein. „Wo mag denn nur unser Millionenbauer stecken?“ sagte er, fügte aber sofort hinzu: „Wahrhaftig, da sitzt er wieder und mustert uns mit seiner unverschämten Miene. Jetzt raucht er sogar dabei.“
II
Er saß in der Tat ganz allein an einem Tische, hatte ein Bein über das andere geschlagen, stieß fortwährend große Rauchwolken von sich und unterhielt sich mit der Dame hinter dem Büfett, die im Augenblick gerade sehr laut lachte. Vor ihm auf dem Tische standen wieder eine halbe Flasche Rotwein und eine Selter. Als er die beiden Freunde erblickte, glitt ein stillvergnügtes Lächeln über seine Lippen, und Heckenstett glaubte abermals jenes Augenzwinkern zu bemerken, das er draußen bereits als eine zudringliche Belästigung empfunden hatte. Er hatte die Empfindung, als wollte dieser Protz sagen: Na, da seid ihr ja wieder.
Beide ließen sich auf Heckenstetts Wunsch ausnahmsweise zwei Chartreuse geben und wollten sich wieder entfernen, als der Alte sich erhob, auf sie zutrat, den Hut lüftete und sie bat, an seinem Tische Platz zu nehmen. Sie waren so erstaunt, daß sie ihn zuerst verwundert anblickten. Heckenstett fragte etwas ironisch, wie sie zu der Ehre kämen. Der Alte aber ließ nicht nach und erwiderte, daß sie das sofort erfahren würden. Er zeigte sich plötzlich von großer, natürlicher Liebenswürdigkeit und rückte ihnen bereitwilligst zwei Stühle hin, so daß sie kaum zu widerstehen vermochten. Die Dame hinter dem Büfett lachte dazu, und so gewann die ganze Situation für sie einen gewissen humoristischen Anstrich, als sie wirklich Platz nahmen. Zum mindesten konnte die Sache sehr interessant werden.
„Köppke aus Schöneberg“, sagte er, indem er sich wieder halb erhob und den Hut lüftete. Heckenstett und Rigard fühlten sich dadurch ebenfalls veranlaßt, ihre Namen ohne jeden Zusatz zu nennen; selbst das „von“ wurde weggelassen.
In diesem „Köppke aus Schöneberg“ lag alles. Es war mit einer gewissen Feierlichkeit und Herablassung ausgesprochen, begleitet von der ruhigen Miene eines Mannes, der von vornherein erwartet, daß man die Bedeutung dieses Namens zu würdigen verstehen werde. „Goethe aus Weimar“ hätte nicht großartiger und überzeugender klingen können.
„Fräulein, drei Konjäkker, aber von meiner Sorte!“ rief er der Dame hinter dem Büfett zu.
Heckenstett wollte protestieren, aber Rigard stieß ihn unter dem Tische mit dem Knie an. Und da die Büfettdame bereits eingeschenkt und Köppke das Tablett hinübergereicht hatte, so zeigte er schließlich eine gute Miene. Seine Neugierde war stark gereizt worden.
„Nun, so wollen wir uns wieder vertragen. Ich wußte es ja gleich, daß wir noch zusammenkommen würden.“
Sie tranken, und Heckenstett bestellte sofort noch drei neue. „Aber wir wissen immer noch nicht, mein Herr, wie wir zu dieser Ehre kommen“, sagte er dann etwas spöttisch, da er das unbehagliche Gefühl, sich in einer seinem Geschmack wenig angepaßten Gesellschaft zu befinden, nicht loswerden konnte.
Köppke erklärte die Sache für sehr einfach. Sie sollten nicht glauben, daß sie es mit einem „Knoten“ zu tun gehabt hätten, als er sich draußen unberufenerweise in ihr Gespräch gemischt habe. Beide hätten ihm von Anfang an sehr gut gefallen, und wenn er sich amüsieren wolle, dann müßten immer junge Leute dabei sein, denn die alten fielen bald ab. Und da heute der letzte Tag seiner Strohwitwerschaft sei, so habe er sich vorgenommen, noch einmal gründlich den „wilden Mann“ zu machen. Hoffentlich würden sie heute noch dazu kommen, verschiedenen „Pullen die Köpfe zu brechen“. Sein Wagen halte draußen. Wenn’s den jungen Herren passe, dann machten sie alle drei noch eine Spritztour nach Berlin. Da kenne er ein paar gemütliche Kneipen, in denen man ganz ungeniert sei.
Bei den letzten Worten schnalzte er mit der Zunge, sprach gedämpft und sah sich nach der Büfettdame um, der er nicht recht zu trauen schien. Alles das brachte er ganz offenherzig hervor, dabei mit einer sehr gleichgültigen Miene, als verstände sich das von selbst und als gehörten derartige Dinge zu seinen Lebensgewohnheiten, die man mit ihm teilen müsse. Aus allen seinen Bewegungen, aus seiner Redeweise, in welcher das unverfälschte niedere Berlinertum immer mehr zur Geltung kam, sprach der ungebildete Mann, der zu vielem Gelde gekommen war und die halbe Welt in der Westentasche zu haben glaubte. Dieses Protzentum wurde nur gemildert durch die natürliche Komik und den angeborenen Mutterwitz, mit denen er die Lachmuskeln reizte und Sympathie erweckte.
„Der wärmt den Magen und stärkt die Glieder“, sagte er, als sie den zweiten Kognak hinuntergegossen hatten. Er war sehr rot geworden im Gesicht – ein Zeichen, daß ihm die Getränke nach dem Kopfe gestiegen waren. Auch Heckenstett und Rigard fühlten, daß es ihnen hinter der Stirn sehr heiß wurde und daß sie allmählich in jene Stimmung gerieten, in welcher der Mensch zu den tollsten Dingen aufgelegt ist.
Es dauerte nicht lange, so saßen sie gegen ihren Willen fest. Diese Ecke hier war so gemütlich, Köppke entwickelte so viele originelle Seiten, übte außerdem durch den Gedanken an seine Millionen einen stets neuen Reiz aus, daß sie die Musik im Hintergrunde überhörten und den eigentlichen Zweck dieses Abends ganz vergaßen. Sie hatten bald erfahren, daß Frau Köppke nebst ihren beiden Töchtern sich in Heringsdorf befinden und am folgenden Abend wieder zurückerwartet werden.
Bei der Erwähnung der Töchter konnte Rigard sich nicht enthalten, dem Freunde unter dem Tische ein verständnisvolles Zeichen zu geben; und es war hauptsächlich seiner indiskreten, aber durch die Stimmung zu entschuldigenden Frage zu verdanken, daß Köppke nun etwas prahlerisch die Vorzüge der beiden Mädchen zu rühmen begann. Die jüngste, Anna, zähle neunzehn, komme aber etwas nach der Mutter, denn sie gehe sehr in die Breite, sei jedoch sonst ein sehr kluges, gebildetes Mädchen. Die älteste, Marie, sei allerdings schon vierundzwanzig Jahre, aber schlank wie eine Tanne und spiele prächtig Klavier. Beide seien aber ganz gesund und hätten sogar ein Pensionat besucht. Das Klavier und das Pensionat spielten überhaupt mehrfach eine Rolle in diesem Bericht.
„Sie möchten wohl so einen Goldfisch haben, was?“ fragte er plötzlich Rigard, indem er das linke Auge zusammenkniff und ihn schlauüberlegen anblickte. „Aber Sie sind etwas klein geraten. Die Mädels wollen große Männer haben. So wie Ihr Freund ungefähr ... Übrigens hat die Olle den Ausschlag zu jeben. Ich bin bloß immer da, wenn’s an ’nen Jeldsack jeht.“
Es war kein Zweifel mehr: er war auf dem besten Wege, berauscht zu werden. Bereits mehrmals hatte er einen Versuch gemacht, den Freunden eine Flasche Wein aufzudrängen, wovon ihn dieselben nur mit Gewalt zurückzuhalten vermochten. Das wäre ja noch schöner, dachte Heckenstett bei sich, in diesem Tanzsaale Wein zu trinken! Trotzdem auch er anfing, benebelt zu werden, behielt er doch seine Geistesgegenwart. Überdies hätte er sich nicht einmal zu revanchieren vermocht, denn in seinem Portemonnaie befand sich eine bedenkliche Leere. Selbst Rigard vermochte ihn heute nicht herauszureißen. Köppke konnte diese Enthaltsamkeit auch dann noch nicht begreifen, als er in seiner zudringlichen Weise wiederholt betont hatte, daß er alles bezahlen würde. „Es ist jenug da, Kinder“, sagte er und klopfte auf seine Brusttasche. Als er sich vergeblich bemüht hatte, wollte er aufs neue Kognak bestellen. Aber auch Rigard, der mit der Zeit ein sehr verständliches Organ bekommen hatte, behagte diese Art der Zecherei nicht mehr.
Plötzlich kam Fritz die Treppe herauf, die von dem unteren Büfett nach hier führte; er hatte irgend etwas Geschäftliches bei dem Fräulein zu erledigen. Als er die drei so friedlich beisammen erblickte, lächelte er etwas malitiös, trat dann aber ehrerbietig näher und erlaubte sich die Frage, wie der Herr Baron sich amüsiere. Das „Herr Baron“ war mit einem Seitenblick auf die Mamsell absichtlich sehr laut gesagt, als fiele schon durch diese bloße Anrede ein Abglanz der Titulatur auf ihn zurück. Köppke blickte überrascht auf, sagte aber nichts. Und als Heckenstett dem Kellner gestattete, zur Belohnung für die Nachfrage ein Glas Bier auf seine Rechnung zu trinken, und dieser mit einem doppeltuntertänigen: „Der Herr Baron sind sehr gütig“ und mit einer Verbeugung bescheiden zurücktrat, um sich den Genuß sofort zu gestatten, griff Köppke zu seinem Pincenez, um es mit derselben Bedächtigkeit wie draußen der Nase zuzuführen. Es war ein merkwürdiger Blick, den er jetzt auf Heckenstett warf: zusammengesetzt aus Staunen und Zweifel, wie bei einem Menschen, der seiner Sache noch nicht ganz sicher ist.
Währenddessen war Rigard verschwunden. Er hatte die drei Mädchen an der Saaltür entdeckt und war ihnen gefolgt. Als zehn Minuten vergingen, ohne daß er zurückkehrte, berichtigte Heckenstett seine Zeche, bat auf einige Augenblicke um Entschuldigung und ging ebenfalls hinaus. Die Schöne im weißen Kleide war ihm wieder eingefallen. Eine Ahnung sagte ihm, daß er sie nicht weit von Rigard finden werde. Er hatte sich auch nicht getäuscht. Rigard bummelte gemütlich mit allen dreien am Ufer des Sees entlang, und zwar an einer Stelle, wo die wenigsten Menschen zu finden waren. Hinter ihnen, in einer gewissen Entfernung, machte sich eine dunkle Gestalt bemerkbar, die wie die verkörperte Drohung jeden ihrer Schritte überwachte.
„Ach, da ist Ihr Freund!“
Die Weiße rief es, und, wie es schien, mit dem Ausdrucke tiefer Befriedigung, als Heckenstett sich zu ihnen gesellte und dem Freunde einen wohlgemeinten „Verräter“ entgegenwarf. Rigard spielte eine Weile den Ärgerlichen, denn er war auf dem besten Wege gewesen, durch den ganzen Zauber seiner Beredsamkeit die Blondine an sich zu fesseln. Da er eine poetische Ader besaß, so war es ihm nicht schwergefallen, das Stimmungsbild, das der See und der Kirchturm boten, die im Mondeslicht glänzten, in die Unterhaltung einzuflechten. Als er aber bemerkte, daß das weiße Kleid neben Heckenstett zurückblieb, ergab er sich in sein Schicksal und wandelte eine Zeitlang schweigend neben den blau und rot Gestreiften. Selbst die Kognakstimmung vermochte ihn nach dieser Enttäuschung auf keinen vernünftigen Gedanken zu bringen. Der Schatten im Hintergrunde aber bewegte sich plötzlich mit bedenklicher Schnelle dem erleuchteten Teile des Gartens zu, und zwar gerade in dem Augenblick, als Heckenstett den Versuch machte, den Arm um die Taille seiner Begleiterin zu legen.
Sie schritten den Feldweg entlang, der zum Ausgange nach der Seite des Dorfes führte. Ein einziges Pärchen kam ihnen entgegen, das das gleiche Bestreben zeigte, so ungestört als möglich zu sein. Sonst Stille ringsumher. Über ihnen der durchsichtige Himmel, zwischen den Bäumen die funkelnden Lichter und die ganze Landschaft in blaue Luft getaucht.
Als sie endlich umkehren mußten, blieben Heckenstett und die Kleine zurück. Rigard schien sich wieder getröstet zu haben, denn die Schwestern lachten. Trotzdem konnte er sich nicht entschließen, die Hände vom Rücken zu nehmen.
Heckenstett flüsterte sehr eindringlich zärtliche Dinge. Er hatte dasselbe bereits hundert anderen gesagt, aber er wußte, daß er immer etwas damit erreicht hatte. Die Kleine antwortete nicht, aber ihr Gesicht glühte, und ihre Gestalt zitterte unter seinem Händedruck.
„O du himmelblauer See,
kennst nicht mein Herzeleid,
stillst nicht mein Weh“,
sangen helle Mädchenstimmen auf der Dorfstraße.
„Einen Kuß nur, damit ich diese Nacht von Ihnen träumen kann“, bat er mit weicher Stimme. Ehe sie es hindern konnte, hatte er sich niedergebeugt, drückte er seinen Mund auf ihre schweigenden Lippen, von denen das heiße Feuer der Jugend ihm entgegenströmte. Und zum zweiten und dritten Male berauschte er sich an ihrer Willenlosigkeit, sah er ihre geschlossenen Augen, genoß er, trunken vor Entzücken, die Seligkeit dieser Minute in lauer Sommernacht. Dann war der Zauber vorüber.
„Dora, wo steckt ihr denn?! Wir müssen gehen!“ schallte eine weibliche Stimme aus der Entfernung herüber.
Breit und fest hatte sich die Mutter in den Weg gepflanzt und erwartete ihre Schützlinge. Neben ihr machte sich der dünne Schatten von vorhin bemerkbar, der sehr eifrige Armbewegungen anstellte.
„Also morgen abend?“
„Ja, morgen. Gute Nacht!“ gab sie flüsternd zurück, ohne ihn anblicken zu können. Dann begann das weiße Kleid zu flattern. Aber noch von weitem leuchtete und bewegte es sich einige Male wie ein grüßendes Abschiedszeichen. Und auch die blau und rot Gestreiften rauschten über den Sand dahin, aber nicht so lustig wie das weiße, sondern schwerfällig und steif, als grämten sie sich über die trübe Stimmung ihrer Trägerinnen.
Die Freunde beeilten sich nicht gerade, als sie ihnen folgten.
„Nun?“ fragte Heckenstett, als Rigard kein Wort hervorbrachte.
„Es sind Gänse“, gab der Kleine resigniert zurück.
„Und du, lieber Junge, bist ein Narr. Wenn man langweilig wie ein Meilenstein neben derartigen Mädchen einherläuft, dann darf man sich auch nicht über die Folgen beklagen.“
Vor dem Saale wurden sie bereits von Köppke erwartet, der durchaus darauf versessen zu sein schien, sie heute nicht mehr loszulassen. Er hatte inzwischen die Gelegenheit benutzt, um bei Fritz Erkundigungen einzuziehen. Er wollte durchaus wissen, ob Heckenstett ein „richtiger“ sei. Damit hatte er den „Baron“ gemeint. In dieser Beziehung war er äußerst mißtrauisch und ließ sich nicht gern aufziehen. Fritz, der ein Markstück in der Hand fühlte, hatte sich denn auch beeilt, das freiherrliche Geschlecht der Heckenstetts für ein uraltes zu erklären und sogar eine entfernte Verwandtschaft mit einem regierenden Fürsten hinzuzulügen, dessen Name ihm aber „im Augenblick“ entfallen sei.
Da er im besten Zuge war und diesem „Bauern“ einmal beweisen wollte, mit was für Leuten er sonst zu verkehren pflege, so ließ er noch etwas von einem „schneidigen Kavallerieoffizier“ fallen, der auf allen Rennplätzen zu Hause sei, und mit dem an einem Tische zusammenzusitzen man als eine Auszeichnung betrachten müsse. Alles das schien Köppke sehr zufriedenzustellen; denn zum Schluß überreichte er dem Kellner noch eine Zigarre mit dem Bemerken, daß er dieselbe mit Verstand rauchen möge. Der schlagfertige Fritz wollte sie nach dieser Erklärung dem Wohltäter wieder zur Verfügung stellen, besann sich aber noch rechtzeitig und fügte nur hinzu, daß der Papa des Herrn Baron, den zu bedienen er auch bereits die Ehre gehabt habe, Ritter mehrerer Orden sei.
„So, Herr Baron, nun können wir losfahren.“
Heckenstett und Rigard achteten gar nicht auf diese Worte. Sie hatten die Absicht, den nächsten Zug zu benutzen und in Berlin noch irgendwo einzukehren. Der Aufbruch schien überhaupt allgemein zu sein, denn an allen Familientischen rüstete man sich.
Am Ausgange wollten sie sich von Köppke verabschieden, aber erhielt sie zurück und fragte ganz verwundert, was sie denn wollten? Er denke, die Sache sei abgemacht. Und zum zweiten Male sprach er vom „Losfahren“. Bisher hatten sie alles für Scherz gehalten, mußten nun aber zu der Überzeugung kommen, daß es ihm mit der „Spritztour“ wirklich Ernst gewesen war. Denn tatsächlich hielt nicht weit vom Torwege ein Zweispänner, der nach einem Zurufe von ihm sofort vorgefahren kam.
„Nun man rin, und nicht lange besonnen. Bitte, meine Herren! Herr Baron, nehmen Sie drüben Platz. Und Ihr Freund setzt sich daneben. Ich werde meinen Korpus schon unterbringen.“
Der Kutscher, der in einer etwas ausgedienten Livree steckte, sonst aber ganz intelligent aussah, zog den Hut und zeigte ein erstauntes Gesicht. Heckenstett und Rigard konnten sich nicht lange besinnen. Sie wurden in die saubere Kalesche hineinbugsiert, wie man etwa in einen Eisenbahnzug getrieben wird, der in der nächsten Sekunde abfahren soll. Und nun saßen sie fest, und ihnen gegenüber auf dem Rücksitz Köppke.
„Willem, erst nach Schöneberg“, rief er zum Bock hinauf. Die Peitsche knallte, die kräftigen, wohlgenährten Braunen griffen aus, und der Wagen rollte in die Sommernacht hinein. Es war ein herrlicher Abend. Der Vollmond stand groß und klar am Himmel, und die Felder zu beiden Seiten waren in bläuliches Licht getaucht. Eine halbe Minute lang schimmerte das Wasser des Sees durch die Bäume, glitzerte der Schiefer des Kirchturms, dann war Wilmersdorf im Dunst des Abends verschwunden. Die roten und grünen Lichter der Eisenbahn tauchten auf, der schrille Pfiff einer Lokomotive ertönte, dumpfbrausend verklang das Rollen eines Zuges. Dann, als die Höhe des Weges erreicht war, breitete sich tief unten Berlin mit seinem Lichtmeer aus. Der Himmel war leicht gerötet vom Abglanz der erleuchteten Riesenstadt. Rechts lag Schöneberg wie ein Füllhorn, das Berlin dem Fremden entgegenstreckte.
Merkwürdigerweise war Heckenstett jetzt sehr geneigt, den Verlauf der Dinge ganz natürlich zu finden. Anfänglich machte er allerdings noch einige Redensarten wie: er könne alles noch nicht begreifen, wisse nicht, wohin die Reise gehen solle und so weiter. Aber aus seiner lächelnden Miene ging doch hervor, daß er sich bereits gefügt hatte. Ein Gedanke war plötzlich in ihm aufgetaucht, den er zuerst als einen sehr unwürdigen niederzukämpfen versuchte, der aber immer wieder zurückkehrte und ihn beherrschte. Vielleicht war dieser Tag dazu ausersehen, eine Wendung in seinem Leben eintreten zu lassen. Als er einige Minuten lang träumerisch zum Himmel blickte, nahm dieser Gedanke bereits eine bestimmte Richtung an.
Er stellte Betrachtungen darüber an, ob die Töchter Köppkes Ähnlichkeit mit ihrem Vater hätten oder nicht. Er würde viel darum gegeben haben, wenn er sofort Gewißheit darüber bekommen hätte. Aber vielleicht erhielte er bald die Gelegenheit dazu. Es würde gewiß nicht schwerhalten, die Bekanntschaft mit dem Alten fortzusetzen. Einige Male war er nahe daran, sich über diese selbstsüchtigen Gedanken zu schämen, aber es war nicht zu ändern: das Bewußtsein, einem Millionär gegenüberzusitzen, der heiratsfähige Töchter besaß und obendrein ein zugänglicher Mann zu sein schien, belebte seine Phantasie und ließ aus ihr rosige Zukunftsbilder entstehen. Es war doch wunderbar, wie schnell er sich der Herrschaft dieses Mannes, den er vordem sehr von oben herab betrachtet, gefügt hatte. Er nahm sich vor, in der Zukunft die Menschen nicht mehr nach ihrem Äußeren zu taxieren. Es geschah doch hin und wieder, daß man sich täuschte.
Währenddessen hatte er gar nicht auf die lebhaften Erörterungen Köppkes geachtet, trotzdem es ihm gewesen war, als hätte er diesem mehrmals eine zustimmende Antwort gegeben. Um so aufmerksamer hörte Rigard zu. Er hatte sich weit zu dem Alten herniedergebeugt, so daß er ihm fast den Rauch seiner Zigarre ins Gesicht blies, und wandte den Kopf bald nach rechts, bald nach links, je nachdem Köppke die Richtung auf den Feldern angab. Köppke befand sich im besten Zuge, Rigard in den „Grund und Boden“ zu beiden Seiten einzuweihen, wobei das Wort „Terrain“ eine große Rolle spielte. Je näher sie Schöneberg kamen, je eingehender wurden diese Betrachtungen, die zum Teil in der Sprache des Urberliners vorgetragen wurden, so daß Rigard sich verführt sah, selbst hin und wieder einige Worte einzuwerfen, die nicht gerade salonfähig waren. Seine Sympathie für Köppke war bereits so groß, daß er es geduldig hinnahm, als dieser ihn zweimal hintereinander mit „lieber Freund“ anredete.
„Det da drüben ist noch Deutsch-Wilmersdorf, aber hier bin ich schon zu Hause. Wat meenen Sie, was hier noch für Moneten im Boden stecken. Noch eene zwanzig Jährchen, dann können Sie hier an die Dore von Berlin kloppen. Die Kossäten hier werden ooch mal viere lang fahren. Berlin frißt allens uff.“
Alles bei ihm drehte sich um den Wert, den diese Erde später als Baugrund haben werde oder teils schon hatte. Das andere war ihm Nebensache. Er sprach von demnächstigen „Auflassungen“, von Parzellierung und Straßenregulierung, kramte die ganzen Schöneberger Bauverhältnisse aus und nannte so viele Namen, daß weder Rigard noch Heckenstett, den die Sache schließlich ebenfalls interessierte, ihm zu folgen vermochte. Einige dieser Namen waren von derben Ausdrücken begleitet, über welche die Betroffenen wenig erbaut gewesen wären. Neid, Feindschaft und Gehässigkeit schienen unter den reich gewordenen Bauerngutsbesitzern eine große Rolle zu spielen.
Endlich kam er auch auf „seine Seite“ zu sprechen. Damit meinte er den Teil, der jenseits Schönebergs lag, wo er wohnte. Das sei allerdings eine ganz andere Sache, da lägen noch Klumpen Gold in der Erde, und er hoffe auch noch auf seine Kosten zu kommen. Da hinten befinde sich noch so eine Sandgrube, die ihm gehöre; in der Nähe der neuen Straßen. Etwa acht Morgen groß. Man habe ihm bereits für den Morgen hundertachtzigtausend Mark geboten, er wolle aber zweihunderttausend haben und werde sie auch sicher bekommen, denn das Land laufe ihm nicht weg, und er habe Zeit zu warten. Wenn nur die anderen Zeit hätten, dann ginge die Geschichte schon. Das Schönste sei, man brauche nicht einmal nach dem Golde zu graben, das täten andere kostenlos.
Als Rigard wieder von den Hunderttausenden sprechen hörte, stieg der Ärger in ihm auf; viel weniger über die enorm hohen Summen, die andere besaßen, als über die Prahlsucht, die aus diesem früheren Bauern sprach.
„Was machen Sie denn mit dem vielen Gelde?“ fragte er dann.
Köppke kniff wieder das linke Auge zusammen und schlug Rigard ganz ungeniert auf das Bein. „Das möchten Sie wohl wissen, was? Aber wenn Sie es nicht verraten wollen, will ich’s Ihnen sagen. Die eenen Füchse halte ich warm, und die anderen laß ick loofen.“ Er lachte laut auf. Da aber Rigard diese Heiterkeit nicht begreifen konnte, sondern eine verständnislose Miene zeigte, fuhr er gleich fort: „Das heißt mit anderen Worten, die einen werden sicher an die Kette gelegt, zu vier Prozent, und die andern werden weitergegeben, damit die Bauunternehmer buddeln können. Wenn den Herren dann die Gelder ausgegangen sind, dann heißt’s: ‚Wer zuerst kommt, der zuerst mahlt.‘ “
Rigard pfiff leise vor sich hin und nickte ein paarmal, als wäre ihm nun endlich das höhere Verständnis aufgegangen. In seinem Innern war er überzeugt, daß man, um diesen alten Herrn zu verkaufen, sehr früh aufstehen müßte. Jedenfalls war er ein seltsames Gemisch von Schlauheit, Gutmütigkeit und Freigebigkeit – einer jener Menschen, denen das Geld nicht die Befriedigung gegeben hat, die sie erwartet hatten, und die sich nun an der ganzen Welt rächen, indem sie eine fieberhafte Tätigkeit entfalten, um den Besitz von Tag zu Tag zu vermehren.
„Aber ich mache das immer solide“, begann er wieder, als er die etwas erstaunten Gesichter der Freunde erblickte. „Ich bin nicht so wie Barnikow drüben hinter der Kirche, der durch den Bauschwindel reich geworden ist. So was machen wir nicht. Nich’ in die Hand! ... Aber fragen Sie mal an, ob er was hat. Prost Mahlzeit! Keene Maus findet etwas. Alles gehört der Frau. Er aber abends immer fein nach Berlin. Da taucht er dann unter mit dem Taschengeld von seiner Ollen. Das Taschengeld kennen wir.“
Als der Wagen in die Hauptstraße von Schöneberg einbog, zeigte sich noch reges Leben. Das Klingeln der Pferdebahn ertönte, die Schaufenster waren zum Teil noch erleuchtet, und die Menschen spazierten durch die Straßen.
Sie fuhren in der Richtung nach Berlin zu. Als Köppke sich erhob, um dem Kutscher etwas zuzurufen, benutzten Heckenstett und Rigard diese Gelegenheit, um sich über ihr Ziel zu verständigen. Sie hatten keineswegs die Absicht, sich aufs Geratewohl mitschleppen zu lassen. Aber plötzlich machte der Wagen eine Kurve und bog auf der anderen Seite der Straße in eine Einfahrt. Noch während des Fahrens knallte der Kutscher mit der Peitsche. Die Pferde hatten kaum einige Augenblicke unruhig gescharrt, als das Gitter geöffnet wurde und sich hinter dem Wagen wieder schloß. Heckenstett und Rigard waren so verblüfft, daß sie erst allmählich zu der Erkenntnis kamen, zum dritten Male an diesem Abende überrumpelt worden zu sein. Es war hier so wenig erleuchtet, daß ihre Augen sich erst an die Umgebung gewöhnen mußten. Endlich kamen sie zu der Überzeugung, sich vor dem hinteren Teil einer Villa zu befinden, die zurückgebaut von der Straße lag und von dieser durch einen üppigen Baumwuchs getrennt wurde. Der große Hof machte einen halb ländlichen, halb städtischen Eindruck; denn soviel sie im Augenblick gewahr werden konnten, trugen die langgestreckten Gebäude im Hintergrunde einen sehr bäuerischen Charakter, der durch den scharfen Geruch, der herüberdrang, noch verstärkt wurde. Den Gebäuden schien sich noch ein Garten anzuschließen.
„Nun, meine Herren, bitte ich um die Ehre, auf ein Stündchen meine Gäste sein zu wollen“, sagte Köppke, als er ausgestiegen war und die Freunde mit einer Handbewegung einlud, dasselbe zu tun.
„Ich bitte um Entschuldigung für meine Keckheit, aber Sie kommen heute nun einmal nicht eher fort, bis wir ein Gläschen zusammen getrunken haben. Wer weiß, ob wir so jung noch einmal zusammenkommen. Bitte, Herr Baron, bitte, Herr von Rigard. Theodor, es soll sofort Licht gemacht werden, ich bringe Besuch mit“, rief er dem alten Manne zu, der das Gitter geöffnet hatte und bescheiden beiseite stand.
Mit der Einfahrt in sein Eigentum hatte sich sein Benehmen auffallend geändert. Er schien jetzt sehr viel Gewicht auf seine Höflichkeit zu legen, trat würdiger auf und bemühte sich sogar, nur Hochdeutsch zu sprechen, was ihm aber sehr schwerfallen mußte, denn er verbesserte sich einigemal. Jedenfalls zeigte er das Bestreben, sich mehr der Umgebung anzupassen, als es vordem der Fall gewesen war.
Dieses Aufdrängen der Freundschaft ging Heckenstett denn doch über das erlaubte Maß hinaus. Trotzdem ihm der Abschluß dieses Tages in Gesellschaft Köppkes immer noch lieber gewesen wäre, als an irgendeinem anderen Orte, und trotzdem ihn ein unerklärliches Etwas antrieb, die Einladung anzunehmen, widersprach diese Taktlosigkeit, die jedenfalls viel mehr Egoismus als gutgemeintes Entgegenkommen enthielt, ganz seiner gewohnten gesellschaftlichen Anschauung. Er fühlte sich beleidigt, wenn er sich auch gestehen mußte, diesen Schlußakt der bisherigen Vergnügungskomödie selbst verschuldet zu haben. Und auch Rigard, der bereits vorher seine Neugierde darüber geäußert hatte, wie das „Abenteuer mit dem Goldonkel“ enden würde, fand die Zumutung, spät abends in ein fremdes Haus zu dringen, um sich womöglich von einem Menschen, den man erst einige Stunden kannte, mit Wein traktieren zu lassen, etwas stark. Aber sowie sie ihre Widersprüche und Vorwürfe geäußert hatten, fühlten sie sich auch wieder überwunden durch die Einwendungen Köppkes: sie störten ja niemanden und möchten ihm doch die Freude nicht verderben. Er wurde jetzt in dem Grade liebenswürdig, in dem er vordem zudringlich gewesen war. Und so fügten sie sich denn, getrieben von der Neugierde, abermals in das Unvermeidliche. Köppke bat um Entschuldigung, sie hinten herum führen zu müssen, und dann um die Erlaubnis, ihnen voranschreiten zu dürfen.
Nach zehn Minuten saßen sie in dem großen, hell erleuchteten Salon des Parterregeschosses. Die Glastüren, die nach dem Vorbau führten, waren geöffnet worden. Und so hatte man über das herrliche, wohlgepflegte Blumenbeet hinweg, das sich, vom Mondeslicht übergossen, in sanften Wellenlinien in die Tiefe zog, einen Ausblick auf die Straße. Es war eine jener abgezirkelten Anlagen, wie man sie vor vielen Villen findet, und welche mehr der Kunstfertigkeit des Gärtners und dem Gelde zu verdanken sind, als dem eigenen Geschmacke. Frisch geharkte Kieswege und einige Vasen und Statuen vollendeten das Aussehen dieses Ziergartens, der sich wie ein buntes Präsentierbrett inmitten der alten Bäume breitmachte.
Schon während die Freunde durch die Vorräume geschritten waren, hatte die elegante Ausstattung ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie hatten diese Einrichtung hier am allerwenigsten erwartet. Die schweren, geschnitzten Möbel waren stilvoll, weiche Teppiche bedeckten den Fußboden, und Kristallspiegel prunkten an den Wänden. Aber alles sah überladen aus und roch nach Neuheit. Statt ausgesuchter Eleganz lag etwas Zusammengewürfeltes in diesen Räumen, das das Auge auf sich zog und blendete, aber nicht befriedigte. Etwas Kaltes, wenig Anheimelndes ging von diesen breiten Möbeln aus, diesen ohne Verständnis ausgesuchten Öldruckbildern, diesen steifen, herausfordernd leuchtenden Portieren und den mit peinlicher Gleichheit aufgestellten Damastfauteuils. Im Geist glaubte man noch den Dekorateur zu sehen, wie er sich im Hintergrunde verbeugte und der Herrschaft verkündete, daß er fertig sei. Hin und wieder tauchte ein Möbelstück auf, das andere Zeiten verriet und eigentlich nicht hierher gehörte, welches man aber, um den Raum zu füllen, irgendwo zwischengepreßt hatte, ohne daran zu denken, daß der prahlerisch glitzernde Kronleuchter aus Kristall sein helles Licht in jeden Winkel warf.
Der alte Theodor, der sich mittlerweile einen schwarzen Rock angezogen und, wie Köppke erläutert hatte, die Dienste eines Faktotums und Portiers vertrat, und dessen Vertraulichkeit mit dem Alten den Gästen sofort auffiel, brachte Wein und Gläser. Alten Rüdesheimer Berg, wie Köppke ausdrücklich betonte! Theodor hatte die Angewohnheit, beim Abgange sich mehrmals umzudrehen und an der Tür stehenzubleiben, als erwartete er noch irgendeine Anrede. Dasselbe tat er auch, als er nach einer Weile mit einem Brett voll kalter Speisen zurückgekehrt war und dieselben auf einem kleinen Tische serviert hatte. Er sagte kein Wort, aber etwas Stummes, Vorwurfsvolles lag in jedem Blick, den er auf den Herrn des Hauses richtete.
Heckenstett und Rigard ließen sich nicht lange nötigen, denn in dieser Umgebung befanden sie sich einigermaßen zu Hause. Sie stießen mit dem sonderbaren Gastgeber an und machten es sich dann auf den Fauteuils bequem. Da der Wein ganz vortrefflich war und sie sich verpflichtet fühlten, das zu äußern, so ruhte Köppke nicht eher, bis er ihnen auch die Hummern aufgenötigt hatte, die sehr einladend vom Tische aus winkten. Er lobte sie über die Maßen und beeilte sich dabei, für zwei zu essen. Nebenbei vergaß er nicht, zum Trinken zu ermuntern und die Gläser aufs neue zu füllen. Theodor hatte bereits eine neue Flasche kalt gestellt und kam ungerufen mit dem Kühler herein. Alles, was er tat, geschah wortlos und in sehr gedrückter Stimmung, wie ein Mensch es zu tun pflegt, der jeden Augenblick eine heftige Anrede erwartet und davor zittert.
Der Hausherr bot echte Havannazigarren an, und so zeigte auch Rigard, der sich seit fünf Minuten über eine schlechte Landschaft an der Wand geärgert hatte, wieder ein anderes Gesicht. Er zeichnete und malte etwas und konnte daher die mangelhafte Perspektive auf dem Bilde nicht begreifen. Er hatte das Heckenstett diskret, aber sehr eindringlich auseinanderzusetzen versucht. Nun fiel sein Blick auf das Piano im Hintergrunde, und sofort beeilte er sich, einige Töne anzuschlagen. Als er dann gedämpft ein Lied von Schubert spielte, erkannte es Köppke als dasjenige wieder, das seine Jüngste noch kurz vor ihrer Reise eingeübt hatte. Er habe diese Melodie oft durch die Decke gehört, denn er halte sich größtenteils oben im ersten Stockwerk auf. Unten sei es ihm zu fein; hier hätten seine Frau und die Mädchen die Regierung. Er habe gewisse Gewohnheiten, von denen er nicht abgehen könnte, wenn er sich zu Hause befände. So zum Beispiel das Pfeifenrauchen und so weiter.
Nachdem sie ungefähr drei Viertelstunden zusammengesessen und sich in der rosigsten Weinstimmung über die verschiedensten Dinge unterhalten hatten, mahnte Heckenstett zum Aufbruch. Elf Uhr war längst vorüber, und er fing allmählich an müde zu werden. Köppke wollte sie durchaus noch zurückhalten. Er war sehr laut geworden und redete nun auch Rigard mit „Herr Baron“ an, was sich dieser auch ohne Widerspruch gefallen ließ. Schließlich zündete er die Lichter des Armleuchters an und lud sie zum Schluß noch ein, sich einmal die Nebenräume anzusehen. Beide lehnten aber dankend ab, da er in seinen Bewegungen etwas unsicher und seine Zunge sehr schwer geworden war. Dann wollte er durchaus Karten mit ihnen spielen und neuen Wein kommen lassen. Diesmal sollten sieden roten probieren. Plötzlich wurden alle diese Auseinandersetzungen durch lautes Wagengerassel unterbrochen, das unmittelbar vor dem Håuse verstummte.
„Es scheint Besuch da zu sein, Mama“, ließ sich eine weibliche Stimme deutlich vernehmen.
„Schwerenot, da ist meine Frau schon!“ sagte Köppke und riß sofort die Tür nach hinten auf. „Theodor, Theodor!“ rief er hinaus. Der Gerufene erschien; es gab eine wenig rücksichtsvolle Auseinandersetzung. Theodor hatte ganz vergessen, die am Nachmittag eingetroffene Depesche abzugeben. „Du bist und bleibst ein Schafskopf“, raunte er ihm zu, so daß Heckenstett und Rigard es hören konnten. Beide hatten sich erhoben und bedauerten lebhaft, sich nicht früher verabschiedet zu haben, denn die kommende Situation erweckte schon jetzt ein unangenehmes Gefühl in ihnen.
Während einiger Minuten befanden sie sich allein im Zimmer. Durch die geschlossene Tür vernahmen sie fortwährend die Stimme des Hausherrn. Das Schlimmste war, wie es schien, daß die Girlanden und der Willkommensgruß noch nicht angebracht worden waren. Köppke erwähnte das im Vorzimmer mehrmals und gebrauchte dabei zweimal das Wort „Esel“. Es wurde nicht ersichtlich, wer damit gemeint sei, aber eine helle, vorwurfsvolle Stimme wehrte sich dagegen mit dem Bemerken, daß der Befehl erteilt worden sei, den Schmuck erst am anderen Morgen anzubringen.
Dann wurden Tritte und eine energisch klingende Frauenstimme laut. „Das ist aber wirklich stark. Kein Mensch läßt etwas von sich hören!“ Schließlich vernahm man nur noch ein Murmeln. Der Hausherr schien den beginnenden Ausbruch des Unwillens im Keime erstickt zu haben. Dann klopfte es, und herein rauschten Mutter und Töchter, noch angetan mit den seidenen Staubmänteln.
Als nach der Vorstellung, die, soweit es sich um die Freunde drehte, von Köppke sehr laut und mit Nachdruck geführt wurde, dessen Frau mit einem liebenswürdigen Lächeln um Entschuldigung dafür bat, daß sie es sich sofort bequem mache, knackte der ganze Sessel. Während Heckenstett und Rigard ihrerseits einige höfliche Worte gebrauchten und auf den Augenblick warteten, wo sie sich mit Anstand empfehlen könnten, erfuhren sie noch die Veranlassung dieses unerwarteten Eintreffens. Frau Köppke hatte sich um einen Tag geirrt. Da die Vorbereitungen zur Abreise bereits getroffen waren, so wollte man nicht länger warten. Ihr ganzes Gesicht strahlte vor derber Gesundheit, als sie die wohlerhaltenen, weißen Zähne zeigte. Alles an ihr war rund und von Kraft strotzend: das Urbild der Jüngsten, die mit geröteten Wangen neben dem Vater stand. Am Kamin saß die Älteste, etwas ermattet, wie es schien, und fixierte neugierig die beiden Freunde. Sie hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit Mutter und Schwester.
Endlich brachen die Gäste auf. Schon wollte sich Heckenstett zum letzten Gruß verbeugen, als ihm noch etwas einfiel. Der letzte Blick auf die Älteste hatte ihm diesen Gedanken eingegeben. Er bat um die Erlaubnis, sich am andern Tage nach dem Befinden der Damen erkundigen zu dürfen.
„Sehr angenehm, Herr Baron ... Soll uns eine große Ehre sein.“ Das Ehepaar rief es fast gleichzeitig. Die Jüngste zuckte nicht mit der Wimper. Die Älteste aber schien Verständnis dafür zu haben, denn sie lächelte und nickte Heckenstett ermunternd zu.
In dieser Nacht ergingen sich Heckenstett und Rigard noch in sehr lebhaften Meinungsäußerungen, bevor sie sich trennten, um ihre im Potsdamer Viertel gelegenen Wohnungen aufzusuchen.
III
Die Köppkes waren seit langer Zeit bereits in Schöneberg ansässig. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde der Ort fast ganz verwüstet, so daß von den Hüfnern und den Kossäten nur etwa vier oder fünf Besitzer übrigblieben; die andern hatte die Kriegsfurie auf Nimmerwiedersehn in die Fremde getrieben oder im eigenen Lande zugrunde gerichtet. Seit jeher hatte der Segen des Dorfes in der Erde gesteckt, denn der Boden war fett und ersprießlich. Wer im Orte fest saß, der hatte sein gutes Auskommen. Um so fühlbarer machte sich plötzlich der Mangel an Wirten in den verödeten Höfen und auf den herrenlosen Feldern, deren letzte Halme von den bewaffneten Horden zertreten waren.
Um die Saaten wieder reifen zu sehen, zog man Leute aus fremden Ortschaften heran. Etwa ein Dutzend Bauern kam der Aufforderung nach, und unter ihnen befand sich der Hüfner Stefan Köppke aus Köpenick. Das war Tatsache, nur war es nicht ganz erwiesen, ob die jetzigen Köppkes direkt von diesem Stefan abstammten; denn vor Beginn des Siebenjährigen Krieges sollte es noch einen Pferdeknecht gleichen Namens im Dorfe gegeben haben, der bei Leuthen geblieben war und Frau und Kind hinterlassen hatte. Als die Russen zwei Jahre später Schöneberg in Brand steckten, kam die Mutter dabei ums Leben. Der Stammhalter aber, der sich später sein Brot als Tagelöhner verdienen mußte und die Witwe seines Brotgebers, eines kleinen Kossäten, heiratete, sollte der Großvater des jetzigen Familienoberhauptes gewesen sein. Die Chronik des Dorfes sprach wenigstens dafür. Martin Hans, der jetzige Millionär, wollte nichts davon wissen; wenigstens bestritt er diese Verwandtschaft auf das entschiedenste. Köppke aus Köpenick klinge schon so überzeugend, daß jedermann die Abstammung von dem Hüfner einsehen müsse, meinte er. Damit wies er jede Beziehung dieser „Seitenlinie“ weit von sich; am meisten aber den „Pferdeknecht“, dessen Erwähnung er sich energisch verbat. Ja in seinem Eigendünkel ging er so weit, fest und steif zu behaupten, daß der Name Köppke eng mit der Begründung von Köpenick zusammenhinge und daß die Köppkes damals jedenfalls eine große Rolle gespielt haben müßten. Seitdem er diesen witzigen Einfall bekommen hatte, tischte er ihn jedermann auf, der sich für seine Familie interessierte. Eines Tages – es war vor zwanzig Jahren – hatte man ihn aber mit seinem Namendünkel gehörig heimgeleuchtet, indem ein Bauer die Behauptung aufstellte, Köppke komme eigentlich von „fauler Kopp“ her. Es gab viel Lachen darüber, und seitdem war er vorsichtiger geworden.
Alle diese kleinen unliebsamen Erinnerungen wurden jedoch mit der Zeit verwischt; sie tauchten nur noch in engeren Kreisen auf, bei den eingeborenen und langjährigen Bewohnern Alt-Schönebergs, die über die Verhältnisse von Hinz und Kunz unterrichtet und in jener Zeit aufgewachsen waren, als das Dorf noch losgetrennt von Berlin lag und sich seiner stillen ländlichen Ruhe erfreuen durfte. Damals war der Goldsegen über die Bauern noch nicht hereingebrochen. Er hatte erst seinen Anfang genommen, als die Potsdamer und Anhalter Bahn ihre Eisennetze über die Felder spannte, als der Steinkoloß unten am Berge sich reckte und dehnte und nach Westen immer größere Kreise schlug, um ein Riesenterrain nach dem andern in sein Bereich zu ziehen.
Die Gärten an der Landstraße verschwanden, ganze Ackerwirtschaften wurden in Baugrund verwandelt, und auf den grünenden Wiesen, wo einst die Jugend die Papierdrachen lustig im Winde flattern ließ, schossen die Mietskasernen gleich Pilzen aus der Erde. Allmählich stieg der Koloß auch den Berg hinan, füllte jede Lücke aus, vermengte „Neu-Schöneberg“ mit dem alten und trug das rauschende Leben der Großstadt auf breiten Strömen in den einstigen unscheinbaren Vorort. Abgeschlossen von dieser lärmenden Welt lag nur nach wie vor der Botanische Garten mit seinen stillen Reizen und den ewigen Geheimnissen der Natur und sandte an den Sommertagen den Duft der Blumen in das Gewühl der Menschen.