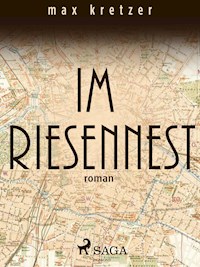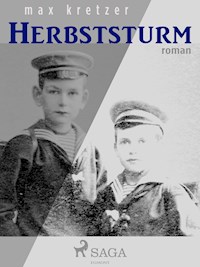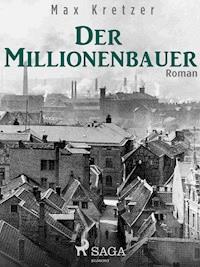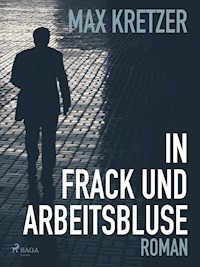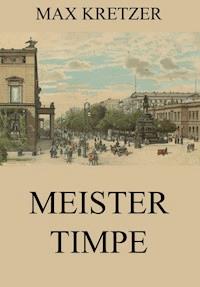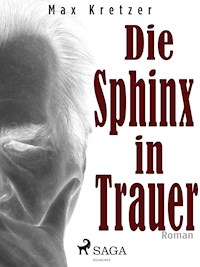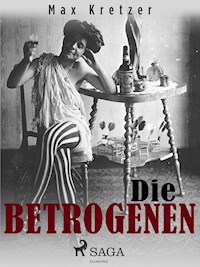Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Dietrich Frobel vor ein paar Jahren wegen seiner krankhaften Verschwendungssucht für geschäftsunfähig erklärt wurde, führt seine patente Frau erfolgreich das Kontor. Ab und zu kommt er vorbei – die elegante Stadtwohnung ist mit dem Kontor direkt verbunden – und seine Besuche sind von ausgesprochener Liebenswürdigkeit. Diesmal überrascht er seine Frau mit der Nachricht, dass der früher berühmte und bewunderte Tenor Dedo Emmerich sein Comeback in der Oper gibt. Ernestine erschrickt, mit Emmerich verbindet sie mehr als eine lose Bekanntschaft von früher. Die so lebensbejahende Frau hatte damals schon zwei Kinder geboren. Beide zeigten bald die gleichen genetischen Schwächen, die bei ihrem Mann im Laufe der Zeit so verheerende Folgen hatten. Mit dem Mut zur Sünde hatte sie sich auf den so begabten wie charmanten Künstler eingelassen. Dass sie seitdem sein Schweigen über diese Affäre bezahlt, ist der Lohn für ihren Sohn Günther. Keiner weiß, dass das einzige lebenstüchtige Kind der Frobels einen anderen Vater hat. Aber jetzt soll Schluss sein mit den Zahlungen. Doch die Wiederbegegnung mit Emmerich läuft nicht so wie geplant!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Mut zur Sünde
Roman
Viertes Tausend
Saga
Mut zur Sünde
© 1909 Max Kretzer
Cover image courtesy of Freepik.com
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502853
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die grossen Leidenschaften sind selten wie die Meisterstücke.
Balzac
I
Am Abend des 2. Dezember hielt sich Frau Ernestine Frobel auffallend lange in ihrem Geschäftszimmer auf, ohne jedoch ihren gewohnten Platz an dem mächtigen Diplomatentisch einzunehmen, über dem das Licht sonst regelmässig Punkt 7 Uhr zu erlöschen pflegte, falls aussergewöhnliche Umstände es nicht eher bedingten. Sie durchschritt vielmehr aufgeregt das Zimmer — diesen ausgedehnten Raum, der mit seinen drei breiten Fenstern etwas Saalartiges hatte und in seiner ganzen Ausstattung mit dem schweren Teppich, dem Ruhebett mit türkischer Decke, den bequemen Sesseln und den seidenen Übergardinen überwiegend einen privaten Charakter zeigte, so dass man ihn eher als eine Fortsetzung der Wohnung nebenan hätte betrachten können. Nur der eintürige Geldschrank in der äussersten Ecke, ein elegantes Regal mit etikettierten Buchkartons und sonstige, von einem grossen Kaufmannshause unzertrennliche Dinge zeugten von dem geschäftlichen Eifer, der hier tagtäglich entwickelt wurde und sich durch die geöffnete Tür gleichsam hinüberspann zu dem grossen Kontor hinten, wo sich zwei Reihen bereits verlassener Doppelpulte, nur noch schwach von einer einzigen Deckenflamme beleuchtet, aus dem gähnenden Dunkel hervorhoben.
Im kleinen Nebenkabinett, das die Verbindung nach dort herstellte, arbeitete als Letzter noch Herold, der alte, biedere Herold, der schon unter dem seligen Chef seine verschiedenen Gros Stahlfedern in aller Ruhe verschrieben hatte und dem im Laufe der Jahre beim Lampenlicht die letzten Haare allmählich vom blanken Schädel gefallen waren wie der dünne Schnee von einer Bergeskuppe, den der Sturmwind ins Tal hinunterfegt. Die goldene Brille etwas weit auf die spitze, vom Lampenschirm grün angehauchte Nase gerückt, vergass er nicht, über sie hinweg zeitweilig besorgte Blicke nach dem erleuchteten Nebenzimmer zu werfen, falls seine wasserblauen Augen nicht den Weg gerade nach der Wanduhr nahmen. Denn obwohl in jahrzehntelanger Zucht daran gewöhnt, sich der alten Gewohnheit zu beugen, die ihn nach dem Ultimo über dem Privatkonto der Frau Chef länger als sonst hier festhielt, noch mehr dem eisernen Willen dieser seltenen Frau da drinnen, die als Muster von Pflicht und Herzensgüte gelten konnte, erschien ihm für seine mürben Knochen die Tagesarbeit diesmal jedoch ein wenig zu ausgedehnt — gerade heute, wo sein Schwiegersohn zu Besuch kommen wollte und, wie immer bei dieser Gelegenheit, ausnahmsweise ein saftiges Filet zu erwarten war.
Etwas Aussergewöhnliches musste Frau Frobel bewegen, denn noch niemals hatte er ihre stattliche Gestalt den Lichtschein der geöffneten Tür so oft durchkreuzen sehen wie jetzt — selbst in jenen schweren Tagen nicht — mit Schauern dachte er daran —, als der Zusammenbruch der alten, angesehenen Firma C. D. Frobel zu befürchten war und ein Sturm die Seele dieser Frau aufgepeitscht hatte, der für alle älteren Angestellten, die um ihr Brot bangten, etwas Erschütterndes hatte.
Es war so still in den Räumen, dass man nur das Rauschen des Kleidersaumes hörte, denn obgleich Frau Frobel, die einst so überschlanke Frau Frobel, allmählich üppige Formen angenommen hatte, zeigte sie doch die Geschmeidigkeit der eleganten Dame, und so vernahm man kaum ihre Tritte, die obendrein durch Teppich und Dielenbelag gedämpft wurden. Nur von draussen schallte das schon im Erlöschen begriffene Leben der stillen Kanalstrasse herein, das sich wie ein dumpfes Grollen der anbrechenden winterlichen Nacht ausnahm, die auch in dieser wenig arbeitsamen Gegend Berlins allmählich nach Ruhe verlangte. Dann machte sich ein Räuspern des Alten bemerkbar, das entschieden der Ausdruck einer Art verhaltenen Aufmuckens sein sollte. Und dazwischen hinein stahl sich nun ein leiser, langgezogener Seufzer der Frau, der das feine Knistern ihres Taftkleides begleitete und sich bis zu Herold verlor, der nun erst recht nicht den Mut fand, sich mit einem „ergebenen Diener“ zu melden, um seine Bitte für heute anzutragen. Vor einer Stunde etwa hatte ihn Frau Frobel ersucht, noch „einige Minuten“ zu bleiben, wonach denn glücklich eine Viertelstunde nach der anderen vergangen war. Und während er hin und wieder, diesmal unruhiger als zuvor, die Feder eintauchte und die Buchung fortsetzte, brachte er den Seufzer mit der Wohnung zusammen, die man allgemein im Geschäft „das Lazarett“ nannte, weil fast die ganze Familie aus kranken Menschen bestand: aus den Nachkommen einer degenerierten Rasse, die teils mit diesem, teils mit jenem Mangel behaftet waren.
Frau Ernestine selbst hatte diese Bezeichnung schon zur Zeit gebraucht, als die nun Erwachsenen noch Kinder waren und sie selbst noch mehr Zinn dafür hatte, die Vergehen der Natur durch Liebe, Güte und ewige Geduld auszugleichen.
Und der biedere Herold, der so gern sprach, wenn ihn etwas bewegte, blickte unwillkürlich durch das Fach des Pultaufsatzes der Stelle zu, wo tagsüber Frobel junior seinen dunklen Krauskopf über die Papiere beugte und so oft sein hübsches Gesicht zu ihm erhob, wenn es sich um Auskunft über schwierige geschäftliche Dinge handelte, die in sein zerstreutes Gehirn nicht gleich hinein wollten. Und schon hatte er die gewohnte Frage auf den Lippen: Nicht wahr, mein lieber Herr Günther, — die Frau Mama hat wohl wieder recht ihre Sorgen drüben? als er sich noch rechtzeitig seines Alleinseins bewusst wurde und mit einem Lächeln den Augen wieder die Richtung nach unten gab. Dabei erfüllte ihn aber etwas wie ein stiller Neid gegen den Abwesenden, der seine Lampe schon längst ausgedreht hatte.
Dieser junge Herr Günther hatte es gut —: er schenkte seiner Mutter keine Minute mehr über Kontorschluss und flog mit dem ersten Glockenschlag aus, und zwar seit Wochen schon. Wohin, das mussten die Götter wissen, weshalb sollte er es auch nicht tun — er, der einzige Gesunde unter dem Nachwuchs, der Temperamentvolle und Lebenslustige, der nur am Tage die Beharrlichkeit seiner Mutter zeigte, um sie dann am Abend gehörig abzuschütteln! Gott hatte ihr diesen blühenden Knaben geschenkt (sie selbst hatte es ihm, dem alten Vertrauten, in einem Augenblick der Glückseligkeit in überschwenglicher Weise zugerufen), und er und die älteren Köpfe im Geschäft, die Anteil an der Familie nahmen, hatten sich darüber gefreut, dass dem gesunden Blute der Mutter diesmal zum Siege verholfen war.
Bis hierher war Herold in seinen Gedanken gekommen, als Frau Frobel auf die Schwelle des Zimmers trat und mit ihrer tiefen, melodischen Stimme, die etwas von dem Klang einer Heroine hatte, ihn zu sich herein bat. Als dann aber die Uhr acht schlug, rief sie erstaunt aus: „Schon so spät? Aber mein lieber Herr Herold, weshalb sagen Sie das nicht! Entschuldigen Sie nur, aber ich bin heute wirklich sehr zerstreut.“
Herold tat das, was brave Angestellte bei solcher liebenswürdigen Offenheit ihres Chefs immer zu tun pflegen: er lächelte krampfhaft und behauptete mit gemachter Überzeugung, dass eine derartige Verzögerung durchaus nichts auf sich habe. Dann brachte er die Papiere in seinem Pulte unter, wischte die Feder sauber aus, nahm die Brille ab, die er etwas umständlich in das Futteral steckte, und ging auf seinen steifen Beinen, mit dem Buch in der Hand, zu Frau Frobel hinein, denn es war Gebrauch, dass das Privatkonto, in dem vertrauliche Dinge standen, an jedem Abend hier eingeschlossen wurde.
„Nun, werden Sie bald in Ordnung sein?“ fragte Frau Frobel, während sie ihm gestattete, den Folianten in ihren Privatschrank zu legen. „Es ist diesmal ein bisschen viel nachzuholen, nicht wahr?“
„Wenn nichts dazwischen kommt, hoffe ich in acht Tagen fertig zu sein. Tja“, erwiderte Herold mit seiner klebrigen Stimme, an die man sich erst gewöhnen musste, um ihn zu verstehen. Dieses „Tja“ pflegte er immer erst nach einer Gedankenpause hinzuzusetzen, gleichsam wie nach einer nochmaligen Überlegung.
Abwartend blieb er vor ihr stehen in der losen Haltung aller jener Leute, die ihr ganzes Leben lang den Rücken über die Bücher krümmen mussten. Mit seinem bartlosen, faltenreichen Gesicht, das schon die rostbraunen Flecke des Alters zeigte, und in dem langen, schwarzen Kontorrock (einem abgelegten Sonntagsrock), den er gegen sein Strassenjackett noch nicht eingetauscht hatte, machte er fast den Eindruck eines ehrwürdigen Lehrers vom Lande in den Darstellungen, wie sie auf Bildern typisch geworden sind. Nur eine gewisse Koketterie in der Wahl seiner Krawatte, das blendend-weisse Oberhemd unter der mässig ausgeschnittenen Modeweste und die schwere goldene Uhrkette — der Bestandteil eines Jubiläumsgeschenkes — gaben ihm einen Zug ins Moderne, dem er mit der Zeit doch nicht hatte widerstreben können; schon aus Rücksicht auf die stete Nähe der Frau Chef, die ihn so gern zu Rate zog.
„Nehmen Sie doch einige Augenblicke Platz, lieber Herr Herold“, sagte Frau Frobel wieder und wies auf den Rohrsessel neben dem Schreibtisch, der solchen Unterredungszwecken diente. Gegen diesen alten Herrn, der sie schon als Backfisch gekannt hatte, war sie stets von grosser Zuvorkommenheit, die als besondere Auszeichnung aufgefasst werden konnte.
„Ich möchte Sie nur um etwas bitten“, fuhr sie fort und brachte, noch im Stehen, rasch einige Briefschaften beiseite.
Herold, der sich vor ihr nicht zu setzen wagte, vergass im Augenblick seinen Schwiegersohn und das Filet, denn er machte sich nun auf irgendeine Entlastung ihres Herzens über neue Aufregungen im Lazarett gefasst. Seit etwa acht Tagen sollte es mit Annemarie, der Jüngsten, nicht besonders gut stehen, so dass man bereits in Erwägung gezogen hatte, ob es nicht besser wäre, dass Herr Frobel, der im Geschäft eigentlich gar nicht zählte, sobald als möglich mit ihr nach dem Süden ginge. Solche Reisen wurden fast in jedem Jahr unternommen, und Frobel senior, der selbst „schwach auf der Brust“ war, wie man sein dispositionsloses Viveurtum zartfühlend an den Pulten umschrieb, hatte dann den Beschützer und Reisebegleiter zu spielen, was er sich, schon aus Gründen der eigenen Erholung, gern gefallen liess.
Zu seiner Enttäuschung musste aber Herold erfahren, dass es sich nur um einen kleinen Auftrag handelte, den er, gewissermassen diskret, gleich in der Frühe des andern Tages ausführen lassen sollte. Frau Frobel wünschte zu einem bestimmten Abend einen guten I. Rang-Sitz zu einer Vorstellung im Theater des Westens, das sie allein zu besuchen wünsche.
„Ich möchte aber nicht gern, dass mein Sohn etwas davon erfährt, weil ich gewisse Absicht damit verbinde“, fügte sie mit der Gleichgültigkeit einer Frau hinzu, die es selbstverständlich findet, dass man sich über den Grund ihres Vorhabens nicht den Kopf zerbreche.
Herold jedoch, der des Abends, wenn er ermüdet von der Kontorarbeit nach Hause kam, seine Zeitung bis auf die letzte Zeile las und dem daher nichts verheimlicht blieb, was im grossen Berlin vorging, entfuhr es unwillkürlich: „Ei, ei, tritt da nicht wieder Herr Emmerich auf? Nach so langer Zeit wieder. Mir ist’s, als hätte ich es gelesen. Tja.“ Und bevor noch Frau Frobel etwas erwidern konnte, fügte er, ganz eingenommen von diesem Ereignis, hinzu: „Also hat er sich doch wieder emporgerafft, dieser Herr Don Juan, der uns so schwere Sorgen gemacht hat.“ Wenn der Alte „uns“ sagte, so sprach er gewissermassen im Namen des Geschäftes, oder doch im Sinne des Privatkontos, in dem der Buchstabe „E“ seine finanzielle Bedeutung hatte, die ausser Frau Frobel er allein nur kannte.
Damit hatte es eine eigene Bewandtnis. Eines Tages, vor etwa fünfundzwanzig Jahren, hatte man Ernestines Mutter, Frau Kommerzienrat Brüning, die damals schon Witwe war, aber immer noch in den Spuren ihres Gatten wandelte, in ihrem Salon alles, was in der Kunst einen Namen hatte, um sich zu sehen, einen jungen, angehenden Tenor zugeführt, einen bildhübschen Menschen von grosser Figur, der, armer Leute Kind, weder Mittel noch Verbindung besass, den Schatz in seiner Kehle zu heben. Es dauerte nicht lange, so wurde er der umschwärmte Schützling Frau Brünings, die ihn ausbilden liess, ihn völlig erhielt und ihm zum ersten Siegeszug über die weltbedeutenden Bretter verhalf. Einige Jahre erfüllte sein Ruhm ganz Deutschland, man warf ihm das Gold in den Schoss, und unzählige Frauenherzen flogen ihm zu. Dann aber verlor er infolge eines Halsleidens — Boshafte meinten infolge seiner Trunksucht — seine Stimme; der Stern erlosch, und es trat ein, was immer bei gefallenen Grössen einzutreten pflegt: er geriet in Vergessenheit, vegetierte im Auslande und in den Provinzen und liess sich dann vorübergehend irgendwo als Gesanglehrer nieder, wo er nur noch eine lokale Rolle spielte.
Gegen seine Wohltäterin hatte er sich sehr undankbar benommen, was ihm aber seines über Nacht entstandenen Grössenwahns und seiner exzentrischen Neigung wegen verziehen worden war, obgleich sie unter seiner Renommage mit ihrer Freundschaft, die zu Andeutungen aller Art Veranlassung gegeben hatte, sehr gelitten hatte. Und selbst dann noch, als er, zurückgekehrt in seinen Staub, sich mit Briefen späten Dankes der einstigen Gönnerin erinnerte, hatte sie eine offene Hand für ihn, die seltsamerweise später auch auf die Tochter überging und sich bis auf den heutigen Tag bewährte.
Das ungefähr war die Geschichte, die zur Kenntnis Herolds gelangt war und ihm nun den Mut gab, eine scherzhafte Anspielung zu wagen. Und als er sah, dass keine Einwendung kam, fuhr er ermuntert fort: „Frau Frobel wollen sich gewiss davon überzeugen, ob seine Stimme noch nicht ganz passé ist.“
„Ja, das will ich. Sie sorgen dafür, nicht wahr?“
Es klang zwar freundlich, aber an der veränderten Tonart merkte er, dass diese Sache für sie erledigt sei. Einigermassen verschnupft stand er da, denn gar zu gern hätte er das Gespräch darüber weitergesponnen, weil ihn dieses Konto „E“ von jeher besonders interessiert hatte. Schliesslich war es doch wundersam, dass man immer noch bedeutende Summen an einen Menschen verschwendete, zu dem man persönlich gar keine Beziehungen mehr hatte, obwohl ihm von Frau Frobel einmal angedeutet worden war, dass sie damit nur eine letzte Bestimmung ihrer Mutter erfülle. Aber es war nicht seine Aufgabe, sich den Kopf hierüber zu zerbrechen, selbst wenn dieser Grossmut tiefere, geheimnisvolle Dinge zugrunde lagen. Was konnte sich eine Millionenfirma nicht alles leisten! Er hatte nur zu buchen und zu schreiben. Punktum.
Dann aber sagte er verbindlich, um Gelegenheit zur Verabschiedung zu finden: „Wenn Sie nichts dagegen hätten, Frau Frobel, würde ich das Billett selbst besorgen. Ich ginge einmal früher zu Tisch.“
Sofort war sie wieder die Gütige. „Das wäre mir eigentlich das liebste, Herr Herold. Wie gesagt, soll mein Sohn nichts davon wissen.“
Obgleich noch Hans Gerhard, der Älteste, vorhanden war, sprach sie im Geschäft nur von Günther, als von ihrem Sohne, was man auch erklärlich fand, weil dieser nur der Firma diente. Und da Herold wusste, dass der junge Frobel sich über diese „unverständliche Wohltätigkeit“ seiner Mutter bereits mehrmals aufgehalten hatte, so fand er diesen Standpunkt auch erklärlich.
„Es freut mich, dass Sie mich verstehen“, sagte sie durchaus liebenswürdig. Kein Zug in ihrer Miene verriet, was dabei in ihrem Innern vorging. Die Linke auf den Rand des Schreibtisches gestützt, den Oberkörper der elektrischen Flamme zugeneigt, überflog sie anscheinend gespannt ein Schriftstück, nach dem sie inzwischen gegriffen hatte, und markierte so die ewig beschäftigte Frau, die kleine Dinge nebensächlich abtut, ohne sich in den grossen dadurch stören zu lassen. Dann legte sie den Brief wieder fort, tat einen grossen Atemzug und ging zur geöffneten Tür, um einen Blick in die menschenleeren Räume zu werfen. Und als sie sich davon überzeugt hatte, dass der Kontordiener, der da hinten noch herumlungern musste, nicht zu sehen war, nahm sie ihren Platz am Schreibtisch ein und gab Herold stumm einen Wink, sich endlich zu setzen.
„Sagen Sie, — haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo mein Sohn jetzt des Abends steckt?“ begann sie unvermittelt. Seit ein paar Wochen wird mir die Sache zu bunt. Er fängt an zu bummeln.“
Herold, der endlich etwas Tragisches erwartet hatte, lachte unwillkürlich.
„Die Sache ist nicht zum Lachen, lieber Herr Herold“, warf Frau Frobel ein. „Im Gegenteil, — sie ist sehr ernst. Und deshalb hoffe ich auf Ihre Hilfe. Ich weiss ja, dass Sie sehr von ihm eingenommen sind, aber auch er hat viel für Sie übrig. Er kroch Ihnen ja schon als Kind gewissermassen zwischen den Beinen herum. Und nun hängen Sie ja den ganzen Tag über am Pult zusammen. Gerade darauf baue ich. Denn sehen Sie: er plaudert so gern mit Ihnen und erzählt Ihnen gewiss so manches.“
Herold, ein wenig geschmeichelt, nickte; dann aber fasste er diese Dinge nicht so schlimm auf. Herr Günther sei eben kein Duckmäuser. Jedenfalls werde er seine Freunde haben, mit denen er sich des Abends amüsiere, wie es immer bei jungen Leuten der Fall sei. Im übrigen zeigte er sich durchaus nicht verändert. Er sei immer pünktlich zur Stelle, habe Liebe zur Arbeit und trage sein altes verbindliches Wesen zur Schau, das ihn in den Augen aller so angenehm mache.
„Ja, ja, das weiss ich“, wandte Frau Frobel lebhaft ein. „Dass seine Umgangsformen darunter nicht leiden, das ist ja selbstverständlich. Dazu ist er viel zu gut erzogen, denn ich habe ihn erzogen, worauf ich mir etwas einbilde . . . Aber ich sehe doch anders als Sie, mein lieber Herr Herold, was vielleicht daher kommt, dass mir diese Dinge mehr im Kopfe liegen. Sie werden eben durch Ihre Bücher zu sehr abgelenkt; was auch ganz erklärlich ist. Sehen Sie, mein Bester, — die Pünktlichkeit allein macht es nicht, denn das kann Gewohnheit und Zwang sein; meinetwegen auch Klugheit, um zu täuschen. Aber sagen Sie offen: ist es Ihnen nicht aufgefallen, dass mein Sohn jetzt öfters des Morgens aus dem Gähnen nicht herauskommt, wie? Es gibt doch solche Vormittage.“
Herold lachte nicht mehr, denn er sah die besorgte Miene seiner Gebieterin und konnte sich nicht verhehlen, dass ihm diese Vorgänge nicht entgangen seien. Und da ihm daran lag, dieser vortrefflichen Mutter jedes Bedenken zu nehmen, so wies er auf die anderen jungen Leute im Geschäft hin, die dasselbe täten, wogegen aber nichts zu machen sei, solange sie ihre Arbeit erledigten und man ihnen nicht den Vorwurf der Nachlässigkeit machen könne. Frau Frobel zeigte leichten Ärger. Was sie die anderen jungen Leute angingen! Hier handele es sich um ihren Sohn, der den Angestellten als Vorbild dienen und nicht Veranlassung geben sollte, ihnen gleichgestellt zu werden.
„Ich verstehe wohl, weshalb Sie das alles entschuldigen“, fuhr sie fort. „Sie entschuldigen es eben mit der Jugend. Das ist hübsch, und das freut mich, weil ich zum Teil denselben Standpunkt vertrete. Ich habe diese Sorte von Eltern niemals leiden können, die mit Vorliebe die Einmauerung ihrer Kinder verlangen. Gewöhnlich ist es die Sorte, die früher am meisten gesündigt hat.“
Und ihr Gesicht nahm unwillkürlich die Richtung nach der Wohnungstür, so dass Herold sie verstehen musste.
„Nein, nein, ich klage niemals ungerechtfertigt an“, fuhr sie mit verlorenem Blick fort, wobei sie nach einem Bleistift griff und auf den Rand der Abendzeitung zu stricheln begann. „Ich war ja auch mal jung und vergnügte mich nach Herzenslust. Natürlich soweit es jungen Mädchen erlaubt ist — namentlich in unseren Kreisen. Und doch kann ich Ihnen sagen: — manchmal hatte ich einen Drang, alles Konventionelle über den Haufen zu werfen und mich einmal gründlich auszuleben, wie es sich unsere modernen Töchter so sehnlichst herbeiwünschen, zum Teil auch schon tun. Die Zeiten haben eben andere Anschauungen gebracht. Und mir wäre es nicht schwer geworden, denn ich hatte ganz das Blut von meinem Vater. Aber ich wurde verdammt streng gehalten, ich sage Ihnen! Bei jeder Gelegenheit bekam ich’s von der Mutter zu hören: das schickt sich nicht, das passt sich nicht, so was tut man nicht. Für die Frauen gibt’s ein eigenes Moralgesetz, das die Männer für sie zusammengebaut haben. Manchmal hätte ich gewünscht, ich wäre ein Junge und könnte auf und davon gehen.“
Männliche Tatkraft haben Sie ja genug, hätte Herold am liebsten eingeworfen.
Frau Frobel hatte gar nicht die Empfindung, das alles zu einem Angestellten zu sagen, der schliesslich nur stilles Erstaunen darüber zeigen musste. Es war ihr vielmehr nur darum zu tun, sich an ihren eigenen Worten zu berauschen, während ihre Gedanken ganz wo anders waren. Fortwährend dachte sie an Sänger Emmerich, an den Mann, der damals ihr junges Mädchenherz bestrickt und sie bezaubert und vernarrt gemacht hatte und dessen Frau sie geworden wäre, wenn sich die Mutter und alle Verwandten nicht so energisch dagegen gewehrt hätten. Und so bereitete es ihr eine gewisse Befriedigung, noch einmal an Dinge zu rühren, die sich gerade an diesem Tage mit dem einstmals Geliebten verbanden.
Dieser Zustand dauerte aber nur wenige Minuten, dann war sie wieder die kluge Frau, die sich von überflüssigen Gefühlen nicht mehr bewältigen liess. „Also hören Sie mal, mein lieber Herold,“ sagte sie mit offener Heiterkeit, „Sie müssen mir ein wenig helfen, aus meinem Jungen etwas herauszubekommen. Ich glaube, es steckt ein Mädel dahinter — na, und das wäre das Schlimmste, was ich mir denken könnte. In seinen Jahren schon, und bei diesem Temperament! Ich möchte es nicht wünschen, aber, aber! — Ich befürchte, ich werde recht behalten.“ Und sie enthüllte ihm, dass Günther in letzter Zeit niemals vor zwei Uhr morgens nach Hause gekommen, ja, dass es einmal schon gegen fünf gewesen sei, ohne dass eine besondere Festlichkeit vorgelegen habe, die als Entschuldigung hätte dienen können. Und das müsse sie mit ihm, dem bisher Soliden, erleben.
„Mein lieber Herr Herold,“ fuhr sie erregt fort, „Sie wissen, was für ein unbegrenztes Vertrauen ich zu Ihnen habe, und Sie wissen auch, dass ich mit meinem Mann über solche Dinge nicht reden kann, für die er kaum Verständnis finden würde. Oder doch höchstens in seiner Auffassung, die, wie immer, minderwertig wäre. Steht es nicht ganz traurig um mich?“
Ein bewegender Seufzer kam über ihre Lippen, ähnlich dem, der schon vordem bis zu Herold gedrungen war, und den er sich jetzt nur zu sehr erklären konnte. Überrascht hatte er kein Wort hervorgebracht, sondern sein stilles Bedauern nur durch leichtes, verständnisvolles Nicken ausgedrückt. Das waren allerdings Dinge, die er nicht erwartet hatte und die manche Zerstreuung des jungen Herrn Günther in letzter Zeit erklärlich machten. Also auch dieser ging aus dem Gleise, wenn auch auf seine eigene Art; und alle Welt hatte sich bisher darüber gefreut, in ihm den Brauchbaren und Tüchtigen zu sehen, den Menschen mit gesunden Gliedern und unverrücktem Verstande, der dereinst die Firma kräftig leiten sollte. Obwohl das alles in seinem Kopfe herumging, begann er doch, die Gebieterin nochmals zu trösten, und je mehr Worte er dazu fand, die schönen und aufrichtigen Worte eines treuen Ratgebers, je mehr gewann er selbst der Sache die leichte Seite ab, an der er schliesslich nur etwas Vorübergehendes erblickte, eine kleine Verführung durch leichtsinnige Freunde, der man durch vernünftige Vorstellungen bald werde Abhilfe schaffen können.
Frau Frobel jedoch schüttelte mit dem Kopf, denn sie wusste bereits mehr, als sie angedeutet hatte. „Fangen Sie die Sache nur recht schlau an, dann wird’s schon gehen“, scherzte sie los. „Heucheln Sie ein wenig, schwindeln Sie meinetwegen auch, ich verzeihe es Ihnen. Alle Diplomaten haben ja zwei Gesichter . . . Nur darf er nicht wissen, dass ich dahinter stecke. Sagen Sie ihm doch, Sie seien ihm des Nachts in der Friedrichstrasse Arm in Arm mit einem hübschen Mädel begegnet und wären erstaunt über die Schönheit gewesen. So etwas schmeichelt und macht redelustig, wenn’s auch nicht wahr sein sollte. Und dann kommt ein Wort zum anderen.“
Herold, der sich bereits erhoben hatte, sah sie mit einer Miene an, in der in diesem Augenblick durchaus nichts von einer zu erwartenden Schlauheit zu lesen war. Dann lachte er aus Anstand mit, aber es war das Lachen eines Gefolterten. Bei knifflichen Dingen pflegte er sich die Nase zu reiben, und das tat er jetzt auch in ausgiebiger Weise, so dass es fast unschön war. Er, der schon seit Jahren regelmässig spätestens um elf Uhr in sein schmales separiertes Bett stieg und selten aus seiner stillen Gegend herauskam, sollte sich des Nachts in der Friedrichstrasse umhertreiben! Und er, der sich rühmen durfte, stets wahr und aufrichtig gewesen zu sein, sollte diese Tugend plötzlich ablegen! Aber was tat man nicht alles einer besorgten Mutter wegen, der obendrein geschäftlich zu dienen man sich zur Ehre rechnen durfte.
„Die Bummelei würde ich ihm schon verzeihen, wenn er sich nur an kein Frauenzimmer hängt“, sagte Frau Frobel nach seiner Zustimmung noch und benutzte die Gelegenheit, sich noch rasch nach dem Befinden seiner Familie zu erkundigen.
Dadurch war Herold endgültig bezwungen.
II
Er wollte gerade gehen, als er durch Frobel senior zurückgehalten wurde, der aus der Wohnung hereintrat und sich gleich durch seine kleinen Liebenswürdigkeiten bemerkbar machte, die er für jedermann in derselben Form bereit hatte. Schon vorher hatte man durch die Tür sein helles Pfeifen vernommen: den Hohenfriedberger Marsch, in den er sich geradezu verliebt hatte und den er bis zum Überdruss pfiff, obendrein mit der Eintönigkeit eines musikalischen Analphabeten. Diese Melodie verfolgte ihn auf Schritt und Tritt, er schleppte sie gleichsam in seiner Seele mit wie die einzige Stimme eines Instruments, die nur dem Besitzer noch Vergnügen macht, weil er sich daran gewöhnt hat. Er wusste schon gar nicht mehr, dass er sie pfiff, und das diente ihm in den Augen seiner Frau, die diese Angewohnheit unausstehlich fand, als einzige Entschuldigung.
„Ei, sieh da, mein lieber Herold, sieh da, mein Lieber, Wie geht’s, wie schaut’s? Noch so spät tätig? Immer fleissig, immer fleissig? Recht so, recht so. Wer der alten Firma Frobel dient, dient sich selbst. Wie Vater selig schon zu sagen pflegte. Und er hatte es schon von seinem Alten.“
Er lachte mit seiner Kinderstimme, trotzdem eigentlich keine Veranlassung dazu vorlag. „Zigarre gefällig, he? Die hier, wie? Nehmen Sie nur, nehmen Sie nur. Zieren Sie sich nicht. Dem Verdienste seine Krone . . . Meine Sorte. Das sagt eigentlich genug.“ Und wieder lachte er einfältig wie ein grosses Kind.
Cornelius Herold, überrascht durch so viel Güte, krümmte den Rücken und griff mit zwei vorgestreckten Fingern in die ihm dargereichte Zigarrentasche, und zwar in die aufgeklappte Seite, wo die grossen und dicken mit goldener Bauchbinde steckten. Und sein Dank klang überstürzt, aus gespitztem Munde, und wurde noch wiederholt, als Herr Dietrich Frobel sich bereits seiner Gattin zuwandte und die Begrüssung fortsetzte.
„’n Abend, liebes Tinchen, ’n Abend! Entschuldige, wenn ich vielleicht stören sollte, denn du hattest gewiss wichtige Dinge mit unserem alten, lieben —. Ich sehe dich immer nur tätig, bis in den Abend hinein. Ich frage dich, weshalb? Pourquoi? Muss das sein? Darf das sein? Bin ich nicht da? Aber ich will nicht weiter in dich dringen, denn ich weiss, es macht dir Vergnügen — grosses Vergnügen.“ Und er wandte den Kopf wieder dem alten Getreuen zu. „Nicht wahr, mein lieber Herold? Sie müssen es doch wissen, denn Sie sind ja sozusagen vortragender Rat in unserem Handlungsministerium. Guter Vergleich, he?“ Und er lachte wieder zwecklos und sprach zu seiner Frau weiter. „Du bist die Herrscherin, und was bin ich? Der Chefgemahl bin ich. Du — das ist ein guter Witz, ein wirklich guter Witz. Mir eben erst eingefallen. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet.“
Und abermals hatte er sein helles Lachen bereit, das eigentlich mehr ein Meckern war.
Das alles sagte er durchaus liebenswürdig, mit einer göttlichen Selbstverständlichkeit, die man nicht anzweifeln dürfe, während er sich dabei galant zu seiner Frau niederbeugte, ihre schön geformte weisse Hand ergriff, sie ein paarmal streichelte und dann einen flüchtigen Kuss darauf drückte.
„Ja, du triffst immer das Richtige, mein lieber Dietrich“, sagte Frau Frobel mit der gleichen Liebenswürdigkeit. Damit war ihre Anerkennung erschöpft, gleichsam wie in der Erkenntnis, dass es zwecklos wäre, sich dagegen zu wehren. Fest und bestimmt sass sie auf ihrem Sessel, fast unberührt von dieser Zärtlichkeit, die ihr nur als der Austausch häuslicher Gewohnheiten dünkte.
Herr Dietrich Frobel spazierte, die Hände auf dem Rücken, vor beiden auf und ab, wobei er sich nach allerlei geschäftlichen Dingen erkundigte, was immer etwas sinnlos geschah, seitdem ihm seine willensstarke Frau das Zepter entwunden hatte. Das war damals, als er wegen krankhafter Verschwendungssucht für geschäftsunfähig erklärt wurde und entmündigt werden sollte, schliesslich aber, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden, in einen Kompromiss willigte, durch den er für die Firma einfach kaltgestellt wurde. Gewagte Börsenspekulationen, mit denen er sich über den drohenden Krach hinweg helfen wollte, hatten ihn noch mehr hineingerissen. Und so wurde er, als Ernestinens Mutter einsprang, um die Verhältnisse allmählich zu sanieren, plötzlich zum gehorsamen Kinde.
Er hatte überhaupt viel von einem Kinde an sich, das wohl mit den Jahren gewachsen war, bei dem sich aber der Verstand nicht gleichmässig entwickelt hatte. Das wussten alle im Geschäft, die diese elegante, verkörperte Null hin und wieder in dem breiten Gang zwischen den Pulten auftauchen sahen, wie sie freundlich, aber herablassend, ungefähr wie ein entthronter Fürst, grüssend nickte und dann leutselig mit diesem oder jenem älteren Herrn ein paar Worte über geschäftliche Dinge wechselte, die allerdings vorsichtig aufzufassen waren. Herr Dietrich Frobel hatte nie viel davon verstanden und sich schon vor seiner Kaltstellung auf Geschäftsführer und Prokuristen verlassen.
Aber er musste sich doch zeigen, beweisen, dass er noch am Leben war, und so tun, als hätte er nur aus Gesundheitsrücksichten abgedankt, ohne jedoch seinen Einfluss aufzugeben! Und man liess ihn auch in diesem Glauben, indem man vor ihm dienerte und ihm alle Ehren eines abgesetzten Chefs erwies. Denn schliesslich war und blieb er der Gatte der Frau Chef, der Träger des alten Firmennamens C. D. Frobel.
„Nun, gehst du heute nicht in den Klub?“ fragte Ernest, ine die sich wunderte, ihn noch hier zu sehen, da er, wie alle berufslosen Leute, seine eigenen Wege wandelte, ganz besonders des Abends, nachdem er sich den ganzen Tag über mit seiner Münzensammlung beschäftigt hatte, die reich an kostbaren Stücken war. Die halbe Nacht gehörte dann der Zerstreuung und dem Vergnügen, entweder bei seinen Freunden oder im Ballett und Zirkus, denn er behauptete, er müsse für sein ewiges Katalogisieren am Tage des Abends den nötigen Ausgleich finden. In Wahrheit vertrug sein Gehirn schwere, das Gemüt bewegende Sachen nicht, die ihm an die Nerven gingen. Und so war denn seine Lebensauffassung auf die leichten Genüsse gestimmt.
„Ich wollte dir doch wenigstens noch Adieu sagen, mein liebes Tinchen“, erwiderte er, ohne seine Wanderung einzustellen. „Und dann, siehst du, wollte ich doch noch mal einen Blick ins Kontor werfen; du weisst ja, mir fehlt sonst etwas. Vormittags war ich in der Fabrik.“
„So, so, du warst in der Fabrik“, sagte Frau Frobel völlig interesselos.
„Na, ich musste mich da draussen doch auch einmal sehen lassen. Es ist übrigens alles in schönster Ordnung. Und zu tun haben wir jetzt . . .! Keine Maschine steht still! Freut mich, freut mich ausserordentlich.“
Ersichtlich gehoben davon, als hätte es erst seines Eingreifens dazu bedurft, reckte er sich ein wenig; dann blieb er vor dem grossen Wandspiegel stehen, beäugelte sich selbstgefällig und zog die Spitzen des gefärbten Schnurrbarts aus, der allzu üppig über dem kurz gestutzten, ergrauten Spitzbart hing. Sein schräg wie ein Dach aufsteigender Schädel hatte schon gehörig Haare lassen müssen, die er sich frühzeitig wegamüsiert hatte; und so lagen da oben nur noch die letzten gebleichten Reste, die, in der Mitte kokett gescheitelt, wie ein dünnes Gewebe die Stirnwölbung krönten.
Stets ging er wie ein Lord gekleidet, in einem auffallend karrierten Jackettanzug aus englischem Stoff, einen weissen Vorstoss an dem Westenausschnitt, hinter der die rote Krawatte grell ins Auge stach. Dazu trug er modefarbige Hemden und steingraue Gamaschen über den tadellosen Lackstiefeln.
„So, so, es ist also alles in Ordnung da draussen“, ging Frau Frobel wohlmeinend darauf ein. „Es ist hübsch, dass du mal wieder hinaus warst. Das feuert gleich ein wenig an.“
„Siehst du, — das wusste ich ja, dass ich dafür deine Anerkennung finden würde“, rief er vergnügt aus und trat abermals auf sie zu, um ihr mit Herzensfreude die Hand zu drücken.
Und sie nickte und blickte ihn diesmal lächelnd an, denn sie wusste, dass er im geheimen immer noch die Hoffnung hegte, wieder in seine Rechte eingesetzt zu werden, und dass sie ihm keinen grösseren Gefallen tun konnte, als ihm hin und wieder ein gütiges Wort für sein abgestumpftes Interesse zu sagen.
Seine unverminderte Aufmerksamkeit für sie, seine Zärtlichkeit und die stete Hochachtung, die er ihr seit Überwindung der geschäftlichen Krisis und besonders ihrer Energie entgegenbrachte, enthielten etwas Rührendes, beinah für sie Beschämendes, gegen das sie sich manchmal vergeblich wehrte: obendrein aus tief verschlossenen Gründen wehrte, die er nicht einmal ahnen durfte. Und das war das Versöhnende in seinem Wesen, das alle seine sonstigen Fehler wieder gutmachte.
„Du — übrigens ist auch drüben alles in Ordnung“, meldete er sich wieder in bester Stimmung. „Annemarie fühlt sich wieder besser, denk nur. Aber ich reise doch mit ihr, selbstverständlich tue ich’s. Denn eine Last muss ich dir doch abnehmen.“ Dann wandte er sich wieder an Herold, der sich nicht zu verabschieden wagte, aber wie auf Kohlen stand. „Wie geht denn das Weihnachtsgeschäft, he? Was macht die Konjunktur in Messing, he? Man besass eine grosse Metallwarenfabrik in einem östlichen Vorort, wohin man sie vor zehn Jahren verlegt hatte. Hier war das Stadtlager, verbunden mit Musterlager und Korrespondenzbureau.“
Frau Frobel machte jedoch sofort dem Gespräch darüber ein Ende, indem sie den Alten endlich entliess. Und so kehrte Herold noch einmal an sein Pult zurück, begleitet von Frobel, den es lockte, noch einen Blick ins grosse Kontor zu werfen, denn er bildete sich ein, selbst um diese Zeit noch einmal nach dem Rechten sehen zu müssen. Da er aber niemand mehr vorfand, mit dem er sich hätte unterhalten können, so nahm er den Hohenfriedberger wieder auf, der diesmal, getragen durch die Leere des Raumes, ungemein laut erklang und den er erst allmählich ersterben liess, als er zu seiner Frau zurückkehrte. Man hörte ihn immer schon kommen, denn seine Beine knackten beim Gehen, was wohl mit seiner Magerkeit zusammenhing. Alsdann wandelte er eine ganze Weile durch das grosse Zimmer und schritt den Takt zu seinem Marsch.
Frau Frobel liess ihn ruhig gewähren, denn sie kannte diese Gedankenvertiefungen, die manchmal die langen Pausen zwischen ihnen ausfüllten. Das war immer so gewesen, schon zuzeiten, als Dietrich noch Herr im Geschäft war und von seinem Marsch noch nicht so verfolgt wurde wie heute. Denn sie hatten sich eigentlich nie viel zu sagen gehabt, wenigstens nicht, soweit zwischen Eheleuten die Sprache auch dazu dienen sollte, den innersten Gefühlen Ausdruck zu geben. Beide hatten sich geheiratet, wie sich ungefähr zwei Fabriken zusammentun, die eine stille Fusion bilden wollen, um die Kapitalmacht zu stärken und die Konkurrenzschlachten besser schlagen zu können. Die Industrie-Vetterschaft hatte es so gewollt.
Frau Frobel beschäftigte sich still weiter. Sie legte einige wichtige Papiere in die Schublade ihres Schreibtisches, verschloss den Kasten wieder und machte sich einige Notizen auf dem Papierblock, damit sie am anderen Vormittage sogleich an diese Dinge erinnert würde. Dann ging sie an den Geldschrank, nahm aus dem Tresor, der die Handkasse enthielt, etwas bare Münze, notierte die Summe auf eine kleine Tafel und verschloss dann Tresor und Schrank mit peinlicher Sorgfalt. Und nachdem sie das Geld einstweilen auf den Schreibtisch gelegt hatte, nahm sie denselben Weg, den ihr Mann vorhin nach dem grossen Kontor genommen hatte. Herold hatte auf ihren Wunsch seine Flamme noch nicht abgedreht, und so konnte sie sich noch rasch davon überzeugen, dass hinten der Letzte gegangen war. Das tat sie an jedem Abend, sobald sie über die Zeit hinaus arbeitete. Als dann auch im Nebenkabinett alles dunkel war, schloss sie die gepolsterte Doppeltür und drehte den Schlüssel zweimal um. An jedem Morgen sorgte hier der herrschaftliche Diener für Ordnung, während in den Kontoren und den sonstigen Räumen das niedere Kontorpersonal diese Arbeit verrichtete.
„Weisst du,“ begann Frobel endlich, „wenn man so sieht, mit welcher Gewissenhaftigkeit du mich hier in allen Dingen vertrittst, — ich könnte fast eifersüchtig auf dein Ansehen werden. Wirklich, das könnte ich.“
Frau Frobel lachte leicht auf. „Vertrittst? Aber, lieber Dietrich! Ich vertrete dich doch nicht, sondern ersetze dich. Vollkommen. Wenn wir allein sind, kann ich’s dir doch sagen.“
Sie sagte es heiter, aber hinter ihren Worten drohte das Grollen darüber, ihr ganzes verpfuschtes Leben an diesen Mann gehängt zu haben, der weder ihrer Seele noch ihrem Körper hatte Befriedigung geben können.
Frobel, der diese kleinen Spitzen bereits kannte, verschluckte seinen Ärger, nahm aber um so lebhafter seinen Weg durch das Zimmer. „Nun ja, nun ja, liebes Tinchen, das weiss ich schon längst“, sagte er dann durchaus würdig. „Du mein Gott, darein habe ich mich schon allmählich gefügt. Muss ich wohl auch! Und je älter ich werde, um so mehr. Denn du bist die Stärkere, — in allen Dingen bist du es. Aber sei mir nicht böse, wenn ich immer wieder daran tippe. Etwas Komisches, wirklich Komisches liegt darin, dich hier als reiche Frau sich abplagen zu sehen, da du es eigentlich gar nicht nötig hast. Da wir es gar nicht nötig haben. Verzeihe, dass ich mich wieder zum Geschäft rechne, aber ich kann’s nun mal nicht lassen. Den Chef hast du mir genommen, aber den Ehrgeiz, siehst du, den Ehrgeiz der grossen Firma kannst du mir nicht nehmen. Und dann kommt die Liebe zu dir hinzu, wahrhaftig, die Liebe zu dir. Du wirst natürlich wieder lachen. Aber deshalb kann ich dieses Gefühl doch nicht unterdrücken, — auch wenn ich von dir beiseite geschoben worden bin.“
„Ach, ich lache ja gar nicht“, warf Frau Frobel zerstreut ein. Sie hatte sich wieder gesetzt und sass nun, den Kopf in die Hand gestützt, wie sinnend da, ungefähr wie jemand, der nur aus Gefälligkeit zuhört, weil er gerade nichts zu versäumen hat.
Und Herr Frobel fuhr eifrig fort: „Und dann der Dank, mein liebes Tinchen, und die Bewunderung, die grosse Bewunderung! Was für eine Zähigkeit hast du, was für eine Ausdauer. Gar nicht zu reden von deiner Intelligenz, von deinem gesunden Weitblick. Wenn ich bedenke, wie schnell du dich in alle Dinge gefunden hast. Die grössten Kaufleute könnten vor dir den Hut ziehen. Und das tun sie ja auch. Kunststück! Du imponierst ja aller Welt. Soll ich mich mal sozial ausdrücken, so muss ich sagen: Du bist die verkörperte Lösung der Frauenfrage, in die höheren Schichten übertragen . . . Manchmal habe ich doch noch gute Gedanken, wie?“ Er lachte kindisch. „Wenn ich auch so halb und halb als Idiot gelte, oder doch als Trottel, meinetwegen auch als lädierter Nachtschmetterling. Lädierter Nachtschmetterling ist gut, wie? Das nebenbei gesagt . . . Aber hör mal, liebes Tinchen, — was wollte ich doch . . . gleich sagen?“
Manchmal verlor Herr Frobel den Faden; dann wurde er gewöhnlich rot, weil er befürchtete, man könnte ihm seine „Minderwertigkeit“ ansehen. Sein Erschrecken dauerte aber nur wenige Augenblicke; dann stolzierte er wieder vor seiner Frau auf und ab, wobei er ausrief: „Richtig, richtig! Das wollte ich sagen: Bist du eine gelernte Buchhalterin? Etwa eine, die aus der Geschäftsdamenwelt hervorgegangen ist? He? Hast du ganz vergessen, dass du eine Brüning bist, eine geborene Brüning? Die nun hier sitzt und sechs Stunden am Tage den Sessel drückt? Mindestens sechs Stunden, liebes Tinchen! Unerhört, unerhört! Und die sich mir dadurch entzieht. Mir, mir!“
Frau Frobel lachte diesmal mit Vergnügen. „Sei doch nicht komisch, lieber Dietrich.“
Herr Frobel liess sich nicht stören. „Ich weiss, ich weiss, es ist das alte Thema, immer das alte Thema. Mir aber bleibt es immer neu . . . Erlaubst du übrigens?“ und als er ihr Nicken gewahrte, holte er seine Zigarrentasche hervor und steckte sich eine von den schweren, torffarbigen an, die ihm eigentlich verboten waren, die er aber den ganzen Tag über und auch noch in den Nachtstunden rauchte, obgleich ihm das Gehirn davon platzen musste, wie seine Frau meinte.
Und als er die ersten Züge tat, kam um so grössere Munterkeit über ihn, wie immer, wenn er den vergnügenwinkenden Abendstunden entgegenging. „Mach doch endlich Schluss mit dieser Geschäftssimpelei. Setz dir einen Vertrauten hin, einen energischen Kerl. Räum Ahlmann deinen Platz ein. Er kennt die Dinge aus dem ff. Schon lange habe ich dich darauf gebracht. Wenn du nur Gründe dagegen hättest, mein liebes Tinchen, Gründe!“
Frau Frobel blieb diesmal ernst. „Gründe? Die habe ich allerdings, mein guter Dietrich. Ich will nicht.“
Sie sagte es so bestimmt, dass ihr Mann ganz verlegen wurde. „So, so, du willst nicht“, sagte er dann wahrhaft betrübt. „Das ist was anderes. Dann allerdings . . .“
Eingeschüchtert stand er da, schwenkte die grosse Zigarre vor seiner Nase und labte sich mit geschlossenen Augen an ihrem scharfen Duft.
„Nein, ich will nicht“, sagte Frau Frobel nochmals mit Nachdruck. „Solange ich gesund und arbeitsfähig bin, werde ich hier das sein, was du hier hättest sein müssen. Werde ich also auch den Sessel des Chefs einnehmen. Das sind meine Gründe. Lass uns also darüber nicht mehr streiten.“
„Nein, nein, es ist wohl auch schon besser“, sagte Herr Frobel nach einer gedankenschweren Pause. „Immerhin, weisst du, sind es eigentlich gar keine Gründe.“
„Aber du hörst es ja, — die Gründe liegen in meinem Willen.“
„Gut, gut, liebes Tinchen. Also Schluss darüber. Ganz und gar. Tout a fait.“
Beide schwiegen eine Weile, bis sich Frobel wieder meldete. „Was sagst du übrigens dazu, dass Emmerich wieder auf der Bildfläche erschienen ist, he? Hat er sich noch nicht bemerkbar gemacht?“
Ernestine, bereits darauf gefasst, erwiderte gleichgültig: „Da liegen sie im Papierkorb — die Logenbilletts.“
Herr Frobel blieb vor dem schön bemalten Kasten aus imitiertem Leder stehen, bückte sich etwas und warf einen gewichtigen Blick hinein. Und um noch sicherer zu gehen, führte er sein Monoele, das er immer lose in der Westentasche trug, dem rechten Auge zu, das nicht die Sehkraft des linken besass, weil es mit der Zeit durch den ewigen Gebrauch der Lupe bei Besichtigung seiner Münzen stark angegriffen war. Dann meckerte er sein Lachen hervor.
„Wahrhaftig, da liegen die roten Dinger, obendrein zerrissen! Ei, ei, das sollte er wissen, dieser kostspielige Schützling von einst.“
„I—a, das sollte er wissen“, sagte Frau Ernestine gedehnt, während sie einen Blick in die Zeitung warf, um ihre Gleichgültigkeit noch mehr zu bestätigen. Nicht aber konnte sie ihre innere Erregung bemeistern, denn ihre Brust ging stärker als zuvor. Eigentlich hätte sie lachen mögen über die Zumutung ihres einstigen Freundes, sich ihm dicht unter seiner Nase am Orchester zu präsentieren, damit er jede Regung in ihrem Gesicht verfolgen könne und sich sagen dürfe: Sie ist hier, sie hat noch Interesse für mich, sie hat mich noch nicht ganz vergessen . . . Das war einmal. Heute lag ein Abgrund zwischen ihnen, vor dem sie zurückschreckte, denn aus der Tiefe stiegen ekle Dünste empor, die er durch sein schmieriges Verhalten bereitet hatte. Und wenn sie doch noch Neigung zeigte, ihn einmal zu sehen, unbemerkt von ihm, — so folgte sie nur der Neugierde, nur ihr allein.
„Also ists diesmal nichts mit dem Sprichwort: Alte Liebe rostet nicht“, sagte Herr Frobel wieder, durchaus gemütlich. Früher, vor Jahren, als Emmerich noch nicht der tote Mann und ihr Interesse für ihn noch reger war, hatte er sie öfter damit geneckt, und nun erfasste ihn wieder der Spass dazu.
Ernestine warf die Lippen auf. „Nein, damit ist nichts mehr, mein Bester.“ Unaufhörlich überflog sie die Abendzeitung, als interessiere sie diese Unterhaltung nur so nebenbei.
„Er hat sich eigentlich auch nicht danach benommen“, sagte Frobel wieder, blieb dann stehen und bemühte sich, einige wohlgelungene Rauchringe aus seinem Munde zu stossen. Und als er von diesem Spiel genug hatte, trabte er wieder durchs Zimmer und fuhr fort: „Weisst du, liebes Tinchen, wenn du schon keine Lust hast, — ich möchte mir den alten Wunderknaben doch noch mal ansehen, oder eigentlich anhören. Na, beides zusammen. Bin sehr neugierig auf diese Ruine. Willst du?“
„Vergeude doch deine Zeit nicht“, fiel ihm Ernestine ins Wort.
Und ihr Gatte ging sogleich darauf ein. „Eigentlich hast du recht. Man ärgert sich dann noch über sein Geld. Schon genug, dass er uns immer noch in der Tasche liegt. Dir wenigstens. Entschuldige, entschuldige . . . Man liest es ja nachher auch in den Blättern. Wenn er uns nur keinen Besuch macht . . .“
„Er wird doch nicht“, sagte Frau Frobel mit demselben Gleichmut, aber sie bewegte sich unruhig auf dem Sessel. Noch weniger als zuvor las sie jetzt, denn er hatte plötzlich etwas berührt, woran sie schon mit Schrecken gedacht hatte.
„Als was tritt er doch gleich auf? Soeben habe ich es noch gewusst“, sagte Herr Frobel wieder, blieb aufs neue stehen und sann nach.
„Interessiert mich gar nicht, lieber Dietrich.“
Herr Frobel gab sich auch keine Mühe mehr, und da es ihm diesmal wirklich schwer wurde, sein Gedächtnis zusammenzusuchen, so liess er die Kapsel seiner goldenen Uhr springen, tat nun ungemein eilig und verabschiedete sich von seiner Frau, indem er wiederum galant ihre Hand an seine Lippen zog. Dann stolzierte er von dannen. Er hatte aber kaum die Tür hinter sich, als er den Kopf wieder hereinsteckte, denn sein Gedächtnis war ihm inzwischen gekommen.
„Du, ich hab’s jetzt“, rief er ihr zu. „Er singt den Herzog in Rigoletto. War mal seine Glanzrolle im Opernhaus, weisst du noch? Den wird er jetzt hübsch verzapfen . . . Nochmals gute Nacht. Bon soir.“
Dann klappte die Tür wieder.
III
Frau Frobel hatte das Zeitungsblatt sinken lassen und sass nun unbeweglich da, die Hände im Schoss gefaltet, den Blick verloren vor sich gerichtet auf irgend etwas, was sie sah und wieder nicht sah, weil ihre Augen weiter gingen: über die ganze Umgebung hinweg, hinein ins Reich der geistigen Vorstellungen. Kaum hatte sie noch ihres Mannes letzte Worte gehört. Der Harmlose! Wenn er wüsste, weshalb sie diesen Platz hier niemals aufgeben wollte, diesen Sitz im Zimmer, an den alles herantreten musste, was sie berührte; wenn er auch nur ahnte, dass die Furcht sie hier zur täglichen Wache trieb, die Furcht eines ewig zitternden Weibes bei dem zehrenden Gedanken an die geheime Schmach ihres Lebens!
Die stattliche Frau Frobel stöhnte auf, erhob sich und ging mit gesenktem Haupt träge durchs Zimmer. Und während sie diesen Gang machte, sah sie wieder den Abend vor zehn Jahren, wo Emmerich hier vor ihr stand und sie mit versteckten Anspielungen an ihren Sündengang erinnerte, und zwar — es wurde ihr nur zu klar — nur zum Vorteil seines Beutels. Damals hatten diese üblen Gewohnheiten begonnen, und was andere für unbegreifliche Wohltaten hielten, war nur ein Blutopfer, das sie brachte, dem Zwange folgend, nicht dem eigenen Willen. Und sie sah ihn wieder gehen, gleich einem liebenswürdigen Schuft, der in seinem Vorgehen nichts Besonderes fand, vielmehr nur sein persönliches Recht darin erblickte, von ferne mitzugeniessen an einem glänzenden Leben, das ihm versagt bleiben sollte, trotzdem er es hatte mit versüssen helfen. Und sie sah sich danach wie zusammengebrochen auf den Stuhl sinken und hörte sich heisse Tränen weinen, die stillen, heissen Tränen einer doppelt betrogenen, tief verkannten Frau.