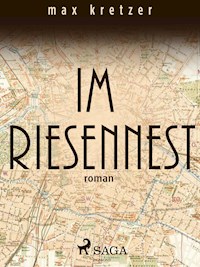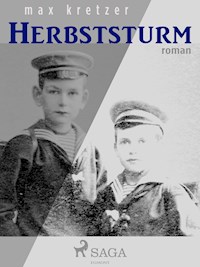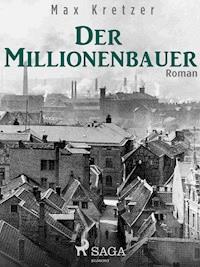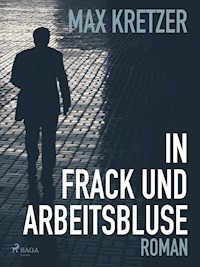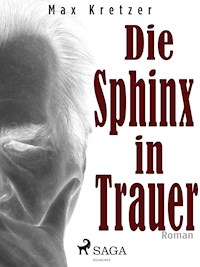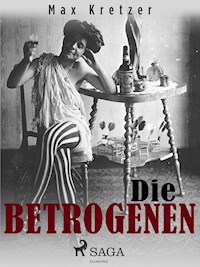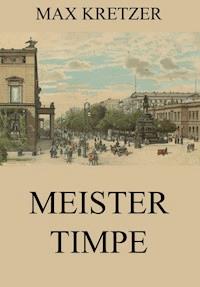
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kretzers autobiografischer Roman beschreibt den Existenzkampf seiner eigenen Familie anhand des Handwerkmeisters Timpe, der sich immer mehr den Fabriken und dem Kapitalismus erwehren muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meister Timpe
Max Kretzer
Inhalt:
Max Kretzer – Biografie und Bibliografie
Meister Timpe
I. Frühmorgens, wenn die Hähne krähn –
II. Drei Generationen
III. Die Nachbarschaft
IV. Das Loch in der Mauer
V. Fräulein Emma
VI. Franzens-Ruh
VII. Große Toilette
VIII. »Erst mein Chef, dann ich«
IX. Franz bekennt Farbe
X. Im Kampfe des Jahrhunderts
XI. Schlimmer Verdacht
XII. Ein entarteter Sohn
XIII. Timpes Versuchung
XIV. Verzweiflungskampf
XV. »Schlaf wohl, Alte«
XVI. Innen- und Außenwelt
XVII. Der neue Heiland
XVIII. Der Meister predigt Aufruhr
XIX. Unter Trümmern
Meister Timpe, Max Kretzer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849629939
www.jazzybee-verlag.de
Max Kretzer – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geb. 7. Juni 1854 in Posen, verstorben am 15. Juli 1941 in Berlin. Kam früh nach Berlin, wo er auf autodidaktischem Wege seine Bildung erwarb und mit den Romanen und Erzählungen: »Die beiden Genossen« (Berl. 1880; 4. Aufl., Leipz. 1901), »Sonderbare Schwärmer« (Berl. 1881, 2 Bde., u. ö.), »Die Betrogenen« (das. 1882, 2 Bde.; 5. Aufl., Leipz. 1901), »Die Verkommenen« (Dresd. 1883, 2 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1900), »Berliner Novellen und Sittenbilder« (Jena 1883, 2 Bde.) ein entschiedenes Talent für Schilderung des Volkes, aber auch die Neigung zu greller Übertreibung der Sittenschilderung bekundete. Schon die Erzählungen: »Im Riesennest« (Leipz. 1886, 2. Aufl. 1895) und »Im Sündenbabel« (das. 1886), namentlich aber die Romane: »Meister Timpe« (Berl. 1888; 3. Aufl., Leipz. 1901), »Ein verschlossener Mensch« (Leipz. 1888, 2 Bde.; 2. Aufl. 1900) und »Die Bergpredigt« (Dresd. 1890, 2 Bde.; 4. Aufl., Leipz. 1901) zeigten eine bedeutende Klärung und einen innern Fortschritt Kretzers, doch trat auch seine sozialistische Tendenz schärfer hervor. Ferner erschienen von ihm die Romane: »Der Millionenbauer« (Leipz. 1891, 2 Bde.; 2. Aufl. 1896), »Onkel Fifi« (Berl. 1891, 2. Aufl. 1897), »Irrlichter und Gespenster« (Weim. 1892, 3 Bde.), »Die Buchhalterin« (Dresd 1894; kt. Aufl., Leipz. 1901), »Die gute Tochter« (Dresd. 1895; 2. Aufl., Leipz. 1901), »Das Gesicht Christi« (Dresd. 1897), »Verbundene Augen« (Berl. 1899, 2 Bde.), »Der Holzhändler« (das. 1900, 2 Bde.), »Warum?« (Dresd. 1900), »Die Madonna vom Grunewald« (Leipz. 1901), »Die Sphinx in Trauer« (Berl. 1903), »Treibende Kräfte« (das. 1903), »Familiensklaven« (das. 1904); die Novellen: »Das bunte Buch« (Dresd. 1889), »Ein Unberühmter und andre Geschichten« (das. 1895), »Frau von Mitleid und andre Novellen« (Berl. 1896), »Die Blinde. Maler Ulrich« (2. Aufl., Dresd. 1897), »Furcht vor dem Heim und andre Novellen« (Berl. 1897); »Das Rätsel des Todes und andre Geschichten« (Leipz. 1901) u. a. Auch schrieb K. mehrere Schauspiele: »Bürgerlicher Tod« (Dresd. 1888), »Der Millionenbauer« (Leipz. 1891, Bearbeitung seines Romans), »Der Sohn der Frau« (Dresd. 1899), »Die Verderberin« (Berl. 1900) sowie das Possenspiel »Die Kunst zu heiraten« (das. 1900) und die fünfaktige Märchendichtung »Der wandernde Taler« (Leipz. 1902). Vgl. Kloß, Max K. (Dresd. 1895).
Meister Timpe
I. Frühmorgens, wenn die Hähne krähn –
Berlin schlief noch, aber es lag in jenem leisen Schlummer, der dem Erwachen vorhergeht. Eingelullt in süße Träume, ahnte es nichts von den Sorgen und Kämpfen des kommenden Tages, von dem unerwarteten Glück, den zermalmenden Schlägen des Schicksals. Nur an einzelnen Stellen stieß der tausendköpfige Koloß seinen Atem aus. Dunkler, zu gewaltigen Ringen geballter Qualm entstieg, von Feuergarben begleitet, den geschwärzten Schloten; wie der Gigantenlunge eines unsichtbaren Ungeheuers entstoßen, strömte er dem graublauen Äther zu, verwob er sich allmählich mit der Dunstwolke, die den Horizont noch verschleierte.
Es war zwischen drei und vier Uhr an einem der letzten Tage des Monats April – in jener Stunde, wo die Straßen plötzlich menschenleer erscheinen, als hätte selbst der letzte Kneipenschwärmer das Bedürfnis gefühlt, noch vor dem jähen Wechsel von Nacht und Tag im Schutze des Dunkels sein Heim zu erreichen. Hinter dem äußersten Häuserring tauchte der erste fahle Schein der Morgendämmerung auf, der wie das geisterhaft bleiche Antlitz eines Riesen aus dem Dunkel sich erhob und immer höher und höher stieg. Die Häuser erschienen wie bleigetränkt, die Perspektive der Straßen verkürzte sich: Berlin glich einer toten Stadt, in der jeder Tritt, jedes leise Geräusch ein Echo abgibt, das weit vernehmbar die Luft durchzittert.
In diesem Zwielicht taumelte Franz Timpe durch die Straßen, dem Hause seines Vaters zu, um Ruhe für seinen schweren Kopf zu suchen. Die Augen fielen ihm fast zu, sein Gang war unsicher, so daß er sich mit Gewalt beherrschen mußte, um auf den Beinen zu bleiben. Auf dem jugendlichen, nicht unschönen Antlitz zeigten sich die Spuren einer durchzechten Nacht: jene Merkmale der Überanstrengung, welche ein schwacher Körper noch nicht zu überwinden vermag. In der eigentümlichen Beleuchtung des heranbrechenden Morgens, hervorgerufen durch den Kampf der letzten Schatten der Nacht mit dem grüngelben Luftschein am Horizont, erschien sein Gesicht fahl und grau, hatte es harte, ausdruckslose Linien angenommen. Den Paletot lose um die Schultern gehängt, den Hut in den Nacken gerückt, das Pincenez schief auf die Nase geklemmt, fuchtelte er mit dem dünnen Spazierstöckchen in der Luft herum, versuchte er jedem Laternenpfahl seine Fechterkünste zu beweisen.
In seiner Phantasie standen die Häuser schief, machten sie einen fremdartigen Eindruck auf ihn, trotzdem ihm jedes einzelne durch die Firmenschilder, die an ihm klebten, die Eigentümlichkeiten, die ihm anhafteten, genau bekannt war. In diesem Stadtviertel war er geboren, hatte er die Tage seiner Kindheit verlebt, war er zum Knaben und zum Jüngling gereift. Selbst jetzt, wo das Fehlen der flutenden Menge und rasselnden Wagen, die herabgelassenen Rouleaus und geschlossenen Jalousien den Gebäuden eine veränderte Physiognomie gaben, waren ihre Absonderlichkeiten seinem Gedächtnisse eingeprägt, denn es war nicht das erste Mal, daß er spät nach Mitternacht an ihnen vorüberschritt. Seit beinahe einem halben Jahre, seitdem ihn der Weg von der Schule direkt ins Comptoir der Firma Ferdinand Friedrich Urban geführt hatte, war fast keine Nacht vergangen, während welcher er nicht das nächtliche Leben Berlins durchkostet hatte.
Die frische Morgenluft wirkte endlich wohltuend auf ihn ein. Seine Haltung wurde sicherer, sein Gedankengang klarer, nur die Müdigkeit wollte nicht von ihm weichen. Um sich munter zu erhalten, begann er halblaut ein Lied zu summen, das er aber wieder abbrach, weil die Kehle ihren Dienst versagte.
Er befand sich in jenem Gewirr enger Straßen des Ostens von Berlin, die sich wie ein Überbleibsel aus alter Zeit bis heute noch erhalten haben. Altehrwürdige Giebeldächer mit Mansardenfenstern blickten auf ihn herab. Unregelmäßig standen die Gebäude am schmalen Trottoir, hier eines von schiefer Haltung, wie von der Last der Jahre vornübergebeugt, dort eines weit hinter die Front gerückt, geziert mit einem kleinen Vorgarten, dessen Efeu die schmalen Fenster umrankte und bis zum Dache hinauflief. Nur vereinzelt überragte ein vierstöckiger Steinkasten, wie ein schlank gewachsener Jüngling zusammengeschrumpfte Greise, die vorväterlichen Wohnstätten, um, einem stummen Wahrzeichen gleich, den Segen der neuen Zeit zu verkünden. In der Stille dieses patriarchalischen Viertels vernahm man weiter nichts als die schallenden Schritte des jungen Mannes und das schrille Pfeifen eines Bäckerjungen, das wie die ersten Mißtöne des erwachenden Tages aus der Entfernung herüberklang.
Als Franz Timpe um die nächste Ecke bog, erblickte er endlich das Haus seines Vaters. Wie von Angst und Reue erfüllt, bannte er seine Schritte und drückte sich an die Häuser. Er befürchtete, gesehen zu werden, und schämte sich seines Nachhausekommens um diese Stunde. Beim Weiterschreiten richtete er den zaghaften Blick auf die gegenüberliegenden Fenster, hinter welchen noch friedliche Ruhe herrschte; dann rechts und links die Straße entlang. Er versuchte den Nachtwächter zu erspähen, der ihm wie gewöhnlich das Haus öffnen sollte.
Krusemeyer, ein bereits alter Beamter, dessen kugelrundes Gesicht von einer silbergrauen Bartfraise umrahmt wurde, hatte auf ihn gewartet. Er stand mit einem Schutzmann plaudernd unter dem Torbogen eines neuen Gebäudes auf der anderen Seite der Straße und beobachtete das Näherkommen des jungen Mannes. Seit fünfzehn Jahren verschloß er die Häuser in diesem Revier, konnte sich aber nicht entsinnen, jemals einen besseren Kunden gehabt zu haben, als Franz Timpe es war. Er hielt sich daher mit Vorliebe in diesem Teile der Straße auf, um sich das übliche Zehnpfennigstück nicht entgehen zu lassen. Der Länge der Zeit, während welcher er hier seinem nächtlichen Berufe obgelegen, hatte er es zu verdanken, daß er mit den Geheimnissen der Hausbewohner vertraut war, ihre Tugenden und Sünden, Freuden und Leiden kannte. Wenn er hätte sprechen dürfen, was würde man da vernommen haben! Vormittags holte er den verlorenen Schlaf der Nacht nach. Nachmittags betrieb er sein Geschäft als Flickschuster, bis die Zeit zum Abendappell ihn rief. Auf den einsamen Gängen durch die dunklen Straßen hatte sich mit der Zeit ein Philosoph aus ihm gebildet, der, in des Wortes bester Bedeutung, sein Licht nur im dunkeln leuchten ließ. Und da ein Philosoph mindestens einen vertrauten Abnehmer seiner Ideen haben muß, so hatte sich denn auch im Laufe der Jahre ein solcher in einem gleichaltrigen, bereits mit einer stattlichen Zahl Dienstjahre befrachteten Schutzmann des Reviers gefunden, welcher den seltenen und merkwürdigen Namen Liebegott führte.
Herr Alexander Liebegott erfreute sich eines behäbigen Körperumfanges, der den Neid seiner sämtlichen Kollegen und die Freude aller derjenigen zweifelhaften Individuen bildete, welche in nächtlicher Stunde auf der Flucht vor ihm begriffen waren und denen er niemals auf den Fersen zu bleiben vermochte. Auf den Schultern ruhte ein Riesenkopf, in dessen kürbisfarbenem Gesichte eine etwas groß geratene Nase in sanftestem Violett erstrahlte und ein mächtiger Schnurrbart traurig seine ungedrehten Spitzen hängen ließ, so daß das würdige Antlitz dem eines Seelöwen glich. Krusemeyer und Liebegott waren, soweit die Gelegenheit sich darbot, auf ihren nächtlichen Gängen ein unzertrennliches Paar, dessen Hang zu philosophischen, höchst sonderbaren Gesprächen ebenso groß war wie die uneigennützige Freundschaft zueinander und die Liebe zu gewissen alkoholduftenden »Erheiterungstropfen«, die in kalten Winternächten dazu dienen mußten, das Gespräch über die großen Vorgänge dieser Welt zu gleicher Zeit mit der Wachsamkeit anzufeuern. Im übrigen waren sie zwei pflichtgetreue Beamte, welche die Achtung ihrer Vorgesetzten genossen und beim Publikum allgemein beliebt waren. Die Autorität, die sie in den Augen ihrer Kollegen besaßen, war bereits eine derartige, daß ein Streit unter ihnen mit den vielbedeutenden Schlußworten: »So sagt Krusemeyer«, oder: »So sagt Liebegott«, zugunsten des diese Behauptung Aufstellenden als beendet betrachtet werden durfte.
Wenn die Ansichten der beiden zeitweilig auseinandergingen, so geschah es über die Frage nach dem höchsten Ziele ihrer Wünsche. Liebegott hegte nur den einen Wunsch: während seines nächtlichen Dienstes von niemandem belästigt zu werden, um seine teure Haut nicht zu Markte tragen zu brauchen; Krusemeyers höchster Wunsch ging dahin: durch eine seltene Heldentat sich diejenigen Lorbeeren zu erwerben, die unbedingt nötig waren, um seine soziale Stellung nach Kräften aufzubessern. Er hatte es besonders auf nächtliche Einbrüche abgesehen, lebte daher in der Einbildung, eines Nachts irgendeinen Juwelier oder einen reichen Fabrikanten durch seine Aufmerksamkeit vor einem Verlust bewahren zu können, wodurch ihm dann eine reichliche Belohnung zuteil werden würde; ganz abgesehen von der amtlichen Belobung und Auszeichnung, die zu erwarten waren. Seine Phantasie hatte sich während der Jahre so sehr mit dieser dereinstigen Heldentat beschäftigt, daß sein Spürsinn in jedem einigermaßen verdächtig aussehenden Passanten jene gefährliche Person witterte, deren verbrecherisches Treiben ihn endlich zum Helden seiner Umgebung machen sollte. Da er obendrein ein arger Bücherwurm war, der die geringe freie Zeit, die ihm am Tage während der Pausen beim Essen zur Verfügung stand, redlich dazu benutzte, abenteuerliche Romane zu lesen, in denen das Verbrechertum eine Hauptrolle spielte, so war sein Kopf mit den Erinnerungen an allerlei grausige Dinge erfüllt, die in einsamen Nachtstunden erst recht ihre Wirkung taten.
»Ich erreiche es doch noch«, sagte er mit Bezug auf die größte Zukunftstat seines Lebens.
Liebegott schüttelte das schwere Haupt und erwiderte:
»Ich glaube es nicht. Hier in dieser Gegend, wo jeder darauf wartet, daß man ihm etwas ins Haus trage! Laß den Gedanken daran fallen. Und bedenke nur: Wenn der Kerl ausrückt und du laufen müßtest, verstehst du? Ich sage laufen – –«
Alexander Liebegott beendete den Satz nicht. Es war ihm schon entsetzlich genug, nur an die Möglichkeit einer schnellen Fortbewegung zu denken. Er starrte vielmehr vor sich hin, lächelte dann im Gefühle seiner Sicherheit und klopfte leise mit der flachen Hand auf den wohlgenährten Bauch, während Krusemeyer listig die Augen zusammenkniff und sagte: »He, he, dann rufe ich dich, du fängst ihn gewiß.«
»Keine Anspielung«, brummte Liebegott mit komischem Ernst.
Die Annäherung Franz Timpes gab dem Gespräch eine andere Wendung. Das laute Krähen eines Hahnes ließ sich in der Nachbarschaft vernehmen. Aus der Ferne klang schwach die Antwort eines zweiten und dritten herüber.
»Recht so, melde dich, alter Junge«, begann Krusemeyer wieder. »Die Stunde muß angezeigt werden, in welcher der hoffnungsvolle Sohn nach Hause kommt ... Sage mal, Liebegott, hast du es auch so in deiner Jugend getrieben, he?«
»Wäre so etwas gewesen, Krusemeyer! Birke und Weide hätten einen Walzer auf meinem Buckel aufgeführt, und mein Alter wäre der Tanzmeister gewesen, der die Hände dabei bewegt hätte«, erwiderte der Angeredete mit unterdrücktem Lachen.
»Meister Timpe muß einen Narren an seinem Jungen gefressen haben, daß er so etwas duldet; aber das machen die Kneipmädels, die den Bengels die Köpfe verdrehen und das Geld aus der Tasche ziehen«, philosophierte Krusemeyer, als er sich anschickte, dem Rufe des jungen Mannes Folge zu leisten. Bevor er über den Damm ging, wandte er sich noch einmal an den Genossen.
»Hörst du nichts, Liebegott? Mir war's, als knarrte hier hinter uns eine Tür. Sollte vielleicht ein Dieb –«
»Beruhige dich nur, es ist nichts. Du wirst es nicht erreichen, verlaß dich darauf«, erwiderte Liebegott und schritt dann bedächtig die Straße nach der anderen Seite hinunter, um seinen Genossen an der nächsten Ecke zu erwarten.
Das Schlüsselbund des Wächters knarrte, die schwere Tür drehte sich in ihren Angeln und schloß sich dann leise hinter Franz Timpe, der horchend stehenblieb. Im Hause war noch alles ruhig. Durch die geöffnete Hoftür fiel ein fahler Schein auf die roten Steinfliesen des Flurs, der sich schmal und lang, gleich einer Kegelbahn, durch das altertümliche Haus zog. Links befand sich die Werkstatt des Vaters, rechts die Wohnung der Eltern. Auf dieser Seite führte eine schmale, gebrechliche Stiege zum einzigen Stockwerk des Hauses empor, in dem zwei kleine, bewohnbare Stuben sich befanden. In der einen schlief Franz, in der anderen Gottfried Timpe, der Großvater.
Der Großvater! Bei dem Gedanken an ihn erzitterte der junge Mann, denn der Greis pflegte mit den Hühnern aufzustehen, war begabt mit einem wunderbar feinen Gehör und der einzige Feind, den er im Hause besaß.
Franz Timpe lauschte noch eine Weile, dann zog er behutsam die Stiefel von den Füßen und schlich mit angehaltenem Atem die leise ächzende Treppe empor. Oben angelangt, tappte er die Wand entlang, denn hier herrschte noch völliges Dunkel. Er mußte bei der Tür des Großvaters vorüber, um zu der seinigen zu gelangen. Lautlose Stille umgab ihn. Er atmete auf. Als er aber in seinem Zimmer angelangt war, vernahm er durch die dünne Wand deutlich das laute Husten des Großvaters: die ihm längst bekannte Begrüßung, welche in aller Frühe zu ertönen pflegte, als ein Zeichen, daß der steinalte Mann das Nachhausekommen seines Enkels gehört habe.
Franz Timpe preßte vor Ärger die Lippen fest aufeinander; dann suchte er totmüde sein Lager auf, um sich während einiger Stunden für den kommenden Tag zu stärken. Durch das dünne Rouleau drang das Licht des immer mehr heraufziehenden Morgens gedämpft herein und ließ in dem Halbdunkel nur das bleiche Gesicht des Schläfers leuchten.
II. Drei Generationen
»Ja, ja, das waren noch andere Zeiten ... damals! Das Handwerk hatte einen goldenen Boden und wurde geehrt. Voll Stolz band man sich frühmorgens die Schürze vor und schämte sich nicht der Arbeit der Eltern. Aber das scheint sich geändert zu haben, seitdem ich nicht mehr sehen kann. Heute will so ein Grünschnabel von Junge den großen Herrn spielen, mit gefüllter Tasche und weißen Händen umherlaufen und klüger als wir Alten sein ... Aber die Zuchtrute fehlt, die Zuchtrute – das ist meine Rede!«
Auf diese wohlgemeinten Worte Gottfried Timpes, die sich seit einem Jahrzehnt täglich zu wiederholen pflegten, blieb Johannes Timpe gewöhnlich die Antwort schuldig, sobald es sich um die Anklage gegen sein einziges Kind, seinen Sohn, handelte. Aber sein Blick voll Liebe richtete sich mit dem Ausdrucke tiefsten Mitleids nach dem Fenster auf die hinfällige Gestalt des dreiundachtzigjährigen Greises, der seit einem Jahrzehnt ein Dasein in ewiger Nacht führte und in der Welt des vergangenen Jahrhunderts lebte, die seine Erinnerung ihm vor das geistige Auge zauberte.
Ja, der Großpapa, sein Zorn über die Neuerungen! Es war schwer, sich beiden zu widersetzen, denn man ehrt die Ruine, der man seine Existenz zu verdanken hat, und betrachtet ihre Absonderlichkeiten wie etwas Heiliges, Überliefertes. Und Johannes Timpe hatte seinem Vater alles zu verdanken: seine Kunstfertigkeit als Drechsler, die Zähigkeit und Ausdauer, die man ihm nachrühmte, und auch dieses kleine, unscheinbare Haus, in dem er geboren und erzogen worden war. Schon sein Äußeres verriet die längst vergangene Epoche, in der es entstanden war. Über den vier Fenstern des Parterregeschosses zeigten sich, in Stein gehauen, geflügelte Engelsköpfe, von denen nur zwei noch völlig erhalten waren, während von je einem der anderen Nase und Flügel fehlten.
Die drei ausgetretenen Steinstufen führten zu der bohlenartigen, mit großen Nägelköpfen gezierten Tür, über welcher reliefartig das Sinnbild des Drechsler- und Kunstdrechslergewerbes prangte: ein Taster, auf dem über Kreuz Meißel und Röhre lagen; darunter eine Kugel, flankiert von zwei Schachfiguren.
Was dem Hause als ein besonderes Merkmal anhaftete, war seine außergewöhnliche Lage. Es stand mit der Front schräg hinter der Straße, so daß vor seinen Fenstern zwischen der Flucht des Trottoirs und der Seitenwand des Nachbarhauses ein spitzwinkliger Vorderhof entstanden war, der von der Straße durch ein Holzgitter getrennt wurde. Dieser absonderliche Umstand hatte auch an der Schmalseite des Gebäudes, an deren äußerster Ecke das andere Nachbarhaus hervorragte, einen zweiten, kleineren Winkel geschaffen, der durch eine Bretterwand bis zur Höhe des Giebelfensters den Blicken verdeckt wurde. Man hätte das ganze Häuschen wie einen steinernen, nach Fertigstellung der Straße in dieselbe hineingetriebenen Keil betrachten können, wenn nicht sein Alter dem widersprochen haben würde. In Wahrheit war es bereits vorhanden gewesen, als vor einem halben Jahrhundert die Notwendigkeit zur Anlage einer Straße an dieser Stelle sich geltend gemacht hatte und man das Häuschen rechts und links zu umbauen begann, weil sein bisheriger Besitzer, Ulrich Gottfried Timpe, nicht die geringste Neigung zeigte, seine Rechte zu veräußern.
Wenn der Großvater seine ewigen Rückblicke mit den Worten einleitete: »Ja, ja, das waren noch andere Zeiten ... damals!« – so sprach er das in der Erinnerung an jene Jahre, wo das Häuschen hier noch wie ein einsamer Vorposten an der Peripherie der Stadt lag und den Blicken seiner Bewohner die weitmöglichste Aussicht über freie Felder und über das Bett der Spree gestattete.
Als Ulrich Gottfried Timpe im Jahre 1820 vermöge eines kleinen Kapitals, das sein Vater, der Kunstdrechsler Franz David Timpe, ihm hinterlassen, sich hier angebaut hatte, war von dem großen Stadtteile, der sich heute von der Frankfurter Straße bis zur Spree hinzieht, noch wenig zu sehen. Vereinzelt standen die Häuser zwischen Gärten, Baustellen und Getreidefeldern. Selbst innerhalb der Stadtmauern zeigten sich lange Strecken öder Felder, unterbrochen bis zu den Toren durch Königliche Magazine, durch ein riesiges Familienhaus, das dazu bestimmt war, armen Handwerkerfamilien ein billiges Obdach zu gewähren, und hin und wieder durch eine der vielen Gärtnereien, deren blühende Obst- und Blumenanlagen das damalige Köpnicker Feld, auf dem heute ein Meer von Häusern sich erhebt, zu einem eigentlichen Fruchtfeld gestaltet hatte. Die Straßen glichen ländlichen Fahrwegen, auf denen man hin und wieder tief im Sande versank; und die ein- und zweistöckigen Häuser, welche sich mit der Zeit zu Straßenzügen aneinandergekettet hatten, waren zum größten Teil von armen Handwerkern bevölkert, die notdürftig ihr Dasein fristeten. Untergeordnete Gasthöfe und unansehnliche Wirtschaften tauchten überall auf, und die mangelhafte Verbindung mit dem Zentrum der Stadt, die vereinzelt stehenden Häuser auf freiem Felde hatten ein höchst zweifelhaftes Gesindel geschaffen, das in Spelunken aller Art seine Zufluchtsstätte fand, die Sicherheit bedrohte und die Gegend in einen argen Ruf brachte.
Und trotzdem lobte Ulrich Gottfried Timpe die alte Zeit, denn inmitten von Armut und Elend, die damals ebenso vorhanden waren wie heute und die ganze ungeheure Hälfte Berlins, die sich von dem Schlesischen bis zum Rosenthaler Tor hinzog, bevölkerten, hatte sein Handwerk geblüht, wurde es in Ehren gehalten, galt die Schlichtheit des Mannes noch etwas, bestrebte sich nicht der Sohn des Meisters das Arbeitsgewand des Vaters zu verachten, um über seine Verhältnisse hinaus zu wollen. Allerdings wußte man auch damals noch nichts (nach der Ansicht Ulrich Gottfried Timpes!) von einer gewissen Affenliebe, mit denen die Eltern ihre Kinder beglücken, um dieselben eines Tages über ihre eigenen Köpfe wachsen zu sehen.
Gewiß, die Affenliebe! Johannes Timpe hätte über den Gebrauch dieses Wortes von seiten des erblindeten Greises ein Liedchen singen können; denn der, dem die übertriebenen elterlichen Zärtlichkeiten galten, war Franz, sein und seines Weibes einziger Stolz.
Der heutige Besitzer des kleinen Hauses hatte erst spät geheiratet. Nachdem seine zwei Brüder, die ebenfalls in der Werkstatt des Vaters tätig gewesen waren, das Zeitliche gesegnet hatten und seine Stellung im Hause eine völlig andere geworden, war der Entschluß in ihm gereift, seine langjährige Braut heimzuführen. Als das geschah, zählte er bereits sechsunddreißig Jahre. Sein erstes Kind war ein Mädchen gewesen, das aber gleich nach der Geburt gestorben war. Dann war sein Sohn gekommen und nach diesem abermals ein Mädchen, welches das zehnte Jahr erreicht hatte und dann ebenfalls den Eltern entrissen wurde. Der Schmerz Johannes Timpes und seiner getreuen Gattin war ein unaussprechlicher gewesen. Als sie aber sahen, wie ihr Sohn zu einem hübschen Knaben heranwuchs und vortrefflich gedieh, faßten sie sich allmählich und übertrugen die Liebe, die sie für die blühende Tochter an den Tag gelegt hatten, auf ihn allein. Sie übersahen seine Schwächen, die sich im Hange zu allerlei Unarten, zum Verleugnen der Wahrheitsliebe, zur Ränkesüchtelei und zur Trägheit ausprägten; trösteten sich mit der Selbstlüge, daß dieser böse Keim sich dereinst beim Emporschießen in die Frucht verlieren werde. War Franz doch ihr Stolz, der Träger des Namens seines Vaters, die Verwirklichung ihrer ganzen Zukunftspläne!
»Handwerker darf der Junge nicht werden, er soll sich sein Brot leichter verdienen«, pflegte Johannes Timpe in den Stunden nach Feierabend zu Frau Karolinen zu sagen. Und die getreue Ehehälfte ließ die klappernden Stricknadeln auf ein paar Augenblicke ruhen, blickte im Zwielicht sinnend auf den kleinen Winkel vor dem Fenster hinaus und erwiderte stolz beseelt: »In dem Jungen steckt etwas, der muß was Großes werden.«
Diese elterlichen Träume hatten bereits begonnen, als Franz anfing, die Schule zu besuchen, der Großvater nach dem Heimgange seiner Frau über mangelndes Sehlicht klagte und Haus und Geschäft ganz in die Hände seines Sohnes legte. Und als eines Tages dem Alten durch eine Entzündung seiner Augen das Sehvermögen gänzlich entschwunden, er ganz und gar auf die liebende Pflege Johannes und Karolinens angewiesen war, ein Leben aus sich heraus führte und nur noch mit seiner Erinnerung an die alte Zeit und mit seinen Ratschlägen nützen konnte; als Johannes Timpe der Werkstätte ganz allein vorstand, er das Schicksal seines Vaters tagtäglich vor Augen hatte – wurde um so mehr der Wunsch in ihm rege, seinem einzigen Kinde Erziehung und Bildung zuteil werden zu lassen, die ihm die Fähigkeiten zu geben vermöchten, eine bessere soziale Stellung einzunehmen und sich mit weniger saurem Schweiß durchs Leben zu schlagen.
»Er soll Kaufmann werden«, hatte er dann eines Tages mit einer Bestimmtheit gesagt, an welcher nichts mehr zu ändern war. Und mit diesem Ausspruch verbanden sich merkwürdige Ideen, die in innigstem Zusammenhange mit seinem Gewerbe standen. Er hatte acht Gesellen in seiner Werkstatt, die Drehbänke standen selten still, um Aufträge war er niemals verlegen, sein Wohlstand schien nach und nach zu reifen, seitdem der industrielle Aufschwung im Viertel immer größer wurde; ein kleines Kapital war zur Reserve angelegt worden – weshalb sollte er also nicht darauf sinnen, aus einem Handwerker zum Handeltreibenden zu werden, seine Beziehungen zu erweitern und auf eigene Faust zu spekulieren? Dazu bedurfte er eines gewiegten Beraters, den er dereinst in seinem Sohn zu erblicken gedachte.
Als Johannes Timpe in der Dämmerung eines Wintertages, wie gewöhnlich mit Frau Karoline am Fenster des Wohnzimmers sitzend, die Zukunft seines Sohnes festgestellt hatte, war auch sofort der Widerspruch bemerkbar geworden.
»Kaufmann ist Laufmann«, hatte die Stimme des Großvaters sich vernehmen lassen. »Mach den Jungen zu einem ordentlichen Handwerker, erziehe ihn zu harter Arbeit, dann wird er auch stets sein Brot finden und euch nicht über die Köpfe wachsen. Ich will euch nicht wehe tun, aber der Junge hat schlechte Seiten. Und was ein Häkchen werden will, das krümmt sich beizeiten.«
Damals bereits war das harte Wort von der Zuchtrute gefallen, das sich wie eine ewige Mahnung aus dem Munde des Alten Jahre hindurch fortsetzen sollte. Hätte Johannes Timpe seinen Vater nicht so liebgehabt, nicht das Bewußtsein seiner ewigen Dankbarkeit gegen ihn mit sich herumgetragen, so würde er über die Hartnäckigkeit, mit welcher der Greis die wohlmeinenden Pläne des Ehepaars bekämpfte, ernstlich böse geworden sein; aber eingedenk des Sprichworts, welches alten Leuten eine gewisse Wunderlichkeit zuspricht, verlor er niemals seine Ruhe, versuchte er so viel als möglich Ulrich Gottfried Timpe milder zu stimmen und ihn dem Knaben geneigter zu machen. Zum Schluß brachte er denn immer etwas hervor, was seiner Meinung nach das Recht auf seine Seite bringen mußte.
»Franz hat eine schwache Brust, er wird schwere Arbeit nicht ertragen können; für die Drehbank ist er ganz und gar nicht geschaffen.«
Das war ein Punkt, der allerdings zu denken gab und welcher auch Karolinens Redseligkeit entfesselte. Was hätte Gottfried Timpe wohl gegen die Mutterliebe einzuwenden vermocht! In einer derartigen Situation lauteten seine letzten Worte: »Ihr werdet's ja sehen.« Dann sank das Haupt wieder auf die Brust, hüllte der Greis sich in tiefes Schweigen.
So waren denn die Jahre vergangen. Franz hatte die obere Sekunda-Klasse der Realschule erreicht und wurde dann bei Ferdinand Friedrich Urban in die Lehre gebracht. Das war bereits im Oktober des vergangenen Jahres geschehen. Während dieser Zeit hatte er vielfach Gelegenheit gefunden, seine Anlagen zum Leichtsinn aufs gründlichste zu beweisen, die Freiheit des Willens, die man ihm seit seiner frühesten Jugend gelassen hatte, nach Kräften auszunützen. An Bildung und Wissen seinen Eltern weit überlegen, inmitten der Weltstadt groß geworden, gewöhnt, mit gleichaltrigen Genossen in Berührung zu kommen, deren Eltern eine andere Lebensstellung einnahmen, als die seines Vaters war, von dem brennenden Ehrgeize beseelt, in eine andere Sphäre der Gesellschaft hineinzukommen – hatte er sich mit der Zeit Neigungen zugewendet, die ihm unzertrennbar von den Passionen eines jungen Mannes seiner Bildung und seiner Zukunft schienen.
Meister Timpe verweigerte seinem Sohne nichts. Er kleidete ihn nach der neuesten Mode, er gab ihm zu dem kleinen Monatsgehalt ein reichliches Taschengeld und empfand einen gewissen Stolz darin, von wohlmeinenden Nachbarsleuten die elegante Erscheinung seines Sohnes, der wie ein »junger Graf« dahinschreite, gelobt zu wissen. Dabei übersah er denn auch gern die »kleinen Seitensprünge« Franzens, wie er die abenteuerlichen Kneipereien des jungen Mannes zu nennen pflegte. Das kam selten vor; legte sich doch der »gute Junge« fast regelmäßig um neun Uhr schlafen, um des Morgens rechtzeitig munter zu sein. Als der Großvater eines Vormittags seinem Sohne berichtete, daß Franz einige Mal nach Mitternacht nach Hause gekommen sei, lachte Johannes Timpe ihm laut ins Gesicht. Sein Sohn, der um neun Uhr bereits nach seiner Stube hinaufgegangen war, sollte am frühen Morgen nach Hause gekommen sein? Er fand das äußerst schnurrig und sprach von »wunderlichen Träumen« und »Gespenstersehen trotz der Blindheit«. Der Greis aber hatte sich nicht getäuscht. Eines Abends vernahm er, wie sein Enkel kurz vor zehn Uhr leise die Tür verschloß und die Treppe hinunterschlich. An den geschlossenen Fensterläden vorüber, konnte Franz unbemerkt die Straße erreichen. Das wiederholte sich mehrmals in der Woche. Er täuschte und belog seine Eltern zu gleicher Zeit.
Der Alte war starr bei dieser Entdeckung, behielt sie zuerst für sich, nahm aber seinen Enkel bei Gelegenheit ins Gebet, um ihn zu beschämen. Timpe junior leugnete; und als er inne ward, daß das nichts helfe, wurde er von einem unbezwingbaren Haß gegen den Alten erfaßt – einem Haß, der eigentlich nur das helle Aufflackern einer von seiner Kindheit an in ihm schlummernden Abneigung gegen den Großvater war.
Ulrich Gottfried Timpe aber mußte nach seiner Mitteilung erleben, daß Johannes zuerst ein sehr ernstes, überraschtes Gesicht zeigte, dann zu lachen anfing und sagte: »Ein toller Junge! Der hat richtigen Mutterwitz. Ich weiß, Vater, daß du dich nicht gut mit ihm stehst; überlaß mir nur die Geschichte. Das ist mehr Leichtsinn als Schlechtigkeit. Du darfst nicht vergessen, daß die jungen Leute von heute anders über die Moral denken und daß die Welt mit der Zeit eine andere geworden ist. Das verstehen wir beide nicht mehr. Du noch weniger als ich.«
Als Franz Timpe von dieser Unterredung erfahren hatte, versuchte er seinen Großvater auf das gründlichste anzuschwärzen: Der Alte gönne ihm nicht das liebe Leben. Wenn er wirklich einmal des Nachts spät nach Hause gekommen, so sei das nicht so schlimm und nicht dazu angetan, eine große Klatscherei darüber zu machen. Das ganze Bestreben des Großpapas ginge nur darauf hinaus, ihn mit den Gesellen auf eine Stufe zu stellen, wie es früher vielleicht Mode gewesen sein mochte. Könne er wohl etwas dafür, wenn der Geschäftsführer ihm die Ehre erweise, mit ihm länger zu kneipen, als es sonst der Fall zu sein pflegt? Er sei eben sehr angesehen im Geschäft, und seine Kollegen hielten große Stücke auf ihn.
Damit hatte Franz sein Ziel erreicht; denn Johannes Timpe, erfreut über das Ansehen, das sein Sohn, der Stolz seiner alten Tage, genoß, wischte die Hände an der blauen Schürze ab, zog seinen Stammhalter an sich und sagte leise, indem er sich verlegen umsah, als befürchte er, von dem Großpapa gehört zu werden:
»Ich weiß, wie das ist, mein Junge ... Also der Geschäftsführer verkehrt mit dir? Hm – das läßt sich hören ... Versprich mir nur, nicht länger als bis Mitternacht wegzubleiben, dann bin ich schon zufrieden. Du mußt doch schlafen. Wenn das nicht wäre ...«
Franz Timpe wendete sein hübsches Gesicht ab, denn er wollte dem Vater seine Verlegenheit nicht zeigen. Und während Daumen und Zeigefinger der rechten Hand sich mit dem Flaum der Oberlippe beschäftigten, erwiderte er: »Ich verspreche es dir!«
»Ich wußte, daß du es tun würdest, mein Sohn.«
Meister Timpe hatte seinem Jungen vergnügt auf die Schulter geklopft und ihn dann (es war in der Mittagsstunde beim hellen Sonnenschein eines trocknen Wintertages) durch den langen Flur nach dem Garten hinaus genötigt, der sich hinter dem Häuschen ausdehnte.
Mit diesem Fleckchen Erde hatte Johannes Timpe seine besonderen Pläne, über welche er nur zu gern mit seinem Sohne sprach. Da schwirrten die Worte »Anbauen ... Kleine Fabrik errichten ... Das Geschäft kaufmännisch betreiben ... Seinen Sohn zum Kompagnon machen ... Neues Vorderhaus errichten ...« durch die Luft, so daß Franz seinem Vater mit dem größten Interesse zuhörte; denn man schilderte ihm das Element, in dem er sich einst zu bewegen gedachte. Befehlen, herrschen, Fabrikbesitzer spielen – gewiß, das war das Ziel, dem er zustrebte.
Während aber Johannes Timpe das seinem Sohne entwickelte, vergaß er niemals, den Kopf nach dem Großpapa zu wenden, der in der Mittagsstunde in dem Rahmen der Hoftür zu stehen pflegte, um die Tauben zu füttern, die girrend auf seinen Pfiff herangeflogen kamen. Der Drechslermeister fürchtete seinen Vater, wie Franz ihn haßte.
Was würde er wohl sagen, wenn er Kenntnis von diesen tollen Plänen bekäme? Er, der sich einen Handwerker nicht anders vorstellen konnte als mit zwei oder drei Gehülfen in der Werkstatt, arbeitend gegen bare Bezahlung, im Besitze eines einzigen Geschäftsbuches, in dem die Ausgaben und Einnahmen gewissenhaft verzeichnet wurden; bescheiden und anspruchslos lebend, nur darauf bedacht, ohne jede Spekulation zu einem soliden Wohlstande zu gelangen.
Großvater, Vater und Sohn bildeten in ihren Anschauungen den Typus dreier Generationen. Der dreiundachtzigjährige Greis vertrat eine längst vergangene Epoche: jene Zeit nach den Befreiungskriegen, wo nach langer Schmach das Handwerk wieder zu Ehren gekommen war und die deutsche Sitte aufs neue zu herrschen begann. Er lebte ewig in der Erinnerung an jene glorreiche Zeit, die nach Jahren voller Schrecken und Demütigung den deutschen Bürger zu einem bescheidenen Menschen gemacht hatte.
Johannes Timpe hatte in den Märztagen Barrikaden bauen helfen. Er war gleichsam das revoltierende Element, das den Bürger als vornehmste Stütze des Staates direkt hinter den Thron stellte und die Privilegien des Handwerks gewahrt wissen wollte.
Und sein Sohn vertrat die neue Generation der beginnenden Gründerjahre, welche nur darnach trachtete, auf leichte Art Geld zu erwerben und die Gewohnheiten des schlichten Bürgertums dem Moloch des Genusses zu opfern.
So winklig wie Timpes Haus nahm sich auch das Gärtchen aus. Eine in doppelter Mannshöhe emporragende Mauer umschloß es von drei Seiten und trennte es vom Nachbargrundstück. Diese Mauer hatte ihre besondere Geschichte.
Vor zehn Jahren stand an ihrer Stelle ein niedriger Staketenzaun. Die Handwerkerfamilie konnte an schönen Sommertagen, war sie hinten in einer kleinen Laube versammelt, einen herrlichen Anblick genießen, wenn die Augen sich nach den uralten Bäumen, grünenden Rasenflächen und künstlichen Blumenanlagen des Nachbargrundstückes richteten. Dasselbe gehörte einer reichen Kaufmannswitwe, die mit ihren Töchtern in der nächsten Querstraße ein villenartiges Haus bewohnte. Die drei Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren hatten ein besonderes Vergnügen daran gefunden, vom niederen Zaune aus dem Treiben in der Werkstatt, deren große Fenster nach dem Gärtchen hinausgingen, zuzuschauen. Das Schnurren der Drehbänke und das Sprühen der Schnitzel übten einen großen Reiz auf sie aus.
Mit der Zeit waren sie mit Franz so vertraut geworden, daß er sich nicht scheute, den Zaun zu überklettern, um sich nach Herzenslust mit den Mädchen in dem großen Garten zu tummeln. Dabei blieb es jedoch nicht. Sein Hang zu allerlei üblen Streichen trieb ihn öfters dazu, in der Dämmerung auf eigene Faust dem Nachbargrundstücke Besuche abzustatten, um die Obstbäume zu plündern.
Als er eines Abends dabei gesehen worden war, hatte es eine Auseinandersetzung zwischen der Witwe und Johannes Timpe gegeben. Der Drechslermeister war sehr betrübt über die Diebereien seines einzigen Kindes und versprach der Witwe, den Knaben zu züchtigen und Sorge dafür zu tragen, daß man ihr zu weiteren Klagen keine Veranlassung geben würde. Johannes Timpe hätte vielleicht die versprochene Züchtigung, zum ersten Male in seinem Leben, energisch vorgenommen, wenn er nicht bemerkt haben würde, wie sein Vater bereits auf den Moment wartete, wo das Geheul des Jungen ihm endlich den Beweis für die Umsetzung seiner Lehre von der Zuchtrute ins Praktische geben werde. Er unterließ also die Züchtigung und beschränkte sich auf einen Verweis, der beschämend auf seinen Sprößling wirken sollte. Seine übergroße Gutmütigkeit aber tat nicht die geringste Wirkung; denn nach acht Tagen hatte Franz die gute Lehre vergessen. Er ließ sich abermals auf frischer Tat im Nachbargarten ertappen. Diesmal schlug die Witwe einen anderen Weg ein.
Eines Tages wurden Fuhren neuer Steine hinter dem kleinen Zaune abgeladen; Arbeiter mit ihren Gerätschaften erschienen und errichteten in wenigen Tagen die mit Glasscherben gekrönte Mauer.
Johannes Timpe und Frau Karoline waren natürlich sehr aufgebracht darüber. Der Meister setzte eine Beschwerde auf, des Inhalts, daß die Mauer der Werkstatt das Licht nehme. Es kam auch eine Kommission, um sich an Ort und Stelle davon zu überzeugen, gelangte aber zu dem Resultat, daß der Abstand der Mauer vom Hause ein zu großer sei, um die Beschwerde zu rechtfertigen. Sie mußten sich also in das Unvermeidliche fügen. Nur der Großvater fühlte ein geheimes Behagen an der Rache der Nachbarin. Er konnte ohnehin nicht sehen, der Garten war ihm also völlig gleichgültig.
»Das habt ihr eurem lieben Söhnlein zu verdanken«, sagte er mehrmals. Johannes Timpe und sein Weib mußten darauf schweigen, denn sie konnten ihm nicht unrecht geben.
Es wurde dem Drechslermeister und seiner Ehehälfte schwer, sich daran zu gewöhnen, den Vorgängen jenseits der Mauer keine Aufmerksamkeit mehr schenken zu dürfen, wie es vorauszusehen war, daß Franz sich am wenigsten in das Unvermeidliche fügen würde. Eines Tages konnte er es ohne einen Einblick in den Nachbargarten nicht mehr aushalten. Er kam auf eine glückliche Idee. In der Ecke, wo die Mauer an das Häuschen stieß, stand ein mächtiger Lindenbaum, der seine Zweige weit über das Dach des Hauses streckte und an heißen Sommertagen einen vortrefflichen Schutz gegen die Strahlen der Sonne gewährte. Hoch oben in der Krone des Baumes erblickten die Eltern eines Abends den Sohn. Er war durch eine Dachluke direkt auf den Baum gestiegen, hatte auf zwei Äste ein Brett gelegt und guckte vergnügt in die Welt hinaus.
»Von hier aus kann man weit sehen«, hatte er heruntergerufen. Und Johannes Timpe, der über die Waghalsigkeit seines Einzigen erst erschrocken war, dann aber lachen mußte, war ebenfalls zum Dachboden emporgestiegen, hatte seinen behäbigen Korpus mit Mühe durch die Luke gedrängt und neben seinem Sprößling Platz genommen.
Wahrhaftig, der Junge hatte recht. Hier oben konnte man sich über den Verlust der früheren Aussicht vortrefflich trösten.
Dem Sohne zur Liebe wurde die Dachluke erweitert. Die Gesellen mußten eine Art Brücke vom Dache bis zum Baume schaffen; und zur Sicherheit wurde hoch oben in der Krone rings um den Stamm ein Sitz mit Geländer angebracht und dieser Auslug, zu Ehren seines Entdeckers, »Franzens-Ruh« getauft. Johannes Timpe aber nannte ihn seine »Warte«. Der Aufenthalt zwischen Himmel und Erde war eine vortreffliche Abwechselung in der Eintönigkeit der langen Abende und gab Veranlassung, sich noch wochenlang darüber zu unterhalten.
Als der Großvater das Sägen und Hämmern über seinem Kopfe vernahm, erkundigte er sich im geheimen bei den Gesellen nach der Ursache des Zimmerns, da man ihm aus sehr bekannten Gründen wohlweislich von den Vorgängen der neuesten Zeit nichts gesagt hatte. Er schwieg tagelang. Eines Abends aber, als Meister Timpe vergnügt plaudernd neben seinem Sohne auf der Warte saß, konnte der Greis sich doch nicht enthalten, in einem Gespräche mit seiner Schwiegertochter unten in der Laube die absichtlich laut getane Bemerkung zu machen, daß zu seiner Zeit die Eltern den Jungen die Hosen strammgezogen hätten, wenn dieselben so vermessen gewesen wären, auf den Bäumen herumzukriechen, um sich der Gefahr auszusetzen, Arme und Beine zu brechen. Heute aber schiene es, als strebten die Eltern danach, ihren Kindern mit bösem Beispiele voranzugehen:
»Ja, früher, wer dachte früher an so etwas!«
Mit den Jahren hatte sich dann auch der älteste Timpe an die Kletterlust von Vater und Sohn gewöhnt und sogar einmal lebhaft bedauert (das geschah natürlich ganz verstohlen), daß sein Alter und seine Blindheit es ihm nicht möglich machten, ebenfalls von dort oben den Leuten in die »Suppenterrine zu spucken«. In der Mittagsstunde des Tages, in dessen ersten Stunden Krusemeyer und Liebegott ihre Ansichten über die Nachtschwärmerei Franz Timpes zum besten gegeben hatten, suchte dieser seinen Vater in dem Gärtchen auf. Er war soeben aus dem Geschäft gekommen, und da das Essen noch auf sich warten ließ, wollte er die Neuigkeit, die er mitgebracht hatte, dem Alten sofort mitteilen.
Meister Timpe war bei seinen Beeten, die er eigenhändig zu umgraben und zu besäen pflegte. Den einen Zipfel der Schürze hochgesteckt, die Schirmmütze etwas schräg auf die noch wohlerhaltenen grauen Haare gerückt, stand er über seine Schaufel gebeugt und musterte den Boden. Dieser kleinen Beschäftigung im Garten, die ihm neben seinem Handwerk wie eine Erholung dünkte, pflegte er in den Morgen- und Mittagsstunden nachzugehen. Den ganzen Winter hindurch freute er sich bereits auf den Frühling, der ihn in den Stand setzen würde, seine Liebhaberei für Blumen und Gemüse zu betätigen.
Die Aprilsonne lag erwärmend auf den Bäumen und Sträuchern, an denen bereits das erste Grün sich bemerkbar machte; und ein frischer Erdgeruch entstieg dem keimenden Boden und würzte die Luft. Nur wie ein leises Brausen drang das Branden und Wogen des Berliner Lebens über die Dächer hinweg in diese abgeschlossene Idylle hinein.
Wenn Johannes Timpe seinen Sohn zu Gesicht bekam, galt seine erste Frage den Fortschritten im Geschäft. In den ewig sich gleichbleibenden Worten »Nun, wie war's heute – sind sie zufrieden mit dir?« lag die ganze Zärtlichkeit, die er für seinen Sohn stets in so reichem Maße übrig hatte.
Franz überhörte heute die Frage ganz; dafür aber sagte er sofort:
»Weißt du noch, Vater, wie meinetwegen die Mauer errichtet wurde?«
Meister Timpe blickte bei dieser merkwürdigen Frage auf.
»Gewiß, mein Junge, aber wie kommst du darauf?«
Franz schwieg ein paar Minuten, denn es fiel ihm ein, daß er zuvor etwas Nützlicheres zu tun habe, als sogleich die Frage seines Vaters zu beantworten. Er zog eine Haarbürste hervor, musterte sich eine Weile aufmerksam in dem Stückchen Spiegel derselben, glättete seine nach der neuesten Mode in der Mitte kokett gescheitelte Frisur, versuchte den Spitzen des keimenden Schnurrbartes eine symmetrische Form zu geben, pfiff leise vor sich hin, stellte sich mit den Händen in den Hosentaschen breitbeinig vor seinen Vater hin und erwiderte dann erst:
»Wer hätte jemals daran gedacht, daß ich doch noch über die Mauer hinwegkommen würde. Denke dir nur: Herr Urban hat die Witwe da drüben geheiratet, und zwar ganz im stillen auf einer Reise, die er kürzlich gemacht hat. Selbst das Geschäftspersonal hat jetzt erst davon erfahren. Es soll nämlich extra eine Festlichkeit für uns veranstaltet werden. Meine alte Feindin wird meine Frau Chef – ist das nicht ein Hauptspaß?«
Johannes Timpe war diese Enthüllung so unerwartet gekommen, daß er zuerst stumm blieb, nur an seiner Mütze rückte und mit den Fingern der linken Hand über den kurzgeschorenen Kinnbart fuhr. Es war das immer ein Zeichen großer Nachdenklichkeit. Dann erst sagte er langsam:
»Sieh, der Schlauberger! Ein schönes Grundstück da drüben, und, was die Hauptsache ist, Frau Kirchberg, jetzt Frau Urban, soll viel Geld besitzen. Es ist die alte Geschichte: Wo viel ist, kommt viel hinzu.«
Meister Timpe faßte unter den Brustlatz seiner Schürze, holte eine mächtig-runde, bemalte Dose hervor und nahm mit einem »hm, hm« bedächtig eine Prise. Das sei aber noch nicht alles, berichtete Franz weiter. Man habe die Absicht, den größten Teil des Gartens zu Bauterrain umzuwandeln und eine große Fabrik mit den neuesten Verbesserungen zu errichten. »Die schönen alten Bäume!« warf Meister Timpe im Tone des Bedauerns ein, bei dem Gedanken, eines Tages an Stelle des herrlichen Laubschmuckes kahle Backsteinmauern und riesige Schornsteine emporragen zu sehen.
»Also dein Chef will im eigenen Hause fabrizieren«, sagte er dann aufs neue, indem er die Arme über den Knauf des Spatens kreuzte und vor sich hin blickte. Im Geist vernahm er bereits das Zischen des Dampfes, das Schnurren und das Summen der Treibriemen – jenes eigentümliche, die Erde erzitternd machende Geräusch, das die Nähe großer, in Bewegung gesetzter Maschinen verkündet.
Wenn er nur genau gewußt hätte, wann das Bauen drüben seinen Anfang nehmen sollte. Er war nicht umsonst plötzlich so still geworden. Ihm fielen seine alten Pläne wieder ein, welche sich um die Vergrößerung seines eigenen Geschäftes drehten. Wenn an Stelle dieser Mauer eine schwindelhohe Wand erstünde, wenn man ihn immer mehr umschlösse, um ihm das Licht des Himmels zu nehmen? Er hatte nie daran gedacht, daß die Verhältnisse jenseits der Mauer sich jemals ändern würden. Etwas wie Traurigkeit überkam ihn, eingedenk der Möglichkeit, daß sein Gärtchen eines Tages einem jener dunklen Höfe gleichen könne, über welche die Sonnenstrahlen nur auf Minuten dahinhuschen, ohne jemals ganz die Tiefe zu erreichen.
Als er sich umwendete, um an seinen Sohn noch eine Frage zu richten, war dieser bereits verschwunden; die Mutter hatte ihm vom Flur aus einen Wink gegeben, dem er gefolgt war.
Es war nahe an ein Uhr. In der Werkstatt hatten die Gesellen sich nach und nach eingefunden, um die Arbeit wieder aufzunehmen. An dem geöffneten Flügel des einen Fensters saß Thomas Beyer, der älteste Gehülfe Timpes. Seit fünfzehn Jahren stand er bereits an ein und derselben Drehbank. Er war ein hagerer, starkknochiger Mann von etwa vierzig Jahren und wohnte mit einer Schwester zusammen, die ihm die Wirtschaft führte. Er lebte sehr mäßig, besuchte sehr häufig populäre Vorträge und benutzte jede Gelegenheit, seine Belesenheit zu beweisen. Dadurch war er zu einer gewissen Autorität bei seinen Kollegen in der Werkstatt gelangt, die ihn wie ein lebendes Auskunftsbüro betrachteten, das auf alles Antwort geben müsse. Die ergötzlichsten Ansichten wurden dabei zutage gefördert. Da er überdies mit allen Verhältnissen des Hauses vertraut war, in Abwesenheit seines Arbeitgebers die Geschäfte desselben wahrnahm, so wurde er von diesem mehr wie ein Kamerad als wie ein Untergebener betrachtet.
»Meister«, rief er zum Garten hinaus, »wir haben noch nicht genug Schornsteine in der Nähe, es müssen noch einige hinzukommen. Aber ich habe es immer gesagt: Die Überproduktion wird die Menschen zugrunde richten. Die großen Fabriken fressen das Handwerk auf, und zuletzt bleibt weiter nichts übrig: als Arbeiter und Fabrikanten, zweibeinige Maschinen und Dampfkessel. Wie soll das enden!«
»Diesmal haben Sie recht, Beyer«, erwiderte Johannes Timpe, während von der Hoftür her, wo die Tauben sich vor dem Großvater versammelt hatten, die alte Litanei des Greises ertönte:
»Ja, ja, das waren noch andere Zeiten ... damals! Das Handwerk hatte einen goldenen Boden ... Die Schornsteine müssen gestürzt werden, denn sie verpesten die Luft; aber die Handwerker haben selbst daran schuld. Sie sollten ihre Söhne nicht Kaufleute werden lassen, die nur noch spekulieren und nicht arbeiten wollen.«
Er hatte seinem Ingrimm wieder einmal Luft gemacht, drehte sich um, faßte nach der Wand und schritt, auf seinen Stock gestützt, den Oberkörper gebeugt und den Atem kurz hervorstoßend, den langen Flur entlang, begleitet von dem Geräusch der klappernden Hauspantoffeln.
Durch das Gespräch aufmerksam geworden, hatten sämtliche Gesellen sich an den Fenstern versammelt. Da drüben sollte also eine Fabrik errichtet werden? Das war eine Nachricht, über welche man sprechen mußte. Johannes Timpe war es selbst angenehm, mit den Arbeitern seine Ansicht auszutauschen; und so eiferte denn ein jeder, seine Bemerkungen zu machen.
Urban sei ein ganz geriebener Junge, meinte Leineweber aus Braunschweig, ein kleiner, schmächtiger Mensch, der sich die Brust an der Drehbank ruiniert hatte, aber sich immer in Träumen darüber erging, was er anfangen würde, wenn er einmal einen Batzen in der Lotterie gewönne. Er habe bei einem Meister gearbeitet, der für Urban geliefert habe. Wenn dieser anfange, auf eigene Faust zu fabrizieren, so würde er wohl seinen guten Grund haben. Jedenfalls mache er hundert kleine Meister tot.
Und Leitmann, ein bereits graubärtiger Geselle, der früher einmal selbstständig gewesen war und durch das viele Treten der Drehbank einen hinkenden Gang sich angeeignet hatte, kannte ihn schon seit der Zeit, als sein ganzes Geschäft aus zwei winzigen Zimmern bestand und er, einen mächtigen Karton unter dem Arm, seinen eigenen Reisenden spielte, der durch die Straßen Berlins keuchte oder hoch oben auf dem Omnibus von einem Tor zum andern fuhr. Das sei vor zwanzig Jahren gewesen, als die ovalen Bilderrähme zum ersten Male auf der Drehbank hergestellt wurden. Dadurch habe er sein Glück gemacht.
Fritz Wiesel, ein blutjunger Berliner, hatte, als er noch Lehrling war, im Kontor von Ferdinand Friedrich Urban zu tun gehabt. Sein Geiz sei sprichwörtlich, meinte er. Er habe einmal einem Droschkenkutscher in der Zerstreutheit ein Zehnpfennigstück zu viel gegeben und sich darüber so sehr geärgert, daß er befürchtete, bankerott zu werden.
Meister Timpe wurde durch die eintretende Heiterkeit mit fortgerissen, bis er endlich sagte: