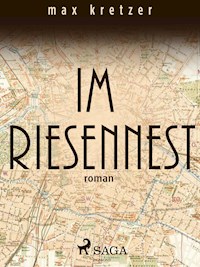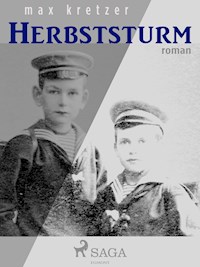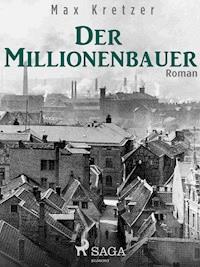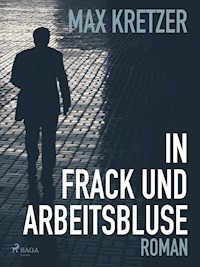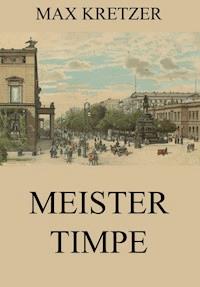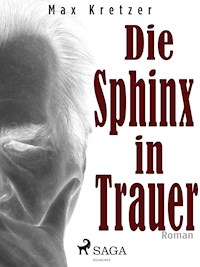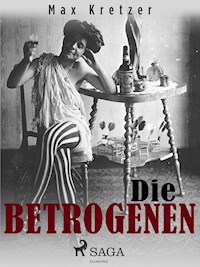Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gemeinsam stehen – gemeinsam fallen: diese ungewöhnliche Freundschaft verbindet die beiden Bildhauer Lorensen und Kempen. Und sie teilen wirklich alles: das Atelier, die Aufträge, die Einnahmen. Während Lorensens offene Art kaufkräftige Kunden gewinnt, sind es doch Kempens weitaus genialischeren Entwürfe, die das Geld bringen. Das Atelier wird zum Anlaufpunkt für ihre vielen erfolglosen Künstlerfreunde. Und das junge Mädchen Klara gehört auch dazu – seit dem Umzug ins neue Atelier schaut sie ständig neugierig vorbei. Nach und nach entsteht ein besonderes Verhältnis zu ihr. Aus dem Kinderkörper entwickelt sich eine anmutige Gestalt, die, mit Erlaubnis der Mutter, auch Modell steht. Und wenn auch "...Modell Sache ist", zu Klara haben beide ein liebevolles Verhältnis. Es ist der lebenslustige Lorensen, der andere Wege zum Erfolg sucht. Nach und nach gelingt es ihm, die Kontakte zur gehobenen Gesellschaft für mehr als nur für Aufträge zu nutzen, ohne Kempen zu verraten. Trotz seiner Eifersucht erwähnt er überall Kempens expressive Begabung. Alles könnte gut werden: Lorensen wird sich reich einheiraten und Kempen wird immer bekannter. Doch ausgerechnet die unschuldige Klara wird die Freundschaft beider für immer zerstören.Max Kretzer (1854–1941) war ein deutscher Schriftsteller. Kretzer wurde am 7. Juni 1854 in Posen als der zweite Sohn eines Hotelpächters geboren und besuchte bis zu seinem 13. Lebensjahr die dortige Realschule. Doch nachdem der Vater beim Versuch, sich als Gastwirt selbstständig zu machen, sein ganzes Vermögen verloren hatte, musste Kretzer die Realschule abbrechen. 1867 zog die Familie nach Berlin, wo Kretzer in einer Lampenfabrik sowie als Porzellan- und Schildermaler arbeitete. 1878 trat er der SPD bei. Nach einem Arbeitsunfall 1879 begann er mit der intensiven Lektüre von Autoren wie Zola, Dickens und Freytag, die ihn stark beeinflussten. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Die beiden Genossen" 1880 lebte Kretzer als freier Schriftsteller in Berlin. Max Kretzer gilt als einer der frühesten Vertreter des deutschen Naturalismus; er ist der erste naturalistische Romancier deutscher Sprache und sein Einfluss auf den jungen Gerhart Hauptmann ist unverkennbar. Kretzer führte als einer der ersten deutschen Autoren Themen wie Fabrikarbeit, Verelendung des Kleinbürgers als Folge der Industrialisierung und den Kampf der Arbeiterbewegung in die deutsche Literatur ein; die bedeutenderen Romane der 1880er und 1890er Jahre erschlossen Schritt für Schritt zahlreiche bislang weitgehend ignorierte Bereiche der modernen gesellschaftlichen Wirklichkeit für die Prosaliteratur: das Milieu der Großstadtprostitution (Die Betrogenen, 1882), die Lebensverhältnisse des Industrieproletariats (Die Verkommenen, 1883; Das Gesicht Christi, 1896), die Salons der Berliner "besseren Gesellschaft" (Drei Weiber, 1886). Sein bekanntester Roman, "Meister Timpe" (1888) ist dem verzweifelten Kampf des Kleinhandwerks gegen die kapitalistische Konkurrenz seitens der Fabriken gewidmet. Während Kretzer anfangs der deutschen Sozialdemokratie nahestand, sind seine Werke nach der Jahrhundertwende zunehmend vom Gedanken eines "christlichen Sozialismus" geprägt und tragen in späteren Jahren immer mehr den Charakter reiner Unterhaltungsliteratur und Kolportage. Er starb am 15. Juli 1941 in Berlin-Charlottenburg.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Was ist Ruhm?
Ausgewählte Werke
Mit einem Vorwort von Thomas Schäfer
Roman
Saga
Was ist Ruhm?
Copyright © 1905, 2017 Max Kretzer und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711502815
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
I.
An einem Abend des Jahres 1890 erregte ein sonderbares Fuhrwerk die Aufmerksamkeit der Passanten im verkehrsreichen Westen von Berlin. Ein Handwagen mit Bretterwänden, der vollgepfropft mit allerlei Gerümpel war, aus dem ein Modellierbock seine drei Beine in die Luft streckte, um das Herabrutschen der Gipsbüste einer Venus zu verhindern, wurde von einem schmächtigen, jungen Mann, Mitte der Zwanzig, gezogen, der als Laterne eine Papierdüte trug, in die man ein Licht gesteckt hatte. Hinten schritt der ältere Genosse, der, in der Linken eine kleine Petroleumlampe haltend, mit der Rechten kräftig nachhalf, sobald der Deichsellenker schwach zu werden drohte.
Der grosse Oktoberumzug war im Gange, und so mussten sie sich wiederholt an riesigen Möbelwagen vorbeiwinden, aus denen noch kurz vor Toresschluss die letzten schweren Stücke in die Häuser getragen wurden. Namentlich in der Potsdamer Strasse, wo das Leben allgewaltig brandete und die Pferdebahn alle Augenblicke ihre Warnungsklingel ertönen liess, war das Leiten des Gefährtes mit einer gewissen Gefahr verbunden, die durch das ungewohnte Amt des Führers noch erhöht wurde. Wenn sie sich dann glücklich wieder seitwärts an der Bordschwelle des Bürgersteiges befanden und einige Augenblicke anhielten, um Luft zu schöpfen, kamen sie sich mit ihren Habseligkeiten wie verkrümelt vor beim Anblick der glänzenden Möbel, die noch umherstanden, bevor kräftige Arme sie verschwinden liessen. Sobald dann die Träger die bleiche Venus erblickten, die, aufgepflanzt und von Stricken gehalten, mit ihren leeren Augen das Licht der Laternen auffing und das einzig Wertvolle bei diesem Wohnungswechsel zu sein schien, fielen derbe Witzworte, die auch die Heiterkeit der Vorübergehenden erweckten. Die Damen musterten die Gruppe und vergnügten sich lächelnd daran, was Lorensen, dessen noch milchbärtiges Gesicht von dem Lichtstumpf rötlich beleuchtet wurde, Veranlassung gab, seine breiten, gesunden Zähne zu zeigen und ihnen vertraulich zuzunicken, als gehörte er eigentlich in ihre Gesellschaft und hätte sich heute nur einen Jux gemacht, den Ziehhund zu ersetzen. Trotzdem er sich auf den ersten Blick als der Zartere von beiden erwies, war er doch der Keckere, sozusagen der Himmelstürmende, der den Lorbeer bereits in der Tasche hatte und die bewundernde Welt zu seinen Füssen sah. Gleich einem Rastelbinder trug er die Krempe des weichen Filzhutes weit heruntergestreift, weil er das Bedürfnis gefühlt hatte, sich hier, wo die Atelierzigeuner zu Hause waren, ein wenig unkenntlich zu machen.
Kempen war straffer und untersetzter, mit seiner Ruhe im schon vollbärtigen Gesicht mehr der Gegensatz zu der Lustigkeit des andern, der um Worte nie in Verlegenheit geriet und gern schwatzte, wo es eigentlich gar nicht notwendig war. So wurde Lorensen auch jetzt wieder lebhaft, als sie in die Steglitzer Strasse einbiegen wollten, wo ihr Dach ihnen winkte; er blieb aufs neue stehen, so dass der Wagen einen Ruck bekam, und wischte sich unter dem gelüfteten Hut den Schweiss von der Stirn, wobei eine Fülle hellblonden Haares sichtbar wurde; denn nicht nur die Anstrengung hatte ihn warm gemacht, sondern auch der milde Abend, der noch nichts von der Kühle des Herbstes verriet. Während des ganzen Tages war Berlin von der Sonne des Spätsommers durchzogen gewesen, deren Abglanz noch immer von den Mauern der riesigen Steinkasten ausgeschwitzt wurde, so dass der Dunst zwischen den Häusern lag. Lichtnebel wogte in der Ferne, der wie ein Niederschlag der ewig rastlosen, dampfenden Stadt sich mit den Menschen fortbewegte, gleichsam wie von ihnen mitgeschleppt.
„So treck doch man weiter“, sagte Kempen unwillig. Solange sie unterwegs waren, hatte er in seiner Verschlossenheit immer dasselbe geknurrt, weil ihm die Glocke der alten Lampe Sorge machte. Sein grauer Hut sass ihm wie ein Fez auf dem Kopfe und passte nicht recht zu dem kurzen, schwarzen Rock, der ihm etwas Schulmeisterliches gab.
„Ja, das sagst du so, Hermann,“ fiel der andre mit seiner holsteinischen Gemütlichkeit ein und setzte ihm auseinander, dass seine rechte Schulter durch den Strick bereits weich wie Ton geworden sei. Ganz unten auf dem Wagen lag eisernes Rüstzeug, dessen Schwere sich besonders fühlbar gemacht hatte. Plötzlich fing Lorensen an zu blasen, denn die Papierdüte ging in Flammen auf und erregte das Wohlgefallen einiger Jungen, von denen der eine lustig „Gross-Feuer“ rief. Ärgerlich, mit verbrannten Fingern, liess er den Lichtstumpf zur Erde fallen und trat die Flamme aus.
„Das hast du wieder mal gut gemacht! Guck doch nicht so viel nach den Mädels,“ brummte Kempen aufs neue und richtete die Venus wieder in die Höhe, die sich allmählich auf die Nase gelegt hatte. Hinten fielen Blechgefässe heraus, die mit einem Halloh von der hilfreichen Jugend aufgehoben wurden. Schon wollte man ohne Laterne weiterfahren, als sich drohend ein Schutzmann nahte, mit jenem berühmten Griff nach dem Taschenbuch, der den Schrecken aller Kutscher bildet. Kempen setzte ihm ihr Pech auseinander und holte zugleich zehn Pfennig aus seinem Portemonnaie hervor, die er Lorensen zu einem neuen Licht gab, denn dieser verfügte niemals über Geld, weil er leichtsinnig veranlagt war und daher dem stets nüchternen und sparsamen Hamburger die gemeinsame Kasse überlassen musste. Hurtig hatte sich Lorensen den Strick von der Schulter gestreift und suchte mit den Augen nach einem geeigneten Laden, innerlich erbost über die Knickrigkeit des Freundes, denn gern würde er gesehen haben, dass er ein grösseres Geldstück empfangen hätte, um rasch seinen Durst durch ein Glas Bier zu löschen, wie er es bei ähnlichen Gelegenheiten zu tun pflegte.
Ein halbwüchsiges Mädchen aus der Schar der Neugierigen erbot sich, ihm gefällig zu sein. Flugs legte sie ihr Paket auf den Wagen und eilte fort, um schon nach wenigen Minuten wieder zur Stelle zu sein. Aufgeweckt wie ein frühkluges Berliner Volkskind, hatte sie sich sofort eine durchsichtige Düte geben lassen und überreichte Lorensen die neue Laterne fix und fertig, die er nun vergnügt in Brand setzte, wobei er das hübsche, frische Gesicht der Kleinen mit den Augen des Künstlers betrachtete.
„Du bist ja mal ’n nettes Ding,“ knurrte Kempen mit seiner höchsten Liebenswürdigkeit und musterte sie ebenfalls, aber mit reinerem Blick als der andere, der in jedem hübschen Gesicht nur das Modell sah und alles, was dazu gehörte. „Wie heisst du denn?“ fügte er mit harmloser Neugierde hinzu und opferte ein zweites Streichhölzchen, um den Tabaksrest in seiner kurzen Holzpfeife zu entzünden.
„Klara Munk,“ erwiderte sie und machte einen leichten Knicks, was sich wie einstudiert ausnahm. Und als sie mit geschärftem Blick sofort erfasst hatte, dass sie hier keine gewöhnlichen Arbeiter vor sich habe, sondern bessere Leute, die auf alle Fälle Bildung besassen, liess sie lächelnd die Frage los, ob sie dem „Herrn“ vielleicht die Lampe abnehmen und ein Stück Weges tragen dürfe. Sie würde es gern tun und hätte Zeit, wenn es nicht gar zu weit wäre. Etwas wie Bedauern sprach aus ihren Zügen darüber, dass diese beiden Männer noch spät am Abend sich so quälen müssten.
„Lass sie, Hermann, sie bringt uns Glück,“ sagte Lorensen lachend und spannte sich wieder an die Deichsel. „Man jut, dass uns keen altes Weib über’n Wej jeloofen is.“ Manchmal suchte er etwas darin, die Sprechweise des niederen Berliners anzuwenden, was sich in seinem singenden Tonfall sehr merkwürdig anhörte.
„Pfui, wie gewöhnlich spricht der,“ dachte die Kleine und wurde schwankend in ihrer besseren Meinung. Erst Kempen, der in gut gewähltem Hochdeutsch dankend die Begleitung annahm und ihr die Lampe reichte, stimmte sie wieder um. So bogen denn alle drei links um die Ecke, dem stilleren Teil der Steglitzer Strasse zu, der in der Nähe der Eisenbahn liegt. Es war nicht mehr weit bis an ihr Ziel; schon nach fünf Minuten machten sie vor einem Durchschnittshause Halt, das aus älterer Zeit stammte und weder Balkon noch Erker zeigte. Da es bereits auf zehn ging, so griffen sie kräftig zu, um ihr Eigentum in das vierte Stockwerk hinaufzutragen, wo sie bei einer Witwe ein grosses, zweifenstriges Zimmer gemietet hatten. In dem breiten, ausgefahrenen Torweg standen Bewohner des Hinterhauses, die von der Abendluft noch nippen wollten. Lorensen nahm die Venus vom Wagen, drängte sich durch und schritt als erster die etwas unsaubere Treppe hinauf, die von zirpenden Gasflämmchen nur schwach erhellt war. Die Schönheit musste vorangetragen werden, das leuchtete ihm ein. Ein altes Weib, das er mit der weissen Larve erschreckt hatte, lachte hinter ihm her. Dann hörte er, wie oben eine helle Kinderstimme rief: „Mutta, die Kinstler kommen!“
Frau Lemke, eine kleine Person mit breiter Taille und aufgeschwemmten Zügen, aus denen aber gutmütige Augen sprachen, stand mitten in der erhellten Flurstube und begrüsste freundlich die neuen Mieter; aber schon beim zweiten Gange der Freunde wurde sie misstrauisch, denn vergeblich wartete sie auf Koffer und Kisten. Und als dann Kempen wiederum beladen die Stufen nahm, hörte er sie durch die offene Tür mit Lorensen keifen: „Nein, nein, das geht nicht! Wenn Sie keine Sachen haben, dann kehren Sie nur gleich um. Sie wollen wohl einen Stall aus meiner Wohnung machen? Wenn ich das nur geahnt hätte!“ Sie hatte erst jüngst schlimme Erfahrungen mit einem Möblierten gemacht, und so schüttete sie rücksichtslos ihren Ärger aus. Schon, als sie zum Fenster hinauslag, war sie verwundert darüber, dass diese Herren wie die Knechte ihren Wagen selbst schoben und statt der Herrlichkeit Lumpen und Eisen mit sich führten.
„Aber erlauben Sie mal, beste Frau,“ muckte Lorensen laut auf. „Das verstehen Sie nicht, hier steckt enormer Wert drin. Unsere Modelle sind unbezahlbar. Die Büste allein kostet hundert Mark. Warten Sie nur erst ab.“ Er schnitt gern auf, und so versuchte er, sie mit seinen Worten zu betäuben, die endlich in dem Satze gipfelten: „Wir haben eine Zukunft, liebe Frau, eine grosse Zukunft!“
Klara Munks helle Stimme klang dazwischen: „Aber das sind ja Künstler, das müssen Sie doch sehen. Die sind anders wie gewöhnliche Menschen.“ Ohne erst viel zu fragen und als verstünde es sich von selbst, hatte sie wacker Hand mit angelegt und hinaufgetragen, was ihre schwachen Arme vermochten.
„Gehörst du vielleicht auch dazu?“ fiel ihr Frau Lemke spöttisch ins Wort.
„So halb und halb,“ erwiderte sie lachend.
Lorensen blickte auf, konnte aber nicht mehr fragen, denn Kempen kam und beruhigte Frau Lemke, indem er ihr mit seiner trockenen Würde auseinandersetzte, dass sie durchaus nichts zu befürchten habe. Sie seien anständige und ehrliche Leute, die zwar keine Reichtümer besässen, aber doch so viel verdienten, um eine brave Frau nicht schädigen zu brauchen. Und um seinen Worten Nachdruck zu verhelfen, zählte er ihr sofort die Miete in harten Talern auf den Tisch; dann bat er, ihnen für heute etwas Petroleum abzulassen, damit sie ihre Lampe füllen könnten. Und um ihr Zimmer brauche sie nicht zu fürchten; es seien ganz reinliche Dinge, die sie hier trieben, dafür bürge er. Sie würde sich bald überzeugen, dass sie sehr gut mit ihnen auskäme, denn sie wollten nichts umsonst haben.
Sein gesetztes Wesen, das dem des andern so sehr widersprach, gefiel ihr, und so strich sie vergnügt das Geld ein, was ihr im Augenblick die Hauptsache war; dann hatte sie wieder freundliche Worte bereit und erfüllte sofort die kleinen Wünsche der beiden.
„Na, und du?“ knurrte Kempen das Mädchen an, als die Wirtin hinaus war. „Was sind wir dir denn schuldig?“
„Freundliche Behandlung,“ erwiderte sie lachend, wobei ihre Zähne blitzten.
Er wollte ihr einen Nickel schenken, sie aber dankte mit den Worten, dass es gern geschehen sei.
„Na, dann scher dich nach Hause,“ brummte er, ohne es böse zu meinen.
Die Tür stand noch offen, und so nahm sie ihr Paket und wollte hinausflitzen. Lorensen jedoch hielt sie zurück. „Nimm doch einmal die alte Schute vom Kopf,“ rief er ihr zu, und als sie ohne Ziererei seinen Wunsch erfüllt hatte und nun lächelnd den Hut mit den roten Bändern hin und her schwenkte, riss er seine blauen Augen, die sonst immer etwas müde unter den Lidern lagen, gross auf. Er sah einen schön gewölbten Scheitel, der sich in dem Glanz der saftigbraunen Haare wiegte, das zusammengeknotet üppig über den Nacken fiel. Kleine, anliegende Ohrmuscheln leuchteten zart auf diesem dunklen Grunde, und die Läppchen unten drängten sich nur wenig hervor, zerflossen fast in der weichen Fülle des schlanken Halses. Die Nasenflügel waren vielleicht etwas zu breit, aber sie stimmten zu den vollen Lippen des prachtvoll geschnittenen Mundes. Überall die keuschen Linien der knospenden Jugend, die aus dem Frühling in den Sommer hinein wächst.
„Hör mal, du bist ’ne hübsche Kröte,“ sagte Lorensen mit der Offenheit eines Künstlers, der seine Erfahrung hinter sich hat und nicht viel Umstände macht. Zudringlich fasste er sie am Zopf, Kempen aber fuhr erbost dazwischen. „Lass das, und du mach endlich, dass du dich verziehst. Sonst kommst du schliesslich nicht mehr ins Haus.“
„Ach, ich hab ’n Schlüssel,“ gab sie mit Unschuldsmiene zurück, brennend rot geworden durch die Schmeichelei des Blonden.
Lorensen lachte laut; Kempen aber knirschte ärgerlich mit den Zähnen, denn der Weiberhass packte ihn wieder, der ihm um so notwendiger erschien, je mehr er Beweise für die frühe Verderbtheit dieses Geschlechts bekam, das er niemals hatte verstehen lernen.
„Was ist denn dein Vater?“ forschte Lorensen weiter. Und als sie erwiderte, dass er tot sei, dass ihre Mutter aber für feine Leute Wäsche wasche und plätte, fügte er grossspurig hinzu: „Na, dann bist du ja gerade an die richtige Adresse gekommen.“ Und er schrieb sich ihre Wohnung auf und liess sie gehen. Mit einem Knicks gab sie jedem die Hand und schritt dann hinaus, gefolgt von Kempen, dem nun einfiel, dass der Wagen auf dem Hofe untergebracht werden müsse. Neugierig blieb sie unten stehen, bis er sein Werk verrichtet hatte. „Ja, bist du denn gar nicht fortzukriegen?“ sagte er gutmütig. „Solltest du Schelte kriegen, dann beruf dich nur auf uns.“
„Ach, Mutter schimpft nicht, die kennt mich schon. Ich bin selbständig,“ erwiderte sie mit einem gewissen Stolz und lief dann eilig davon.
„Ein richtiges Berliner Mädel,“ dachte Kempen und stieg nun wieder die Treppe hinauf, auf der das Gaslicht gerade verglimmte.
Oben hatte Lorensen sämtliche Fenster aufgerissen, um die muffige Luft, die noch in den Tapeten steckte, durch frische Luft zu ersetzen. Nun stand er in Hemdsärmeln mitten im Zimmer, umringt von dem Durcheinander ihres armseligen Daseins, wie jemand, der nicht weiss, wo er zuerst mit dem Aufräumen anfangen soll.
„Du, Hermann, das ist ’n Kopp, was? Der muss nächstens ’ran. Da ist Weichheit drin, so ’ne Linie hinten, weisst du, die so —. So was ist furchtbar echt.“ Wenn er nicht den richtigen Ausdruck fand, aber etwas ganz Besonderes sagen wollte, dann wandte er diese Schlussredensart an, die, hart ausgesprochen, etwas Komisches in sich barg, was noch dadurch verstärkt wurde, dass er mit dem gebogenen Daumen krampfhaft Luftlinien beschrieb, als striche er bereits vom weichen Ton etwas ab, um die Form herauszubekommen.
„Ach, dir stecken bloss die Weiber im Sinn,“ knurrte Kempen, und sofort schwebte ihm sein „Löwenkämpfer“ und sein „Gefesselter Prometheus“ vor — die beiden zukünftigen Meisterwerke, die er in kleinen Tonskizzen längst entworfen hatte und die ihm dereinst Geld und Ehren bringen sollten, sobald er in der Lage wäre, sie auszuführen.
„Jeder nach seiner Art, Hermann,“ wandte Lorensen ein und bat sich „auf ein paar Züge“ die Tabakspfeife des Genossen aus, da ihm die seinige heute früh zerbrochen war. Und mit Genuss paffend fuhr er fort: „Lass man — weibliche Puppen werden heute am meisten verlangt. Wir müssen erst ’s Tiergartenviertel haben, das ist die Hauptsache. Ein halbes Dutzend Nymphen, und wir sind schöne raus. Dann kommt erst das Grosse, das furchtbar Echte.“
„Ich seh dich auch noch als Kitsch-Meier enden,“ stiess Kempen wieder zwischen den Zähnen hervor, kniete nieder und schnürte einen grossen, alten Karton auf, in dem sich ihre Sonntagsanzüge befanden. Und während er sie glatt strich und in den einfachen Mahagonischrank hängte, vergnügte sich Lorensen über diesen Zornesausbruch, von dem er wusste, dass er weniger dem Künstler in ihm galt, als seiner leichten Auffassung von dem vorläufigen Schwimmen mit dem Strom. So plänkelten sie manchmal, wenn ihre Naturen sich zeigten, die aber den festen Freundschaftskitt nicht brechen konnten.
Frau Lemke kehrte zurück, stellte eine Flasche mit Petroleumrest neben das brennende Licht auf der alten, noch zugeklappten Waschtoilette, warf einen bedeutsamen Blick auf die schmokende Pfeife des Blonden, wobei sie an die frisch gewaschenen Gardinen dachte, und wünschte mit freundlichem Lächeln gute Ruhe. Sie sah den offenen Schrank mit den Kleidungsstücken, in dem sogar zwei lange Mäntel hingen, und ging nun mit der stillen Genugtuung einer stets um ihr Wohl besorgten Wirtin, die einen kleinen Trost mit sich nimmt. Alte, gefüllte Pappkartons erschienen ihr plötzlich wertvoller, als grosse Koffer, in denen nichts drin war.
Wirtschaftlich wie immer machte Kempen die Lampe zurecht, zündete sie an und blies das Licht aus, um zu sparen. Dann legte er ebenfalls seinen Rock ab und rührte abermals die Hände, um rasch ein wenig Ordnung zu schaffen. Wenn die neue Herbergsmutter am andern Morgen den Kaffee brachte, sollte sie einen besseren Begriff von dem „Kunststall“ bekommen, als am Abend vorher. Er säuberte mit einem Lappen den dreibeinigen Bock und stellte ihn vor das eine Fenster; nässte die Leinwand um den Klumpen Modellierton frisch an und brachte ihn in einer Ecke unter; hob die Venusbüste auf das Mahagonispind und breitete die Arbeitshölzer auf die wacklige Kommode unter dem Pfeilerspiegel aus. Die Skeletteisen wanderten in den Schrank, wo sie einstweilen von dem zukünftigen Gebrauch träumen konnten. Dann liess er die kleinen, zusammengetrockneten Tonmodellskizzen auf dem ovalen Tisch eine Reihe bilden, wickelte sorgsam die wenigen Gipsabgüsse klassischer Hände und Arme aus und legte sie auf das ausgesessene Sofa. Am andern Tage sollten sie die Wände zieren, um den Eindruck dieses Philisterzimmers würdiger zu machen. Eine Kiste mit gewöhnlichem Werkzeug, mit Töpfen und Blechgefässen verschwand unter der einen Bettstelle; und auch der freie Raum der andern musste es sich gefallen lassen, mit ähnlichen Dingen gefüllt zu werden.
Während dieser ganzen Zeit liess Lorensen ihn ruhig gewähren. Er hatte sich längst daran gewöhnt, dass Kempen das alles besser ohne ihn machte, viel sauberer und schneller, ohne Anspruch auf Hilfe. Höchstens, dass er ein paar gute Lehren austeilte, die aber nicht beachtet wurden. Der Blonde stopfte sich die Pfeife aufs neue, ging im Zimmer auf und ab und legte sich hin und wieder zum Fenster hinaus, um die Gegend zu studieren; dann schritt er an sein Jackett, das auf einem Nagel am Türrahmen hing, nahm einen Brief heraus, setzte sich und las ihn, wie er es an diesem Tage bereits mehrmals getan hatte.
So fand ihn Kempen, als er mit dem Gröbsten fertig war und nun einen grossen Berg Papier, Stroh und alte Lumpen in den Ofen hineinstopfte, den er sich unergründlich wünschte. „Na, es geht dir wohl wieder nahe, wie?“ stiess er pustend hervor, als er die letzte Arbeit glücklich verrichtet hatte und sich nun die Knie rieb. „Lies doch das Zeugs nicht mehr. Was will sie denn noch? Hübsche Sache, wenn es mal von dir heisst: „Er war Bildhauer, und sie hatte auch nichts.“
Über derartige eigene Scherze lachte er gern zuerst, und so gab er jetzt mit Vergnügen, kurz und bissig, auf diesem Wege seine Weiberfeindschaft zu erkennen, wobei er die Lampe auf einen anderen Platz stellte; denn er empfand das Bedürfnis, Wasser in die Schüssel zu giessen, um sich die zwar kleinen, aber derben Hände zu waschen, deren Finger mit breiten Nägeln die Merkmale der Arbeit zeigten.
Es handelte sich um eine Liebschaft Lorensens in Lübeck, der er schon vor längerer Zeit ein Ende gemacht hatte, an die er aber heute durch einen acht Seiten langen Brief erinnert worden war.
Schliesslich aber kniffte er das Schreiben wieder zusammen und heftete die blauen Augen vor sich auf die Diele; dann erhob er sich mit einem Ruck, zerriss die Bogen und sagte dabei wie aufgescheucht aus einer Beklemmung: „Das wollen wir uns noch ein bisschen beschlafen, Hermann. Erst aus diesem Luderleben heraus, das wäre wohl wichtiger, dächt ich.“
Kempen stand mit weit zurückgestrichenen Hemdsärmeln mitten im Zimmer, trocknete sich die Hände und stiess dann hervor, während er sich auch das Gesicht abrubbelte: „Nur nicht zu früh hängen bleiben, mein Junge. So ein Kerl wie du, der eine grosse Zukunft hat! Wenn du nur willst, dann kannst du schon was. Was für Feinheiten siehst du, verflucht noch mal! Wenn du nur endlich deine Schwäche lassen könntest! Sieh den Kunstgegenstand im Weibe, weiter nichts, das allein führt zur Grösse. Schlimm genug, dass wir Künstler ohne sie nicht fertig werden. Na, ich meide sie so viel als möglich, das weisst du ja. Das habe ich immer dir überlassen.“
„Jajaja,“ war alles, was Lorensen, nun schon gähnend beim Auskleiden, hervorstiess. Er kannte diese ewigen Redensarten des sonderbaren Menschen, der in seiner Jugend niemals Freude gehabt hatte, dessen ganzes Leben Entbehrung gewesen war und der die Enthaltsamkeit eines Spartaners besass.
Beide kannten sich schon aus ihrer Knabenzeit. Lorensens Vater war ein kleiner Beamter in Neumünster mit gutem, ehrlichem Auskommen. Kempens Mutter hatte als arme Witwe lange in demselben Hause gewohnt, bis sie wieder nach Hamburg zog, wo sie ein besseres Fortkommen zu haben glaubte. Hermann kam in eine Drechslerwerkstatt und musste sich frei lernen. Zugleich mit ihnen siedelte Fritz über und wurde als Holzbildhauer in die Lehre gebracht, weil er Neigung dazu hatte. Er lebte einigermassen gut bei Verwandten, während der andre saure Wochen durchmachen musste. Lorensen hielt es nur ein Jahr aus, dann ging er nach Lübeck zu einem Meister, wo Gipssachen fabriziert wurden. Kempen dagegen frass sich glücklich bis zum Gesellen durch. Vier lange Jahre stand er dann in einem Keller und drechselte immer dasselbe eintönige Zeug, um seine kränkliche Mutter mit ernähren zu helfen. Während dieser Zeit aber hatte sein bildhauerisches Talent sich entwickelt. Schon als Junge war er ein Kneter gewesen, der aus Brotkrumen und Wachs allerlei Figuren formte, bis er zum ersten Mal weichen Ton in die Hände bekam, wodurch ihm ein neuer Horizont aufging. Mit der Zähigkeit des begabten Menschen, dem der Vater weiter nichts als den gesunden Organismus hinterlassen hatte, stahl er sich die Freistunden ab, um seinen brennenden Kunstdurst zu stillen und zugleich die Lücken seiner Bildung zu überbrücken. Er besuchte die Fortbildungsschule am Sonntag, sass beim Lichtstumpf die halben Nächte über Büchern und sah in trostloser Einsamkeit ein fernes Paradies vor Augen.
Eines Tages tauchte Lorensen wieder vor ihm auf, der endlich seinen Vater breit geschlagen hatte und nun zu seiner weiteren Ausbildung auf dem Wege nach Berlin war. Als er die Kunstversuche des Freundes erblickte, in denen bereits die Klaue des Löwen sich zeigte, fand er zuerst vor Erstaunen weiter nichts als sein berühmtes: „Das ist furchtbar echt;“ dann aber war es für ihn eine ausgemachte Sache, dass Hermann sofort die Tretmühle verlassen müsse, um mit ihm zu fahren. Es wäre eine Sünde, ein Verbrechen an der heiligen Kunst, wenn er sein Talent verkümmern liesse! In Berlin würden sie sich schon durchstümpern, und er leiste einen Schwur, alles mit ihm zu teilen.
Er hatte bare dreihundert Mark in der Tasche, und so machte er mit seinem Versprechen gleich den Anfang. Für die Mutter Kempens wurde der Unterhalt auf einen Monat im voraus bestritten, was Hermann gern annahm, denn er hatte sich im Augenblick auch ferner sein festes Ziel gesteckt: in Berlin neben der Kunst die Arbeit nicht zu vergessen. So würde er dem Freunde bald alles vergelten können.
Sie fuhren also los, hinein in die verschleierte Zukunft.
Ein Jahr lang besuchten sie die Modellierklasse der Berliner Akademie, bis dann Lorensen in ein Meisteratelier ging, während Kempen der Gehilfe eines alten Bildhauers wurde, der zeitweilig von seinen vielgenannten Kollegen Aufträge erhielt, die er allein in seiner Scheune aber nicht bewältigen konnte. Der verschlossene Hamburger, der bereits bärtig wie ein Vierzigjähriger war und sich ein wenig unter den Jünglingen genierte, hatte bald herausbekommen, dass die akademischen Formen nicht für ihn geschaffen seien, und so klopfte er bei Walzmann an, dem halb verkommenen Genie, der nur arbeitete, wenn er Geld brauchte, die übrige Zeit sich jedoch dem Alkohol ergab. Hier konnte Kempen lernen und dabei auch verdienen, denn in der Heimat sass noch immer das Mütterchen, das von den Sorgen des Sohnes nichts erfahren durfte. In solchen Arbeitswochen blieb Walzmann durchaus nüchtern; er schloss sich dann in seinem „Müllkasten“, wie er das Atelier nannte, gänzlich von der Aussenwelt ab, um die Lieferungsverträge pünktlich innehalten zu können, die seine Auftraggeber mit ihm gemacht hatten. Ein gewisser Paragraph brachte ihn um einen Teil seines Lohnes, sobald er rückfällig zu werden drohte; und das gab ihm die jämmerliche Kraft, in Enthaltsamkeit auszuharren.
Während Lorensen zu einem Professor ging, um sorgsam eine Sprosse der Kunstleiter nach der andren zu nehmen, machte sich Kempen an jedem Morgen in aller Frühe wie ein Handwerker auf den Weg, um erst des Abends auf der gemeinsamen Bude mit dem Freunde zusammenzutreffen; und gleich einem Scharwerker brachte er an jedem Sonnabend seinen Lohn nach Hause, der dazu beitrug, die beiden notdürftig über Wasser zu halten, denn Lorensens Vater konnte nur einen geringen Zuschuss leisten.
So standen die Dinge, als die Freunde sich genötigt sahen, ihre Wohnung in der Nähe des Schiffbauerdammes aufzugeben, nachdem ihr dortiger Wirt, ein Kellner, erklärt hatte, die „Schweinerei“ nicht mehr ertragen zu können. Lorensen war allerdings in der Ausnutzung des Hofzimmers in letzter Zeit ein wenig zu weit gegangen. Eines Sonntags, in den Ferien, während Kempen im Zoologischen Garten weilte, um Löwenstudien zu treiben, hatte er sich ein bekanntes weibliches Modell der Akademie kommen lassen und ungeniert seine „Eva in Scham erglüht“ lebensgross zu modellieren begonnen. Das war der Ehehälfte des biederen Serviettenschwenkers zu viel, da sie sich obendrein in ihren Reizen zurückgesetzt fühlte. Sie schlug Lärm bei ihrem Manne, und die Folge davon war, dass der zum Leben erweckte Ton wieder sein feuchtes Klumpendasein führen durfte und die Stubengenossen nach einer gastlichen Stätte für ihren Ehrgeiz sich umsehen mussten. Da es bei Meister Walzmann nichts mehr zu tun gab, so machte Kempen den Vorschlag, die vierzehn Tage bis zum Umzug in der Heimat zu verbringen, wogegen Lorensen nichts einzuwenden hatte, schon aus praktischen Gründen, weil das Leben zu Hause nichts kostete.
Frisch gestärkt, mit gebräunten Wangen, war man wieder zurückgekehrt, hatte sich einen Wagen geliehen und die kühne Fahrt nach dem Westen gemacht.
II.
Gleich am Abend des zweiten Tages fanden sich sonderbare Gestalten bei ihnen ein, um die neue Bude einweihen zu helfen. Als erster klopfte Schmarr an, ein kleiner verwachsener Mann mit einem auffallend grossen Kopf, der stets eine Satyre bereit hatte, sobald der breite Mund mit den schlechten Zähnen sich öffnete. „Na, wollt Ihr Eure Ehe immer noch fortsetzen?“ fragte er sogleich mit einer Anspielung auf die bereits sprichwörtlich gewordene Unzertrennlichkeit der beiden und reichte jedem von ihnen seine lange Pfote, die dürr und knochig aus dem zu kurzen Ärmel ragte.
Dieser von der Natur so stiefmütterlich behandelte Mensch, der fast hässlich wirkte, aber wunderschöne, grosse Augen hatte, suchte etwas darin, seiner Kleidung einen kokett-künstlerischen Anstrich zu geben, was sich namentlich in den bunten, auffallend punktierten Selbstbindern zeigte, deren geschwungene Schleifen schmetterlingsartig in riesiger Ausdehnung auf dem Rockkragen lagen. „Ich hörte doch irgendwo, Ihr wolltet Euch endlich scheiden lassen, weil Kempen Absichten auf seine alte Waschfrau habe. Junges Gemüse hat ihm ja nie geschmeckt.“
Um seine Witze anzubringen, erdichtete er immer das Hörensagen. Kempen brummte nach seiner Gewohnheit, Lorensen jedoch lachte hell auf, angesteckt von der Lustigkeit, die dieser Spötter immer hereinbrachte, dessen eigentlich tiefes Gemüt in köstlichen Kindergruppen zum Ausdruck kam, die sozusagen seine Spezialität waren. Seine Doppelbüste „Singende Knaben“ hatte ihm ein Studienjahr nach Rom eingetragen, von dem er noch immer wie ein Weltreisender zehrte. Dreimal war diese Gruppe von ihm verkauft worden, was mit einem gewissen Zunftstolz von seinen Freunden erzählt wurde.
Maler Blankert, dünn und hochaufgeschossen, umschlottert von seinem ewigen Pelerinenmantel, für den, weil er viel zu kurz und zu eng war, Lorensen die Bezeichnung „Talentwindel“ erfunden hatte, meldete sich zugleich mit dem beweglichen, unverwüstlichen Musiker Nuschke, der, kaum die Tür hinter sich, einen täuschend ähnlichen Trompetentusch hervorbrachte und dann seine Gelenkigkeit bewies, indem er mit dem rechten Bein über eine Stuhllehne setzte. Ein sogenanntes verrücktes Huhn, besass er die Gabe, die verschiedensten Instrumente nachzuahmen, was namentlich zwerchfellerschütternd wirkte, wenn er die Klarinette dudelte.
Beide wurden mit einem Halloh empfangen. „Ja, Kinder, habt Ihr denn immer noch kein Klavier?“ fragte Nuschke sofort, was er jedesmal tat, sobald er die Bildhauer besuchte. „Das wird ja bald strafwürdig von Euch. Pfui Teufel, seid Ihr unmusikalische Menschen. Ihr geht in kein Konzert, in keine Oper, und wenn ich Euch dann mal ein bisschen Schliff durch meine neueste Komposition beibringen will, dann verlangt Ihr, ich soll die Suppe bei Euch blasen; und die gibt’s nicht mal. Schmarr, ist das ’ne Gesellschaft, was? Gipsbolzen sind’s. Ton kennen sie, aber an Gefühl für Töne mangelts.“
Und während der Verwachsene wieherte vor Wonne, prüfte Nuschke, der stets patent gekleidet ging, vorsichtig die Stühle auf ihre Reinlichkeit, denn wiederholt war es vorgekommen, dass er aus der früheren Bude der beiden sichtbare Zeichen ihres Kunstmaterials mit davongetragen hatte.
„Sag mal, wo schindest du denn jetzt fremde Schlafstellen?“ fragte Blankert den kleinen Bildhauer, von dem alle wussten, dass er, da er kein rechtes Heim hatte, in den Ateliers der Jungen herumnassauerte, wo er bald hier, bald dort etwas modellierte, das er dann zu verkaufen versuchte. „Ich habe mir ein paar Sohlen abgelaufen, um dich zu suchen.“
Schmarr blickte gewohnheitsmässig in schiefer Richtung zu dem Langen empor. „Wieso, wolltest du mich anpumpen?“ gab er ruhig zurück, sicher der Wirkung seiner Worte. Im Innern von Trauer erfüllt über seine Lage, stimmte es ihn stets ärgerlich, sobald man ihn zu offen daran erinnerte. „Ich kann solch einem unsicheren Kantonisten unmöglich längeren Kredit gewähren,“ fuhr er durchaus ernst unter dem Heiterkeitsausbruch der übrigen fort . . . . Du malst ja schon seit zwei Jahren an deiner Auferweckung des Lazarus. Sämtliche Toten werden inzwischen lebendig, darunter die zwölf Droschkenkutscher, die als Modell unter deinem Pinsel gestorben sind.“ Nun konnte er nicht mehr an sich halten, und so schüttelte er sich förmlich vor Lachen.
Der Maler stimmte vergnügt mit ein, denn trotzdem sich die beiden zeitweilig auf diese Art rieben, waren sie sich doch sehr zugetan, und man sah sie oft brüderlich vereint in den Strassen wandern, was sich sehr komisch ausnahm, wenn der Kleine den Langen untergehakt hatte und von diesem fast mit fortgeschleift wurde. Blankert legte seinen fadenscheinigen Dallesmantel ab (diese zweite Bezeichnung dafür hatte Nuschke erfunden) und faltete ihn mit einer Sorgfalt zusammen, als hätte er teuren Sammet zu behandeln. Dabei sagte er wieder in seiner geschraubten Sprechweise, die ihm etwas Überlegenes geben sollte: „Nein, nein, diesmal irrst du dich, mein Kleiner. Ich habe da einem Böotier in petto, dem ich furchtbar viel von dir vorgeschwefelt habe, was natürlich angesichts deiner soeben erwiesenen Behandlung gegen mich unverantwortlich von mir ist. Ja.“ Er machte eine Kunstpause. „Unter anderem log ich ihm auch vor, du könntest vortrefflich Kindsköpfe porträtähnlich machen, auch die blödsinnigsten.“
Schmarr, der darin nur verstecktes Lob sah, lachte lautlos in sich hinein, so dass man die Erschütterung an seinem ganzen Körper merkte.
„Und siehst du,“ sprach Blankert nun mit Gönnermiene weiter, so ist es mir denn glücklich gelungen, sein Interesse für dich zu erwecken. Unverdientermassen für dich. Jawohl, jawohl! Blök doch nicht! Dein Gebiet ist doch nur das Genre . . . . Aber es gäbe einen niedlichen Auftrag. Dreihundert Mark will er anlegen. Vorläufig Gips, vielleicht schwingt er sich später mal zu Marmor auf. Er versteht sich darauf, weisst du, denn es ist ein sehr kunstliebender Herr. Früher hatte er ein Milchgeschäft, jetzt ist er Hausbesitzer. Mein Gönner nämlich, dem ich die Miete für meinen Taubenschlag, Atelier genannt, schuldig bleibe. Ein Vierteljahr habe ich bereits abgemalt, indem ich seine ehrenwerte Gattin porträtierte. Zur völligen Zufriedenheit, weisst du, denn aus dem dreifachen Kinn machte ich ein durchaus natürliches, ohne jede Aufregung. Ja. So strahlt sie nun als ihre jüngere Schwester über dem Sofa. Die Ähnlichkeit ist einfach herzbrechend.“
Nuschke konnte nicht mehr lachen. Er ging im Zimmer umher und schlug sich mit den Händen fortwährend auf die Schenkel, so dass es klatschte. „Zum Küssen, zum Küssen! Das sind ja grossartige Noten! Wagners Ballet im Tannhäuser!“ schrie er förmlich vor Vergnügen, während er sich mit seinen schmalen Schultern an den übrigen vorbeiwandte.
„Du wirst deine Freude an dem Jungen haben,“ fuhr Blankert mit der Miene des Schauspielers fort, dem man bei offener Szene soeben Beifall geklatscht hat. „Er ist zwölf Jahre alt, hat eine platte Nase und schielt mit schiefstehenden Augen; ausserdem hat er mächtige Horchlappen. So was übersehen aber geniale Geister wie du, denn Zahlung erfolgt nach Ablieferung, eventuell hundert Emm Vorschuss, wenn ich ein gutes Wort einlege. Ich bin ihm ja sicher. Selbstverständlich! Hast du ihn ganz ähnlich gemacht, dann gibt’s noch ein Frühstück mit Weissbier. Gesteh jetzt also, wo du deine Empfangsstunden hast. In irgend einem Winkel musst du ihm doch imponieren. Natürlich habe ich ihm vorgeschwindelt, du hättest ein eigenes Atelier und wärest mit Aufträgen überschüttet. Besinn dich nicht lange, so einen Blaseengel mit Zahnschmerzen backst du ja in acht Tagen zusammen. Wie ich dich kenne! Übrigens garantiere ich für sein Stillsitzen, denn unter zwei Jahren macht er nie eine Klasse ab.“
„Das ist zuviel, das ist zuviel! Ich muss die Musik dazu machen!“ quietschte Nuschke jetzt auf, und er flötete, stimmte dann die Klarinette an, fiedelte auf seinem Arm, trompetete, schlug die Trommel, bis er plötzlich diese Orchestermusik mit einem grossen „bum, bum“ schloss, das das schallende Gelächter ringsum wie mit einem letzten dumpfen Paukenschlag durchschnitt. Dann warf er sich auf das Sofa, strampelte mit den Beinen und schrie mit krampfhafter Luftschöpfung: „Ein Trauerspiel, ein Trauerspiel, oder ich lach mich tot!“ Und er sprang wieder auf, ergriff Blankerts beide Hände und sagte voll Begeisterung: „Du wirst wohl deinen Lazarus nicht eher ausstellen können, mein Sohn, als bist du eine Landschaft daraus gemacht haben wirst. Diese Seite liegt dir viel besser — ich hab’s dir immer gesagt. Aber das hast du grossartig erzählt. Einfach plastisch. Geh zur Bühne und werde Komiker.“
Frau Lemke, die auf ihr Klopfen kein Herein fand, trat erschreckt ins Zimmer. Was denn los sei? Die Lehrerin nebenan habe sie gerufen. Der Anblick der vielen Herren, die im Tabaksdampf förmlich schwammen, denn man qualmte Pfeifen und rauchte Zigaretten, schüchterte sie ersichtlich ein; aber deutlich sprach aus ihren breiten Zügen, dass sie sich diesen Skandal nicht hätte träumen lassen. Nuschke, der nie seine Geistesgegenwart verlor, bot ihr sofort galant einen Stuhl an und machte aus ihr ein „verehrtes Fräulein“, wodurch er ihr ein schämiges Lächeln abzwang, was von einer Verbeugung begleitet wurde, die sich beinahe wie ein Knicks ausnahm.
Kempen beruhigte sie leise und gab ihr die nötige Aufklärung, wobei er ihr Geld zusteckte mit der Weisung, ein Dutzend Flaschen Bier holen zu lassen, so dass sie mit einer Entschuldigung wieder verschwand. Während die übrigen durcheinander schwatzen und ihre Possen trieben, hatte er im Hintergrunde an einem kleinen Tischchen gestanden und Brotschnitten mit Butter bestrichen, die er nun mit Aufschnitt belegte. Am Tage vorher war für Lorensen eine Kiste aus der Heimat eingetroffen, die einen Schinken und Dauerwürste enthielt, so dass man heute gehörig prassen konnte.
Schmarr war still geworden, wie immer, wenn ihn etwas Besonderes bewegte. Dieser koboldartige Spötter hatte seine Tiefen, in die er sich zeitweilig versenkte, so dass er mit Gewalt aus ihnen hervorgeholt werden musste. Er setze sich auf das schäbige Sofa, wobei an der eingedrückten Ecke seine spillerigen Beine tief unter dem Tische verschwanden. Wie ein ungeschlachter Zwerg sass er da, dessen Kopf nur auffällt. Er hatte seinen alten Zustand, in dem der Kunstsinn mit der Not den grossen Seelenkampf führte; denn überall hing er mit kleinen Schulden, und es war wieder einmal gänzlich Ebbe in seiner Kasse. Diese verlockenden dreihundert Mark hätten ihn gründlich flott machen können von dem rauhen Riff seines augenblicklichen Daseins; aber er hasste alle Porträtarbeit, die ihn mit Widerwillen erfüllte, weil er keinen Fortschritt darin erblickte.
Minutenlang blieb er unbeachtet, denn Blankert erzählte den andern eine lustige Geschichte. Er malte in einem alten Bodenraum der Luisenstadt, den ihm der Hauswirt durch dünne Kalkwände hatte erträglich machen lassen, weil er mit seinem Vater bekannt war. Eine unstete Natur, hatte er, kaum flügge geworden, die Akademie verlassen und sich zwischen den vermörtelten Latten eingekapselt, von dem Wahn befallen, er könnte sich schon jetzt durch ein unsterbliches Meisterwerk sein Glück erzwingen. Allen diesen jungen Leuten, in denen es fortwährend gärte, schwebte immer etwas Grossartiges, noch nie Dagewesenes vor, das sie allein bewältigen müssten; sie hatten etwas von Einsamkeit gehört, aber nicht richtig verstanden. Und so patzte auch Blankert auf seinen erweckten Lazarus die unmöglichsten Farben, kratzte sie immer wieder ab und strich aufs neue drauf los, ohne Befriedigung zu finden. Es war die Zeitvergeudung eines Menschen, der zur Höhe möchte, ohne die nötige Kraft zu haben. Schon verschiedene Male hatte er die ganze Zeichnung umgestossen, je nachdem er einen andern Kerl fand, der sich gegen wenig Geld hinaufschleifen liess, um sich einige Stunden als Lazarus zu fühlen. Letzthin nun tat ihm ein Dienstmann den Gefallen, der aber plötzlich die Krämpfe bekam, so dass Blankert, tödlich erschreckt, schon glaubte, er werde ihn als Leiche in seinem Atelier haben.
„Ich lief hinaus, um Hilfe zu holen,“ schloss er dramatisch, „und denkt Euch nur, als ich zurückkomme, sitzt der Kerl wieder gesund da, lacht mich an und sagt vergnügt: „Nun bin ich wirklich erwacht“. Was für einen Effekt habe ich mir entgehen lassen!“
„Du, den hätt ich gleich lebend nach der Ausstellung getragen,“ witzelte Nuschke. „Die kleine goldene wär dir sicher gewesen.“
„Das kommt nur alles davon, wenn man die Dienstleute nicht an der Ecke stehen lässt,“ mischte sich Kempen trocken ein und reichte nun das belegte Brot herum. Das Bier kam, und man ass und trank.
„Nein, es geht nicht, es geht wirklich nicht,“ sagte Schmarr plötzlich wie aus einer Betäubung erwacht, während die andern sich den Mund gehörig stopften. Und er begann, Blankert auseinanderzusetzen, dass ihm niemals etwas gelänge, sobald er Fratzen vor sich habe; er möchte es ihm nicht übelnehmen, wenn er seine Bemühungen mit Dank ablehne. Er war nicht mehr der Spötter, sondern der Duldsame, der andern nicht mehr weh tun möchte.
„Was, es geht nicht!“ hauchte ihn Nuschke nun an, der rasch das zweite Glas Bier heruntergestürzt hatte. „Lieber Sohn, bist du verrückt geworden? Dreihundert Mark, bedenke doch! Das ist ja ein kleines Kapital. Du könntest dir gleich die Haare schneiden lassen und uns alle zu einem Diner bei Dressel einladen.“
„So viel Geld gibt’s ja gar nicht,“ warf der Maler ein.
Und auch Lorensen stimmte in diese Entrüstung mit ein. „Das ist mal wieder furchtbar echt von dir, dieser Eigensinn,“ sagte er kauend. „So etwas nimmt man doch mit, man lernt doch dabei.“
„Nein, es geht nicht,“ wiederholte Schmarr und liess die langen, dürren Finger durch den sprossenden Christusbart gleiten, während er die klaren, braunen Augen zu den Freunden aufschlug. „Seht Ihr, ich kann nur hübsche Gesichter vor mir sehen, dann gelingt mir’s. Die Schönheit ist der Quell, aus dem ich schöpfe und der mich begeistert. Die Hässlichkeit stösst mich immer ab, und dann erstarrt mir der Ton in den Händen. Es ist wirklich so. Mein Auge will trinken, aber nur das, was meiner Seele schmeckt. Schlag mich tot, Blankert, nennt mich alle einen Faulpelz, meinetwegen, einen Idioten, aber es ist nicht zu ändern; ich kann keine verkrüppelten Linien sehen.“
„Aber Herrgott, einmal ist doch keinmal,“ liess Lorensen nicht locker, der noch zwanzig Mark von ihm bekam und nun hoffte, bei dieser Gelegenheit die Schuld getilgt zu sehen.
„Doch, doch!“ fuhr Schmarr mit geröteten Wangen fort, die seinem schmalen Gesicht den Glanz lebhaften Feuers gaben. „Einmal ist manchmal hundert Mal. Wie viele haben dasselbe gesagt und sind dann hübsch weiter gepatscht, bis sie ihr Ideal in einem Sumpf begraben haben. Kinder, lasst mir doch das bisschen Eigensinn. Wenn ich in dieser kunstfeindlichen Welt mal verhungern sollte, möchte ich wenigstens von der Schönheit beweint werden. Na, und ein paar Putten werden auch noch zur Seite stehen.“
Es war sein altes Lied, das er sang und das die Streber, die gern gut lebten, nicht verstanden. Selbst von der Natur missgestaltet, betete er sie doch an, aber nicht im Lichte seines Spiegelbildes, sondern in aller Herrlichkeit ihrer Vollendung, die ihm die eigene Gebrechlichkeit erträglich machte. Er ass und trank jetzt nicht, denn wenn er bei diesem Punkt angelangt war, brachte er seine Überzeugung gründlich zum Durchbruch, wobei ihm die Rede von den Lippen perlte. Stets die Ahnung von einem frühen Tode in der schwachen Brust, klammerte er sich förmlich an sein Kunstevangelium, wie an einen heiligen Retter, der ihn in dem Drangsal seines Leidens beschirmen müsse.
„Das gefällt mir, bleib dir nur treu,“ mischte sich Kempen hinein, der seine eigene Meinung von ihm verfochten sah.
„Seht Ihr, ein bisschen Ruhm möchte ich doch auch noch erleben,“ fuhr Schmarr fort und griff nun endlich zu, erfreut über die Anerkennung des Hamburgers.
„Ach, was heisst Ruhm?“ hielt ihm der lebenslustige Nuschke entgegen, der gern zum Wortstreit herausforderte, sobald die Gelegenheit es mit sich brachte. „Erst kommt der Erhaltungstrieb, dann die Widerstandskraft und dann allmählich das Klettern auf die Höhe. Ich könnte nur schaffen, wenn ich meine Bequemlichkeit hätte.“
„Ruhm ist Martyrium, eine lange Kette von Enttäuschungen,“ wandte Schmarr ein.
Die Frage war angeschnitten und brachte nun ein wüstes Durcheinander der Ansichten hervor. Nuschke schrie am lautesten und lachte jedesmal, sobald ihm etwas gegen den Strich ging; in solchen Dingen unterdrückte er gern seine Überzeugung und liess seine Witze los, um recht zu behalten.
„Der Ruhm ist ein schwaches Weib, das heute steht und morgen fällt,“ rief Lorensen eifrig und wiederholte es mehrmals, weil er ganz etwas Besonderes gesagt zu haben glaubte.
„Sehr richtig! Wer besitzt mehr Launen als ein Frauenzimmer,“ übertönte ihn Blankert. „Das habe ich neulich erst erlebt. Eine ganze Stunde habe ich vergeblich an der Normaluhr gewartet. Mein Mädel kam nicht.“
Selbst Kempen musste lachen, wogegen Nuschke, neidisch auf den Erfolg dieses Witzes, sich einen „anderen Gast“ ausbat.
Dann aber behandelte Blankert die Sache doch ernst. „Schliesslich hat Lorensen doch recht,“ sagte er wieder, indem er auf seinen langen Beinen im Zimmer umherstelzte, „schon deswegen, weil wir Künstler ohne die Weiber nicht leben können. Was sollten wir wohl machen, wenn wir keine Modelle hätten! Mancher alte Kracker, der heute als Grosser rumläuft, würde seinen Lorbeer hübsch zerfetzt sehen, wenn der weibliche Ateliergeist ihm ausbliebe. Na, und von der Liebe, die uns inspiriert, will ich gar nicht reden! Etwas fürs Herz müssen wir immer haben. Ergo: Das Weib führt immer zum Siege.“
Plötzlich mischte sich Kempen hinein, der nach seiner Gewohnheit wenig gesprochen hatte. „Ach, was wollt Ihr denn! Der Schöpfer ist immer der Mann, und der Ruhm ist ein Zwillingsbruder von ihm,“ knurrte er hervor, wobei er die kurze Holzpfeife nicht aus dem Munde liess. „Glaubt es mir. Das Weib ist nur die Begleiterscheinung, die wir als notwendiges Übel mit in den Kauf nehmen müssen, der Parasit, der sich an uns vollsaugt und uns die beste Kraft nimmt, sobald wir ihn nicht überwinden können. Sie sind gerade gut genug, uns die Suppen zu kochen und die Strümpfe zu stopfen. Glaubt es mir. Man muss sich ja doch aus einem Dutzend zusammensuchen, was der einen fehlt, die wir brauchen.“
Alle lachten, weil sie ihn kannten. Nuschke jedoch rief sofort: „Hermann, das hast du wieder einmal gut gesagt.“ Und als die andern nun eifrig dagegen sprachen, fuhr er mit erhobener Stimme fort: „Aber natürlich doch, es ist so, es ist so! Das Weib ist schöpferisch immer subaltern und kann nur reproduktiv wirken. Seht Euch doch die ganze moderne Frauenbewegung an, dann habt Ihr den Beweis dafür. Wo ist da Grösse, wo der geniale Zug? Wenn sie malen, sind’s Blumen und Stilleben. Lampenschirme, Fächer, Ofenvorsetzer sind das Schlachtfeld, auf dem sie sich messen. Und wenn sie modellieren, dann gibt’s Vasen mit Schlangen und Nixenköpfe mit Seerosen an der Brust. Was sie den Männern abgeguckt haben, bringen sie als dritten Aufguss glücklich auf die Tafel . . . Jawohl, mein lieber Sohn Lorensen — du bist natürlich schon total verweiblicht, daher deine Opposition in solchen Dingen . . . Prosit, Kempen, auf dich als Schöpfer!“
„Dein Lieblingsthema!“ rief ihm der Holsteiner zu und wickelte ein langes Redeknäuel auf, in dem er sich schliesslich verhaspelte. Stets auf der Suche nach Bildung, las er alles, was ihm unter die Augen kam, und verteidigte dann mit Zähigkeit die Ergebnisse seiner letzten Geisteswanderung. So hatte er einen Zeitschriftartikel: „Die Frau in der Kunst“ noch nicht gehörig in sich verarbeitet und schwamm nun in dem Gedankenstrom des Verfassers. „Die Frauen sind bisher immer von den Männern unterdrückt worden, ihre Sklavinnen gewesen,“ kaute er sorgsam wieder, was er in sich aufgenommen hatte, „sie sind immer als Menschen zweiter Güte behandelt worden.“
„Das sind sie auch,“ schrie ihn Nuschke nun fuchswild an. „Schon die Natur hat sie dazu gestempelt, denn sonst würden sie nicht mit breiten Hüften auf die Welt gekommen sein, die nur dazu geschaffen sind, die Röcke festzuhalten. Der Mann jedoch schreitet in seiner ganzen Gloriole dahin —.“
„Und zeigt dafür auch manchmal seine krummen Beine,“ warf Blankert rasch ein. „Ob das nun gerade ästhetisch ist . . .“
„Und die George Sand, die Rosa Bonheur, wie?“ mischte sich Schmarr hinein.
„Ach, das sind Ausnahmen,“ erwiderte Nuschke. „Entschieden ein Versehen der Natur. Sie fühlten es auch, sonst wären sie nicht in Männerkleidern herumgelaufen.“ Und plötzlich, als Lorensen mit seiner Gegenmeinung schon erschöpft war, begann er, ihnen allen aufs neue einen schlagenden Beweis für seine Behauptung zu geben, worauf er erst kürzlich nach ernstem Denken gekommen sei. Man spreche so viel von der Gefühlswelt im Weibe, von der Weichheit seines Seelenlebens, von der Empfindungszartheit der Frau. Mitleid sei der Grundzug ihres Wesens, göttliche Schwäche ihre Stärke, Anschmiegung und Hingebung die köstlichsten Seiten ihrer Natur. Alles in ihr vereinige sich zu einem grossen Orchester herrlichster Töne, das die Männer mit Circengewalt in den Musikrausch dieses Geschlechts treibe. Und doch sei es dem Weibe gerade am meisten versagt, dieses innere Leben in das umzusetzen, wozu es von Natur geradezu geschaffen sei: in Töne nämlich. Die Kunst der Tondichtung sei ihm völlig verschlossen, denn nirgends höre man von einer Komponistin, nicht einmal von einer solchen, die ein klangvolles Lied zustande gebracht habe, ganz zu schweigen von einer Sonate, einer Symphonie, oder gar von einer Oper! Das könne gar nicht scharf genug betont werden, um die Schöpferohnmacht des Weibes gründlich festzunageln. Es sei und bleibe nur Mitempfinderin, die wohlige Schlingpflanze am starken Lebensbaum des Mannes, die kümmerlich am Boden dahinkriechen müsse, wenn sie ihren mächtigen Halt verliere; ihr Saft würde vertrocknen und ihre natürliche Kraft verderben. Die Natur lasse sich eben nicht meistern, sondern wandle ihre ewigen, fest vorgeschriebenen Bahnen.“
Alle waren über diese neue Auslegung verblüfft und schwiegen still, um sich erst zu sammeln. Nuschke jedoch benutzte diese Pause und liess sofort den Schalk in ihm wieder steigen, indem er vergnügt ausrief: „Deshalb sage ich: die beste Frauenbewegung ist ein guter Walzer . . . Spielt nur gehörig auf, und sie werden sich sorglos in Eure Arme hängen, die Führung Euch überlassend. Schon Eva tanzte, als die Vögel sangen. Der Geist des Weibes liegt in seinen Reizen. Basta.“
In dem lauten Lachen, das jeden Widerspruch auflöste, wurde dreimal so stark geklopft, dass Kempen fast erschreckt die Tür öffnete.
III.
Bildhauer Walzmann schob sich auf seinen kurzen Beinen herein, halb seitwärts, in jener eigentümlichen Gangart, die durch die rechte emporgezogene Schulter hervorgerufen wurde, hinter der das mächtige Haupt eingeengt, fast haltlos lag. Etwas Monumentales sprach aus diesem Kopf, der, fest gefügt, den wackligen Körper mit seiner Wucht zu erdrücken versuchte, so dass die Beine mit dem hervorgekehrten Knie etwas Schlotterndes hatten.
„’n Abend, Kollegen, ’n Abend,“ sagte er eintönig mit seiner verrosteten Stimme, ging im Kreise umher und schüttelte jedem kräftig die Hand. „Ich suchte dich schon, ich suchte dich schon,“ wandte er sich dann sofort an Kempen. „Es gibt zu tun. Neue Nahrung! . . . Unhöfliche Menschen hier im Hause! Dja. Kann man auch nicht wissen, dass du vier Treppen wohnst. Dja. Die Maler ziehen nächstens in den Keller. Verkehrte Welt.“
Jeden, der zum Bau gehörte, nannte er du, wie ein Fürst, der besondere Gnaden erteilt, wobei es ihm gleichgültig war, mit welcher Anrede man ihn bedachte. Im Dunkeln hatte er bereits die beiden grossen Höfe hinten abgesucht, um die Spuren der Freunde zu entdecken, bis man ihn schliesslich hier hinauf wies.
„Wie geht’s Ihnen, Meister?“ sagte Kempen, der ihn mit sichtlicher Achtung behandelte.
„Danke, danke,“ erwiderte Walzmann in seinem Telegraphenstil, klemmte den schäbigen Schlapphut unter den linken Arm und kraute sich mit der Rechten in dem kurzen, stark ergrauten Flockenhaar. „Man vegetiert. Backt seinen Kunstmist ruhig weiter . . . Dja. Und Ihr lebt bon. Prasst. Habt wohl geerbt? Kann mir nie passieren. Ich beerbe mich selbst. Meinen Kadaver. Ist auch danach. Krepiere ich, heulen nur die Professoren.“